Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Körperliche Aktivität und kognitive Funktionen
2.2 Die quantitative Erfassung körperlicher Aktivitäten
2.3 Das EEG
2.3.1 Entstehungsmechanismen
2.3.2 Ableitung
2.3.3 Auswertung und Beschreibung
2.4 Evozierte Potentiale
2.5 Ereigniskorrelierte Potentiale
2.6 P300
2.6.1 Die Neuheits-P3/P3a
2.6.2 Die P3b
2.6.3 Weitere P300-Subkomponenten
2.7 Das Oddball-Paradigma
2.8 Effekte körperlicher Aktivität auf die P300
2.9 Zusammenfassung und Herleitung theoretisch-inhaltlicher Forschungshypothesen
3 Untersuchung
3.1 Methode
3.1.1 Fragestellung
3.1.2 Stichprobe
3.1.3 Untersuchungsablauf
3.1.4 Statistische Analyseverfahren
3.2 Ergebnisse
3.3 Diskussion
4 Zusammenfassung
5 Ausblick
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1. Die Effektstärken der vier unterschiedlichen Aspekte kognitiver Leistungsfähigkeit, unterteilt zwischen Interventions- und Kontrollgruppe (Colcome & Kramer, 2003, S.129)
Abb. 2. Anwendbarkeit und Validität von Möglichkeiten zur Alltagsaktivitätserfassung (Müller, Winter, & Rosenbaum, 2010, S.12)
Abb. 3 Elektrische Dipole an den senkrecht angeordneten großen Pyramidenzellen (Wilhelm, Bruhn & Kreuer, 2006, S. 7)
Abb. 4 Mittelungsprozedur eines evozierten Potentials (Schandry, 1998, S. 242)
Abb. 5 Schematische Darstellung der endogen und exogen evozierten Potentiale nach visueller und auditorischer Reizung (Stöhr, Dichgans, Buettner & Hess, 2005, S. 503)
Abb. 6 Schematische Darstellung akustisch evozierter Potentiale sowie deren Kategorisierung (Hegerl, 1998, S. 96)
Abb. 7 Schematische Darstellung der P300 Context Updating Theory (Polich, 2007, S. 2130)
Abb. 8 Schematische Darstellung der Beeinflussung der P300 von attentionalen Prozessen (Polich, 2007, S. 2130)
Abb. 9 Unterschiede hinsichtlich der Latenz und der Topografie
zwischen der P3a (oben) und der P3b (unten) (Polich, 2007, S. 2135)
Abb. 10 Schematische Darstellung der kognitiven Aktivität bei der Evozierung einer P300 (Polich, 2010, S. 22)
Abb. 11 Vereinfachtes Modell zur Beschreibung der Einflussfaktoren auf die P3b und die Slow Wave (Bledowski, 2005, S. 40)
Abb. 12 Schematische Darstellung der verschiedenen OddballParadigmen mit den dazugehörigen Potentialen, die durch die jeweilige Aufgabe ausgelöst werden (Polich & Criado, 2006, S. 173)
Abb. 13 Die Veränderungen und die Topografie der P3a- und der P3b-Amplitude in Abhängigkeit der jeweiligen Probandengruppe (Polich. 2010, S. 24)
Abb. 14 Ein Proband nach dem Aufsetzen der 64-Channel Quik-Cap
Abb. 15 Die visuellen Reize beim Oddball-Paradigma. Oben: Standardreiz. Mitte: Zielreiz. Unten: Distraktor
Abb. 16 Signifikanter Unterschied der P3b-Amplitude an der Position Fz zwischen körperlich sehr inaktiven und körperlich sehr aktiven Probanden (p = 0.01)
Abb. 17 Gemittelte P3a der acht wenig aktiven Probanden (links) sowie der acht körperlich aktiveren Probanden (rechts)
Abb. 18 Gemittelte P3b der acht wenig aktiven Probanden (links) sowie der acht körperlich aktiveren Probanden (rechts)
Abb. 19 Topografisch dargestellte P3a-Aktivität der acht wenig aktiven Probanden (links) sowie der acht körperlich aktiveren Probanden (rechts)
Abb. 20 Topografisch dargestellte P3b-Aktivität der acht wenig aktiven Probanden (links) sowie der acht körperlich aktiveren Probanden (rechts)
Abb. 21 Korrelation zwischen dem Ergebnis des Oddball-Tests und der P3b-Amplitude an der Position Fz (links), Cz (Mitte) sowie Pz (rechts)
Abb. 22 Korrelation zwischen der Reaktionszeit des Oddball-Tests und der P3b-Latenz an der Position Fz (links), Cz (Mitte) sowie Pz (rechts)
Abb. 23 Topografisch dargestellte P3a-Aktivität des Nichtspielers (links) sowie des Videospielers (rechts)
Abb. 24 Topografisch dargestellte P3b-Aktivität des Nichtspielers (links) sowie des Videospielers (rechts)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1. Tabellarische Darstellung der deskriptiven Statistik bezüglich der Leistungsparameter, der EEG-Daten und der körperlichen Aktivität
Tab. 2. Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-Tests zur Prüfung auf Normalverteilung der Leistungsparameter, der EEG-Daten und der jeweiligen körperlichen Aktivität.
Tab. 3. T-Test zur Prüfung auf Mittelwertgleichheit der Leistungsparameter und der EEG-Daten zwischen der aktiven und der inaktiven Gruppe.
1 Einleitung
Die positiven Effekte regelmäßiger körperlicher Aktivität auf das individuelle Wohlbefinden sowie zum Erhalt und zur Förderung der körperlichen Gesundheit sind den meisten Menschen bereits durch diverse Medienberichte aus dem Radio, der Zeitung oder dem Fernsehen bekannt. „Langfristig durchgeführt hat ein regelmäßiges körperliches Training, insbesondere aerobes
Ausdauertraining, positive Effekte auf bekannte kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Hypertonie, Typ-2-Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und abdominelle Adipositas" (Bjarnason-Wehrens et al., 2009, S. 6). Inwiefern sich auch unter neurologischen Gesichtspunkten Effekte feststellen lassen, ist aufgrund der Komplexität des Gehirns nicht eindeutig darzustellen. Diesbezüglich ist auch die entsprechende Zielgruppe zu berücksichtigen. So sind zum Beispiel bei Kindern, bei denen sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet, adaptive Effekte und Verbesserungen der exekutiven Funktionen (Tomporowski, Davis, Miller & Naglieri, 2008) zu erwarten, welche im Erwachsenenalter jedoch ausbleiben können.
Heutzutage können im Zuge der fortschreitenden Entwicklung technologischer Messmethoden, wie beispielsweise die Erfassung ereigniskorrelierter Potentiale mithilfe der Elektroenzephalografie oder die dreidimensionale Darstellung des Gehirns mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie, bestimmte Hirnareale und -funktionen separat betrachtet werden. Dies gibt den Wissenschaftlern die Möglichkeit, das jeweilige Forschungsinteresse auf gezielt ausgewählte Veränderungen im Gehirn zu reduzieren, die eventuell durch regelmäßige körperliche Aktivität hervorgerufen werden.
Als ein gebräuchlicher Parameter in der neurokognitiven Forschung ist in diesem Zusammenhang die sogenannte P300 zu nennen. Diese Komponente stellt ein gut nachweisbares positives Potential im EEG-Abbild dar, welches etwa 300ms nach der Darbietung eines seltenen Zielreizes oder eines unerwarteten Neuheitsreizes evoziert wird (Picton, 1992). Über die Bedeutung dieser Komponente bestehen derzeit verschiedene Theorien, welche im Kapitel 2.6 in Grundzügen erläutert werden. In der vorliegenden Arbeit sollen unter Berücksichtigung theoretischer Grundlagen (Kapitel 2) die Amplitude und die Latenz einer P300 sowie dessen Korrelation mit regelmäßigen körperlichen Aktivitäten untersucht werden. Aufgrund dessen, dass die P300 die Aktivität des zentralen Nervensystems widerspiegelt und ferner bei der kognitiven Verarbeitung neuartiger Reize beteiligt ist (vgl. Polich & Kok, 1995), kann die Latenz und die Amplitude dieser Komponente dazu dienen, die Auswirkungen regelmäßiger körperlicher Aktivitäten auf das Gehirn nachzuweisen. Das Untersuchungskollektiv besteht dabei ausschließlich aus männlichen Probanden im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, um bei der sensiblen Messung der Hirnpotentiale möglicherweise für das Ergebnis bedeutende Einflussfaktoren, wie beispielsweise das Geschlecht, möglichst gering zu halten.
Die theoretischen Grundlagen bilden den ersten Teil der vorliegenden Arbeit. Dabei sollen nicht nur Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und kognitiven Funktionen dargelegt, sondern darüber hinaus auch verschiedene Verfahren beschrieben werden, mit dessen Hilfe sich der Parameter „körperliche Aktivität" quantifizieren lässt. Ferner sollen in diesem Teil dieser Arbeit die theoretischen Grundlagen der Elektroenzephalographie im Allgemeinen gefolgt von den evozierten und den ereigniskorrelierten Potentialen im Speziellen beschrieben werden. Diesbezüglich wird ein besonderes Augenmerk auf die sogenannte P300 sowie dessen Subkomponenten, die sogenannte P3a und die P3b, gelegt und eines der gängigsten Verfahren zur Evozierung einer solchen Komponente erläutert.
Im Anschluss an den theoretischen Teil wird eine detaillierte Darstellung meiner Studie folgen. Diese beinhaltet neben der Beschreibung der Stichprobe auch den exakten Untersuchungsablauf, die verwendeten Messinstrumente sowie die statistischen Verfahren zur Auswertung der ermittelten Variablen. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Studie zusammenfassend dargestellt und unter Berücksichtigung der zuvor erwähnten theoretischen Grundlagen diskutiert. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung dieser Arbeit sowie ein Ausblick auf nachfolgende Studien.
2 Theoretische Grundlagen
Im folgenden Kapitel werden zunächst mögliche Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und kognitiven Funkionen dargestellt, wobei diesbezüglich auch das Problem der quantitativen Erfassung ausgeübter körperlicher Aktivität diskutiert wird. Im Anschluss daran werden die Elektroenzephalographie im Allgemeinen sowie evozierte und ereigniskorrelierte Potentiale im Speziellen als mögliches Messinstrument kognitiver Funktionen beschrieben. In diesem Zusammenhang wird ein besonderes Augenmerk auf die sogenannte P300 und der dazugehörigen Subkomponenten gelegt, welche seit ihrer Entdeckung von Sutton, Braren, Zubin und John im Jahre 1965 zu einer der am häufigsten untersuchten ereigniskorrelierten Potentiale gehört (Kok, 2001).
Da sich das sogenannte Oddball-Paradigma zur Evozierung einer P300 als eine der sichersten Reizdarbietungen dargestellt hat (Donchin & Coles, 1988), ist die Beschreibung dieses Versuchsaufbaus sowie die dazugehörigen denkbaren Variationen ebenfalls Bestandteil des nachfolgenden Kapitels. Abschließend werden mögliche Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und der beschriebenen P300 erörtert, um, ausgehend von diesen theoretischen Hintergründen, entsprechende Forschungshypothesen aufstellen zu können.
2.1 Körperliche Aktivität und kognitive Funktionen
Neben den in der Einleitung bereits erwähnten Auswirkungen regelmäßiger körperlicher Aktivität auf den physischen sowie psychischen Gesundheitszustand konnten in einer Vielzahl von Studien Verbesserungen der kognitiven Leistungsfähigkeit durch ein sportliches Training aufgezeigt werden (Bashore & Goddard, 1993; Tomporowski & Ellis, 1986). Die Anfänge dieses Forschungsbereichs in der kognitiven Neurowissenschaft gehen einige Jahrzehnte zurück auf Studien von Spirduso und Clifford, die zum Beispiel im Jahre 1978 junge und ältere Läufer, Sportler aus Rückschlagsportarten sowie körperlich inaktive Menschen anhand einer einfachen Reaktions- und Entscheidungsaufgabe miteinander verglichen hatten (Spriduso & Clifford, 1978). Die Reaktionszeiten älterer Sportler waren im Vergleich zu den Reaktionszeiten der älteren inaktiven Menschen deutlich kürzer. Ferner erreichte auch die Gruppe der jüngeren Sportler kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Anzahl richtiger Entscheidungen als die Gruppe, die körperlich nur wenig aktiv war. Die Erkenntnisse und die Zahl der Untersuchungen bezüglich der positiven Wirkungen körperlicher Aktivitäten auf die kognitive Leistungsfähigkeit haben sich in den letzten Jahren beachtlich erweitert, wenn auch mit teilweise divergierenden Ergebnissen. Diesbezüglich kommt Stroth (2009) zu der Erkenntnis, dass experimentelle Untersuchungen, in welchen die Teilnehmer randomisiert unterschiedlichen Bedingungen körperlicher Aktivität zugewiesen wurden, widersprüchliche Ergebnisse liefern. Vor allem bei älteren Probandengruppen gehen aerobe Aktivitäten, zum Beispiel Walken, mit einem deutlichen Leistungszuwachs bei kognitiven Aufgaben einher (Dustman, Emmerson, & Shearer, 1994; Williams & Lord, 1997), während andere Untersuchungen keinen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und kognitiver Leistung herausstellen konnten (Blumenthal et al., 1991; Hill, Storandt, & Malley, 1993).
In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass die Ergebnisse aufgrund kleiner Stichproben, verschiedener Interventionen und teilweise unterschiedlicher Definitionen von kognitiver Leistungsfähigkeit nicht vergleichbar und somit kritisch betrachtet und hinterfragt werden sollten. Desweiteren können anhand dieser Studien die Mechanismen, die diesen Effekten zugrunde liegen, nicht eindeutig geklärt werden. Eine denkbare Erklärung für einen Zusammenhang zwischen regelmäßiger körperlicher Aktivität und kognitiver Leistungsfähigkeit ist die sogenannte „Kardiovaskuläre Fitness Hypothese" (North, McCullagh & Tran, 1990). Dabei wird davon ausgegangen, dass regelmäßige körperliche Aktivitäten mit einer Verbesserung der kardiovaskulären Fitness einhergehen, welche wiederum für verschiedene physiologische Veränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die zerebrale Struktur (Colcombe et al., 2003), dem zerebralen Blutfluss (Endres et al., 2003) oder neurotrophischen Faktoren (Vaynman & Gomez-Pinilla, 2005), verantwortlich gemacht werden können.
Ferner unterstützen diverse Untersuchungen an Tieren die Vermutung, dass die Ausübung körperlicher Aktivtäten zu Veränderungen im Gehirn und somit möglicherweise zu Verbesserungen der kognitiven Leistungsfähigkeit führen kann. Als Beispiel sei in diesem Zusammenhang eine Studie von Black, Isaacs, Anderson, Alcantara & Greenough (1990) genannt, in der die Autoren bei Ratten, die regelmäßig auf einem Laufrad aktiv waren, eine erhöhte Kapillardichte im Kleinhirn feststellen konnten. Vergleichbare Untersuchungen haben ergeben, dass eine erhöhte aerobe Fitness bei Ratten, erzeugt durch regelmäßige Aktivitäten auf dem Laufrad, die Dichte ihrer Dopaminrezeptoren sowie die Fähigkeit der Cholinaufnahme im Gehirn verbessern konnte (Fordyce & Farrar, 1991). Desweiteren wurden Zusammenhänge zwischen dem Fitnesszustand der Tiere und dem Wachstumsfaktor BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) sowie der Anzahl der Nervenzellen im Hippocampus festgestellt (Neeper, Gomez, Choi & Cotman, 1995; van Praag, Kempermann & Gage, 1999).
Aufgrund der uneinheitlichen Studienlage haben Colcombe & Kramer (2003) eine Meta-Analyse aus insgesamt 18 Interventionsstudien veröffentlicht, in der die Effekte eines aeroben Ausdauertrainings in Form verschiedener Sportarten wie Laufen, Walking und Tanzen auf diverse Parameter der kognitiven Leistungsfähigkeit untersucht worden sind. Dabei unterteilten die Autoren diese Fähigkeit in folgende vier Aspekte: Exekutive Funktion, Handlungskontrolle, visuell-räumliches Gedächtnis und Schnelligkeit (vgl. Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Die Effektstärken der vier unterschiedlichen Aspekte kognitiver Leistungsfähigkeit, unterteilt zwischen Interventions- und Kontrollgruppe (Colcome & Kramer, 2003, S.129)
Auch wenn in der angesprochenen Meta-Analyse vielzählige unterschiedliche und teilweise spezifische Fragestellungen untersucht worden sind, lassen sich die Ergebnisse dieser Publikation insofern zusammenfassen, als ein eindeutiger und signifikanter Effekt von körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit festzustellen war. Im Speziellen konnte diesbezüglich eine deutliche Verbesserung der exekutiven Funktion ermittelt werden, welche bei der Handlungsvorbereitung, der -planung und der -ausübung eine Rolle spielt und primär im Frontallappen lokalisiert werden kann (Markowits]ch & Welzer, 2006).
2.2 Die quantitative Erfassung körperlicher Aktivitäten
Die Überwachung der körperlichen Alltagsaktivität ist für viele Untersuchungen ein unerlässliches Vorgehen, wenn bestimmte Zusammenhänge zwischen Bewegung, Sport, Gesundheit oder neurologischen Veränderungen aufgezeigt werden sollen. Dabei sind körperliche Aktivitäten durch einen erhöhten Energieverbrauch charakterisiert und lassen sich hinsichtlich der Frequenz, Bewegungsart, der Intensität und der jeweiligen Dauer unterscheiden.
Allerdings existieren derzeit keine Messinstrumente, die präzise und möglichst quantitativ jegliche Alltagsaktivitäten und -bewegungen erfassen können. Grundsätzlich lassen sich nach Beneke (2008) dabei drei verschiedene Kategorien zur Erfassung der körperlichen Aktivität unterscheiden, welche sowohl Vor- als auch Nachteile beinhalten. Diesbezüglich existieren zum einen subjektive Erhebungsmethoden, wie beispielsweise Fragebögen oder Bewegungstagebücher, zum anderen objektive Messverfahren, die auf mobile Sensorsysteme, wie etwa der elektromechanische Schrittzähler oder das Akzelerometer, beruhen. „Daneben existieren weitere Möglichkeiten wie Doubly Labeled Water, Kalorimetrie oder direkte Beobachtungen der Testperson, die als Goldstandard des Activity Assessments angesehen und zur Validierung oben genannter Verfahren genutzt werden können. Obwohl diese Methoden das größte Potential bei der Erfassung körperlicher Aktivitäten hinsichtlich der Messpräzision haben, muss bei der Auswahl der Erhebungsmethode angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten auch ihre Anwendbarkeit berücksichtigt werden" (Müller, Winter & Rosenbaum, 2010, S. 11).
Bei der Planung einer Studie, die aufgrund der jeweiligen Fragestellung die Erfassung der körperlichen Aktivität im Alltag beinhaltet, muss dementsprechend ein Kompromiss zwischen der Validität und der Anwendbarkeit von Möglichkeiten zur Erfassung der Alltagsaktivtät geschlossen werden (Abb. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch wenn die Doubly Labeled Water Methode die präziseste Methode zur Bestimmung des täglichen Energieverbrauchs und somit zur Erfassung der körperlichen Aktivität darstellt, birgt dieses Verfahren verschiedene Nachteile und ist somit nicht ohne Einschränkungen empfehlenswert. Bei der Doubly Labeled Water Methode wird eine bestimmte Menge Wasser getrunken, das mit den beiden stabilen Isotopen Deuterium (2H) und schwerem Sauerstoff (18O) angereichert ist. „Deuterium wird als Wasser ausgeschieden, während schwerer Sauerstoff (18O) sowohl als Wasser als auch als Kohlendioxid ausgeschieden wird. Der Unterschied zwischen diesen beiden Eliminierungsraten liegt folglich in der CO2-Produktion, die Aussagen über die verbrauchte Energie zulässt" (Müller, Winter & Rosenbaum, 2010, S. 12). Ein Nachteil dieses Verfahrens liegt vor allem in den hohen Kosten, die die Anwendbarkeit insbesondere bei größeren Stichproben einschränkt. Darüber hinaus eignet sich diese Methode, ebenso wie sämtliche objektive Methoden, wie die Pedometrie, die Akzelerometrie und das Herzfrequenzmonitoring, lediglich für prospektive Studien. Aussagen über die körperlichen Aktivitäten aus der Vergangenheit der Probanden können mit diesen Messinstrumenten nicht getroffen werden.
In diesem Zusammenhang erscheinen verschiedene Fragebögen als geeignetes Mittel der Wahl, aufgrund der subjektiven Erhebungsmethodik jedoch mit verminderter Validität. Darüber hinaus stellt die Erfassung der körperlichen Aktivität mithilfe von Fragebögen nicht nur eine kostengünstige Methode dar, sondern birgt im Vergleich zu anderen Verfahren einen zeitlichen Vorteil. Das Problem bei Untersuchungen dieser Art ist jedoch die Tatsache, dass die Antworten der Probanden oftmals von subjektiven Einschätzungen geprägt sind, die sich beispielsweise an sozialen Erwartungen, dem Fragendesign und der Motivation der Befragten orientieren (Coughlin, 1990). Um diese subjektiven Verzerrungen der Antworten möglichst gering zu halten, haben sich in der Vergangenheit eine Vielzahl von verschiedenen Autoren und Organisationen mit der Erstellung eines validen und reliablen Fragebogens befasst. An dieser Stelle sei zum Beispiel der Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) der WHO (http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/en/ index.html), der Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q; http://www.csep.ca/english/view.asp?x=698) oder der International Physical Activity Questionaire (IPAQ) des Karolinska Instituts in Schweden genannt. Letzterer hat schon in über 120 Studien (www.ipaq.ki.se) aus unterschiedlichen Forschungsbereichen Verwendung gefunden und wurde darüber hinaus von mehreren Autoren hinsichtlich der Validität und der Reliabilität untersucht. So kamen diesbezüglich zum Beispiel Dinger, Behrens und Han (2006) zu der Erkenntnis, dass die Zeit an starker körperlicher Aktivität, die mithilfe des IPAQs ermittelt wurde, signifikant mit den Ergebnissen der Pedometrie und der Akzeleometrie der entsprechenden Personen korrelierten. Darüber hinaus konnten die Autoren hinsichtlich der Reliabilität der gegebenen Antworten über eine Intraklassenkorrelation (ICC) von 0.71 - 0.89 berichten (Dinger, Behrens & Han, 2006). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Hagströmer, Oja und Sjöström (2005), welche zwischen der im IPAQ angegeben Dauer der jeweiligen körperlichen Aktivität und jener, die mithilfe eines Akzeleometers gemessen wurde, keine signifikanten Unterschiede feststellen konnten.
Trotz der dargestellten Erkenntnisse sollte die Validität des IPAQs nicht überbewertet und zumindest die absolute körperliche Aktivität der Probanden, die mithilfe dieses Fragebogens erfasst wurde, stets unter Vorbehalt interpretiert werden. In diesem Zusammenhang kommen Mynarski, Rozpara, Czapla und Garbaciak (2009) zu dem Schluss, dass diese Methode zwar Limitierungen aufweist, zur Kategorisierung zwischen aktiven und wenig aktiven Studenten jedoch ein geeignetes Hilfsmittel darstellt.
2.3 Das EEG
Die Elektroenzephalografie beschreibt ein nicht-invasives Verfahren zur Aufzeichnung der spontanen und der evozierten elektrischen Aktivität der unter der Schädeldecke liegenden Kortexschichten (vgl. Zeiler, Auff & Deecke, 2006). Mithilfe von Elektroden, die in einem bestimmten System, dem sogenannten 10/20-System (Jasper, 1958), an der Kopfhaut platziert sind, können diese kortikalen Spannungsveränderungen aufgezeichnet und bestimmten Hirnregionen zugeordnet werden, um zum Beispiel einen unmittelbaren Einblick des Funktionszustands des Hirns zu erhalten. „Diese als
Elektroenzephalogramm bezeichneten Potentiale spiegeln den allgemeinen Aktivitätszustand des Gehirn wider, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird" (Wehrli & Loosli-Hermes, 2003, S. 277). Zu diesen Faktoren zählen neben den genetischen auch externe Einflüsse, wie zum Beispiel Medikamente oder bestimmte Umweltfaktoren, sowie interne Einflüsse, wie etwa der Metabolismus oder der affektive Zustand.
Der relativ geringe zeitliche sowie technische Aufwand und die verhältnismäßig geringen Kosten dieses Verfahrens sind allerdings auch mit Nachteilen verbunden. „Das von der Kopfoberfläche abgeleitete EEG hat in Bezug zum Hirn und im Vergleich zu verschiedenen Methoden der funktionellen Bildgebung ein relativ geringes räumliches Auflösungsvermögen" (Wilhelm, Bruhn & Kreuer, 2006, S. 5). Dementsprechend sind zum Beispiel tieferliegende zerebrale Prozesse im Mittelhirn und im Hirnstamm nicht zu lokalisieren. Aufgrund der äußerst geringen Spannungsschwankungen, die an der Kopfoberfläche abgeleitet werden und im Bereich von 5 bis 100 pV liegen, beinhaltet die Elektroenzephalografie zudem jene Problematik, dass dieses Verfahren sehr anfällig gegenüber technischen sowie probandenbezogenen Störgrößen ist. Durch eine sorgfältige Versuchsanordnung und Präparation der Probanden können die technisch bedingten Artefakte, zum Beispiel aufgrund schlecht angebrachter Elektroden, zwar weitestgehend auf ein Minimum reduziert werden, Muskel- oder EKG-Artefakte lassen sich allerdings nicht vermeiden (Zschocke, 2009).
Da die Kenntnis der Entstehung des EEGs wesentlich zum Verständnis der vielgestaltigen EEG-Befunde beiträgt (Stöhr, Wagner, Pfadenhauer & Scheglmann, 1999, S. 4), werden im Folgenden die Entstehungsmechanismen, die Ableitung und die dazugehörige Auswertung kurz beschrieben.
2.3.1 Entstehungsmechanismen
Die an der Kopfoberfläche ableitbaren elektrischen Spannungen entsprechen der Summation von postsynaptischer Dendritenpotentialen an den sogenannten Pyramidenzellen der obersten Hirnrindenschicht. Die Aktivierung der Synapsen an den einzelnen Neuronen des Kortex führt durch Ausschüttung der lokalen Transmittermoleküle mit Öffnung bestimmter lonenkanäle für Na+, K+ und Cl" in der subsynaptischen Membran zu einer lonenverschiebung quer zur Zellmembran und demzufolge zu einer örtlichen Veränderungen des elektrischen Membranpotentials (Stöhr, Wagner, Pfadenhauer & Scheglmann, 1999; Wilhelm, Bruhn & Kreuer, 2006). „Dies führt längs der Zellmembran zu den übrigen, nicht erregten Abschnitten des Neurons zu einem elektrischen Potentialgefälle, das sich außerhalb der Synapse in Form der sogenannten postsynaptischen Potentiale über das Neuron und seine Umgebung ausbreitet und die Erregbarkeit der Nervenzelle beeinflusst" (Wilhelm, Bruhn & Kreuer, 2006, S. 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3. Elektrische Dipole an den senkrecht angeordneten großen Pyramidenzellen (Wilhelm, Bruhn & Kreuer, 2006, S. 7)
Aufgrund des Na+-Einstroms in das Zellinnere und der damit verbundenen Verringerung positiver Ionen an der Zellaußenseite bilden sich an den senkrecht angeordneten großen Pyramidenzellen negative Dipole, welche summarisch eine unmittelbare Potentialquelle bei der EEG-Messung darstellen (vgl. Abb. 3). Da der Ausgangspunkt des beschriebenen Mechanismus die Aktivierung einer Synapse durch erregende Zuflüsse ist, beruhen die erfassbaren Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche in erster Linie auf sogenannte exzitatorische postsynaptische Potentiale (EPSP) und den davon ausgehenden Potentialdifferenzen.
„Bei hemmenden Synapsen, die durch Transmitter wie zum Beispiel GABA über die Öffnung anderer Ionenkanäle subsynaptisch umgekehrt zu einer vorübergehenden Erhöhung des Zellmembranpotentials führen, gelten prinzipiell die gleichen Zusammenhänge, nur mit umgekehrtem Vorzeichen" (Stöhr, Wagner, Pfadenhauer & Scheglmann, 1999, S. 5). Dabei werden in der Regel die lonenkanäle für K+-Ionen geöffnet, so dass diese aus dem Zellinneren ausströmen können und eine Erhöhung der Konzentration von positiven Ionen an der Zellaußenseite bewirken. Dieser Vorgang führt zu einer Erhöhung des Ruhemembranpotentials und die subsynaptische Membran hyperpolarisiert, das wiederrum ein sogenanntes inhibitorisches postsynaptisches Potential (IPSP) nach sich zieht.
Die zuletzt genannten Potentiale der Pyramidenzellen spielen bei EEG- Messungen eine eher geringe Rolle, da diesbezüglich die fließenden Ströme pro Zeiteinheit sehr viel kleiner sind als dies bei den exzitatorischen postsynaptischen Potentialen (EPSP) der Fall ist. Eine an der Kopfoberfläche angebrachte Elektrode kann die elektrischen Veränderungen einer einzelnen Synapse allerdings nicht aufzeigen, da sowohl die inhibitorischen als auch die exzitatorischen postsynaptischen Potentiale zu gering und die Abstände zur Schädeldecke zu groß sind. Dass mithilfe der Enzephalografie dennoch die Aktivität verschiedener Hirnregionen detektiert werden kann, liegt zum einen in der zeitlich synchronen Aktivierung einzelner Zellen sowie zum anderen in der parallelen Anordnung der senkrecht zur Kortexoberfläche liegenden Pyramidenzellen. Diese Eigenschaften des Kortex bewirken, dass veränderte elektrische Aktivitäten als Summenpotential beziehungsweise als kortikale Feldpotentiale an der Kopfoberfläche mittels einer Elektrode erfassbar sind. „Keine oder nur geringe Beiträge zum EEG liefern unter normalen Umständen die Aktionspotentiale der Neurone, da sie zu ungeordnet auftreten und zu rasch wieder abklingen, um sich zu hohen Potentialschwankungen zu summieren" (Schmidt & Schaible, 1993, S. 360).
2.3.2 Ableitung
Die Ableitung der schwachen, summiert auftretenden Potentiale erfolgt in Abhängigkeit der verfügbaren technischen Möglichkeiten über 19, 21, 32, 64, 128 oder sogar 256 Elektroden, die in einem international einheitlichen System (10/20-System) auf der Kopfoberfläche positioniert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Schädelgrößen und -formen lässt sich die Lage der jeweiligen Ableitpunkte der Elektroden allerdings nicht in absoluten Maßangaben festlegen, sondern wird ferner in relativen Abständen zu bestimmten Bezugspunkten, namentlich das Nasion, das Inion und einem präaurikulären Bezugspunkt vor dem Tragus, angegeben.
Aufgrund dessen, dass die hirnelektrische Aktivität an der Schädeloberfläche sehr niedrig ist, müssen die ableitbaren Potentialdifferenzen zwischen zwei verschiedenen Elektroden mithilfe eines Differenzverstärkers gemessen werden. Dabei ergibt sich das Ausgangssignal eines Differenzverstärkers aus der Differenz zweier Eingangssignale unter Berücksichtigung der Polaritätsbeziehungen beziehungsweise des entsprechenden Vorzeichens. „Die verschiedenen Arten der Elektrodenverschaltungen (Ableitprogramme) lassen sich auf zwei grundsätzliche Formen zurückführen, nämlich auf Referenzableitungen (Bezugsableitungen) und auf bipolare Ableitungen" (Zschocke, 2009, S. 65). Die erst genannte Ableitform beinhaltet einen gemeinsamen Bezugspunkt für alle Elektroden, welcher entweder einer natürlichen Referenz am Probanden, etwa dem Ohrläppchen, entspricht, oder einer technisch hergestellten Referenz wie beispielsweise die Ableitung gegen eine Durchschnitts- oder Mittelwertreferenz. Demgegenüber steht die sogenannte bipolare Ableitung, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die beiden differenten Ableitungselektroden über elektrisch aktiven Regionen platziert werden. „Da sich das Ausgangssignal stets auf zwei benachbarte Elektroden bezieht und da zumindest im Normalfall die Hirnrindenaktivität regional relativ gut synchronisiert ist, bleiben die Potentialdifferenzen zwischen den einzelnen Elektroden oft relativ gering" (Zschocke, 2009, S. 73).
Aufgrund der geringen Amplituden, die in einem Bereich von 5 bis 100 pV liegen, ist bei der Ableitung des EEG-Signals eine Kontrolle verschiedener biologisch erzeugter Artefakte, zum Beispiel Augen- oder Muskelpotentiale, mittels Filterungsprozeduren oder einem Elektrookulogramm (EOG) notwendig. Bei der Elekrookulografie werden zwei zusätzliche Elektroden in unmittelbarer Nähe des Auges platziert, die im Falle einer Augenbewegung einen elektrischen Spannungsunterschied zwischen der Horn- und der Netzhaut registrieren können, welcher ebenfalls im EEG-Abbild sichtbar ist. Die anschließende digitale Filterung der biologischen sowie technisch bedingten Artefakte beruht auf modernen mathematischen Verfahren, die allerdings unter Umständen mit Problemen behaftet sein können, wenn diese zu Verzerrungen des EEG-Signals und der entsprechenden Topografie führen (Ebner & Deuschl, 2006).
2.3.3 Auswertung und Darstellung
Im Anschluss an eine visuelle Begutachtung des aufgenommenen EEG-Abbilds inklusive der dazugehörigen Detektion von Artefakten kann mithilfe einer Digitalisierung des kontinuierlichen EEG-Signals eine quantitative EEG-Analyse durchgeführt werden. „Ziel der digitalen computergestützten EEG-Analyse ist es, definierte Komponenten des EEGs selektiv darzustellen und zu quantifizieren, um sie in der Folge in Verlaufsuntersuchungen, im Vergleich zu Normaldaten oder als Subgruppen zu untersuchen" (Wallesch & Förstl, 2005, S. 108). Als eines der häufigsten angewandten Analyseverfahren ist diesbezüglich die Frequenz- beziehungsweise Spektralanalyse zu nennen, welche auf dem sogenannten Fast-Fourier-Algorithmus basiert und die Bestimmung des jeweiligen Anteils der einzelnen Frequenzkomponenten am Gesamt-EEG ermöglicht. Dabei wird die Amplitude des EEG-Signals in Abhängigkeit der auf der horizontalen Achse abgebildeten Zeit insofern transformiert, als zu jeder Frequenz ein separater Amplitudenwert berechnet wird. Dementsprechend fällt die zeitliche Information weg. (Walter, 2004). Die ermittelten Amplituden, Frequenzen und das Leistungsspektrum aus der Frequenzanalyse lassen sich üblicherweise mit einem Histogramm veranschaulichen, können aber auch in Form einer topografischen Darstellung der über der Schädeloberfläche verteilten Hirnaktivität aufgezeigt werden. „Hierfür werden die Signalamplituden zwischen den durch Elektroden bestimmten Ableitpunkten durch Interpolation berechnet. Die Amplituden der so gewonnenen zweidimensionalen Verteilungen werden quantifiziert und farblich codiert" (Kramme, 2011, S. 172). Ein Problem, das auch nach sorgfältiger Artefaktbereinigung und Frequenzanalyse weiterhin besteht, ist die Tatsache, dass mit dem genannten Verfahren eine eindeutige lokale Zuordnung der EEG-Signale zu ihren Entstehungsorten nicht möglich ist. Für die Identifikation der aktivierten Areale im Gehirn mithilfe der an der Kopfoberfläche abgeleiteten elektrischen Aktivität wurde in den letzten Jahren die sogenannte EEG-Tomografie (low resolution electromagnetic tomography, LORETA) entwickelt. Diesbezüglich wird unter Berücksichtigung neuroanatomischer und physiologischer Grundlagen eine dreidimensionale Stromdichteverteilung berechnet, die auf der Annahme basiert, dass benachbarte Neurone simultan und synchron aktiviert werden müssen, um sich zu einem messbaren kortikalen Feldpotential aufsummieren zu können (Springer-Kremser, Löffler-Stastka & Schuster, 2010). „In einer Weiterentwicklung des Verfahrens können nun simultan aktive elektrische Generatoren im Talairach-Koordinationsystem lokalisiert werden. Dabei wird der Lösungsraum entsprechend der anatomischen Struktur auf Bereiche mit kortikaler grauer Hirnsubstanz und den Hippocampus beschränkt" (Holsboer, Gründer & Benkert, 2007, S. 344).
2.4 Evozierte Potentiale
Im Unterschied zu dem beschriebenen spontan ablaufenden EEG-Signal stellen die evozierten Potentiale bestimmte Spannungsveränderungen dar, welche durch die Reizung eines Sinnesorgans oder eines peripheren Nerves ausgelöst werden. Da die Amplituden solcher evozierten Potentiale allerdings deutlich kleiner als die des Spontan-EEGs ausfallen und somit von diesem überlagert werden, ist bei der Ableitung der evozierten Potentiale eine elektronische Mittelwertbildung (Averaging) unumgänglich (Abb. 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4.
„Diese wird mit einem dem Reiz simultanen Triggersignal gesteuert. Damit werden die Signalkomponenten, die in einem festen zeitlichen Zusammenhang mit dem Reiz stehen, aus der Hintergrund-aktivität herausgelöst. Diese Signalkomponenten bilden das evozierte Potential" (Kramme, 2011, S. 185).
Bei dieser Mittelwertbildung muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Wellenform der einzelnen Komponenten in einem direkten Zusammenhang mit den auslösenden Reizen steht und somit stets dieselbe ist. „Insbesondere wird angenommen, dass der gesamte zeitliche Verlauf des evozierten Potentials in einer festen Zeitbeziehung zum Reiz steht, dass also die Latenzen der verschiedenen Komponenten über viele Reizdarbietungen hinweg konstant bleiben. Ebenso wird vorausgesetzt, dass die Amplitudenwerte konstant bleiben" (Schandry, 1998, S. 241).
Diesbezüglich kann es sich bei den dargestellten Reizen sowohl um visuelle Reize, wie beispielsweise Helligkeitsreize in Form von Lichtblitzen oder Kontrastreize in Form eines dargestellten Schachbrettmusters, als auch um akustische, somatosensorische oder motorische Reize handeln. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass mithilfe dieser Messtechnik Aussagen über die Umwandlung, Weiterleitung und Verarbeitung von bestimmten Reizen möglich sind und dementsprechend auch die Zustände einzelner neuronaler Bahnen benannt werden können. „Das Ziel der Ableitung evozierter Potentiale ist es, zu prüfen, ob die Fortleitung der sensorischen Reizung bis zur kortikalen Verarbeitung im Gehirn normal, verzögert beziehungs-weise überhaupt vorhanden ist" (Kramme, 2011, S. 185). Dementsprechend hat zum Beispiel die Ableitung visuell evozierter Potentiale insofern vor allem eine klinische Bedeutung, als dadurch bestimmte zentrale Sehstörungen oder eine multiple Sklerose (MS) frühzeitig erkannt werden können. Bei der Auswertung und der anschließenden Interpretation entsprechen die jeweiligen Amplituden, gemessen in gV, sowie die dazugehörige Polarität und die Latenzen der einzelnen Komponenten den gängigen Kennwerten zur Beschreibung der evozierten Potentiale. Darüber hinaus beinhaltet die differenzierte Beschreibung einer Komponente die genaue Elektrodenlokalisation auf der Schädeldecke, welche ebenfalls im 10/20-System positioniert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5. Schematisierte Darstellung der endogen und exogen evozierten Potentiale nach visueller und auditorischer Reizung (Stöhr, Dichgans, Buettner & Hess, 2005, S. 503)
Die hirnelektrischen Antworten, die sich beim Menschen nach entsprechender Reizdarbietung ableiten lassen, können ferner in sogenannte exogene sowie endogene Komponenten unterteilt werden (vgl. Abb. 5).
Diesbezüglich entsprechen die dargestellten evozierten Potentiale, unabhängig davon, ob diese visuellen, akustischen, somatischen oder motorischen Reizen zugrunde liegen, den exogenen Komponenten, die bei intaktem Nervensystem hinsichtlich ihrer Amplitude, Latenz und Topografie lediglich durch die physikalischen Eigenschaften des Stimulus bestimmt werden. „Die späten, endogenen Potentialkomponenten dagegen werden vorrangig durch psychologisch fassbare Faktoren beeinflusst, sie werden als ereigniskorrelierte (Hirn-) Potentiale (englischer Terminus: event-related potentials) bezeichnet" (Olbrich, 1989, S. 513).
2.5 Ereigniskorrelierte Potentiale
Im Unterschied zu den evozierten Potentialen, mit deren Hilfe in erster Linie Aussagen über die Reizwahrnehmung und -weiterleitung getroffen werden können, bieten ereigniskorrelierte Potentiale dagegen die Möglichkeit, elementare Prozesse der Informationsverarbeitung im Gehirn darzustellen. Diese Potentiale treten im Allgemeinen nicht in den ersten 100 ms nach Reizdarbietung auf (Buchner & Noth, 2005), können im Einzelfall aber auch vor einem dargestellten Ereignis gefunden werden. Diese speziellen Komponenten der ereigniskorrelierten Potentiale werden namentlich zum Beispiel als die „contingent negative variation" (Walter, Cooper, Aldridge & McCallum, 1964) und als das „Bereitschaftspotential" (Kornhuber & Deecke, 1964) bezeichnet. Sie gehen einem äußeren Reiz oder internen Ereignis voraus und spiegeln demzufolge die Erwartungshaltung oder das Priming der Probanden wider. Darüber hinaus werden in der Literatur die verschiedenen Potentialklassen in Hirnstammpotentiale, mittlere und späte Potentiale unterteilt, wobei die beiden letzteren der bereits erwähnten Kategorisierung in exogenen (mittleren) und endogenen (späten) Potentialen entsprechen (Abb. 6). „Die Hirnstammpotentiale sind allerdings kaum Gegenstand psychologischer Betrachtung, da sie durch psychologische Variablen nicht beeinflusst werden. Sie können zum Beispiel eingesetzt werden zur Diagnostik der Hörfähigkeit bei Säuglingen" (Universität Trier, 2003).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Darüber hinaus ist eine trennscharfe Unterscheidung in ausschließlich endogene beziehungsweise exogene Potentiale nicht möglich, da eine Variation der selektiven Aufmerksamkeit der Probanden bereits in einem Latenzbereich ab 20 ms zu erkennen ist. „Zudem hängen späte Potentiale wie die P300- Komponente durchaus auch von rein physikalischen Eigenschaften des Ereignisses wie zum Beispiel der Stimulationsintensität, dem Stimuluskontrast oder der Modalität ab" (Hegerl, 1998, S. 97).
Trotz dieser unscharfen Unterteilung der Komponenten in verschiedene Kategorien, lassen sich bestimmte Kriterien festmachen, mit dessen Hilfe die ermittelten Potentiale eindeutig beschrieben werden können. „Ein ereigniskorreliertes Potential ist durch seine Polarität, Latenz und Topografie charakterisiert, im weiteren Sinne auch durch das Untersuchungsparadigma, bei dem die Komponente zur Beobachtung kommt" (Olbrich, 1989, S.514). Zur eindeutigen Kennzeichnung der jeweiligen Komponenten existieren in der Literatur verschiedene Vorgehensweisen. Zum einen können die einzelnen Amplitudenmaxima chronologisch durchgezählt und mit einer Kennzeichnung bezüglich der jeweiligen Polarität (p = positiv, n = negativ) versehen werden. Demnach entspricht zum Beispiel die P3-Komponente der dritten postiven Welle, wenn in der hirnelektrischen Antwort auf einen bestimmten Reiz die Komponenten, beginnend bei den Vertexpotentialen P1, N1 und P2 (Hillyard, Picton & Regan, 1978), nacheinander durchnummeriert werden. Zum anderen ist es möglich, dass anstelle der Ordnungszahlen der einzelnen Komponenten die jeweiligen Gipfellatenzen in Millisekunden angegeben werden. Nach diesem Schema entspricht zum Beispiel die P300, eine der prominentesten und meist untersuchten Wellen der ereigniskorrelierten Potentiale, jener Komponente, deren Gipfel sowohl positive Potentialwerte als auch eine Latenz von etwa 300 ms aufweist. „Der genannte Latenzwert findet sich bei Darbietung leicht diskriminierbarer akustischer Reize. Bei optischer Reizmodalität sowie bei Erschwerung der Signalerkennung und -klassifizierung können um mehrere 100 ms längere P3-Latenzen gemessen werden" (Olbrich, 1989, S. 514). Demzufolge erscheint eine Benennung der auftretenden Potentiale mithilfe von Ordnungszahlen als die sinnvollere Methode.
Unabhängig von der Namensgebung der einzelnen Komponenten besteht bei der Messung der Hirnströme, sei es nach einer gezielten Reizdarbietung oder bei dem Spontan-EEG, stets der Nachteil, dass die an der Schädeldecke gemessene Aktivität nur mit Einschränkungen bestimmten Hirnarealen zugewiesen werden kann. Diesbezüglich haben zwar Herweg, Satrapi und Schönfeldt-Lecuona (2003) in einer Untersuchung mithilfe von EEG und einer transkraniellen Magnetstimulation bestimmten Elektrodenpositionen verschiedenen Brodman-Areale zugeordnet, inwiefern die Validität dieser Studie eine Allgemeingültigkeit zulässt, sollte allerdings kritisch hinterfragt werden.
2.6 P300
Die im Jahre 1965 von Sutton, Baren, Zubin und John erstmals beschriebene P300-Kom ponente zählt im Bereich der kognitiven Neuropsychologie zu den bedeutsamsten und am meisten untersuchten Potentialen und gilt seitdem als wichtigstes Korrelat kognitiver Prozesse (Linden, 2005). Wie die Bezeichnung verrät, handelt es sich dabei um eine Komponente mit positiver Polarität, dessen Amplitudenmaximum 300-800 ms nach unerwarteten, aufgabenrelevanten Stimuli in einer Stimulusreihe, dem sogenannten Oddball- Paradigma, aber auch im Rahmen anderer Paradigmen zur Darstellung kommt (Hegerl, 1998). Diesbezüglich konnte mithilfe eines sogenannten "Missing- stimulus-Paradigmas" (Klinke, Frühstorfer & Finkenzeller, 1968; Picton & Hillyard, 1974) ebenfalls eine P300-Welle ausgelöst werden. Bei diesem Versuch wurde den Probanden kontinuierlich alle 1,2 Sekunden ein akustisches Klickgeräusch dargeboten. Gelegentlich blieb dieser Reiz aus. Während reale Klicks bei diesem Experiment eine N1- und P2-Welle auslösten, wurde das Ausbleiben eines erwarteten Klickgeräusches mit einer N2- und P3-Welle beantwortet. „Hier wird unmittelbar der endogene Charakter der ereigniskorrelierten Potentiale ersichtlich" (Olbrich, 1989, S. 517). Darüber hinaus werden die vorrangig endogenen Anteile der P300-Komponente durch die Tatsache verdeutlicht, dass die Amplitude ein größeres Maximum aufweist, wenn einem Reiz verstärkte Aufmerksamkeit zugewendet wird, wenn die Reize bedeutsam sind und wenn die objektive sowie die subjektive Ungewissheit über das Eintreten eines Ereignisses größer ist (Hillyard, Squires, Bauer & Lindsay, 1971; Johnson, 1986).
Seit der Entdeckung der P300 im Jahre 1965 sind vielzählige Untersuchungen durchgeführt worden, die unter anderem die kognitive und funktionelle Bedeutung, die Lokalisation der Quellen sowie die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Amplitude und die Latenz beinhalteten. In diesem Zusammenhang sind Simson, Vaughan und Ritter (1976) zunächst davon ausgegangen, dass die P300 von bilateralen Generatoren im parietalen Assoziationscortex und vom frontalen Cortex generiert wird (Dietrich, 2002).
„Intracranielle Ableitungen ergaben aber inzwischen, dass ein P300 ähnliches Potential in den medialen Abschnitten des Temporallappens unter den gleichen Bedingungen registriert werden konnte wie das auf dem Skalp abgeleitete P300-Potential" (Dietrich, 2002, S. 54). Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass die P300 kein einheitliches Potential mit einer eindeutig bestimmbaren Quelle darstellt, sondern stattdessen von mehreren, möglicherweise weit verstreuen Quellen generiert wird.
Bezüglich der Größe der Amplitude konnten verschiedene Autoren feststellen (vgl. Duncan-Johnson & Donchin, 1977; Squires, Wickens, Squires & Donchin, 1976), dass diese signifikant mit der Wahrscheinlichkeit eines Stimulus sowie mit dem Ausmaß an zusätzlichen Informationen, die mit dem auslösenden Reiz verbunden sind, zusammenhängen. „Diese und andere Überlegungen haben dazu geführt, dass man die P300 auch als Korrelat von kontext- und gedächtnisrelevanten Faktoren ("context or memory updating") ansieht, bei dem das vorhandene eigene Modell von der Umgebung als Funktion der einlaufenden Informationen modifiziert wird" (Dietrich, 2002, S. 53). Diesbezüglich vermuten Donchin, Ritter und McCallum (1978) in der P300 den Endpunkt einer Stimulusbewertung, bei der die sensorisch wahrgenommenen Reize mit der aktuellen mentalen Repräsentation der Umwelt verglichen werden. Entspricht der dargestellte Reiz nicht dem im Gehirn befindlichen, erwarteten Abbild, muss dieses erneuert werden. Dieses Update des jeweiligen mentalen Schemas kann anschließend als P300 erfasst werden (Abb. 7). Diese Betrachtungsweise suggeriert allerdings die Annahme, dass eine Veränderung in der Amplitude der P300 lediglich den kognitiven Prozess der Kontextaktualisierung widerspiegelt. Wie im Folgenden noch genauer dargestellt wird (Kap. 2.6.1), entspricht die auf der Kopfoberfläche abgeleitete P300 jedoch keiner einheitlichen Komponente, sondern kann stattdessen in weitere Subkomponenten mit unterschiedlicher Topografie und funktioneller Bedeutung unterteilt werden. „Eine experimentelle Manipulation der P300 kann somit nicht einwandfrei mit der Stärke des Kontextaktualisierungsprozesses gleichgesetzt werden" (Bledowski, 2005, S. 39).
Bei gleichbleibenden Stimuli tritt die P300 nicht auf, lediglich sensorisch evozierte Potentiale (N100, P200, N200) sind dann messbar (Polish, 2007). „Der Grad der Abweichung findet vornehmlich in einer der P300 vorauslaufende Komponente Ausdruck. Die sogenannte Mismatch Negativität (MMN), die rund 200 ms nach Reizauftreten einsetzt, reflektiert die Antwort auf Abweichung und fällt umso stärker aus, je größer die Abweichung von einem etablierten Standard ist" (Nebel, 2007, S. 16). Aufgrund dessen, dass die Amplitude der P300 proportional zur Intensität der Aufmerksamkeit, die einer bestimmten Aufgabe gewidmet wird, steigt und darüber hinaus bei der Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses beteiligt ist, kann die Größe der P300-Welle als Index der Gehirnaktivität angesehen werden, welcher die Verarbeitung einkommender Informationen und ihre Integration in aktuelle Gedächtnisrepräsentationen reflektiert (Buchner & Noth, 2005).
- Arbeit zitieren
- Till Hansmeier (Autor:in), 2011, Der Einfluss körperlicher Aktivität auf die kognitive Orientierung (P3a) und Evaluierung (P3b) visueller Reize, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188481
Kostenlos Autor werden



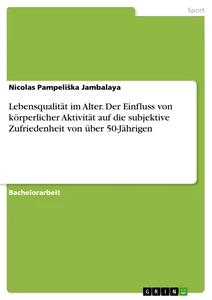
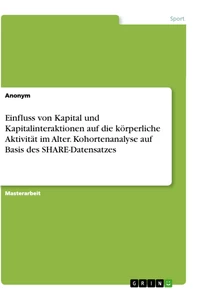







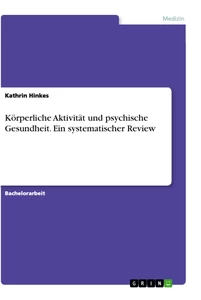






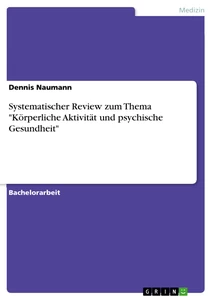
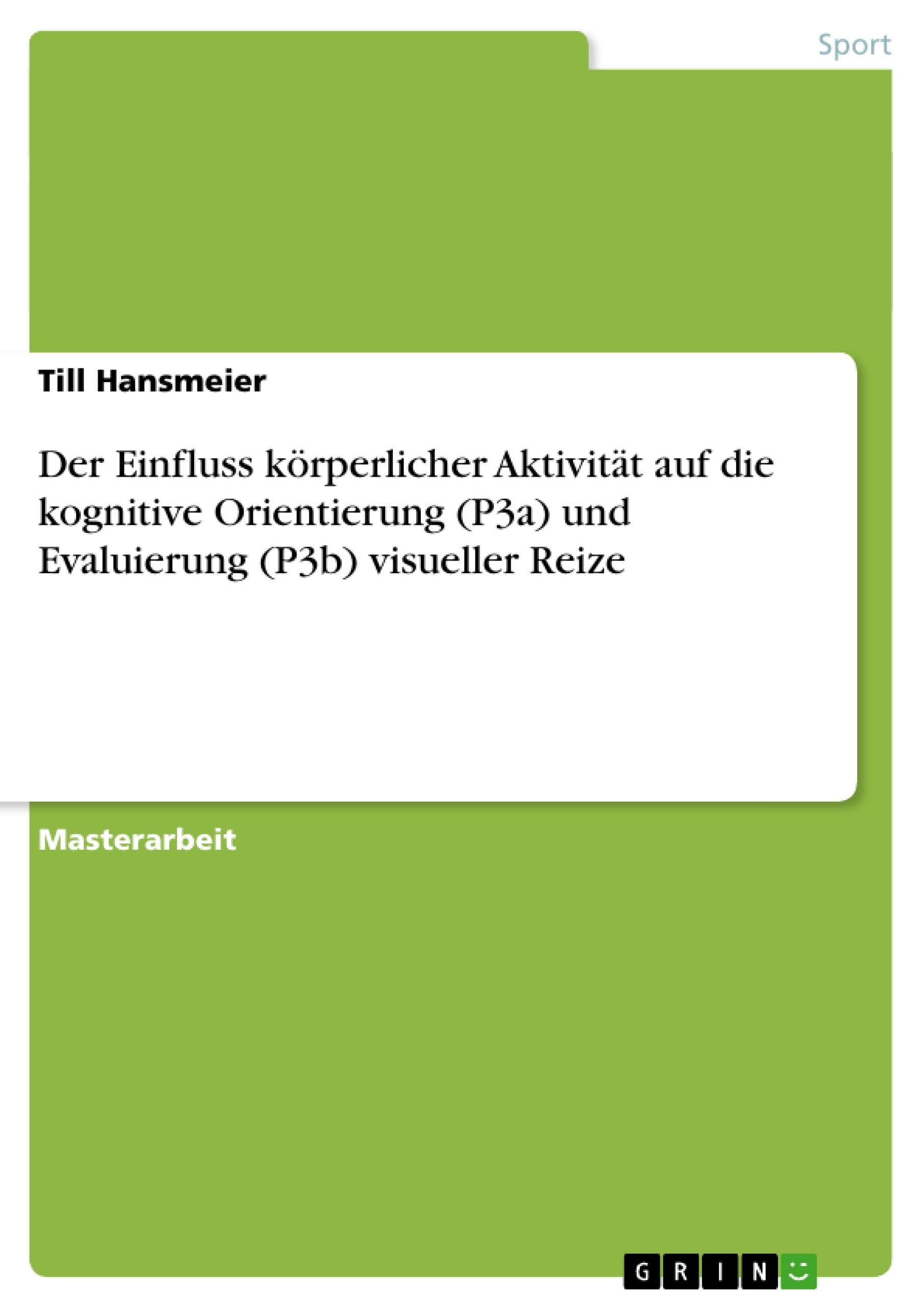

Kommentare