Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Eidesstattliche Versicherung
II. Danksagung
III. Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1 Spezifische Phobien
2.1.1 Diagnostische Kriterien und klinische Merkmale der spezifischen Phobien
2.1.2 Epidemiologie
2.1.3 Ätiologie
2.1.4 Diagnostik und Diagnoseinstrumente
2.1.5 Behandlung
2.2 Zahnbehandlungsphobie
2.2.1 Definition sowie typische und spezifische Merkmale des Störungsbildes der Zahnbehandlungsphobie
2.2.2 Epidemiologie
2.2.3 Komorbidität
2.2.4 Ätiologie
2.2.5 Diagnostik und Diagnoseinstrumente
2.2.6 Behandlung
2.3 Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
2.3.1 Definition sowie typische und spezifische Merkmale des Störungsbildes der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
2.3.2 Epidemiologie
2.3.3 Komorbidität
2.3.4 Ätiologie
2.3.5 Diagnostik und Diagnoseinstrument
2.3.6 Behandlung
2.4 Zahnbehandlungsphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
2.4.1 Der Zusammenhang zwischen Dentalphobie und Blut-, Spritzen und Verletzungsphobie im ICD-10 und DSM-IV
2.4.2 Empirische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Dentalphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
3. FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN
3.1 Ziele der Untersuchung
3.2 Ableitung der Fragestellungen und Hypothesen der vorliegenden Studie
4. METHODE
4.1 Datenerhebung
4.2 Erhebungsinstrumente
4.2.1 Soziodemografische Variablen
4.2.2 Mutilation Questionnaire
4.2.3 Dental Fear Survey
4.2.4 Hierarchischer Angstfragebogen
4.2.5 Fragebogen zu angstauslösenden Situationen der Zahnbehandlungsangst
4.3 Operationalisierung der untersuchten Variablen
4.4 Eigenschaften der Stichprobe
4.5 Datenauswertung und verwendete statistische Verfahren
5. ERGEBNISSE
5.1 Fragestellungen 1 - 3: Prävalenzraten der Dentalphobie und der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie sowie Komorbidität
5.2 Fragestellung 4 - 5: soziodemografische Variablen und Dentalphobie, Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie und Komorbidität
5.3 Fragestellung 6: Zusammenhang zwischen Dentalphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
5.4 Fragestellung 7: Regelmäßigkeit der zahnmedizinischen Versorgung und Dentalphobie
5.5 Fragestellung 8: Übereinstimmung zwischen den beiden Erhebungs instrumenten für die Dentalphobie
5.6 Fragestellung 9: Güte des Fragebogens zu angstauslösenden Situationen der Zahnbehandlungsangst (ASZBA)
5.7 Fragestellungen 10 - 11: Zusammenhänge mit den berichteten Angstausprägungen bezüglich der angstauslösenden Situationen (ASZBA)
5.8 Überblick über die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
6. DISKUSSION
6.1 Zahnbehandlungsphobie
6.2 Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
6.3 Zusammenhang zwischen Zahnbehandlungsphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie
6.4 Kritik an der vorliegenden Untersuchung
6.5 Ausblick und Implikationen für weitere Forschungsarbeiten
7. ZUSAMMENFASSUNG
IV. Literaturverzeichnis
V. Anhang
A: Tabellenverzeichnis
B: Abbildungsverzeichnis
C: Ergebnistabellen der Faktorenanalyse des ASZBA
D: Untersuchungsinstrumente
II. Danksagung
Vor allem möchte ich mich bei Frau Dr. Gaby Bleichhardt für die hilfreiche Unterstützung und ihre anregende Kritik beim Anfertigen dieser Arbeit bedanken.
Danken möchte ich auch meinen Freunden und Kommilitonen, die mir bei der Bearbeitung des Themas immer wieder anregende Tipps und Hinweise gaben.
Selbstverständlich gilt auch all jenen ein großer Dank, die mir bei der Verbreitung der Fragebögen geholfen haben und jedem Einzelnen, der sich zur Bearbeitung eines Fragebogens bereit erklärt hat.
Besonders danken möchte ich zuletzt auch meiner Mutter, die mich stets in der Umsetzung meines Vorhabens unterstützte und einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet hat.
1. EINLEITUNG
„Zahnweh, subjektiv genommen, ist ohne Zweifel unwillkommen ...“ Wilhelm Busch (1832 - 1908)
Der Zahnarztbesuch ist für viele Menschen mit unangenehmen Gefühlen oder sogar leichter bis starker Angst verbunden. Mit keiner anderen Art von Arztbesuch gehen durchschnittlich so viele negativen Erwartungen, Kognitionen und Emotionen einher wie mit dem Besuch beim Zahnarzt. Trotz der heute möglichen weitgehenden Schmerzfreiheit während einer zahnmedizinischen Versorgung durch den Einsatz von Lokalanästethetika sieht ein Großteil der Allgemeinbevölkerung dem Besuch beim Zahnarzt nicht angstfrei entgegen. Zahnarztbesuche werden häufig mit Schmerzen und anderen Missempfindungen in Verbindung gebracht. Etwa fünf bis zehn Prozent der Allgemeinbevölkerung (Jöhren & Sartory, 2006) vermeiden zahnmedizinische Versorgung gänzlich und ihre spätere Behandlung ist sehr zeit- und kostenaufwendig. Zahnbehandlungsphobiker leiden vor allem aufgrund von Schuld- und Schamgefühlen, die sie wegen ihrer im Laufe der Zeit zunehmend schlechter werdenden Zahngesundheit entwickeln. Diese Schuld- und Schamgefühle sowie der Wunsch, dieses Problem im Alltag zu verbergen, führen nicht selten auch zu einer sozialen Isolierung.
Ähnlichen Leidensdruck erleben auch Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobiker. Sie vermeiden mitunter lebenswichtige medizinische Prävention und Behandlung aufgrund ihrer Angst. Die Angst vor Blut, Spritzen sowie Verletzungen ist im Wesentlichen evolutionär begründet, der Schutz vor eigenen körperlichen Verletzungen und die körperliche Reaktion beim Anblick von Blut machte es den Lebewesen möglich, zu überleben und sich selbst zu schützen. Sowohl die Dentalphobie als auch die Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie gehören zur Angstgruppe der spezifischen Phobien.
Die spezifischen Phobien, welche schon viele Jahrhunderte zuvor immer wieder Erwähnung in verschiedensten Typologien der Angst (u. a. bei Hippokrates) gefunden hatten, wurden 1948 erstmals in der sechsten Version des internationalen Klassifikationssystems (ICD) der Weltgesundheitsorganisation und 1952 im Klassifikationssystem (DSM) der American Psychiatric Association (APA) als eigenständige Kategorie einer psychischen Angststörung aufgeführt. In den folgenden Jahrzehnten kam es dann auch zur genaueren Erforschung der Dentalphobie, der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie sowie weiterer spezifischer Phobien. Vermehrtes wissenschaftliches Interesse an der Zahnbehandlungsangst und der Blut-, Spritzen- und Verletzungsangst zeigte sich erstmals Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Ungeklärt bleibt jedoch bis heute die Einordnung der Dentalphobie als eigenständige Angsterkrankung, welche als selbstständige Einheit zu den spezifischen Angststörungen gehört oder als Bestandteil der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie einzuordnen ist. Im DSM-IV wird Zahnbehandlungsangst dem Blut-Spritzen-Verletzungstypus zugeordnet und ist somit eine Komponente dieses Typus und nicht eigenständig erwähnt. Das ICD-10 unterscheidet hingegen diese beiden Arten von spezifischen Angststörungen.
Schwerpunktmäßig beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Stellenwert, welchen die Dentalphobie neben der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie einnimmt. Es sollen zunächst beide Angststörungen getrennt betrachtet werden, um danach näher auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden spezifischen Phobien eingehen zu können. Um eine Abgrenzung beider Arten der spezifischen Phobien zu ermöglichen, sollen Dentalphobiker und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobiker auch hinsichtlich ihrer Angstreaktionen in verschiedenen zahnbehandlungsspezifischen angstauslösenden Situationen betrachtet werden. Ebenso beschrieben wird, welchen Einfluss eine regelmäßige zahnmedizinischen Versorgung auf die Zahnbehandlungsangst hat. Zudem wird auch die Übereinstimmung zwischen zwei weit verbreiteten Erhebungsverfahren der Zahnbehandlungsangst kritisch diskutiert.
2. THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1 Spezifische Phobien
Die spezifischen Phobien gehören zur Gruppe der Angststörungen und sind gekennzeichnet durch eine klinisch relevante Angstreaktion auf einen spezifischen angstauslösenden Reiz oder eine Situation. Solche angstauslösenden Reize und Situationen können unter anderem bestimmte Tiere, wie zum Beispiel Schlangen oder Spinnen (Arachnophobie) oder Umgebungsbedingungen, zum Beispiel Höhen (Akrophobie), Dunkelheit (Nyktophobie), geschlossene Räume (Klaustrophobie) oder medizinische Settings sein. Auf diese angstauslösenden Reize reagiert der Betroffene mit einer intensiven und lang anhaltenden Furchtreaktion. Mit zunehmender physiologischer Gegenwart des gefürchteten Reizes steigt auch die Intensität der Angstreaktion an. Infolge wiederholter Konfrontation mit dem angstauslösenden Stimulus werden diese Reize und Situationen zukünftig vermieden. Der Betroffene ist sich bewusst darüber, dass seine Angstreaktion irrational ist, kann aber sein Verhalten nicht willentlich kontrollieren (Hamm, 1997; Marks, 1987). Durch die Vermeidung der spezifischen angstauslösenden Situationen und Reize ist es den meisten Betroffenen möglich, den Alltag ohne Einschränkungen und ausgeprägten Leidensdruck zu bewältigen. Eine Behandlung der spezifischen Phobie wird dann zumeist als unnötig angesehen. Wenn der angstauslösende Reiz allerdings gehäuft in alltagsrelevanten Situationen auftritt (z.B. bei speziellen Berufen: Höhenangst bei einem Dachdecker, Flugangst bei einem Geschäftsreisenden), kann ein ausgeprägter Leidensdruck entstehen und eine Behandlung wird dann eher in Anspruch genommen (Angenendt, Frommenberger & Berger, 2004).
2.1.1 Diagnostische Kriterien und klinische Merkmale der spezifischen Phobien
Die beiden gegenwärtig bedeutendsten Klassifikationssysteme für psychische Störungen, das DSM-IV und das ICD-10, beschreiben die spezifischen Phobien mit einer recht hohen Übereinstimmung. Daher werden im Folgenden die Kriterien des DSM-IV als Klassifikationsgrundlage gewählt, die im Vergleich zu denen des ICD-10 etwas strikter ausfallen (siehe Abbildung 2.1). Das DSM-IV unterscheidet zudem insgesamt fünf Typen spezifischer Phobien, den Tier-Typus (Furcht vor Tieren, z.B. Spinnen, Schlangen, Hunde), den Umwelt-Typus (u. a. Furcht vor Höhen, Stürmen, Wasser, Dunkelheit), den Blut-, Spritzen- und Verletzungstypus (z.B. Furcht vor dem Anblick von Blut, Verletzungen, Furcht vor Injektionen oder invasiven medizinischen Behandlungen), den s ituativen Typus (u. a. Furcht in Flugzeugen, Fahrstühlen, engen geschlossenen Räumen) und den anderen Typus (Furcht vor Reizen, die zum Ersticken oder Erbrechen oder zum Erwerb von Krankheiten führen können).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1: Diagnostische Kriterien für das Vorliegen einer spezifischen Phobie (DSM-IV)
Spezifische Phobien treten gehäuft mit anderen Angststörungen auf. Mögliche komorbide Diagnosen sind z.B. die soziale Phobie, die Panikstörung mit und ohne Agoraphobie, aber auch die Hypochondrie. Meist sind die komorbiden Hauptdiagnosen und nicht die einzelne spezifische Phobie Anlass für eine therapeutische Behandlung (Becker, 2006).
2.1.2 Epidemiologie
Frederikson, Annas, Fischer und Wik (1996) geben eine totale Punktprävalenz für das Vorliegen einer spezifischen Phobie von 19.9% an. Die berichteten Prävalenzraten hängen sehr stark davon ab, welche Kriterien zur Diagnose und zur Einschätzung des Beeinträchtigungsgrades durch die Störung gewählt wurden. Perkonigg und Wittchen (1995) analysierten mehrere Einzelstudien und berichten zusammenfassend von einer Lebenszeitprävalenz für das Auftreten einer spezifischen Phobie von 4.5 - 11.3% (Median: 8.6%). In einer Studie von Wittchen und Jacobi (2005) wurde die 12-Monats-Prävalenz des Auftretens spezifischer Phobien in der Europäischen Union (N = 1500 000, aus 16 EULändern) untersucht und bei 6.4% der Teilnehmer dieser Studie wurden Hinweise für das Vorliegen einer spezifischen Phobie objektiviert.
Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer; die spezifischen Phobien sind das psychische Störungsbild, an dem Frauen am häufigsten leiden (Becker, 2006). Spezifische Phobien treten familiär gehäuft auf; 31% der Angehörigen ersten Grades haben ebenfalls eine spezifische Phobie. Je mehr Angststörungen komorbid vorliegen, desto stärker sind auch die Beeinträchtigungen für den Betroffenen und desto schlechter sind seine Remissionschancen. Spezifische Phobien entstehen in den ersten beiden Lebensjahrzehnten, die verschiedenen Subtypen der spezifischen Phobien haben unterschiedliche Onset-Alter. Klaustrophobie entsteht so relativ spät, im Durchschnitt im 20. Lebensjahr, wohingegen Tier- und Blutphobie sich bereits im siebenten bis neunten Lebensjahr manifestieren (Öst, 1987).
2.1.3 Ätiologie
Im Folgenden sollen kurz einige grundlegende Entstehungsfaktoren und aufrechterhaltende Bedingungen der spezifischen Phobien besprochen werden. Eine genauere Betrachtung möglicher Erklärungsmodelle erfolgt auch in den Abschnitten 2.2.3 und 2.3.3.
Einen unbestrittenen wesentlichen Einfluss auf den Erwerb spezifischer Phobien haben Lernerfahrungen, die Ergebnisse von Konditionierungsprozessen sind. Die Theorie der Furchtkonditionierung basiert auf den Annahmen der Zwei-Faktoren-Theorie, die Aspekte des klassischen und operanten Konditionierens vereinigt (Mowrer, 1949). Dieser Erklärungsansatz geht davon aus, dass traumatische Erlebnisse eine konditionierte Angstreaktion auf einen spezifischen Reiz auslösen können. Furcht wird demnach im ersten Schritt durch klassische Konditionierung erworben und im zweiten Schritt löst die erlernte Furchtreaktion ein Vermeidungsverhalten aus, welches durch die verhinderte Furchtreaktion negativ verstärkt wird (operante Konditionierung) und aufrecht erhalten bleibt. Diese Theorie wurde vor allem durch Befunde aus Tierexperimente gestützt (Becker, 2006). Zur Erklärung der Entstehung klinisch bedeutsamer spezifischer Phobien müssen zudem andere Erklärungsaspekte berücksichtigt werden. Die Konditionierung durch die Beobachtung ängstlicher Modelle (Lernen am Vorbild) und durch die Übermittlung negativer Nachrichten und Informationen (Instruktionslernen) erscheinen als weitere Erklärungsansätze des Angsterwerbs bei spezifischen Phobien plausibel (Becker, 2006). Zusammen ergeben diese unterschiedlichen Arten des Lernens das „Three Pathway Model of Fear Aquisition.“ Rachman (1977) beschreibt in diesem Modell drei Typen der Konditionierung, die letztendlich zu einem Erwerb einer spezifischen Phobie führen können: 1. die direkte klassische und operante Konditionierung, 2. das Modelllernen und 3. die Informationsübermittlung.
Poulton und Menzies (2002) gehen zudem davon aus, dass auch eine fehlende Bewältigung einer frühkindlichen Furchtdisposition zur Manifestation einer spezifischen Phobie beitragen kann. Spezifische Phobien treten gehäuft im Kindes- und Jugendalter auf und sind bei den meisten Kindern als vorübergehendes Phänomen zu beobachten. Nur bei Wenigen nimmt die Angst vor spezifischen Reizen und Situationen durch klassische Konditionierung, Modelllernen oder negative Informationsübertragung einen chronischen Charakter an. Durch kognitive Verzerrungen und Vermeidungsverhalten wird die spezifische Phobie aufrechterhalten (Merckelbach, de Jong, Muris & van den Hout, 1996).
Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Muris, Merckelbach, de Jongh & Ollendick, 2002) erklärt auch die auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen der spezifischen Phobien. Angst gilt als eine evolutionär grundlegende Reaktion, die eine Schutzfunktion für den Organismus übernimmt und biologisch und genetisch verankert ist. Die Vulnerabilität besteht nun darin, dass die Bereitschaft zur Entwicklung einer spezifischen Phobie vererbbar ist. Neben dieser Prädisposition (genetischer Anteil) spielen aber auch Umweltbedingungen (Lerngeschichte, Erziehungsstil, negative Lebensereignisse) eine ebenso entscheidende Rolle. Als aufrechterhaltende Bedingungen gelten das Vermeidungsverhalten und die Veränderungen, die sich bezüglich der Aufmerksamkeit und Interpretation ergeben können (Becker, 2006).
2.1.4 Diagnostik und Diagnoseinstrumente
Um eine spezifische Phobie in der klinischen Praxis diagnostizieren zu können, werden strukturierte Interviewleitfäden, wie z.B. das Diagnostische Interview bei psychischen Störungen (DIPS; Margraf, Schneider & Ehlers, 1994) oder das Strukturierte Klinische Interview nach DSM-IV (SKID; Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) angewendet. Im Zusammenhang mit diesen klassifikatorischen Diagnoseverfahren sollte auch eine Exploration der Furchtsymptomatik und des Vermeidungsverhaltens durchgeführt werden. Psychophysiologische Untersuchungen können die vegetativen Begleiterscheinungen (z.B. schnellerer Herzschlag, höherer Blutdruck und steigender Hautwiderstand) einer spezifischen Furchtreaktion sichtbar machen (Merckelbach, de Jong, Muris & van den Hout, 1996; Hamm, 2006). Mit Hilfe von Selbstbeurteilungsverfahren kann der Schweregrad einer spezifischen Phobie erfasst werden.
2.1.5 Behandlung
Die hier vorgestellten Behandlungsansätze sollen nur einen kurzen Einblick geben; detaillierte Beschreibungen des Behandlungsvorgehens für die Zahnbehandlungsphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie finden sich in den Abschnitten 2.2.6 und 2.3.6.
Die systematische Desensibilisierung nach Wolpe (1958) baut auf dem Mechanismus der konditionierten Hemmung auf. Die Furchreaktion wird schwächer, wenn in der Anwesenheit des gefürchteten Reizes eine antagonistische Reaktion, z.B. Entspannung, hervorgerufen wird. Der zu behandelnde Patient lernt zunächst eine Anspannungs- oder Entspannungstechnik (z.B. progressive Muskelentspannung nach Jacobson, 1938) und wird dann in sensu oder in vivo schrittweise mit der angstauslösenden Situation, die zuvor in eine ansteigende Angsthierarchie gebracht wurden, konfrontiert. Dieses Vorgehen ermöglicht eine schnelle Habituation an den zuvor angstauslösenden Reiz.
Ausgehend von den Überlegungen Wolpes (1958) zur Technik der systematischenDesensibilisierung (Wolpe, 1958) basiert die Behandlung spezifischer Phobien heute vor allem auf Techniken, die eine Konfrontation mit den angstauslösenden Reizen als zentrales Element beinhalten. Dabei wird zwischen der Reizkonfrontation in sensu und in vivo unterschieden, wobei die Exposition in viv o die Methode der Wahl bei der Behandlung vieler Phobien ist. Öst (1996) hat dieses Verfahren der Konfrontation gut standardisiert und eine Durchführung ist in nur vier bis fünf Therapiesitzungen durchführbar und zeigt langfristig stabile Erfolgsraten von 71 - 80%. Eine neuere Entwicklung zur Steigerung der Effektivität und Ökonomie ist die Virtual Reality Exposure Therapy, bei welcher visuelle Simulationen die Exposition in vivo ersetzen (Becker, 2006).
Ruhmland und Margraf (2001) haben in einer Metaanalyse acht verschiedene Arten zur Behandlung von spezifischen Phobien bezüglich ihrer Prä-Post-Effektstärken und der Dauerhaftigkeit der Therapieerfolge verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Behandlungsarten Desensibilisierung, Konfrontation, angewandte Entspannung und angewandte Anspannung und auch die kognitive Therapie sehr gute Effektstärken (d = 1.42 bis d = 2.06) für die Hauptsymptomatik aufweisen. Die Behandlung mit Stress- Management-Strategien und reine Informationsvermittlung zeigten hingegen wesentlich geringere Effektstärken und konnten in ihrer Wirksamkeit nicht bestätigt werden. Nach einem Jahr konnten für die Konfrontation und für angewandte Entspannung sowie die angewandte Anspannung stabile Behandlungserfolge objektiviert werden.
2.2 Zahnbehandlungsphobie
Die Zahnbehandlungsphobie (ZBP) gehört zur Gruppe der spezifischen Phobien, wobei die Zahnbehandlung und die zahnbehandlungsspezifischen Reize die angstauslösende Situation gestalten. Werden Zahnbehandlungsängstliche mit einer solchen Situation konfrontiert, löst diese unmittelbar Angst aus. Vermeidung ist eine Möglichkeit, um dieser Angst aus dem Weg zu gehen, sodass viele Zahnbehandlungsphobiker den Zahnarzt über lange Zeit (zumeist mehrere Jahre) nicht besuchen. Unregelmäßige Zahnarztbesuche oder eine komplette Vermeidung der Zahnbehandlung führen in der Folge zu einer mangelnden Zahngesundheit (Hakeberg, Berggren & Gröhndahl, 1993). Diese erhält das Vermeidungsverhalten aufrecht, da die Betroffenen nun den Zahnarzt auch meiden, weil sie sich wegen ihrer „schlechten Zähne“ schämen.
Nach Markgraf-Stiksrud (1996) können 75% der Allgemeinbevölkerung einen Zahnarzt nicht ohne starke bis mittlere Ausprägung der Angst besuchen. Die Zahnbehandlungsphobie bleibt als Störung oft unerkannt, weil es sich um eine psychische Erkrankung handelt, die aufgrund ihrer weiten Verbreitung kein gesellschaftliches Tabu darstellt (Jöhren & Sartory, 2006). Diese Angst vor einer regelmäßigen Zahnbehandlung hat weitreichende Konsequenzen für die Zahngesundheit und die Lebensqualität der Betroffenen, die eine Zahnbehandlung längerfristig vermeiden. Außerdem stellt die Zahnbehandlungsangst eines Patienten auch eine wesentliche Schwierigkeit für den behandelnden Zahnarzt dar, da Zahnbehandlungsängstliche im Durchschnitt 20% mehr Behandlungszeit benötigen als angstfreie Patienten (Filewich, Jackson & Shore, 1981). Die zahnmedizinische Versorgung von Angstpatienten bedeutet demnach nicht nur für den Patienten ein erhöhtes Stressniveau, auch der behandelnde Zahnarzt berichtet oftmals ein erhöhtes Stresserleben (Institut der deutschen Zahnärzte, 1996). Deshalb ist eine genauere Betrachtung dieses Störungsbildes nicht nur aufgrund des Leidensdrucks der Betroffenen, sondern auch aufgrund ökonomischer Gesichtspunkte für das Gesundheitssystem sinnvoll. Im Folgenden werden die diagnostischen Kriterien und Merkmale der Zahnbehandlungsangst, ihre Epidemiologie und Ätiologie, sowie Komorbidität, Behandlungsmöglichkeiten und Diagnoseinstrumente besprochen.
2.2.1 Definition sowie typische und spezifische Merkmale des Störungsbildes der Zahnbehandlungsphobie
Unterscheidung zwischen Zahnbehandlungsangst und Dentalphobie
Zu unterscheiden ist grundsätzlich zwischen einem bei fast allen Zahnarztpatienten während der Behandlung auftretenden Unbehagen und den Ausprägungen einer Zahnbehandlungsphobie. Dieses Angstgefühl ist individuell und auch situationsspezifisch sehr unterschiedlich und erstreckt sich auf einem Kontinuum. Enkling, Marwinski und Jöhren (2006) beschreiben die Zahnbehandlungsangst (ZBA) als ein nicht pathologisches Angstniveau, welches als Furcht im Zusammenhang mit der Zahnbehandlung oder zahnmedizinischen Reizen auftritt. Die Dentalphobie ist hingegen pathologischer Natur und durch ein hohes Angstniveau und die Vermeidung zahnmedizinischer Behandlung charakterisiert. Zahnarztpatienten, bei denen lediglich eine leichte Zahnbehandlungsangst vorliegt, ohne dass die Kriterien für eine spezifische Phobie erfüllt sind, sind durch ihr Angstgefühl weniger eingeschränkt und zahnärztlich leichter zu behandeln (Kvale et al., 2002).
Angstauslösende Situationen und Kognitionen
Als angstauslösende Reize gelten alle Objekte und Situationen, die während einer Zahnbehandlung auftreten können und die mit ihr assoziiert sind (Jöhren & Margraf- Stiksrud, 2002). Locker, Shapiro und Liddell (1997) befragten 1420 Kanadier und untersuchten Reize und Situationen, die sowohl bei Zahnbehandlungsphobikern als auch bei Probanden ohne Zahnbehandlungsphobie Angst auslösten. Am häufigsten wurden das Sehen der Nadel, das Gefühl beim Setzen der Spritze, das Gefühl beim Bohren, der Vorgang, eine Zahnfüllung zu bekommen, und die Zahnextraktion als angstauslösende Situationen benannt. Angstauslösende Kognitionen, die mit diesen Situationen einhergehen, beinhalten im Wesentlichen Schmerzerwartung, erwarteter Kontrollverlust und Gedanken, die mit der Wahrnehmung des eigenen Verhaltens durch das zahnmedizinische Personal einhergehen (de Jongh & ter Horst, 1993).
Stouthardt und Hoogstraten (1987) konnten bestätigen, dass vor allem mit steigender raum- zeitlicher Nähe und stärkerem Behandlungsbedarf das Angstniveau steigt. Gale (1972) hat hoch und niedrig Ängstlichen mögliche angstauslösende Reize in eine „Angstreihenfolge“ bringen lassen und festgestellt, dass hoch und niedrig Ängstliche die angstauslösenden Reize in der Zahnbehandlungssituation auf ähnliche Art und Weise anordnen und beurteilen und sich nur in der Wirkung, die diese Stimuli auf sie haben, unterscheiden.
Angstreaktion
Die auf den auslösenden Stimulus erfolgende Angstreaktion hat eine kognitive Komponente (z.B. negative Kognitionen und Schmerzerwartung), eine physiologische Komponente (Veränderungen auf physiologischer Ebene; z.B. Beschleunigung der Herzrate, Anstieg der Atemfrequenz und des Blutdrucks, Muskelanspannung und zunehmende Schweißbildung) sowie eine verhaltensbezogene Komponente (zentral ist hier das Vermeidungsverhalten und die fehlende Compliance während der zahnärztlichen Behandlung).
Vermeidungsverhalten
Als wesentliches Charakteristikum der Zahnbehandlungsphobie gilt das Vermeidungs- verhalten, welches viele Betroffene zeigen, um der angstauslösenden Zahnbehandlung zu entgehen. Für viele Autoren stellt die Vermeidung der Zahnbehandlung ein wesentliches Kriterium dar, das bei der Diagnose Dentalphobie vorliegen muss. Jedoch zeigte unter anderem die Studie von Vassend (1993), der 1288 Norweger befragte, dass viele Zahnbehandlungsphobiker trotz eines starken Angstgefühls regelmäßig den Zahnarzt besuchen. Zahnbehandlungsvermeider unterscheiden sich von regelmäßigen Zahnarzt- besuchern bezüglich ihrer selbstberichteten Reaktion in früheren zahnärztlichen Behandlungen, ihrer Schmerztoleranz während der Zahnbehandlung, ihrer Zustandsangst und in ihrer Überzeugung bezüglich der Wirksamkeit ihrer Copingressourcen (Klepac, Dowling & Hange, 1982). Schuurs, Duivenvoorden, van Velzen und Verhage (1984) befragten 438 25-jährige Amsterdamer und stellten fest, dass regelmäßige Zahnbehandlungen vom Ausmaß der Zahnbehandlungsangst, dem Geschlecht (Frauen besuchen Zahnarzt regelmäßiger als Männer) und der dentalen Erziehung durch die Eltern (regelmäßige Zahnarztbesuche in der Kindheit und regelmäßige Zahnarztbesuche der Eltern) abhängen. Weitere Studien der letzten Jahre haben untersucht, welche Faktoren regelmäßige Zahnbehandlungen begünstigen. In einer amerikanischen Untersuchung, bei der 630 Probanden befragt wurden, zeigte sich, dass vor allem die wahrgenommene Zahngesundheit, ein geringeres Angstniveau bezüglich der Zahnbehandlung und auch das Vorhandensein einer Zahnversicherung (die vom Einkommensniveau abhängt) im Zusammenhang mit einer regelmäßigeren Zahnbehandlung stehen (Sohn & Ismail, 2005). Jöhren, Enkling und Sartory (2005) haben 48 erwachsene Zahnbehandlungsphobiker untersucht und konnten zeigen, dass negative Kognitionen, irreale Vorstellungen, welche die Behandlung betreffen, sowie Depressionen und emotionale Komorbiditäten die Regelmäßigkeit der Zahnbehandlung nicht erklären konnten. Parameter, die 30% der Varianz des Vermeidungsverhaltens in dieser Studie aufklärten, waren das Vorhandensein einer externalen Kontrollüberzeugung, ein hohes Kontrollbedürfnis gegenüber einem geringen Kontrollerleben sowie die Anzahl der behandlungsbedürftigen Zähne.
Schuld und Schamgefühl
Die Vermeidung der Zahnbehandlung kann durch eine schlechter werdende Zahngesundheit und das daraus resultierende Schuld- und Schamgefühl verstärkt werden. Somit fungieren soziale Aspekte als aufrechterhaltende Bedingungen der Zahnbehandlungsangst. Moore, Brodsgaard und Rosenberg (2004) haben 30 Dentalphobiker befragt und festgestellt, dass das Angstniveau der Zahnbehandlungsangst auch im Zusammenhang mit der sozialen Beurteilung durch den Zahnarzt und durch andere und damit auch im Zusammenhang mit „versteckenden“ Verhaltensweisen (vorgehaltene Hand versteckt den Mund, Sprechen ohne das die Zähne sichtbar werden) steht.
Abbildung 2.2: Teufelkreis der Zahnbehandlungsangst nach Berggren (1984, S.248)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Je länger die Zahnbehandlung vermieden wird, desto stärker wird auch die emotionale Schuld- und Schamreaktion („Teufelskreis der Zahnbehandlungsangst“ nach Berggren, 1984, siehe Abbildung 2.2). Diese emotionale Reaktion erfüllt in machen Fällen auch die Kriterien für das Vorliegen einer sozialen Phobie und ist laut Moore et al. (2004) durch ein geringes Selbstwertgefühl, Tabu-Denken, ein gestörtes Selbstbild, ein schlechtes Gewissen, sozialen Rückzug und Persönlichkeitsveränderungen gekennzeichnet.
Gesundheitliche Folgen und eingeschränkte Lebensqualität
Zahnbehandlungsphobiker weisen eine deutlich schlechtere Zahngesundheit auf als nicht von Zahnbehandlungsangst Betroffene. In einer schwedischen Untersuchung zeigten Hakeberg, Berggren und Gröhndahl (1993), dass Zahnbehandlungsphobiker (durchschnittlich 4.4 fehlende Zähne, 19.5 kariöse Zähne und 13.1 gefüllte Zähne) eine wesentlich schlechtere Zahngesundheit hatten als die Kontrollgruppe (durchschnittlich 2.5 fehlende Zähne, 7.9 kariöse Zähne und 8.1 gefüllt Zähne) und andere Zahnpflegegewohnheiten berichteten (schnellere Entscheidung für Zahnextraktionen). Schuller, Willumsen und Horst (2003) konnten anhand der Fragebogendaten und Untersuchungsdaten zum Zahnstatus von 1365 Niederländern zeigen, dass Hoch- Zahnbehandlungsängstliche mehr fehlende oder beschädigte Zähne aufweisen als Niedrig- Zahnbehandlungsängstliche. Vor allem mit steigendem Alter nimmt die Zahngesundheit von Hoch-Zahnbehandlungsängstlichen im Vergleich zu Niedrig-Zahnbehandlungs- ängstlichen ab (Schuller et al., 1993). Zahnbehandlungsangst schränkt auch die psychische Gesundheit ein, sodass Zahnbehandlungsängste einen negativen Zusammenhang mit der Lebensqualität, dem psychischen Wohlbefinden, der Vitalität und dem sozialen Funktionsniveau aufweisen (Mehrstedt, Tönnies & Eisentraut, 2002). Cohen, Fiske und Newton (2000) haben 20 Zahnbehandlungsphobiker mit Hilfe von Interviews untersucht und kommen zu dem Schluss, dass die Dentalphobie auf das alltägliche Leben der Betroffenen einen breiten und dynamischen Einfluss nimmt, wobei fünf Bereichen (physiologischer, kognitiver, verhaltensbezogener, gesundheitlicher und sozialer Bereich) besonders stark betroffen sind. Cohen et al. (2002) beschreiben unter dem Aspekt des gesundheitlichen Einflusses auch Schlafstörungen, von denen Zahnbehandlungsängstliche aufgrund der Schmerzen oft betroffen sind. Im sozialen Bereich geben sie einen Einfluss der Zahnbehandlungsangst auf soziale Interaktionen (Kontaktvermeidung) und die Arbeitsleistung an (aufgrund der Schmerzen z.B. eingeschränkt). Nach Moore, Brodsgaard und Birn (1991) litten 66% der von ihnen untersuchten Dentalphobikern unter sozialen Hindernissen durch von der Zahnbehandlungsangst erzeugte Begleiterscheinungen und berichteten, nichts gegen diese tun zu können.
2.2.2 Epidemiologie
Die berichteten Prävalenzraten für das Vorliegen einer Zahnbehandlungsphobie schwanken stark und liegen im Mittel zwischen 5% und 10% (Jöhren & Sartory, 2006). Das liegt vor allem daran, dass viele Untersuchungen unterschiedliche Stichprobencharakteristika haben. Oft sind die Stichproben nur mit Vorsicht gegeneinander zu vergleichen, da sie aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Gesundheitssystemen stammen, die Alters- und Geschlechtszusammensetzung sehr unterschiedlich ist und verschiedene Erhebungsinstrumente verwendet wurden. Einen Überblick über die Prävalenzraten für das Vorliegen einer Zahnbehandlungsphobie aus verschiedenen Studien der letzten Jahre bietet Tabelle 2.1.
Die berichteten Prävalenzraten bewegen sich zwischen 4.2% und 13.6%. Bis auf zwei der hier aufgeführten Untersuchungen, die Prävalenzdaten berichten, haben alle Autoren mit Selbstbeurteilungsverfahren gearbeitet und nur in den Untersuchungen von Poulton et al. (1998) und Ragnarsson et al. (2003) wurde eine Diagnostik der Dentalphobie mit Hilfe der DSM-IV-Kriterien realisiert (Tabelle 2.1).
Zu beachten ist auch der Anteil derer, die eine Zahnbehandlung angstfrei erleben. Schabacker und Pohlmeier (1985) berichten lediglich von 5% Befragten, die zu einer Zahnbehandlung relativ angstfrei gehen. Jöhren und Margraf-Stiksrud (2002) fassen zusammen, dass 60 - 80% der Allgemeinbevölkerung den Zahnarzt nicht ohne ein Angstgefühl besuchen können, dass davon 20% als hoch ängstlich eingestuft werden können und dass von denen 5% die Zahnbehandlung komplett vermeiden und nach ICD-10 als Zahnbehandlungsphobiker klassifiziert werden können.
Die Ausprägung der Zahnbehandlungsangst steht in einem starken Zusammenhang mit soziodemografischen Variablen. Am stärksten Einfluss nimmt dabei das Geschlecht, da Frauen durchschnittlich wesentlich höhere Angstintensitäten bei einem Zahnarztbesuch berichten als Männer, dies konnten unter anderem die Untersuchungen von Enkling et al. (2006) und Eitner et al. (2006) zeigen. Diese Befunde wurden auch in zahlreichen anderen Studien belegt (Hakeberg et al., 1990; Vassend, 1993; Locker et al., 1997; Doerr et al., 1998; Schuller et al., 2003).
Lediglich die Ergebnisse von Kunzelmann und Dünninger (1990) und von Locker und Liddell (1991) geben ein anderes Bild wieder, da hier keine Unterschiede bezüglich des Geschlechts objektiviert werden konnten.
Tabelle 2.1: Prävalenzraten verschiedener Studien zur Zahnbehandlungsphobie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkung: Unterschiedliche Prävalenzraten, die in einer Studie berichtet werden, sind den verschiedenen Erhebungsinstrumenten zuzuordnen.
Das Niveau der Zahnbehandlungsangst scheint auch vom Alter abhängig zu sein. Locker, Shapiro und Liddell (1996) fanden Hinweise darauf, dass jüngere Befragte signifikant höhere Angstwerte berichteten als ältere. Eine signifikante Abnahme der Zahnbehandlungsangst mit dem Alter konnten auch Liddell und Locker (1997) zeigen, sie führen diese auf das geringere Kontrollbedürfnis der älteren Probanden im Vergleich zu den jüngeren zurück. Neben Geschlechterunterschieden in der Ausprägung der Zahnbehandlungsangst gaben Schuurs et al. (1985) an, dass geschiedene Frauen und Männer höhere Angstlevel berichteten als Verheiratete. Außerdem zeigten ihre Daten auch einen Zusammenhang der Ausprägung der Dentalphobie mit dem Bildungsniveau, da Probanden mit höheren Bildungsabschlüssen ein geringeres Angstniveau bezüglich der Zahnbehandlung berichteten. Locker und Liddell (1991) bestätigen den Zusammenhang zwischen Alter sowie Ehestatus und Zahnbehandlungsangst, finden aber keine Zusammenhänge mit dem Bildungs- und Einkommensniveau. Laut Doerr, Lang, Nyquist und Ronis (1998) sind sechs Faktoren eng mit Zahnbehandlungsangst assoziiert. Zu ihnen gehören: 1. unvorteilhafte Einstellungen dem Zahnarzt gegenüber, 2. unregelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen, 3. Unzufriedenheit mit der eigenen Zahngesundheit, 4. eine geringe Anzahl von Füllungen, 5. weibliches Geschlecht und 6. geringes Einkommensniveau. Zudem fanden Doerr et al. (1998) keinen Zusammenhang zwischen Zahnbehandlungsangst und Alter oder Bildungsniveau.
Das mittlere Alter, in dem sich eine Dentalphobie erstmals manifestiert, liegt bei 12 Jahren (Öst, 1987). Poulton, Waldie, Thomson und Locker (2001) untersuchten die Fragestellung, welche Faktoren Einfluss auf einen frühen oder späteren Onset der Dentalphobie haben und kommen zu dem Schluss, dass Persönlichkeitsvariablen nicht sehr stark mit dem Zeitpunkt des Onsets korrelieren. Entscheidend für das Onset-Alter ist laut der Autoren dieser Studie der Zeitpunkt eines konditionierenden Erlebnisses (im Sinne einer negativen Zahnbehandlungserfahrung), da ein früher Erwerb der Zahnbehandlungsangst mit höheren kumulativen Karieserfahrungen und negativerer Einstellung zur Zahnbehandlung einhergeht. Probanden, die einen späteren Onset der Zahnbehandlungsphobie berichteten, erlebten die erste Kariesbehandlung erst nach dem 15. Lebensjahr, haben dann aber stärkeren Bedarf für Zahnbehandlung (meist Verlust von mindestens einem Zahn), besuchen den Zahnarzt nur, wenn sie bereits Schmerzen haben und nicht regelmäßig zur Prävention, und haben eine externale Kontrollüberzeugung. Poulton et al. (1997) haben längsschnittlich untersucht, welche Faktoren auf das Manifestationsalter der Zahnbehandlungsangst wirken, und ihre Ergebnisse zeigten, dass die Länge der positiven Behandlungserfahrung beim Zahnarzt, bevor eine schmerzhafte Behandlung erlebt wurde, protektiven Charakter hatte. Längere Behandlungen stehen laut den Autoren im Sinne der Konditionierungstheorien auch in Verbindung mit einer Habituation an die angstauslösenden Reize.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die überwiegende Anzahl von Studienbefunden darauf hinweist, dass vor allem das Geschlecht und das Alter einen wesentlichen Einfluss auf den Ausprägungsgrad der Zahnbehandlungsangst haben.
2.2.3 Komorbidität
Die Dentalphobie tritt als spezifische Phobie gehäuft im Zusammenhang mit anderen Angststörungen auf. Berggren (1992) geht davon aus, dass Zahnbehandlungsphobiker über eine höhere generelle Ängstlichkeit verfügen und daher häufig multiple Angstdiagnosen aufweisen. Des Weiteren behauptet er, dass eine eher spezifische Zahnbehandlungsphobie erfolgreicher behandelt werden kann als eine Dentalphobie, die gemeinsam mit einer generalisierten Angststörung auftritt. Oftmals sind Zahnbehandlungsphobiker auch von einer weiteren Achse-I-Störung betroffen (Kaakko et al., 2000). Roy-Byrne, Milgrom, Khoon-Mei, Weinstein und Katon (1994) berichten Daten ihrer Untersuchung an 73 Patienten der Dental Fear Research Clinic in Washington, die 40% der Betroffenen eine weitere Achse-1-Diagnose zuordnen (20% Angststörung, 16% affektive Störung, 4% Substanzmissbrauch und 2% Essstörungen). Außerdem wurde bei 61% der Betroffenen eine Achse-II-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Lebenszeitprävalenz für eine andere psychische Erkrankung bei vorliegender Dentalphobie geben Roy-Byrne et al. (1994) mit 70% an. In der Untersuchung von Kaakko et al. (N = 106 mit Angst vor Injektion bei Zahnbehandlung) hatten 31.4% der Betroffenen (Roy-Byrne et al., 1994: 45%) mindestens eine weitere spezifische Phobie. In welchem Zusammenhang Zahnbehandlungsangst und andere Angststörungen stehen, untersuchten McNeil und Berrymann (1989). Sie stellten fest, dass Angst vor Verletzungen und geschlossenen Räumen sowie Angst vor Schmerzen in einem engen funktionalen Zusammenhang mit der Dentalphobie standen. Dentalphobie ist assoziiert mit Höhenangst, Angst vor geschlossenen Räumen, Flugangst und 22% der Zahnbehandlungsphobiker berichteten zwei oder mehr andere Angststörungen (Fiset, Melnick, Milgrom & Weinstein, 1989).
2.2.4 Ätiologie
Die ätiologischen Erklärungsmodelle der spezifischen Phobien finden sich auch bei der Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung der Zahnbehandlungsphobie wieder. Eine Reihe von Erklärungsansätzen, unter anderem Aspekte aus den klassischen Lerntheorien, den kognitiven Theorien und verschiedene Persönlichkeitsaspekte werden diskutiert. Ein umfassendes empirisch belegtes Erklärungsmodell der Dentalphobie existiert bisher noch nicht.
Grundlegend und von den meisten Forschern anerkannt ist ein traumatisches Zahnbehandlungserlebnis, das zu einem Angsterwerb führen kann. In diesem Sinne wirkt die Klassische Konditionierung, die durch die raum-zeitliche Kopplung eines unkonditionierten neutralen Stimulus (UCS) mit einem schmerz- oder angstauslösenden Stimulus (CS) zu einer konditionierten Furchtreaktion (CR) führen kann. Dieses Modell ist gerade durch seine Unterstützung durch die Befunde des Experimentes mit „Little Albert“ (Watson & Raynor, 1920) sehr umfassend und beliebt und wurde auch durch die Untersuchungsbefunde von Poulton et al. (1997) gestützt. Die Bedeutung angstauslösender Stimuli kann bei der Zahnbehandlungsangst über das Erleben einer traumatischen Situation erklärt werden. Davey (1989) konnte zeigen, dass Menschen ohne Zahnbehandlungsangst signifikant weniger Schmerzerfahrungen machen als Zahnbehandlungsängstliche. Das Ausmaß, in dem frühere Zahnbehandlungen als schmerzhaft und traumatisch erlebt werden, steht in einem engen Zusammenhang mit der Zahnbehandlungsangst (de Jongh, Muris, ter Horst & Duyx, 1995). Die meisten Zahnarztpatienten (76%) können sich an mindestens eine schmerzhafte Behandlung erinnern (Liddell & Grosse, 1998). Dentalphobiker berichten signifikant mehr traumatische Behandlungserlebnisse als angstfreie Patienten (de Jongh, Fransen, Oosterink-Wubbe & Aartman, 2006). Einige Autoren (de Jongh, Aartman & Brandt, 2003) diskutieren zudem, dass die traumatischen Erlebnisse bei der Zahnbehandlung der posttraumatischen Belastungsstörung ähnliche Symptome (z. B. Intrusionen und Gedankenvermeidung) auslösen konnten. De Jongh et al. (2006) gehen soweit zu behaupten, dass die Zahnbehandlungsphobie als milde Form einer posttraumatischen Belastungsstörung gesehen werden kann.
Wesentlichen Erklärungsgehalt bietet auch das Modelllernen, welches besagt, dass ein Angsterwerb auch durch das Beobachten anderer und die Übernahme von deren Verhaltensweisen erfolgen kann. Untersuchungen dazu haben sich auf die Beobachtung ängstlicher Kinder und des Verhaltens ihrer Eltern (vor allem die Zahnbehandlungsangst der Mütter) konzentriert und konnten zeigen, dass Kinder von ängstlichen Elternteilen stärkere Angst vor der Zahnbehandlung berichteten als Kinder von angstfreien Eltern (Bailey, Tibot & Taylor, 1973). Auch konnte gezeigt werden, dass negative Einstellungen zur Zahnbehandlung durch einfache Informationsübermittlung von anderen Personen übernommen werden, selbst dann, wenn man zuvor noch nie zahnärztlich behandelt wurde (Jöhren, Landmesser, Jackowski & Jordan, 1997). Nach Kleinknecht, Klepac und Alexander (1973) ist vor allem die Familie entscheidend bei der Entstehung der Zahnbehandlungsangst beteiligt.
Auch hier kann das „Three Pathway Model of Fear Aquisition“ nach Rachman (1977) als Erklärungsansatz für die Entstehung der Zahnbehandlungsphobie gesehen werden. Dieses Modell wird auch durch die Befunde von Öst und Hugdahl (1985) unterstützt, die nachweisen konnten, dass 69% der von ihnen untersuchten Probanden ihre Zahnbehandlungsangst über Konditionierungserlebnisse erworben haben, dass 12% Modelllernen als Ursprung angaben und 6% Hinweise auf einen Angsterwerb über Informationsvermittlung berichteten.
Weiner und Sheehan (1990) unterteilen die Aspekte, die zum Erwerb einer Dentalphobie führen können, in eine exogene und eine endogene Kategorie. Zu den exogenen Erwerbsfaktoren zählen sie vor allem den Erwerb durch ein traumatisches Behandlungserlebnis oder über Modelllernen. Daher ordnen sie den exogenen Erwerbsbedingungen auch eher einen Erwerbzeitpunkt im Kindesalter zu. Als endogenen Erwerbsfaktoren benennen Weiner et al. (1990) eine Vulnerabilität des Individuums für den Erwerb einer Angsterkrankung und eine hohe generelle Ängstlichkeit. Den Zeitpunkt der Erstmanifestation dieses endogenen Typus des Angsterwerbs sehen die Autoren so eher im Erwachsenenalter.
De Jongh, Muris, ter Horst, van Zuuren und de Wit (1994) fanden einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der negativen Kognitionen und der Zahnbehandlungsangst (r = .82). Hoch ängstliche Zahnarztpatienten haben aber nicht nur mehr negative Kognitionen, sie können diese auch schlechter kontrollieren als Patienten mit geringer Zahnbehandlungsangst (de Jongh et al., 1994; Muris, de Jongh, van Zuuren & ter Horst, 1994). Basierend auf diesen Ergebnissen haben de Jongh et al. (1995) den Dental Cognition Questionnaire (DCQ, siehe Abschnitt 2.2.5) zur Erfassung der negativen Kognitionen entwickelt. Demnach ist vor allem die Kontrolle der negativen Gedanken ein Ansatzpunkt für das therapeutische Vorgehen bei der Behandlung der Dentalphobie. De Jongh und ter Horst (1993) untersuchten 32 Zahnbehandlungsängstliche bezüglich ihrer Gedanken im Hinblick auf eine Zahnbehandlung. Fast alle Probanden berichteten negative oder katastrophisierende Gedanken und Selbstverbalisationen. Zu den Gedankentypen (die Autoren unterscheiden neun Bereiche), die stark mit der Zahnbehandlung assoziiert sind und von den Befragten berichtet wurden, gehörten „Gedanken über das eigene Verhalten“, „Gedanken über die eigenen Zähne“ und „Gedanken über die Behandlung / Schmerzen.“ Nach dem „Cognitive Model of Emotional Disorders“ (Beck, 1976) ist vorstellbar, dass die kognitiven Prozesse, die im Zuge der Zahnbehandlungsangst auftreten, auch wie in Abbildung 2.3 beschrieben werden könnten.
Abbildung 2.3: Kognitive Aspekte der Zahnbehandlungsangst (nach de Jongh et al., 1994)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Unterschätzung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens positiver Ereignisse während der Zahnbehandlung durch Zahnbehandlungsängstliche konnte auch Kent (1985) nachweisen. Er vermutete außerdem, dass nicht die Anzahl negativer Kognitionen zwischen hoch und niedrig ängstlichen Patienten differenziert, sondern dass der Glaube an die Kontrollierbarkeit dieser negativen Kognitionen eine Unterscheidung zwischen Dentalphobikern und niedrig ängstlichen Zahnarztpatienten ermöglicht. Die Überschätzung des Auftretens negativer Konsequenzen durch den Angstpatienten ist eine Bedingung, welche die Manifestation der Dentalphobie aufrechterhält. Kunzelmann et al. (1990) gehen davon aus, dass die Ab- bzw. Anwesenheit von Schmerzen ein wichtiges Kriterium für das Angsterleben und die Anzahl der negativen Kognitionen ist (Korrelation zwischen Zahnbehandlungsangst und dentalen Kognitionen r = .39). Patienten mit katastrophisierenden Gedanken erlebten in einer Untersuchung von Sullivan und Neish (1999) mehr emotionalen und schmerzbezogenen Stress als Patienten ohne katastrophisierende Gedankeninhalte.
Locker, Shapiro und Liddell (1999) kommen hingegen zu dem Schluss, dass negative Kognitionen bezüglich der Zahnbehandlung nicht spezifisch gehäuft oder stärker bei Zahnbehandlungsphobikern auftreten, sondern dass in der Allgemeinbevölkerung scheinbar die meisten Menschen negative Gedanken bezüglich der zahnärztlichen Behandlung haben.
Ein weiterer Aspekt, der die Entstehung und Aufrechterhaltung der Dentalphobie erklären kann, ist die Schmerzerwartung. Zahnbehandlungsphobiker unterscheiden sich bezüglich ihrer Schmerzerwartung von Patienten, die keine Zahnbehandlungsangst haben. So konnte Wardle (1984) zeigen, dass angstfreie Patienten richtige Erwartungen bezüglich des Zahnschmerzes hatten; Zahnbehandlungsängstliche hatten hingegen übertriebene Schmerzerwartungen. Die Angst vor Schmerzen korreliert positiv mit dem Ausmaß der Zahnbehandlungsangst (McNeil et al., 1989). Kleinknecht und Bernstein (1978) konnten in einer Stichprobe von 128 Probanden (die kurz vor einer Zahnbehandlung untersucht wurden) nachweisen, dass hoch ängstliche Patienten eine wesentlich größere Schmerzerwartung hatten als niedrig ängstliche Probanden. Einen Zusammenhang zwischen Schmerzempfindlichkeit und erlebter Schmerzintensität, welche wiederum das Vermeidungsverhalten beeinflusst, beschreibt Gross (1992). Die Erwartungsangst, die im Zusammenhang mit der Schmerzerwartung steht, scheint vor allem im Hinblick auf die aufrechterhaltenden Bedingungen der Dentalphobie eine Rolle zu spielen. Da es aber auch niedrig ängstliche Patienten mit einer Reihe von Schmerzerfahrungen gibt, ist die Schmerzerwartung kein Aspekt, der die Entstehung der Zahnbehandlungsangst eigenständig erklären kann (Jöhren & Sartory, 2002)
Einfluss auf die Manifestation der Dentalphobie haben, neben den bereits beschriebenen soziodemografischen Variablen (Abschnitt 2.2.2), auch Aspekte, die mit Persönlichkeitsmerkmalen in Zusammenhang gebracht werden können.
Das Niveau der generellen Ängstlichkeit als eine Persönlichkeitseigenschaft hat Einfluss auf die Entwicklung einer Dentalphobie. Personen, die generell sehr ängstliche Reaktionen zeigen, weisen auch bezüglich der Zahnbehandlung ein gesteigertes Angstniveau auf (Brandon & Kleinknecht, 1982). Berggren (1992) fand empirisch einen Zusammenhang zwischen genereller Ängstlichkeit und Zahnbehandlungsangst. Er behauptet außerdem, dass eine hohe generelle Ängstlichkeit mit einer schlechteren Behandlungsprognose und mit einer größeren Anzahl von komorbiden Angsterkrankungen einhergeht. Auch spielt die generelle Ängstlichkeit für die längerfristige Aufrechterhaltung der Dentalphobie eine Rolle. So konnten Liddell und Locker (1994) in einer Stichprobe mit über 50-Jährigen zeigen, dass ältere Probanden mit Dentalphobie sich von Probanden, die früher mal dentalphobisch waren (gegenwärtig angstfrei), bezüglich des Ausmaßes an genereller Ängstlichkeit unterschieden.
In der Situation der Zahnbehandlung spielt für viele Patienten auch eine Rolle, dass sie während der Behandlung die Kontrolle größtenteils an den behandelnden Zahnarzt übertragen (Angst vor Kontrollverlust). Dass Zahnbehandlungsangst in einen Zusammenhang mit dem Kontrollbedürfnis des Betroffenen gebracht werden kann, haben unter anderem Liddell et al. (1997) bestätigt. Einen Hinweis auf die Bedeutung des erlebten Kontrollverlustes durch den Patienten gibt auch die Untersuchung von Corah, Bissell und Illig (1978). Sie konnten zeigen, dass das erlebte Stressniveau sinkt, wenn man dem Patienten während der Behandlung über ein „Stoppsignal“ die Möglichkeit gibt, die Behandlung zu unterbrechen und so die Angst vor einem Kontrollverlust minimieren kann. Eigenschaften und Verhaltensweisen des behandelnden Zahnarztes und der gesamte zahnärztliche Kontext sind bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Zahnbehandlungsphobie nicht zu vernachlässigen (Jöhren & Margraf-Stiksrud, 2002).
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Dentalphobie in ihrer Entstehung multikausale Ursachen haben kann und dass vor allem lerntheoretische und kognitive Aspekte, aber auch Persönlichkeitsvariablen und soziodemografische Faktoren wesentlich an der Manifestation und Aufrechterhaltung der Dentalphobie beteiligt sind.
2.2.5 Diagnostik und Diagnoseinstrumente
Die Zahnbehandlungsphobie wird als spezifische Phobie nach DSM-IV und ICD-10 klassifiziert. Auffallend ist aber, dass in beiden Diagnosesystemen die Dentalphobie in der Kategorie der spezifischen Phobien nicht explizit erwähnt wird. Hamm (2006) empfiehlt die Zuordnung zum Blut-, Spritzen- und Verletzungstypus nach DSM-IV aufgrund der ähnlichen Symptomatik und wegen der gleichenden Therapieindikation. Da sich die Dentalphobie aber in wesentlichen Aspekten von der Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie unterscheidet (Abschnitt 2.4), bleibt diese Zuordnung zweifelhaft.
Abbildung 2.4: Seattler Diagnosesystem der Zahnbehandlungsangst nach Milgrom et al. (1985) mit Ergänzung von Moore et al. (1991, S. 58) Milgrom, Weinstein, Kleinknecht und Getz (1985) haben das Seattler Diagnosesystem für die Zahnbehandlungsangst entworfen (siehe Abbildung 2.4), welches als zentrales Element die Kategorisierung des Ursprungs der Dentalphobie beinhaltet.
Die Studien von Moore et al. (1991) und Locker et al. (1999) ergaben Hinweise darauf, dass vor allem Kategorie I sehr häufig diagnostiziert wird und dass Frauen vorwiegend in den Kategorien II und III klassifiziert werden. Jüngere werden häufiger als Typ I kategorisiert und Ältere häufiger als Typ III.
Moore et al. (1991) schlagen außerdem vor, die Zahnbehandlungsphobiker in zwei Subkategorien nach DSM-IV einzuordnen, die den Ursprung der Dentalphobie beschreiben, 1. Zahnbehandlungsangst als konditionierte Phobie mit sozialen und spezifischen Aspekten und 2. Zahnbehandlungsangst im Zuge einer generellen Ängstlichkeit, die durch das Vorliegen multipler Phobien verkompliziert wird.
Zur Diagnostik der Zahnbehandlungsphobie als spezifische Phobie gehört die Betrachtung der Reaktionskomponenten der drei Ausdrucksebenen der Angst (Verhalten, Physiologie, Kognitionen). Grundsätzlich kann man auch zur Diagnose einer Dentalphobie objektive sowie subjektive Verfahren heranziehen. Objektive Verfahren umfassen die Bestimmung biochemischer Indikatoren der Angstreaktion (z.B. Konzentration von Seretonin, Katecholaminen und Lactat). Sehr gut geeignet ist auch die Überprüfung physiologischer Indikatoren (Pulsratenbeschleunigung, ansteigender Blutdruck, elektrodermale Hautleitfähigkeit und Atemfrequenz). Diese objektiven Diagnoseverfahren werden vorrangig bei wissenschaftlichen Untersuchungen eingesetzt. Im praktischen Setting sollte als objektives Verfahren eine Verhaltensbeobachtung bezüglich der Mimik, Gestik und Körperhaltung (z.B. nach den Klassifikationskriterien nach Frankl, 1962) des Betroffenen vorgenommen werden (Jöhren & Sartory, 2006). Um das Vorliegen einer Zahnbehandlungsphobie schon vor der Konfrontation mit der angstauslösenden Situation zu erfassen, werden Selbstbeurteilungsverfahren eingesetzt, um einen Überblick über das Ausmaß der bestehenden Angst erhalten zu können. Diese subjektiven Verfahren können zwar verzerrte Antworten zur Folge haben (durch z.B. Tendenzen der sozialen Erwünschtheit), aber sie sind ökonomisch einsetzbar und verfügen über eine ausreichend hohe Validität und Reliabilität.
Das älteste Verfahren zur Erhebung der Zahnbehandlungsangst ist die Dental Anxiety Scale (DAS) von Corah (1969). Die DAS besteht aus vier Fragen mit je fünf Antwortalternativen. Wie den meisten Verfahren zur Erhebung der Dentalphobie liegt ihr kein theoretisches Konzept oder Konstrukt zugrunde, außerdem bleibt die Dentalphobie undefiniert. Dieses Verfahren ermöglicht eine ökonomische Durchführbarkeit und differenziert in niedrig, mittel und hoch ängstliche Patienten. Die Diagnoseergebnisse geben nur einen kurzen Einblick, da mit der DAS nur ein begrenzter Informationsgehalt gewonnen werden kann. Die DAS findet auch aktuell noch breite Anwendung im englischsprachigen Forschungsraum. Für die deutsche Übersetzung gibt es bisher noch keine Daten, welche Aussagen zur Reliabilität und Validität des Verfahrens zulassen (Jöhren & Sartory, 2006).
Aufgrund der undifferenzierten Betrachtung der einzelnen angstauslösenden Situationen im DAS wurde das Dental Fear Survey (DFS: Kleinknecht et al., 1973) entwickelt. Das DFS ist ein weit verbreitetes englischsprachiges Erhebungsinstrument für die Zahnbehandlungsangst und besteht aus 20 Items, welche auf einem fünfstufigem Antwortformat beantwortet werden und angstbedingte Verhaltensweisen, physiologische Reaktionen und Gefühle bezüglich der Zahnbehandlung erfassen.
Der Dental Cognition Questionnaire (DCQ) wurde 1995 von de Jongh, Muris, Schoenemakers und ter Horst entworfen und umfasst 38 Items, welche negative Kognitionen erfassen sollen, die während einer Zahnbehandlung auftreten können. Die Iteminhalte beziehen sich auf die Persönlichkeit des Befragten, die Eigenschaften des Zahnarztes und auf die Behandlung an sich. Jedes Item kann vom Befragten mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden, zudem ist eine Einschätzung der Glaubhaftigkeit der Aussage (variierend zwischen 0 und 100%) vorhanden. Die Daten für die Reliabilität (RetestReliabilität r = .83 und interne Konsistenz = .89) sowie die Validität (konvergente Validität zum State-Trait-Angstinventar von Spielberger et al., 1972 betrug r = .58) waren zufriedenstellend (de Jongh et al., 1995). Eine Selbsteinschätzung des eigenen Angstniveaus ist auch mit der Visuellen Analogskala (VAS) möglich. Diese hat den Umfang von 0 (keine Angst) bis 100 (so starke Angst, dass man glaubt sterben zu müssen). Ein deutschsprachiges Verfahren, dass die Zahnbehandlungsangst erfasst, ist der Hierarchische Angstfragebogen (HAF) von Jöhren (1999), der mit elf Fragestellungen und einem fünfstufigem Antwortformat in vielen neueren deutschsprachigen Untersuchungen als Screeningverfahren der Dentalphobie eingesetzt wird.
Des Weiteren wurden in vielen, vor allem älteren, englischsprachigen Untersuchungen seltener auch das Dental Anxiety Inventory (DAI; Stouthardt, 1989), Weiners (1990) FearQuestionnaire (FQ), sowie die 10-point-Dental-Fear-Scale (Gatchel, 1989) und ein singleitem -Format verwendet (Schuurs & Hoogstraten, 1993).
In der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Dentalphobie sollten stets mehrere Fragebogenverfahren in eine Erhebung eingeschlossen werden (Newton & Buck, 2000), da die Übereinstimmung der Ergebnisse, welche diese Erhebungsverfahren erbringen, nicht ausreichend hoch ist. So berichten Locker et al. (1996), dass die einzelnen Verfahren zwar für sich genommen auch in verschiedenen Populationen stabile Prävalenzangaben liefern, aber die Messinstrumente im Vergleich nicht die gleichen Aspekte der Zahnbehandlungsangst erfassen.
2.2.6 Behandlung
Ziel einer jeden Behandlung der Dentalphobie ist eine Reduktion des Angsterlebens des Betroffenen in einer Zahnbehandlungssituation sowie das Erreichen der Aufgabe von Vermeidungsstrategien und die Ermöglichung einer regelmäßigen zahnmedizinischen Versorgung. Folgend sollen nun einige Behandlungsmöglichkeiten kurz erläutert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit betrachtet werden. Zunächst erfolgt ein kurzer Einblick in die medikamentösen Behandlungsmethoden und im Anschluss werden die psychotherapeutischen Interventionsmöglichkeiten vorgestellt.
Problematisch ist eine Behandlung der Dentalphobiker, weil sie zumeist erst mit einem stark ausgeprägten Leidensdruck zahnmedizinische Behandlung aufsuchen und dann eine medizinisch intensive Intervention größtenteils unumgänglich ist. Eine medikamentöse Behandlung kann zwei Ziele verfolgen: zum einen die Verminderung der Angstgefühle und zum anderen eine Schmerz reduzierende Indikation. Die Vollnarkose wird von vielen Dentalphobikern gewünscht, da sie sowohl die Angst als auch den Schmerz ausschaltet. Jedoch konnte nachgewiesen werden, dass die Behandlung unter Vollnarkose zu keiner Verbesserung der Zahnbehandlungsangst führt, da sie das Bewusstsein komplett ausschaltet und nicht zulässt, dass neue Verhaltensweisen zum Umgang mit der angstauslösenden Situation gelernt werden können (de Jongh, Adair & Meijerink- Anderson, 2005). Lokale Betäubungsspritze oder „Kältesprays“ wirken vor allem auf die Schmerzempfindlichkeit und verbessern auch die Behandelbarkeit hoch ängstlicher Patienten. Zur kurzfristigen Reduktion des Angsterlebens wurden seit den 1980er Jahren vermehrt auch Sedativa und Anxiolytika (z.B. Benzodiazepine: Midazolam) eingesetzt. Zu beachten bleibt aber, dass all diese medikamentösen Interventionen mehr oder weniger starke Nebenwirkungen haben können und ihre anxiolytische Wirkung mit dem Nachlassen des Wirkens der Substanzen im Körper wieder verlieren (Thom, Sartory & Jöhren, 2000).
Die psychotherapeutische Behandlung der Zahnbehandlungsphobie kann ebenfalls eine anxiolytische und eine Schmerz reduzierende Indikationsstellung verfolgen. Wie auch bei den spezifischen Phobien sind vor allem Konfrontationsverfahren wie die systematische Desensibilisierung (siehe Abschnitt 2.1.5) zur Behandlung der Zahnbehandlungsphobie geeignet (Kvale et al. 2002). Zur Behandlung der Dentalphobie wird diese heute aber kaum noch eingesetzt, zwar verfügt sie über hohe Erfolgsraten von 70 - 95% (Sartory, 1997), jedoch werden meist kostengünstigere und weniger zeitintensive Verfahren gewählt. Bei einem Angsterwerb durch ein traumatisches Erlebnis eignet sich die Expositionin vivo (de Jongh, van der Burg, von Overmeier, Aartman & van Zuuren, 2002) zur Behandlung der Dentalphobie. Eine besondere Form der Exposition in vivo ist die Reizüberflutung, bei welcher die Betroffenen sofort mit dem am stärksten angstauslösenden Reiz konfrontiert werden. Die Dentalphobie ist auch durch Techniken des Modelllernen s gut behandelbar (Melamed, Weinstein & Hawes, 1975). Mittelmäßige Erfolgsraten hat eine Behandlung mit Hilfe eines Stressmanagementtraining s, bei dem vor allem das Erlernen von Entspannungstechniken („angewandte Entspannung“) und das Aneignen von Bewältigungsstrategien (z.B. zur Kontrolle negativer Kognitionen oder der physiologischen Erregung) vordergründig sind. Jerremalm, Jansson und Öst (1986) nahmen an, dass die individuellen Reaktionsmuster der betroffenen Zahnbehandlungs- phobiker eine wichtige Rolle bei der Behandlung der Phobie spielen. Sie haben ihre 37 Probanden (alle litten unter starker Dentalphobie) in eher kognitive und eher physiologische Responder unterteilt und entsprechend mit kognitiv (Selbstinstruktions- training, Abbau negativer Kognitionen) und mit physiologisch (angewandtes Entspannungstraining) orientierter Therapie behandelt. Ihre Hypothese konnten die Autoren jedoch nicht bestätigen, da es keine größeren Behandlungserfolge gab, wenn die Behandlungsmethode dem Reaktionstypus des Patienten angepasst wurde. Einen Vergleich zwischen kognitiver Therapie und Verhaltenstherapie unternahmen Getka und Glass (1992) und kamen zu dem Schluss, dass beide Therapieformen sehr effektiv sind und auch im 1-Jahres-Follow-up zu einer Verbesserung der Dentalphobie und zu regelmäßigeren Zahnbehandlungen führen.
Berggren und Carlsson (1984) haben ein „psychophysiologische Therapie für die Angst vor dem Zahnarzt“ entwickelt. Diese besteht aus systematischer Desensibilisierung, EMGBiofeedback und Modelllernen durch Videotapes und kann im Vergleich zu einer Behandlung unter Vollnarkose auf bessere Effektstärken auch im 2-Jahres-Follow-up verweisen (Berggren & Linde, 1984).
Eine ökonomische Form der psychotherapeutischen Intervention ist die Kurzintervention (one session treatment), die de Jongh et al. 1995 publizierten. Die einstündige Intervention basiert auf den Mechanismen der kognitiven Umstrukturierung und ist sehr effektiv und lang anhaltend wirksam. Im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe und zu einer Gruppe von Probanden, die lediglich Informationen über die Dentalphobie erhielten, zeigte die einstündige kognitive Umstrukturierung nach de Jongh et al. (1995c) einen klaren Rückgang der Zahnbehandlungsangst und der mit ihr einhergehenden negativen Kognitionen.
Auch Thom et al. (2000) haben eine Kurzintervention entwickelt, welche aus fünf Komponenten besteht (1. Psychoedukation / Information, 2. Entspannungstraining, 3. Stressimpfungstraining, 4. Selbstverbalisation und 5. Hausaufgaben) und in 90 Minuten durchgeführt werden kann. Nach dieser psychologischen Kurzintervention konnten 70% der Betroffenen eine Zahnbehandlung durchführen lassen (Thom et al., 2000). Willumsen, Tiril, Vassend und Hoffart (2001) haben die kurzfristige Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie, der angewandten Entspannung und der konventionellen pharmakologischen Betäubung miteinander verglichen und kommen zu dem Ergebnis, dass alle drei Verfahren vergleichbar gut kurzfristig wirksam die Angst reduzieren.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dipl. Psych. Maria Weigel (Autor:in), 2007, Der Zusammenhang zwischen Zahnbehandlungsphobie und Blut-, Spritzen- und Verletzungsphobie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186495
Kostenlos Autor werden
















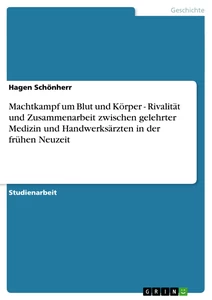


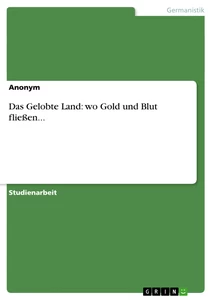


Kommentare