Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was sind Essstörungen? Erscheinungsformen, Symptomatik und mögliche Folgeschäden
2.1. Anorexia nervosa/ Magersucht
2.2. Bulimia nervosa/ Bulimie
2.3. Binge Eating Disorder/ Ess-Sucht
2.4. Orthorexia nervosa
3. Warum treten Essstörungen auf? Hintergründe und Erklärungsansätze
3.1. Psychologische Faktoren
3.2. Familiäre Faktoren
3.3 Gesellschaftlicher Hintergrund
3.3.1. Der Traum vom gesunden Körper
3.3.2. Das Schönheitsdiktat der Medienwelt
3.3.3. Wandel der Esskultur
3.3.4. „Fit statt fett“ - Bundesregierung greift in die Ernährungs- debatte ein
3.4. Lebensphase Adoleszenz: Der schwierige Schritt ins Erwachsenenleben
3.4.1. Körperliche Veränderungen
3.4.2. Geschlechtsidentität: männliche und weibliche Rollenanforderungen
3.4.3. Autonomie und Ablösung vom Elternhaus
3.4.4. Einfluss der Peergroup
3.5. Lebensgeschichtliche (traumatische) Faktoren
4. Zwischenbilanz: Welche Konsequenzen ergeben sich für die Arbeit im schulischen Bereich?
5. Essstörungen im schulischen Kontext - Theoretischer Teil -
5.1. Bildungsauftrag der Schule
5.2. Präventive Maßnahmen
5.2.1. Primärprävention
5.2.1.1. Essstörungen als Unterrichtsgegenstand
5.2.1.2. Themenspezifische Projekttage, Workshops und AGs
5.2.1.2.1. Workshop des Mädchenhaus Heidelberg e.V
5.2.1.2.2. Mädchen-AG „Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin“
5.2.1.2.3. Medienkritisches Fotoprojekt „Was heißt hier schön?“
5.2.2. Sekundärprävention
5.2.2.1. Wie erkennt man als Lehrer Essstörungen?
5.2.2.2. Das erste Gespräch
5.2.2.3. Weiterführende Schritte auf dem Weg zur Therapie
6. Zum empirischen Teil
6.1. Untersuchungsmethode
6.2. Auswahl der Probanden und Durchführung der Interviews
6.3. Fragestellung und Zielsetzung
6.4. Auswertung der Interviews
6.4.1. Lehrerin
6.4.2. Schulpsychologe
6.4.3. Ehemalige Betroffene
6.5. Fazit der Interviewauswertung
7. Schlussbetrachtung und Ausblick
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Fit statt fett“ - So lautet die Devise der Bundesregierung im Kampf gegen das Übergewicht der Deutschen. Besonders an Schulen sehen Politiker großen Handlungsbedarf, denn statistisch betrachtet ist jedes dritte bis vierte Kind im früheren Schulalter übergewichtig oder adipös (vgl. Marti 2006, S. 44). Diese und ähnliche Meldungen hat man in letzter Zeit immer öfter vernommen. Schlagzeilen wie „Deutschlands Nachwuchs - Immer dicker und träger“, „Generation XXL“, „Übergewicht macht unsere Kinder krank“ sowie eine steigende Tendenz von ernährungsratgeberischen Sendungen („Du bist was du isst“/ RTL 2, „Besser essen - Leben leicht gemacht“/ Pro 7, „Liebling, wir bringen die Kinder um“/ RTL 2) sind prägend für unsere moderne Gesellschaft. Doch was ist mit den jungen Menschen, die Jahr für Jahr dem gängigen Schlankheitsideal nacheifern und sich und ihren Körper in einen zum Teil lebensbedrohlichen Zustand hungern? Was ist mit den Menschen, die nach außen hin ideal wirken, aber nach jeder Mahlzeit verschwinden, um das Essen zu erbrechen? Diesen Menschen wird bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Fakt ist: Das Thema Ernährung rückt immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit und gewinnt stetig an Bedeutung. Tagtäglich wird man mit neuen Informationen über aktuelle Diäten und Gesundheitsempfehlungen konfrontiert. In einer Zeit, in der Gesundheitsbewusstsein mehr denn je gefragt ist und Diäten so allmächtig und präsent sind, dass sie als völlig normal empfunden werden, begegnet man teilweise der Auffassung, die ausgiebige Auseinandersetzung junger Mädchen mit Nahrung und Kalorien sei nichts weiter als eine Modeerscheinung unter Jugendlichen und folglich nicht weiter besorgniserregend. Wenn man jedoch in Betracht zieht, dass sich heutzutage bereits 50% der 11- bis 13-jährigen Mädchen als zu dick empfinden und 40% der 11- bis 19-jährigen Mädchen schon Diäterfahrungen haben (vgl. Pauli/ Steinhausen 2006, S. 17), so wird deutlich, dass es sich um ein ernstzunehmendes Problem handelt, welches in einen breiteren Zusammenhang eingeordnet werden muss. An diesem Punkt soll die vorliegende Arbeit ansetzen, die sich zum Ziel gemacht hat, das Thema Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen unter mehreren Blickpunkten zu beleuchten. Zum einen geht es mir um das Hinterfragen des Kontexts, in dem Essstörungen bei Heranwachsenden entstehen, und zum anderen soll darauf aufbauend eine Analyse pädagogischer Interventionsmöglichkeiten folgen. Zentrales Anliegen für mich als angehende Lehrerin ist es, für die Thematik Essstörungen zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass Probleme im Essverhalten von Heranwachsenden kein zu bagatellisierendes Phänomen darstellen, sondern neben der Gewalt- und Drogenthematik auch in den Schulalltag integriert werden sollten.
In meiner Arbeit werde ich mich den drei wesentlichen Essstörungen Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Bulimie bzw. Ess-Brech- Sucht) und Binge Eating Disorder (Ess-Sucht) widmen. Nur am Rande soll auch auf das Phänomen der Orthorexia nervosa, einer vergleichsweise neuen Essstörung, bei der das zwanghafte Beschäftigen mit gesunder Nahrung im Vordergrund steht, eingegangen werden. Im Fokus der vorliegenden Arbeit werden die beiden erstgenannten Erscheinungsformen Anorexia nervosa und Bulimia nervosa liegen, weil ich es beachtlich finde, dass immer mehr junge Mädchen in einer Zeit des Nahrungsmittelüberflusses zu Hungern, Erbrechen, exzessivem Sport und anderen fragwürdigen Methoden der Gewichtskontrolle neigen. Da die Debatten um dicke Kinder und übergewichtsbedingte Krankheiten derzeit sehr ausgiebig geführt werden, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, vorrangig das andere Extrem zu untersuchen: das Streben nach der perfekten Figur.
Zu Beginn der Arbeit soll zunächst die Frage geklärt werden, was Essstörungen eigentlich sind und am Beispiel der oben genannten Störungsbilder die Kernmerkmale und die Eigendynamik dieser Phänomene aufgezeigt werden. In einem zweiten Schritt sollen dann die Ursachen und Hintergründe, die zur Ausbildung einer Essstörung führen können, fokussiert werden. Dabei konzentriere ich mich in besonderem Maße auf die tragende Rolle der Gesellschaft in Hinblick auf Schönheitsideale, Medienwirkung und gesundheitliche Vorgaben.
Auch die Lebensphase Adoleszenz1 soll hinsichtlich der zentralen problematischen Veränderungen dieses Abschnitts überprüft werden, da vorrangig in dieser Lebensspanne problematisches Essverhalten auftritt. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse soll im weiteren Verlauf der Bogen zur Arbeit im schulischen Bereich gespannt werden, denn erst wenn die Hintergründe und Risikofaktoren für die Entstehung von Essstörungen ausreichend transparent gemacht wurden, kann in einem weiteren Schritt über die Möglichkeiten der schulischen Intervention nachgedacht werden. Der Ausgangspunkt für die Einordnung von Essstörungen in den schulischen Bereich wird der Bildungsauftrag der Schule sein, um vorab zu analysieren, wie die Aufgabe der Schule gesetzlich verstanden wird und ob sich daraus konkrete Schlüsse für die Arbeit zum Themengebiet Essstörungen ziehen lassen. Im darauf folgenden Kapitel wird schließlich die Thematik der Prävention von Essstörungen aufgegriffen. Dabei soll zum einen geklärt werden, welche Möglichkeiten der Schule im primärpräventiven Bereich offen stehen, d. h., in welchem Maße die Institution Schule dazu beitragen kann, Essstörungen erst gar nicht entstehen zu lassen, zum anderen sollen die Möglichkeiten der Intervention für Lehrer/innen bei bereits vorliegenden Essstörungen hinterfragt werden. Auf der Grundlage dieser theoretischen Erkenntnisse soll schließlich zum empirischen Teil der Arbeit übergeleitet werden, in dem ich mir zum Ziel gemacht habe anhand von qualitativen Interviews mit einer Lehrerin, einem Schulpsychologen und einer ehemaligen Betroffenen, einen konkreteren Zugang zum Thema Essstörungen an Schulen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werde ich die verschiedenen Sichtweisen der Probanden darstellen und durch Zitate stützen. In dem letzten Teil der Arbeit sollen dann Vergleiche zwischen den empirischen und den theoretischen Erkenntnissen gezogen werden, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt sowie schlussfolgernd über die Möglichkeiten erfolgreicher schulischer Intervention für die Zukunft nachgedacht werden. Als letztes möchte ich darauf hinweisen, dass ich bei meinen Ausführungen, wenn von Betroffenen die Rede sein wird, vornehmlich die weibliche Form verwenden werde, da der Anteil essgestörter Mädchen und junger Frauen, trotz steigender Tendenz im männlichen Bereich, der weitaus überwiegende ist2.
2. Was sind Essstörungen? Erscheinungsformen, Symptomatik und mögliche Folgeschäden
Es ist im Prinzip nicht möglich, eine exakte Definition zu liefern, was „normales“ Essverhalten ist und ab wann genau die Grenze zu einer Essstörung gezogen werden kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo Diäten als völlig gesellschaftsfähig empfunden werden, fällt es schwer, eine klare Linie zu ziehen. Es gibt jedoch charakteristische Verhaltensweisen und Muster in Hinblick auf die Körperwahrnehmung und Gedankengänge, die ganz typisch für eine Essstörung sind. Allen Essstörungen gemeinsam ist zum Beispiel die permanente Fixierung des Denkens auf das Essen und der zwanghafte, suchtartige Umgang mit Nahrung und dem Körpergewicht. Dennoch werden diese Krankheitsbilder in der Medizin nicht als Süchte klassifiziert, sondern als psychische oder psychosomatische Erkrankungen eingestuft, was auf den entscheidenden Zusammenhang zwischen seelischer und körperlicher Ebene dieser Phänomene verweist. Gewisse Parallelen zu Suchterkrankungen sind in jedem Fall gegeben, so zum Beispiel die Tatsache, dass Essstörungen von den Betroffenen heruntergespielt werden und in aller Heimlichkeit stattfinden (vgl. Stierle In: Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart 2001, S.1).
Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen drei Hauptformen von Essstörungen: Magersucht (Anorexia nervosa), Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa) und Ess-Sucht (Binge Eating Disorder) (vgl. Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 15). Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden, wobei vorab bemerkt werden muss, dass die Symptome zwischen den Krankheitsbildern sich häufig mischen, so dass man von fließenden Übergängen sprechen kann.
Im Anschluss an die drei oben genannten Krankheitsbilder soll auch auf die so genannte Orthorexia nervosa eingegangen werden, ein essspezifisches Phänomen, das erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und besonders deutlich macht, wie fließend die Übergänge zwischen normalem, gesellschaftlich akzeptiertem Essverhalten und einer Essstörung sein können.
2.1. Anorexia nervosa/ Magersucht
Bei dieser Form der Essstörung wird die Nahrungsaufnahme stark eingeschränkt bzw. bewusst verweigert. Oberstes Ziel ist der radikale Gewichtsverlust. Übersetzt man den Begriff Anorexia nervosa wörtlich, so spricht man von „nervöser Appetitlosigkeit“, eine Bezeichnung, die eigentlich irreführend ist, da die meisten Betroffenen durchaus Appetit verspüren, diesen aber unterdrücken oder leugnen (vgl. Raabe 2004, S. 6).
Um eine voll ausgeprägte Magersucht diagnostizieren zu können, braucht man gewisse Klassifikationssysteme. Auch wenn diese Schemata recht starr sind, sind sie dennoch für eine angemessene Verständigung unter Fachleuten unverzichtbar. Die beiden international gebräuchlichen Klassifikationssysteme sind das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene ICD-10 („International Classification of Diseases“) sowie das von der Amerikanischen Psychiatriegesellschaft erarbeitete DSM-IV („Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“) (vgl. Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 15f.).
Entsprechend dieser beiden Klassifikationssysteme sind die Kernmerkmale einer voll ausgeprägten Magersucht wie folgt zu beschreiben:
Das Körpergewicht liegt mindestens 15% unter dem für das Alter und die Größe zu erwarteten Gewicht bzw. es liegt ein BMI <17,5 vor3. Der Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt durch die Vermeidung von hochkalorischen Speisen, teilweise begleitet von selbst induziertem Erbrechen bzw. Abführen, übertriebener körperlicher Aktivität sowie dem Gebrauch von Appetitzüglern und/ oder Diuretika (Entwässerungsmittel).
Es liegt eine Körperschema-Störung vor. Charakteristisch hierfür ist die überwältigende Angst, zu dick zu werden und eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Selbst bei offensichtlichem Untergewicht nehmen sich die Betroffenen als „zu dick“ wahr.
Es liegt eine hormonelle Störung vor, die sich bei jungen Mädchen im Ausbleiben oder - bei präpubertärem Beginn - im Nichteinsetzen der Menstruation äußert und bei Männern als Libido - und Potenzverlust manifestiert (vgl. Raabe 2004, S. 7 sowie S. 114).
Trotz der bisher beschriebenen Symptome der Magersucht bleibt zu betonen, dass Ausprägung und Hintergründe der Erkrankung bei jedem Menschen anders gelagert sind. Es gibt durchaus Magersüchtige, die nicht alle geschilderten Merkmale aufweisen bzw. einige Symptome anders erleben. So zeigen manche Magersüchtige zum Beispiel Einsicht in die Tatsache, dass sie zu dünn sind. Der Punkt der Körperschema-Störung trifft hier also nicht zu. Dennoch fühlen sich diese Menschen unfähig, ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen, um ihr Gewicht zu stabilisieren. Es wäre verfehlt anzunehmen, dass jemand, der einzelne Symptome anders erlebt als in den Klassifikationssystemen aufgeführt, demnach nicht an Magersucht leidet (vgl. Pauli/Steinhausen 2006, S. 13).
Die Diagnosekriterien für Magersucht wurden im Verlauf der letzten 20 Jahre immer wieder leicht modifiziert. Seit 1994 findet man im Klassifikationssystem DSM-IV die Unterscheidung von zwei Magersuchts- Typen, dem restriktiven und dem Binge-purging-Typ. Beim restriktiven Typ werden keine aktiven Maßnahmen zur Gewichtskontrolle wie Abführen oder Erbrechen durchgeführt, beim Binge-purging-Typ hingegen können die Hungerperioden teilweise unterbrochen werden, und es kommt zwischenzeitlich zu wiederholten Heißhungeranfällen mit anschließendem Erbrechen oder anderen Maßnahmen zur Gewichtskontrolle (vgl. Gerlinghoff/ Backmund o. J., S.16f.).
Neben den oben beschriebenen Symptomen der Magersucht sind oftmals auch noch folgende Besonderheiten zu beobachten:
Magersüchtige sind sehr angepasste und leistungsorientierte Schülerinnen, die sehr hohe Anforderungen an ihre (schulischen) Leistungen stellen. Ihr Streben nach Perfektionismus wird jedoch oftmals von Versagensängsten begleitet. Dies gilt auch für ihren Körper: Kontrolle über ihr Gewicht wird als Leistung erlebt, Essen und Gewichtszunahme hingegen als Schwäche.
Trotz weitgehender Nahrungsverweigerung kreisen die Gedanken der Betroffenen fast ununterbrochen um Essen und Gewicht. Häufig werden Kochbücher gelesen, Rezepte ausgesucht und Familienmitglieder und Freunde bekocht.
Magersüchtige sind sehr streng mit sich selbst und reagieren sehr empfindlich auf Zurückweisungen. Häufig können sie auch eigene Gefühle nicht beschreiben.
Betroffene verleugnen die körperlichen und seelischen Warnsignale ihres Körpers. Sie zeigen oft keine bzw. eine sehr geringe Krankheitseinsicht, was die Behandlung massiv erschwert.
Selbstwert und Identität von Magersüchtigen sind in extremem Maße an ihr Gewicht gekoppelt. Eine Gewichtszunahme käme einem Verlust ihres Selbst gleich (vgl. Preiß/ Wilser 2000, S. 8f.).
Auffällig ist, dass die Magersucht vor allem junge Mädchen in der frühen Pubertätsphase bis hin ins junge Erwachsenenalter betrifft. 95% aller Magersüchtigen sind weiblich (vgl. ebd., S. 8).
Man geht von ca. 1% betroffener Frauen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus, wohingegen das Phänomen bei Männern 10 bis 15 Mal seltener vorkommt (vgl. Klinik für Psychosomatische Medizin Bad Grönenbach o. J., S. 4). Oftmals beginnt der Einstieg in die Krankheit mit einer harmlosen Diät. Dabei ist zu beobachten, dass sich die Altersgrenze immer weiter nach unten verschiebt. „ Untersuchungen haben gezeigt, dass sich heute ca. 50% der 11- bis 13- j ä hrigen M ä dchen als zu dick empfinden und ca. 40% der 11- bis 19- j ä hrigen weiblichen Jugendlichen bereits eine Di ä t hinter sich haben “ (Pauli/Steinhausen 2006, S. 17). Ähnliche Ergebnisse gehen auch aus einer Studie von Gerlinghoff/ Backmund hervor, bei der 800 Schüler/innen der fünften Gymnasialstufe (im Schnitt waren die Kinder 10,8 Jahre alt) zu Körperzufriedenheit und Diäterfahrungen befragt wurden. Ergebnis war, dass 43% der befragten Kinder den Wunsch äußerten, dünner zu sein und 33% der Schüler/innen bereits Diätversuche hinter sich hatten (vgl. Gerlinhoff/ Backmund o. J., S. 14).
Die Erkrankung bricht meist im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus, wobei es auch immer mehr Fälle gibt mit Eintritt vor Beginn der Pubertät. Als ganz besonders gefährdete Risikogruppen für Magersucht gelten
Balletttänzerinnen, Extremsportlerinnen und Models, bei denen ein zierlicher Körperbau zur optimalen Karriereförderung vorausgesetzt wird (vgl. Pauli/ Steinhausen 2006, S. 17).
Die gesundheitlichen Folgen der Krankheit sind gravierend. Hormonelle Veränderungen und das damit verbundene Ausbleiben oder Nicht-Eintreten der Monatsblutung werden häufig begleitet von Störungen im Magen-Darm- Trakt, einem Absinken des Blutdrucks und Herzschlags und dadurch resultierend Müdigkeit, geringe Belastbarkeit und häufiges Frieren. Nicht zu vergessen bleiben auch die psychischen Komponenten der Krankheit, die sich nicht selten in Konzentrationsstörungen, Depressionen und einem damit einhergehenden sozialen Rückzug äußern (vgl. ebd., S. 21ff).
In rund 16% der Fälle endet die Magersucht sogar tödlich (vgl. Stierle In: Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart 2001, S. 2).
2.2. Bulimia nervosa/ Bulimie
Der Name Bulimie kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Stierhunger“. Von Bulimie spricht man, wenn es zu wiederholten Episoden von Essanfällen kommt, die von anschließenden Gegenmaßnahmen zur Gewichtskontrolle begleitet werden. Die häufigste Gegenmaßnahme ist dabei das selbst induzierte Erbrechen, weshalb Bulimie auch häufig als Ess-Brech-Sucht bezeichnet wird.
In den beiden oben genannten internationalen Klassifikationssystemen ICD- 10 und DSM-IV wird das voll ausgeprägte Krankheitsbild nach folgenden Kriterien diagnostiziert:
Betroffene zeigen eine andauernde Beschäftigung mit Essen sowie eine unwiderstehliche Gier nach Nahrungsmitteln. Zeitweise kommt es zu unkontrollierten Essattacken, bei denen große Mengen an Nahrung verzehrt werden.
Es finden kompensatorische Maßnahmen zur Vermeidung einer Gewichtszunahme statt. Hierzu zählen z. B. selbst induziertes Erbrechen, Missbrauch von Abführmitteln, Hormonpräparaten oder Diuretika.
Die Frequenz der Heißhungerattacken in Verbindung mit kompensatorischen Maßnahmen liegt bei mindestens zwei Mal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten.
Ähnlich wie bei der Magersucht zeigen Betroffene eine krankhafte Furcht, zu dick zu werden. Ebenso besteht eine ausgeprägte Abhängigkeit des Selbstwertgefühls vom Körpergewicht.
Häufig gibt es in der Vorgeschichte der Betroffenen eine Episode von Anorexia nervosa (vgl. Raabe 2004, S. 9 sowie Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 17).
Auch beim Erscheinungsbild der Bulimie kann man zwei Typen unterscheiden, den Purging-Typ, der alle charakteristisch geltenden Verhaltensweisen wie selbst induziertes Erbrechen oder Missbrauch von Abführmitteln erfüllt und den Non-purging-Typ, der stattdessen andere kompensatorische Verhaltensweisen wie Fasten, sowie gesteigerte Bewegung zur Gewichtsregulierung nutzt (vgl. Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 17).
Etwa 90% aller an Bulimie erkrankten Personen sind weiblich, wobei das Alter bei Erkrankungsbeginn meist etwas höher liegt als bei der Magersucht, da die Bulimie zum Teil erst als Folgeerkrankung der Magersucht auftritt (vgl. Raabe 2004, S. 9 sowie Klinik für Psychosomatische Medizin Bad Grönenbach o. J., S. 5).
Ähnlich wie bei der Magersucht ist auch bei dieser Essstörung eine permanente Beschäftigung mit Essen, Figur und Gewicht charakteristisch. Im Unterschied zu magersüchtigen Personen sind Bulimiker/innen aber in aller Regel normalgewichtig, was das Erkennen der Krankheit für Außenstehende erschwert. Die Dunkelziffer von Betroffenen ist schwer zu bestimmen, so dass verlässliche epidemiologische Angaben kaum möglich sind. Man geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Erkrankten etwa 2- bis 3-mal höher liegt als bei der Magersucht und somit 2 bis 4% aller jungen Frauen an Bulimie erkranken (vgl. Preiß/ Wilser 2000, S. 10). Tatsache ist, dass die Zahl derer, die ein bulimisches Verhalten zeigen sicherlich weitaus größer ist als die Zahl derjenigen, die in ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxen zur Behandlung kommen (vgl. Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 18).
Betroffene können während der Essattacken die Nahrungsaufnahme kaum kontrollieren. Sie greifen hauptsächlich zu hochkalorischen Nahrungsmitteln wie Süßigkeiten, Kuchen, Keksen, Torten usw. - typische Dickmacher, die sie sich im sonstigen Alltag verbieten. Außerhalb bulimischer Episoden legen die Betroffenen nämlich zumeist großen Wert auf gesunde Ernährung (vgl. Preiß/ Wilser 2000, S. 11). Tatsache ist, dass Bulimie für die Betroffenen zunächst die Lösung für die Vereinbarkeit zweier sich im Kern widersprechender Bestrebungen zu sein scheint: Der Möglichkeit, enthemmt und ohne jegliche Verbote zu essen, sowie dabei gleichzeitig, nicht zuzunehmen.
Bulimiker/innen berichten häufig in Zusammenhang mit Essanfällen von Spannungszuständen, Frustration, Angst, Wut, Gefühlen der Isolation sowie innerer Leere. Durch die Essattacken werden diese Gefühle zeitweise kuriert, unmittelbar danach ekeln sich die Betroffenen jedoch und empfinden ihr Verhalten als Schwäche. Sie versuchen die Symptome solange wie möglich geheim zu halten, was in vielen Fällen auch zu sozialem Rückzug führt, oftmals begleitet von depressiven Verstimmungen, denn mit fortschreitender Sucht bestimmt die Bulimie zunehmend den Alltag der Betroffenen; frühere Interessen und Freizeitaktivitäten werden aufgegeben (vgl. Preiß/ Wilser 2000, S. 11f.).
Die körperlichen Folgeschäden der Bulimie sind nicht zu unterschätzen.
Neben Störungen des Mineralstoffhaushalts kommt es in den meisten Fällen auch zu chronischen Halsschmerzen, Entzündungen und Verletzungen der Speiseröhre, angegriffenem Zahnfleisch sowie in fortgeschrittenen Stadien Herz-Kreislauf-Störungen, die sich in Schwindelanfällen und Müdigkeit äußern. Auch Schäden an Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren sind zu beobachten (vgl. ebd., S. 12).
2.3. Binge Eating Disorder/ Ess-Sucht
Diese Form der Essstörung ist im Vergleich zu Magersucht und Bulimie noch am wenigsten erforscht und wurde erst in den letzten Jahren als Form der Esssüchte klassifiziert (vgl. Stein-Hilbers und Becker 1998, zit. nach Raabe 2004, S. 11). „To binge“ kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet wörtlich übersetzt „ein Fressgelage abhalten“ (vgl. „Binge Eating-Störung“, September 2007). Vereinfacht ausgedrückt beschreibt diese Essstörung das Krankheitsbild der Bulimie ohne kompensatorische Maßnahmen zur Gewichtskontrolle.
Im DSM-IV werden folgende diagnostische Kriterien für das Erkennen der Binge Eating Disorder genannt:
- Es kommt zu wiederholten Episoden von Essattacken, die von einem Gefühl des Kontrollverlustes begleitet werden. Im Gegensatz zur Bulimie werden jedoch keine gegensteuernden Maßnahmen zur Gewichtsregulierung wie Erbrechen, exzessiver Sport oder Abführmittel durchgeführt.
- Die Episoden von Essanfällen treten mit mindestens drei der folgenden Symptome auf:
- wesentlich schnelleres Essen als normal
- Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl
- Aufnahme großer Nahrungsmengen ohne Hungergefühl
- Aus Scham und Peinlichkeit erfolgt die Nahrungsaufnahme alleine.
- Ekel gegenüber der eigenen Person, Schuldgefühle sowie Deprimiertheit bezüglich des Essens
- Es besteht deutliches Leiden aufgrund der Heißhungerattacken.
- Betroffene haben durchschnittlich zwei Essattacken pro Woche über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten (vgl. Raabe 2004, S. 12).
Die Folge dieser Essstörung ist häufig eine mehr oder weniger stete Gewichtszunahme. Betroffene berichten oftmals von Ekel gegenüber dem eigenen Körper, Depressionen, Ablehnung und zwischenmenschlichen Konflikten (vgl. Kerber 2003, zit. nach Raabe 2004, S. 12f.). Im Unterschied zu Magersucht und Bulimie ist die Binge Eating Disorder keine frauenspezifische Essstörung. Nach neueren Erkenntnissen leiden 0,7 bis 4% der Bevölkerung unter diesem Krankheitsbild. Der Einstieg erfolgt oft in der späten Adoleszenz bzw. im jungen Erwachsenenalter, häufig im Anschluss an einen deutlichen Gewichtsverlust in Folge einer Diät (vgl. ebd., S. 13).
Auch bei der Binge Eating Disorder sind somatische Folgesymptome zu beobachten, die häufig an das mit dem Krankheitsbild einhergehende Übergewicht gekoppelt sind. Diese umfassen unter anderem Herz- und Kreislauferkrankungen, Störungen der Atemfunktion, Venenleiden sowie Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates (vgl. Munsch 2003, S. 5).
2.4. Orthorexia nervosa
Das Krankheitsbild der Orthorexia nervosa ist noch relativ neu und wurde bislang nicht in die internationalen Klassifikationssysteme wie ICD-10 und DSM-IV aufgenommen. Der Begriff wurde 1997 von dem US-amerikanischen Arzt Dr. Steven Bratman geprägt, der Orthorexia nervosa als eine übersteigerte Fixierung auf gesunde Nahrungsmittel beschreibt. Bratman zufolge dreht sich das Leben der Betroffenen permanent darum, ungesunde Nahrungsmittel zu vermeiden und stets „das Richtige“ zu essen. Im Laufe der Zeit wird die Einteilung in gesunde und ungesunde Kategorien immer rigider, und das Essverhalten wird immer stärker eingeschränkt. So werden beispielsweise Lebensmittel vermieden, die potenziell krebserregend oder allergieauslösend sein könnten bzw. Zusatzstoffe enthalten. Fatalerweise kann es so jedoch, gerade im Rahmen einer rein veganen Kost, zu Mangelerscheinungen kommen, die im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich sein können.
Die Betroffenen sind überzeugt, im Auftrag ihrer Gesundheit zu handeln und sehen in ihrem Verhalten keinerlei Krankheitswert. Sie legen eine große Selbstdisziplin an den Tag und versuchen, ihre Umwelt von ihrer Lebensweise zu überzeugen.
Die Fixierung der Betroffenen geht oftmals einher mit Schlaf- und Konzentrationsproblemen, Leistungsabfall, niedrigem Blutdruck und einem verlangsamten Herzschlag (vgl. Raabe 2004, S. 13 ff.).
3. Warum treten Essstörungen auf? Hintergründe und Erklärungsansätze
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, Risikofaktoren und Ursachen für Essstörungen zu erörtern. Sicherlich gibt es nicht eine einzige Ursache für gestörtes Essverhalten, vielmehr handelt es sich um ein mehrdimensionales Entstehungsmodell. Um ein angemessenes Verständnis für essgestörte Personen zu entwickeln, ist es daher unverzichtbar, die verschiedenen Entstehungsbedingungen nebeneinander gestellt zu betrachten.
Ich werde mich bei meinen Ausführungen auf die Risikofaktoren beschränken, die für einen pädagogischen Interventionsansatz relevant sein könnten. Daher gehe ich zum Beispiel nicht näher auf genetische Faktoren ein.
3.1. Psychologische Faktoren
Grundlage für die Ausbildung einer Essstörung bildet oft ein niedriges Selbstwertgefühl. Dies muss nicht zwingend der Fall sein, ist aber häufig zu beobachten. Wenn Magersüchtige ihren Körper kritisch unter die Lupe nehmen, steht dahinter das Gefühl, „ sich selbst als Person nicht akzeptieren zu k ö nnen und sich von anderen nicht geliebt und angenommen zu f ü hlen, so wie man ist “ (Pauli/Steinhausen 2006, S. 28).
Dieses Gefühl der Selbstunsicherheit versuchen Betroffene wiederum durch einen übersteigerten Perfektionismus und Selbstkontrolle in allen Lebensbereichen zu kompensieren, Gefühle der Unzulänglichkeit und Schwäche werden nicht zugelassen. Der Drang nach Perfektion dient also dazu, die mangelnde emotionale Stabilität und das geringe Selbstwertgefühl auszugleichen. Langfristig führt dieser Prozess jedoch durch die immerwährende Forderung nach besonders guter Leistung zur Überforderung (vgl. Klinik für Psychosomatische Medizin Bad Grönenbach o. J., S. 28).
Hinzu kommt, dass Menschen mit Essstörungen sich mehr mit den Augen anderer als mit ihren eigenen Augen sehen und stets versuchen, sich deren (vermuteten) Erwartungen anzupassen. Indem sie sich von ihrer Umgebung abhängig machen, übertragen sie die Verantwortung ihrer eigenen Lebenssituation auf andere, was langfristig ein Gefühl von Unselbständigkeit erzeugt. Sie versuchen bedürfnislos zu erscheinen, kümmern sich rührend um die Probleme anderer, lassen ihre eigenen Sorgen aber stets außen vor. Die Definition der eigenen Person erfolgt so ausschließlich über das Umfeld. Durch das sehr ausgeprägte Helferverhalten erhoffen sie sich Zuwendung und Nähe, ohne aktiv danach fragen oder bitten zu müssen. Da diese Zuwendung aber letztendlich nur indirekt erfolgt, nämlich basierend auf der Leistung für andere, bleibt sie im Kern unbefriedigt, da sie nicht ausdrücklich und vorbehaltlos der eigenen Person gegolten hat.
Dem sehr angepassten, wenig von sich preisgebenden Verhalten der Betroffenen liegt oft die biographische Erfahrung zu Grunde, als eigenständige Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen nicht akzeptiert und ernst genommen worden zu sein (vgl. ebd., S. 27f.).
3.2. Familiäre Faktoren
„ Aus psychoanalytischer und familientherapeutischer Sicht liegen viele Ursachen f ü r die Entwicklung einer Essst ö rung in der Familie “ (Raabe 2004, S. 17). Teilweise werden in der Literatur so genannte typische „Magersuchtsfamilien“ beschrieben. Diese gelten als besonders intakt und harmonisch, die Beziehungen untereinander sind sehr eng, mit einem überbehütenden und überkontrollierenden Erziehungsverhalten, insbesondere seitens der Mutter, was die Ablösung der Jugendlichen eher erschwert. Basierend auf dem stark ausgeprägten Harmoniebedürfnis werden Konflikte nur selten ausgetragen und oftmals „unter den Tisch gewischt“ (Pauli/Steinhausen 2006, S. 31). Oberste Priorität dieser Familien ist das Motto, sich stets zu beherrschen und zu keiner Zeit Schwäche zu zeigen. Somit werden Gefühle aller Art unterdrückt, und man gibt sich jederzeit freundlich- kontrolliert. Dadurch kommt es jedoch auch unweigerlich zu unterschwelligen Spannungen (vgl. Preiß/ Wilser 2000, S. 26). Die Nahrungsverweigerung von Magersüchtigen kann als ein Versuch verstanden werden, sich gegen diese starren Familienstrukturen abzugrenzen, sich der elterlichen Kontrolle zu entziehen und durch das Hungern ein Stück Autonomie und Kontrolle über sich selbst und den eigenen Körper zu erlangen (vgl. Raabe 2004, S. 19).
Sicherlich muss betont werden, dass diese Beschreibung nicht auf alle Magersuchts-Familien zutrifft. Jede Familie ist anders und schematische Beschreibungen sind meistens unzureichend. Dennoch können sie Anhaltspunkte liefern und gerade Betroffenen helfen, Zusammenhänge in ihrer eigenen Geschichte zu verstehen.
Untersucht man Familien von Bulimiker/innen, so trifft man oft auf folgende Kennzeichen: Anders als bei Magersuchts-Familien, gelten Bulimiefamilien als eher konfliktreich mit der Besonderheit, dass diese offen und lautstark ausgetragen werden. Hinzu kommt, dass Bulimikerinnen dazu erzogen werden, „ anderen Menschen - insbesondere M ä nnern - zu gefallen und dem Urteil anderer zu entsprechen “ (Boskind-Lodahl 1979, zit. nach Stahr et al. 1998, S. 66).
Für gewöhnlich herrschen sowohl in Magersuchts- als auch Bulimiefamilien rigide Regeln und Normen, Veränderungen werden als bedrohlich wahrgenommen, womit die Bildung eigener Standpunkte erschwert wird (vgl. Stahr et al. 1998, S. 66). Eine weitere Gemeinsamkeit im Familienhintergrund von magersüchtigen und bulimischen Personen ist ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, das keinerlei Zwischentöne zulässt. Das gesamte Denken, Fühlen und Urteilen der Familienangehörigen funktioniert nach dem „Entweder-Oder-Prinzip“ und läuft nach folgendem Muster ab:
„ Entweder man beherrscht seinen K ö rper, oder man wird von diesem beherrscht; entweder leistet man etwas Besonderes, oder man ist eine Null, ein Versager; entweder man ist der Familie total verbunden, oder man ist ganz drau ß en. Es gibt keinen dritten Weg, keine Alternative dazu, kein Sowohl-als-auch “ (Weber/ Stierlin 1989, S. 70).
Im Familienhintergrund von übergewichtigen und esssüchtigen Menschen fällt auf, dass die Betroffenen meist als einziges oder jüngstes Kind aufwachsen. Oftmals ist die Kommunikation innerhalb der Familie gestört. Es findet ein ständiger Wechsel von Nähe und Distanz statt, und die Mütter gelten als unsicher in der Einstellung ihrem Kind gegenüber. Gleichzeitig wird durch übermäßiges Behüten der Aufbau von Ich-Grenzen zwischen Mutter und Kind verhindert. In Familien mit esssüchtigen Personen nimmt Nahrung einen sehr großen Stellenwert ein, hat einen hohen emotionalen Wert und wird oftmals mit Gefühlen von Liebe, Sicherheit und Zufriedenheit verbunden (vgl. Bruch 1992, zit. nach Stahr et al. 1998, S. 67).
Erwähnenswert im familiären Zusammenhang mit Essstörungen ist auch noch die Tatsache, dass vielen Kindern mit der Zeit die Wahrnehmung von Hunger und Sattheit abtrainiert wird, was ein gestörtes Verhältnis zum Essen zur Folge haben kann (vgl. Selvini Palazzoli 1984, zit. nach Raabe 2004, S. 23).
Ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Essstörung besteht zudem in Familien, in denen die Beschäftigung mit Ernährung und Diäten, meistens auf Seiten der Mutter, eine zentrale Rolle spielt. Ist die Mutter bereits an einer Essstörung erkrankt bzw. besteht bei den Eltern eine Depression oder Suchtproblematik, birgt dies Gefahren für die Entwicklung einer Essstörung auf Seiten der Kinder (vgl. Pauli/Steinhausen 2006, S. 31).
Ein Problembewusstsein auf Seiten der Eltern in ihrer Vorbildfunktion auch für das Essen muss daher dringend eingefordert werden. So schreibt Monika Gerlinghoff, die Leiterin des Therapie- Zentrums für Essstörungen in München: „ Wenn jemand eine Abmagerungskur nach der anderen durchf ü hrt oder nach dem Essen erbricht oder sonst etwas Ungesundes f ü r seine schlanke Linie tut, dann ist das seine Sache, solange er ohne Kinder lebt, deren Essverhalten ma ß geblich in der Familie gepr ä gt wird “ (Gerlinghoff/ Backmund o. J., S. 14).
3.3. Gesellschaftlicher Hintergrund
Dass der Gesellschaft im Zusammenhang mit Essstörungen eine zentrale Rolle zukommt, wird allein durch die Tatsache deutlich, dass Magersucht, Bulimie und Ess-Sucht typische Phänomene unserer westlich orientierten Wohlstandsgesellschaft sind. Wie kann es sein, dass gerade in den Ländern, wo Nahrungsmittel im Überfluss vorhanden sind, solche Krankheiten wie Magersucht oder Bulimie vermehrt auftreten? Welchen Einfluss haben die Medien und inwiefern kann der aktuelle Gesundheitstrend einen Beitrag zur Verfestigung von Essstörungen leisten? Diese Punkte werde ich im Folgenden näher analysieren. Abschließend möchte ich noch auf die aktuelle Debatte der Bundesregierung eingehen, Ziele der Kampagne „Fit statt fett“ aufzeigen und das viel- zitierte Übergewichts-Problem genauer unter die Lupe nehmen.
3.3.1. Der Traum vom gesunden Körper
Der Durchschnittsbürger von heute ist mehr denn je bestrebt, sich und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Angesichts der massiven Ausbreitung von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Diabetes etc., oftmals zurückgeführt auf Übergewicht, finden Richtlinien und Empfehlungen in Sachen Gesundheit bereitwillig ein offenes Ohr.
Gemäß den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollte sich die tägliche Nahrungszufuhr aus 60% Kohlenhydraten, 10-15% Eiweiß und maximal 30% Fett zusammensetzen (vgl. Martin Maria Schwarz In:
Thimm/Wellmann 2004, S. 18). Es wird empfohlen, dass „ bei einer vollwertigen Ern ä hrung pflanzliche Lebensmittel, wie Getreideprodukte, vorzugsweise aus Vollkorn, Gem ü se und Obst im Mittelpunkt der Ern ä hrung stehen “ („Eine runde Sache: Der neue DGE-Ernährungskreis“, Dezember 2003).
So wie Empfehlungen gibt es auch zahlreiche Produkte auf dem Markt, die mit dem Stichwort Gesundheit werben. „ Beim Gang entlang eines K ü hlregals in einem beliebigen Supermarkt empf ä ngt den Verbraucher heute ein allein schon durch die Produktnamen ausgel ö stes Gesundheitsfeuerwerk: Drink fit, Vitality Fruchtdrink, Fitnessquark, Fastenfruchtjoghurt hei ß en die
Milchprodukte, die kaum zu umgehen sind “ (Martin Maria Schwarz In: Thimm/Wellmann 2004, S. 15).
Dass der Verbraucher mit dem Stichwort „Gesundheit“ durchaus gelockt werden kann, haben Nahrungsmittelhersteller längst erkannt. Zusätzlich zu viel versprechenden Produktbezeichnungen geht der neueste Trend deshalb dahin, Nahrungsmittel mit besonders aktuellen Nährstoffen aufzupeppen.
„ Bonbons und Fruchts ä fte werden mit Vitaminen oder Mineralstoffen angereichert. (...) Milch und K ä se werden abgesahnt, schlichter Joghurt mit M ü sliflocken zum Fitne ß snack „ gepowert “ . Kuchen aus Wei ß mehl, dessen Ballaststoffe bei der Herstellung entzogen wurden, wird nun mit Weizenkleie, Zellulose oder Faserstoffen aus Sojabohnen zum „ Vollwertkuchen “ umfrisiert “
(Furtmayr-Schuh 1993, S. 107).
Angesichts der vielfach beschworenen Übergewichts-Epidemie wird der Bundesbürger auch in regelmäßigen Abständen daran erinnert, sein Körpergewicht zu kontrollieren. Was wäre da einfacher, als zu den inzwischen massenhaft verbreiteten kalorienreduzierten Varianten im Supermarkt zu greifen? Fettarme Butter oder Margarine, leichte Salatsaucen, kalorienarm gesüßte Limonaden, fettreduzierte Desserts - das alles ist fast überall problemlos erhältlich, und in Kombination mit den viel- versprechenden Werbeslogans greift der figur- und gesundheitsbewusste Verbraucher gerne zu. „ Wie gierig der satte Wohlstandsb ü rger nach kalorienreduzierten Nahrungsmitteln greift, belegt die j ä hrliche zweistellige Umsatzsteigerung der S üß stoffhersteller. Im N ä hrstoffgehalt ver ä nderte Nahrungsmittel machen heute bereits rund acht Prozent aller Lebensmittel aus “ (ebd., S. 105).
Der Trend in Richtung Gesundheitsbewusstsein ist offensichtlich und unverkennbar. Problematisch an der ganzen Sache ist, dass oftmals widersprüchliche Empfehlungen kursieren, die den Verbraucher zuweilen orientierungslos dastehen lassen. So wurde den Menschen lange Zeit suggeriert, dass Kohlenhydrate in Form von Getreideprodukten den Basisbestandteil der gesunden Ernährung darstellen sollten. Seit einiger Zeit hört man jedoch immer häufiger von einer Gegenbewegung, die dahingeht, Kohlenhydrate als gesundheitsschädliche Dickmacher zu verteufeln. Begriffe wie „Low Carb“, „Eiweiß-Diät“, „Logi-Methode“ etc. fallen immer häufiger und empfehlen eine deutliche Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr zugunsten des Eiweißbedarfs (vgl. Martin Maria Schwarz In: Thimm/Wellmann 2004, S. 18f.). Damit steht dieser neue Trend in deutlichem Widerspruch zu den aktuellen Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es scheint, dass die einst so sicheren Erkenntnisse der Wissenschaft immer wieder auf eine neue Probe gestellt werden. Kaum hat sich eine Gesundheitserkenntnis in den Köpfen der Bürger verfestigt, wartet schon die nächste Empfehlung, die mit allem Vorherigen gründlich aufräumt (vgl. Eva Maria Siefert In: Thimm/Wellmann 2004, S. 247ff.).
Doch es scheint zumindest eine andere verlässliche Orientierungshilfe zu geben, die es dem Bundesbürger ermöglicht, auf seine Gesundheit zu achten. So soll der Body Mass Index, der Gewicht und Größe einer Person miteinander in Bezug setzt, Auskunft über den körperlichen Gesundheitszustand geben. Pendelt sich der BMI zwischen 18,5 und 25 ein, liegt man statistisch gesehen im Normbereich und hat demnach ein „gesundes“ Körpergewicht. Ab einem BMI von 25 gilt man bereits als übergewichtig, beginnend mit einem BMI von 30 spricht man von Fettleibigkeit. Bei einem BMI unter 18,5 liegt die Schwelle zum Untergewicht (vgl. Pollmer 2007, S. 189).
Aber wie sind diese Zahlen eigentlich zur Richtlinie für den körperlichen Gesundheitszustand geworden? Und wer hat den BMI als Gesundheitsindikator eigentlich festgesetzt? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es einem kleinen Exkurs:
Tatsächlich ist es so, dass Versicherungsangestellte im Jahre 1959 auf der Grundlage einer Datenuntersuchung anhand von Geburtsjahr, Größe und Gewicht ihrer Kundschaft den obersten Richtwert von 25 für das „gesunde“ Gewicht berechneten. Das Ergebnis bekamen sie, indem sie die Daten der Kundschaft beim Abschluss älterer Policen mit dem Sterbedatum dieser Versicherten in Bezug setzten. Hierzu bleibt jedoch anzumerken, dass die Daten zu Gewicht und Größe der Kunden mit gewissen Fehlern behaftet waren. Zum einen wurden die Kunden oftmals weder gewogen noch gemessen, so dass die Angestellten sich ausschließlich auf die (wahrheitsgetreuen?) Angaben der Kundschaft verlassen mussten, zum anderen waren die Daten bei denjenigen Personen, die tatsächlich gemessen und gewogen wurden häufig verfälscht, da viele Kunden mit Kleidung auf die Waage stiegen bzw. Frauen bei der Ermittlung der Größe sogar ihre Stöckelschuhe anbehalten durften. Darüber hinaus waren einzig und allein die Daten beim Abschluss der Policen relevant. Wie sich das Gewicht der Kunden im Laufe der Jahre veränderte und ob sich daraus Konsequenzen hinsichtlich der Lebenserwartung ergaben, wurde nicht weiter untersucht. Fakt ist, dass sich trotz zeitweiliger Kritik und Überarbeitung dieser Werte (beispielsweise nach differenzierenden Kategorien wie Geschlecht und Alter), die ursprünglichen Versicherungswerte von 1959 als allgemeiner Richtwert der Weltgesundheitsorganisation durchsetzten.
„ Unterschiede zwischen jung, ä lter und alt werden dort nicht mehr gemacht, schon gar nicht zwischen unterschiedlichen K ö rpertypen, Ethnien oder Geschlechtern “ (Pollmer 2007, S. 34).
Zieht man diese Informationen in Betracht, wird deutlich, dass der BMI als Gesundheitsindikator nur als sehr relativer Wert angesehen werden kann. Trotzdem hat sich dieser Wert in den Köpfen der Menschen derart verfestigt, dass Abweichungen von der Norm als äußerst belastend empfunden werden.
Christoph Klotter, Professor für Ernährungspsychologie und Gesundheitsförderung an der Fachhochschule Fulda, bringt die Denkweise unserer heutigen Gesellschaft auf den Punkt: „ Fr ü her gab es eine Unterscheidung von dick oder d ü nn. Auf einmal gibt es eine ganz graduelle, minuti ö se Beurteilung des Ü bergewichts - leicht ü bergewichtig, stark ü bergewichtig - und heute sagen schon Jugendliche: „ Ich bin f ü nf Prozent ü ber ´ m BMI “ - und das begreifen sie als gro ß es Leiden! “ (Utz Thimm In: Thimm/Wellmann 2004, S. 155).
Es stellt sich nun die Frage, inwiefern die oben dargestellten Informationen Relevanz in Hinsicht auf das Themengebiet Essstörungen haben. Fakt ist, dass das Essen nach den Bedürfnissen des Körpers zunehmend durch ein kopfgesteuertes Essverhalten abgelöst wird. Das, was die Wissenschaft uns gerade vorgibt, scheint Gesetz zu sein, zumindest so lange bis die nächste Empfehlung kommt. Zieht man dies in Betracht, ist es nicht verwunderlich, dass das Ernährungsverhalten von immer mehr Menschen durcheinander gerät.
[...]
1 Ich werde statt „Pubertät“ überwiegend den Begriff „Adoleszenz“ verwenden, da ich mich nicht nur auf körperliche, sondern auch auf psychosoziale Entwicklungsprozesse beziehe.
2 Nach Angaben von Gerlinghoff/ Backmund kommt das Phänomen bei Männern etwa 20 Mal seltener vor (vgl. S. 15).
3 Der Richtwert für die Bestimmung des Normalgewichts wird anhand des so genannten Body- Mass -Index (BMI) errechnet. Dabei wird das Gewicht (kg) durch die Körpergröße (m²) geteilt.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Stoichita (Autor:in), 2007, Essstörungen im Kindes-und Jugendalter: Problemanalyse und pädagogische Interventionsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186448
Kostenlos Autor werden




















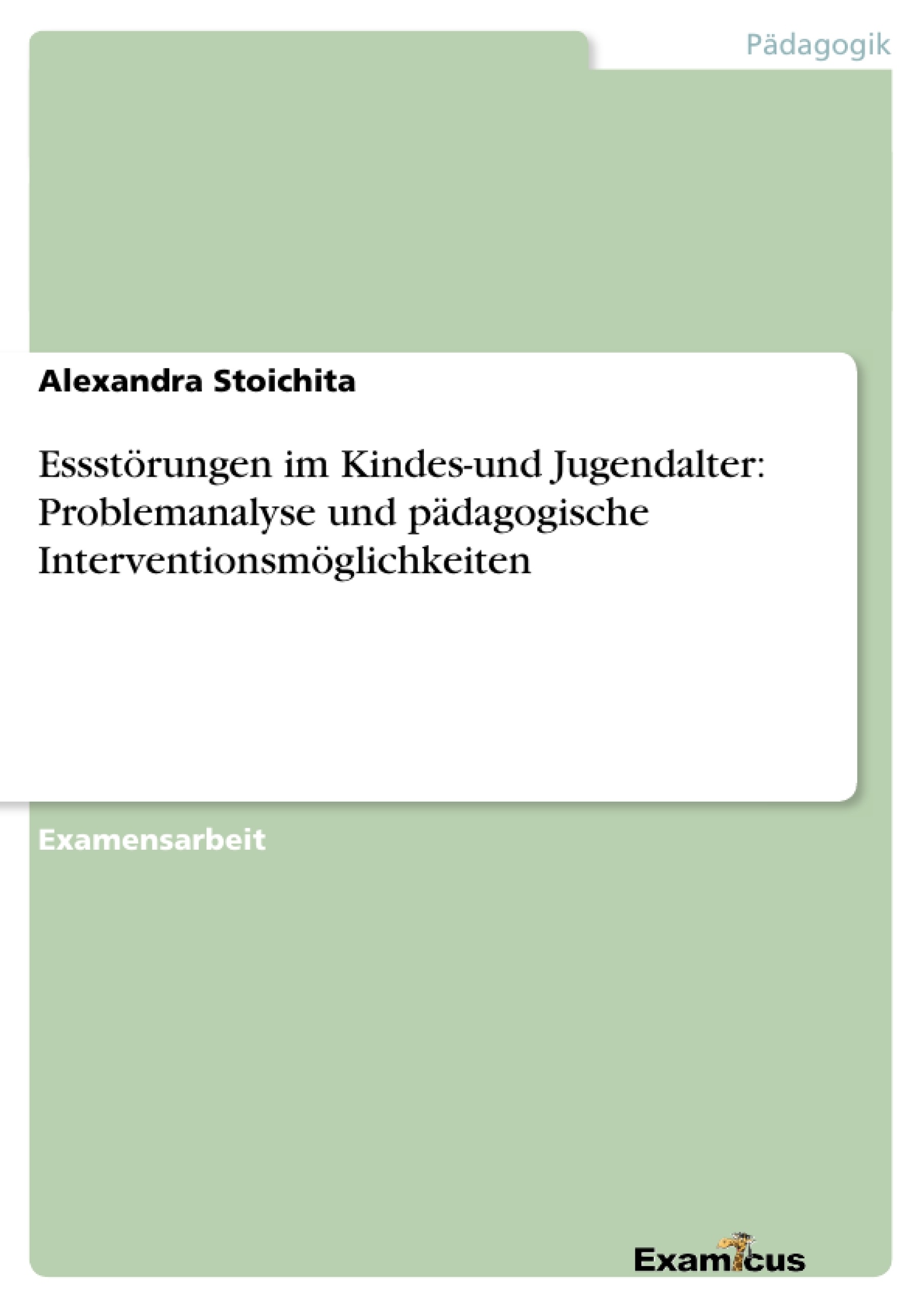

Kommentare