Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung und Problemstellung
II. Die Rosskastanie in Mitteleuropa
2.1 Systematik und Bezeichnung
2.2 Verbreitung
2.3 Beschreibung
2.4 Lebenszyklus
2.5 Schädlinge
III. Inhaltsstoffe der Rosskastanie
3.1 Aescin (Saponine)
3.2 Aesculin
3.3 Reduzierende Zucker
3.4 Stärke
3.5 weitere Inhaltsstoffe
IV. Verwendung von Kastanien
4.1 Historische Aufzeichnungen und Überlieferungen
4.2 Aktuelle Nutzungsmöglichkeiten
V. Experimentelle Untersuchungen
5.0 Vorbereitende Behandlung
5.1 Aescin
5.2 Aesculin
5.3 Reduzierende Zucker
5.4 Stärke
5.5 weitere Inhaltsstoffe
VI. Didaktische Überlegungen
6.1 Das Experiment im Chemieunterricht
6.2 Zugänge zur Thematik „Rosskastanie“
6.3 Die Projektmethode
6.4 Projektorientierter Chemieunterricht
6.5 Projekt: Rosskastanie
VII. Schlussbetrachtung
VIII. Literatur- und Quellenverzeichnis
8.1 Literaturverzeichnis
8.2 Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 0.1: Aesculus hippocastanum
An vollen Büschelzweigen
(Johann Wolfgang Goethe)
An vollen Büschelzweigen,
Geliebte, sieh nur hin!
Laß dir die Früchte zeigen,
Umschalet stachlich grün.
Sie hängen längst geballet,
Still, unbekannt mit sich;
Ein Ast, der schaukelnd wallet,
Wiegt sie geduldiglich.
Doch immer reift von innen
Und schwillt der braune Kern;
Er möchte Luft gewinnen
Und säh die Sonne gern.
Die Schale platzt, und nieder
Macht er sich freudig los;
So fallen meine Lieder
Gehäuft in deinen Schoß.
I. Einleitung und Problemstellung
Der Begriff „Rosskastanie“ weckt unterschiedliche Assoziationen beim Menschen. Kinder denken vermutlich an die rotbraunen Früchte, die Möglichkeit, mit ihnen zu basteln und an die stacheligen Hüllen der „Kastanie“. Erwachsene verbinden mit diesem Begriff vielleicht eher eine Pflanze, die sie durch ihre Früchte an den Herbst erinnert, oder einen großen einheimischen Baum, der im Sommer auffällige, weiße Blüten besitzt und als Schattenspender in Alleen und Parks verbreitet ist. Biologisch Interessierte wissen möglicherweise, dass dieser Baum nicht immer bei uns heimisch war, verwandtschaftlich nichts mit der Esskastanie zu tun hat und dass er Inhaltsstoffe besitzt, die in der Medizin Anwendung finden.
Kaum jemand käme aber auf die Idee, die Rosskastanie und ihre Früchte direkt mit der Chemie oder gar mit Chemieunterricht in Verbindung zu bringen. Bei genauerer Betrachtung des Themenkomplexes „Rosskastanie“ ergeben sich jedoch verschiedenste Ansatzmöglichkeiten für die Einbeziehung dieser Thematik in den Chemie- bzw. NWA- Unterricht an Realschulen.
Weshalb schäumt eine Straße mit überfahrenen Kastaniensamen bei Regen?[I] Warum sind diese Früchte für den Menschen ungenießbar und konnten dennoch in Krisenzeiten zum Backen verwendet werden? Welche Stoffe enthält Rosskastanienextrakt, dass es in Sonnenschutzmitteln zum Einsatz kommen kann und als Grundlage für die Entwicklung von Weißmachern diente?
Im folgenden soll die Klärung dieser Fragen als Ausgangspunkt für die Entwicklung von schulrelevanten Experimenten mit Rosskastanien dienen. Dazu soll zunächst die Verbreitung der Rosskastanie in Mitteleuropa sowie ihre Inhaltsstoffe betrachtet werden. Ferner wird der Frage nachgegangen, welche historischen Verwendungen die Kastanie hatte und wozu sie heute genutzt wird.
II. Die Rosskastanie in Mitteleuropa
2.1 Systematik und Bezeichnung
Als Pflanze ist die Gewöhnliche Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) in der Systematik der Biologie nach folgendem Schema einzuordnen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Familie der Hippocastanaceae ist recht klein, sie umfasst außer „Aesculus" nur noch die Gattung „Billia" mit zwei Arten in Südamerika.
Die Gattung „Aesculus" umfasst 13 Arten, die in Südosteuropa, Süd- und Ostasien sowie in Nordamerika heimisch sind. Neben der Gewöhnlichen Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) gehören hierzu u.a. noch die Gelbe Rosskastanie (Aesculus octandra), die Pavie (Aesculus pavia) und die Japanische Rosskastanie (Aesculus turbinata). Innerhalb dieser Gattung sind Arthybride recht häufig, einige werden taxonomisch als Art aufgefasst. Ein Beispiel ist die rotbraunblühende Aesculus x carnea, eine Kreuzung aus A. hippocastanum und A. pavia.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Botanisch sind die Rosskastanien nicht mit der Edel- oder Esskastanie (Castanea sativa) verwandt, diese gehört zur Familie der Buchengewächse.
Der Gattungsname „Aesculus" geht auf Linne1 zurück, er ist eigentlich der lateinische Name einer Eichenart, welcher auf diese Pflanze übertragen wurde.
Die Bezeichnung „Aesculus" könnte nach Ursel Bühring auch auf die Verwendung als Viehfutter hinweisen (lat. esca = Futter).[II] [III]
Erstmals beschrieben wurde dieser Baum 1565 in einem Brief des Arztes und Gelehrten Matthiolus (1501-1577).2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. II.4: Rosskastaniensamen
Die Bezeichnung „Kastanie" geht wohl auf die Ähnlichkeit der Samen mit den Früchten der Esskastanie (griech. kastanon) zurück. Die Bezeichnung „Ross" steht in der alten indo-europäischen Sprache für „falsch" oder „unecht". Was bedeuten kann, dass die bestehende Ähnlichkeit der beiden Arten nur oberflächlich ist. Möglich wäre auch, dass sich der Name „Rosskastanie" auf die früher bekannte Verwendung als Pferdearznei bezieht. „Hippocastanum" stellt somit eine nachträgliche Rückübersetzung des Namens „Pferdekastanie" dar (griech. hippos = Pferd)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. II.5: Rosskastanie
Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich bei der Rosskastanie streng genommen nicht um einen einheimischen Baum, sondern eher um einen Rückkehrer.
Zwar belegen Fossilienfunde, dass diese Art im Tertiär in Mitteleuropa heimisch war. Die starke Abkühlung zu Beginn des Quartär vor ca. zwei Millionen Jahren und die einsetzende Eiszeit drängten diese Baumart jedoch immer weiter südlich. Im Gegensatz zu anderen Arten schaffte es Aesculus jedoch, dem Aussterben zu entgehen und konnte in kleinen Arealen auf dem Balkan überleben. Das natürliche Verbreitungsgebiet zerfällt in zahlreiche voneinander getrennte Teile, die sich über Griechenland, Mazedonien und Albanien erstrecken. Der dortige Lebensraum sind Berg- und Schluchtwälder mit tiefgründigen und nährstoffreichen Böden. Die Rosskastanie kommt dort u.a. zusammen mit Eichen, Hainbuchen und Silberlinden vor. Weshalb Aesculus hippocastanum die Rückverbreitung nach der Eiszeit nicht geschafft hat, ist bisher nicht geklärt. Erst der Mensch sorgte wieder für eine Verbreitung dieser Art in Mitteleuropa.
Bei ihren Feldzügen nutzten die Türken im 15. und 16. Jahrhundert die Früchte der Rosskastanie als Futter für ihre Pferde. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass diese Art wieder nach Mitteleuropa eingeführt wurde. Der französischstämmige Arzt und Botaniker Carolus Clusius (1526-1609) erhielt 1576 als Hofbotaniker in Wien die ersten Samen der Rosskastanie aus Konstantinopel. Von dort aus wurde sie in Europa verbreitet. Insbesondere nachdem der französische König Ludwig XIV (1638-1715) die Rosskastanie zu seinem Lieblingsbaum erklärt hatte, wurde es große Mode, sie in Alleen, Parks und Gärten anzupflanzen.
Heutzutage ist Aesculus hippocastanum in ganz Europa, außer dem hohen Norden anzutreffen. Als winterharter Baum kommt sie gut mit den europäischen Klimazonen zurecht und verkraftet nur Temperaturen unter -30°С nicht. Auch in Höhenlagen bis 1200 m können Rosskastanienbäume wachsen.
Hauptsächlich ist diese Art noch immer in Parks und Alleen sowie in Städten anzutreffen. Nur selten sind ausgewilderte Exemplare in Wäldern vorzufinden. Dies hängt wohl zum einen mit den mangelnden Nutzungsmöglichkeiten in der Forstwirtschaft und zum anderen mit der ungünstigen Ausbreitung der schweren Samen zusammen.
Wuchs: Die Rosskastanie ist bereits auf Entfernung an ihrer unregelmäßigen, wolkenförmigen Kronenstruktur erkennbar. Sie ist asymmetrisch, breit- kronig und kann bis zu 30 Meter hoch werden.
Der Stamm ist recht kurz, bis zu 2 m dick und zeigt häufig die typische Rechtsdrehwüchsigkeit, welche 90% der Rosskastanien aufweisen.[4] Die Wurzeln sind sehr tief und weit reichend.
Rinde: Die Rinde ist zunächst grau und glatt, mit der Zeit wird sie jedoch zu einer graubraunen, flachschuppigen und oft grobrissigen Borke. Holz: siehe „4.2 Aktuelle Nutzungsmöglichkeiten“ Triebe: Junge Zweige sind bis zu 2 cm dick, graubraun bis braun und weisen zahlreiche warzige Lentizellen (hellere Korkwarzen) auf.
Die Winterknospen sind rotbraun, eiförmig und sehr klebrig (Harzausscheidung zum Schutz gegen Wasser und Insekten). Sie sind mit 6-10 glänzenden, etwas filzigen Schuppen bedeckt.
Die gegenständigen Seitenknospen sind meist deutlich kleiner als die Endknospen, welche ca.
2 - 3,5 cm lang werden.
Die Laubblätter sind sehr groß, lang gestielt und stehen gegenständig am Spross. Sie sind handförmig gefiedert, mit 5 - 7 länglich verkehrteiförmigen Fiederblättchen, die am Grund keilförmig zugespitzt ansitzen.
Auffällig ist, dass sie am Ende eine „Träufelspitze" ausgebildet haben, wie man sie bei tropischen Bäumen findet, damit das Wasser schneller abfließen kann.
Die einzelnen Fiederblättchen können unterschiedlich groß sein, wobei das mittlere immer am größten ist. Der Rand der Blätter ist regelmäßig doppelt gesägt. Ihre Oberseite ist stumpf dunkelgrün und kahl, die Unterseite ist heller und an den Adern behaart.
An den Ansatzstellen der Fiederblättchen sind diese beweglich. Das ermöglicht der Rosskastanie mit ihrer Blattstellung einen Tag-NachtRhythmus zu vollziehen.
Das große, dichte Blattwerk der Rosskastanie sorgt für eine sehr starke Beschattung der Fläche unter ihr, kaum eine anderer europäische Baumart hat einen solch starken Schattenwurf.
Das Laub wird im Herbst goldgelb bis braungelb und fällt ab. Nach dem Laubfall hinterlassen die Blätter an den Zweigen große, hufeisenförmige Narben, in denen man die Leitbündel-Narben als Punkte erkennen kann.
Die Blüten stehen in endständigen, aufrechten, kegelförmigen, 20 - 30 cm langen Scheinrispen (Thyrsen). Diese „Blütenkerzen“ können über 100 einzelne Blüten enthalten. In der Krone einer Rosskastanie können sich bis zu 1000 solcher Blütenstände entwickeln.
Die Blütenkrone ist schief zweilippig (zygomorph) mit doppelter fünfzähliger Blütenhülle. Die Kronblätter sind eiförmig, lang genagelt und am Rand gewellt. Der Kelch ist glockenförmig. Ein gefärbtes Saftmal besitzen nur die beiden oberen Blütenblätter. Dieses ist entweder gelb oder orange bis rot.
Meist sind sieben Staubblätter zu finden (5 - 9), diese sind gebogen und überragen die Krone. Je Staubblatt ist beinahe die bekannte Höchstzahl an Pollen vorzufinden (26.000), je Blütenstand sind also etwa 42 Mio. Pollen möglich.
Die Rosskastanie ist polygam, wobei die meisten Blüten funktionell männlich sind. Diese stehen im oberen Teil des Blütenstandes. In der Mitte folgen vereinzelte Zwitterblüten, während im unteren Teil funktionell weibliche Blüten überwiegen.
Der Fruchtknoten ist dreifächrig und oberständig mit langem Griffel.
Die Blüten werden von Insekten bestäubt. Die Nektarien, kleine Höcker zwischen den Kron- und Staubblättern, bilden reichlich Nektar, der zu 40-76 % aus Zucker (vor allem Saccharose) besteht. Die Produktion erfolgt jedoch nur in der „gelben Phase“ (siehe 2.4)
Chromosomenzahl: 2n = 40
Der Fruchtknoten ist zur Reifezeit eine 5 - 7 cm große kugelige, grüne Kapsel mit einer Stachelhülle. Darin befinden sich in drei Fächern 1 - 3 Samen.
Beim Erreichen der Reife fällt die Kapsel vom Baum, platzt dreiklappig auf und lässt
die Samen heraus, welche dann noch etwas weiterrollen können.
Diese „Kastanien" sind bis 4 cm groß und bis zu 20 g schwer, rundlich- abgeflacht, haben eine glänzend braune, derbe Haut und einen großen hellbraunen Nabelfleck (Hilum). Ein großer Baum kann etwa 10.000 Früchte tragen.
Um dem in Samen enthaltenen Embryo den bestmöglichen Start zu geben, bestehen diese überwiegend aus den beiden Speicherkotyledonen des Embryos.
Sie sind sehr reich an Stärke und Mineralstoffen für die Versorgung in der ersten Wachstumsphase.
Die Gemeine Rosskastanie wird in der einschlägigen Literatur als Giftpflanze aufgeführt. Bedingt durch die enthaltenen Saponine und Flavon- glykoside sind Samen, Samenschale und Rinde für den Menschen und einige Tiere ungenießbar bitter und schwach giftig.
Als besonders gefährdet werden 2 - 6jährige Kinder eingestuft, die mit den Früchten spielen.
Mögliche Vergiftungserscheinungen: Erbrechen, Durchfall, Gastroenteritis, starker Durst, Unruhe, Angst, Rötung des Gesichts, Sehstörungen, Pupillenerweiterung (Mydriasis), Bewusstseinsstörungen, Müdigkeit Therapie: Erste Hilfe: Kohle-Pulvis 10g, ggf. Augen spülen.
Klinik: Nach wahrscheinlich großer Giftaufnahme Magenspülung (evtl. mit burgunderfarbener Kaliumpermanganatlösung), Instillation von 10g Kohle- Pulvis, Elektrolytsubstitution, Azidoseausgleich mit Natriumbikarbonat (Urin pH 7,5). Überwachung der Nierenfunktion, bei Krämpfen Diazepam (Valium ®), gegen Koliken Atropin, ggf. Intubation und Sauerstoff- beatmung.[5]
Von einem ausgewachsenen Rosskastanienbaum fallen die stacheligen Kapseln ab, wenn sie ihre Reife erreicht haben. Diese Schutzhülle dämpft den Fall, springt am Boden auf und entlässt die Samen ins Freie. Rollt dieser auf einen geeigneten Untergrund, muss er noch mit Erde oder Laub bedeckt werden, nur so kann eine Keimung der gegen Austrocknung sehr empfindlichen Samen erfolgen (hypogäische Keimung). Die Primärblätter sind den normalen Laubblättern bereits sehr ähnlich.
In der Jugend erfolgt das Wachstum der Sprosse monopodial (entlang der Hauptachse), die gegenständige Verzweigung ist akroton, d.h. die Spitze wächst im jedem Jahr weiter. Innerhalb mehrerer Jahre können Seitenzweige sich mehr und mehr aufrichten und mit der Hauptachse in Konkurrenz treten.
Insgesamt verzweigen sich Rosskastanien nur spärlich.
Entstehende Verzweigungen sind stark hypoton. Seitensprosse, die auf der Unterseite entspringen, werden gewöhnlich länger als jene auf der Oberseite.
Ein durchgehender Stamm und nach oben strebende Seitenäste führen zu einer kegelförmigen Krone. Ein solches Erscheinungsbild prägt die Gestalt einer jungen Rosskastanie bis zu ihrem Blühbeginn im Alter von 10 bis 15 Jahren.
Ab diesem Zeitpunkt kommt es zu einem abrupten Wechsel in der Verzweigung. Die Blüten stehen immer an der Sprossspitze. Blühende Triebe bilden deshalb keine Endknospen und können im nächsten Jahr nur an den Seitentrieben weiterwachsen. Das Sprosssystem wird dichasial aufgegabelt, wenn sich die beiden obersten gegenständigen Endknospen weiterentwickeln. Dies ist hauptsächlich bei aufrecht wachsenden Trieben in der Lichtkrone der Fall. Bei ausgeprägter Hypotonie, wie es vor allem in den Seitenästen vorkommt, entwickelt sich meist nur die untere Knospe weiter (monochasiale Verzweigung). Dieser Wechsel führt zu einer Veränderung im Habitus: Stamm und Äste lösen sich mehr und mehr auf und die Krone wird breiter und runder.
Da ihr Holz recht weich ist und nicht splittert, kann es einer Rosskastanie bereits nach einem heftigen Regen, der das Laub beschwert, passieren, dass dicke Äste abbrechen.
Je nach Witterung kann der Zeitpunkt, ab dem die Blätter und Blütenstände nach einem Winter sprießen, sehr stark schwanken. Normalerweise beginnt das Blattwachstum im März bis April.
Die Blütezeit ist gewöhnlich von Mai bis Juni. Mit dem Öffnen ihrer tausenden Blüten zieht die Rosskastanie besonders Bienen und Hummeln zur Bestäubung an.
Eine besondere blütenökologische Anpassung zwischen dem Baum und Insekten ist das farbige Saftmahl. Der Farbfleck der beiden oberen Kronblätter jeder Blüte ist zunächst gelb gefärbt. Nur diese Blüten produzieren Nektar. Nach ein bis zwei Tagen (bzw. nach einer Befruchtung) verfärbt sich das Saftmahl zunehmend rötlicher, bis es schließlich karminrot erscheint. Auch der Duft der Blüte ändert sich und die Nektarproduktion erlischt. Insekten erkennen diesen Unterschied und fliegen praktisch nur „gelbe Farbflecken" an.
Somit stellt die Rosskastanie sicher, dass ihre bestäubungsbereiten bzw. pollenspendenden Blüten möglichst alle besucht werden.
Nach der Bestäubung verdickt sich der Fruchtknoten und bildet nach und nach die bekannte stachelige Kapsel mit den Samen heran. Da wegen des hohen Gewichts der Früchte nur ein kleiner Teil der Blüten hierzu heranwachsen kann, werden überzählige junge Früchte frühzeitig abgeworfen. Ein großer Rosskastanienbaum hätte sonst bei vollem Besatz ein Gewicht von 10 Tonnen zu tragen.
Sind die Samen im September oder Oktober herangereift, so werden diese abgeworfen und eine neue Baumgeneration kann bei günstigen Bedingungen ihr Leben beginnen.
Mit Beginn des Spätherbstes verfärben sich die Blätter der Rosskastanie gelb bis braun und fallen ab.
Die Gewöhnliche Rosskastanie kann bis zu 200 Jahre alt werden.
2.5 Schädlinge
Da die Rosskastanie nicht selbst wieder nach Mitteleuropa einwandern konnte, sind auch die einheimischen Insekten wenig an sie angepasst. Insgesamt leidet diese Art wesentlich weniger unter Insektenfraß als einheimische Bäume. Vermutlich tragen hierzu auch die von der Kastanie produzierten Saponine bei, da sie offensichtlich den einheimischen Insekten nicht sonderlich zusagen.
Verschiedene Pilzarten führen bei der Rosskastanie, ebenso wie bei anderen Bäumen, zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Blattbräune und Phytophthora-Rindenfäule sind hierfür häufig auftretende Beispiele.
Auch vor tierischen Schädlingen ist Aesculus hippocastanum nicht vollständig gefeit. Die Ross- kastanien-Miniermotte sorgte durch ihre starke Verbreitung zu erheblichen Schäden an dieser Baumart. Auch Wollige Napfschildlaus, Rosskastanienmilbe und Rosskastanieneule sowie weitere Insektenarten können bei Massenbefall zu starkem Blattverlust und damit zu einer Schwächung von Rosskastanienbäumen führen.
Umfangreiche Ausführungen zu den Schaderregern an der Rosskastanie finden sich in „Beiträge zur Rosskastanie“ der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.
Neben den natürlichen Feinden sorgt, wie so häufig, auch der Mensch für eine Schädigung der Rosskastanie. Als Allee- und Zierbaum in Städten hat Aesculus sehr stark mit der Belastung durch Abgase und Streusalz zu kämpfen.
Insgesamt kann der Bestand dieser Gattung jedoch als weitgehend ungefährdet gesehen werden. Insbesondere, da er durch den Menschen immer wieder aufgeforstet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. II.37: Rosskastanienbaum am Stadtrand
III. Inhaltsstoffe der Rosskastanie
Diese Zusammenfassung berücksichtigt die Inhaltsstoffe der Rosskastanie (insbesondere der Samen), wie sie in den unterschiedlichen Veröffentlichungen und Literaturstellen aufgeführt werden (siehe Literaturverzeichnis):
- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF); LWF WISSEN 48;
Beiträge zur Rosskastanie; Lerchl Druck; Freising; 2005
- Bühring, Ursel; Freiburger Heilpflanzenblätter; Einheimische Arzneikräuter 4;
Freiburger Heilpflanzenschule; 2002
- Düll, Ruprecht und Kutzelnigg, Herfried; Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands;
Ein botanisch-ökologischer Exkursionsbegleiter; 6. Auflage; Quelle & Meyer; Wiebelsheim; 2005
- Roth, Lutz, Daunderer, Max und Kormann, Kurt; Giftpflanzen - Pflanzengifte
Vorkommen, Wirkung, Therapie, allergische und phototoxische Reaktionen;
4. Auflage; ecomed; Landsberg/Lech; 1994
- Schmidt, Olaf; Bauminfoblätter - Die Rosskastanie; Nr. 23
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Bundesverband e.V. (SDW); Bonn; ohne Jahr
Inhaltsstoffe, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, können mit einfachen Mitteln nachgewiesen werden und konnten in den experimentellen Untersuchungen (Kapitel V) auch für die Rosskastanie bestätigt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. III.1: Inhaltsstoffe in Rosskastaniensamen
Beschreibung:
Saponine ist die Bezeichnung für eine Gruppe von hauptsächlich sekundären Pflanzenstoffen, die in Wasser kollidale, seifenartige Lösungen bilden. (lat. sapo = Seife)
Sie werden nach Art ihrer Aglykone (der Sapogenine) in Steroid-, Steroidalkaloid- und Triterpensaponine unterteilt.
Die in den Rosskastanien vorkommenden Saponine gehören zu den Triterpensaponinen. Zu diesen zählen ca.
1500 bisher bekannte Substanzen. Über die Hälfte wiederum gehören, wie das Kastaniensaponin Aescin, zum Oleanan-Typ.
Bei Aescin handelt es sich um ein isolierbares Gemisch aus über 30 verschiedenen Saponinen, das zu 20-40% aus ß-Aescin besteht.
Wohl aufgrund der komplizierten Zusammensetzung finden sich in der Literatur recht unterschiedliche, zum Teil sogar widersprüchliche Angaben. Sollte dies der Fall sein, wird an gegebener Stelle auf die entsprechende Literatur verwiesen.
ß-Aescin ist ein Glykosid des Protoaescigenins oder des Barringtogenol C, Polyole des Oleanan-Typs. Protoaescigenin (12-Oleanen-3ß,16a,21ß,22a,24,28-hexaol) hat die Summenformel C30H50O6 und eine relative Molekülmasse (MR) von 506,72.
Das ß-Aescin hat die Summenformel C54H84O231 (C55H86O24[6] [7] )und ein Molekulargewicht von 11001 (1131,272). Die CAS-Nummer lautet 11072-93-8.
Das früher beschriebene a-Aescin ist ein Gemisch aus ß-Aescin und dem hämolytisch inaktiven Kryptoaescin (bei diesem ist ein Acetylrest an die C-28 CH2OH-Gruppe gebunden). In einem Gemisch liegen die beiden etwa im gleichen Verhältnis vor.[8]
Eigenschaften:
Das Saponingemisch Aescin ist trotz der unterschiedlichen Komponenten insgesamt isolierbar. Es bildet Kristalle und hat eine Schmelztemperatur von 222-225°}.
Aescin hat einen bitteren Geschmack und bildet in Wasser eine seifenartige Lösung. Beim Schütteln bildet sich ein stabiler Schaum.
Wie Seifen haben auch diese sekundären Pflanzenstoffe eine emulgierende Wirkung.
Biologisch gesehen, wirken Saponine sehr einheitlich. Sie beeinflussen die Membranpermeabilität und zeigen deshalb auch eine hämolytische Wirkung (das Hämoglobin tritt aus den Erythrocyten aus). Aus diesem Grund sind Saponine als piscizid eingestuft. Sie sorgen für ein Austreten der Blutbestandteile aus den Kiemen der Fische.
Außerdem reizen sie die Schleimhäute, wodurch es zu erhöhter Drüsensekretion kommt. Viele Saponine wirken auf Pilze wachstumshemmend.
Vorkommen und Gewinnung:
Die Gruppe der Saponine ist bei den Pflanzen weit verbreitet, sie kommen insbesondere im nährstoffreichen Gewebe der Blätter, Rinde, Wurzeln, Knollen und Früchte vor.
Als einzige Gruppe im Tierreich können einige niedere Tiere, wie Seesterne, Seegurken und Seewalzen ebenfalls Saponine erzeugen.
Zur Gewinnung müssen die entsprechenden Pflanzenteile nur zerkleinert werden, um die Saponine mit einem geeigneten Lösungsmittel herauslösen zu können.
Bedeutung und Verwendung:
Wegen der fungiziden Wirkung haben Saponine in Pflanzen wahrscheinlich die Funktion eines Abwehrstoffs.
Die Erwähnung pflanzlicher Seifenstoffe findet sich bereits im 16. Jahrhundert. Die Namensgebung vieler Pflanzen lässt jedoch darauf schließen, dass Saponine zum Waschen bereits wesentlich früher eingesetzt wurden. In Krisenzeiten (z.B. nach den Weltkriegen) wurde auch im 20. Jahrhundert Seife und Waschmittel aus Kastanienextrakt hergestellt.
Als Lebensmittelzusatzstoff E999 dürfen Saponine in Getränken, Zahnpasta und Shampoos als Schaumbildner eingesetzt werden.
In der Medizin kommen Extrakte der Rosskastaniensamen aufgrund ihres Aescingehalts in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Sie wirken venotonisch und werden deshalb bei Venenerkrankungen eingesetzt. Außerdem haben sie eine ödemhemmende Wirkung.
Beschreibung:
Bei dem Stoff Aesculin handelt es sich um ein 6,7-Dihydroxycumarinderivat. Die vollständige chemische Bezeichnung lautet 6-ß-D-Glucopyranosyloxy-7-hydroxicumarin.
Das in der Literatur häufig gleichgesetzte Aesculetin (6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2- on) besitzt keinen glykosidisch gebundenen Glucoserest. Aesculin ist also ein Glykosid aus Aesculetin und Glucose.
Eigenschaften:
Aesculin bildet bitter schmeckende, nadelförmige Kristalle aus, die 1,5 Mol H2O enthalten.
Wie es für die meisten Cumarine beschrieben ist, zeigt Aesculin unter UV-Licht (λ=366 nm) eine intensiv blaue Fluoreszenz.
Bereits 1929 wurde diese Eigenschaft der Cumarine von Krais (?) beschrieben.
Laut Hilbert Wagner („Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe“) soll diese bis zu einer Verdünnung von 3Ю'6 g/l sichtbar sein.
Die Fluoreszenz von Aesculin kann durch Pin- akolisierung gelöscht werden.
(siehe Experimentelle Untersuchungen)
Dihydroxycumarine sind neben der Rosskastanie auch noch in anderen Pflanzen zu finden, z.B. Tollkirsche, Stechapfel, Fingerhut und Esche. Diese sind jedoch meist andere Cumarinderivate mit ähnlichen Eigenschaften.
In der Rosskastanie ist Aesculin hauptsächlich in der Rinde und in den Blättern festzustellen. Entgegen den Berichten in der Fachliteratur enthalten aber auch die Rosskastaniensamen einen Aesculinanteil (siehe: Experimentelle Untersuchungen)
Bedeutung und Verwendung:
Einige Cumarinderivate wirken fungizit und könnten von der Pflanze deshalb als Defensivstoff eingesetzt werden.
Zudem hemmen einige Vertreter das Keim- und fördern das Wurzelwachstum. Möglicherweise haben Cumarine bei Pflanzen somit eine physiologische Funktion.
Fluoreszierende Pflanzenstoffe haben zudem generell die Aufgabe, die Gene vor Veränderungen durch UV-Strahlung zu schützen. Sie absorbieren die energiereiche Strahlung und geben sie in einem anderen Wellenlängenbereich wieder ab.
Früher wurden Cumarine in Lebensmitteln zur Korrektur von Geschmack und Geruch zugesetzt. Da ihnen jedoch in Tierexperimenten leberschädigende und cancerogene Eigenschaften nachgewiesen wurden, ist eine Verwendung als Aromastoff heute verboten.
Die Cumarine der Rosskastanie werden in der Medizin aufgrund ihrer antiphlogistischen, ödemhemmenden und zirkulationsfördernden Wirkung in Salben und Cremes eingesetzt. Die Eigenschaft, bestimmte UV-Strahlung zu absorbieren macht Aesculin für Zusätze in Sonnenschutzmitteln geeignet.
Die Fähigkeit UV-Licht in blaues Licht umzuwandeln ist außerdem in der Textilindustrie von Bedeutung. Moderne optische Aufheller wurden in Anlehnung an diese Eigenschaft einiger Cumarine entwickelt und Aesculin könnte als solcher einsetzt werden.
Beschreibung:
Kohlenhydrate oder Saccharide (sacchar = Zucker) sind Verbindungen, die nach der allgemeinen Summenformel Cn(H2O)m beschrieben werden können.
Zucker werden mit der Endung -ose kenntlich gemacht.
Sie werden von grünen Pflanzen bei der Photosynthese aufgebaut und bilden die wichtigste Energiequelle der Lebewesen.
Die Kohlenhydrate lassen sich in 4 Gruppen einteilen:
- Monosaccharide: Diese lassen sich nicht mehr in kleinere Zucker zerlegen.
- Disaccharide: Sie bestehen aus zwei verknüpften Monosacchariden.
- Oligosaccharide: Bei ihnen sind 3-9 Monosaccharide verknüpft.
- Polysaccharide bestehen aus bis zu mehreren Tausend Einfachzuckern.
Monosaccharide sind ihrer Struktur nach mehrwertige Alkohole mit einer Aldehyd- oder Ketogruppe. Man unterscheidet sie deshalb in Aldosen und Ketosen.
Aufgrund der Tatsache, dass Monosaccharide ein oder mehrere asymmetrische Kohlenstoffatome besitzen, werden sie, je nach Stellung der OH-Gruppe an dem asymmetrischen C-Atom, das am weitesten von der Aldehyd-/Ketogruppe entfernt ist, in D (von dexter = rechts) oder L (laevus = links) eingeteilt. Nicht alle möglichen Enatiomere kommen jedoch in der Natur vor.
Eine weitere Einteilung erfolgt über die Drehung von polarisiertem Licht in wässrigen Lösungen. Hier wird dann entsprechend dem Namen ein - oder + beigefügt.
Wie sich bei wässrigen Lösungen auch feststellen lässt, sind nicht alle z.B. GlucoseMoleküle einheitlich aufgebaut. Sie liegen in zwei unterschiedlichen Formen vor und nur ein kleiner Teil bildet eine offene Kohlenstoffkette mit freier Aldehydgruppe. Die meisten Glucose-Moleküle sind ringförmig gebaut. Beide Formen lagern sich jedoch leicht ineinander um.
Eigenschaften:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insgesamt sind sich Glucose und Fructose in ihren Eigenschaften recht ähnlich. Beide wirken reduzierend und können von Mikroorganismen vergoren werden.
Fructose hat von allen Sacchariden die größte Süßkraft.
Vorkommen und Gewinnung:
Fructose und Glucose werden von Pflanzen bei der Photosynthese gebildet. Sie kommen in vielen Früchten vor und verleihen ihnen ihre Süße. Glucose ist besonders reichlich in Trauben zu finden, Fructose in vielen süßen Früchten, aber auch in Bienenhonig und Gemüse.
Das Disaccharid „Saccharose“ besteht aus je einem Molekül D-Glucose und D-Fructose. Es wird auch als Rohrzucker oder Rübenzucker bezeichnet und bildet den technisch gewonnenen Haushaltszucker.
Im Körper kann dieser wieder zu Fructose und Glucose gespalten und aufgenommen werden.
Glucose und Fructose werden von Pflanzen als Energielieferanten bei der Photosynthese aus Sonnenlicht, CO2 und Wasser produziert. Alle tierischen Lebewesen sind direkt oder indirekt auf diese Kohlenhydrate angewiesen, da sie neben Energie auch die Ausgangsstoffe für die Synthese von Fetten und Proteinen liefern. Somit hängt alles Leben unmittelbar oder mittelbar von Kohlenhydraten ab.
Der Glucosegehalt im menschlichen Blut liegt etwa bei 0,1%. Einige Teile unseres Körpers sind völlig auf die Energieversorgung mit diesem Monosaccharid angewiesen.
Zum Süßen von Speisen und Getränken und auch bei der Herstellung von Alkohol bilden Glucose und Fructose die Grundlage.
Beschreibung:
Stärken sind Polysaccharide, die aus 500 - 2.900 miteinander verknüpften Glucoseeinheiten bestehen. Normalerweise liegen sie in Pflanzen als Stärkekörner vor. Diese bestehen aus 2 Arten von Stärke:
- der a-Amylose (ohne Verzweigungen (linear), jedoch schraubenförmig gewunden, nur a-1,4-glycosidisch verknüpft), die 20% des Stärkekorns ausmacht.
- dem Amylopektin (mit Verzweigungen innerhalb des Moleküls, a-1,6-glycosidisch und a-1,4-glycosidisch verknüpft), das 80% darstellt.
Im Stärkekorn sind Amylose und Amylopektin räumlich getrennt. Die Amylose befindet sich im Inneren, das Amylopektin bildet die Hüllschicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Je nach Pflanzenart sehen die Stärkekörner unterschiedlich aus.
Eigenschaften:
Amylose ist in heißem Wasser löslich, Amylopektin quillt oberhalb von 60°C in Wasser zwar auf, löst sich jedoch nicht.
Stärke kann bei Wärme sehr viel Wasser aufnehmen und aufquellen, bei Temperaturen über 55°C-87<C (je nach Sorte) platzen die Körner au f und bilden Stärkekleister. Das ist eine klebrige, viskose Flüssigkeit, die beim Abkühlen zu einer Gallerte erstarrt.
Elementares Iod kann sich in die Spiralwindungen von Amylose schieben. Hierdurch entsteht eine typische Blaufärbung (andere Lichtbrechung), die als Stärkenachweis dient. Erwärmt man die Amylose, so verschwindet diese Färbung, da das Iod wieder aus dem Hohlraum des Moleküls tritt.
Durch verdünnte Säuren oder Enzyme kann Stärke wieder in die aufbauenden Zucker gespalten werden.
Stärke kommt als Speicher- und Aufbaustoff in praktisch allen Pflanzen vor. Insbesondere in Knollen von Kartoffeln (21%), in Weizen (58-64%), Mais (30-35%) und Reis (70-75%), aber auch in Kastaniensamen (30-60%) ist sie zu finden.
Die Stärke kann durch das Aufbrechen der sie enthaltenden Zellen gewonnen werden. Hierbei werden die Knollen oder Körner zunächst komplett zermahlen und danach in Wasser unter Reiben durch ein Sieb gedrückt. Anschließend wird die Stärke getrocknet und kann weiterverarbeitet werden.
Bedeutung und Verwendung:
Für alle Landpflanzen und die Grünalgen bildet Stärke den Reservespeicher für überschüssige Energie. Der Sinn, der dahinter steht, ist die Speicherung von Glucose in unlöslicher Form und somit eine Umgehung des Problems mit dem osmotischen Druck. Stärke kann ohne den Einsatz von viel Wasser eingelagert werden.
Für den Menschen und viele Tiere ist Stärke ein wichtiger Nährstoff. Durch Enzyme im Mundspeichel, der Bauchspeicheldrüse und des Dünndarms wird Stärke zunächst in Maltose und dann in Glucose aufgespaltet. Diese kann dann vom Körper absorbiert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch für die Industrie bildet Stärke ein wichtiger Rohstoff. Aus ihr werden neben Verdickungs- und Bindemitteln für Lebensmittel auch Leime und Kleber, Grundstoffe für Kunststoffe, Zutaten für Kosmetika und Papier gewonnen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. III.14: Daten zur Stärkeproduktion
3.5.1 Flavonoide*
Beschreibung:
Flavonoide (von lat. flavus = gelb) sind sehr häufig vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe aus der Gruppe der Polyphenole. Sie finden sich in allen höheren Pflanzen und bestehen generell aus 3 Kohlenstoffringen mit zwei aromatischen (A & B) und einem O- heterozyklischen Ring (C). Anhand der Unterschiede am „C-Ring" lassen sich die Flavonoide in 6 Gruppen einteilen: Flavonole,
Flavanole, Flavanone, Flavone,
Athocyane und Isoflavonoide.
Aufgrund der vielen möglichen Modifizierungen am Grundgerüst ist eine große strukturelle Vielfalt möglich. Bisher wurden etwa 6.500 verschiedene Strukturen entdeckt.[9]
Die Flavoniode wurden von Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt in den 1930er Jahren entdeckt und zunächst als Vitamin P bezeichnet.
Eigenschaften:
Der größte Teil der Flavonoide kommt in der Natur nicht frei (Aglykon), sondern in Form von Flavoinglykosiden vor. (Nur die Flavanole und die Proanthocyanidine bilden hier eine Ausnahme.) Über 80 verschiedene Zucker wurden bisher in Flavonglykosiden nachgewiesen, darunter D-Glukose, D-Galaktose, L-Rhamnose, L-Arabinose, D-Xylose und D-Apiose. Aufgrund dieser Tatsache sind Flavonoide vorwiegend wasserlöslich.
Es wird geschätzt, dass 2% des gesamten Kohlenstoffs, der durch Photosynthese in Pflanzen eingebaut wird, zu den Flavonoiden und deren Derivaten umgesetzt wird. Das wären etwa 10 Billionen Tonnen pro Jahr.
Durch Biosynthese werden diese Pflanzenstoffe über viele Zwischenschritte aus der bei Photosynthese gewonnenen Glucose gebildet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich bei Peter Nuhn in „Naturstoffchemie“ auf Seite 536.
Praktisch alle höheren Pflanzen besitzen einen Anteil an Flavonoiden. Je nach Art kann dieser sehr unterschiedlich sein, aber auch das Klima kann eine Rolle spielen. Wird durch stärkere Belichtung mehr Photosynthese betrieben, steigt auch der Anteil der Flavonoidglykoside im Pflanzengewebe. Die Flavonoide befinden sich überwiegend in den Randschichten der Pflanzen sowie in den Blättern. Dort sind sie vorwiegend, gelöst in Wasser, in den Vakuolen zu finden.
Der Mensch nimmt diese Pflanzenstoffe gewöhnlich aus der Nahrung auf. Sie werden über den Dünndarm absorbiert und somit in den Körper aufgenommen.
Über die technische Gewinnung dieser Stoffgruppe ist in der Literatur kein Hinweis zu finden. Dennoch gibt es verschiedene Angebote an Kosmetika, die unterschiedliche Flavonoide als Inhaltsstoffe angeben.
Bedeutung und Verwendung:
Pflanzen nutzen ihre Flavonoide als Farbstoffe bzw. als Grundlage zur Farbstoffbildung.
Für den Menschen haben diese Pflanzenstoffe unterschiedliche Wirkungsmöglichkeiten. Verschiedene Tierversuche haben gezeigt, dass Flavonoide bei der Krebsvorbeugung und bei der Krebstherapie positive Einflüsse haben, deshalb wird dies auch für den Menschen angenommen. Sie können in direkte Wechselwirkung mit DNA treten und diese durch Anlagerung an die Enden vor Kanzerogenen schützen.
Flavonoide sind Antioxidanzien, die sowohl im Hydrophilen als auch im Lipophilen wirken können. Sie sind deshalb fähig, im Körper schädigende Radikale abzufangen.
Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flavonoiden wurde auch ein positiver Effekt auf das Herz-Kreislauf-System festgestellt, da sie die Blutgerinnung beeinflussen können. Eine positive Wirkung auf Entzündungsreaktionen konnte ebenfalls bewiesen werden.
Eine normale Aufnahme an Flavonoiden über die Nahrung beinhaltet keine Risikofaktoren. Nur wenn eine Überdosierung eintritt, können negative Folgen nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist diese Stoffgruppe auch in Büchern über Pflanzengift zu finden.
a) Kaempferol
Beschreibung:
Kaempferol (chem.: 3,4’,5,7-Tetrahydroxiflavon) gehört innerhalb der Flavonoide zur Klasse der Flavonole. Die Summenformel lautet Ci5H10O6 und es besitzt eine relative Molekülmasse (MR) von 286,24.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eigenschaften:
Kaempferol bildet beim Trocknen eine gelbe, nadelige Kristallstruktur aus. Seine Schmelztemperatur liegt bei 276-278°C.
Ebenso wie die anderen Vertreter der Flavonoide kann Kaempferol die unterschiedlichsten Zucker anlagern und so viele verschiedene Glykoside bilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kaempferol ist neben Quercentin in Form unterschiedlichster Glykoside als eines der häufigsten Flavonoide in Pflanzen vertreten.
Es wird durch die Nahrung vom Menschen aufgenommen. Endivien, Brokkoli und Grünkohl sind Pflanzen mit recht hohem Kaempferolgehalt.
Bedeutung und Verwendung:
In der Pigmentschicht verschiedener Pflanzen bildet Kaempferol hellgelbe Pigmente.
Die bei den Flavonoiden beschriebenen Wirkungsweisen treffen auf diesen Stoff ebenfalls zu. Aus diesem Grund wird er in Arzneimitteln und als Zusatzstoff in Kosmetika eingesetzt.
Bei der photometrischen Bestimmung von Ga, In und Sn(IV) können 0,3%ige Lösungen von Kaempferol verwendet werden.
b) Quercetin
Beschreibung:
Quercetin hat die chemische Bezeichnung 3,3’,4’,5,7-Pentahydroxyflavon.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Summenformel ist C15H10O7 und die relative Molekülmasse (MR) beträgt 302,24. Aufgrund seines Aufbaus gehört es zur Klasse der Flavonole. Es trägt die CAS- Nummer 117-39-5
Eigenschaften:
Quercetin bildet beim Trocknen eine zitronengelbe, nadelige Kristallstruktur aus. Seine Schmelztemperatur liegt bei 312-316‘C, darüber begin nt es sich zu zersetzen. Bei 95°C- 97°C beginnt es, sein Kristallwasser zu verlieren.
Der Stoff ist in Wasser schlecht, in siedendem Ethanol, Essigsäure und verd. Natronlauge gut löslich.
Ebenso wie die anderen Vertreter der Flavonoide kann Quercetin die unterschiedlichsten Zucker anlagern und so viele verschiedene Glykoside bilden.
Quercetin und einige seiner Glykoside wirken in höheren Dosen giftig. Der LD50-Wert bei einer Maus liegt bei 160 mg/kg.
Quercetin ist in Form unterschiedlichster Glykoside als eines der häufigsten Flavonoide in Pflanzen vertreten.
Es ist weit verbreitet in Baumrinden, Schalen von Früchten und Blättern (auch der Rosskastanie) sowie in gelben Blüten.
Das Isoquercitrin (Quercetin-3-O-ß-D-glucofuranosid) kommt auch in den Blüten der Rosskastanie vor.
Es wird durch die Nahrung vom Menschen aufgenommen. Grünkohl, Zwiebeln aber auch Äpfel und grüne Bohnen sind Pflanzen mit recht hohem Quercetingehalt.
Über die Pulverisierung von Rinde (z.B. der Färbereiche) kann ebenfalls dieser gelbe Stoff gewonnen werden.
Bedeutung und Verwendung:
Quercetin dient vielen Pflanzen als Farbstoff in Blüten, Blättern und Früchten.
Früher wurde Quercetin zum Färben und Bedrucken von gebeizter Wolle und Baumwolle verwendet.
Es hat wie Kaempferol und andere Flavonoide eine antioxidative Wirkung und wurde früher auch als Schutzmittel gegen UV-Strahlung eingesetzt.
Heute ist es noch vielen Naturheilprodukten zugesetzt.
Quercetin gilt als Enzymhemmstoff und wirkt als Mutagen auf Mikroorganismen und Insekten.
c) Rutin
Beschreibung:
Rutin wird in vielen Veröffentlichungen auch als Vitamin P bezeichnet. Sein chemischer Name lautet 3,3’,4’,5,7-Pentahydroxyflavon-3-O-ritinosid, die Summenformel C27H30O16 und eine MR von 610,53. Die CAS-Bezeichnung ist 153-18-4.
Betrachtet man den Aufbau, so handelt es sich bei Rutin um ein Glykosid des Quercetins mit dem Disaccharid Rutinose.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Rutin wurde 1842 von dem Nürnberger Apotheker Weiss erstmals aus der Gartenraute isoliert.
Eigenschaften:
In Reinform bildet Rutin blassgelbe bis grünliche Nadeln mit 3 Mol Kristallwasser aus. Wasserfreies Rutin wird braun bei 125C.
Die Schmelztemperatur liegt bei 188-190‘C, bei 214-2 15°С zersetzt sich dieser Stoff.
Trockenes Rutin ist hygroskopisch und hat die Eigenschaften einer schwachen Säure. Es ist schlecht wasserlöslich, löst sich jedoch gut in Ethanol, Aceton und auch in Laugen.
Die letale Dosis (LD50) beträgt bei Mäusen 950 mg/kg.
[...]
[I] Ergänzung: 29.09.07: Siehe Seite 169
[II] Karl von Linnè (1707-1778); Begründer der Artdiagnostik und der binären Nomenklatur
[III] Bühring, Ursel; Freiburger Heilpflanzenblätter; Einheimische Arzneikräuter 4; 2002; S. 62
[4] Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF); LWF WISSEN 48; S. 13
[5] Roth, Lutz, Daunderer, Max und Kormann, Kurt; Giftpflanzen - Pflanzengifte; S.99f
[6] nach Roth, Lutz, et al.; Giftpflanzen - Pflanzengifte; Landsberg/Lech; 1994; S. 750
[7] nach Fugmann, Burghard et al.; Römpp-Lexikon; Naturstoffe; Stuttgart; 1997; S. 9
[8] Wagner, Hildebert et al.; Pharmazeutische Biologie Teil 2; Arzneidrogen Arzneidrogen und ihre Inhaltstoffe; Stuttgart; 1999; S. 211
[9] Watzl, Bernhard et al.; Basiswissen aktualisiert; Flavonoide; Ernährungs-Umschau 48; Heft 12; 2001; S. 498
- Arbeit zitieren
- Philipp Weber (Autor:in), 2006, Chemie der Kastanie: Schulrelevante Experimente mit Rosskastanien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186410
Kostenlos Autor werden

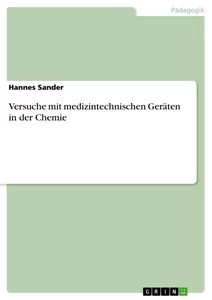


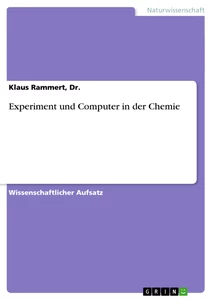


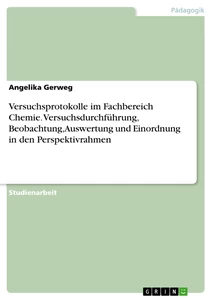
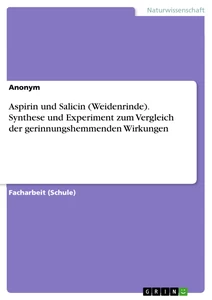


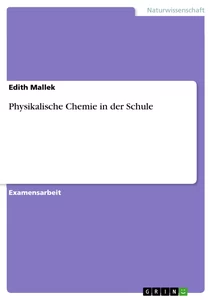





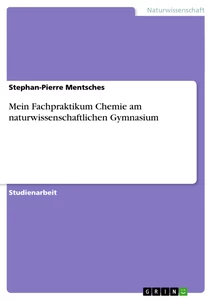


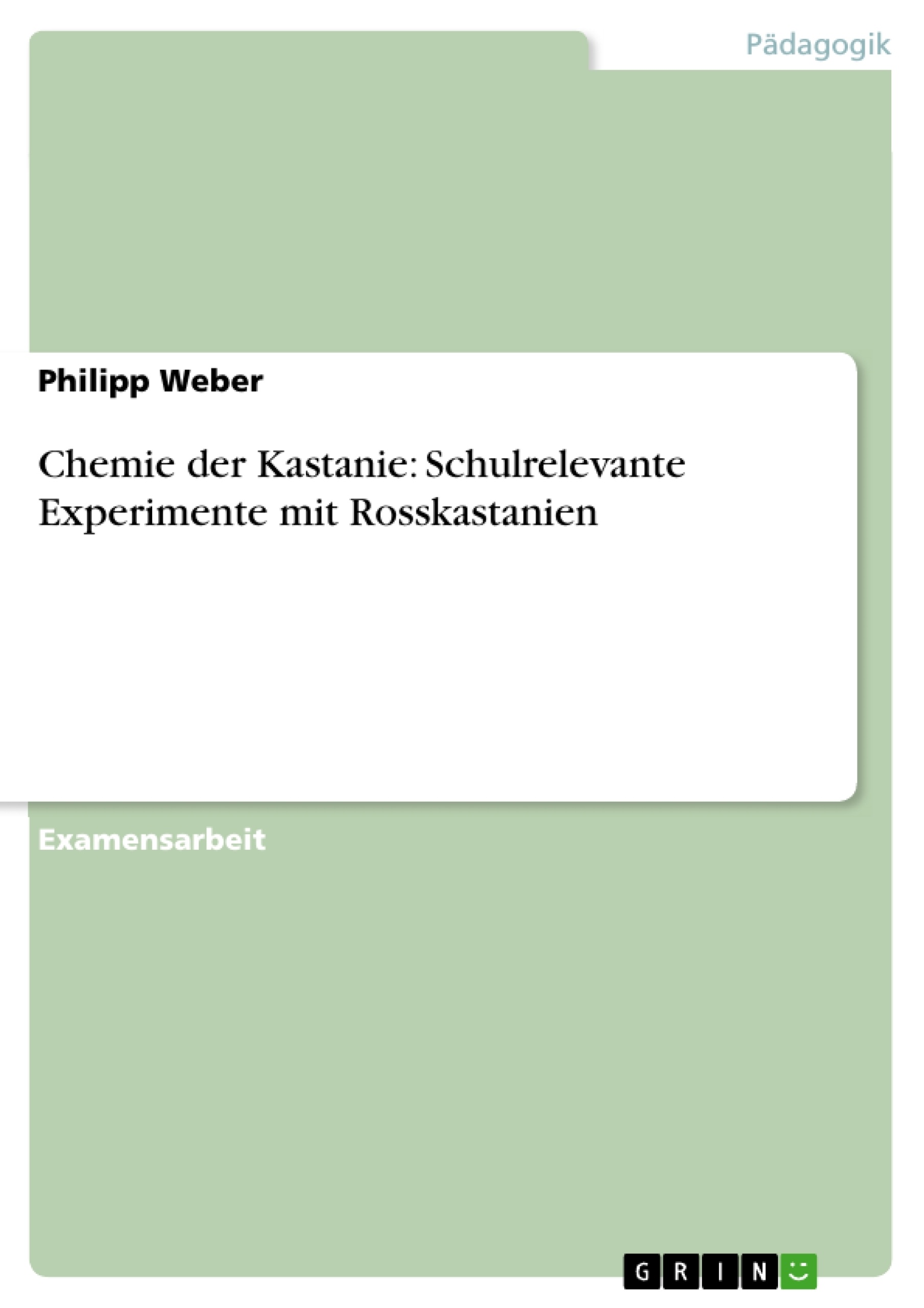

Kommentare