Leseprobe

![]()
Abkürzungsverzeichnis
![]()
Einleitung 1
I. Einleitung
Einleitung 2
meinsam auf die enorme Bedeutung des spezifischen Wissens in einem Unternehmen hin; eben dieses fließt zunehmend in Prozesse, Produkte und Dienstleistungen ein und wird gleichzeitig mehr und mehr selbst zur Ware (vgl. z.B. ebd. S.37ff). Vor diesem Hintergrund wurde die, durch besondere Eigenschaften gekennzeichnete, Ressource Wissen als zentraler „neuer“ Produktions- und Wettbewerbsfaktor „entdeckt“. In Abkehr vom industriellen Paradigma wird in der Folge ein neues Wissensparadigma propagiert (vgl. Romhardt 1998 S.2). Es ist zwar offensichtlich, dass sich Unternehmen schon immer mit dem Umgang mit Wissen beschäftigt haben, zumal jede individuelle und kollektive Handlung größtenteils wissensgeleitet geschieht, aber unter der neuen Perspektive werden Unternehmen explizit als wissensverarbeitende Systeme betrachtet, für die das zielgerichtete und reflektierte Management von Wissen eine Möglichkeit bietet, den gewandelten Wettbewerbsbedingungen dauerhaft gerecht zu werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil durch die reflexive Gestaltung von Wissensprozessen die Realisierung des schon älteren Ideals einer lernenden Organisation möglich erscheint. Die Popularität des Wissensmanagements in Deutschland ist seit Mitte der 90er Jahre ungebrochen. Unzählige Veröffentlichungen und eine weite Verbreitung in der Beratungs- und Konferenzenszene zeugen davon, inzwischen werden sogar die ersten eigenen Studiengänge (Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.12) eingerichtet. Vielzitiertes empirisches Zahlenmaterial sorgt für zusätzlichen Auftrieb: So schätzt die Mehrheit der deutschen Unternehmen, dass der Anteil des Wissens an der Wertschöpfung über 50 Prozent beträgt (Bullinger/Prieto 1998 S.94), gleichzeitig werden aber nur knapp 40 Prozent des vorhandenen Wissens genutzt (Gentsch 1999 S.5;Pawlowsky 1999 S.114) und es wird von 30-prozentigen Produktivitätssteigungen durch Wissensmanagement gesprochen (Bullinger u.a. 1998a S.21) 1 .
Die gestiegene Bedeutung von Wissen als Unternehmensvermögen macht also dessen bewusste Bewirtschaftung erforderlich, wodurch letztlich Wettbewerbsvorteile generiert werden sollen. Konkreter ausgedrückt sollen durch Wissensmanagement eine bessere Koordination, eine bessere Ausnutzung vorhandenen Wissens und eine Förderung von Innovationen erreicht werden (vgl. Schneider 2001 S.19f). Dabei ist Wissensmanagement untrennbar mit den Fortschritten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) verbunden. IuK kann zugleich als Auslöser und Bedingung
Einleitung 3
bzw. „Enabler“ des Wissensmanagements betrachtet werden. Zum einen steigert sie die Menge der potentiell zur Verfügung stehenden Informationen enorm (z.B. durch das Internet) und ist damit selbst eine Ursache für die Notwendigkeit, diese besser zu organisieren, zum anderen wird die Organisation vieler wissensbezogener Prozesse erst durch sie ermöglicht. Mit Blick auf den zuletzt genannten Punkt kommt unter den vielen im Kontext des Wissensmanagements diskutierten informationstechnologischen Werkzeugen den sogenannten intranetbasierten Datenbanksystemen eine herausragende Rolle zu. Diese finden in der Praxis eine zunehmende Verbreitung, weil sie wichtige Prozesse des Wissensmanagements unterstützen können: Indem sie helfen Wissensbestandteile langfristig zu bewahren und Transparenz über vorhandene Wissensbestände des Unternehmens herstellen, verbessern sie die Bedingungen für den Austausch von Wissen zwischen den Mitarbeitern und können auf diese Weise dazu beitragen, dass Wissen besser ausgenutzt wird sowie indirekt auch die Generierung neuen Wissens fördern. Typische Wissensprobleme, wie z.B. die Wiederholung der gleichen Fehler oder das ständige „Neuerfinden des Rades“, sollen so vermieden werden.
In der Pionierphase des Wissensmanagements konzentrierte sich dessen Verwirklichung in den Unternehmen häufig einseitig auf die Einrichtung unterschiedlicher informations-und kommunikationstechnischer Instrumente (häufig unter der Federführung der IT-Abteilungen). Dieses technische Bias ist inzwischen der Einsicht gewichen, dass der effiziente Einsatz von Wissensmanagement eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens erfordert, d.h. um tatsächlich Erfolge im Umgang mit Wissen zu erzielen gilt es, neben der technischen Dimension zusätzlich kulturelle, personelle und organisatorische Aspekte zu berücksichtigen. Zwei Gedanken schließen daran an. Erstens gibt es Instrumente und Maßnahmen im Wissensmanagements, die kaum in Zusammenhang mit der technischen Infrastruktur stehen, zweitens ist aber davon auszugehen, dass innerhalb eines weit größeren Gestaltungsbereiches strukturelle, kulturelle und personelle Maß- nahmen in einem engen Wechselverhältnis zur technischen Dimension stehen. Dieser zweite Gedankengang führt zur Zielsetzung der vorliegenden Arbeit: Im Folgenden geht es darum, die Implementation intranetbasierter Datenbanken in den Kontext des Wissensmanagements einzuordnen. Ausgehend von ihren angestrebten Funktionen steht dabei die Frage im Mittelpunkt, welche organisationalen und motivationalen Funktionsvoraussetzungen existieren und wie diese im Unternehmen zu realisieren sind, damit Datenbanken entsprechend ihrer Zielsetzung erfolgreich implementiert werden können. Dabei wird von der These ausgegangen, dass notwendige Funktionsvoraussetzungen,
Einleitung 4
neben der Gestaltung technischer Aspekte, vor allen Dingen Veränderungen im kulturel- personellen und strukturellen Bereich erfordern, denn der Optimierung des Umgangs mit Wissen stehen zunächst viele Barrieren und Problemfelder entgegen. Um nur einige zu nennen, ist darauf hinzuweisen, dass sich ein Großteil des Wissens im Besitz der Mitarbeiter befindet, die Bereitschaft, Wissen an Datenbanken „abzugeben“ und bereitwillig untereinander auszutauschen, kann nicht vorausgesetzt werden. Gerade der gestiegene Stellenwert, den Wissen durch ein explizit betriebenes Wissensmanagement erhält, kann Widerstände bei den Mitarbeitern hervorrufen und zur Zurückhaltung ihrer Ressource aus Eigeninteresse führen. Auch die Anwendung von Wissensbestandteilen aus Datenbanken und mögliche Lerneffekte sind nicht voraussetzungsfrei, u.a. weil die Anwendung fremden Wissens immer einen „Zumutungsaspekt“ (Soukup 2001 S.155) beinhaltet; verschärft wird dieses Problem dadurch, dass Wissen immer kontextabhängig und personengebunden ist 2
Einleitung 5
orientierten Ansatzes darzulegen. Abschließend wird die aktuelle und umfassende stra- Relevanz von Wissensmanagement herausgearbeitet, u.a. in der Auseinandersetzung mit dem bekannten Phänomen der Managermoden. Kapitel II.2 widmet sich den theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements, zentrale Begriffe werden vorgestellt und diskutiert. Hier findet sich eine ausführliche Diskussion des komplexen Wissensbegriffes. Wissen besitzt eine andere Qualität als Daten oder Informationen, außerdem enthält es implizite und explizite Bestandteile. Seine besonderen Ressourceneigenschaften verleihen Wissen seinen Wert, müssen aber im Umgang mit ihm auch adäquat berücksichtigt werden. Des Weiteren wird in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lernebenen und -typen deutlich, wie und wo Wissen in Unternehmen entstehen kann und was es in diesen Prozessen zu berücksichtigen gilt. Nicht zuletzt bei der Erläuterung der organisatorischen Wissensbasis zeigt sich dabei die Nähe des Wissensmanagements zum Konzept der lernenden Organisation. Nachdem in Kapitel II.3 einige prominente Ansätze skizziert und in ihrer Bedeutung für die Implementation von Datenbanken abgetastet wurden, schließt Kapitel II.4 mit der Darstellung einiger organisationstheoretischer Überlegungen den zweiten Teil ab. Dort wird unter einem handlungstheoretischen Zugang dargelegt, auf welche Weise Wissen als wichtige Machtressource im Unternehmen fungieren kann, außerdem werden die begrenzten Kontrollmöglichkeiten in einem Unternehmen sowie die Interdependenz von Handlungen und Strukturen begründet. Teil III der Arbeit beginnt mit der Beschreibung des Intranets, welches als Basistechnologie den vernetzten Zugang zu Datenbanken erst ermöglicht, des Weiteren werden einige technologische Instrumente des Wissensmanagements überblicksartig vorgestellt (Kapitel III.1). Im Anschluss (Kapitel III.2) werden Datenbanken detailliert beschrieben. Hier geht es darum, technische Unterschiede und Potentiale zu erklären sowie die wichtigsten Datenbanktypen im Wissensmanagement zu klassifizieren, um auf dieser Basis, die im Mittelpunkte der Arbeit stehenden, intranetbasierten Datenbanksysteme abgrenzen zu können. Anschließend werden deren typische wissenslogistische Funktionen im Wissensmanagement dargestellt und sodann in einer erweiterten Perspektive ihre Unterstützungsmöglichkeiten für die Wissensgenerierung diskutiert. Die sich dabei bereits andeutenden Probleme ihrer Funktionsvoraussetzungen werden in Kapitel III.3 auf Grundlage eines (spiel-)theoretischen Modells, empirischer Untersuchungen und literaturbasierter Plausiblitätsüberlegungen näher analysiert. Zentrale Probleme ergeben sich dabei sowohl in der Input-Dimension, d.h. der Abgabe von Wissen an Datenbanken, als auch in der Output-Dimension, d.h. beim Abrufen, Verstehen und Anwenden von Wis-
Einleitung 6
sensbestandteilen aus Datenbanken. Als zentraler Einflussfaktor erweist sich dabei u.a. der Grad der intrinsischen Motivation bei den Mitarbeitern; diesem kommt im Wissensmanagement auch für die Wissensgenerierung eine große Bedeutung zu. Deshalb wird in einem Exkurs (Kapitel III.4) ausführlich auf motivationstheoretische Überlegungen eingegangen, die im Zusammenhang mit Datenbanken aber auch im Wissensmanagement allgemein relevant erscheinen. Vor dem Hintergrund des bis dahin Gesagten ist es dann in Kapitel III.5 möglich, die erfolgskritischen Funktionsvoraussetzungen von Datenbanksystemen ausführlich darzustellen, indem ihre Verwirklichung anhand von Gestaltungsempfehlungen und zu schaffenden Rahmenbedingungen im Unternehmen beschrieben wird. Es wird sich zeigen, dass eine in Bezug auf Nutzung und Nutzen erfolgreiche Implementation von Datenbanksystemen vielfältige Anforderungen an ein Unternehmen stellt. Ein abschließendes Resümee fasst wichtige Ergebnisse, u.a. in Auseinandersetzung mit den Bedeutungsinhalten des Begriffes der Ganzheitlichkeit, zusammenund gibt einen Ausblick auf einige offene Fragestellungen.
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 7
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
Um einen ersten Zugang zum weiten und teilweise sehr heterogenen Bereich des Wis- zu ermöglichen, sollen in diesem Abschnitt einleitend zunächst die Gründe für das große Interesse, die das Thema in letzter Zeit erfährt, dargestellt werden. Die Bedeutung, die Wissen heute als Wettbewerbsfaktor zukommt, steht dabei im Vordergrund. Die umfassenden Veränderungen, die daraus für die Unternehmen resultieren, werden skizziert. (Kapitel II. 1.1).
Mit dem Ziel einer ersten inhaltlichen Annäherung an den Begriff des Wissensmanagements werden verschiedene Systematisierungen des Feldes dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Verbindung zwischen Wissensmanagement und der Debatte um das organisationale Lernen eingegangen. Anhand der dargestellten unterschiedlichen Zielrichtungen des Wissensmanagements wird deutlich, dass es zwar einen gemeinsamen Nenner der Ansätze gibt, darüber hinaus aber eine facettenreiche Differenzierung besteht. Es werden zwei idealtypische Zugänge zum Wissensmanagement dargestellt. Abschließend wird auf Entwicklungen und Trends bei der Beschäftigung mit dem Management von Wissen eingegangen, hierbei geht es in erster Linie darum, Gemeinsamkeiten aktueller Konzepte herauszuarbeiten (Kapitel II. 1.2). Im folgenden Abschnitt (Kapitel II. 1.3) wird diskutiert, inwiefern Wissensmanagement als Modeerscheinung zu sehen ist, wobei zunächst geklärt wird, welche Implikationen eine Managementmode mit sich bringt. Es werden empirische Daten zur Verbreitung und Akzeptanz des Wissensmanagements dargestellt. Anschließend wird diskutiert, was als das eigentlich Neue am Wissensmanagement zu charakterisieren ist.
1.1 Wissen als Wettbewerbsfaktor
Als konstituierend für das Wissensmanagement ist die inzwischen, sowohl in der Theo- als auch in der Praxis, unbestrittene Tatsache zu sehen, dass Wissen 3 im heutigen Wirtschaftssystem einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt. Der Umgang, den
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 8
Unternehmen 4 für die Ressource Wissen wählen, erhält somit zunehmend strategische Relevanz beim Erringen von Wettbewerbsvorteilen (vgl. z.B. Nonaka/Takeuchi 1997 S.16ff.; Picot/Scheuble 2000 S.20f.; Probst u.a. 1997 S.15ff). Diese Aussage wird von einigen Autoren (z.B. Gentsch 1999 S.5; Rehäuser/Krcmar 1996 S.9) untermauert, indem sie betonen, dass Wissen inzwischen als eigenständiger vierter Produktionsfaktor von großer Bedeutung ist. Im Vergleich mit den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Werkstoffe und Betriebsmittel 5 zeigt das Wissen einige spezifische Eigenheiten (bspw. bei der Generierung oder der Bewertung), die es nötig machen, neue Techniken im Umgang mit ihm zu entwickeln. Dies kann sicherlich als entscheidender allgemeiner Punkt für die Herausbildung eines Wissensmanagements verstanden werden. Welche Entwicklungen sind aber nun für den enormen Stellenwert, der dem Wissen inzwischen als relevante Wettbewerbsressource zukommt, verantwortlich? Der Bedeutungszuwachs des Wissens ist durchaus nicht auf das Wirtschaftssystem beschränkt, sondern erfasst auch andere gesellschaftliche Teilbereiche (z.B. das Wissenschaftssystem) 6 . Diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung wird unter dem Begriff der Wissensgesellschaft (z.B. Pawlowsky 1998 S.11f), welche in einem tiefgreifenden Strukturwandel aus der Informations- bzw. der vorgelagerten Industriegesellschaft hervorgegangen ist, subsumiert. Dabei wird betont, dass gerade die Dynamik auf dem Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie als Stützpfeiler bzw. Auslöser dieser Transformation von enormer Bedeutung ist (Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.6f). Als wesentliche Indikatoren für die sich entwickelnde Wissensgesellschaft werden oft die quantitative Wissensexplosion 7 und die verkürzten Halbwertzeiten der Wissensnutzung aufgeführt (Romhardt 1998 S.3; Pietsch u.a. 1998 S.14). Probst u.a. (1997 S.21) nennen neben der exponentiellen Vermehrung des Wissens zwei weitere Faktoren, welche den Wandel zur Wissensgesellschaft charakterisieren: Die steigende Fragmentierung des Wissens (z.B. gibt es immer mehr Spezialgebiete in der Wissenschaft) und die zunehmende Globalisierung des Wissens (es wird theoretisch überall verfügbar, insbesondere durch das Internet). Als Folge dieser Entwicklung wird das Wissensumfeld, in dem Unternehmen agieren müssen, deutlich komplexer und turbulenter. Damit wird die Not-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 9
wendigkeit eines gezielten Wissensmanagements evident, wenn keine Chancen auf günstige Wettbewerbspositionen vernachlässigt werden sollen (ebd. S.21f). In Verbindung mit der Transformation zur Wissensgesellschaft stehen die umfassenden makroökonomischen Umwälzungen der letzten Jahre: Weltweit zeichnet sich seit Mitte der 80er Jahre ein tiefgreifender Wandel der Wettbewerbsbedingungen ab, Güter-, Arbeits-, Finanz- und Informationsmärkte globalisieren sich zunehmend (vgl. Picot u.a. 1996 S.2f). Dies schafft neue Herausforderungen für die Unternehmen, denn die wachsende Internationalisierung der Märkte geht mit einer steigenden Zahl der Anbieter und damit einer Verschärfung des Wettbewerbs einher. Spürbare Auswirkungen sind ein zunehmender Innovations-, Flexibilitäts-, Qualitäts-, Preis- und Kostendruck. Generell werden Kundenwünsche anspruchsvoller und vielfältiger. Die Firmen hochindustrialisierter Staaten müssen mit neuen Wettbewerbsstrategien und Wertschöpfungsprinzipien reagieren, wenn sie Ihre Existenz nicht gefährden wollen. In dieser Situation kann der reine Preiskampf (insbesondere Billiglohnländern gegenüber) nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr müssen Konkurrenzvorteile durch das Ausschöpfen von Human Ressources und Wissenspotentialen erzielt werden (Pawlowsky 1998 S.10f). Diese gewandelten Rahmenbedingungen erfordern von den Unternehmen grundlegende Veränderungen in weiten Bereichen, und viele sind mittel- oder unmittelbar auf den Umgang mit Wissen fokussiert. Einige dieser Veränderungen sollen im Folgenden kurz umrissen werden, um danach explizit den Zusammenhang zum Konzept der lernenden Organisation bzw. zum Wissensmanagement aufzuzeigen.
Eine recht plastische Reaktion der Firmen stellt die Tatsache dar, dass Produkte und Dienstleistungen heute zunehmend zu wissensbasierten, „intelligenten Gütern“ (Willke 1998 S.2) umgestaltet werden 8 . Als intelligente Produkte sind z.B. Software, Handys, Videokameras, aber auch Autos oder Küchengeräte zu fassen. Sie alle weisen einen hohen Anteil an eingebauter Elektronik auf und müssen mit moderner, wissensbasierter Technologie entwickelt, produziert und verbessert werden. Auch Dienstleistungen benö- tigen in zunehmendem Maße einen hohen Wissensanteil, wenn sie erfolgreich angeboten werden sollen. Einerseits werden sie mit den intelligenten Produkten direkt zu Problemlösungen verbunden, so ist in den Verkauf eines Computersystems heutzutage seine Planung, Implementation und Wartung meist integriert. Anderseits bieten viele reine Dienstleister durch die Wissensbasierung ihrer Dienste einen immer professionelleren
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
Service an (z.B. Unternehmensberatungen) (ebd.; Probst u.a. 1997 S.23ff). Krebs (1998 S.5) fasst diese Entwicklung zusammen:
„Wissen und Information werden zu einer entscheidenden Ressource, die die Wertigkeit der Produkti- Arbeit und Kapital bestimmt.“
Eine weitere damit in Verbindung stehende Entwicklung ist die Konzentration der Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen, um dauerhafte Wettbewerbsvorteile erlangen bzw. bewahren zu können. Diese auf unternehmensstrategischer Ebene angelegte Reaktion basiert auf den Überlegungen, dass eine rein marktorientierte Perspektive, welche auf die „optimale“ Auswahl von Branchen und die richtige Positionierung in diesen abzielt, unter den oben geschilderten geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr als erfolgversprechend angesehen werden kann, um dauerhafte Konkurrenzvorsprünge zu erzielen (Steinmann/Hennemann 1997 S.35). Statt einer auf unternehmensexterne Faktoren zentrierte Strategie wird eine Ressourcenperspektive favorisiert, welche auf Potentiale und Ressourcen innerhalb eines Unternehmens setzt, womit wieder auf die Schlüsselposition von Wissen verwiesen wird. Insbesondere schwer zu imitierendes Wissen (Kernkompetenzen/Schlüsselqualifikationen) 9 soll den Unternehmen helfen, langfristig eine vorteilhafte Position gegenüber Konkurrenten in sich ständig verändernden Märkten zu erlangen (ebd. S.36). Die Bedeutung von Kernkompetenzen und Wissen allgemein lässt sich zusätzlich veranschaulichen, durch die Betrachtung des verwandten, aber umfassenderen Begriff des intellektuellen Kapitals 10 eines Unternehmens bzw. der Diskussion um dessen Bewertung. Unter intellektuellem Kapital oder „unsichtbaren Aktiva“ (Pawlowsky 1998 S.12) sind die gesamten Wissensbestände (einschließlich der Kernkompetenzen) einer Firma zu verstehen. Eine einfache Bewertungsmethode stellt der Vergleich von Marktwert und Buchwert eines Unternehmens dar. Der Marktwert ist derjenige Wert, den das Unternehmen an der Börse erzielt (Zahl der Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs); subtrahiert man davon den Buchwert, d.h. die in den Bilanzen doku-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
mentierten Vermögensbestände, ergibt sich der Wert des intellektuellen Kapitals. Dieser wächst in den letzten Jahren kontinuierlich an und macht im Durchschnitt aller Branchen heute schon ca. 40% des Marktwertes aus; dabei gibt es erhebliche Varianzen, z.B. beträgt er in der Gesundheitsvorsorge bereits über 75% und bei Dienstleistungsunternehmen allgemein über 60% des Marktwertes (Picot/Scheuble 2000 S.23f.) 11 . In der globalisierten Wissensgesellschaft steigt also die Bedeutung von wissensbasierten Produkten, eine „Entmaterialisierung der Wertschöpfung“ (Wilkesmann 1999b S.485) ist zu konstatieren, der Anteil von intellektuellem Kapital an den Firmen steigt, und die Konzentration auf Kernkompetenzen wird für Unternehmen immer bedeutender. Bei den aufgeführten allgemeinen Entwicklungen wird die Ressource Wissen meist direkt und unmittelbar wettbewerbsrelevant. Auf darunter liegenden Ebenen sind es die vielen praktischen Anwendungssituationen, in denen Wissen indirekt, über vermittelnde Variablen, Einfluss auf die Wettbewerbschancen eines Unternehmens nimmt. Zwei Beispiele seien genannt: Es ist für ein Unternehmen von Bedeutung zu erfassen, was es alles weiß, andernfalls besteht die Gefahr, Ressourcen zu verschwenden, wenn versucht wird, benö- tigtes, aber schon vorhandenes, Wissen zu erlangen. Sind nun aber diesbezüglich Informationen in einer Datenbank vorhanden, werden Zeit und Kosten gespart, was dann eben wieder wettbewerbsrelevant wird. Ein anderes Beispiel leitet sich aus der in der Wissensgesellschaft sinkenden Halbwertzeit des Wissens ab, wodurch ständiges Lernen und kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter erforderlich werden. Wird das Unternehmen diesen gestiegenen Wissensansprüchen gerecht, wirkt sich dies letztendlich ebenfalls wieder auf die Chancen eines Unternehmens am Markt aus. Diese Reihe von Beispielen ließe sich fast unbegrenzt fortsetzen. Es wird deutlich, dass es viele Möglichkeiten für Unternehmen gibt, durch den „richtigen“ Umgang mit Wissen, ihre Wettbewerbschancen zu verbessern.
Unternehmen können mit Hilfe von Wissen(smanagement) eine bessere Umweltanpassung erreichen und/oder ihre Betriebsabläufe optimieren mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren sowie Qualität zu erhöhen und/oder ihre Innovationsfähigkeit zu steigern (vgl. Wahren 1996 S.3). Es zeigt sich, wie facettenreich Wissensmanagement aufgefasst werden kann, dies gilt gleichermaßen für den theoretischen Ansatz, für Inhalte und Methoden und teilweise sogar für die Ziele, die es realisieren soll. Im folgenden Gliederungspunkt wird versucht, dieses weite Feld zu systematisieren.
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
1.2 Einordnung - Inhalte, Ziele und Entwicklung von Wissensmanagement
Hinter dem Begriff Wissensmanagement verbirgt sich kein geschlossener einheitlicher Ansatz oder gar eine konsistente Theorie, es existieren unterschiedliche Perspektiven und Teildisziplinen nebeneinander. Folglich herrscht auch bei Methoden, Instrumenten und Zielen des Wissensmanagements eine dementsprechende Vielfalt. Die Heterogenität des Feldes ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen: Sie erwächst z.B. aus verschiedenen theoretischen oder ideologischen Positionen sowie aus unterschiedlichen Zielen und Funktionen, welche durch Wissensmanagement verwirklicht werden sollen (Schmitz/Zucker 1999 S.178). Dies wiederum lässt sich u.a. durch die inzwischen erreichte Interdisziplinarität des Forschungsfeldes erklären (Romhardt 1998 S.6), so gibt es u.a. Beiträge aus der Betriebswirtschaft, der Sozialwissenschaft, der (Arbeits- und Sozial-)Psychologie, aber auch aus der Pädagogik und der (Wirtschafts-)Informatik zu diesem Thema. Es ist festzuhalten, dass es eine übergreifende Definition des Wissensmanagements höchstens auf einem sehr allgemeinen Niveau geben kann, bspw. in der Form:
„Wissensmanagement beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Einflußnahme auf die Ressource
„Wissen“ [im Unternehmen, U. L.] und beurteilt Möglichkeiten und Grenzen der Intervention.“ (ebd.
S.47). 12
Oder wenn eher auf dessen instrumentelle Seiten abgehoben wird:
„... geht es beim Wissensmanagement (...) um die Vernetzung vorhandenen, die Generierung neuen
Wissens sowie die Dokumentation und den Transfer von Wissen aus der Umwelt in die Unterneh- (Schneider 1996 S.31).
Die Vielschichtigkeit von dem, was unter Wissensmanagement alles verstanden werden kann, wird dadurch unterstrichen, dass selbst die Systematisierungsversuche verschiedener Autoren nicht einheitlich ausfallen (vgl. Schmitz/Zucker 1999 S.178ff; Schneider 1996 S.13ff; Wagner/Schencking 2001 S.22ff). Wissensmanagement umfasst mehrere Teildisziplinen. Exemplarisch zeigt die folgende an Schmitz/Zucker (1999) orientierte Tabelle eine mögliche Einteilung des breiten Feldes. Neben ihrer Orientierungsfunktion ermöglicht sie einen ersten Eindruck der unterschiedlichen Inhalte und Ziele von Wissensmanagement:
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements

Abb. 1: Hauptrichtungen des Wissensmanagements (nach Schmitz/Zucker 1999 S.180)
An dieser Stelle sollen die aufgeführten Hauptrichtungen zunächst nicht vertieft werden, auf prominente Ansätze des Wissensmanagements wird in Kapitel II. 3 näher eingegangen. Für die Einordnung des Wissensmanagements ist es aber wichtig, dessen konzeptionelle Nähe zur Debatte um die lernende Organisation wahrzunehmen 13 . Relativ unstrittig ist, dass der Diskurs der lernenden Organisation in den letzten Jahren in Konzeptionen zum Wissensmanagement mündete (vgl. Aulinger u.a. 2001 S.82; Wilkesmann 1999b S.488). Dies ist insofern einsichtig, als jede Form von Wissen zunächst Lernprozesse verschiedenster Art erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Wissen nicht nur als Ergebnis, sondern immer auch als Ausgangspunkt bzw. Rahmenbedingung für Lernprozesse aufzufassen ist (Wiegand 1996 S.313f) 14 . Viele Begriffe und Modelle, mit denen im Wissensmanagement argumentiert wird, leiten sich aus der Diskussion um die lernende
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 14
Organisation ab (Schreyögg 2001 S.4f); die wichtigsten werden in Kapitel II. 2.2 spezi- 15 . Die Übergänge zwischen Konzepten zur lernenden Organisation und zum Wissensmanagement sind fließend und nicht eindeutig, in der Literatur finden sich dazu unterschiedliche Einschätzungen. Dies ist nicht verwunderlich, da beide Konzepte nicht einheitlich definiert werden. Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, steht nach Schmitz/Zucker (1999 S.178ff) bei Konzepten der lernenden Organisation die Lernfä- higkeit, die einen ständigen Organisationswandel in dynamischer Umwelt garantieren soll, im Vordergrund. Allerdings ist dies für die Autoren nur ein Feld des Wissensmanagements 16 , daneben stehen Wissensentwicklung (zentrales Charakteristikum: Wissen im Geschäft anwenden), Wissensbewirtschaftung (Wissen nutzen und verteilen) sowie das Konzept des intellektuellen Kapitals (Wissen messen). Die dritte Zeile der Tabelle macht deutlich, dass entsprechend den verschiedenen Themengebieten auch unterschiedliche Akteure zentrale Rollen beim Management von Wissen einnehmen. Wilkesmann (1999b S.488) trifft eine allgemeinere Unterscheidung, indem er das Interesse der Theorie des organisationalen Lernens eher bei der Generierung und Bewertung von Wissen sieht, während Wissensmanagement sich hauptsächlich (neben dem Ideenmanagement) mit der Speicherung und Distribution von Wissen auseinandersetzt. Probst u.a. (1997 S.44f) grenzen Wissensmanagement von der Theorie des organisationalen Lernens anhand des Kriteriums der Anwendungsorientierung ab. Mandl/Reinmann -Rothmeier (2000 S.10) argumentieren ähnlich, wenn sie Wissensmanagement als Instrument sehen, mit welchem Menschen, Gruppen und Organisationen in nachhaltige individuelle, soziale und organisationale Lernprozesse eingebunden werden können, um so die „Lernende Organisation“ zu realisieren. Nach Probst u.a. (1997 S.45) beschreibt organisationales Lernen nur die Veränderung der organisationalen Wissensbasis, während Wissensmanagement auf eine bewusste Interventionsabsicht abzielt 17 . Diese lässt sich anhand von acht Kernprozessen (ebd. S.51ff) systematisieren: Wissensmanagement zielt darauf ab, Wissen im Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben, zu entwickeln, zu verteilen, zu nutzen, zu bewahren sowie in übergeordneten Prozessen Wissen zu be-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 15
werten und Wissensziele festzulegen (ähnlich Pawlowsky 1998; Bullinger u.a. 1998a). Dieser integrative Ansatz verfolgt das Ziel, verschiedene Teildisziplinen 18 des Wissensmanagements, welche sich mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen, zu verbinden und damit für die Praxis übersichtlicher zu gestalten (Probst/Raub 1998 S.133). Aulinger u.a. (2001 S.82) betonen als unterscheidendes Charakteristikum zum organisationalen Lernen, dass Wissensmanagement sich deutlich präziser mit der Erklärung und dem Verständnis von Wissen auseinandersetzt. Des Weiteren sind sie der Meinung, dass Wissensmanagement nicht primär den Aufbau einer gemeinsamen organisationalen Wissensbasis zum Ziel haben sollte, was eben als konstituierendes Merkmal des organisationalen Lernens zu sehen sei. Vielmehr sollte ein Wissensmanagement auf Innovationen zielen und sich deshalb darauf konzentrieren, dass eben nicht alle „das Gleiche über das Selbe wissen“ (ebd.) 19 .
Die Diskussion über das Verhältnis zwischen Konzepten der lernenden Organisation und dem Wissensmanagement soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter vertieft werden, es soll genügen, die Bezüge aufgezeigt zu haben. Als Fazit kann nur festgehalten werden, dass die Inhalte beider Diskussionen eng miteinander verwoben sind und dass die jeweiligen Inhalte und damit auch das Verhältnis zueinander je nach Autor variieren 20 . Im Weiteren wird jedoch grundsätzlich von Wissensmanagement gesprochen, da die Anwendung der sich in den letzten Jahren rasch entwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) 21 hauptsächlich mit diesem Begriff in Verbindung gebracht
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 16
wird (vgl. Bach u.a. 1999; Gentsch 1999; Schneider 2000 S.38), und in Teil III dieser Arbeit eben die Implementation von (Dienstleistungs-)Datenbanken untersucht wird. Dabei wird Wissensgenerierung ebenfalls als Aufgabe des Wissensmanagements aufgefasst.
In Bezug auf die Rolle, die der IuK zugeschrieben wird, ist folgende analytische Systematisierung des Wissensmanagementfeldes von Bedeutung. Demnach sind idealtypisch 22 zwei Entwicklungsstränge des Wissensmanagements auf Basis verschiedener Denktraditionen zu unterscheiden (zum folgenden Aulinger u.a. 2001 S.70ff; Schneider 1996 S.15ff). Es lässt sich ein instrumentell-technischorientierter von einem konstruktivistisch-prozessorientierten Ansatz abgrenzen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der Ansätze ist epistemologischer Natur, d.h. die jeweils unterschiedliche Aufassung, was unter Wissen zu verstehen ist. Daraus abgeleitet ergeben sich u.a. entsprechende Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung, die der Informations- und Kommunikationstechnologie zugeschrieben werden. Der instrumentell-technische Ansatz des Wissensmanagements geht davon aus, dass Wissen „teilbar, positiv gegeben und weder körper-, noch kontextgebunden“ (ebd. S.18) ist. Es gibt Auskunft über eine gegebene, objektiv festzustellende Realität. Aus diesem Blickwinkel haben Prozesse der Weitergabe und Nutzung keine Wirkung auf das Wissen. Resultierend aus diesem Grundverständnis ist es zentrale Aufgabe des Wissensmanagements, insbesondere mit Hilfe von neuen Technologien, dafür Sorge zu tragen, dass Wissenspakete im Unternehmen „richtig“ verteilt, gespeichert und genutzt werden. Dabei wird Lernen als kumulativer Vorgang verstanden, implizit wird also immer davon ausgegangen, umso mehr Wissen desto besser. Diese Auffassung von Wissensmanagement folgt einem tayloristischen Prinzip, denn Wissensentwicklung und Wissensverarbeitung sind voneinander getrennt und werden erst im Nachhinein zusammengeführt. Einen komplett anderen Ansatz stellt ein Wissensmanagement dar, welches Wissen aus einer konstruktivistischen Sichtweise 23 begreift. Eine der Hauptaussagen des Konstruktivismus ist, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, die Realität zu deuten. Folglich kann es kein objektives Wissen geben, sondern Wissen wird objektiviert, indem Menschen Konstruktionen miteinander teilen. Wirksamere Deutungen der Realität setzen sich mit Hilfe von Kommunikationsprozessen durch. Entspre-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 17
chend ist Wissen immer an einen (Entstehungs-)Kontext gebunden, in welchem es „dis- und prozessual entsteht“ (ebd. S.20). Insbesondere bei turbulenten dynamischen Umweltbedingungen ist es nicht sinnvoll, Wissen in erster Linie als etwas Bestandhaft-Kodifizierbares zu begreifen, sondern die Prozesshaftigkeit rückt in den Vordergrund. Es wird deutlich, dass Wissensmanagement aus dieser Perspektive über die reine Implementierung einer technischen Infrastruktur weit hinaus gehen muss. Es stehen die Interaktionsprozesse im Vordergrund, in welchen Wissen produziert und ausgetauscht wird. Schneider (1996) führt ihre theoretische Kategorisierung weiter voran, indem sie die zwei Entwicklungsstränge als Bezugsrahmen für eine Systematisierung des gesamten Wissensmanagementfeldes hinsichtlich Methoden und Maßnahmen heranzieht. Ihre Einteilung soll kurz dargestellt werden, um das Bild vom Wissensmanagement weiter zu differenzieren (vgl. auch mit Abbildung 1, S.13). Sie unterscheidet anhand der Entwicklungsstränge zwei Modelle von Wissensmanagement, welche verschiedene Inhalte integrieren (ebd. S.42). Das erste Modell (Lernen 1) folgt tendenziell dem instrumentelltechnischen Verständnis von Wissen (ebd. S.32). Darin werden vier unterschiedliche Ziele zusammengefasst, es geht darum (ebd. S.27ff):
- vorhandenes, aber brachliegendes Wissen in der Organisation zu nutzen bspw. durch den Abbau von Kommunikationsbarrieren, hauptsächlich mit Hilfe von IuK, aber auch durch Empowerment und Enthierarchisierung;
- Lernbarrieren in Bezug auf extern vorhandenes Wissen abzubauen, bspw. durch Kooperation mit Kunden und Lieferanten;
- Ergebnisse von Lernprozessen und vorhandenes Wissen zu dokumentieren, bspw. mit Hilfe von Expertensystemen und Datenbanken;
- Wissen bzw. den „Intelligenzgrad“ eines Unternehmens zu bilanzieren. Schneider kritisiert an diesem Modell hauptsächlich, dass oft ein kumulativer Ansatz vertreten wird. Es kann aber nicht darum gehen, Wissen im Unternehmen nur zu maximieren, also „möglichst vielen möglichst viel Wissen zur Verfügung zu stellen“ (ebd. S.32). Dies führt zu einer kontraproduktiven Informationsüberflutung, welche Entscheidungen oft erschwert und verzögert. Außerdem weist sie auf theoretische Mängel hin, bspw. bezüglich der Unbestimmtheit des Wissensbegriffes (ebd. S.33f). Die darauf reagierenden Ansätze fasst die Autorin im Anschluss in einem zweiten Modell des „Meta-Wissensmanagements“ (ebd. S.39) zusammen. Darin rückt eine prozess- und interaktionsorientierte Sichtweise des Wissens in den Vordergrund. Zentraler Punkt eines Meta-Wissensmanagements ist der Einbau reflexiver Schleifen, d.h.
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 18
„Wissen [soll] mit seinen Vorannahmen und Begründungszusammenhängen reflexiv bewusst gemacht
und in Frage gestellt [werden], wodurch es sich verändert.“ (ebd. S.35). Wesentliche Ziele eines Meta-Wissensmanagements sind also die Bewusstmachung der individuellen und kollektiven Mentalstrukturen, daran anschließend sollen deren innovations- und veränderungshemmende Wirkungen erkannt und verändert werden. Es geht darum, kollektive Glaubenssysteme zu relativieren, indem das „gefrorene Wissen“ in Systeme, Strukturen und Personen sowie in der übergeordneten Unternehmenskultur reflektiert wird (ebd. S.36). Wichtige Maßnahmen dazu sind z.B. die Pflege einer lernbzw. fehlerfreundlichen Kultur, Förderung von Diversität im Unternehmen, bspw. durch multikulturell besetzte Führungsgremien, und vor allen Dingen der Einbau von verschiedenen Feedbacksystemen. Zusammengefasst geht es in Bezug auf Wissen in Schneiders erstem Modell eher um Informationsanhäufung durch einfaches Lernen, im zweiten wird Wissen eher mit doppelschleifigem Lernen (vgl. II. 2.2.3, S.53) in Verbindung gebracht, immer vor dem Hintergrund einer tendenziell unterschiedlichen Auffassung von Wissen (ebd. S.41).
Diese von Schneider schon 1996 dargestellte „Zweiteilung“ der Wissensmanagementverständnisse setzt sich über die Jahre fort und wird von ihr (2000 S.26ff; 2001 S.31ff) in einem neuen Modell präzisiert. Dieses soll für den weiteren Verlauf der Arbeit als Bezugspunkt dienen. Unterschiedliche Wissensmanagementverständnisse ergeben sich demnach durch die Differenzierung von drei Dimensionen. Die erste Dimension bezieht sich auf das schon beschriebene unterschiedliche Wissensverständnis (Produkt vs. Prozess) und wird durch zwei weitere Unterscheidungsdimensionen ergänzt, nämlich einem konträren Managementverständnis (Kontrolle vs. Ermöglichung) und unterschiedlichen Zielen (bessere Nutzung vs. Generierung von Wissen) (ebd. 2000 S.26). Wenn im Weiteren von verschiedenen (idealtypischen) Zugängen zum Wissensmanagement die Rede ist, ist also folgende Unterscheidung gemeint: Zum einen der instrumentalistische Wissensmanagementansatz, der einem klassischen Managementzyklus folgt. Diesem liegt ein menschenunabhängiger, objektiver Wissensbegriff zu Grunde. Wissen wird als dokumentierbares Produkt gesehen, es soll identifiziert und zugänglich gemacht werden, mit dem primären Ziel, seine Ausnutzung zu optimieren. Das Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter soll in Strukturen überführt und transparent gemacht werden, auf diese Weise soll eine umfassende Kontrolle des Managements über das Wissen erzielt werden; wie schon erwähnt, wird bei diesem Vorgehen die Technik besonders betont (ebd. S.27f). Im Gegensatz dazu steht der evolutionäre Ansatz (ebd. S.30), der den Menschen
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 19
in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Wissen ist hier personengebunden und wird als Prozess definiert. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Wissen, dies kann auf verschiedene Arten geschehen, sowohl durch doppelschleifiges Lernen wie beim oben geschilderten „Meta-Wissensmanagement“, in dessen Folge dann auch radikale Strukturänderungen möglich sind, als auch durch einfache Kombination von bekanntem Wissen (dies wäre dann ein Anknüpfungspunkt zum instrumentalistischen Ansatz). Management wird dabei systemtheoretisch als Prozess der Ermöglichung von Eigenlogik und Selbstorganisation verstanden, in diesem Sinne sollen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, „... damit Wissen entsteht, Wissensträger einander begegnen und auch kooperieren wollen.“ (ebd. S.29). Es geht darum, Personen zu vernetzen, Erfahrungen zu ermöglichen und einen Kontext zu schaffen, in dem Wissen in Frage gestellt werden kann. Insgesamt zeigt dieser Ansatz deutliche Bezüge zu Konzepten der lernenden Organisation, er ist für das Management wesentlich riskanter, weil er eben „nur“ darauf abzielt, Prozesse anzustoßen und zu fördern, diese aber letztendlich nicht komplett beherrscht werden können 24 .
Schon 1996 weist Schneider darauf hin, dass einzelne Modelle des Wissensmanagements die dargestellte theoretische Differenzierung zu überbrücken versuchen, indem sie zwischen Wissensarten 25 unterscheiden (ebd. 20). Dies hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt, so gut wie jedem Beitrag zu dem Thema ist eine theoretische Auseinandersetzung zu dem Verständnis von Wissens vorangestellt, so dass es möglich wird, sowohl die Produkt- als auch die Prozesshaftigkeit von Wissen zu erfassen (z.B. Davenport/Prusak 1998 S.26ff; Romhardt 1998 S.24ff; Weggemann 1999 S.33ff). Generell wird versucht, Elemente des instrumentalistischen und evolutionären Ansatzes zu integrieren. Krauter/Kreitmeier (1999 S.73f) sehen die Zukunftspotentiale von Wissensmanagement gerade in einer sinnvollen Verbindung dieser beiden Ansätze. Allgemein lässt sich festhalten, dass die meisten neueren theoretischen Wissensmanagementkonzepte versuchen, möglichst viele Ziele zu behandeln, d.h. sowohl Transfer und Dokumentation
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 20
von Wissen werden thematisiert, aber immer auch vor dem Hintergrund der Notwendig- Bestehendes reflektieren und verändern zu müssen. Schneider (2000 S.27) merkt in diesem Zusammenhang kritisch an, dass das instrumentalistische Verständnis immer noch die Konferenzszene dominiere und nur die vielversprechende Begleitrhetorik aus dem Gebiet des evolutionären Ansatzes stamme. Nichtsdestotrotz gewinnt (zumindest in der Literatur) in den letzten Jahren eine umfassende ganzheitliche Sicht, in welcher auch die Technik nur noch als notwendige, aber bei weitem nicht hinreichende Bedingung (Aulinger u.a. 2001 S.83; Bullinger u.a. 1998a S.22) für erfolgreiches Wissensmanagement gesehen wird, zunehmend an Bedeutung; ein rein instrumentalistischer Zugang ist selten, womit allerdings nicht gesagt werden soll, dass alle neueren Wissensmanagementkonzepte inhaltlich und methodisch übereinstimmen. Der Trend weist aber in die angedeutete Richtung. U.a. aus diesem Grund werden Datenbanken in Teil III auch nicht lediglich vor dem Hintergrund des instrumentellen Ansatzes betrachtet, sondern es werden Bezüge zum evolutionären Ansatz aufgezeigt (s. dazu insbesondere III. 2.3, S.83). Wissensmanagement wird inzwischen als differenziertes Konzept verstanden, welches - auf der Basis eines präzisierten Wissensverständnisses - Interventionen auf mehreren Ebenen eines Unternehmens umfasst: Mandl/Reinmann-Rothmeier (2000 S.7) bspw. sprechen explizit die Faktoren Organisation, Mensch und Technik an. Weggemann (1999 S.118ff) differenziert noch feiner in die Gestaltungsdimensionen Strategie, Unternehmenskultur, Struktur, Systeme, Managementstil und Personal. Um diese verschiedenen Gestaltungsdimensionen für das Management von Wissen handhabbar zu machen, werden oft einzelne Handlungsfelder (z.B. Wissensidentifikation, -generierung, - diffusion, -integration, -transfer [Pawlowsky 1999 S.115f; Probst u.a. 1997 S.51ff, s.o.]) bestimmt, welchen wiederum bestimmte Maßnahmen und Methoden 26 zugeordnet werden, die dann auf die jeweiligen Gestaltungsdimensionen anzuwenden sind. Es gilt also in Theorie und Praxis als prägende Erfahrung der letzten Jahre, dass ohne die Beachtung der personellen, organisatorischen und kulturellen Rahmenbedingungen (Bullinger u.a.1998a S.38; Heisig 1999 S.42ff; Hilse 1999 S.170f) Wissensmanagement nicht zum versprochenen Erfolg führt. Dies gilt sowohl für unternehmensweite, wissensorientierte Gesamtstrategien, als auch für einzelne Projekte, die den Umgang mit Wissen optimieren sollen (Hilse 1999 S.172). Unter den letzten Punkt wäre z.B. die Gefahr zu fassen, dass neu implementierte Datenbanken letztlich nur nutzlose Datenfriedhöfe 27
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 21
(keiner gebraucht die Daten sinnvoll) produzieren (Wilkesmann/Rascher 2001 S.1) oder dass sie sogar völlig leer bleiben.
Es ist also festzuhalten: In gleichem Maße wie die Bedeutung von technisch dominierten Ansätzen in den Hintergrund rückt, gewinnen ganzheitliche, das evolutionäre Wissensmanagementverständnis integrierende, Ansätze an Relevanz, die auch speziell dem Faktor Mensch eine zentrale Rolle zuschreiben 28 . Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es nur bedingt möglich ist, Wissensentwicklung und Wissensaustausch anzuweisen, direkt zu planen und fremd-zu-organisieren (Schmitz/Zucker 1999 S.192). Es setzt sich - um es erneut zu betonen: in der Literatur - zunehmend die nicht allzu neue Erkenntnis durch, dass ohne das Engagement der Mitarbeiter häufig wenig erreicht werden kann (vgl. Bullinger u.a. 1998a S.37); „... niemand [kann] zum Wissen, Lernen oder Können gezwungen werden ...“ (Romhardt 1998 S.46). Es müssen die Motivstrukturen der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund, eben deren Engagement 29 sicherzustellen, sind die inzwischen weit verbreiteten Forderungen zu verstehen, die zum einen die Partizipation der Mitarbeiter schon bei der Einführung von Wissensmanagement, zum anderen die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Wissensprozessen, fordern. Unter die allgemeinen Forderungen nach Ganzheitlichkeit und Beachtung von Rahmenbedingungen (Heisig 1999 S.46) lassen sich eine große Anzahl von Empfehlungen und entsprechenden Einzelmaßnahmen subsumieren. So wird im Zusammenhang mit Wissensmanagement zunehmend die Bedeutung von Bereichen der Unternehmenskultur thematisiert, es soll bspw. eine Vertrauens- und Kooperationskultur institutionalisiert werden (Frey, D. 2000), neue Prinzipien der Führung werden empfohlen (Rosenstiel v. 2000), außerdem entwickelt sich eine breite Diskussion um sogenannte Wissensgemeinschaften bzw. Communities of Practice (North u.a. 2000; Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.11). Insbesondere der Art, Form und Möglichkeit von Kommunikation im Unternehmen wird bei vielen Aspekten des Wissensmanagements eine herausragende Bedeutung beigemessen, so dass viele personelle und strukturelle Maßnahmen auf deren Optimierung zielen (vgl. Eberl 2001 S.55ff; Frey, D. 2000;
Reflexion zu unterziehen, kann ebenfalls als Trend der letzten Jahre verstanden werden (siehe Kapitel II. 2).
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 22
Kalmus 1998; Schmitz/Zucker 1999 S.184ff; Wahren 1996 S.109, 119, 194ff; Straub 1999). Diese exemplarische Aufzählung von möglichen Aktionsfeldern erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie macht aber deutlich, dass im Rahmen von Wissensmanagement einiges von den Unternehmen und den Mitarbeitern verlangt wird. In diesem Zusammenhang muss allerdings kritisiert werden, dass viele Aussagen einen rein normativen Charakter haben, denen oft jegliche theoretische und/oder empirische Validierung fehlt (vgl. Schneider 1996 S.16f). Meist werden lediglich Empfehlungen weitergegeben, die aus best-practice Fällen abgeleitet wurden oder deren Nutzen bestenfalls (für ein einzelnes Unternehmen) anhand von Fallstudien nachgewiesen wurden. Konkrete Umsetzungsproblematiken werden meist stiefmütterlich behandelt. In ähnliche Richtung geht die Kritik von Wilkesmann (2000b S.9), wenn er feststellt, dass häufig nur strategische Zielgrößen definiert werden, ohne auch entsprechende Bedingungen der Umsetzung näher zu spezifizieren oder zu untersuchen.
Einige der aufgeführten Defizite sollen im Rahmen dieser Arbeit vermieden werden. Wenn es in Teil III um kritische Faktoren einer erfolgreichen Datenbankimplementation geht, ist es zwar sinnvoll, vorhandene Empfehlungen aus der Literatur zu würdigen, es wird aber zusätzlich immer versucht, Begriffe (wie z.B. Vertrauen oder Motivation) theoretisch fundiert darzustellen und, wenn möglich, relevante empirische Ergebnisse zu präsentieren. Es soll an dieser Stelle schon erwähnt werden, dass es m.E. sinnvoll ist, Wissensmanagement, wenn es um die konkrete Umsetzungsthematik einzelner Projekte
- wie eben einer Datenbank - geht, im Anschluss an Wilkesmann (2000b) als „Aushandlungsprozess zwischen Organisationsmitgliedern“ (ebd. S.9) aufzufassen, anstatt als strategische Führungsgröße oder rein technische Problematik. Dies begründet sich u.a. dadurch, dass sich Wissensmanagement innerhalb der organisatorischen, kulturellen und technischen Aspekte eben immer auch mit mikropolitische Fragen beschäftigen muss (ebd. S.8; Baecker 1999 S.103; Schmitz/Zucker 1999 S.181; Schneider 1996 S.27). Wissensmanagement ist in vielen Bereichen „highly political“ (Davenport 1996 zitiert nach Romhardt 1998 S.212), bspw. weil Wissensabgabe und -verteilung immer auch in Zusammenhang mit potentiellen Machtverschiebungen zu betrachten sind (vgl. Hanft 1996; Kuppinger/Woywode 2000 S.138f; II. 4). Diese Aspekte treten natürlich insbesondere bei der Einführung und Umsetzung einzelner Maßnahmen zu Tage. Bezogen auf eine Datenbank kann dies z.B. bedeuten, dass Experten einen Verlust ihrer Machtposition befürchten, wenn sie Teile ihrer Kenntnisse an eine Datenbank abgeben.
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 23
1.3 Wissensmanagement als Mode - das Neue am Wissensmanagement
Das Auf und Ab von Managementmoden ist eine bekannte Erscheinung, die durchaus auch kritisch hinterfragt werden kann (vgl. zum Folgenden Kieser 1995 S.65ff). Konzepte wie Lean Management, Total Quality Management oder Business Process Reengineering tauchen regelmäßig kometenhaft auf und werden bereits nach einigen Jahren durch neue Konzepte abgelöst, manchmal ohne dass eine umfassende Realisierung in den Unternehmen stattgefunden hat. Oft enden Umsetzungen solcher Konzepte in der Praxis auch mit dem Ergebnis, dass sich zwar das Reden über die Organisation verändert hat, die Organisationsstrukturen aber im Wesentlichen erhalten geblieben sind. Von dem versprochenen revolutionären organisationalen Wandel bleiben höchstens einige nützliche Ideen zurück. Außerdem wird mit Managementmoden manchmal lediglich versucht, altbekannte Prinzipien unter einem neuen Schlagwort wieder salonfähig zu machen. Auch in der Diskussion um das Wissensmanagement taucht immer wieder die Frage auf, inwiefern es sich bei seinen Konzepten und Ansätzen tatsächlich um etwas grundlegend Neues - mit ausreichender Praxisrelevanz - handelt, bzw. inwiefern es sich von der langen Reihe vorhergehender Managementmoden abgrenzen lässt (Krauter/Kreitmeier 1999 S.72f.; Schneider 1996 S.23ff; Schneider 2000 S.78f; Probst/Raub 1998; Sturz 2000). Die Antworten können im Rahmen dieser Arbeit nicht mit allen Argumentationssträngen und Facetten dargestellt werden. Es werden aber zwei m.E. in diesem Kontext besonders relevante Punkte herausgegriffen, anhand welcher Potential und Bedeutung von Wissensmanagement deutlich werden. Wissensmanagement ist praktisch und inhaltlich mehr als eine schnelllebige Managementmode oder ein überschätzter „Hype“ 30 . Zum einen wird Bezug auf die tatsächliche Verbreitung von Wissensmanagement in der Praxis genommen; zum anderen wird seine strategische Komponente als diejenige Facette, die nötig ist, um auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können und damit etwas wesentlich Neues konstituiert, unterstrichen.
Über Wissensmanagement wird nun schon seit ca. zehn Jahren diskutiert und geschrieben. Die Literatur der letzten Jahre ist zwar reichhaltig gespickt mit Fallstudien und Beschreibungen von best practice Beispielen zum Thema, aber parallel gab es auch immer wieder die ernüchternde Feststellung, dass in den Unternehmen der große Durchbruch auf breiter Basis noch auf sich warten lasse (Schneider 1996 S.24; Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000 S.4). Eine breit angelegte Unternehmensstudie des Fraunhofer-Institutes
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 24
(Bullinger u.a. 1998b) aus dem Jahre 1998 zur Durchdringung der deutschen Wirtschaft mit der Wissensmanagementthematik spiegelt eben diese Problematik in Bezug auf die Praxis wieder. Die Unternehmen haben die Bedeutung von Wissen als Ressource erkannt (96 Prozent halten Wissensmanagement für wichtig bzw. sehr wichtig [ebd. S.8]) und sind sich sogar ihrer Defizite im Umgang damit bewusst (nur 15 Prozent bewerten ihre Ausnutzung des Wissens für gut bzw. sehr gut [ebd.]), aber trotzdem findet die Umsetzung der Erkenntnisse in die Praxis „nur sehr zögerlich statt“ (ebd. S.21). Zur Zeit deutet sich hier ein Wandel an, nicht nur Interesse, sondern eben auch Aktivitäten im Bereich Wissensmanagement haben kontinuierlich zugenommen. Dieser Trend lässt sich anhand einer Reihe von aktuellen Studien nachvollziehen 31 . Nach einer international angelegten Studie 32 der KPMG Consulting GmbH (Schmitz/Voigt 2000 S.1) hatten 1998 43 Prozent der befragten Unternehmen ein Wissensmanagementprogramm begonnen, 2000 waren es schon 62 Prozent. Auch eine Online Umfrage aus dem Frühjahr des Jahres 2001 (Döring-Katernkamp/Trojan 2001) kommt zu dem Ergebnis, dass sich Wissensmanagement als fester Bestandteil in den Unternehmen zu etablieren beginnt: Über 50 Prozent der befragten Betriebe gaben an, Wissensmanagement habe bei ihnen einen sehr wichtigen bzw. wichtigen Stellenwert, nur für 4 Prozent ist es gar nicht wichtig. Über 90 Prozent halten Wissensmanagement zukünftig für wichtig/sehr wichtig in ihrem Unternehmen und bezeugen auch eine entsprechende Investitionsbereitschaft. Diese wird durch eine schon ältere Studie von 1997 (ILOI 2001 S.3) bestätigt, demnach „beabsichtigen die meisten befragten Unternehmen erhebliche Summen“ (ebd.) zur Einführung von Wissensmanagement zu investieren. Abbildung 2 (S.25) gibt die durchschnittlichen monetären Größen der jährlich geplanten Investitionen wieder:
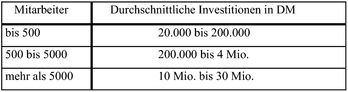
Abb. 2: Durchschnittliche jährliche Investitionsbereitschaft der deutschen Unternehmen ins Wissensmanagement, gestaffelt nach Mitarbeiterzahlen (ILOI 2001 S.3)
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 25
Es ist also festzuhalten, dass Wissensmanagement sicherlich ein Modethema ist, aber eben nicht im Sinne eines ausschließlich theoretischen Hypes, sondern eines, mit dem Inhalte und Methoden transportiert werden, die in der Unternehmenspraxis zunehmende Akzeptanz und in der Folge auch entsprechende Umsetzungen erfahren. Um zu klären, in welchem Umfang die angestrebten Ziele langfristig erreicht werden können, und welche tatsächliche Veränderungen bspw. der Organisationsstrukturen damit einhergehen, sind weitere Studien erforderlich.
Im Weiteren soll nun auf das innovative Potential von Wissensmanagement abgehoben werden, indem es erneut in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklungen gestellt wird. Oft wird in Beiträgen zum Wissensmanagement auf einzelne Probleme der Unternehmen im Umgang mit Wissen Bezug genommen, z.B. Wichtiges wird vergessen, Ausscheiden von Experten hinterlässt Lücken; Wissen wird nicht genutzt, weil es nicht bekannt ist usw. (Romhardt 1998 S.50; Pawlowsky 1999 S.114). Dies wird oft in Kombination mit dem Argument, Wissen werde in der Wissensgeselllschaft zur bedeutenden Ressource, als oberflächliche Begründung für die Notwendigkeit von Wissensmanagement angeführt. Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, entsprechen im Wesentlichen dem oben dargestellten instrumentalistischen Ansatz: Der Umgang mit Wissen soll optimiert werden, indem es dokumentiert und ausgetauscht wird. Der strategische Fokus ist auf eine bessere Prozessbeherrschung und damit letztlich auf Kostensenkung ausgerichtet (Schneider 2000 S.28). Dies ist für die Unternehmen sicherlich nützlich und wertvoll, auch vor dem Hintergrund der immer wieder zitierten Aussagen, Unternehmen würden nur 20-30 Prozent (Lehner 2000 S.227) bzw. 40 Prozent (Pawlowsky 1999 S.114) ihres eigentlich verfügbaren organisatorischen Wissens nutzen. Auch Schneider (2000 S.79) betont, dass gerade in einer globalisierten Wirtschaft der Managementaufgabe, alle Teilprozesse zu optimieren, eine hohe Bedeutung zukommt. Als Neuerung gegenüber anderen Managementansätzen ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen der vermehrte Einsatz von IuK-Technologie zu betrachten. Die grundsätzliche innovative Komponente von Wissensmanagement bleibt aber im Dunkeln, denn mit (wissensbasierten und auf Wissen fokusierten) Optimierungsprozessen beschäftigen sich Unternehmen schon seit längerem (Nonaka/Takeuchi 1997 S.63f), ein durch IuK leistungsfähigeres gewordenes effizienzorientiertes „Datenmanagement“ - stellt für sich genommen - keine bahnbrechende Innovation dar (vgl. Aulinger u.a. 1999 S.74f). Diese Form der „Wissenslogistik“ (ebd.) sieht Wissen primär als Produktionsfaktor und kann eine unterstützende Funktion für die Ziele einer weitreichenderen Auffassung von Wis-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 26
sensmanagement ausüben. Nach dieser wird Wissen in erster Linie als strategische Res- gesehen, mit deren Hilfe eine angemessene, tiefergehende Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ermöglicht werden soll. Wissen wird dann unter dem Blickwinkel des Strategischen Managements betrachtet, daran kann nach Probst/Raub (1998) „... das spezifisch Neue einer wissensorientierten Managementperspektive festgemacht werden.“ (ebd. S.132). Diesen Gedanken ausführend, plädieren sie dafür, Wissensmanagement letztendlich zum Auf- und Ausbau von organisationaler Kompetenz zu verwenden mit dem primären Ziel, dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die organisationale Kompetenz wird durch zwei sich ergänzende Kriterien charakterisiert. Erstens durch die strategische Relevanz, damit sind Aktivitäten bezeichnet, die ein Unternehmen derart gut beherrscht, dass es sich mit deren Hilfe von seinen Konkurrenten absetzen kann. Zweitens basiert organisationale Kompetenz auf dem Kriterium der organisationalen Komplexität; diese soll garantieren, dass die Funktionsweise der Kompetenzen für Konkurrenten schwierig zu verstehen und damit auch kaum zu imitieren ist und somit ihre strategische Relevanz erhalten bleibt (ebd. S.134f). Ein in diesem Sinne verstandenes Wissensmanagement muss als zentralen Punkt die Schaffung von neuem Wissen betonen (ebd. S.136); nur neues Wissen ermöglicht Innovationen, den Aufbau von Kompetenzen und dadurch letztlich dauerhafte Wettbewerbsvorteile (Schmitz/Zucker 1999 S.181f). Dieses strategische Verständnis von Wissensmanagement orientiert sich an dem ressourcenbezogenen Strategieansatz. Dieser gelangte Anfang der 90er Jahre, vor dem Hintergrund einer Analyse der ökonomischen Umbrüche, zu dem Schluss, dass nur besondere Fähigkeiten, d.h. (Kern-)Kompetenzen/Schlüssel-qualifikationen eines Unternehmens in dynamisierten Märkten nachhaltige Wettbewerbsvorteile garantieren (Prahalad/Hamel 1990) 33 . Das wesentliche innovative Element des Wissensmanagements ist, dass es sich vor diesem Hintergrund explizit und (mehr oder wenig) theoriebasiert damit auseinandersetzt, wie diese strategisch bedeutsamen Kompetenzen erzielt werden bzw. wie sich verschiedene, in diesem Zusammenhang relevante, Wissenspotentiale gewinnen lassen (Nonaka/Takeuchi 1997 S.62f; vgl. Probst/Raub 1998). Oben wurde schon erwähnt, dass besonders ein personenorientiertes, am evolutionären Ansatz orientiertes Wissensmanagement in der Lage ist, die zur Wissensgenerierung erforderli-
1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements 27
chen Kreativitätspotentiale zu aktivieren und Lernprozesse in Gang zu setzen (Schneider 2000 S.28ff) 34 .
Ebenfalls mit dem gewandelten Strategieparadigma als Bezugspunkt weist Deiser (1996) auf weitere Implikationen eines Wissensmanagement, das in erster Linie auf die Schaffung eines Portfolio von Kernkompetenzen zielt, hin. Ein Unternehmen, welches sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert, ist gezwungen, sekundäre Funktionen, die nicht zur Basis der strategischen Ausrichtung gehören, auszugliedern.
„Die ursprünglich innerhalb eines Unternehmen angesiedelte Wertschöpfungskette wird in mehrere
eigenständige Unternehmen `verstreut´ - Unternehmen, die übrigens Kunden, Lieferanten Mitbewer- oder gar alles in einem sein können.“ (ebd. S.56).
In der Folge entstehen vermehrt netzwerkartige Unternehmensverbünde bis hin zur virtuellen Organisation 35 . Innerhalb dieser werden neue Koordinations- und Regelungsmechanismen erforderlich (ebd.). (Dabei können IuK und Datenbanksysteme unterstützend wirken, sie sind aber nicht die Träger des eigentlichen Prozesses). Gerade hier sieht Deiser den Anknüpfungspunkt für ein strategisches Wissensmanagement. Nur ein kontinuierlicher Lernprozess der Unternehmen, welcher sich an den externen Schnittstellen auf Basis der bewussten Auseinandersetzung mit den relevanten Umweltpartnern abspielt, kann die strategische Kompetenz 36 eines Unternehmens langfristig garantieren, d.h. Antworten auf die Frage liefern, „... mit welchen Kompetenzen welche Produkte auf welchen Märkten positioniert werden sollen.“ (ebd. S.58). Auch in dieser Argumentationskette wird deutlich, dass Wissensmanagement erforderlich ist, um auf gewandelte Umweltbedingungen angemessen reagieren zu können, und sie gibt dem Management von Wissen auf diese Weise einen Status, der es von einem Modethema mit recycelten Zielen und Inhalten abhebt.
Wissensmanagement bietet eine Möglichkeit, einen Transformationsprozess zu begleiten und zu unterstützen, der aufgrund der Umbrüche der Weltwirtschaft und der Gesellschaft notwendig geworden ist; es beinhaltet somit Potentiale, die weit über eine (per Definition vergängliche) Mode hinausweisen (vgl. Schneider 2000 S.77-79).
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 28
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen
Nachdem nun ein einführender Überblick über Inhalte, einzelne Themengebiete, Ent- und Potentiale des Wissensmanagements dargestellt wurde, geht es in diesem Kapitel darum, das Verständnis von dem, was Wissensmanagement ist, wie es angewendet werden kann und was es leisten kann, weiter zu vertiefen. Um dieses Vorhaben zu realisieren, ist es erforderlich, die Basisbegriffe des Wissensmanagements zu diskutieren, zu differenzieren und, wenn möglich, theoretisch zu unterlegen. Die nachfolgenden Ausführungen stellen notwendigerweise eine Auswahl von Begriffen und Modellen dar. Auswahlkriterien waren dabei die Relevanz bezüglich der Implementation von Datenbanken, die Verbreitung in der Literatur sowie das Ziel, ein umfassendes Verständnis vom Wissensmanagement zu vermitteln.
2.1 Diskussion des Wissensbegriffes
Einleitend sollen zwei Zitate deutlich machen, was in der folgenden Diskussion des Wissensbegriffes nicht geleistet werden kann.
„Die Einheit der Idee des Wissens ist heute faktisch nicht mehr vorhanden.“ (Romhardt 1998 S.24). „Ein einheitliches Wissensverständnis oder gar der Begriff des Wissens liegen nicht vor, so dass die
unterschiedlichen Wissenskonzepte immer in Bezug auf bestimmte Forschungsbereiche, Ansätze und
Leitunterscheidungen zu verstehen sind.“ (Krebs 1998 S.33; Hervorhebung im Original). Es geht im Folgenden also weder darum, die endgültige Definition des Wissens zu prä- sentieren, noch sollen beliebige Definitionen unkommentiert aneinandergereiht werden. Vielmehr sollen unterschiedliche, nützliche Verständnisse, Aspekte und Klassifikationen des Wissensbegriffes dargestellt werden. Nützlich für den Fortgang dieser Arbeit, d.h. für die Einordnung von Wissensmanagement allgemein, und als Basis für die weitere Argumentation, womit insbesondere das Verhältnis von Wissen und Datenbanken gemeint ist. Vor diesem Hintergrund soll eine, für das weitere Vorgehen geeignete, Auffassung des Wissensbegriffes gewonnen werden 37 , außerdem sollen die im Kontext dieser Arbeit relevanten Merkmale von Wissen aufgeführt werden, um am Ende des Kapitels zu einem Verständnis zu gelangen, das geeignet ist, im weiteren Verlauf der Arbeit als Bezugspunkt zu dienen.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 29
2.1.1 Erkenntnistheorie und Perspektiven auf Wissen
Als Ausgangspunkt, um ein erstes (Vor-)Verständnis von Wissen zu erlangen und vor allen Dingen, um anhand der langen, kontroversen Diskussion die Komplexität des Begriffes deutlich zu machen, wird häufig Bezug genommen auf verschiedene erkenntnistheoretische Positionen (Krebs 1998 S.34ff; Nonaka/Takeuchi 1997 S.32ff; Rollet 2000 S.23ff) 38 . An dieser Stelle soll zunächst ein kurzer Abriss einiger historischer erkenntnistheoretischer Positionen erfolgen, um im Anschluss daran auf moderne Positionen einzugehen.
Ziel der (philosophischen) Erkenntnistheorie (Epistemologie) ist es zu klären, ob Wissen existiert, was wir wissen können und wie man zu gesichertem Wissen gelangen kann (Krebs 1998 S.36). Die Grundlagen der westlichen Epistemologie liegen in Griechenland. Die Suche nach einer Definition und Charakteristika des Wissens lässt sich zumindest bis zu Platon zurückverfolgen. Dieser vertrat eine rationalistische Sichtweise, dabei ging er, auf Basis seiner Theorie der Ideen 39 , davon aus, dass sich Wissen nur durch menschliche Vernunft resp. logisches Denken (a priori) erlangen ließe. Wissen wird dabei als Weisheitswissen verstanden, welches Bildung einer Person und Denkereignisse innerhalb derselben erfordert (ebd. ; Rollet 2000 S.23ff). Platon gelangte zu der Auffassung, unter Wissen sei ein „gerechtfertigter, wahrer Glaube“ zu verstehen. Eine Diskussion der Definition kann hier nicht geleistet werden, es soll lediglich erwähnt werden, dass die Kritik an ihr sich im Wesentlichen auf die mangelnde Operationalisierbarkeit bezieht (vgl. Rollet 2000 S.25; Wiegand 1996 S.164).
Eine konträre Einstellung zu der Frage, was Wissen ist und wie es gewonnen werden kann, entwickelte Platons Schüler Aristoteles. Dieser plädierte für eine empiristische Sichtweise, d.h. nach seiner Meinung kann Wissen nur aus Sinneswahrnehmungen (a posteriori) gewonnen werden. Wissen entsteht durch sorgfältige Beobachtung. Die beiden Zugänge zum Wissen finden ihre Fortsetzung in der klassischen Erkenntnistheorie. Bedeutende Rationalisten sind Descartes, Leipnitz und Spinoza, während Denker wie Locke, Berkeley und Hume als wichtige Empiristen zu nennen wären. Als erster versuchte Kant beide Ansätze miteinander zu vereinen, er charakterisiert den menschlichen Verstand als aktive Instanz, mit dessen Hilfe es möglich wird, Sinneseindrücke in Zeit
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 30
und Raum einzuordnen sowie die zu deren Verständnis erforderliche Instrumente einzu- (Rollet 2000 S.25; Nonaka/Takeuchi 1997 S.36f) 40 .
Trotz diametral unterschiedlicher Ausgangslage von Empiristen und Rationalisten besitzen sie eine bedeutende Gemeinsamkeit, sie gehen davon aus, dass ein direkter Zugang zur Wahrheit (zum Wissen) möglich ist. Entweder die Vernunfteinsicht oder die Beobachtung werden als Legitimation für die Existenz eines letzten Gültigkeitskriterium angesehen, aus welchem für gewonnenes Wissen eine absolute „Wahrheits- und Gewiß- heitsgarantie“ resultiert (Krebs 1998 S.37). Dass es eine solche Garantie nicht geben kann, wurde von (traditioneller) skeptizistischer Position schon immer angezweifelt (ebd. 36f; Rollet 2000 S.26f). In Folge der grundsätzlichen Zweifel an einem absoluten, gesicherten Wahrheitskriterium und der daraus abgeleiteten Relativität von Wissen haben sich verschiedene moderne Erkenntnistheorien entwickelt (Krebs 1998 S.40). Als direkter Sprössling aus dieser Problematik ist der kritische Rationalismus hervorgegangen, der grundsätzlich davon ausgeht, dass es kein absolutes für immer gültiges Wissen geben kann. Er baut auf einem prinzipiellen Fallibilismus auf, d.h. jedes (nach strenger Methodologie) gewonnene Wissen ist nur vorläufig wahr (es ist lediglich eine Hypothese über die Wirklichkeit), es bleibt grundsätzlich immer möglich, dass es durch kritische Überprüfung - insbesondere wissenschaftliche Experimente - falsifiziert wird (vgl. ebd. S.36ff, 99ff). Diese Methodologie verhindert ein Abgleiten in den Irrationalismus, welcher prinzipiell droht, wenn die Existenz von garantiert wahrem Wissen abgelehnt wird. Neben dem Ablehnen eines absoluten Wahrheitskriterium des Wissens muss als wesentliche Konsequenz aus dem kritischen Rationalismus festgehalten werden, dass Wissen immer konstruiert ist, da seine Gewinnung eben an eine soziale Praxis und die beschriebene Methodologie gebunden ist (ebd. S.39) 41 .
Basierend auf diesen Erkenntnissen haben sich unterschiedliche Ausformungen von neueren (und radikaleren) konstruktivistischen Positionen der Erkenntnistheorie entwickelt. Als Beispiel wäre die systemtheoretische Position zu nennen, welche Wissen als „kondensierte Beobachtung“ (ebd. S.40) und „kognitiv stilisierten Sinn“ betrachtet (ebd.). In dieser Sichtweise entsteht Wissen immer nur innerhalb eines sinnverarbeitenden Systems 42 auf Basis einer von diesem gemachten Unterscheidung. Wissen ist immer
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 31
zustandsgebunden, d.h. es ist abhängig von der Struktur und den Verknüpfungsmöglich- des jeweiligen Systems, außerdem ist es zeitpunktgebunden und sozial konditioniert (vgl. Krebs 1998 S.40-46) 43 .
Erkenntnistheoretische Diskussionen füllen Regale, die dargestellten Splitter sollten aber genügen, um deutlich zu machen, dass der Blick auf Wissen immer von einer wissensphilosophischen Position abhängt. Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass im klassischen Verständnis Wissen als etwas (göttlich) Gegebenes, absolut Wahres galt, was der Mensch entdecken konnte, heutzutage „... ist Wissen aber säkularisierter Natur und damit vom Menschen zu produzieren.“ (Walger/Schencking 2001 S.24). Diese Produktivität des Menschen in Bezug auf Wissen kann zum einen als abstrakte Rechtfertigung für die Notwendigkeit des Managements von Wissen verstanden werden, zum anderen weist sie auf die grundsätzliche, je nach erkenntnistheoretischem Verständnis variierende, Konstruiertheit des Wissens hin, welche auch das Wissensverständnis dieser Arbeit prä- gen wird.
Um einen ersten - und damit notwendigerweise noch beschränkten - Zugang zu dem viel diskutierten Begriff des Wissens zu bekommen, wird oft die Möglichkeit gewählt, ihn von verwandten Begriffen zu unterscheiden. Am häufigsten trifft man in diesem Zusammenhang auf die hierarchische Abgrenzung zwischen Daten, Information und Wissen (z.B. Rehäuser/Krcmar 1996 S.3ff; Weggemann 1999 S.34ff; Willke 1998 S.7ff.). Die Hierarchie besteht entlang zweier Dimensionen, einerseits aus einer temporalen (Information entsteht aus Daten, Wissen aus Information), andererseits wird eine Werthierarchie impliziert (Informationen sind höherwertig als Daten, und Wissen ist wertvoller als Information) (Rollet 2000 S.38) 44 . Diese Kategorisierung ist Grundvoraussetzung, um typische Begriffe des Wissensmanagements, wie z.B. Wissenstransfer oder Wissensspeicherung, richtig einordnen und benutzen zu können.
Daten stehen in dieser Hierarchie ganz unten. Sie werden aufgefasst als „... die symbolische Reproduktion von Zahlen, Quantitäten, Variablen oder Fakten:“ (Weggemann 1999
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 32
S.35) bzw. „... als strukturierte Aufzeichnungen von Transaktionen.“ (Davenport/Prusak 1998 S.27). Willke (1998) weist darauf hin, dass es „keine Daten an sich“ (ebd. S.7) geben kann, dabei bezieht er sich auf die konstruktivistische Erkenntnistheorie, diese zeigt, dass Daten immer beobachtungsabhängig sind, d.h. sie hängen unmittelbar von den Instrumenten und Verfahren ab mit denen sie gewonnen werden, somit sind schon Daten immer konstruiert (ebd.). Ohne ein gewisses (Vor-)Wissen kann nichts zu einem Datum werden (Schneider 2000 S.9). Menschen benutzen als Instrumente der Beobachtung z.B. Theorien, Ideologien oder Vorurteile, also allgemein ausgedrückt, verschiedene kognitive Modelle, um Daten zu gewinnen (Willke 1998 S.7). Daten gelten als „hart“, wenn die Vertrauenswürdigkeit der Meßinstrumente, mit denen sie gewonnen werden und die Gültigkeit der Messung zweifelsfrei belegt sind (Weggemann 1999 S.36). Daten müssen immer in irgendeiner Form codiert sein, dabei gibt es nur drei Möglichkeiten: Sie können als Zahlen, Texte/Sprache oder Bilder vorliegen (Willke 1998 S.7f). Informationen entstehen, wenn Daten Relevanz für ein System erhalten, dafür müssen sie in einen ersten „Kontext von Relevanzen“ (ebd. S.8) bzw. „Sinnzusammenhang“ (Wilkesmann/Rascher 2001 S.2) eingebunden werden 45 . Daten sind also der Rohstoff der Information, für sich genommen sind sie wenig wert, da sie keine Aussage über die eigene Bedeutung enthalten.
„Eine Information ist nur dann konstituiert, wenn ein beobachtendes System über Relevanzkriterien
verfügt und einem Datum eine spezifische Relevanz zuschreibt.“ (Willke 1998 S.8). Als Systeme werden z.B. psychische Systeme, also Menschen, oder soziale Systeme bspw. Organisationen, aufgefasst. Die Relevanzen sind immer systemabhängig, es gibt keine Relevanzen an sich, damit ist also jede Information systemrelativ. Daraus wiederum folgt, dass der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Systemen (zunächst theoretisch) nicht möglich ist. Dies würde identische Relevanzkriterien, die sich u.a. aus der jeweiligen Geschichte, den kognitiven Strukturen sowie aus Motiven und Zielen ergeben, bei beiden Systemen erfordern, wäre dies jedoch der Fall, könnte nicht mehr von zwei unterschiedlichen Systemen gesprochen werden. Wenn ein System (Alter) eine Information einem anderen (Ego) übermitteln möchte, nimmt Ego diese nur als Datum wahr. Erst indem Ego dieses Datum anhand seiner systemspezifischen Relevanzkriterien bewertet, konstruiert es aus ihm eine bedeutungsvolle Information. Dass diese für Ego
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 33
eine andere ist als für Alter ergibt sich zwangsläufig aus der Systemspezifität der Rele- (ebd. S.8f). Diese recht abstrakte Argumentation ist nötig, um eine naive Betrachtung des Informationsaustausches im Sinne einer Eins zu Eins-Übertragung von Information und die damit verbundenen Fehlschlüsse, auch im Hinblick auf die Verwendung von Datenbanken, zu vermeiden 46 . Angelehnt an den (einfacheren) Worten von Davenport/Prusak (1998 S.29) ist festzuhalten, dass letztlich immer der Empfänger einer Information (bzw. die Ausgestaltung seiner Relevanzkriterien) darüber entscheidet, ob etwas für ihn eine Information darstellt und was diese für ihn bedeutet. Wissen ist der komplexeste und umstrittenste der drei Begriffe. Unstrittig und intuitiv einsehbar ist, dass Wissen im Vergleich zu Information „... mehr umfaßt, tiefer gründet und reichhaltiger ist.“ (Davenport/Prusak 1998 S.31). Wissen entsteht, wenn Informationen - nach der Formulierung von Willke (1998) - „in einen zweiten Kontext von Relevanzen“ (ebd. S.11) eingebunden werden. Dieser Kontext basiert auf bisherigen bedeutsamen Erfahrungsmustern, welche in dem Gedächtnis eines Systems gespeichert sind. Informationen müssen also immer mit Erfahrungen verknüpft werden, damit Wissen entstehen kann, dabei ist Wissen immer in einen zweckorientierten Produktionsprozess integriert, d.h. es muss für das System einen Grund/Zweck geben, die Informationen einzubinden (ebd. S.11f) 47 . In jedem Fall entsteht Wissen nach dieser Auffassung durch einen menschlichen Konstruktionsprozess, womit die Auffassung von Wissen als objektive Wahrheit negiert wird (s.o.; Mandel/Reinmann-Rothmeier 2000 S.6). Völlig trennscharf ist Willkes Differenzierung von Information und Wissen aber nicht, denn es bleibt unklar, inwiefern nicht auch die Relevanzkriterien, mit denen aus Daten Informationen gemacht werden, ähnlich wie der „zweite Kontext von Relevanzen“, ebenfalls auf Erfahrungen beruhen und somit ebenfalls ein Gedächtnis benötigen. Es fehlt also eine genauere Definition der Relevanzkriterien und der Erfahrungsmuster bzw. eine präzisere Differenzierung beider Begriffe 48 .
Grundsätzlich herrscht aber weitgehend Einigkeit in der Ansicht, dass Wissen in irgendeiner Form die Struktur ist bzw. eine solche vorgibt, mit deren Hilfe Informationen nä-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 34
her eingeordnet werden können (Davenport/Prusak 1998 S.32; Schneider 2000 S.16). Folgendes Zitat veranschaulicht diese Auffassung:
„Wissen ist eine fließende Mischung aus strukturierten Erfahrungen, Wertvorstellungen, Kontextin- und Fachkenntnissen, die in ihrer Gesamtheit einen Strukturrahmen zur Beurteilung und
Eingliederung neuer Erfahrungen und Informationen bietet. Entstehung und Anwendung von Wissen
vollziehen sich in den Köpfen der Wissensträger.“ (Davenport/Prusak 1998 S.32) 49 . Ursachen für die Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Wissensbegriff entstehen sicherlich auch zum Teil dadurch, dass es möglich ist, Wissen sowohl als Bestand als auch als Prozess anzusehen (ebd. S.33). Auf einen Aspekt dieses Problems weist auch Weggemann (1999 S.39) hin, wenn er feststellt, dass für eine Definition des Wissens im Rahmen der dargestellten Hierarchie immer die Notwendigkeit besteht, die Interaktion zwischen Information und Wissen zu erfassen. Information kann nämlich sowohl als Input für die individuelle Wissensentwicklung (Prozess) als auch als Teil des bereits entwickelten Wissens (Bestand) angesehen werden. Auf dieses Problem wird im Folgenden noch eingegangen.
Die bisherigen Ausführungen zum Wissen waren hauptsächlich auf die Entstehung von Wissen fokussiert. Um für den weiteren Verlauf der Arbeit einen klaren Rahmen zu besitzen und die Unklarheiten in der Abgrenzung von Information und Wissen (s.o.) weiter zu minimieren, soll Wissen (ergänzend, d.h. auf Grundlage des oben Gesagten) auch unter dem Aspekt der Anwendung definiert werden. Es ist durchaus verbreitet, Wissen als Handlungsgrundlage darzustellen (Rollet 2000 S.33f), es wird also in Zusammenhang mit Entscheidungen und Problemlösungen gestellt. Dementsprechend wird im Weiteren Wissen als
„... persönliche Fähigkeit, durch die ein Individuum eine bestimmte Aufgabe ausführen kann ...“
(Weggemann 1999 S.39, Hervorhebung durch U. L.)
aufgefasst (vgl. ebd. S.36ff; Davenport/Prusak 1998 S.34ff; Nonaka/Takeuchi 1997 S.71; Schmidt 2000 S.15ff). Wobei sich Wissen nach der metaphorisch zu verstehenden Formel W = I * EFE aus Information, Erfahrung, Fertigkeit und Einstellung zusammensetzt (Weggemann 1999 S.41) 50 . Aus dieser fähigkeitsbezogenen Definition ergeben sich wichtige Implikationen: Der Wissensbegriff wird streng an den Menschen gebunden.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 35
Wissen entsteht nur durch und in den Menschen, es wird individuell konstruiert, vor allen Dingen existiert Wissen nur in den Köpfen von Personen. Folglich ist es nicht möglich, Wissen in Datenbanken abzuspeichern, diese können lediglich die Wissensgenerierung der Menschen anregen 51 . Die oft verwendete Formulierung des „Speicherns von Wissen“ (z.B. Probst u.a. 1997 S.295ff) ist also irreführend, weil verkürzend. Außerhalb des Menschen gibt es nur Daten, denn schon Informationen sind etwas Persönliches, sie können aber in Form von Daten weitergegeben werden und so bei einem anderen Menschen wieder zu (nicht unbedingt identischer) Information führen (vgl. Fußnote 45, S.32) 52 . Diese Perspektive auf Wissen als persönliche Fähigkeit im Sinne eines Handlungspotentials, entstanden in dem Prozess einer menschlichen Realitätskonstruktion, gewinnt in der aktuellen Literatur zwar an Bedeutung, allerdings werden nicht immer die nötigen Konsequenzen daraus gezogen (vgl. das nächste Unterkapitel), außerdem ist sie durchaus nicht unumstritten (Schmidt 2000 S.16). Sie wird aber den folgenden Ausführungen als Bezugsrahmen dienen, weil erstens gerade in ökonomisch orientierten Organisationen die Handlungsrelevanz des Wissens von Bedeutung ist und zweitens, weil sie sich für die Darstellung vieler in Zusammenhang mit Datenbanken auftretenden Probleme (z.B. beim sogenannten „Wissenstransfer“) als besonders anschlussfähig erweist sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten klarer hervortreten lässt 53 .
2.1.3 Implizites und explizites Wissen und andere Systematisierungsversuche
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass es durchaus kompliziert werden kann, wenn man sich näher mit dem Wissensbegriff auseinandersetzt. Um diese Komplexität zu reduzieren und um den Wissensbegriff für die jeweiligen Zwecke handhab-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 36
bar zu machen, hat es im Verlaufe der Zeit die unterschiedlichsten Versuche gegeben, Wissen zu systematisieren. Entweder werden Listen von unterschiedlichen Wissensdimensionen aufgestellt oder Wissen wird entlang von Gegensatzpaaren dichotomisiert. Begründet durch die fruchtbare theoretische und praktische Anschlussfähigkeit hat im Wissensmanagement unbestritten die, auf Polanyi (1985 S.13ff) 54 zurückgehende und von Nonaka/Takeuchi (1997) in den organisationalen Kontext gesetzte, Dichotomisierung von implizitem und explizitem Wissen 55 den größten Zuspruch erhalten und damit zusammenhängend die weiteste Verbreitung gefunden. Bevor dieses Gegensatzpaar detaillierter dargestellt wird, sollen noch einige andere Wissensunterscheidungen zumindest erwähnt werden, denen eine gewisse Relevanz im Kontext des Wissensmanagements nicht abgesprochen werden kann.
Grundsätzlich ist jedoch zunächst in den Worten von Schneider (2001 S.43ff) festzuhalten, dass, wenn Wissen sinnvoll gemanagt werden soll, gerade die Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit von Wissen es für die Unternehmen unabdingbar macht, sich „Wissen über Wissen“ (ebd. S.51) anzueignen und parallel dazu eine verlebendigte Auseinandersetzung darüber zu führen, welche Wissensdimensionen und Verständnisse unternehmensspezifisch relevant und erfolgsentscheidend sein können, d.h. letztendlich Marktwert schaffen. Bei diesen Prozessen können Systematisierungen von Wissen hilfreich sein, indem sie eine unterstützende (Erklärungs-)Funktion übernehmen, letztlich muss allerdings immer aus dem jeweiligen Unternehmenskontext heraus entschieden werden, was Sinn macht (Schneider 2000 S.10f; vgl. Baecker 1999 S.106). Romhardt (1998 S.27) präsentiert in einer umfassenden Literaturübersicht 40 Dichotomien des Wissensbegriffes aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, trifft aber unter dem Aspekt der Praxisrelevanz 56 eine Auswahl von vier Gegensatzpaaren (ebd. S.56ff), welchen er beim Management von Wissen besondere Bedeutung zumißt. Erstens unterscheidet er individuelles Wissen von kollektivem Wissen; anhand dieser Differenzierung wird das Phänomen verdeutlicht, dass es bestimmte Fähigkeiten einer Organisation gibt, die sich nicht durch die Summe der Fähigkeiten aller Mitarbeiter erklären lassen. Es existiert ein kollektives Wissen, was insbesondere durch die Relationen und Verknüpfungen zwischen den Organisationsmitgliedern geprägt ist und sich bspw. in Ar-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 37
beitsroutinen oder der Unternehmenskultur manifestiert 57 . Im zweiten Gegensatzpaar differenziert er zwischen internem und externem Wissen. Dies macht deutlich, dass Organisationen nur als offene Systeme zu verstehen sind, die dem Zwang unterliegen, externe Wissensbestandteile zu beachten und evtl. zu integrieren. Auf jeden Fall sind Interaktion und Verhältnis beider Wissensarten wichtiger Bestandteil aller Überlegungen zum Wissensmanagement. Des Weiteren ist nach Romhardt (1998) der Unterschied zwischen analogen und digitalen Daten und Informationen (als Grundlage des Wissens) von Bedeutung. Die neuen Technologien haben die Möglichkeiten, traditionelle analoge Wissensträger (z.B. Bücher) der Organisation in digitalisierter Form (z.B. im Intranet) zur Verfügung zu stellen, enorm vergrößert. Mit der Unterscheidung analog/digital sollen Möglichkeiten und Grenzen dieser neuen Potentiale erkannt bzw. analysiert werden (ebd. S.60). Schließlich führt er die bereits erwähnte Dichotomie zwischen implizitem und explizitem Wissen an.
Doch bevor diese Basisdifferenzierung dargestellt wird, sollen zunächst noch einige Auflistungen von Wissensarten auf weitere Dimensionen des Begriffes hinweisen: Schneider (2000 S.18f) unterscheidet die fünf in Abbildung 3 (S.38) aufgeführten Wissensbestandteile. Sie betont, dass Wissen grundsätzlich aus einer Kombination von Bestandteilen besteht und bspw. für die Entwicklung von Alternativen also Innovationen, die Warum- und Wozu-Inhalte des Wissens nicht vernachlässigt werden dürfen. Außerdem weist sie explizit darauf hin, dass für die mehrwertschaffende Anwendung von Wissen immer die drei Aspekte des Wollens, Dürfens und Könnens Beachtung im organisationalen Kontext finden müssen.
Generell lässt sich Wissen aus Sicht des Unternehmens vor dem Hintergrund seines Einsatz- und Generierungsbereiches gliedern. So lässt sich Wissen über Beschaffungsmärkte, über Absatzmärkte und dazwischenliegend Wissen über den Transformationsprozess unterscheiden (Rehäuser/Krcmar 1996 S.14).
Es gibt eine Reihe weiterer Versuche, den Begriff des Wissens mit Hilfe von Kategorisierungen näher zu erfassen (z.B. Baecker 1998; Rehäuser/Krcmar 1996 S.6ff; Zahn 1999 S.43f), sie können aber im Kontext dieser Arbeit vernachlässigt werden.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 38

Abb. 3: Bestandteile des Wissens (nach Schneider 2000 S.18)
Wie schon erwähnt, ist die Klassifikation von Wissen in explizites und implizites die im Wissensmanagement am häufigsten verwendete. Explizites Wissen ist, in den Worten von Nonaka und Takeuchi (1997), Wissen welches
„... sich formal, das heißt in grammatischen Sätzen, mathematischen Ausdrücken, technischen Daten,
Handbüchern und dergleichen artikulieren läßt.“ (ebd. S.8). Demgegenüber steht das implizite Wissen, welches sich
„... dem formalen sprachlichen Ausdruck entzieht.“ (ebd.).
und nur schwer mitzuteilen ist (ebd. S.18). Der Begriff des impliziten Wissens geht auf Polanyi (1985) zurück, der als Ausgangspunkt seiner philosophischen Betrachtungen über die menschliche Erkenntnis die Tatsache wählte, dass „... wir mehr wissen als, wir zu sagen wissen.“ (ebd. S.14) 58 . Implizites Wissen basiert auf den Erfahrungen des Einzelnen und bezieht sich auf schwer zu formalisierende Faktoren, wie subjektive Einsichten, Überzeugungen, Intuitionen und Wertsysteme (Nonaka/Takeuchi 1997 S.8; Weggemann 1999 S.42). Nonaka/Takeuchi (1997 S.19) differenzieren zwei Dimensionen des impliziten Wissens. Die technische Dimension bezeichnet schwer beschreibbare Fertigkeiten, darunter fällt z.B. die häufig zitierte Tätigkeit des Radfahrens, bei welcher die ausführende Person kaum in der Lage ist zu erklären, wie sie die notwendigen Muskelbewegungen koordiniert, um das Gleichgewicht zu halten 59 . Aber auch die von ei-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 39
nem Handwerker nach Jahren der Berufserfahrung entwickelte perfekte Beherrschung seiner Maschinen oder bestimmter Bewegungsabläufe fällt in diese Kategorie. Die zweite Dimension des impliziten Wissen wird als kognitive bezeichnet. Sie spiegelt die Wirklichkeitsauffassungen von Menschen wieder und beinhaltet Überzeugungen, mentale Modelle und Vorstellungen, die so tief verwurzelt sind, dass sie für selbstverständlich gehalten werden. Diese Dimension bestimmt die Art und Weise, wie wir die uns umgebende Umwelt wahrnehmen. Generell eignet sich für die Weitergabe von implizitem Wissen, wenn es nicht expliziert werden soll oder kann, am besten die direkte soziale Interaktion zwischen Menschen (Nonaka/Takeuchi 1997 S.74ff). Bevor im Weiteren die bedeutenden Implikationen der Wissensunterscheidung in implizites und explizites Wissen für das Wissensmanagement dargestellt werden, sind noch einige systematisierende Anmerkungen erforderlich. Rüdiger/Vanini (1998) weisen in ihrem Aufsatz darauf hin, dass die Konzepte des impliziten Wissen 60 zwar alle mehr oder weniger Bezug auf Polanyi (1985) nehmen, in ihrer Ausgestaltung aber erheblich variieren, so dass bisher keine einheitliche Definition vorliegt (ebd. S.468). Die Definitionen haben beschreibenden Charakter und beziehen sich auf drei Komplexe (wobei jeweils unterschiedlich, teils widersprüchliche 61 Merkmale auftauchen): Die Eigenschaften von implizitem Wissen (z.B. schwer oder nicht zu artikulieren), die Ursachen für diese Eigenschaften (z.B. Wissen ist verinnerlicht, unbewusst) und auf die Folgen der Eigenschaften für die Weitergabe von Wissen (z.B. schwer übertragbar). Rüdiger/Vanini (1998) entwickeln in ihren weiteren Ausführungen eine präzisere Abgrenzung impliziten und expliziten Wissens anhand von drei Dimensionen, woraus sich acht Wissensformen ergeben (ebd. S.470ff), für die Zwecke dieser Arbeit erscheinen sie allerdings zu detailliert und werden aus diesem Grund hier nicht dargestellt. Als Bezugspunkt für die weiteren Darstellungen bleibt festzuhalten, dass die zentrale Eigenschaft von implizitem Wissen die „schwierige“ Artikulation, Formulierung und Kodifizierung ist, wobei zu unterscheiden ist, dass es implizites Wissen gibt, welches lediglich nicht ausgesprochen ist und solches, welches grundsätzlich unaussprechbar bleibt (so auch Schneider 2000 S.15). Die grundlegenden Merkmale expliziten und impliziten Wissens sind in Abbildung 4 zusammengefasst.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 40
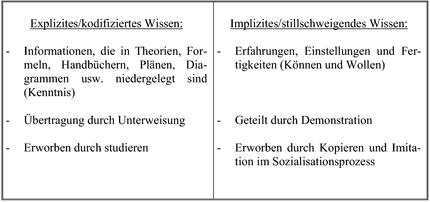
- Informationen, die in Theorien, For- Erfahrungen, Einstellungen und Fer- Übertragung durch Unterweisung - Geteilt durch Demonstration
- Erworben durch studieren - Erworben durch Kopieren und Imitation im Sozialisationsprozess
Abb. 4: Explizites und implizites Wissen (nach Weggemann 1999 S.43)
In Rückbezug auf die oben (II. 2.1.2, S.31) getroffene Festlegung von Wissen als perso- Fähigkeit ist festzuhalten, dass der Begriff des expliziten Wissens streng genommen in Widerspruch dazu steht. Denn per Definition kann Wissen nur in den Köpfen von Personen verortet werden, außerhalb existieren nur Daten. Da sich der Begriff des expliziten Wissens in der Diskussion aber eingebürgert hat, wird er auch hier im Folgenden weiter verwendet. Es muss aber immer beachtet werden, dass explizites Wissen eher als Variable für erst noch zu leistende Denk- und Kommunikationsprozesse steht (Schneider 2000 S.12). Explizites bzw. kodifiziertes Wissen beruht auf Strukturen, in denen das für wesentlich Befundene in Codes dargestellt wird, diese Codes müssen beim Empfänger wieder jene stillschweigenden Bestandteile 62 auslösen, die die Entwickler bzw. Verwender des Codes damit verbunden haben. Bevor dies nicht geschieht, ist auch expliziertes „Wissen“ für den Empfänger nichts anderes als eine Ansammlung von Daten oder sogar lediglich nichtssagendes Rauschen (Aulinger u.a. 2001 S.78f; Schneider 2000 S.14). Folgt man dieser Darstellung wird deutlich, dass Wissen nie als solches expliziert werden kann, sondern - je nach Definition - nur in der Form von Daten (Aulinger u.a. 2001 S.78) oder als Information (Weggemann 1999 S.43), mit für bestimmte Adressaten unterschiedlich hoher Anschlussfähigkeit. Die Implikationen dieses Gedankenganges werden später in Bezug auf die Nutzung von Datenbanken und hier speziell bei der Bedeutung von Wissensgemeinschaften eine Rolle spielen und entsprechend ausgeführt.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 41
2.1.4 Eigenschaften von Wissen als Ressource sui generis
Dieser Abschnitt dient weniger der Definition, sondern benennt einige bisher noch nicht aufgeführte Eigenschaften von Wissen 64 , einerseits um die Bedeutung dieser Ressource zu unterstreichen (hier besteht ein Bezug zu II. 1.1), vor allen Dingen aber um auf Be-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 42
sonderheiten aufmerksam zu machen, welche Berücksichtigung finden müssen, wenn ein angemessener Umgang mit Wissen praktiziert werden soll. Die (wirtschaftlich relevanten) Eigenschaften der Ressource Wissen werden evident, wenn man sie den materiellen Produktionsfaktoren gegenüberstellt (zum Folgenden Rehäuser/Krcmar 1996 S.9ff; Rollet 2000 S.30ff; Schneider 2000 S.19ff). Die wichtigsten Merkmale sollen nun erläutert werden.
Die das Wissensmanagement konstituierenden Eigenschaften von Wissen 65 sind, dass es sich in vielfachem Besitz an unterschiedlichen Orten befinden kann, durch Gebrauch und Abgabe „vermehrt“ es sich u.U., und durch diese Prozesse kann es wertvoller werden. Gibt eine Person ihr Wissen an andere Personen ab (Wissensteilung) verliert sie es nicht, es kann mit Wissensbestandteilen anderer verknüpft werden, um auf diese Weise reicher und bedeutungsvoller zu werden, evtl. wird sogar neues Wissen generiert (vgl. III. 2.3, S.83) 66 . Umgekehrt ist aber auch davor zu warnen, Wissen unreflektiert aus seinem Kontext zu lösen, denn dann kann es geschehen, dass es an Wert verliert, weil es von anderen aufgrund mangelnder Anschlussfähigkeit an bestehende Wissensstrukturen nicht mehr verstanden wird und entsprechend der oben gemachten Definition keine (neue) Handlungsfähigkeit darstellt. 67
Neben den Besonderheiten der Wertdimension von Wissen, was Besitz, Gebrauch und Teilung anbelangt, sind auch seine Charakteristika in Bezug auf die Kosten seiner Teilung und Vervielfältigung zu beachten. In der Literatur werden üblicherweise Entwicklung und Vervielfältigung des Wissens unterschieden, wobei dann betont wird, dass der Großteil der Kosten bei der Entwicklung von Wissen entsteht und die Verteilung bzw. Vervielfältigung dagegen relativ kostengünstig geschehen kann 68 . Es wird im Allgemeinen angenommen, dass sich explizites, kodifiziertes Wissen im Vergleich mit materiellen Produktionsfaktoren vergleichsweise kostengünstig vervielfältigen bzw. teilen lässt (vor allen Dingen unter Zuhilfenahme neuster IuK), allerdings kann Wissen erst als vervielfältigt angesehen werden, wenn es bei Menschen entsprechend verankert wurde.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 43
De facto ist jegliche Wissensvervielfältigung unabhängig von der Wissensart also im- auch mit mehr oder weniger hohen Personalkosten verbunden und muss zusätzlich durch entsprechende organisationale Rahmenbedingungen gefördert werden. Eine weitere Eigenschaft des Wissens, die den Umgang mit ihm für Unternehmen schwierig macht, ist, dass es sich nicht ohne weiteres messen lässt, dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es nicht einfach zu operationalisieren ist. Diese Problematik ergibt sich aus der Kontext- und Personengebundenheit des Wissens, soll es gemessen werden, kann dies nur „... über den Preis der Verdinglichung ...“ (Roehl/Romhardt 1997, zitiert aus North u.a. 1998 S.158) geschehen, d.h. seiner Entnahme aus zeitlichen, situativen und persönlichen Kontexten. Folglich kann es nur mittelbar und unscharf erfasst werden, d.h. harte quantitative, finanzielle Kennzahlen müssen teilweise durch qualitative Indikatoren ersetzt werden (ebd.; Probst u.a. 1997 S.318ff). Es wird häufig betont, dass eine Form der Messung als unverzichtbar erscheint, u.a., um Wissensmanagement über seine Erfolge zu legitimieren und in Anlehnung an den klassischen Managementzyklus - welcher eine Zielsetzung und deren anschließende Kontrolle beinhaltet - steuern zu können (instrumentelle Sicht) oder um verständigungsrelevante Feedbackprozesse erhalten zu können (evolutionäre Sicht) (vgl. Schneider 2000 S.58f).
Entsprechend der Bedeutung, geeignete Methoden zur Wissensmessung zu finden, hat sich in den letzten Jahren eine umfangreiche Diskussion zu diesem Thema herausgebildet. Die Darstellungen der Wissensmessung firmieren dabei meist unter den Begriffen des intellektuellen Kapitals, welches wiederum in Human-, Struktur- und Beziehungskapital gegliedert werden kann, oder allgemein unter dem Oberbegriff der immateriellen Ressourcen. Grob lassen sich deduktiv summarische (mit Fokus auf den Unternehmensprozess) und induktiv analytische Ansätze (basierend auf einer Mikrobetrachtung des Unternehmens) unterscheiden (Schneider 2000 S.65ff). An dieser Stelle kann nicht auf einzelne Meßverfahren eingegangen werden, es bleibt aber festzuhalten, dass die Messung von Wissen für erfolgreiches Wissensmanagement unbedingt nötig erscheint, dabei viele (bisher ungelöste) Probleme (ebd. S.72f) aufwirft und von den bisher entwickelten Methoden keine ohne Schwächen daherkommt (vgl. North u.a. 1998 S.158f u. S.163; Probst u.a. 1997 S.339). In den kritischen Worten Schneiders (2001) beruhen die vorliegenden Modelle zur Erfassung von Wissen
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 44
„... auf schwachen Kausalitätsvermutungen, reduzieren die Komplexität vernetzter Einflußmuster und
69 . sind zu wenig an Aktivitäten und Ergebnissen orientiert:“ (ebd. S.113) Wird Wissen im Kontext von Organisationen betrachtet, darf eine Eigenschaft keinesfalls ausgeblendet bleiben: Wissen ist immer auf vielfältige Weise mit Machtpotentialen verbunden, die Macht(verteilung) hat Einfluss auf Verbreitung, Interpretation und Aneignung von Wissen 70 (vgl. Hanft 1996). So kann die Weitergabe von Wissen Machtverluste für einzelne Personen zur Folge haben, weil sie ihre Verhandlungsposition schwächt und innerhalb der Organisation zu Wettbewerbsnachteile führt (ebd. S.144; Wilkesmann/Rascher 2001 S.2). Außerdem wird bei einer mikropolitischen Betrachtung der Organisation (s. II. 4, S.64) deutlich, dass schon die Aushandlung von neuem Wissen (und dessen Integration in die Organisation) immer erst vor dem Hintergrund der Herstellung gemeinsamer Deutungsschemata zu begreifen ist, wobei eben dieser Prozess mit einer Reformulierung von Macht- und Einflusszonen verbunden ist. Neues Wissen fließt also insbesondere dann in die Organisation ein, wenn es den Interessen der (durchsetzungsfähigen) Akteure entspricht (Hanft 1996 S.143). Auf den Zusammenhang von Wissen und Macht sollte hier nur hingewiesen werden, seine Implikationen werden im dritten Teil (III. 3.1.2) vertiefend geschildert. Abschließend sei noch einmal auf eine schon kurz angesprochene Eigenschaft von Wissen hingewiesen: Es ist teilweise in Organisationsprozessen eingebettet, nur diese Tatsache macht es möglich, von kollektivem Wissen zu sprechen. Organisationen speichern Wissen in Strukturen, Routinen, Normen, Werten u.Ä.; dieses Wissen ist mehr als die Summe des sich in den einzelnen Köpfen befindlichen Wissens. Allerdings wird es erst auf dem Umweg über die Köpfe der Organisationsmitglieder aktiviert und in Handeln umgesetzt und damit zum Wissen i. e. S. (wie unter II. 2.1.2, S.31 definiert) (Schneider 2000 S.20).
69 Zur umfassenden Darstellung der Meßproblematik von Wissen siehe, neben der im vorstehenden Text aufgeführten Literatur, Kaplan/Norton (1997) sowie zusammenfassend Horváth (1998) jeweils zum prominenten Konzept der Balanced Scorecard, außerdem die gesamte Diskussion erfassend: Reinhardt (1998) sowie Kurtzke/Popp (1998).
Im Kleinen treten diese Probleme auch im Zusammenhang mit Datenbanken auf, wenn Aktualisierungsprozesse oder zu gewinnende Kriterien für Belohnungsmechanismen die Bewertung von abgelegten Inhalten nötig erscheinen lassen.
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 45
2.2 Lernen auf verschiedenen Ebenen
Gemessen an dem Auftreten in der Literatur sind die Inhalte des folgenden Abschnittes der breiten Diskussion um das organisationale Lernen zuzuordnen, neuere Beiträge zum Wissensmanagement thematisieren Lernprozesse auf theoretischer Basis häufig nicht explizit oder nur am Rande resp. beschränken sich auf ein Modell (oft die Wissensspirale von Nonaka/Takeuchi 1997) 71 . Hier wird allerdings die Ansicht vertreten, dass, parallel zu der Auffassung, für ein angemessenes Verständnis des Wissensmanagements den Wissensbegriff theoretisch erfassen zu müssen, dies in ähnlicher Weise auch für Prozesse des Lernens gilt. Aus Platzgründen soll dies hier allerdings nur grob überblicksartig geschehen. Es gibt zwei eng verbundene Argumente, die es notwendig erscheinen lassen, sich mit den verschiedenen Formen des Lernens auseinanderzusetzen. Zum einen werden mit dem Verständnis von Lernprozessen, die auch als “Wissenserzeugungsprozesse” charakterisiert werden können (Weggemann 1999 S.51), die Entstehungsbedingungen von Wissen, und damit seine angemessene Erfassung, analytisch vertieft, damit in Zusammenhang stehend wird zum anderen die zentrale Thematik der Wissensgenerierung erfasst. Dies ist erforderlich, wenn man Wissensmanagement nicht (verkürzend) lediglich im Sinne eines rein instrumentellen Ansatzes auffassen möchte. Die Beschäftigung mit Lernprozessen macht deutlich, dass Lernen auf verschiedenen Ebenen geschieht, dabei unterschiedlichen Regeln folgt und welche Zusammenhänge zwischen den Ebenen modelliert werden können.
In der Literatur zur lernenden Organisation wird individuelles Lernen meist in Bezug auf mögliche Erkenntnisse für das organisationale Lernen behandelt. Der Stellenwert, den die individuellen Lernprozesse dabei einnehmen, variiert, je nachdem wie weit das organisationale Lernen auf diese untere Ebene zurückgeführt wird 72 . Zur Konstruktion individueller Lernprozesse wird auf Konzepte der Lernpsychologie zurückgegriffen, wobei sich grob eine (neo)behavioristische und eine kognitive Erklärungsperspektive 73 unterscheiden lassen (z.B. Schüppel 1996 S.64ff; Wiegand 1996 S.343ff), wobei die letztere inzwischen meist als tragfähiger für den organisationalen Kontext aufgefasst
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 46
wird (Schreyögg 2001 S.5). Obwohl gerade auch im Wissensmanagement individuelle Lernprozesse eine große Bedeutung haben, bspw. bei Prozessen der Wissensgenerierung, wird in den aktuellen Veröffentlichungen selten ein theoretisches Lernkonzept expliziert. Meistens rekurrieren die Darstellungen in diesem Zusammenhang lediglich auf die oben geschilderte Unterscheidung von Daten, Information und Wissen. An dieser Stelle soll allerdings ein ausgewähltes lerntheoretisches Konzept (der „Lernzirkel“) 74 und die ihm zugrundeliegende Perspektive skizziert werden, weil sich daraus einige Implikationen für den weiteren Verlauf der Arbeit allgemein sowie speziell für den Wissensbegriff ableiten lassen.
Die theoretische Grundlage der folgenden Konzeption der individuellen Wissensbasis bzw. des Lernzirkelmodells ist im Wesentlichen die kognitivistische Erklärungsperspektive, in dieser stehen kognitive Prozesse (Wahrnehmen, Denken, Problemlösen usw.) im Mittelpunkt. Im Zuge des Lernvorgangs bilden sich bestimmte kognitive Strukturen, d.h. einzelne Kognitionen werden zu einer Wissensbasis verknüpft, diese bildet wiederum den Ausgangspunkt für weiteres Lernen, außerdem ermöglichen sie dem Individuum „sinnvolles“ Handeln (ebd.; Schüppel 1996 S.66). Diese Konzeption von Lernen ist mit zwei schon erwähnten Auffassungen in Bezug auf Wissen vereinbar: Zum einen entsteht neues Wissen immer auf Basis schon vorhandenen Wissens, wobei zu beachten ist, dass es nicht ausreicht, Daten nur aufzunehmen, diese müssen auch in einen Zusammenhang gebracht werden (wofür gewisse Strukturen schon vorhanden sein müssen), zum anderen wird auch hier Wissen bzw. das Ergebnis des Lernprozesses als Handlungsressource aufgefasst. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Auffassung der verknüpften Kognitionen bei Individuen als Analogie auf die organisationale Ebene übertragen wurde und damit das Konzept einer organisationalen Wissensbasis konstituiert wurde (Schreyögg 2001 S.5f; s. dazu das übernächste Unterkapitel 2.2.3). Konkret vollzieht sich der Lernprozess der Individuen im Konzept des Lernzirkels 75 durch vier verflochtene, aufeinanderfolgende Lernaktivitäten. Auf Basis einer subjektabhängigen Realitätswahrnehmung (1) findet eine Analyse des Erfahrenen (2) statt, diese bildet die Grundlage für die Entwicklung von Verhaltensorientierungen (3), welche dann schließlich zu der Generierung von Verhaltensweisen (4) führt. Diese können
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 47
dann wieder Ausgangspunkt für eine erneute Wahrnehmung der Realität, deren Analyse usw. sein. Jede dieser Aktivitäten erzeugt schon für sich genommen verschiedene Wissensarten, die dann, wie gesagt, wieder die Basis für neue Lernaktivitäten darstellen (Schüppel 1996. S.69f) 76 . Parallel zum Lernzirkel ist das Lernen des Menschen durch eine weitere Ebene determiniert, den sogenannten individuellen Kognitionsrahmen 77 ; dieser beeinflusst die oben genannten vier Lernaktivitäten entsprechend seiner individuellen Ausprägung. Er drückt die charakteristische Welt- und Selbstsicht eines Individuums aus und manifestiert sich in subjekttypischen Handlungsroutinen, kognitiven Verarbeitungsmustern und Handlungsstrategien. Er steuert u.a. die „generelle Informationswahrnehmung und Informationsprozessierung“ (ebd. S.73); grundsätzlich darf er aber nicht als einseitiger Einfluss auf die Lernaktivitäten gedacht werden, es besteht ein komplexes, interdependentes Verhältnis (ebd. S.71ff). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vier Lernaktivitäten und der Kognitionitionsrahmen die individuelle Wissensbasis bilden, wobei diese sowohl die Ausgangsbedingung als auch das Ergebnis der Lernprozesse darstellt. An dieser Stelle kann keine tiefgründigere Darstellung erfolgen, dennoch können einige Implikationen aus dem bisher Gesagten geschlussfolgert werden.
Zunächst einmal lässt sich anhand dieser theoretische Konzeption des Lernens recht augenscheinlich die individuelle Konstruktion von Wissen nachvollziehen. Darüber hinaus wird deutlich, dass Menschen als nicht-triviale Systeme zu begreifen sind, d.h. sie reagieren entsprechend ihrer internen (evtl. höchstindividuellen) Prozessierung von wahrgenommen Daten in komplexer, nicht linearer Weise auf externe Stimuli (ebd. S.75). Geißler (1998 S.171ff) macht, basierend auf dem Lernzirkel, deutlich, dass die Logik des Lernens mit der des Arbeiten verbunden ist, u.a.
„... weil Arbeiten, vermittelt über die ihm impliziten Qualitätsansprüche, den Anlaß und den Bezugs- für Lernen bietet.“ (ebd. S.178).
Außerdem entsprechen die einzelnen Aktivitäten des Lernzirkels verschiedenen Phasen des Arbeitsprozesses, so kommt er zu der Schlussfolgerung, dass es beim Arbeiten nicht möglich ist, nicht zu lernen. Unter dem Aspekt der Kostenorientierung betrachtet ist festzuhalten, dass ein solches Lernen zunächst ohne pädagogisches Lehren im herkömmlichen Sinn sowie den entsprechenden Lehrkosten auskommt, deshalb ist es für
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 48
Unternehmen ökonomisch von besonderem Interesse 78 . Bedeutender für diese Arbeit ist aber Geißlers auf dem Zusammenhang von Arbeiten und Lernen aufbauender Hinweis darauf, dass sich durch Lernprozesse beim Arbeiten natürlich auch Motivationen, Gefühle und Deutungsmuster gegenüber dem Arbeiten verändern. Insbesondere weist er in diesem Zusammenhang auf den Einfluss der organisationalen Rahmenbedingungen 79 hin, diese können u.a. so gestaltet sein, dass es, während der Lernzirkel beim Arbeiten durchlaufen wird, zu sogenanntem negativen Erfahrungslernen kommt. Mitarbeiter können lernen, dass es für sie unvorteilhaft ist, gewisse Kompetenzen und Motivationen im Arbeitsprozess zu entfalten. Soll die Kapazität der Mitarbeiter nun für das Unternehmen optimal genutzt werden, müssen organisationale Bedingungen verändert werden und die Mitarbeiter müssen anschließend umlernen, d.h. sie müssen erkennen, dass es nun sinnvoll ist, bestimmte Kompetenzen, Motivationen oder Deutungsmuster einzubringen (ebd. S.175ff). Dieser Aspekt wird später, im Zusammenhang mit der Darstellung der intrinsischen Motivation und dem Einfluss der Unternehmenskultur bzw. dem Führungsverhalten, auf diese wieder aufgenommen. Außerdem wird er in den nächsten beiden Abschnitten eine Rolle spielen, denn mit dem Thematisieren des organisationalen Kontextes ist bereits der Bereich des kollektiven bzw. organisationalen Lernens tangiert. Wird die Konsequenz aus dem zuletzt Gesagten gezogen, kommt man zu dem Schluss, dass individuelle Lernkonzepte zwar den Wissensentstehungsprozess analytisch erhellen, im organisationalen Kontext theoretisch aber zu kurz greifen, da sie die Rahmenbedingungen und die Soziabilität des Lernens zu wenig integrieren.
Der Begriff des kollektiven Lernens ist im Kontext des Wissensmanagements bzw. der Diskussion um die lernende Organisation wie viele andere Begriffe, die dort Verwendung finden, eher als Anker zu verstehen, d.h. an ihm werden von einzelnen Autoren unterschiedliche Konzepte festgemacht. Schüppel (1996 S.94) bspw. versteht unter kollektivem Lernen allgemein die Weiterentwicklung der kollektiven Wissensbasis und setzt es damit im Prinzip dem organisatorischem Lernen gleich. Diese Form des Ler-
2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen 49
nens wird im nächsten Abschnitt behandelt. Im Gegensatz dazu soll hier Bezug auf die Perspektive einiger anderer Autoren genommen werden, die sich explizit mit der dem kollektiven Lernen von und in Gruppen, als einer zwischen individuellem und organisationalen Lernen angesiedelten Ebene, auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Ulrich Lupprian (Autor:in), 2002, Intranetbasierte Datenbanksysteme im Kontext des Wissensmanagements - Motivationale und organisationale Funktionsvoraussetzungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185800
Kostenlos Autor werden













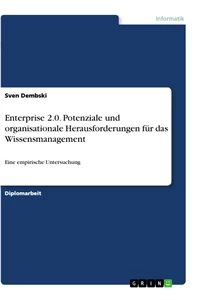


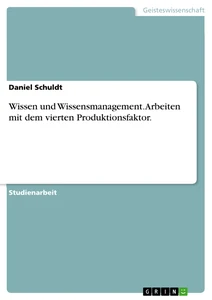





Kommentare