Extrait
GLIEDERUNG
1. Einführung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffe
2.1.1 Merkmale eines mittelständischen Unternehmens und dessen Abgrenzung zum Großunternehmen
2.1.2 Begriff des Business-to-Business-Commerce
2.1.3 Die Elemente eines Entscheidungsproblems und die Charakteristik eines Entscheidungsmodells
2.1.4 Kooperationen als alternative Koordinationsformen zwischen Markt und Hierarchie
2.1.4.1 Kooperationsformen
2.1.4.2 Unternehmensnetzwerke als spezielle Form kooperativer Arrangements
2.2 Vorgehensweise bei strategischen Entscheidungen
2.2.1 Unternehmensstrategien
2.2.2 Die strategische Planung
2.2.3 Die strategische Kontrolle
3. Entscheidung zur interorganisatorischen Vernetzung
3.1 Analyse der Ist-Situation zur Identifikation der eigenen Kernkompetenzen
3.1.1 Die Bildung strategischer Geschäftsfelder
3.1.2 Umweltanalyse
3.1.2.1 Analyse der globalen Unternehmensumwelt
3.1.2.2 Analyse der spezifischen Unternehmensumwelt mit Hilfe der Branchenstrukturanalyse nach Porter
3.1.3 Unternehmensanalyse
3.2 Das virtuelle Unternehmen
3.2.1 Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung
3.2.1.1 Vertrauen
3.2.1.2 Selbstorganisation
3.2.1.3 Koordination
3.2.1.4 Netzwerk-Management
3.2.1.5 Rechtliche Ausgestaltung
3.2.1.6 Gemeinsame Vision und Strategiebildung
3.2.1.7 Kernkompetenzstrategie
3.2.1.8 Die Persönlichkeit des Unternehmers als Kooperationspartner
3.2.1.9 Ausgestaltungsmöglichkeiten des Informationssystems
3.2.2 Wahl der Kooperationspartner
4. Schlußbemerkung
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strategiearten auf den Ebenen des Planungssystems
Abbildung 2: Phasenschema der strategischen Planung
Abbildung 3: Der strategische Kontrollprozeß
Abbildung 4: Die Bestimmung der strategischen Geschäftsfelder
Abbildung 5: Trichter zur Charakterisierung von Szenarien
Abbildung 6: Elemente der Branchenstruktur
Abbildung 7: Stärken-/Schwächenprofil einer strategischen Geschäftseinheit
Abbildung 8: Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio
Abbildung 9: Grundschema des Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolios
Abbildung 10: Überbetriebliche Dienstleistungsprofile
Abbildung 11: Historische Entwicklung von Strategieformen
Abbildung 12: Kernkompetenz-Agenda
Abbildung 13: Klassifikationsschema nach Unterstützungsfunktionen
Abbildung 14: Partner-Kriterienkatalog zur Operationalisierung
Abbildung 15: Grobauswahl der Kooperationspartner
1 Einführung
Lange Zeit fanden Klein- und Mittelbetriebe, im Gegensatz zu Großbetrieben, in der betriebswirtschaftlichen Forschung wenig Beachtung. Man konnte jedoch in den letzten Jahren feststellen, daß kleine- und mittelständische Unternehmen (KMUs) immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Ein Grund ist, daß der Anteil der KMUs, wenn man von allen Marktteilnehmern ausgeht, am größten ist1. Ferner sind KMUs für die Wirtschaft eines Landes ausschlaggebend, da sie einen großen Teil zum Bruttosozi- alprodukt beitragen und darüber hinaus über ein enormes Entwicklungspotential verfü- gen.2 Die Entwicklungspotentiale können von KMUs jedoch aufgrund von größenbe- dingten Schwächen, wie der Mangel an Kapital und an Expertenwissen3, nur dann effi- zient genutzt werden, wenn ihre Ressourcen mit anderen Partnern in zukunftsweisenden Kooperationsformen vernetzt werden. Derartige Kooperationsformen, die der Gestal- tung und dem Management zwischenbetrieblicher Beziehungen dienen, müssen die An- dersartigkeit mittelständischer Unternehmen berücksichtigen. Diese resultiert insbeson- dere aus der ausgeprägten Personenbezogenheit des Mittelstandes.4 Im Informations- zeitalter ist es zur Vervollständigung notwendig, den gezielten Einsatz moderner Info r- mations- und Kommunikationstechnologien zur Vernetzung der Partner, der medienge- rechten Inszenierung ihrer Zusammenarbeit und der Unterstützung der Kooperations- prozesse mit einzubeziehen.5
Ziel dieser Arbeit soll es sein, ein Rahmenkonzept für den Mittelstand zu entwickeln, mit dessen Hilfe der Entscheidungsprozeß zur Bildung von Unternehmenskooperationen erleichtert werden soll. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Kooperationsform sowie deren informations- und kommunikationstechnologischen Unterstützung vorgeschlagen.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffe
2.1.1 Merkmale eines mittelst ä ndischen Unternehmens und dessen Ab- grenzung zum Gro ß unternehmen
Eine Vielzahl von Autoren hat versucht, den Begriff des kleinen und mittelständischen Unternehmens zu definieren. Nicht nur ältere1, sondern auch neuere Arbeiten, national wie international, betonen die Nichtexistenz einer allgemein anerkannten Definition. Eine Unterscheidung von Großunternehmen und KMUs ist insofern erforderlich, da elementare Unterschiede zwischen ihnen bestehen. Hamer spricht sogar von der Notwendigkeit einer neuen Mittelstandsökonomie.2
Anhand von quantitativen und qualitativen Merkmalen wird nun eine Abgrenzung zum Großunternehmen vorgenommen, die man in der Literatur häufig antrifft. Die Abgrenzung der Unternehmen nach Größenaspekten läßt sich mit Hilfe von qua n- titativen Kriterien vornehmen. Dabei werden Merkmale wie Marktanteil, Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz sowie Bilanzsumme oder Gewinn herangezogen. Diese zeichnen sich durch leichte Meßbarkeit und Handhabbarkeit aus. Unternehmen auf Basis quant i- tativer Merkmale zu vergleichen ist problemlos möglich, da sie auf Kennzahlen basie- ren. Nach der Kommission der Europäischen Union handelt es sich um klein- und mit- telständische Unternehmen, wenn sie nicht mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und deren Jahresumsatz nicht mehr als 200 Mio. DM beträgt. Diese Richtlinien wurden zur Bestimmung der formalen Voraussetzung für eine Förderung aufgestellt3. Momentan wird von der Enquetekommission entschieden, ob die obige Definition durch die EU- Definition abgelöst werden soll. Bei dieser neuen Definition wird zwischen Kleinstun- ternehmen (1-9 Mitarbeiter), Kleinunternehmen (10-49 Mitarbeiter) und mittlere Unter- nehmen (50-249 Mitarbeiter) unterschieden.4
Den Vorteilen einer quantitativen Betriebsgrößenbestimmung stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Betrachtet man den Jahresumsatz eines Unternehmens, ist eine genaue Größenbestimmung nicht möglich, da dieser immensen konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt ist.1 Andererseits ist der Umsatz wie auch die Beschäftigten- zahl von Branche zu Branche verschieden. Der Umsatz eines mittelständischen Ind u- strieunternehmens kann im Vergleich zu einem Großhandelsunternehmen, das auf die gleiche Anzahl von Mitarbeitern zurückgreifen kann, wesentlich geringer ausfallen, wenn hauptsächlich Eigenfertigung betrieben wird.2 Bei einem Vergleich von KMUs untereinander bzw. von Unternehmen innerhalb einer Branche können deshalb beden- kenlos quantitative Faktoren verwendet werden, wohingegen im allgemeinen qualitative Faktoren zur Abgrenzung gegenüber Großunternehmen herangezogen werden sollten. Die Begründung liegt darin, daß sich die Unterschiede vor allem durch die Unterne h- mensführung ergeben und infolgedessen auch strukturelle Unterschiede bestehen. Dar- aus resultieren wiederum unterschiedliche Strategien bzw. Unternehmensziele und da- mit existiert wiederum eine andere Entscheidungsgrundlage3. Auf die qualitativen Merkmale wird an dieser Stelle näher eingegangen.
In der Literatur trifft man häufig die Gliederung der qualitativen Merkmale nach betrieblichen Funktionsbereichen an, wie z. B. Unternehmensführung, Organisation, Produktion, Absatz, Forschung und Entwicklung, Finanzierung und Personal. Pfohl hat einige Eigenschaften zusammengestellt, in denen sich mittelständische Unternehmen von Großunternehmen voneinander abheben.4 Im folgenden soll nur auf die wichtigsten Eigenschaften eingegangen werden.
- Unternehmensführung
Häufig handelt es sich bei mittelständischen Unternehmen um Eigentümer-Unter- nehmen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß das Führungspotential nicht austausch- bar ist und der Eigentümer am Betriebsgeschehen unmittelbar teilnimmt. Infolge der Zentralisation der Entscheidungsbefugnis und die daraus resultierende Überlastung der Führungsspitze wird oftmals die strategische Planung zugunsten kurzfristigen, intuitiven Denken und Handelns vernachlässigt. Darüber hinaus streben KMUs Unabhängigkeit an und sind mitunter durch übertriebenes Sicherheitsdenken gekennzeic h- net1, wobei es sein kann, daß Entwicklungsmöglichkeiten nicht genutzt werden, wie z. B. das Eingehen von Kooperationen mit anderen Unternehmen.
Die Entscheidungszentralisation auf die Unternehmensleitung hat jedoch auch die Vor- teile, daß bei Kooperationen Koordinationsprozesse beschleunigt wie auch erleichtert werden.
- Organisation
Die Hierarchie innerhalb der Organisation ist wesentlich flacher als bei Großunterne h- men. Dies resultiert aus der geringen Arbeitsteilung, wobei tendenziell die Aufgabeninhalte einer Stelle auf die individuellen Fähigkeiten des Stelleninhabers zugeschnitten werden.2 Aufgrund der sich dadurch ergebenden kurzen Informations- und Entsche i- dungswege, wie auch des Verzichts auf jegliche Formalisierung zugunsten direkter persönlicher Beziehungen, ist es mittelständischen Unternehmen möglich, auf Umweltve r- änderungen schnell und flexibel zu reagieren.3
- Ressourcen
Im Vergleich zu Großunternehmen verfügen KMUs über begrenzte Finanzierungsmög- lichkeiten, die sich unter anderem dadurch ergeben, daß sie keinen Rechnungslegungs- vorschriften unterliegen, die geforderten Risikoprämien der Banken zu hoch sind und ihnen somit der Zugang zum Kapitalmarkt verwehrt bleibt. Mittelstandsbetriebe kon- zentrieren sich aus diesem Grund in erster Linie auf einige wenige Investitionen, deren Rückflüsse sie bereits in Kürze erwarten können. Die finanzielle Knappheit ist ein zen- traler Grund dafür, daß KMUs Wachstumshindernisse entgegenstehen.4
Bezüglich des Leistungspotentials Personal haben Mittelstandsbetriebe einen größeren Bedarf an Facharbeitern, die über umfangreiche Kenntnisse aus den unterschiedlichsten Disziplinen verfügen. Dagegen legen Großunternehmen eher Wert auf Mitarbeiter, die einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen und so größere Aufgabenbereiche über- nehmen können.5 Die Schwierigkeit von KMUs qualifizierte Mitarbeiter zu finden ist offensichtlich, da Vergütungs- und Karrieremöglichkeiten im Vergleich zu Großunter- nehmen gering sind.
Bezogen auf das Innovationspotential mittelständischer Unternehmen läßt sich sagen, daß sie sich, infolge der aus o. g. Gründen nicht durchführbaren Grundlagenforschung, ausschließlich Basisinnovationen widmen, die nach Unternehmensgründung kontinuierlich weiterentwickelt werden.1
- Markt
Die geringe Arbeitsteilung führt tendenziell zu einer vergleichsweise hohen Arbeitszu- friedenheit, zu einer hohen Motivation der Mitarbeiter und letztlich zu einem positiven Betriebsklima. Das ausgesprochene „Wir-Gefühl“, das aus der starken Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Aufgabe resultiert, führt zu einer hohen Produktqualität, die als Erfolgsfaktor mittelständischer Unternehmen nicht zu unterschätzen ist.2 Viele mittel- ständische Unternehmen, versuchen gegenüber Großunternehmen zu bestehen, indem sie Produkte für ein relativ kleines Marktsegment anbieten, die für Großunternehmen unrentabel sind.3 Infolge begrenzter F & E-Tätigkeiten verfügen KMUs nur über eine wenig diversifizierte Produktpalette und sind so eventuell auftretenden Marktschwan- kungen extrem ausgesetzt.4 Diesen Marktschwankungen können sie jedoch durch die bereits oben erwähnte Flexibilität und im Vergleich zu Großunternehmen schnellen Reagibilität entgegenwirken.
Allgemein muß betont werden, daß es äußerst schwierig ist, den Begriff „mittelständ i- sches Unternehmen“ zu kennzeichnen, da die Merkmale vielfältig sind, sich gegenseitig durchdringen und zum Teil auch nicht offen erkennbar sind. Hinzu kommen Abgrenzungsprobleme aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen im Zeitablauf, regionale Unterschiede und der starken Branchenabhängigkeit.
2.1.2 Begriff des Business-to-Business-Commerce
Unter Electronic-Commerce wird im allgemeinen die automatische Durchführung von Handelstransaktionen über Kommunikationsnetze verstanden.5 Dabei stehen mehrere Klassifikationsmöglichkeiten zur Verfügung: nach der Art der an der Transaktionsbe- teiligten, nach dem Transaktionsvolumen (Mikro-, Makrotransaktionen) und nach den Transaktionsphasen (Informationsphase, Verhandlungsphase, Ausführungsphase). Unter Verwendung der Klassifikation „Art der Beteiligten“ (X-to-Y-Commerce) kann man wiederum in Business-to-Consumer (B2C)-Commerce, das den Online-Handel zwischen Händler und Endkunden zum Inhalt hat, Business-to-Business (B2B)-Commerce, der Transaktionen zwischen zwei oder mehreren Unternehmen impliziert sowie Business-to-Administration (B2A)-Commerce unterscheiden, bei dem das öffentliche Beschaffungswesen als Anwendungsfeld im Vordergrund steht.1
Beim Business-to-Business-Commerce werden in der Regel längerfristige Geschäftsbe- ziehungen eingegangen, wobei die Schaffung einer flexiblen Organisation von Regeln, Abläufen, Rollen und Kommunikationstechnologien zwischen Softwaresystemen im Vordergrund steht. Da sich die Unternehmen in einer äußerst dynamischen Umwelt be- finden, ist die Flexibilität Grundvoraussetzung zur Sicherung des langfristigen Erfolgs jeglicher auf elektronischem Datenaustausch basierenden Geschäftsbeziehungen.2
2.1.3 Die Elemente eines Entscheidungsproblems und die Charakteri- stik eines Entscheidungsmodells
Im Rahmen der Entscheidungstheorie liegt dann ein „Entscheidungsproblem“ vor, „[...] wenn unter bestimmten Umweltzuständen aus mehreren Handlungsalternativen diejenige Alternative zu wählen ist, die am besten zur Zielerfüllung beiträgt.“3 Nach dieser Definition setzt sich ein Entscheidungsproblem aus 3 Elementen zusammen: Umweltzustände, Alternativen und Zielen.
Die Menge aller möglichen Handlungsalternativen wird durch bestimmte reale Sach- verhalte (Umweltzustände , Daten, Nebenbedingungen, Restriktionen) begrenzt, die der Entscheider während des Planungshorizonts im Rahmen des Entscheidungsproblems nicht beeinflussen bzw. kontrollieren kann.4 Dabei kann es sich z. B. um die zur Verfü- gung stehenden finanziellen Mittel oder Anzahl der Mitarbeiter (interne Daten) handeln, wie auch um Veränderungen im Verhalten der Konkurrenten oder Konsumenten (exter- ne Daten), die auch durch Handlungen des Entscheidungsträgers (ex-post) ausgelöst werden können. Da dem Entscheider Umweltveränderungen nicht mit Sicherheit be- kannt sind, sollten Umweltzustände als variable und nicht als konstante Größen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.1
Rationale Entscheidungen können nur dann getroffen werden, wenn Zielvorstellungen existieren. Ziele sind demnach erwünschte Ergebnisse eines Entscheidungsprozesses, die ein Entscheidungsträger vorab definiert.
Als Begründungsfundament für Entscheidungsprozesse können Entscheidungsmodelle herangezogen werden.2 In der betriebswirtschaftlichen Literatur ist die abbildungsori- entierte Begriffsdefinition am häufigsten vertreten, wonach ein Entscheidungsmodell ein homomorphes Abbild eines realen Problems darstellt.3 Trotz der Vielfältigkeit der Problemsituationen, lassen sich alle Entscheidungsprobleme mit Hilfe eines gemeinsa- men Grundmodells erklären. Das Grundmodell setzt sich aus der Zielfunktion und dem Entscheidungsfeld zusammen. Das Entscheidungsfeld enthält Parameter, die durch die Handlungen des Entscheidungsträgers direkt oder indirekt beeinflußt werden. Folglich läßt sich das Entscheidungsfeld in Handlungsalternativen, Umweltzustände und Ergeb- nisfunktion einteilen, wobei sich letztere aus der Bewertung der Handlungskonseque n- zen ergibt. Das Entscheidungsproblem läßt sich im einfachsten Fall - mit nur einem Ziel - in einer Ergebnismatrix darstellen, die alle Elemente des Entscheidungsfeldes beinhaltet. Sind mehrere Ziele zu berücksichtigen, ist das Grundmodell entsprechend zu erweitern.4
2.1.4 Kooperationen als alternative Koordinationsformen zwischen Markt und Hierarchie
Die theoretische Einordnung von Kooperationen ist mit Hilfe der Neuen Institutio- nenökonomik, dem Transaktionskostenansatz, möglich. Williamson geht davon aus, daß Kosten entstehen, wenn ein Gut oder eine Leistung über den Markt bezogen wird. Unter Transaktionskosten versteht man demnach Kosten, die bei der Suche nach passenden Vertragspartnern entstehen, Kosten der Verhandlung und Vereinbarung (Ex-ante Trans- aktionskosten) und darüber hinaus Kontroll- und Anpassungskosten (Ex-post- Transaktionskosten).5 Neben dem Markt ist es auch möglich, Güter bzw. Dienstleistun- gen über die Hierarchie, sprich der Institution Unternehmung, zu beziehen. Es entsteht folglich ein Entscheidungsproblem zwischen zwei konkurrierenden Alternativen, nä m- lich dem Bezug von Gütern- und Dienstleistungen extern über den Markt (Fremdbezug) oder intern über die Hierarchie (Eigenfertigung).
Um eine Entscheidung zwischen Markt und Hierarchie treffen zu können, ist ein Ver- gleich der Produktionskosten bzw. Koordinationskosten mit den Transaktionskosten notwendig.1 Williamson nahm die Idee von Coase auf und ersetzte die zwei Idealtypen Markt und Hierarchie durch Realtypen, wobei er darüber hinaus auch Zwischenformen in seine Betrachtung einbezog. Zwischen den zwei Extremen Markt und Hierarchie lie- gen zahlreiche Abwicklungsformen für arbeitsteilige Prozesse, die mal mehr und mal weniger marktliche bzw. hierarchische Elemente enthalten. Derartige hybride Formen werden Kooperationen genannt.2
2.1.4.1 Kooperationsformen
Da es keine allgemeingültige Definition von „Kooperation“ existiert, wurde aus den zahlreichen Umschreibungsversuchen des Kooperationsphänomens eine mögliche Be- griffsbestimmung ausgewählt, die fortan Gegenstand dieser Arbeit sein soll. „Unter einer Kooperation versteht man die Zusammenarbeit zwischen mehreren Unter- nehmen, bei der die wirtschaftliche Selbständigkeit lediglich in den von der Kooperati- on betroffenen Bereiche für die Dauer der Kooperation eingeschränkt wird, die rechtli- che Selbständigkeit der Kooperationspartner jedoch vollständig erhalten bleibt.“3
Nimmt man eine Klassifizierung nach der Beziehung zwischen den Kooperationspart- nern vor, lassen sich horizontale, vertikale und konglomerate Kooperationen unter- scheiden. Bei horizontalen Kooperationen befinden sich die Partnerunternehmen auf derselben Wertschöpfungsstufe und stehen daher oftmals in einem Konkurrenzverhält- nis zueinander. Vertikale Kooperationen entstehen dagegen, wenn sich Unternehmen zusammenschließen, die sich entlang der Wertschöpfungskette befinden, quasi in einem Zuliefer-Abnehmer-Verhältnis stehen. Bewegen sich Unternehmen auf verschiedenen Geschäftsfeldern, handelt es sich um konglomerate Kooperationen.4
2.1.4.2 Unternehmensnetzwerke als spezielle Form kooperativer Ar- rangements
Unternehmensnetzwerke unterscheiden sich von herkömmlichen Kooperationen in erster Linie durch die größere Anzahl beteiligter Unternehmen (mindestens 3) und die erhöhte Komplexität der Austauschbeziehungen.
Als Definition strategischer Unternehmensnetzwerke schlägt Sydow vor: „Ein Unternehmensnetzwerk stellt eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform ökonomischer Aktivitäten dar, die sich durch komplex-reziproke, eher kooperative, denn kompetitive und relativ stabile Beziehung zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist abhängigen Unternehmungen auszeichnet. Ein derartiges Netzwerk, das entweder in einer oder in mehreren miteinander verflochtenen Branchen agiert, ist das Ergebnis einer Unternehmungsgrenzen übergreifenden Differenzierung und Integration ökonomischer Aktivitäten“.1
Unternehmensnetzwerke werden aufgrund ihrer Charakteristika nicht als zentral steue r- bar angesehen. Durch die relative Autonomie der Netzwerkpartner werden Unterne h- mensnetzwerke als heterarchische oder polyzentrische Systeme verstanden.2
Im folgenden werden unterschiedliche Typen von Unternehmensnetzwerken kurz er- läutert.
Snow et al. (1992) unterscheidet bei Unternehmensnetzwerken unter Berücksichtigung des Zeitaspektes zwischen stabilen (längerfristigen) und dynamischen (kurzfristigen, projektbezogenen) Netzwerken.3 Neben der zeitlichen Komponente lassen sich Netz- werke auch nach der Form der Netzwerksteuerung differenzieren. Dabei kann man da- von ausgehen, daß Netzwerke einerseits hierarchisch, wie am Beispiel der pyramiden- förmig organisierten Automobilzulieferindustrie zu sehen, oder heterarchisch, wie im Falle einer eher gleichberechtigten Kooperation von Unternehmen, orientiert sein können.
Strategische Netzwerke werden von einer oder mehreren fokalen Unternehmungen strategisch geführt.4 Das fokale Unternehmen beeinflußt dabei die strategische Aus- richtung mehr als andere Netzwerkmitglieder. Neben der Definition eines Marktes und der marktbearbeitenden Aktivitäten wird auch der Zugriff auf Ressourcen im Rahmen der Ausgestaltung von Interaktionsbeziehungen koordiniert. Das fokale Unternehmen fungiert demnach als Intermediär (Broker) zwischen Markt und Netzwerkpotentialen.1 In derartigen Netzwerkkooperation wird häufig eine attraktive strategische Alternative zur Akquisition gesehen, da sie einen schnellen Markt- und/oder Technologiezugang ermöglicht, dieser jedoch mit viel weniger Risiko verbunden ist und einen geringeren Kapitaleinsatz erfordert.2
Regionale Netzwerke lassen sich sowohl durch eine fallweise wiederholte Zusammenarbeit hochspezialisierter kleiner und mittlerer Unternehmen kennzeichnen, als auch durch eine räumliche Agglomeration.3
Obwohl die einzelnen Beziehungen zwischen den Netzwerkpartnern eher dynamisch sind, ist die Verweildauer im Netzwerk relativ dauerhaft. Jeder im Unternehmensverbund hat folglich die Möglichkeit, je nach Bedarf und Auftragslage die Beziehung zu einer größeren Zahl von Partnern zu aktivieren.4 Regionale Netzwerke resultieren aus einer polyzentrischen bzw. heterarchischen Organisation derartiger Netzwerke und sind nicht zuletzt Ergebnis einer fehlenden strategischen Netzwerkführerschaft. Typische Beispiele für regionale Netzwerke trifft man in Norditalien in der Emilia Romagna, im Sillicon Valley wie auch in Baden-Württemberg an.5
Projektnetzwerke sind gekennzeichnet durch ihre zeitliche Befristung, was zwangsläufig zu einer hohen Fluktuation der Netzwerkmitglieder führt. Derartige NetzwerkBeziehungen bleiben nach Projektabschluß gewissermaßen latent bestehen, so daß der Zugriff bei einem neuen Projekt ermöglicht wird. Ein weiteres Merkmal von Projektnetzwerken ist die Führung durch ein fokales Unternehmen, wobei auch heterarchisch geführte Projektnetzwerke möglich sind.6
Ein virtuelles Unternehmen stellt eine Unternehmensform dar, die sich durch die fort- schrittliche Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen kennzeichnet und sich dadurch sämtlicher Formen der Auslagerung und Integration bedient. Die Auslagerung kann sogar soweit getrieben werden, daß ausschließlich Aufgaben der Ko- ordination und der informationstechnischen Unterstützung beim fokalen Unternehmen verbleiben.1 Nach Arnold et al. (1995) werden virtuelle Strukturen vor allem zur Nut- zung von Synergien bei der flexiblen Gestaltung der Wertkette eingesetzt. Jede Wert- kettenstufe wird dabei von einem Unternehmen dargestellt, das sich auf seine Kern- kompetenzen konzentriert hat. Auf diese Weise kann auf die Gesamtkompetenz des Netzwerkverbundes zurückgegriffen werden, die von einem einzelnen Unternehmen in so kurzer Zeit - wenn überhaupt - nicht bereitgestellt werden könnte. Neben der Be- griffsverwendung liefert Arnold et al. zugleich einen Erklärungsansatz zur Entstehung virtueller Organisationen - man nennt dies Virtualisierung - anhand von unterschiedli- chen Entwicklungsphasen.2
Für kleine und mittlere Unternehmen stellen Netzwerke eine Möglichkeit dar, einerseits durch ein höheres Maß an Integration größenbedingte Defizite in der Ressourcenaus- stattung gegenüber großen Unternehmen auszugleichen und andererseits spezifische Vorteile ihrer Kleinheit auszunutzen. Dieser Gedanke wird besonders in zwei Typen von Unternehmensnetzwerken realisiert, dem regionalen Netzwerk und dem virtuellen Unternehmen. Im Rahmen dieser Arbeit besitzt jedoch ausschließlich das virtuelle Un- ternehmen Relevanz, da lediglich in derartigen Netzwerkformen die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken erfolgt.
2.2 Vorgehensweise bei strategischen Entscheidungen
Unternehmen befinden sich in einer immer komplexer und dynamischer werdenden Umwelt, die u. a. das Resultat der Globalisierung und des technischen Fortschritts (Ver- besserung in der Kommunikationstechnologie, etc.) ist. Da „die Welt immer kleiner“ geworden ist, stehen die Unternehmen in einem internationalen Wettbewerb auf allen Wertschöpfungsstufen. Die Wettbewerbsfähigkeit wird somit zur wichtigsten Grund- voraussetzung um den langfristigen Erfolg einer Unternehmung zu sichern. Um konkur- renzfähig zu bleiben oder zu werden, ist es erforderlich, auf Veränderungen der Umwelt schnell und flexibel zu reagieren. Aus diesem Grund ziehen Veränderungen der Umwelt auch grundsätzlich Veränderungen in der Unternehmung - wie z. B. die Wahl einer an- deren Strategie - nach sich.3
Zur Anpassung an Umweltveränderungen ist Planung notwendig. Dabei wird die Pla- nung als „[...] aktive, kreative und sehr entschlossene Suche nach den Bedingungen [...]“ verstanden, „[...] die den einzelnen Unternehmenssparten gewinnträchtige Nischen sichern können.“1 Es lassen sich zwei Arten von Planung unterscheiden: Die operative und die strategische Planung, wobei anzumerken ist, daß der Übergang zwischen opera- tiver und strategischer Planung fließend ist. Generell kann man jedoch sagen, daß die strategische Planung eher auf die Entwicklung von Potentialen zielt und durch eine Au- ßenorientierung, wie auch durch eine proaktive Verhaltensweise gekennzeichnet ist. Die strategische Planung steckt quasi den grundsätzlichen Orientierungsrahmen für zentrale Unternehmensentscheidungen ab. Bei der operativen Planung handelt es sich eher um reaktive Maßnahmen auf Umweltveränderungen, wobei neben der Binnenorientierung auch die Nutzung von Unternehmenspotentialen im Vordergrund steht. Mit Hilfe der operativen Planung wird das tägliche Handeln vor dem Hintergrund strategischer Ziele festgelegt.2 Hofer/Schendel drückte das Verhältnis zwischen operativer und strategi- scher Planung recht anschaulich aus: Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge tun („to do the right things“), während Effizienz heißt, die Dinge richtig tun („to do things right“).3
Steht ein Unternehmen nun vor der Wahl zur interorganisatorischen Vernetzung, so handelt es sich um eine Entscheidung, ob überhaupt bzw. welche Art von Kooperations- strategie angestrebt werden soll. Zur Verminderung des Risikos von Fehlentscheidun- gen, Reduktion von Komplexität durch Stabilisierung von Verha ltensweisen und -erwartungen, sowie zur Integration von Einzelentscheidungen in einen langfristigen Perspektivenplan4 ist strategische Planung notwendig. Unabhängig davon kann im Rahmen dieser Arbeit nur dann einer ganzheitlichen Betrachtungsweise entsprochen werden, wenn die Strategieentscheidung nicht isoliert, sondern als Teil des strategischen Planungsprozesses dargestellt wird.5
Neben der strategischen Planung darf ferner die strategische Kontrolle nicht unberück- sichtigt bleiben, denn die „Planung ohne Kontrolle ist sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich.“1
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen Strategie, strategischer Planung und strategischer Kontrolle und damit auch der Notwendigkeit der Berücksicht i- gung dieser Aspekte, werden diese Begriffe nachfolgend näher erörtert.
2.2.1 Unternehmensstrategien
Wie oben bereits angesprochen lassen Strategien „[...] erkennen, wie ein Unternehmen seine bestehenden und potentiellen Stärken dazu benutzt, Umweltbedingungen und de- ren Veränderungen gemäß den unternehmerischen Absichten zu begegnen“.2 Als Stra- tegie wird „[...] ein Gesamtkonzept zur Erreichung eines oder mehrere Ziele [...]“ ve r- standen, „[...] das auf längere Zeit ausgelegt ist und aggregierte Größen beinhaltet“.3 Dabei ist das Oberziel „[...] der Aufbau nachhaltiger Erfolgspotentiale durch Ausnut- zung von Wettbewerbsvorteilen“.4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Strategiearten auf den Ebenen des Planungssystems 5
Nach dem organisatorischen Geltungsbereich lassen sich Unternehmensgesamt-, Ge- schäftsbereichs- und Funktionsbereichsstrategien unterscheiden. In diesem Kontext sollen aufgrund der Relevanz nur die Unternehmensgesamtstrategien näher betrachtet werden.
Gegenstand von Unternehmensgesamtstrategien ist die Festlegung der Geschäftsfelder der Unternehmung sowie die Geschäftsfeld-Ressourcen-Verteilung im Hinblick auf die strategische Zielsetzung.1 Wie aus obiger Abbildung hervorgeht, lassen sich Wachs- tumsstrategien (Investieren), Stabilisierungsstrategien (Halten) und Schrumpfungsstra- tegien (Desinvestieren) den Unternehmensgesamtstrategien zuordnen.2 Nach Ansoff kann die Unternehmensstrategie anhand einer Produkt-Markt-Matrix mit Hilfe eines Wachstums-Vektors dargestellt werden. Die Strategie wird durch die betref- fenden Produkte und sogenannten „missions“ beschrieben, die einen existierenden Be- darf in gegenwärtigen und neuen Märkten kennzeichnet. Die Matrix von Ansoff bildet einen Grundbaustein für die weitere betriebswirtschaftliche Untersuchung des Wachs- tumsphänomens und die Formulierung einer Wachstumsstrategie. Die Förderung des Unternehmenswachstums kann demnach durch eine Marktdurchdringung (Vergröße- rung des Marktanteils), eine Marktentwicklung (Suche nach neuen Märkten für beste- hende Produkte), eine Produktentwicklung (Neuentwicklung von Produkten für einen bestehenden Markt) oder mit Hilfe einer Diversifikation (Suche nach neuen Märkten und neuen Produkten) erfolgen.3 Diese Produkt-Markt-Strategien lassen sich als Primär- strategien verstehen, die durch unterschiedliche Sekundärstrategien umgesetzt werden können. Nach dem regionalen Geltungsbereich bzw. dem relevanten Markt können lo- kale, nationale, internationale und globale Strategien voneinander abgegrenzt werden.4 In Kombination von Sekundär- und Primärstrategie kann sich beispielsweise eine Marktentwicklungsstrategie ausschließlich auf den internationalen Markt beziehen. Neben der regionalen Abgrenzung ist eine weitere Differenzierung möglich. Nach dem Grad der Eigenständigkeit lassen sich Do-it-yourself-, Kooperations- und Akquisitions- strategien voneinander unterscheiden. Die Do-it-yourself und Akquisitions-Strategie sind zwei Extremformen, wobei unter „Akquisitionen“ generell alle Unternehmenskäufe fallen, bei denen das gekaufte Unternehmen seine Rechtspersönlichkeit behält, aber als Tochterunternehmen des Käufers geführt wird. Akquisitionen sind von „Fusionen“ ab- zugrenzen, bei denen die Rechtspersönlichkeit des gekauften Unternehmens verloren geht und eine Absorption durch das kaufende Unternehmen erfolgt.1 Bei der Do-it- yourself-Strategie bleibt - wie der Name schon sagt - die Eigenständigkeit des Unter- nehmens vollständig erhalten, da die eigenen Potentiale aktiviert werden. Reichen die eigenen Ressourcen nicht aus, muß auf externe Potentiale zurückgegriffen werden. Dies kann im Rahmen einer Kooperation oder einer Akquisition erfolgen.2 Da die Kooperati- onsstrategie im Abschnitt 2.1.4 ausführlich beschrieben wurde, kann auf deren Charak- terisierung verzichtet werden.
2.2.2 Die strategische Planung und strategische Kontrolle
Die strategische Unternehmensplanung wird von Kreikebaum als ein Prozeß verstanden, der unter anderem zur Formulierung von Strategien auf unterschiedlichen Ebenen führt.3 Im Mittelpunkt der strategischen Planung steht die Schaffung und Erhaltung von Handlungsspielräumen und Erfolgspotentialen, d. h. die Sicherung der Effektivität und letztlich auch des Überlebens eines Unternehmens.4
Abbildung 2 zeigt die einzelnen Phasen des strategischen Planungsprozesses. Entsche i- dend ist, daß die einzelnen Phasen sachlogisch und zeitlich miteinander verknüpft sind. Die sequentielle Darstellung des Prozesses darf nicht zu der Annahme führen, daß es sich dabei um eine strikte Abfolge der Phasen handelt.5 Der Planungsprozeß verläuft vielmehr zyklisch und iterativ.6 Die aufgrund der Mehrfachdurchläufe erzeugten Wie- derholungen und zusätzlich erworbenen Informationen erweitern das Wissen der ge- samten Organisation wie auch das einzelner Mitglieder, so daß der Planungsprozeß auch einem Lernprozeß gleichkommt.7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Phasenschema der strategischen Planung 1
Bei der Festlegung strategischer Zielgrößen sind zunächst die obersten Ziele des Unternehmens, quasi die Basisziele festzulegen, die mit Hilfe der noch aufzustellenden Strategien erreicht werden sollen. Für die strategische Planung spielen - aufgrund ihres langfristigen Planungshorizonts - die Ziele „Aufbau neuer Erfolgs- und Gewinnpotentiale“ sowie „langfristiges Überleben“ eine besondere Rolle. Darüber hinaus ist es auch wichtig, daß sich die Planungsträger über die zeitliche Struktur der Basisziele einig sind und diese in Form von Zeitpräferenz2 in die Zielgrößen verankern.3
Die strategische Analyse und Prognose setzt sich aus mehreren Komponenten zu- sammen. Bei der Bildung strategischer Geschäftseinheiten wird das Unternehmen in Bereiche aufgeteilt, die eine eigenständige Marktaufgabe haben, d. h. durch spezifische Produkt-Markt-Kombinationen gekennzeichnet sind, und die über eigene unterne h- mensexterne Wettbewerber verfügen. Die Geschäftseinheiten sind so zu bilden, daß die Anzahl aufgrund der Führungproblematik möglichst gering gehalten wird und es zwi- schen den Geschäftseinheiten möglichst wenig Überschneidungen gibt, um eindeutige Strategien entwickeln zu können.4
Ansoff/Leontiades weisen darauf hin, daß jedes Unternehmen mit seinen unterschiedli- chen strategischen Geschäftseinheiten verschiedenen „Umwelten“ gegenübersteht.1 Die Analyse und Prognose der Umwelt (z. B. Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, staatliche Institutionen, etc.2 ) hat nun die Aufgabe, die Chancen und Risiken, die sich aus den jeweiligen Umweltbedingungen ergeben, zu erkennen. Zur Identifikation der Chancen und Risiken gibt es keine allgemeingültigen Handlungsempfehlungen, da die relevanten Umweltveränderungen von einer Vielzahl von Einflußgrößen, wie beispielsweise Bran- che oder Unternehmensgröße, abhängig sind. Andrews hat eine Liste von Fragen zu- sammengestellt, die bei der Umweltanalyse hilfreich sein können.3 Darüber hinaus wer- den im Laufe dieser Arbeit Verfahren dargestellt, die der Erkennung von Chancen und Risiken dienen.
Ziel der Unternehmensanalyse und -prognose ist neben der Bestimmung von strategi- schen Erfolgsfaktoren und damit die Ermittlung eines Stärken- und Schwächenprofils des Unternehmens, auch die Feststellung der Kernkompetenzen.4 Eine Kernkompetenz ist definiert als „[...] ein Bündel von Fähigkeiten, welche die Grundlage für die Kern- produkte und die darauf aufbauenden Endprodukte eines Unternehmens darstellen und welche sich durch schwierige Erzeugbarkeit, Imitierbarkeit und Substituierbarkeit aus- zeichnen.“5 Aufbauend auf den Kernkompetenzen ist es einem Unternehmen möglich, einen Wettbewerbsvorsprung gege nüber den Konkurrenten zu erlangen.6
Wie bereits erwähnt, besteht die Aufgabe der strategischen Planung darin, die Unternehmung bzw. dessen Potentiale oder Kompetenzprofil entsprechend den Umweltveränderungen anzupassen. Ansoff spricht in diesem Zusammenhang von der Herstellung eines System-Umwelt-Fits7 und wurde mit seinem Buch „Corporate Strategy“ 1965 zum Wegbereiter des Fit-Gedankens.
Zur Anpassung der Unternehmung an Umweltveränderungen werden die Ergebnisse der Umwelt- und Unternehmensanalyse gegenübergestellt, wodurch eine Lücke sichtbar wird. Durch eine Lückenanalyse im Rahmen der Strategieentwicklung können darauf- hin die Unternehmensstrategien, die zur Schließung der strategischen Lücke geeignet sind vor dem Hintergrund der strategischen Ziele des Unternehmens mit Hilfe der Ursachenforschung formuliert werden.1 Bei der Ausarbeitung von Strategien sind zur Scha f- fung und zum Halten von Erfolgspotentialen folgende Grundsätze zu beachten: Der Aufbau von Stärken, der Abbau von Schwächen, die Konzentration der Kräfte sowie der Aufbau und die Ausnutzung von Synergieeffekten.2
Die unterschiedlich formulierten Strategien sind in zeitlicher wie inhaltlicher Hinsicht aufeinander abzustimmen. Beispielsweise legen Unternehmensgesamtstrategien den Rahmen für die Geschäftsbereichs- und Funktionsbereichsstrategien fest.3 In einem nächsten Schritt werden die Strategiealternativen bewertet und ausgewählt. Dabei sind quantitative wie qualitative Bewertungskriterien voneinander zu untersche i- den. Quantitative Kriterien beinhalten allgemein ökonomische Ziel-Kriterien, wie Pro- fitabilität und Ertragssicherung, wohingegen die qualitativen Kriterien nur schwer meß- bare Größen enthalten wie Profilabdeckung, Machbarkeit/Akzeptanz und ethische Ver- tretbarkeit. Anhand des Kriteriums der Profilabdeckung kann überprüft werden, ob das Ressourcenanforderungsprofil der Alternativen den tatsächlichen Unternehmensres- sourcen entspricht bzw. wie groß die Differenz ist.4
Um unrealistische Alternativen vorzeitig ausschließen zu können, ist vorab die Mach- barkeit hinsichtlich der gegebenen technischen und personellen sowie gesetzlichen Vo r- aussetzungen zu überprüfen. Obendrein müssen neben der Akzeptanz der betroffenen Interessengruppen auch interne Machtgruppen berücksichtigt werden, deren Widerstand beispielsweise wegen einer notwendigen Neu- oder Umverteilung materieller und im- materieller Ressourcen zum scheitern von Strategien führen kann.5 Durch die Unter- nehmenskultur können Unternehmen in ihrem Handeln gewisse norm- und wertbezoge- ne Eigenständigkeit entwickeln, wodurch sie sich gegebenenfalls voneinander oder von der Gesellschaft abheben. Unternehmenskultur wird vor allem dann wahrgenommen, wenn sie stark ausgeprägt ist. Von einer starken Unternehmenskultur spricht man dann, wenn die Geisteshaltung und Denkweise allen Organisationsmitgliedern gemein ist. Die Unternehmenskultur beeinflußt Entscheidungen und Handlungen auf allen Hierarchie- ebenen und in jeder Abteilung. Sie kann sogar für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sein.1
Das dritte Kriterium ist die ethische Vertretbarkeit. Manche Strategiealternativen, die nach Rentabilitätsgesichtspunkten attraktiv und machbar erscheinen, werden verworfen, da sie den gültigen moralischen Grundsätzen des Unternehmens nicht entsprechen. Aus Sicht der Entscheidungsethik ist zu fordern, daß in allen Planungsphasen die unterne h- mensethische Reflexion einen Platz findet.2 Beispielsweise sind Wertvorstellungen der Führungskräfte genau zu erfassen oder auch Absichten zu formulieren, die auf inter- subjektive Akzeptanz im Unternehmen und in der Gesellschaft stoßen.3
Die Umsetzung der Strategien in konkrete Handlungen erfolgt in der Phase der Strategieimplementierung. In diesem Schritt wird einerseits eine Ausrichtung der Erfolgsfaktoren des Unternehmens (Organisation, Unternehmenskultur, Management, Personal) auf die Strategie vorgenommen, andererseits werden die Mitarbeiter über die Strategien in Kenntnis gesetzt. Zur zeitlichen Anpassung muß eine Konkretisierung der Strategien in taktischen wie auch operativen Plänen vorgenommen werden.4
Obwohl Planung ohne Kontrolle sinnlos ist, werden Problemstellungen der strategi- schen Kontrolle im Vergleich zur strategischen Planung deutlich zurückhaltender dis- kutiert.
2.2.3 Die strategische Kontrolle
Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Kontrollbegriffen, die auch zu verschiedenen Abgrenzungen der Kontrollaufgabe führen5, wird in dieser Arbeit von folgendem Kontrollbegriff ausgegangen: Kontrolle beinhaltet als systematischer, zielgerichteter, informationsverarbeitender Prozeß die Durchführung eines Vergleichs zwischen (mindestens) zwei Kontrollgrößen, von denen eine normativen Charakter hat und damit als Beurteilungsmaßstab für die empirische Größe dient, die Ermittlung und Analyse von relevanten Abweichungen zwischen diesen Größen sowie die Weitergabe der Kontrollergebnisse und die Empfehlung von Korrekturentscheidungen.6
Der strategische Kontrollprozeß setzt sich nach der Konzeption von Steinmann/Schreyögg aus der Durchführungskontrolle, Prämissenkontrolle und strategischer Überwachung zusammen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Der strategische Kontrollproze ß 1
In dieser Konzeption wird die strategische Kontrolle als planungsbegleitender Prozeß verstanden, der das Ziel hat, das durch die Planung verursachte Selektionsrisiko zu kompensieren. Um die Entscheidungssituation zu strukturieren, werden parallel zur Strategieformulierung kontinuierlich Prämissen gesetzt. Die Prämissenkontrolle hat nun die Aufgabe, die gesetzten strategischen Planannahmen über die Entwicklung der Um- welt und der internen Ressourcensituation fortlaufend zu überprüfen und diese kritisch bezüglich ihrer Gültigkeit zu hinterfragen. Mit dem Beginn der Strategieumsetzung setzt die Durchführungskontrolle ein. Dabei werden mögliche Störungen, die bei der Strategieimplementierung auftreten könnten oder Abweichungen von den gesetzten Zwischenzielen („Meilensteine“) festgestellt und somit überprüft, ob die strategische Gesamtrichtung noch beibehalten wird.2
Die strategische Überwachung wirkt, wie die Prämissenkontrolle, ab der Strategiefo r- mulierung wie eine Art Auffangnetzes für die beiden anderen Kontrollarten. „Die Auf- gabe der strategischen Überwachung liegt in einer kontinuierlichen, ungerichteten Be- obachtung der externen und internen Umwelt auf bisher vernachlässigte oder unvorhe r
gesehene Ereignisse, die eine Bedrohung für die gewählte strategische Orientierung der Unternehmung bedeuten könnten. Sie fungiert quasi als „strategisches Radar“, das die Umwelt gewissermaßen flächendeckend auf die strategiegefährdende Information hin überwacht.1
Das nachfolgend beschriebene Entscheidungsmodell zeigt eine mögliche Vorgehensweise für mittelständische Unternehmen auf, die eine Kooperationsstrategie in Erwägung ziehen. Auf Möglichkeiten der Zielbildung wird aus diesem Grund nicht näher eingegangen, da generelle Ziele die ein Unternehmen mit einer Kooperationsstrategie verfolgen2, angenommen werden.
3 Entscheidung zur interorganisatorischen Vernetzung
3.1 Analyse der Ist-Situation zur Identifikation der eigenen Kernkom- petenzen
Im Rahmen der strategischen Analyse der Unternehmens-(Ist-) Situation geht es um eine möglichst umfassende Beurteilung der Unternehmung und der Erfassung ihrer ge- genwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten am Markt. Die Qualität der Analyse be- stimmt in starkem Maße die Realitätsnähe der Planung und damit auch der Handlung der Entscheidungsträger in der Unternehmung.3 Vor allem mittelständische Unterne h- men sollten die Wichtigkeit einer umfassenden Analyse erkennen, die der Beseitigung von Informationsdefiziten in Unternehmen dieser Größenklasse dienen. Dabei ist anzu- merken, daß die Informationsdefizite nicht aus einem Informationsmangel, sondern aus der unzureichenden Verarbeitung der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden In- formationen resultieren.4 Die Ursache für die mittelständischen Probleme im Rahmen der Informationsverarbeitung sind nicht nur in der Geringschätzung formaler Informati- onssysteme, sondern auch in der im Vergleich zu Großunternehmen geringeren Qualifi- kation der Mitarbeiter zu sehen. Mit sinkendem Ausbildungsstand des Personals steigen quasi die Informationslücken, da die Relevanz weiterer Informationen nicht erkannt und folglich auf ihre Beschaffung verzichtet wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn die In- formationen bereits im Betrieb vorhanden sind und eine notwendige Berücksichtigung unterbleibt, weil Entscheidungsrelevanz nicht festgestellt wurde.5
Man muß jedoch betonen, daß es im Rahmen der strategischen Planung nicht darauf ankommt vollständige Informationen zu erhalten, sondern vielmehr um die kreative Vorstellungskraft bei der Strategieentwicklung. Bussiek hebt nicht ohne Grund hervor, „[...] daß nicht die absoluten Zahlen, sondern die Richtung das ausschlaggebende der strategischen Planung sei. Es erscheint sogar die These nicht unberechtigt, daß eine zu sehr mit statistischen und hochgerechneten Daten untermauerte Strategie gefährlich werden kann, wenn ein Unternehmen sich in dem Engagement zu sehr darauf verläßt. [...] Insofern sind die Klein- und Mittelbetriebe durch ihren geringen Informationsstand im Hinblick auf die strategische Überlegungen nicht nennenswert benachteiligt.“1
3.1.1 Die Bildung strategischer Gesch ä ftsfelder
Da die Erfahrung lehrt, daß es nur sehr wenige Unternehmungen gibt, die nur über ein einziges strategisches Aktivitätsfeld verfügen,2 ist eine differenzierte Betrachtung stra- tegischer Geschäftsfelder erforderlich. Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 angesprochen, können Produkte auf verschiedenen Märkten angeboten werden und auf unterschiedli- che Marktaufnahme stoßen. Die daraus resultierende Produkt-Markt-Kombination bil- det die Grundlage zur Definition eines strategischen Geschäftsfeldes.3 Bei deren Bil- dung ist jedoch zu beachten, daß die Einteilung nicht nur produktgruppenbezogen durchgeführt werden darf, sondern wenn spezifische Strategien entwickelt werden sol- len, gleichzeitig auch Merkmale des jeweiligen Marktes berücksichtigt werden müssen. Diese Forderung wird auch von Höfner/Winterling am Beispiel eines Herstellers für Motorradhelme und -brillen betont. Grundsätzlich handelt es sich dabei um zwei unter- schiedliche Produkte. Untersucht man diese jedoch genauer, stellt sich heraus, daß beide Produkte gleiche Kundengruppen ansprechen, über die gleichen Vertriebskanäle ver- marktet und auch von demselben Wettbewerber angeboten werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, beide Produktgruppen dem gleichen strategischen Geschäftsfeld zuzu- ordnen.4
Eine eindeutige Bestimmung der strategischen Geschäftsfelder schon zu Beginn des strategischen Planungsprozesses ist aufgrund der spezifischen Verhältnisse in mittel- ständischen Unternehmen, aber auch aufgrund der Interdependenzen5 zwischen.
[...]
1 Vgl. Pietsch (1995), S. 4.
2 Vgl. Moraw (1990).
3 Vgl. Pfohl (1997).
4 Vgl. Hamer (1987).
5 Vgl. Arnold/Härtling (1995), 3.
1 Vgl. Gantzel (1962).
2 Vgl. Hamer (1987), S. 9.
3 Vgl. Meister-Scheufelen (2000), S. 1.
4 Ebda.
1 Vgl. Eggs u.a. (1999), S. 308.
2 Vgl. Haake (1987), S. 14.
3 Vgl. Hamer (1997), S. 30f.
4 Vgl. Pfohl (1997), S. 19ff.
1 Vgl. Kaufmann (1993), S. 15, Smith/Fleck (1987), S. 61.
2 Vgl. Abels (1980), S. 35.
3 Vgl. Abels (1980), S. 38 ff.
4 Vgl. Mortsiefer et al. (1980), S. 40 ff.
5 Vgl. Abels (1980), S. 44.
1 Vgl. Kaufmann (1993), S. 14.
2 Vgl. Bickel (1981), S. 181.
3 Vgl. Abels (1980), S. 22.
4 Vgl. van Hoorn (1979), S. 85.
5 Vgl. Merz (1999) S. 313 ff.
1 Vgl. Merz (1999) S. 313 ff.
2 Ebda.
3 Bea et al. (1997), S. 379.
4 Vgl. Laux (1995), S. 6.
1 Vgl. Bea et al. (1997), S. 380.
2 Vgl. Bretzke (1980), 126 f.
3 Vgl. Rieper (1992), S. 19.
4 Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 14ff.
5 Vgl. Williamson (1990), S. 22 ff.
1 Vgl. Williamson (1990), S. 25.
2 Vgl. Picot (1982), S. 273.
3 Bea/Haas (1997), S. 427.
4 Vgl. Sell (1994), S. 18 f.
1 Sydow (1992), S. 79.
2 Vgl. Sydow (1992), S. 80.
3 Vgl. Snow et al. (1992).
4 Vgl. Jarillo (1988), S. 32.
1 Vgl. Snow et al. (1992), S. 14 ff.
2 Vgl. Bleicher (1986), S. 215.
3 Vgl. Sydow (1992), S. 47 ff.
4 Vgl. Sydow (1995), S. 163.
5 Vgl. Piore/Sabel (1985).
6 Vgl. Windeler et al. (2000), S. 178ff.
1 Vgl. Sieber (1997), S. 201.
2 Vgl. Arnold et al. (1995).
3 Vgl. Hahn (1997), S. 28.
1 Hax/Majluf (1991), S. 17.
2 Vgl. Bea/Haas (1997), S. 47.
3 Vgl. Hofer/Schendel (1978), S. 2f.
4 Vgl. Wild (1974), S. 15ff.
5 Vgl. Schreyögg (1984), S. 85, Wieselhuber (1986), S. 58, Kreikebaum (1993), S. 26, Hammer (1988), S. 124.
1 Wild (1974), S. 44.
2 Kreikebaum (1997), S. 57.
3 Kreikebaum (1997), S. 19.
4 Ebda.
5 Bea/Haas (1997), S. 157.
1 Vgl. Steinmann/Schreyögg (1993), S. 151.
2 Vgl. auch Kreikebaum (1993), S. 52.
3 Vgl. Ansoff (1966), S. 132.
4 Vgl. Bea/Haas (1997), S. 158.
1 Vgl. Baetge/Krumbholz (1991), S. 3.
2 Vgl. Bea/Haas (1997), S. 162 f.
3 Vgl. Kreikebaum (1997), S. 21.
4 Vgl. Gälweiler (1990), S. 6.
5 Vgl. Hammer (1988), S. 119.
6 Vgl. Wild (1974), S. 40f.
7 Vgl. Riedl (1995), S. 99.
1 Götze/Rudolph (1994), S. 5.
2 Die Zeitpräferenz ist die Präferenz hinsichtlich des Eintrittszeitpunktes der Zielerträge.
3 Vgl. Voigt (1993), S. 66ff.
4 Vgl. Hinterhuber II (1992), S. 142.
1 Vgl. Ansoff/Leontiades (1976), S. 3ff.
2 Vgl. Kubicek/Thom (1976), Sp. 3992.
3 Vgl. Andrews (1980), S. 71f.
4 Vgl. Hinterhuber I (1996), S. 121.
5 Bea/Haas (1997), S. 518.
6 Vgl. Hinterhuber I (1996), S. 122.
7 Vgl. Ansoff (1965).
1 Vgl. Kreikebaum (1993), S. 40ff.
2 Vgl. Welge/Al-Laham (1992), S. 171ff.
3 Vgl. Pekayvaz (1985), S. 65f.
4 Vgl. Hatten/Hatten (1988), S. 168.
5 Vgl. Hill/Jones (1989), S. 311ff.
1 Vgl. Heinen/Frank (1997), S. 2f.
2 Vgl. Behnam (1998), S. 163 ff.
3 Vgl. Behnam (1998), S. 179.
4 Vgl. Welge/Al-Laham (1992), S. 360ff.
5 zusammenfassende Literaturübersicht bei Siegwart/Menzl (1978), S. 114ff.
6 Vgl. Pfohl (1981), S. 59.
1 Vgl. Steinmann/Schreyögg (1993), S. 222.
2 Vgl. Steinmann/Schreyögg (1993), S. 220ff.
1 Hasselberg (1989), S. 97.
2 Zu den Basiszielen siehe Abschnitt 2.2.2, S. 16.
3 Vgl. Kienbaum (1989), Sp.2043.
4 Vgl. Bamberger (1980), S. 34.
5 Vgl. Kellerwessel (1984), S. 84.
1 Bussiek (1983), S. 77.
2 Vgl. Dornis (1986), S. 54f.
3 Vgl. Dunst (1983), S. 57.
4 Vgl. Höfner/Winterling (1982), S. 251.
5 Vgl. Haspeslagh (1982), S. 65f.
- Citation du texte
- Jutta Zimmermann (Auteur), 2000, Entscheidungsmodell für mittelständische Unternehmen zur interorganisatorischen Vernetzung im Rahmen des Business-to-Business-Commerce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185545
Devenir un auteur





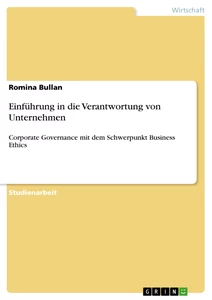
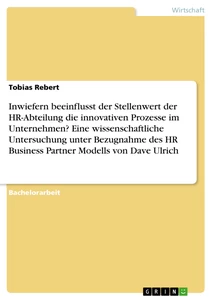















Commentaires