Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Problemstellung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Das natürliche Monopol
2.1.1 Stromerzeugung als natürliches Monopol?
2.1.2 Stromtransport als natürliches Monopol?
2.2 Modelle zur Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft
2.2.1 Netzzugang auf Vertragsbasis (Negotiated Third
Party Access)
2.2.2 Netzzugang auf Vertragsbasis und Einzelkäufer
(Alleinkäufersystem)
2.2.3 Das Pool-Modell
2.2.4 Kriterien zur Beurteilung der Modelle
2.2.5 Beurteilung der Modelle
3 Rahmenbedingungen der deutschen Elektrizitätswirtschaft
3.1 Aufbau und Struktur der Elektrizitätswirtschaft
3.1.1 Aufbau der Elektrizitätswirtschaft
3.1.2 Struktur der Elektrizitätswirtschaft
3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3.2.1 Ordnungsrahmen vor der Liberalisierung
3.2.1.1 Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
3.2.1.2 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
3.2.1.3 Konzessionsabgaben
3.2.2 Ordnungsrahmen nach der Liberalisierung
3.2.2.1 Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
3.2.2.2 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
3.2.2.3 Konzessionsabgaben
3.2.2.4 Verbändevereinbarung
4 Strombörsen
4.1 Voraussetzungen und Funktionen einer Strombörse
4.1.1 Voraussetzungen
4.1.2 Funktionen
4.2 Ausländische Strombörsen
4.2.1 Nord Pool ASA
4.2.1.1 Entstehungsgeschichte
4.2.1.2 Aufbau und Organisation
4.2.1.3 Märkte
4.2.1.3.1 Spotmarkt (Elspot)
4.2.1.3.2 Finanzmarkt
4.2.1.3.2.1 Future- und Forwardmarkt (Eltermin)
4.2.1.3.2.2 Optionsmarkt (Eloption)
4.2.1.3.3 Elbas
4.2.1.4 Geschäftsentwicklung
4.2.2 Amsterdam Power Exchange (APX)
4.2.2.1 Entstehungsgeschichte
4.2.2.2 Aufbau und Organisation
4.2.2.3 Märkte
4.2.2.3.1 Spotmarkt
4.2.2.3.2 Märkte in der Entwicklung
4.2.3 California Power Exchange (CalPX)
4.2.3.1 Entstehungsgeschichte
4.2.3.2 Elektrizitätsmarktstruktur in Kalifornien
4.2.3.3 Märkte
4.2.3.3.1 Spotmarkt
4.2.3.3.2 Terminmarkt
4.2.3.4 Geschäftsentwicklung
4.2.4 Ansatzpunkte für eine deutsche Strombörse
4.3 Konzepte der beiden deutschen Strombörsen
4.3.1 Frankfurt/ M.: European Energy Exchange (EEX)
4.3.1.1 Eigentümerstruktur
4.3.1.2 Zulassungsvoraussetzungen
4.3.1.3 Der EEX-Spotmarkt
4.3.1.4 Der EEX-Termimarkt
4.3.2 Leipzig: Leipzig Power Exchange (LPX)
4.3.2.1 Eigentümerstruktur
4.3.2.2 Zulassungsvoraussetzungen
4.3.2.3 Der LPX-Spotmarkt
5 Befragung von Versorgungsunternehmen
5.1 Struktur und Ziele des Fragebogens
5.2 Befragte Unternehmen und Begründung für deren Auswahl
5.3 Ergebnisse der Befragung
5.3.1 Fragenkomplex: Ausländische Strombörsen
5.3.2 Fragenkomplex: Deutsche Konzepte
5.3.3 Fragenkomplex: Vorbereitungen
5.3.4 Fragenkomplex: Erwartungen und Akzeptanz
5.3.5 Gesamtergebnis der Befragung
6 Fazit der Gesamtarbeit
Anhang 1: Ausgewählte Definitionen aus dem Energiebörsengeschäft
Anhang 2: Fragebogen
Literaturverzeichnis
Abb. 1: Subadditivität bei steigenden und konstanten
Durchschnittskosten
Abb. 2: Ertragsgesetzliche Produktionsfunktion
Abb. 3: Zahlungsströme beim NTPA-Modell
Abb. 4: Zahlungsströme beim Alleinkäufersystem
Abb. 5: Das Pool-Modell
Abb. 6: Struktur der Elektrizitätswirtschaft der allgemeinen Versorgung
Abb. 7: Die klassische Versorgungsstruktur Deutschlands
Abb. 8: Ziele der Energiepolitik
Abb. 9: Organisation von Nord Pool ASA
Abb. 10: Gebotszonen in Norwegen, Schweden und Finnland
Abb. 11: Organisation von APX
Abb. 12: Marktstruktur Kaliforniens
Abb. 13: Niedrig- und Hochpreisgebiete bei Netzüberlastung
Tabellenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung
Mit in Kraft treten des neuen Energiewirtschaftsgesetz am 28. April 1998 entstand für die Elektrizitätswirtschaft eine neue Situation. Die geschlossenen Versorgungsgebiete, die den Energieversorgern die Abschöpfung von Monopolrenten ermöglichten, fielen weg und aus dem ehemals monopolistisch organisierten Elektrizitätsmarkt wurde ein Konkurrenzmarkt. Die Folge davon ist, dass die langfristigen Lieferverträge, Verträgen mit kürzeren Laufzeiten weichen müssen. Es werden heute keine Lieferverträge mehr mit Laufzeiten über 20 Jahre abgeschlossen, wie es vor der Liberalisierung üblich war. Die Kontrakte, die heute unterschrieben werden, haben maximal die Laufzeit von einem Jahr, mit fallender Tendenz. Dieser Markt zeichnet sich im Moment noch dadurch aus, dass es ein Käufermarkt ist, da die Konkurrenzsituation zunimmt, der Markt nur schwach wächst und die Erzeugung unter Überkapazitäten leidet. Eine Hauptrolle in der deregulierten Stromwirtschaft nimmt dabei, wie auch in anderen europäischen Ländern, deren Deregulierung bereits weiter vorangeschritten ist, der Stromhandel ein. Die immer kürzer werdenden Vertragslaufzeiten und die Möglichkeit den Stromlieferanten zu wechseln, was vor der Verabschiedung dieses Gesetzes nicht möglich war, sind dafür verantwortlich. Als Verbraucher sah man sich einem Gebietsversorger gegenüber, der für die Stromlieferungen zuständig war, ohne dass die Möglichkeit für die Endverbraucher bestand, Strom von einer anderer Stelle zu beziehen. Es war also kein Handel möglich, da es nichts zu verhandeln gab. Die Verbraucher waren gezwungen, den Strom von diesem einen Gebietsversorger zu beziehen.
Zu Zeiten vor der Liberalisierung gab es ausschließlich bilaterale, d.h. auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Stromlieferungsverträge. Bei einer Betrachtung der weltweiten Elektrizitätsmärkte stellt man allerdings fest, dass auf allen Märkten, die liberalisiert wurden, neben dem bilateralen Handel auch ein institutioneller Handel, in Form von Spot- oder Terminbörsen, entstanden ist (vgl. Kraus 1998a). Strombörsen auf diesen liberalisierten Märkten haben sich als eigentliche Katalysatoren des Wettbewerbs erwiesen. So sorgen sie durch ihre standardisierten Produkte am Spotmarkt für eine Preistransparenz, indem der Börsenkurs für den gesamten Markt zum Maßstab wird. Preisaufschläge wie zu Zeiten geringerer Markttransparenz entfallen. Weiter besteht die Möglichkeit über den Terminmarkt, sich gegen Preisschwankungen abzusichern (vgl. Kraus 1999a).
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu beurteilen, welche Chancen, auf Grund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz potenzieller Börsenteilnehmer, eine Strombörse mit Standort in Deutschland hat und damit auch, welche Chancen die Signalwirkungen, die von einer Strombörse ausgehen, haben.
Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit wettbewerbstheoretischen Grundlagen, wie dem Konzept des natürlichen Monopols, sowie mit drei unterschiedlichen Deregulierungsmodellen, die alle ihre Bedeutung für Deutschland haben. Die beiden vorgestellten NTPA-Modelle werden beide in der deutschen Umsetzung der EU-Richtline zur Liberalisierung des Energie- und Elektrizitätsmarktes als mögliche Umsetzungsmodelle erwähnt und das danach vorgestellte Konzept des Pool-Modells findet sich zumindest ansatzweise in den einzeln beschriebenen Strombörsen wieder.
Im 3. Kapitel wird eingangs eine kurze Zusammenfassung der geschichtlichen Entstehung der Struktur der Energiewirtschaft gezeigt, der dann die Beschreibung dieser Struktur folgt. Danach werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor und nach der Liberalisierung vorgestellt, welche einen starken Einfluss auf die Chancen einer deutsche Strombörse haben.
Mit Nord Pool, Amsterdam Power Exchange (APX) und California Power Exchange (CalPX) werden im 4. Kapitel drei existierende Strombörsen im Ausland vorgestellt. Es wird untersucht, welche Lehren Deutschland eventuell aus diesen ausländischen Beispielen ziehen könnte. Weiter beschäftigt sich dieses Kapitel mit den beiden Strombörsenkonzepten, das der European Energy Exchange in Frankfurt und der Leipzig Power Exchange in Leipzig, die in Deutschland implementiert werden.
Mittels einer Befragung, die bei sechs ausgewählten Versorgungsunternehmen durchgeführt wurde und deren Ergebnisse in Kapitel 5 dargestellt werden, soll eine Tendenz ersichtlich werden, welche Erwartungen diese Unternehmen an eine deutsche Strombörse haben und welche Chancen sie ihr einräumen.
Die Gesamtarbeit wird mit einem Fazit zu den Chancen einer Strombörse in Deutschland in Kapitel 6 abgeschlossen.
2 Theoretische Grundlagen
In diesem Abschnitt werden verschiedene theoretische Modelle vorgestellt, die in den Diskussionen hinsichtlich des Ordnungsrahmens der Elektrizitätswirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Die Elektrizitätswirtschaft setzt sich aus einer Wertschöpfungskette zusammen, in ihrer groben Struktur bestehend aus der Erzeugung, dem Transport und dem Verkauf (aus wirtschaftlicher Sicht) bzw. der Verteilung (technische Sicht). Der erzeugte Strom muss über Leitungen transportiert werden, damit er zu den Endverbrauchern gelangen und somit verkauft werden kann.
Hier werden am Anfang das Konzept des natürlichen Monopols und dessen Bedeutung für die einzelnen Bereiche der Wertschöpfungskette kurz vorgestellt, da die Bereiche, die ein natürliches Monopol darstellen einer besonderen Regulierung bedürfen, um Ineffizienzen vermeiden zu können.
Danach werden drei Deregulierungskonzepte gezeigt. Durch das Verbot der Demarkations- und Konzessionsverträge werden die ehemalig geschlossenen Versorgungsgebiete dem Wettbewerb geöffnet. Um allerdings Wettbewerb in der Praxis durchsetzen zu können, bedarf es Regelungen, mit denen sich diese Modelle beschäftigen. Zwei davon sind Modelle, die sich damit auseinandersetzen, wie ein Netzzugang geregelt werden kann (NTPA-Modelle). Eine Regulierung ist hierbei nötig, um den Zugang zu den Netzen diskriminierungsfrei zu halten.
Am Ende dieses Abschnittes wird mit dem dritten Modell darauf eingegangen, wie der Handel organisiert werden könnte. Hierfür wird das Pool-Modell vorgestellt. Dieses soll helfen, das übergeordnete Ziel der Liberalisierung, geringere Verbraucherpreise, zu erreichen.
2.1 Das natürliche Monopol
Mit einem natürlichen Monopol wird eine Marktsituation bezeichnet, bei der ein einzelner Anbieter den gesamten Markt zu geringeren Kosten beliefern kann, als dies mehrere Anbieter tun könnten (Subadditivität). Folgende Kostenfunktion beschreibt strenge Subadditivität:
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten](1)
Die Ursachen für Subadditivität liegen dabei in den Unteilbarkeiten der Produktionstechnik, die vor allem dadurch entstehen, dass die Kapazität nur in großen Sprüngen variabel ist. Dies hängt meist mit den technischen Voraussetzungen zusammen, z.B. bei Kraftwerken. Liegen Unteilbarkeiten vor, so gehen damit meistens sinkende Durchschnittskosten bei steigender Produktion einher, die wiederum auf Größenvorteilen (Economies of Scale) beruhen können (vgl. Fritsch/Wein/Ewers 1999, S. 179). Man geht z.B. von Synergieeffekten (Economies of Scope) durch das Produzieren unter einem Dach oder auch von einem Lernkurveneffekt aus. Diese Effekte können nicht oder nur in geringerem Maße erzielt werden, wenn die gleiche Menge von mehreren Unternehmen produziert wird.
Allerdings kann ein natürliches Monopol nicht alleine mit sinkenden Durchschnittskosten erklärt werden, wie dies lange in der Literatur geschah. Mittlerweile hat man erkannt, dass ein sinkender Durchschnittskostenverlauf keine notwendige Bedingung für ein natürliches Monopol ist (vgl. Hensing/Pfaffenberger/Ströbele, 1998, S. 165). Ab einer gewissen Ausbringungsmenge kann der Ressourcenverzehr z.B. durch zusätzlich erforderliche Koordination oder produktionstechnische Gegebenheiten so groß werden, dass die Kostensenkungspotenziale überkompensiert werden können und somit die Durchschnittskosten wieder ansteigen. Dennoch kann ein natürliches Monopol bestehen (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 33). Daher greift man in der neueren Theorie auf das eingangs dargestellte Kriterium der Subadditivität als Charakteristikum des natürlichen Monopols zurück.
Abb. 1 zeigt, dass Subadditivität sowohl bei steigendem als auch bei konstantem Durchschnittskostenverlauf existieren kann. Die obere Durchschnittskostenkurve (DK1) steigt ab dem Output 4Y wieder an, dennoch bleibt die Funktion subadditiv, da ein Produzent z.B. das Volumen 6Y (N1) (Kosten: 6*420 = 2520) günstiger herstellen kann, als dies zwei Produzenten könnten, wenn der eine 4Y und der andere 2Y bereitstellt (Gesamtkosten: 4*390 + 2*670 = 2900). Auch bei der unteren Kurve (DK2) ist die Funktion bis zu dem Output 8Y subadditiv. Die Menge 6Y (N2) ist z.B. günstiger durch einen Produzenten (Kosten: 6*110 = 660) herzustellen als durch zwei Produzenten, die jeweils 3Y produzieren (Gesamtkosten: 2*3*120 = 720). Bei einem Output von 8Y (N3) ist die Funktion nicht mehr subadditiv, da zwei Produzenten diese Menge zu den gleichen Kosten (2*4*110 = 8*110) herstellen können. Für Sub- additivität und somit das Vorliegen eines natürliches Monopols ist also nicht in erster Linie der Durchschnittskostenverlauf bestimmend, sondern die relevante Nachfragemenge in Relation zur optimalen Betriebsgröße (vgl. Spelthahn 1994, S. 46 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Spelthahn 1994, S. 47
Indikatoren für das Vorliegen eines natürlichen Monopols sind die Kostenstruktur des Produktes und eine eventuelle Irreversibilität der Investitionsentscheidung. Ein hoher Anteil an Fixkosten kann ein natürliches Monopol andeuten. In einem solchen Fall entstehen sehr hohe fixe Kosten, damit die Produktion überhaupt aufgenommen werden kann. Danach aber fallen im Vergleich nur noch sehr geringe variable Kosten an, um eine weitere Einheit zu produzieren. (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 34). Eine irreversible Investition liegt vor, wenn in der Vergangenheit Ausgaben getätigt wurden, die unwiederbringlich sind (sunk costs), wie z.B. der Aufbau eines Leitungsnetzes, für das es nur eine Nutzungsmöglichkeit gibt. Solche sunk costs gehen nicht mehr in die kurzfristige Kalkulation eines etablierten Anbieters im Markt ein und führen dazu, dass dieser Preise setzen kann, die nicht seine gesamten Stückkosten abdecken. Ein Anbieter der in den Markt neu eintreten will, wird allerdings diese Investitionskosten mit in sein Kalkül einbeziehen. Somit stellen die sunk costs eine Markteintrittsbarriere für diese potentiellen Marktteilnehmer dar (vgl. Spelthahn 1994, S. 55 f.).
Ein natürliches Monopol stellt allerdings erst ein Problem dar und bedarf somit einer staatlichen Regulierung, wenn der Monopolmarkt nicht bestreitbar ist. Unter nicht bestreitbar versteht man, dass der Monopolist keine Markteintritte anderer Unternehmen zu befürchten hat. Auf einem solchen Markt wird es zu einer Monopolpreisbildung kommen, d.h. der Monopolist wird solange die Preise erhöhen, wie der daraus resultierende Gewinn die zurückgehende Nachfrage überkompensieren kann.
Ist der Markt hingegen bestreitbar, stellt auch Subadditivität kein Problem dar, weil der Monopolist aufgrund der drohenden Markteintritte zur Disziplin und damit zu Konkurrenzpreisen gezwungen wird. Ein staatlicher Eingriff ist dann nicht von Nöten.
Die Erfahrung zeigt, dass natürliche Monopole immer im Zusammenhang mit steigenden Skalenerträgen[1] in der Produktion entstanden sind (vgl. Hensing/Pfaffen- berger/Ströbele 1998, S. 165). Sind die steigenden Skalenerträge allerdings nicht von Dauer und der Markt vergrößert sich weiter, wächst der Markt praktisch selbst aus dem natürlichen Monopol heraus. Historisch gesehen sind drei Phasen zu beobachten:
1. Sinkende Durchschnittskosten und ein Marktvolumen, das kleiner ist als die Menge, bei der die Erzeugniskosten ihr Minimum haben (natürliches Monopol).
2. Subadditive Kosten bei einem Marktvolumen, das über der Menge des Kostenminimums liegt (auslaufendes Monopol).
3. Herauswachsen des Marktes aus dem natürlichen Monopol durch die Vergrößerung des Marktvolumens im Vergleich zum Produktionskostenminimum (Konkurrenz).
In der dritten Phase werden neue Anbieter in den Markt eintreten, die bei anhaltendem Wachstum des Marktes ein Produktionsvolumen erreichen werden, bei dem auch sie, wie einst der Monopolist, Größenvorteile ausnutzen können.
Lange wurde behauptet, dass es sich bei der Stromindustrie um einen Sektor handeln würde, der ein natürliches Monopol darstelle. Damit waren auch alle Teilbereiche dieses Wirtschaftszweiges gemeint. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Behauptung noch immer ihre Berechtigung hat.
2.1.1 Stromerzeugung als natürliches Monopol?
Mit dem Wachstum der Kraftwerksanlagen war im Laufe der Zeit eine erhebliche
Kostendegression verbunden. Durchgeführten Schätzungen zufolge liegt die optimale Betriebsgröße von Kraftwerken bei etwa 300 MW bis 400 MW (bei Kernkraftwerken das 2-3 fache) (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 37). Die Strommenge, die durch diese Anlagen produziert wird, reicht allerdings nicht aus, um die Marktnachfrage zu befriedigen, d.h. mehrere Kraftwerke müssen unabhängig voneinander gleichzeitig produzieren, um den Strombedarf zu decken. Es kann also festgestellt werden, dass im Bereich der Stromerzeugung kein natürliches Monopol vorliegt, sondern sich der Sektor heute vielmehr in der dritten Phase, der Konkurrenz befindet.
Dies ist nicht zuletzt auf die Produktionsfunktion der Stromerzeugung zurückzuführen. Große Versorgungsanlagen müssen mehr Reserven halten, als dies mehrere kleine Anlagen müssten, da der Ausfall einer großen Anlage schwerer zu kompensieren ist als der Ausfall kleiner Anlagen. Weiter können ab einer bestimmten Größe eventuelle Lerneffekte durch den Verwaltungsaufwand überkompensiert werden.
Abb. 2 Ertragsgesetzliche Produktionsfunktion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese beiden Gegebenheiten machen das Vorliegen einer ertragsgesetzlichen Produktionsfunktion (Abb. 2) mit ihrem U-förmigen Durchschnittskostenverlauf sehr wahrscheinlich. Dies wiederum bedingt, dass die optimale Betriebsgröße im Minimum der Durchschnittskostenkurve liegt. Da dieses Minimum mittlerweile weit unterhalb der Strommenge liegt, die die Nachfrage befriedigt, besteht im Bereich der Stromerzeugung kein natürliches Monopol. Dieser Teilmarkt ist demnach für Wettbewerb geeignet.
2.1.2 Stromtransport als natürliches Monopol?
Eine gegebene Strommenge benötigt bei dem Transport durch eine Leitung eine geringere Kapazität, als diese Menge beim Transport durch zwei Leitungen benötigen würde. Dies hängt damit zusammen, dass eine Leitung einen um ein Drittel geringeren Durchmesser haben kann, als zwei Leitungen haben müssten, um die gleiche Strommenge zu transportieren (vgl. ebenda, S. 48). Damit wird klar, dass es bei gleicher Leistung günstiger ist, gemeinsam eine Leitung zu nutzen, als zwei Parallelleitungen zu bauen.
Bei Betrachtung der Kostenstruktur des Transports stellt man fest, dass sich diese zu 70% aus fixen und 30% variablen Kosten zusammensetzt. Der hohe Anteil an fixen Kosten entsteht größtenteils durch den Leitungsbau, Kosten zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Systems und den Übertragungsverlusten. Dieser hohe Fixkostenanteil und die Irreversibilität der Investitionsentscheidung sind für die Erscheinung der sunk costs verantwortlich, da diese Leitungen zu keinem anderen Zweck als zum Stromtransport geeignet sind.
Auf Grund der Subadditivität, die bei der Übertragung durch die Erfüllung der Ungleichung (1) gegeben ist, der hohen Fixkosten und der Irreversibilität der Investitionsentscheidung lässt sich der Transportbereich innerhalb der Stromversorgung als natürliches Monopol identifizieren (vgl. Pfaffenberger 1993, S. 259). Auf den Bereich der Verteilung wird hier nicht näher eingegangen, da er dem Bereich des Transportes sehr ähnlich ist und sich hauptsächlich durch technische Begebenheiten von diesem unterscheidet. Auch die Verteilung ist ein Bereich, wie der Transport, der sich als natürliches Monopol identifizieren lässt.
Abschließend lässt sich sagen, dass nicht der gesamte Energiemarkt als natürliches Monopol gelten kann. Der Bereich der Erzeugung ist durchaus für Wettbewerb geeignet. Aber auch das Verbundnetz, das hier als natürliches Monopol identifiziert wurde, kann in den Wettbewerbsprozess integriert werden. Gefahr besteht allerdings darin, dass sich die Erzeugungsanlagen und die Übertragungsnetze in einer Hand befinden. Denn damit könnte der Eigentümer die Durchleitung fremden Stroms verweigern und andere Stromproduzenten diskriminieren. Diese hätten bei fehlenden eigenen Übertragungsnetzen keine Möglichkeiten, ihren Strom abzusetzen. Um solche Situationen zu verhindern, bedarf es einer Regelung, die die Netztbetreiber dazu verpflichten, auch fremden Strom durch ihre Netze zu leiten. In der Bundesrepublik Deutschland wurde dies an Hand einer Verbändevereinbarung, die den diskriminierungsfreien Zugang zu den Netzen gewährleisten soll, zu erreichen versucht.
2.2 Modelle zur Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft
Mit der Erkenntnis, dass nur Teile der Elektrizitätswirtschaft und nicht der ganze Komplex ein natürliches Monopol darstellen, wie in dem vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, ist eine Regulierung der ganzen Branche hinfällig geworden. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieser Abschnitt mit Modellen, die zeigen sollen, wie eine deregulierte Energiewirtschaft organisiert werden könnte. Unter 2.1.2 wurde dargestellt, dass es sich bei den Transport- und Verteilungsnetzen um ein natürliches Monopol handelt. Da die Netze genau die Mitte der Wertschöpfungskette Erzeugung - Transport - Verteilung - Verkauf darstellen, muss eine Lösung gefunden werden, wie die Bereiche, die für den Wettbewerb geeignet sind, so in Verbindung stehen, dass Wettbewerb möglich ist. Der Transport (Verteilung) muss dabei diskriminierungsfrei ablaufen, damit überhaupt die Chance auf Konkurrenz beim Handel besteht. Hierzu werden die beiden Modelle „Netzzugang auf Vertragsbasis“ und „Netzzugang auf Vertragsbasis und Einzelkäufer“ vorgestellt. Wie der Handel ausserhalb bilateraler Verträge organisiert werden kann, zeigt das „Pool-Modell“.
2.2.1 Netzzugang auf Vertragsbasis (Negotiated Third Party Access)
In diesem Modell ist niemand mehr an den lokalen Versorger gebunden, jeder hat die Möglichkeit, sich seinen Anbieter frei zu wählen. Dies bedeutet aber auch, dass bei einem Wechsel, der neue Stromversorger einen Netzzugang zu dem neuen Kunden benötigt. Dies kann entweder über den Bau einer Direktleitung geschehen oder durch die Nutzung der bereits vorhandenen Netze des lokalen Konkurrenten. Der wird für letzteres allerdings eine Durchleitungsgebühr, eine Art Leitungsmiete verlangen, die von den beiden Parteien zu verhandeln ist. Dabei besteht keine Durchleitungspflicht für den Betreiber (vgl. Schmidtchen/Bier 1997, S. 23 f.).
In Abb. 3 sind zwei Situationen zu sehen, eine vor der Liberalisierung des Strommarktes und eine danach. In der ursprünglichen Situation (links) liefert das lokale EVU Strom und erhält dafür von dem Kunden den Preis pi. In dem Beispiel nach der Liberalisierung hat der Kunde mit einem neuen Lieferanten einen Vertrag über die Stromlieferung abgeschlossen und wird künftig von diesem beliefert. Dabei zahlt der neue Lieferant eine Übertragungsgebühr ü an den lokalen Netzbetreiber als Miete für die Nutzung des Übertragungsnetzes. Der neue Lieferant wird nun versuchen, ü auf den Kunden zu überwälzen. Dies ist nur dann möglich, wenn der Preis des neuen Versorgers plus der Übertragungsgebühr geringer ist als der Preis des alten Versorgers
für eine bestimmte Menge Strom. Denn nur bei dieser Konstellation wird der Kunde bereit sein, seinen Lieferanten zu wechseln, da man bei der Ware Strom von einer hohen Preiselastizität der Nachfrage ausgeht (vgl. ebenda, S. 24).
Abb. 3 Zahlungsströme beim NTPA-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
nachher
Quelle: Schmidtchen/Bier 1997, S. 25
Gegebenenfalls wird der neue Versorger auf einen Teil von ü verzichten, um den Kunden für sich zu gewinnen. Der neue Versorger wird dann p2 plus den überwälz- baren Teil von ü in Rechnung stellen. In der Abbildung wird davon ausgegangen, dass ü vollständig überwälzt werden kann.
Zu beachten bei diesem Modell ist, dass zwar ein bilateraler Vertrag zwischen Versorger und Kunde geschlossen wird, es aber unmöglich ist zu bestimmen, in welchem Kraftwerk der gelieferte Strom produziert wurde. D.h. der Kunde muss nicht aus Kraftwerken des Versorgers, mit dem er einen Vertrag geschlossen hat, beliefert werden, da das Netzprodukt ein Konglomerat aus eingespeisten Strömen verschiedener Kraftwerke ist.
Problem dieses Modells ist die Möglichkeit des Netzbetreibers, eine Durchleitung zu verweigern. Es muss von ihm zwar bewiesen werden, dass bei einer Durchleitung die Versorgung der eigenen Kunden gefährdet ist, eine unzumutbare Beeinträchtigung der eigenen Erzeugungs- und Verkaufsinteressen besteht oder es zu Kapazitätsengpässen kommt (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 108 f.). Dennoch ist insgesamt der Er
messensspielraum der Netzbetreiber, eine Durchleitung zu verhindern, als zu groß anzusehen (vgl. Panitz 2000). Sie können beispielsweise die auszuhandelnde Durchleitungsgebühr zu hoch ansetzen, um den Absatz von Strom eines Konkurrenten in ihrem ursprünglichem Versorgungsgebiet zu verhindern und den Strom aus den eigenen Erzeugungsanlagen zu verkaufen (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 108). Eine mögliche Lösung zeigen Norwegen und Großbritannien, wo die Netzbetreiber nicht gleichzeitig auch Erzeuger sind (Unbundling), wie zur Zeit in Deutschland. Dort besteht für die Netzbetreiber kein Anreiz, bestimmte Stromlieferanten zu diskriminieren, da sie nur an den Gebühren für die Durchleitung verdienen aber nicht an der Stromproduktion selbst. Ihnen entsteht somit kein Verdienstausfall, wenn ein Kunde den Versorger wechselt (vgl. Lapuerta et al. 1999, S. 447).
2.2.2 Netzzugang auf Vertragsbasis und Einzelkäufer (Alleinkäufersystem)
Auch dieses Modell ist ein NTPA-Modell. Der Unterschied zu dem vorherigen Modell besteht darin, dass auf der Stufe der Verteilung weiterhin ein Monopolunternehmen existiert, das alleine das Recht für den Zugang zum Endkunden besitzt. Niemand ausser diesem Unternehmen darf in einem bestimmten Gebiet Verteilungsnetze bauen und Strom verkaufen. Andere Anbieter können ihren Strom nur an diesen Alleinkäufer (single buyer) verkaufen und die Endkunden nur von diesem single buyer Strom beziehen (vgl. Schmidtchen/Bier 1997, S. 27). Ein Endkunde kann mit einem gebietsfremden Versorger einen Vertrag über die Lieferung von Strom schließen und verkauft diesen anschließend an den Gebietsversorger. Die Preisdifferenz steht dem Endkunden als Kostenersparnis zur Verfügung (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 121).
Abb. 4 zeigt noch einmal auf der linken Seite die ursprüngliche Situation. Auf der rechten Seite wird das Alleinkäufersystem veranschaulicht. Hier wird der Kunde weiterhin vom angestammten EVU zum Preis p1 versorgt. Allerdings kauft der Kunde Energie bei einem neuen Lieferanten zum Preis p2, der geringer ist als p1.
Diese Energie verkauft der Kunde dem Alleinkäufer zum Preis p1. Der Verkauf findet fiktiv an der Gebietsgrenze des ortsansässigen EVU statt. Der Alleinkäufer für das bestimmte Gebiet wird eine Übertragungsgebühr ü für die Strecke von der Gebietsgrenze bis zu dem Kunden verlangen. Der Kunde zahlt im Endeffekt p2 + ü, wie auch im reinen NTPA-Modell, bei vollständiger Überwälzung, da er von dem Gebietsversorger p1 - ü zurückerhält. Ein solches Dreiecksgeschäft wird dann zu Stande kommen, wenn p2 + ü < p1 ist (vgl. Schmidtchen/Bier 1997, S. 27 f.).
Abb. 4 Zahlungsströme beim Alleinkäufersystem
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schmidtchen/Bier 1997, S. 28
Oft wird in der Diskussion angeführt, dass ein single buyer noch größere Möglichkeiten habe, Durchleitungen zu verhindern, als dies im reinen NTPA-Modell schon der Fall sei. Hierbei kommt es auf die Umsetzung des Modells an. Man muss unterscheiden, ob der single buyer dazu verpflichtet ist, diese Dreiecksgeschäfte zuzulassen oder ob er lediglich daran mitwirken kann. Ist er zu solchen Geschäften, z.B. per Gesetz verpflichtet, ist er in seinen Manipulationsmöglichkeiten eingeschränkter, als wenn er nur an solchen Geschäften mitwirken kann. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass beide NTPA-Modelle im Ergebnis identische Zahlungsströme aufweisen.
2.2.3 Das Pool-Modell
Hauptbestandteil dieses Modells ist ein Auktionsmarkt, auf dem Stromproduzenten darum konkurrieren, in das Netz einspeisen zu dürfen. Hierfür wird ein Spotmarkt[2] organisiert. Das Problem der vorne beschriebenen Modelle gibt es in diesem nicht, da der installierte Pool automatisch für eine Trennung von Erzeugung und den nachfolgenden Wertschöpfungsstufen sorgt (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 130 f.). Eine Voraussetzung dieses Modells ist nämlich, dass der Netzbetreiber reiner Transportunternehmer ist, wodurch bei ihm keine Interessen im Erzeugungsbereich vorhanden sind.
Die zweite Aufgabe des Netzbetreibers besteht darin, Angebot und Nachfrage zum Ausgleich zu bringen. Die Erzeuger geben einen Tag im Voraus Angebote für jedes ihrer Kraftwerke für die einzelnen Zeitintervalle ab. Diese sind nötig, da zu verschiedenen Tageszeiten auch unterschiedlich viel Strom benötigt wird und es somit zu unterschiedlichen Lastprofilen kommt. Die Angebote werden danach in aufsteigender Reihenfolge sortiert (merit order). Die Nachfrage wird prognostiziert, indem die Nachfrager[3] dem Netzbetreiber ihren Bedarf mitteilen. Die Abnahme der gemeldeten Menge ist verpflichtend. Auch diese Bedarfsanalyse erfolgt an dem vorherigen Tag. Der Netzbetreiber wählt jetzt solange Kraftwerke aus, unter Berücksichtigung regionaler Netzengpässe, bis die Nachfrage befriedigt ist. Dabei legt der Preis für das letzte Angebot, das zum Zuge kommt, um die Nachfrage zu decken, den Pool-Preis fest. Nach diesem Preis werden alle getätigten Geschäfte eines Zeitintervalls abgerechnet (vgl. Klopfer/Schulz 1993, S. 107). Der Preis innerhalb eines Zeitintervalls ist dabei stets konstant, differiert allerdings von Periode zu Periode. Dieses Verfahren ist eine statische Auktion. Alternativ dazu könnten auch dynamische Auktionen eingesetzt werden, bei denen während der Gebotsphase Preisinformationen veröffentlicht werden und die Akteure durch Gebotsänderungen darauf reagieren können.
Die Abb. 5 veranschaulicht das Pool-Modell. Hier ist allerdings zusätzlich zu dem Spotmarkt noch ein Finanzmarkt integriert, der den Marktteilnehmern zur Verfügung steht, um zukünftige Preisrisiken über Absicherungsverträge[4] zu minimieren, und somit das Gefühl der Unsicherheit der Pool-Preise nehmen soll.
Das Pool-Modell weist große Unterschiede zu den NTPA-Modellen auf. Es wird nicht mehr ein Zusammenhang zwischen Einspeisung und Entnahme simuliert. Hier spielt auch die räumliche Nähe der Kunden zum Erzeuger, wie in den beiden vorherigen Modellen, keine Rolle mehr. Alle Marktteilnehmer sind vielmehr gleichberechtigte potenzielle Vertragspartner. Weiterhin werden keine individuellen Verträge mehr geschlossen, sondern die Geschäfte über standardisierte und anonymisierte Regeln abgewickelt. Die Reservehaltung muss nicht mehr durch individuelle Verträge aufrecht erhalten werden, sondern wird zentral gesteuert (vgl. Bräuer/Werner/Egeln 1997, S. 130 ff.). Viele Komponenten dieses Modells sind in den realisierten und noch zu realisierenden Börsen, die im 4. Kapitel vorgestellt werden, wiederzuerkennen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 Das Pool-Modell
Quelle: Energiewirtschaftlicher Arbeitskreis der RWE AG 1998, S. 42
2.2.4 Kriterien zur Beurteilung der Modelle
Will man die drei Modelle auf die Erreichung der energiepolitischen Ziele, die in Abschnitt 3.2 angesprochen werden, überprüfen, bieten sich dazu verschiedene Kriterien an. Im einzelnen sind dies ökonomische Effizienz und anfallende Transformationskosten (für das Ziel Wirtschaftlichkeit), der Grad der Erreichung von Umweltschutzzielen, sowie die Versorgungssicherheit.
Unter der ökonomischen Effizienz versteht man, dass eine Leistung zu den geringst möglichen Kosten erbracht wird. Dies geschieht dann, wenn die Preise auf einem Markt Konkurrenzpreise sind, da in dieser Situation die Marktakteure gezwungen sind Kostensenkungspotenziale auszuschöpfen, um am Markt überleben zu können. Für das Kriterium der ökonomischen Effizienz können mehrere Hilfskriterien heran- gezogen werden. Dabei spielt z.B. die Höhe der Verbraucherpreise eine Rolle. Diese werden zurückgehen, wenn die Kostensenkungspotenziale, die vor allem im Bereich der Erzeugung vorhanden sind, ausgeschöpft werden. Aber auch eine Erhöhung der Wettbewerbsintensität, dadurch dass der Bau neuer Kraftwerke erleichtert wird, kann zur Senkung der Preise beitragen.
Der Grad der vertikalen Integration kann als weiteres Hilfskriterium der ökonomischen Effizienz angesehen werden. Je stärker ein Unternehmen entflochten ist, d.h. dass die einzelnen Geschäftsbereiche getrennt voneinander geführt werden, desto besser ist dies für die ökonomische Effizienz. Es ist dann nicht mehr möglich, einen Bereich der Verluste erwirtschaftet, durch einen der Gewinne produziert zu subventionieren. Eine Trennung auf rein buchhalterischer Ebene, damit ist das Führen getrennter Konten der einzelnen Bereiche allerdings unter einer einheitlichen Leitung gemeint, ist dabei gegenüber einer rechtlichen Trennung, wo die Bereiche eigenständige Unternehmen werden, die schwächere der beiden Desintegrationsformen.
Das dritte Kriterium der ökonomischen Effizienz ist das Regulierungsniveau. Grundsätzlich sollte die Regulierung auf ein nötiges Maß reduziert werden, nämlich auf die Bereiche des natürlichen Monopols. In den wettbewerblich organisierten Teilbereichen wird die ökonomische Effizienz durch geringe Einflussnahme durch den Staat gefördert. Der Markt reguliert sich dabei am besten selbst.
Darüber hinaus lassen sich auch die Transformationskosten, die durch die Implementierung eines Modells entstehen, unter dem Ziel der Wirtschaftlichkeit subsumieren. Die Kosten, die bei der Umorganisation vor allem durch rechtliche Probleme, wie z.B. der Änderung des Ordnungsrahmens, entstehen, gilt es so klein als möglich zu halten.
Aus Sicht des Umweltschutzes können als Indikator die Marktzugangschancen für umweltfreundliche Erzeuger, wie z.B. durch Nutzung erneuerbarer Energien (WindWasser-, Sonnenenergie, etc.), angesehen werden.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Möglichkeit zur Internalisierung externer Kosten, die die einzelnen Modelle bieten. Die Zielsetzung dabei ist es, die entstehenden externen Kosten in das Entscheidungskalkül der Akteure zu integrieren, um eine bessere Ressourcenallokation zu erreichen (vgl. ebenda, S. 81 ff.).
2.2.5 Beurteilung der Modelle
Um gesamtwirtschaftliche Effizienzvorteile zu nutzen, sollte immer der Erzeuger in das Netz einspeisen, der die geringsten Grenzkosten hat, um so eine optimale
Ressourcenallokation zu erreichen. Bei den beiden NTPA-Modellen werden diese Vorteile bei Auftreten von Netzengpässen verhindert, da dann die Kraftwerke, die günstiger produzieren könnten, als die der Netzbetreiber, nicht berücksichtigt werden. Weiterhin haben die vertikal integrierten Kraftwerke einen strategischen Vorteil, da ihnen eine bevorrechtigte Netznutzung gegenüber den unabhängigen Produzenten eingeräumt wird. Diese Probleme treten bei dem Pool-Modell nicht auf, da dort die Stufen Übertragung und Verteilung von der der Erzeugung getrennt sind und somit keine einseitige Bevorrechtigung bei der Netznutzung zu Gunsten eines Erzeugers entsteht.
Nach Umstellung auf eines der Modelle sind grundsätzlich Senkungen der Verbraucherpreise zu erwarten. In allen drei Modellen werden Kostensenkungen durch den Wettbewerb realisiert und an die Kunden weitergegeben, damit diese nicht zur Konkurrenz abwandern. Das Preisniveau hängt dabei von dem Grad der Konkurrenz ab. Da in dem Pool-Modell die Erzeuger darum konkurrieren müssen, wer in das Netz einspeisen darf, ist hier der Wettbewerbsgrad größer als bei den NTPA- Modellen und somit auch eine höhere Senkung der Verbraucherpreise zu erwarten. In einem Pool-Modell entsteht allerdings Unsicherheit hinsichtlich der Preise dadurch, dass sie von Periode zu Periode schwanken[5]. Dies ist gegenüber den beiden anderen Modellen, die diese Preisschwankungen in dieser Form nicht kennen, ein Nachteil des Pools. Dafür besteht aber die Möglichkeit sich gegen diese Preisschwankungen über den Terminmarkt abzusichern.
Der Regulierungsbedarf steigt tendenziell bei den NTPA-Modellen. Da es keine geschlossenen Versorgungsgebiete mehr gibt, ist die Versorgungssicherheit gefährdet und die Netzbetreiber müssen dazu verpflichtet werden, genügend Reserven vor und die Netze in Stand zu halten. Durch die vertikale Integration, die weiterhin in diesen Modellen möglich ist, bedarf es einer besonderen Regulierung der Netzbetreiber, um eine bevorzugte Behandlung der integrierten Erzeugungseinheiten und damit einen gesamtwirtschaftlichen Effizienzverlust zu verhindern. Damit unabhängige Erzeuger nicht benachteiligt werden, müssen Regeln, z.B. festgelegte Einspeisequoten, erlassen werden. Es gilt, langfristige den Wettbewerb hemmende Verträge der EVU zu verhindern, sowie eine Schiedsstelle aufzubauen, die bei Streitigkeiten wegen Durchleitungsverweigerungen entscheidet. In dem Pool-Modell muss dagegen im Großen und Ganzen nur der Bereich des natürlichen Monopols, also die Übertragungs- und Verteilungsnetze, reguliert werden, da die Bereiche in diesem Modell vertikal desintegriert sind und es nicht zu Bevorzugungen einzelner Erzeuger durch einen Netzbetreiber kommt (vgl. ebenda 1997, S. 108 ff.). Insgesamt kann man aus Sicht der ökonomischen Effizienz ein positives Fazit für das Pool-Modell ziehen, da in diesem die Kraftwerke mit den geringsten Kosten berücksichtigt werden und ein geringes Regulierungsniveau von Nöten ist. Somit können volkswirtschaftliche Kosten gegenüber den NTPA-Modellen eingespart werden. Zusätzlich sind, durch die standardisierten Produkte und die Markttransparenz eines Pools, die Transaktionskosten geringer als bei den beiden Netzzugangsmodellen.
Für den zweiten Indikator der Wirtschaftlichkeit, den Transformationskosten, werden große Probleme in der Umsetzung des Pool-Modells gesehen. Eine Poolgesellschaft muss die Verfügungsgewalt der Netze erlangen, um Erzeugung und Übertragung zu trennen. Dabei können vor allem juristische Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht und eine Vielzahl an Klagen erwartet werden (vgl. Schlesinger 1999, S. 27 ff.). Bei den beiden NTPA-Modellen stellt dieser Punkt kein Problem dar, da die Netze im Verfügungsbereich der Unternehmen verbleiben und somit auch keine Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Eigentums der Netze zu erwarten sind.
Die Marktzugangschancen für umweltfreundliche Erzeuger können als Indikator für die Erreichung von Umweltzielen angesehen werden. In dem Pool-Modell sind dabei die Chancen für solche Versorger ungleich besser als bei den Netzzugangsmodellen. Der unabhängige Netzbetreiber hat, durch seine Nichtteilnahme am Handel keinen Anlass, bestimmte Erzeuger zu benachteiligen. Somit werden umweltfreundliche Erzeuger gleichbehandelt und diese haben eine faire Marktzugangsmöglichkeit. Bei den NTPA-Modellen verbessern sich zwar auch die Chancen der umweltfreundlichen Erzeuger gegenüber der Monopolsituation, kleine Anlagen, wie etwa Blockheizkraftwerke werden aber z.B. durch eine pauschale Netzzugangsgebühr gegenüber großen Anlagen, die nicht umweltfreundlich produzieren, benachteiligt.
Geht es darum, die verursachten externen Kosten zu internalisieren, d.h. diese Kosten in die Preiskalkulation der Unternehmen aufzunehmen, sind ökonomische Internalisierungsinstrumente in ihrer allokativen Wirkung effizienter als ordnungsrechtliche Maßnahmen, da mit diesen eine höhere Anreizwirkung, umweltgerechter zu erzeugen, ausgelöst wird. Diese ökonomischen Instrumente benötigen als Plattform starken Wettbewerb, um erfolgreich ihre Wirkung entfalten zu können. Daher ist aus Sicht der Internalisierung externer Kosten das Pool-Modell das am besten geeignete. Die Netzzugangsmodelle stellen zwar gegenüber der Monopolsituation wieder einen Fortschritt dar, aber dennoch können die ökonomischen Instrumente, auf Grund der weiterhin dominanten und wettbewerbshemmenden Stellung der Gebietsversorger innerhalb ihres Stammgebietes, nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Im Alleinabnehmersystem sind durch dessen Exklusivrechte sogar nur ordnungsrechtliche Instrumente sinnvoll (vgl. Bräuer/Egeln/Werner 1997, S. 116 f., 126 f. und 138 f.).
Das Ziel der Versorgungssicherheit ist in einem wettbewerblich organisierten Markt, durch den Wegfall der geschlossenen Versorgungsgebiete, grundsätzlich gefährdet, egal welches Modell zum Einsatz kommt. Für die EVU entsteht eine Absatzunsicherheit und damit gleichzeitig eine Planungsunsicherheit, die wiederum zur Folge hat, dass kapitalintensive Investitionen nicht getätigt werden. Für die Versorgungssicherheit ist ein ausgewogener Energiemix nötig. Durch die entstehende Planungsunsicherheit besteht allerdings die Gefahr, dass hauptsächlich noch billige Gaskraftwerke gebaut werden und somit der Energiemix gefährdet ist. Der Netzausbau zur Verhinderung von Netzengpässen könnte durch diese Unsicherheiten ebenfalls gefährdet, indem z.B. einzelne Haushalte nicht beliefert werden, weil ein entsprechender Netzzugang fehlt (vgl. ebenda 1997, S. 113 ff., 125 und 137 f. und Steeg, 1999, S. 119). Die Versorgungssicherheit ist also sowohl bei den Netzzugangsmodellen, als auch bei dem Pool-Modell gefährdet, wobei das Pool-Modell, durch den höheren Wettbewerbsgrad, eine größere Unsicherheit bei den EVU verbreiten dürfte, als dies die NTPA-Modelle tun.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nachdem im letzten Kapitel theoretische Grundlagen gelegt wurden, beschäftigt sich dieses Kapitel mit den real existierenden Strukturen der Elektrizitätswirtschaft und den rechtlichen Rahmenbedingungen, sowohl vor als auch nach der Liberalisierung. Eine kurze geschichtliche Zusammenfassung der Entwicklung der Stromwirtschaft liefert den Einstieg in dieses Kapitel.
1885 ging in Berlin das erste Kraftwerk öffentlicher Stromversorgung in Deutschland ans Netz. Somit kam es zu einer lokalen Versorgung[6]. Mit den lokalen Kraftwerken war zwangsläufig die Nutzung öffentlichen Eigentums verbunden, da für den Transport Leitungen über- oder unterirdisch gelegt werden mussten. Für die Gemeinden gab es zwei Möglichkeiten, die der Konzessionsvergabe an Privatunternehmen oder den Eigenbetrieb eines Kraftwerkes (vgl. Bohn/Marschall 1992, S. 44). Erst langsam entschieden sich die Gemeinden, Elektrizitätswerke in Eigenregie zu führen. Hauptargument für viele Kommunen war dabei der Bau einer Strassenbahn, die elektrisch betrieben werden musste.
Die Anfänge einer Regionalversorgung wurden 1891 gemacht, als sich das erste Mal ein Transport über eine große Entfernung realisieren ließ. Damals wurde Strom über 175 Km von Lauffen am Neckar[7] nach Frankfurt/ M. zur Internationalen Elektrizitätsausstellung transportiert. Es entstanden nun die ersten Überlandwerke, vor allem an Rhein und Ruhr sowie in Schlesien, wo gute Absatzchancen für Strom bestanden und die benötigte Kohle direkt vor Ort vorhanden war.
In der Zeit des Ersten Weltkrieges erfuhr die Elektrizität einen Schub durch die entstandene Petroleumknappheit. So konnte bis 1918 die Zahl der Kleinabnehmer verdoppelt werden trotz der durch den Krieg erschwerten Netzausbaubedingungen. Probleme traten allerdings wieder direkt nach dem Krieg auf Grund der Gebietsverluste des Saarlandes und Oberschlesiens sowie der Besetzung des Ruhrgebietes mit ihren reichen Kohlevorräten auf. Es kam zu einem drastischen Rückgang der Stromproduktion. Da es noch keine weitreichende Verbundwirtschaft gab, konnten die Verluste nicht ausgeglichen werden. Es ergaben sich regionale Energiekrisen. Der
Zweite Weltkrieg verschärfte diese Situationweiter, durch die Luftangriffe, die in Deutschland sowohl Kraftwerke als auch Übertragungsnetze zerstörten (vgl. Herzig 1992, S. 133 ff.).
Zum Wiederaufbau und Ausbau der Verbundwirtschaft im geteilten Deutschland wurde 1948 die Deutsche Verbundgesellschaft (DVG) von den neun größten Energieversorgungsunternehmen gegründet. 1949 kam es zum Zusammenschluß der Interessenvertreter der lokalen Stufe im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und 1950 wurde die Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungsunternehmen (ARE) gegründet.
Somit festigten sich endgültig die drei Stufen der Elektrizitätswirtschaft:
1. Verbundunternehmen
2. Regionalversorger
3. Lokalversorger.
3.1 Aufbau und Struktur des Elektrizitätswirtschaft
3.1.1 Aufbau der Elektrizitätswirtschaft
Es haben sich im Laufe der Zeit vier Betreibergruppen entwickelt. Zum einen sind dies alle Unternehmen, die sich der Belieferung Dritter mit Elektrizität verschrieben haben (öffentliche Energieversorgung). Eine zweite Gruppe ist die industrielle Kraft- industrie[8]. Drittens ist die Stromerzeugung der Deutschen Bahn AG zu nennen und als vierter Bereich tritt die Stromerzeugung von Privatpersonen in Erscheinung.
Allerdings ist anzumerken, dass ca. 90% (1998) des Stromverbrauchs durch die öffentliche Energieversorgung abgedeckt wurde (vgl. Schiffer 1999, S. 159), weshalb sich die vorliegende Arbeit auf diesen Bereich beschränken wird.
Heute sind ca. 900 Energieversorger (vgl. ebenda, S. 161) tätig, die sich vor allem in ihrer Größe, ihrem Integrationsgrad und ihrer Eigentümerstruktur unterscheiden. Wenn nach Versorgungsaufgaben differenziert wird, können, wie oben dargestellt, drei Unternehmensgruppen auf drei nachgelagerten Stufen unterschieden werden.
Auf der obersten Stufe stehen acht Verbundunternehmen, die Eigentümer und
Betreiber von Anlagen zur Erzeugung und Übertragung von Strom sind[9]. Sie planen, betreiben und koordinieren den Einsatz ihrer Kraftwerke und Übertragungsnetze in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich, sind an der überregionalen Reservevorhaltung beteiligt und betreiben überregionalen Energieaustausch mit gleichartigen Unternehmen aus dem In- und Ausland (vgl. Pfaffenberger 1993, S. 107 ff.). Weiterhin übernehmen diese Unternehmen die Belieferung der regionalen und lokalen EVU. Sie beliefern aber auch Endverbraucher direkt. Diese acht Verbundunternehmen sind in der Deutschen Verbundgesellschaft e.V. (DVG) zusammengeschlossen.
[...]
[1] Steigende Skalenerträge besagen, dass man bei proportionaler Steigerung aller Produktionsfaktoren eine überproportionale Steigerung des Outputs erreicht.
[2] Definition siehe Anhang 1.
[3] Nachfrager sind dabei z.B. große Industriebetriebe oder auch Stromproduzenten, die sich u.U. an der Börse günstiger mit Strom eindecken können, als diesen selbst zu produzieren. In den seltensten Fällen aber sind private Haushalte direkt Börsenmitglieder. Diese werden viel mehr durch Broker oder Händler vertreten, die für mehrere Endverbraucher handeln (vgl. Kraus 1998a).
[4] Dies können Forward-, Future- oder Optionsverträge sein.
[5] Erfahrungen aus den USA z.B. zeigen, dass Energiepreise zu den volatilsten Börsenpreisen zählen (vgl. Kroneberg 1999, S. 682).
[6] Wegen der Nutzung von Gleichstrom war die maximale Entfernung vom Kraftwerk zum Verbraucher auf zwei Kilometer beschränkt, da der Transport mit hohen Verlusten verbunden war.
[7] Dort wurde elektrische Energie aus Wasserkraft gewonnen. Dabei handelte es sich um Hochspannungsdrehstrom, der dazu geeignet ist, über größere Strecken transportiert zu werden.
[8] Hierin ist die Stromerzeugung des Bergbaus eingeschlossen.
[9] Bayernwerk AG, Bewag AG, EnBW AG, HEW AG, PreussenElektra AG, RWE Energie AG, VEAG, VEW Energie AG. Dabei ist zu beachten, dass zwischen Veba/VIAG (PreussenElektra/Bayernwerk) und RWE/VEW zwei Großfusionen anstehen. Die Fusion zwischen RWE/VEW wurde allerdings vorerst durch das Bundeskartellamt untersagt und erhält nur eine Genehmigung, wenn die beiden Konzerne Auflagen erfüllen, die Maßnahmen enthalten, den Wettbewerb zu verbessern (vgl. Klinger 2000, ohne Verfasser 1999a, Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft 2000 und ohne Verfasser 2000a).
- Arbeit zitieren
- Stefan Moritz (Autor:in), 2000, Chancen einer Strombörse in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185485
Kostenlos Autor werden

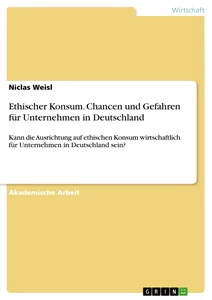
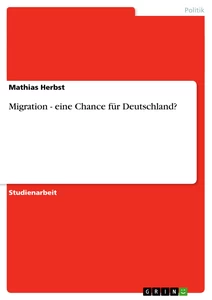






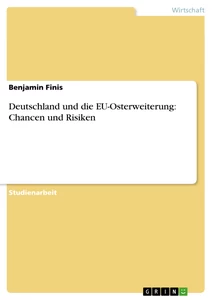


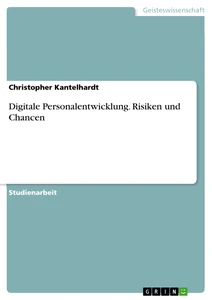
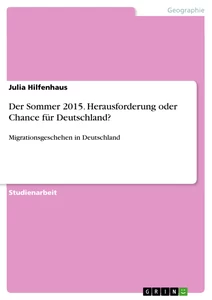






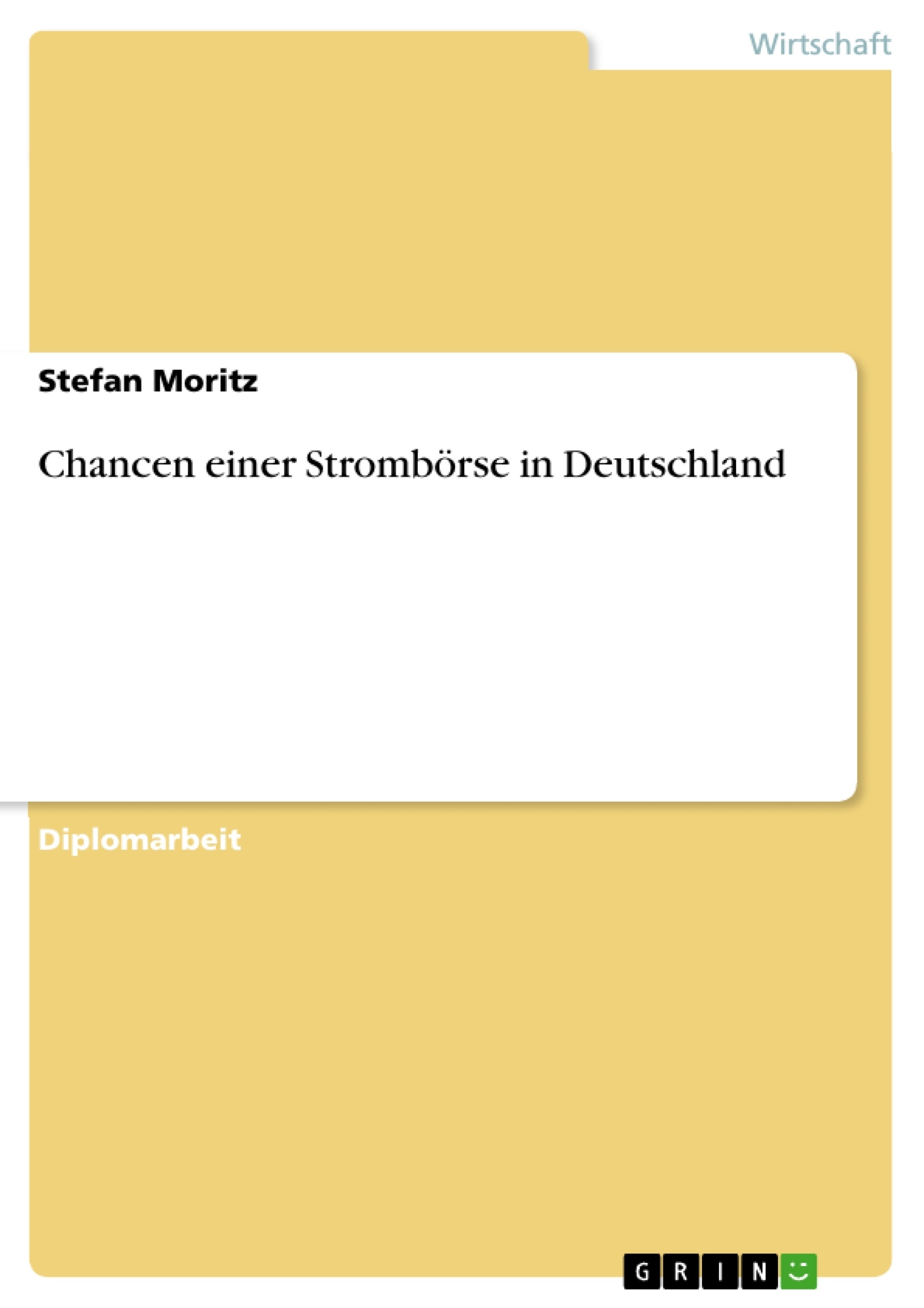

Kommentare