Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen zu Humankapital und Unternehmenskultur
2.1 Die Notwendigkeit der Sicherung von Humankapital
2.2 Das Unternehmenskulturkonzept nach SCHEIN
2.3 Verankerung von Humankapital durch Unternehmenskultur.
3. Unternehmenskultur aus Sicht der NIÖ
3.1 Identität und Institutionen
3.2 Transaktionskostenansatz
3.2.1 Einordnung des Transaktionskostenansatzes in die NIÖ
3.2.2 Verhaltensannahmen nach Williamson
3.2.3 Merkmale von Transaktionen
3.2.4 Fundamentale Transformation und Vertrauen
3.2.5 Humankapitalbindung durch Unternehmenskultur im Transaktionskostenansatz
3.3 Funktionen der Unternehmenskultur
3.3.1 Rahmenbedingungen für Unternehmenskulturfunktionen..
3.3.2 Ausprägungen von Unternehmenskulturfunktionen
4. Risiken und Chancen des Instruments Unternehmenskultur
4.1 Gefahren der Nutzung von Unternehmenskultur
4.1.1 Veränderung der Unternehmenskultur, insbesondere durch
Fusion
4.1.2 Mangel an Identifikation
4.1.3 Stabilitätsverlust durch Sinndefizite
4.1.4 Innere Kündigung und Fluktuation
4.1.5 Sonstige Risikofaktoren
4.2 Erfolgsfaktoren der Unternehmenskultur als Sicherungsinstrument
4.2.1 Wir-Gefühl durch Betriebsklima
4.2.2 Kommunikationsstruktur
4.2.2.1 Informationspolitik.
4.2.2.2 Mitarbeitergespräche und Feedback.
4.2.3 Langfristige Personalplanung
4.2.4 Ausgestaltung der Führung und Partizipation
4.2.5 Sonstige Erfolgsfaktoren
5. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Ebenen der Unternehmenskultur
Abb. 2: Institutionenhierarchie
Abb. 3: Funktionen der Unternehmenskultur
Abb. 4:Abfolge möglicher Risikofaktoren der
Unternehmenskulturinstrumentalisierung 38
Anhangsverzeichnis
Interview Nr. 1 mit Herrn Weißenberg, 11. Februar 1999 A
Interview Nr. 2 mit Frau Mausolf, 18. Februar 1999 A
Interview Nr. 3 mit Herrn Beforth, 5. März 1999 A
Interview Nr. 4 mit Herrn Dr. Ziegler, 9. März 1999 A32
1. Einleitung
Trotz immens hoher Arbeitslosenzahlen in der Bundesrepublik Deutschland sind Spitzenkräfte knapp und auch für die Zukunft ist ein sich verschärfender Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu erwarten.[1] Spätestens aber für die Jahrtausendwende wird ein eklatanter Mangel an Spitzenkräften befürchtet. Dies zusammen mit dem Aspekt der stark wachsenden Zahl der Firmenzusammenschlüsse, sowohl in Deutschland als auch in der übrigen industriellen Welt,[2] führt zu einer steigenden Bindungsnotwendigkeit von Humankapital im Unternehmen, um sich im Wettbewerb durch gute Mitarbeiter behaupten zu können. Gerade bei Fusionen ist der Verlust von Humankapital immanent. Häufig verlassen wichtige Knowhow- und Leistungsträger das neu geschlossene Unternehmen und gefährden damit auch oftmals den Erfolg des Zusammenschlusses.[3] Neben der plötzlichen Doppelbesetzung wichtiger Positionen wird als Grund für das Ausscheiden meist die Unvereinbarkeit des Bewußtseins des Einzelnen mit der Unternehmenskultur genannt.[4] Aber auch sonst stellt die Fluktuation der Mitarbeiter, hervorgerufen durch die Knappheit guten Personals, ein Problem dar, das sich auch direkt in Kosten äußert. Vor diesem Hintergrund stellen sich zwei Fragen: Wie kann Humankapital im Unternehmen abgesichert werden, und kann dies mit dem Instrument der Unternehmenskultur geschehen?
Da im folgenden ständig mit dem Begriff der Unternehmenskultur gearbeitet werden wird, soll der Ausdruck „Unternehmenskultur“ an dieser Stelle zunächst einmal definiert werden:[5]
„Unternehmenskultur ist wesentlich ein implizites Phänomen [...]. Konstitutiv [...] ist, daß es sich bei ihm um ein System geteilter Werte, Normen, Einstellungen, Überzeugungen und Ideale aller Unternehmensmitglieder handelt, welches das Eigenverständnis und die Selbstdefinition eines Unternehmens prägt.“[6]
Sicherung von Humankapital[7] heißt zunächst einmal nur, das Unternehmen vor der Fluktuation der bereits im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter[8] zu schützen. Im weiteren Sinne kann Sicherung von Humankapital aber auch die langfristige Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Personalstabes bedeuten. Damit ist auch die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern zur Sicherung dessen eingeschlossen. Dieses Zugeständnis soll hier vorgenommen werden.
Die Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit gestaltet sich folgendermaßen: Begonnen wird mit der Darstellung der Grundlagen von Humankapital und Unternehmenskultur. Dabei wird zunächst die Notwendigkeit der Sicherung von Humankapital aufgezeigt. Im Anschluß daran wird das Unternehmenskulturkonzept nach Schein erläutert, da dieses gut geeignet ist, um die Frage nach der Möglichkeit der Verankerung von Humankapital durch die Unternehmenskultur zu beantworten. Da im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit die institutionenökonomische Analyse stehen soll, betrachtet der dritte Hauptgliederungspunkt die Unternehmenskultur aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomik. Als Ausgangsbasis werden dort zunächst Identität und Institutionen betrachtet. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf den Transaktionskostenansatz, nachdem dieser von anderen Forschungszweigen der NIÖ abgegrenzt wurde. Als Grundlage für die Problemstellung dienen die Verhaltensannahmen nach Williamson. Danach werden die Merkmale von Transaktionen untersucht, welche die fundamentale Transformation erst möglich machen. Diese kann unter Zuhilfenahme der Merkmale von Transaktionen zu Bildung von Vertrauen führen. Schließlich wird zusammenfassend die Möglichkeit der Humankapitalbindung durch Unternehmenskultur im Transaktionskostenansatz betrachtet. Der vierte Hauptgliederungspunkt zeigt die Chancen und Risiken der Nutzung von Unternehmenskultur als Instrument zur Mitarbeiterbindung auf. Die Risiken oder Gefahren bauen dabei aufeinander auf, auch wenn sie bereits durch alleiniges Auftreten zur Fluktuation führen können. Der Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Veränderung der bestehenden Unternehmenskultur, hervorgerufen durch beispielsweise Fusion mit einem anderen Unternehmen. Daraus kann der Verlust der Identifikationsmöglichkeiten des Mitarbeiters mit der Unternehmung resultieren. Es können Sinndefizite in der Tätigkeit und im Arbeitsumfeld des Arbeitnehmers entstehen, die zu einem Verlust der Stabilität führen. Dadurch wird die Gefahr der inneren Kündigung oder der Fluktuation hervorgerufen. Darüber hinaus existieren aber noch andere Faktoren, die eine Sicherung des Humankapitals durch Unternehmenskultur erschweren. Nach Darstellung der Risikofaktoren werden die Erfolgsfaktoren oder Chancen des genannten Auftrags aufgezeigt. Diese bauen ebenfalls aufeinander auf, sind aber auch jedes für sich Mittel, um die Mitarbeiter an das jeweilige Unternehmen zu binden. Es wird davon ausgegangen, daß ein gutes Betriebsklima die Entstehung von Wir-Gefühl ermöglicht bzw. sogar fördert. Ein gesundes Betriebsklima hingegen wird als Voraussetzung für eine funktionsfähige Kommunikationsstruktur betrachtet, die sich zum einen in Informationspolitik, zum anderen aber auch in Mitarbeitergesprächen zur Feedback-Ermittlung ausdrückt. Mitarbeitergespräche zeigen oftmals Perspektiven einer langfristigen Personalplanung auf. Diese ist jedoch meist abhängig vom Partizipationsgrad und der Ausgestaltung der Führung, die am Schluß diskutiert wird. Selbstverständlich ist aber auch diese Aufzählung von Chancen eines Sicherungsinstruments nicht vollständig, so daß auch hier noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt werden. Den Schluß der Arbeit bildet das Fazit, welches die wichtigen Elemente der Untersuchung nochmals aufzeigt und gleichzeitig einen Ausblick liefert.
2. Grundlagen zu Humankapital und Unternehmenskultur
2.1 Die Notwendigkeit der Sicherung von Humankapital
Um die Frage nach der Notwendigkeit der Absicherung von Humankapital zu klären, wird zunächst einmal normiert, was im folgenden unter Humankapital verstanden werden soll[9]. Der Konsens der in der Literatur verwendeten Definitionen wird durch diese Abgrenzung abgedeckt:
„Unter Humankapital versteht man die Gesamtheit der Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse von Individuen, aber auch deren Wissen, Können und Kreativität.[...] Menschen sind nicht nur die Träger, sondern auch die Eigentümer des Humankapitals, das sie verkörpern.“[10]
Aus dieser Definition geht klar hervor, daß das Humankapital untrennbar mit dem Menschen verbunden ist. Daraus resultiert die Gefahr, daß bei Verlust des Mitarbeiters auch die Nutzung seines Wissens und seiner Fähigkeiten unmöglich wird. Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß heute im Wirtschaftsleben nicht mehr so sehr das Kapital, sondern qualitativ hochwertige Mitarbeiter und ihr kostbares Spezialwissen knapp sind,[11] zeigt dies, warum Humankapital im Unternehmen gesichert werden muß.[12]
Durch die unmittelbare Verbundenheit von Leistung und Leistungsträger entstehen sogenannte „Quasirenten“[13], die verstanden werden als die Differenz, die verloren geht, wenn eine beabsichtigte Transaktion nicht stattfindet und an Stelle dessen nur die zweitbeste Verwendungsmöglichkeit eines Verfügungsrechts realisiert wird.[14] Bezogen auf Humankapital im Unternehmen bedeutet dies, daß der Arbeitnehmer mit seinen erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten im eigenen Unternehmen höher zu bewerten ist, als eine alternative Arbeitskraft, da diese erst mit dem spezifischen Wissen, über welches die derzeitige Arbeitskraft bereits verfügt, ausgestattet werden muß. Die Quasirente entsteht nur, wenn das Unternehmen und der mit spezifischem Wissen ausgestattete Mitarbeiter zusammenarbeiten, d.h. wenn der Arbeitnehmer im Unternehmen verbleibt. Die einzige Alternative und damit nächstbeste Verwendung wäre, daß er die Zusammenarbeit kündigt und ein neuer Mitarbeiter, falls verfügbar, eingearbeitet wird. Damit wäre aber ein Verlust der Quasirente verbunden. Daraus folgt, daß das Humankapital abgesichert werden muß, da sonst zum einen die Quasirente verloren gehen kann oder zum anderen der Mitarbeiter diese abschöpfen kann[15]. Abschöpfen der Quasirente bedeutet, daß der Mitarbeiter sich seines Wertes bewußt ist und von dem Unternehmen den Betrag erpreßt, der bei seinem Weggang verloren ginge. Auf den Kontext bezogen bedeutet das, daß der Arbeitnehmer soviel Gehalt verlangt, daß es rechnerisch gerade noch sinnvoll ist, ihn zu behalten.[16]
Während die oben genannten Argumente die klassische Sichtweise für die Absicherung der Mitarbeiter darstellt, gibt es seit einiger Zeit einen Aspekt, der diese Absicherung noch notwendiger macht. In der Literatur wird übereinstimmend vom „gesellschaftlichen Wertewandel“ geschrieben.[17] Der Mensch kehrt sich zunehmend von materialistischen Haltungen ab, hin zu Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und Partizipation. Die Einschätzung der Werte Anpassung, Unterordnung und Leistung ging zugunsten von Kommunikation, Selbstbestimmung, Lebensgenuß und Toleranz zurück.[18] Auch spielt die eigene Gesundheit und ein stärker bewußter Freizeitkonsum eine zunehmend wichtige Rolle. Daneben wachsen Umweltbewußtsein und Skepsis gegenüber Gewinnstreben und technischem Fortschritt.[19] Das bedeutet für den Mitarbeiter, daß er nicht mehr nur arbeitet, um sich seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, sondern die Berufstätigkeit als Teil seines Lebens zur Selbstentfaltung beiträgt[20]. Im Gegenzug bedeutet dies für das Unternehmen, daß der moderne Mitarbeiter auch anders motiviert werden muß. Nicht nur die Werte des Menschen haben sich geändert, auch das Menschenbild des Managements mußte sich wandeln.[21] Der Mitarbeiter sollte heute nicht mehr zur Arbeit gezwungen und dabei kontrolliert und geführt werden, sondern er sucht von sich aus Leistung und Verantwortung. Die menschliche Tätigkeit hat sich vom Objekt der Unternehmensstrategie zu ihrem Bestandteil entwickelt. Wenn sich die Anforderungen des Mitarbeiters an seinen Arbeitgeber so verändert haben, so heißt das im Umkehrschluß, daß die Unternehmung ihm ein Minimum an Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Einhaltung seiner persönlichen Ziele zur Verfügung stellen muß, wenn sie ihn nicht an den Markt verlieren will. Die Wirtschaft braucht diese neue Art von Mitarbeitern, die kritisch sowohl mitdenken als auch mitreden können und dies auch tun. Aber auf der anderen Seite empfinden genau diese Mitarbeiter Loyalität nicht mehr in erster Linie gegenüber dem Unternehmen, sondern setzen Präferenzen gegenüber ihrer persönlichen Berufskarriere.[22] Daher sind sie latent bereit, ihr Unternehmen zu verlassen, sobald sie an anderer Stelle ihre beruflichen Vorstellungen besser verwirklichen können. Aus diesem Grunde ist es zwingend erforderlich, diese Leistungsträger an das Unternehmen zu binden.[23]
Wenn sich das Unternehmen nicht ausreichend um seine Mitarbeiter kümmert, also die Zufriedenheit nicht bis zu einem gesunden Ausmaß fördert, kann es neben Fehlzeiten und innerer Kündigung auch zur Fluktuation des Arbeitnehmers kommen[24]. Durch Fluktuation entstehen eine Reihe von Kosten, quantifizierbare und nichtquantifizierbare. Als quantifizierbare Kosten bezeichnet man dabei die Kosten, die bei der Neubesetzung der Stellen entstehen. Bei der Kalkulation der Kosten eines Mitarbeiterwechsels rechnet man im allgemeinen bei einem normalen Angestellten mit einem Jahresgehalt, bei Führungskräften mit bis zu drei Jahresgehältern.[25] Bei letzteren kann jedoch das Problem bestehen, trotz immenser Bemühungen keinen gleichwertigen Ersatz zu bekommen. Das zählt dann schon zu den nichtquantifi- zierbaren Kosten. Oft gehen dem Unternehmen durch Fluktuation wichtige Leistungs- und Know-how-Träger verloren, die nicht oder nur schwerlich zu ersetzen sind, da mit ihrem Weggang auch zahlreiche Nebenwirkungen verbunden sind. Zuerst ist der Verlust der besagten Quasirente zu nennen. Dazu gehört aber auch, daß durch die Abkehr erfahrener Mitarbeiter von dem Unternehmen eine Reihe von Kunden ebenfalls die Zusammenarbeit mit der Organisation kündigen könnten[26]. Daraus ergibt sich weiterhin ein Imageverlust, sowohl in bezug auf den Arbeitsmarkt als auch auf das Betätigungsfeld und andere, bisher verbliebene Kunden[27]. Hinzu kommt außerdem auch noch Demotivation der Mitarbeiter, die weiter im Unternehmen tätig sind. Besonders, wenn erfahrene Mitarbeiter ausscheiden, gehen den anderen Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit verloren, was noch schwerer wirkt, wenn keine Einarbeitung in die Aufgaben des Scheidenden erfolgt und diese Mitarbeiter erst ausprobieren müssen, wie diese Aufgaben gelöst werden.[28] Auch ist die Wahrscheinlichkeit, daß gerade gute Mitarbeiter fluktuieren werden, relativ groß, da diese, ausgestattet mit marktfähigen Qualifikationen, nahezu problemlos eine neue Stelle bekommen können. Für weniger Qualifizierte dagegen ist ein Arbeitsplatzwechsel mit wesentlich höherer Unsicherheit verbunden, daher verbleiben diese oft im Unternehmen. Es kommt zu einer Negativauslese.[29] Damit auch die erste Gruppe im Unternehmen verbleibt, ist es notwendig, diese Leistungsträger durch entsprechende Maßnahmen, die insbesondere in Kapitel 4 dargestellt werden, ans Unternehmen zu binden.
2.2 Das Unternehmenskulturkonzept nach Schein
Seitdem man sich in der Literatur vermehrt mit dem Thema der Unternehmenskultur befaßt, existieren zahlreiche Ansätze.[30] Mit Hilfe des Ansatzes von Schein soll hier ein Überblick darüber gegeben werden, was unter Unternehmenskultur - über die Definition hinaus - verstanden werden kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Ebenen der Unternehmenskultur Quelle: Schein (1995), S. 30.
Da Verhalten, das durch Werte und aus ihnen abgeleiteten Normen resultiert, hoffen läßt, effektiver zu sein als ein Handeln, welches ständig durch
Anreize und Kontrollen aufrecht erhalten werden muß, soll die Unternehmenskultur das Verhalten der Mitarbeiter leichter steuerbar machen.[31] Schein erklärt Unternehmenskultur mit Hilfe von drei Ebenen.[32] Diese Ebenen - Artefakte, bekundete Werte und Grundprämissen - sollen die unterschiedlichen Stufen der Sichtbarkeit der Unternehmenskultur für den Betrachter veranschaulichen. Abbildung 1 zeigt die Interdependenzen zwischen den Ebenen:
Die Artefakte bilden die sichtbaren Ausprägungen der Unternehmenskultur ab. Dazu zählen Symbole, Feiern, Bekleidungsgewohnheiten, Formalität des Umgangs der Mitarbeiter und die Architektur der Gebäude. Obwohl diese Merkmale leicht zu beobachten sind, geben sie nur begrenzt Aufschluß über die dahinterstehende Kultur, da sie ohne die Betrachtung der zugrunde liegenden Werte und Normen leicht fehlinterpretiert werden können.[33]
Die eindeutige Analyse läßt sich nur durch eine gleichzeitige Betrachtung der bekundeten Werte und Grundprämissen durchführen. Als bekundete Werte kann man Entscheidungen oder Strategien bezeichnen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Sie entstehen in Organisationen im Laufe der Zeit durch die zunehmenden kollektiven Erlebnisse, die oftmals stark von Gründerpersönlichkeiten geprägt sind. Die bekundeten Werte geben Aufschluß darüber, welche Grundannahmen eine Gruppe als richtig oder falsch bzw. sinnvoll oder unbrauchbar interpretiert. Diese Ebene ist weitgehend unbewußt und damit nur schwer analysierbar. Erschwerend kommt hinzu, daß die Werte, für die Mitglieder eintreten, nicht zwangsläufig mit den gelebten Werten deckungsgleich sind.[34] So kann eine nähere Betrachtung dieser Ebene zeigen, daß die Werte, für die Angehörige einer Organisation eintreten, vorhersehbar machen, was diese sagen werden, während die gelebten Werte Auskunft über ihre Handlungen geben. Also müssen Aussagen und Handlungen nicht unbedingt übereinstimmen, wobei dies den Betreffenden selbst nicht zwangsläufig klar sein muß.[35]
Die Grundannahmen sind der Ausgangspunkt für Werte und Handlungen der Mitarbeiter. Sie sind den Unternehmensmitgliedern so selbstverständlich und von ihnen verinnerlicht worden, daß man innerhalb der Organisation auf fast keine Unterschiede trifft. Dabei handelt es sich um grundlegende, von den Systemmitgliedern nicht mehr hinterfragte Annahmen über den Sinn und die Realität der Unternehmung. Die Grundprämissen bilden den Kern der Unternehmenskultur. Erst wenn der Beobachter diese verstanden hat, wird ihm die Bedeutung der Artefakte und die Glaubwürdigkeit der bekundeten Werte offenbar.
Für Schein ist Unternehmenskultur etwas nicht Konkretes oder nicht Greifbares, das immer nur indirekt durch die Betrachtung des Ganzen entschlüsselt werden kann.[36] Die Unternehmenskultur kann durch die Bildung gemeinsamer Grundannahmen den einzelnen Mitarbeitern oder auch einer Gruppe sowohl Stabilität als auch Sinn vermitteln.[37] Es kommt zu einem Abwehrmechanismus gegen neue oder externe Daten. Damit entsteht für die Führungskräfte die Aufgabe, die Kultur bis zu der unteren Ebene zu analysieren sowie zu bewerten und dadurch die Bedenken der Mitarbeiter zu zerstreuen.
2.3 Verankerung von Humankapital durch Unternehmenskultur
Einer Studie aus dem Jahr 1994 zufolge geht die Fluktuationsneigung der Arbeitnehmer mit wachsender Arbeitszufriedenheit zurück.[38] Da, wie oben gezeigt, die Fluktuation der Mitarbeiter für das Unternehmen unerwünscht ist, muß die Arbeitszufriedenheit gefördert werden. Im folgenden soll gezeigt werden, ob dies durch Unternehmenskultur möglich ist.
Die Folgen des Wertewandels erschweren etablierten Unternehmenskulturen ihre Existenz und machen diese gleichzeitig notwendiger denn je.[39] Wenn man die Menschen als wichtigste Quelle einer Unternehmenskultur betrachtet und diese Menschen sich ändern, dann kann die Kultur nur Stabilität und Halt vermitteln, wenn sie sich entsprechend mit anpaßt. Um die Aufgaben des Unternehmens zu lösen, muß eine entsprechende Motivation vorhanden sein, sich diesen Anforderungen zu stellen. Dafür muß jedoch ein bestimmtes Klima existieren, das dies ermöglicht.[40] Dieses Klima entsteht durch die Unternehmenskultur und die Personalpolitik, die ihrerseits ein Ausdruck der Kultur ist, ebenso wie durch Investitionen in Mitarbeiter, z.B. in Form von Aus- und Weiterbildung. Der Wertewandel kann aber auch dazu führen, daß die Werte und Normen der Unternehmenskultur gespalten erlebt werden. So empfindet ein Teil einer Gruppe oder auch eines Einzelnen wirtschaftliches Wachstum, Gewinnstreben oder die Erreichung technischen Fortschritts als förderlich sowohl für das Unternehmen als auch für sich selbst. Der andere Teil dagegen sieht diese Faktoren als ursächlich für Umweltzerstörung und Arbeitslosigkeit.[41] Dadurch entsteht ein Sinndefizit, das durch die Unternehmenskultur ausgeglichen werden muß. Die Distanz der gesellschaftlichen Werte zu der Wertewelt des Unternehmens muß durch die Unternehmenskultur reduziert werden, um zu verhindern, daß der Mitarbeiter in einem Gewissenskonflikt lebt oder arbeitet und vielleicht deshalb seinen Arbeitsplatz aufgeben würde.
Bei einer genaueren Analyse der Ursachen von Fluktuation - als Ausprägung von Unzufriedenheit - fand Kiechl heraus, daß die Beurteilung der drei Kriterien „Arbeit insgesamt“, „Organisation und Leitung“ und „Tätigkeit die höchste Korrelation aufwiesen.[42] Dies sind alles auch Ausprägungen der Unternehmenskultur, wobei die Tätigkeit und die Arbeit insgesamt zu den Artefakten, und Organisation und Leitung sowohl zu den Artefakten als auch zu den bekundeten Werten gerechnet werden können. Da es sich um Kennzeichen der Organisationskultur handelt, können sie folglich auch durch eine entsprechende Ausgestaltung zur Absicherung dienen.[43]
Durch die gemeinsamen Werte und Normen entsteht in der Organisation ein „Wir-Bewußtsein“.[44] Der Mensch wird als Erfolgsfaktor dargestellt, der die eigentlichen Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen hervorruft. Da dieses Bewußtsein auch zu dem Mitarbeiter selbst vordringt, fühlt er sich dem Un-
ternehmen stark verbunden. Die Identifikation kann im Extremfall soweit gehen, daß die Unternehmenskultur den ganzen Menschen einnimmt, also über die Arbeit als Selbstverwirklichung hinausgeht.[45] Ein echtes Gemeinschaftsgefühl der Mitarbeiter untereinander ist für den Unternehmenserfolg dabei von großer Bedeutung, trotzdem darf es aber keinesfalls soweit kommen, daß die Mitglieder von der Kultur unterdrückt werden. Der Umfang, in dem die Grundannahmen geteilt und als gemeinsame Werte und Normen gelebt werden, korreliert mit der Möglichkeit, individuelle Wünsche im gemeinsamen Interesse zu realisieren.[46] Mit Hilfe der Kultur werden bestimmte Kooperationsbeschränkungen[47] überbrückt, indem sie die Mitglieder dazu bringt, bestimmte Handlungen mehr zu belohnen als andere. Dadurch werden honorierte Handlungen wahrscheinlicher und sich auf Dauer durchsetzen. Wenn auf Seiten des Mitarbeiters zunächst Vertrauen und Bereitschaft zum Engagement besteht, dann kann er durch diesen Selektionsprozeß abgesichert werden. Seine persönlichen Prämissen werden unter der Einschränkung der Allgemeinverträglichkeit im Unternehmen berücksichtigt, und er kann gleichzeitig die anderer beeinflussen.
Die Wahl und Implementierung von Strategien der Unternehmensführung wird implizit durch die Unternehmenskultur gesteuert.[48] Der Erfolg vergangener Strategien ist als Bestandteil der Unternehmenskultur in die Unternehmensgeschichte eingegangen und beeinflußt diese dadurch auch zukünftig. Auf diese Weise wird auch die Absicherung des Humankapitals im Unternehmen als Strategie zum Bestandteil der Unternehmenskultur. Mitarbeiterentwicklung und damit auch ihre Festigung im Unternehmen sind nicht delegierbare Kernaufgaben des Managements. Um dieses mittel- bis langfristig erfolgreich und damit strategisch effektiv zu gestalten, muß die Mitarbeiterentwicklung „in und mit der Arbeitsorganisation bewältigt werden“[49] Das heißt sie muß in den Grundprämissen der Organisation verankert sein. Dabei ist die Bindungskraft der Unternehmenskultur nicht nur von der Ausgestaltung der drei Ebenen abhängig, sondern auch von der Beschaffenheit der Instrumente, die zur Ausführung der innerbetrieblichen Arbeitsund Sozialbeziehungen verwendet werden. Je dezentraler demnach das Unternehmen strukturiert ist, je flacher die Hierarchie aufgebaut ist, desto mehr Gewicht erhält diese Bindungskraft, da gerade in solchen Organisationen, hohe Anforderungen an Flexibilität, Innovationskraft, Qualitätssicherung und Humankapital gestellt werden.[50]
Diese Argumente lassen den Schluß zu, daß Unternehmenskultur grundsätzlich in der Lage ist, die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. In der Literatur wird aber auch darauf verwiesen, daß dies nicht um jeden Preis geschehen muß. Bei unüberwindbaren Unterschieden in den Werten und Normen des Arbeitnehmers und der Organisation muß man sich auch zu einer Trennung bereit erklären,[51] da eine weitere Zusammenarbeit das Klima der Belegschaft beeinträchtigen und damit auch die Kultur an sich schädigen würde. Zusammenfassend kann also das Zwischenfazit gezogen werden, daß mit Hilfe der Organisationskultur Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden werden können. Im folgenden soll nun die Unternehmenskultur aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomik betrachtet werden.
3 Unternehmenskultur aus Sicht der NIÖ
3.1 Identität und Institutionen
Bei der Betrachtung der Unternehmenskultur fragt Bonus bezugnehmend auf den lateinischen Ursprung des Wortes[52], was durch die Unternehmenskultur gepflegt werde.[53] Er kommt zu dem Ergebnis, daß dies die Identität des Unternehmens sei. Als Voraussetzung für das Verständnis der Unternehmenskultur muß zunächst die Identität des Unternehmens betrachtet werden. Da es sich bei einem Unternehmen um ein Kollektiv handelt, eine Gruppe von Menschen also, ergibt sich das Problem, daß ein Kollektiv an sich nicht in der Lage ist, etwas zu empfinden.[54] Nur seine Mitglieder sind empfindungsfähig. Daher kann die Identität des Unternehmens nur über den Umweg der aggregierten Identitäten der Einzelnen bestimmt werden. Die Identität des Individuums ist die Ich-Identität. Es handelt sich um das innere Identitätsgefühl eines Menschen, das sich auch in einer sich wandelnden Umwelt nicht verändert. Es ist die Zustimmung zu Werten und Normen, mit denen sich jeder identifiziert und die in der Biographie des Individuums verankert sind.[55] Identität bedeutet aber nicht, daß Personen sich nicht verändern, sondern daß Konstanz in den Handlungen und Werten des Menschen erkennbar ist, sowohl nach innen als auch nach außen. Identität stellt wahrnehmbare Verläßlichkeit dar, wobei sie dem Menschen selbst Halt und Orientierung bietet.[56] Gleichzeitig leitet sich die Identität nicht nur aus eigenen Persönlichkeiten ab, sondern auch aus dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe. Voraussetzung dafür ist, daß das Individuum sich mit den Zielen und Inhalten der Gruppe identifizieren kann.[57]
Der unmittelbare Zusammenhang von Ich- und Gruppenidentität läßt sich aus der Menschheitsgeschichte erklären. So war der Urmensch nur in einer Gruppe überlebensfähig und konnte aber im Gegenzug dazu nur zum Gruppenmitglied werden, wenn die Gruppe ihn als solches Mitglied erkannte.[58]
Gruppenidentität entsteht aber nur, wenn sich die Mitglieder über das kollektive Verständnis der Werte und Normen hinaus mit der Geschichte und Zukunft der entsprechenden Gruppe identifizieren.[59] Diese Sachverhalte lassen sich auch auf die moderne Unternehmung übertragen, angefangen damit, daß ein Einzelner nicht in der Lage ist, so produktiv zu sein wie eine Gruppe.[60] Auch muß der Mitarbeiter von den Kollegen akzeptiert werden, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Unternehmenskultur muß die Mitglieder soweit einnehmen, daß auch die Biographie der Unternehmung für den Einzelnen identitätsstiftend wirkt. Durch die Unternehmensidentität werden rationale und emotionale Elemente des Zusammenhangs zwischen Zweck, Entwicklung und Tätigkeit der Unternehmung verbunden.[61] So kann durch vergangene Erfahrungen, die sich durch die Unternehmenskultur in ungeschriebene Gesetze gewandelt haben, eine Brücke in die Gegenwart und auch in die Zukunft gebaut werden.[62] Wie für den Einzelnen ist die Identität für die Unternehmung Halt und Orientierung.[63] Um als zuverlässiger Partner auftreten zu können, ihre Mitarbeiter durch Vertrauen und Überzeugung an sich und die gemeinsamen Aufgaben zu binden und auch um einer möglicherweise widersprüchlichen Umwelt gewachsen zu sein, muß sie über eine gesicherte Identität verfügen. Diese tritt meist in Form einer starken Unternehmenskultur auf.[64]
Ähnlich wie die Identität sind auch Institutionen dadurch gekennzeichnet, daß sie Konstanz aufweisen.[65] Sie symbolisieren Kontinuität und Verläßlichkeit und können daher ebenfalls Halt und Orientierung geben. North charakterisiert Institutionen als Spielregeln der Gesellschaft und schreibt ihnen die Aufgabe zu, die allgemeine Unsicherheit durch Schaffen einer stabilen Struktur menschlichen Handelns zu reduzieren. Dabei muß diese Struktur nicht notwendigerweise effizient sein.[66] Mit Hilfe von Institutionen werden aus der unendlichen Zahl der Handlungsalternativen diejenigen ausgewählt, die einer Gruppe akzeptabel erscheinen. Davon abweichende Handlungen werden als illegitim bezeichnet.[67] Da Institutionen menschliches Handeln eingrenzen und es damit in bestimmten Grenzen vorhersehbar machen, senken sie die Transaktionskosten.[68] Es gibt förmliche Institutionen, z.B. Gesetze, oder informelle Institutionen, die beispielsweise Sitten und Gebräuche darstellen. In beiden Fällen wird ein Verstoß mit Sanktionen geahndet. Wenn man ein Unternehmen als eine Gruppe von Individuen mit einem gemeinsamen Ziel betrachtet[69], wird unmittelbar einsichtig, daß diese auch im Rahmen von Institutionen agieren. Da aber Unternehmen durch gemeinsame Werte und Normen die Handlungen von Menschen auch beeinflussen, sind diese, wie andere Organisationen auch, in der Lage, Institutionen langfristig zu verändern. Auf diese Weise entstehen Wechselwirkungen, die den institutionellen Wandel bestimmen.
Für Dietl gibt es fundamentale oder grundlegende und sekundäre oder auch abgeleitete Institutionen.[70] Dabei sind fundamentale Institutionen solche, die von den Mitgliedern einer Gesellschaft nahezu automatisch beachtet werden. Sie haben die Menschen von Kindheit an begleitet und sind dadurch zu einem festen Bestandteil des Lebens geworden, so daß sie auch nur selten in Frage gestellt werden. Da fundamentale Institutionen jedem Gesellschaftsmitglied grundlegende Handlungs- und Entscheidungsrechte oder -pflichten zur Verfügung stellen, stehen sie in der Institutionenhierarchie ganz oben. Die Abbildung 2 zeigt die Institutionenhierarchie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Institutionenhierarchie
Quelle: In Anlehnung an Dietl (1992), S. 74.
Sobald sich diese Regeln und Normen aber nicht mehr auf alle beziehen, bzw. einzelne Gruppenmitglieder das Recht erhalten, die Handlungsmöglichkeiten anderer zu begrenzen, werden sie zu sekundären Institutionen.[71] Diese abgeleiteten Institutionen können die Grundlage für weitere abgeleitete bilden, so daß sich daraus ein der Rangfolge nach strukturiertes Institutionengefüge bildet.[72] Der ausschlaggebende Unterschied zwischen beiden Formen ist, daß sekundäre gestaltbar sind. Der Gestaltungsspielraum nimmt allerdings in der Hierarchie ab, da die übergeordneten Institutionen stark eingrenzend wirken. Im Gegenzug werden aber die Gestaltungskonsequenzen umfangreicher, da eine Berücksichtigung der nachfolgenden Ebenen notwendig wird. Daher ist es, dieser Argumentation folgend, nicht möglich, fundamentale Institutionen zu verändern, da dies die Grenzen der menschlichen Rationalität überschreitet. Die Differenzierung von fundamentalen und sekundären Institutionen zeigt implizit auf, daß diese nicht miteinander harmonieren müssen. Wenn dies der Fall ist, handelt es sich um eine gespaltene Kultur.[73] Das heißt fundamentale und sekundäre Institutionen widersprechen einander. Davon abzugrenzen ist aber Identitätslosigkeit, da bei einer gespaltenen Kultur die sekundären Institutionen meist noch aufrechtgehalten werden und so Halt und Orientierung vorgetäuscht wird.[74]
Gruppenidentität, und damit auch Unternehmenskultur[75], kann als fundamentale Institution bezeichnet werden, da sie durch geteilte Werte und Normen menschliches Handeln in der Gruppe beschränkt und Anreize für Verläßlichkeit setzt. Bei Verstoß treten Sanktionen in Kraft. Die Gruppe ist sowohl intern wie auch extern berechenbar. Darüber hinaus hat sie einen eigenen Charakter, und ist damit nicht direkt formbar.[76] Die Aufgabe der Unternehmenskultur ist es, als identitätsstiftende Klammer zu dienen, indem sie die Gruppenidentität festigt und zum Ausdruck bringt.[77] So verhelfen die aktiv gelebten Werte, die am offensichtlichsten in den Artefakten auftreten, zu dem notwendigen Wir-Gefühl. Dieses Wir-Gefühl verstärkt sich, je länger der Mitarbeiter im Unternehmen bleibt. Daher wird es im Zeitablauf immer unwahrscheinlicher, daß er in einer anderen Organisation tätig werden will.[78] Da dies aber nur bei entsprechender Möglichkeit zur Identifikation der Fall ist, ist es um so wichtiger, die Gelegenheit dazu zu bieten. Ansonsten besteht die Gefahr, daß die Mitarbeiter sich doch anderweitig orientieren.
Zusammenfassend bedeutet dies, daß Unternehmenskultur als fundamentale Institution aller Unternehmensmitglieder verstanden werden kann, die durch die gemeinsamen Erfahrungen und Werte die Identität des Unternehmens bilden. Diese vermittelt ihrerseits das Wir-Gefühl und ist daher in der Lage, Humankapital an das Unternehmen zu binden.
3.2 Transaktionskostenansatz
3.2.1 Einordnung des Transaktionskostenansatzes in die NIÖ
Die drei wesentlichen Forschungszweige der NIÖ bestehen aus der Principal-Agent-Theory, dem Property Rights Ansatz und dem Transaktionskostenansatz.
Bei der Principal-Agent-Theory geht es um die Wechselbeziehung zwischen dem Principal und dem Agenten, wobei der Principal von den Handlungen des Agenten abhängig ist und der Agent seine Handlungen selbst bestimmen kann. Das Problem dieser Beziehung ist die Informationsasymmetrie, durch die im Gegensatz zur Neoklassik nur ein zweitbestes Ergebnis zustande kommt. Diese ungleiche Informationsverteilung ist auf drei Möglichkeiten zurückzuführen:
- „hidden action“: Der Principal kann die Handlungen des Agenten nicht direkt beobachten.
- „hidden information“: Der Agent kennt seine Fähigkeiten und Präferenzen besser als der Principal.
- „nature moves“: Unvorhergesehene Umweltzustände beeinflussen das Ergebnis.[79]
Da die Bedeutung der Principal-Agent-Theory für die vorliegende Untersuchung nicht wesentlich ist, soll sie hier nicht weiter betrachtet werden.[80]
Der Property Rights Ansatz beschäftigt sich mit den mit Gütern verbundenen Verfügungsrechten, um deren Nutzung Individuen konkurrieren.[81] Dabei werden vier Gruppen von Verfügungsrechten unterschieden:
- Rechte, welche die Art der Nutzung betreffen,
- Rechte zur formalen und materiellen Änderung eines Gutes,
- Rechte zur Aneignung von Gewinnen und Verlusten aus der Nutzung eines Gutes und
- Rechte zur Veräußerung und befristeten Überlassung eines Gutes.[82] Auch der Property Rights Ansatz wird hier nicht weiter betrachtet, da er für diese Arbeit nur begrenzt geeignet ist. Das liegt vor allem daran, daß Hu- mankapital das einzige Gut ist, bei dem die Verfügungsrechte direkt und untrennbar mit der Person, dem Eigentümer der Rechte, verbunden sind.[83] Gerade deshalb muß aber hier noch darauf hingewiesen werden, daß bei Abschluß eines Arbeitsvertrags das Nutzungsrecht am Arbeitsvermögen und die Verfügungsrechte über die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters in den Besitz des jeweiligen Unternehmens übergehen. Im Falle einer Kündigung gehen sie jedoch wieder an den Eigentümer zurück, woraus folgt, daß der Arbeitgeber nicht nur die Verfügungsrechte verliert, sondern auch Investitionen, die er in den Mitarbeiter und seine Ausbildung getätigt hat.[84] Auch diese Investitionen könnten theoretisch durch die Unternehmenskultur geschützt werden, wenn diese in der Lage wäre, ein Verbleiben des Mitarbeiters im Unternehmen wahrscheinlich zu machen. Das bedeutet außerdem, daß diese Investitionen öfter erfolgen und sich dadurch das Arbeitsniveau und der Wissensstandard erhöhen könnte, da die Gefahr der Unrentabilität der Investition für das Unternehmen nicht mehr so immanent ist.
Der Transaktionskostenansatz untersucht die Durchführung und Anpassung unvollständiger Verträge unter den Annahmen begrenzter Rationalität und Opportunismus mit dem Ziel, die Kosten einer Transaktion zu minimieren. Williamson zufolge ist eine Transaktion der Transfer eines Gutes oder einer Dienstleistung über eine technologisch separierbare Schnittstelle.[85] Die Schnittstelle beschreibt dabei eine Grenze zwischen zwei unterschiedlichen Einflußsphären, an der eine Transaktion gestört werden kann.[86] Unter zwei Bedingungen lassen sich die Transaktionen zu niedrigen Kosten durchführen: Beide Einflußsphären müssen einer gemeinsamen Wertsphäre im Sinne eines Systems aus Normen und Konventionen unterliegen, und innerhalb dieses Systems müssen Zusagen als grundsätzlich verbindlich angesehen werden.
Eine weitere elementare Frage des Transaktionskostenansatzes ist, warum die Allokation der Ressourcen zum einen über den Marktmechanismus gesteuert wird und zum anderen innerhalb unterschiedlicher volkswirtschaftlicher Institutionen mittels Hierarchie.[87] Diese Frage warf Coase mit der Begründung auf, daß die Existenz von Unternehmen auf die mit dem Preismechanismus verbundenen Transaktionskosten und das fundamentale Problem der Unsicherheit zurückzuführen sind.[88] Williamson hat diesen Ansatz entscheidend erweitert, indem er die Wahl zwischen marktmäßiger und hierarchischer Koordination ebenfalls auf die mit jedem der beiden Koordinationsmechanismen verbundenen Transaktionskosten zurückführt und darüber hinaus auch Faktoren benennt, die diese Transaktionskosteneigenschaften determinieren.[89] Der weitere Gang der Untersuchung soll sich auf den Transaktionskostenansatz beschränken, da dieser am besten geeignet scheint, die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Humankapitalbindung zu erklären.
3.2.2 Verhaltensannahmen nach Williamson
Um die menschliche Natur möglichst realitätsnah darzustellen, zieht Williamson die Verhaltensannahmen der begrenzten Rationalität und des Opportunismus heran.[90]
Der Begriff der begrenzten Rationalität geht dabei auf Simon zurück.[91] Danach hat der Mensch zwar die Absicht rational zu handeln, wird aber durch seine intellektuellen Fähigkeiten beschränkt, so daß ihm dieses nur in begrenztem Maße gelingt. So ist es in der Welt ohne vollkommene Information nicht nur unmöglich, alle entscheidungsrelevanten Informationen zu erhalten, sondern es ist ebenso ausgeschlossen, alle erhaltenen Hinweise zu verarbeiten und bei der Entscheidungsfindung rational zu berücksichtigen. Neben der limitierten Informationsverarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns existieren kommunikative Hindernisse. Diese offenbaren sich beispielsweise in der Unfähigkeit, bestimmte Fähigkeiten oder implizites Wissen weiterzugeben.[92] Unter der Annahme von begrenzter Rationalität ist es unmöglich, vollständige Verträge zu gestalten, da zu der normalen Unsicherheit noch Komplexität hinzukommt.[93] Komplexität bedeutet, daß der
Eintritt eines Ereignisses nicht nur ungewiß ist, sondern darüber hinaus der Entscheidungsträger den Eintritt des Ereignisses für nicht überdenkenswert hält.
Die zweite Verhaltensannahme ist der Opportunismus, für Williamson die stärkste Ausprägung der Verfolgung von Eigeninteresse unter Zuhilfenahme von List.[94] Damit sind auch illegitime Handlungen wie Lügen, Betrügen und Stehlen mit eingeschlossen. Das bedeutet aber nicht, daß Opportunismus immer in dieser Form auftreten muß. Bonus dagegen definiert Opportunismus als fehlenden Anstand, d.h. bei einer für ihn vorteilhaften Gelegenheit bricht der Opportunist den vereinbarten Vertrag.[95] Es muß unterschieden werden zwischen ex ante und ex post Opportunismus. Dabei handelt es sich zum einen um die negative Risikoauslese, die normale Risikounterscheidung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zum anderen um das moralische Risiko. Darunter versteht man den Widerwillen von Trägern hoher Risiken, über die gegebene Situation eine sachliche Auskunft zu geben, da es in dem Fall nicht zu einem Vertragsabschluß käme.[96] Der Opportunist nutzt die vorhandenen Informationsasymmetrien für seine Zwecke aus. Dabei ist das Ausmaß des opportunistischen Verhaltens nicht bei allen Vertragspartnern gleich stark ausgeprägt, denn dann wäre das Problem auch berechenbar und somit lösbar. Daraus folgt, daß entweder Transaktionskosten in Form von Informationskosten auftreten, um sich über seinen potentiellen Vertragspartner zu informieren, oder Transaktionskosten in Form von Absicherungskosten, die ex ante in den Kooperationsvertrag eingearbeitet werden.[97] Opportunistisches Verhalten kann durch die Unternehmenskultur jedoch verhindert werden, wenn die geteilten Werte und Normen dieses ausschließen und mit Sanktionen bestrafen.
3.2.3 Merkmale von Transaktionen
Zur Unterscheidung von Transaktionen nennt Williamson drei Dimensionen.[98] Diese sind:
- Faktorspezifität,
- Unsicherheit und
- Häufigkeit.
Dabei ist die Faktor- oder auch Anlagenspezifität das wichtigste Kriterium zur Differenzierung von Transaktionen. Faktorspezifität stellt ein zeitliches Problem dar. Solange Verträge wie beabsichtigt erfüllt werden, stellen Einzweckinvestitionen meist eine Kostenersparnis gegenüber Mehrzweckinvestitionen dar. Da sich Einzweckinvestitionen, wie der Name schon sagt, nur sehr begrenzt und mit Verlust anderweitig verwenden lassen, sind diese Investitionen riskant. Die aus der Spezifität resultierende Abhängigkeit wird durch die Quasirente beschrieben. Die Gefahr, daß der Vertragspartner diese abschöpft, da ein Ausweichen in die nächstbeste Verwendung der Investition unrentabel ist[99], ist um so größer, je höher die Spezifität ist. Daher ist eine institutionelle Absicherung, insbesondere unter dem Aspekt des Opportunismus, dringend erforderlich.[100] Die Spezifität von Investitionen kann in einer Reihe von Formen auftreten:[101]
- Räumliche Spezifität: Die Besonderheit der geographischen Lage führt zu Einsparungen von Lagerhaltungs- und Transportkosten.
- Physische Spezifität: Spezialisierte Maschinen ermöglichen dem Vertragspartner die Herstellung eines besser angepaßten Produktes.
- Humankapital-Spezifität: Investitionen in eine spezialisierte Ausbildung oder der Erwerb idiosynkratischen Wissens.[102]
- Widmungs-Spezifität: Investitionen zugunsten eines bestimmten Kunden, z.B. im Austausch mit Geiseln.[103]
- Markenartikel-Spezifität: Durch einen Werbefeldzug für ein Produkt erhöht sich dessen Wert in den Vertragsbeziehungen mit den Käufern.
Bei der Unsicherheit von Transaktionen geht es nicht nur um die Wahrscheinlichkeit, mit der zukünftige Ereignisse eintreten, sondern auch um die Unvorhersehbarkeit zukünftiger Ereignisse.[104] Die Unsicherheit darüber, welche aus der Vielzahl der denkbaren und nicht konkretisierbaren Ereignisse tatsächlich eintreten, macht die Verträge regelmäßig unvollständig. Aufgrund der begrenzten Rationalität können die Marktteilnehmer komplexe Umwelt nicht vollständig erfassen und prognostizieren, so daß sie nur innerhalb eines limitierten Feldes rational entscheiden können.[105] Daneben existiert noch Unsicherheit strategischer Art, die auf Opportunismus zurückzuführen ist.[106] Wenn diese nicht institutionell abgesichert werden kann, führt sie zu weiteren Informations-, Kontroll- und Sanktionskosten. Für die Absicherung opportunistischen Verhaltens kann der Austausch von „Geiseln“ vorgenommen werden. Geiseln in diesem Sinne sind spezifische Investitionen in die Sphäre des jeweiligen Vertragspartners, die bei Vertragsbruch verloren sind.[107] Durch diese selbst herbeigeführte gegenseitige Abhängigkeit werden die Beteiligten im eigenen Interesse an der Einhaltung der Vereinbarungen festhalten oder ihre Beziehungen so regeln, daß es für beide vorteilhaft ist. Bonus legt den Schluß nahe, daß die Bindung zwischen den Partnern um so enger sein wird, je größer die mit der Transaktionskette verbundene Unsicherheit ist.
Als weiteres Merkmal, das einen Einfluß auf die Transaktionskosten ausübt, gilt die Häufigkeit einer Transaktion. So ist der Aufbau eines komplexen Absicherungsapparates für einmalige Transaktionen nicht sinnvoll, da dann diese Transaktionskosten vermutlich überproportional hoch wären.[108] Mit zunehmender Nutzungshäufigkeit sinken die Transaktionskosten aber relativ. Beherrschungs- und Überwachungssysteme zur Kontrolle und Durchsetzung vereinbarter Leistungen, auch „Governance Structure“ genannt, werden mit zunehmender Häufigkeit aber nicht nur verhältnismäßig günstiger, sondern auch notwendiger.[109] Häufig stattfindende Transaktionen führen zu einer Bindung der Partner, bei der die einzelnen Transaktionen sich zu einer Transaktionskette zusammensetzen.[110] Das geschieht meist in Form von Rahmenverträgen, insbesondere dann, wenn spezifische Investitionen getätigt werden. Diese längerfristigen Transaktionsketten weisen aber aufgrund der oben genannten Unsicherheit immer Ungenauigkeiten und Unvollständigkeiten auf. In der NIÖ wird dann von relationalen Verträgen gesprochen. Relationale Verträge sind unvollständig und auf Dauer angelegt. Dabei werden eigenständig institutionelle Lösungen bereitgehalten, die der kooperativen Anpassung und Veränderung des Vertrages dienen. Entscheidend ist aber, daß sich der Geist des Vertrages ändern kann. Nicht die eigentliche Transaktion steht im Vordergrund, sondern die Beziehung als sol- che.[111] Durch die längerfristige Zusammenarbeit mit dem Transaktionspartner kann sich Vertrauen aufbauen. Dieses entsteht durch das Unterlassen von opportunistischem Verhalten während der Zusammenarbeit und macht so eine langfristige Beziehung überhaupt erst möglich. Auf der anderen Seite besteht ein Opportunist im Falle von relationalen Verträgen möglicherweise auf der buchstabengetreuen Erfüllung des Vertrages, die allerdings aufgrund der inzwischen veränderten Sachlage dem Geist des Vertrages widerspricht.[112]
Transaktionen im vorliegenden Kontext können als Tätigkeiten interpretiert werden, die der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber ausübt. Die Häufigkeit drückt sich dann im Grad der Alltäglichkeit aus, während die notwendige Spezifität sich aus der Schwierigkeitsstufe ergibt. Die Unsicherheit besteht neben der grundlegenden Frage, ob der Mitarbeiter dem Unternehmen langfristig erhalten bleibt, meist darin, ob die Aufgabe auch für alle Parteien zufriedenstellend gelöst wird. Unternehmenskultur als ein über vertragliche Vereinbarungen hinaus gehendes Regelsystem kann gerade bei häufig wiederkehrenden Transaktionen die Unsicherheit abbauen und damit letztlich die Quasirenten der Spezifität schützen, indem sie nach innen und außen die Stabilität ihrer Werte verkörpert und damit vertrauenswürdig ist.[113]
3.2.4 Fundamentale Transformation und Vertrauen
Insbesondere bei spezifischen Investitionen kann es zu einer fundamentalen Transformation kommen.[114] Ob dies der Fall ist, hängt davon ab, ob es sich um eine ex ante oder ex post Spezifität handelt.[115] Bei der ex ante Spezifität sind von vornherein spezifische Investitionen notwendig, so daß von Grund auf nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern zur Verfügung steht. Zu Beginn anderer Transaktionen herrscht dagegen zunächst ein konkurrenzintensiver Wettbewerb. In diesem Fall handelt es sich dann um ex post Spezifität. Nach Vertragsabschluß mit einem dieser Anbieter hat derjenige, der die spezifische Investition getätigt hat, gegenüber den Mitbewerbern den Vorteil, bereits transaktionsspezifische Fähigkeiten und / oder idiosynkratisches Wissen vorweisen zu können. Wichtig in dem Zusammenhang ist jedoch, daß bei Humankapitalinvestitionen keine Abnutzung vorliegt in dem Sinn, daß der Nutzen bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ebenfalls verloren geht. Besonders bei häufig wiederkehrenden Leistungsbeziehungen bringt dieser sogenannte „First-Mover-Advantage“ dem Anbieter eine bessere Ausgangsposition gegenüber der Konkurrenz ein. Dieser Anbieter ist durch die Investition in der Lage, die Beziehung langfristig ausbauen zu können, da er gegenüber der Konkurrenz einen Wissens- und / oder Fähigkeitsvorsprung vorweisen kann. Daraus folgt, daß die ursprüngliche Wettbewerbssituation nicht bestehen bleibt. Durch die dauerhafte Investition in transaktionsspezifisches Sach- oder Humankapital kann sich die Marktsituation zu einem bilateralen Monopol[116] aufschaukeln. Dieser Vorgang wird dann als fundamentale Transformation bezeichnet.[117]
Durch eine ständige Vertragsverlängerung und eine schrittweise Anpassung der Verträge - im Sinne von relationalen Verträgen - an die gegebenen Situationen ergeben sich weitere Einsparungen. So können Transaktionskosten in der Kommunikation durch zunehmende Vertrautheit der Vertragspartner gesenkt werden. Williamson geht davon aus, daß sich eine sowohl institutionelle wie auch personelle Vertrauensbasis entwickelt.[118] Unter der Voraussetzung, daß die Vertragspartner sich nicht opportunistisch verhalten, kann man den Schluß ziehen, daß Verträge, die auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis basieren, belastbarer und anpassungsfähiger sind als andere. Dabei ist die Nebenbedingung des nichtopportunistischen Verhaltens unter gegeben Umständen durchaus realistisch. Das Eingehen eines persönlichen Verhältnisses ist in diesem Zusammenhang insofern nicht unwahrscheinlich, als investieren, sogar spezifisch investieren, bedeutet, sich auf Bindungen einzulassen und damit auch verletzlich zu werden.[119] Das setzt voraus, daß man sich vor Vertragsabschluß mit dem potentiellen Vertragspartner auseinandersetzt, d.h. abzuschätzen versucht, ob dieser opportunistisch handeln könnte. Der Abschluß des Vertrags wird nur gelingen, wenn entsprechendes Vertrauen vorhanden ist. Dieses Vertrauen, das sich zu Beginn der Beziehung noch nicht aus persönlichen Erfahrungen ergeben kann, wird zuvor durch die Identität und Reputation bereitgestellt. Vertrauen entsteht dabei durch Identität, da diese, wie oben gezeigt, eine Person oder Organisation berechenbar macht.[120] Die Konstanz der Werte und Normen macht diesen Ablauf möglich.
Im Gegenzug schafft Mangel an Vertrauen so enorm hohe Transaktionskosten, daß eine andere Art der Absicherung gefunden werden muß. Wenn dies aufgrund der immensen Höhe der daraus folgenden Transaktionskosten nicht möglich ist, kann die Transaktion folglich nicht durchgeführt werden. Dadurch wird die Bildung von Vertrauen für beide Seiten notwendig. Längerfristige Bindungen, also nach der spezifischen Investition, führen zwangsläufig zu Erfahrungen mit dem Partner, die das persönliche Verhältnis möglich machen. Es entsteht durch das Unterlassen von opportunistischem Verhalten auf beiden Seiten; es bildet sich Vertrauen.[121]
Sich sozusagen selbstbedingend wird durch dieses vertrauenschaffende Verhalten eine längerfristige Beziehung überhaupt erst möglich. Reputation ist eine ähnliche Ausdrucksform des Vertrauens. Der Unterschied besteht darin, daß das Vertrauen durch Dritte an den Partner weitergegeben wurde. Durch die Weitergabe über Dritte erhält die Reputation ein wichtige Rolle, da der Verlust des „guten Rufs“ bei Mißachtung des Vertrauens auf dem Spiel steht.[122] Reputation ist auch ein Ausdruck von Unternehmenskultur. Die gemeinsamen Werte und Normen stehen für etwas ein, dessen Wert verloren geht, wenn sich Mitglieder des Unternehmens nicht an sie halten. Es entsteht Mißtrauen, sowohl nach innen als auch nach außen. Die Reputation wird also durch Nichteinhaltung der impliziten Regelsysteme zerstört, und Vertrauen unmöglich gemacht. Folglich gehört es zu den Aufgaben der Unternehmenskultur, solches Verhalten zu verhindern.[123]
3.2.5 Humankapitalbindung durch Unternehmenskultur im Transaktionskostenansatz
Das Hauptproblem bei Investitionen in Humankapital besteht in der Gefahr, die getätigten Investitionen durch Abwanderung des Personals zu verlieren. Daher ist, wie bereits gezeigt, eine Absicherung dringend erforderlich. Gezeigt wurde ebenfalls, daß dies grundsätzlich durch Unternehmenskultur möglich ist. Wird nun Unternehmenskultur als Identitätspflege des Unternehmens betrachtet, kann Unternehmenskultur auch als identitätsstiftendes Medium zur Sicherung von Humankapital eingesetzt werden. So kann die Unternehmensidentität dem Individuum durch ihre Konstanz Sicherheit und Halt vermitteln. Dadurch wird der Mitarbeiter veranlaßt, im Unternehmen zu bleiben. Darüber hinaus kann die Unternehmensidentität dem Mitarbeiter bei der Bildung der eigenen Identität unterstützen, wenn er sich den gemeinsamen Werten und Normen des übrigen Unternehmens anschließt.[124]
Auch die drei Dimensionen der Transaktionskostentheorie - Unsicherheit, Häufigkeit und Spezifität - sind für die Betrachtung des Humankapitals interessant.[125] Es existiert zunächst einmal die Unsicherheit, ob der potentielle Mitarbeiter die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen kann, und wenn dies der Fall ist, ob er im Unternehmen verbleiben wird. Die Häufigkeit ist insofern interessant, als wie bei allen anderen Transaktionen die Kosten bei einmaligen Vertragsabschlüssen immens hoch sind. Von daher ist es wünschenswert, den Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten, um zum einen die Such- und Informationskosten bei der Einstellung einmalig zu halten, und zum anderen die Transaktionskosten der Zusammenarbeit durch vertrauten Umgang miteinander gering zu halten. Bei der Spezifität kommt dem Humankapital eine Sonderstellung zu. So sind nach Definition die humankapitalspezifischen Investitionen an die Person gebunden. Daraus folgt, daß für die Unternehmung irreversible Fixkosten der Beschäftigung entstehen. Also entsteht über die Abhängigkeit von dem Vertragspartner, für den ein Gut oder eine Dienstleistung produziert wird, eine Abhängigkeit von dem Mitarbeiter, mit dessen Hilfe das Gut oder die Dienstleistung produziert wird. Dies bedeutet, daß die Amortisation der Investition auf die Dauer der individuellen Arbeitsbeziehung angewiesen ist. Die NIÖ betrachtet meist die Absicherung von Transaktionen. Zwangsläufig drängt sich die Frage auf, ob nicht auch die riskanten Humankapitalinvestitionen durch Geiseln abgesichert werden können. Wenn die Unternehmensidentität alle genannten Bedingungen erfüllt, dann entsteht durch das Ende der Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitnehmer und dem Unternehmen ein Verlust, auch auf Seiten des Mitarbeiters. Er verliert ein Stück seiner Identität. Da es auch ein Teil der Aufgabe der Unternehmenskultur ist, sich von anderen Organisationen abzugrenzen[126], wird es nicht leicht sein, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, der die Lücke der gemeinsamen Werte und Normen sowie die aus der Zusammenarbeit entstehende Stabilität schließt. Von daher kann die Identität als Geisel interpretiert werden.
Des weiteren führt die fundamentale Transformation zu bilateralen Monopolen. Für das Humankapital bedeutet dies, daß bei spezifischer Investition, z.B. in Form einer Ausbildung für einen sehr eingeschränkten Tätigkeitsbereich, verbunden mit der Aneignung idiosynkratischen Wissens, dafür auch nur eine sehr enge Zahl von Nachfragern vorhanden ist. Man kann die Mitarbeiter also auch so an das Unternehmen binden, daß sie mit Fähigkeiten ausgestattet werden, die in anderen Unternehmen nicht genutzt werden können. Selbstverständlich bestünde die Möglichkeit, in anderen Bereichen tätig zu sein, aber das würde bedeuten, daß man diese Fähigkeiten unbezahlt brach liegen ließe, was ökonomisch betrachtet unsinnig wäre. So ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Arbeitnehmer sich auf einen längerfristigen Arbeitsvertrag einläßt, der ihm auf der einen Seite berufliche Zusatzqualifikationen verschafft, und auf der anderen Seite das Recht auf die Disposition seiner Arbeitskraft entzieht.[127] Aufgrund der Rechtslage ist auch diese Art des Vertrags vorzeitig kündbar, aber es ist für den Mitarbeiter nicht mehr sinnvoll, das Verhältnis vorzeitig zu beenden, da das neu erworbene Wissen anderweitig nicht verwendbar ist. Somit sinkt auch das Risiko auf Arbeitgeberseite. Das bilaterale Monopol macht die Unternehmenskultur als Sicherungsinstrument vordergründig überflüssig. Trotzdem kann die Unternehmenskultur durch ihre Funktionen die internen Arbeitsabläufe erleichtern, indem sie beispielsweise die Motivation oder das Wir-Gefühl erhöht.[128] Gleichzeitig werden damit auch außerbetriebliche Gründe, das Unternehmen zu verlassen, abgeschwächt.[129]
Auch die Reputation spielt bei spezifischen Investitionen eine Rolle. Wenn ein Unternehmen erkennt, daß diese sinnvoll und die Gefahren berechenbar sind, und diese Investitionen folglich tätigt, kann dem auf Arbeitnehmerseite eine verstärkte Nachfrage nach Arbeitsplätzen in dem Unternehmen folgen.[130] Dabei soll Reputation, die auf den Grundsätzen der Unternehmenskultur aufgebaut ist, durch Bildungsaktivitäten schlechthin die Betriebstreue von Arbeitskräften fördern. Ein Betätigungsfeld, welches zusätzliche Qualifikation erfordert und schafft, vergrößert die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung entsprechend dem Wertewandel.[131] In diesem Fall kommt die Außenwirkung der Unternehmenskultur zum Tragen.
3.3 Funktionen der Unternehmenskultur
3.3.1 Rahmenbedingungen für Unternehmenskulturfunktionen
Der Unternehmenskultur werden zunächst zwei elementare Funktionen zugeschrieben:[132] Sie soll zum einen durch die Verinnerlichung der gemeinsamen Werte und Normen die Verhaltenssteuerung und die soziale Kontrolle der Mitarbeiter ersetzen, indem sich die Mitarbeiter selbst kontrollieren. Zum anderen ist es die Aufgabe der Unternehmenskultur, die Grundbedürfnisse des Menschen zu befriedigen, z.B. durch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe und die Interaktion mit dieser.[133] Darüber hinaus prägt die
Unternehmenskultur auch die Außendarstellung des Unternehmens. Insbesondere die Artefakte demonstrieren z.B. Kunden oder potentiellen Mitarbeitern, was von diesem Unternehmen zu erwarten ist. So kann die Unternehmenskultur dazu genutzt werden, die Attraktivität eines Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt zu beeinflussen.[134] Das Unternehmensimage ist bei der Entscheidung eines Bewerbers, sowohl sich überhaupt zu bewerben, als auch ein Angebot anzunehmen, bedeutungsvoll. Auf diese Weise kann die Selbstdarstellung durch den bewußten Einsatz der gemeinsamen Werte und Normen aller Unternehmensmitglieder die Sicherung des Humankapitals unterstützen.
Darüber hinaus hat die Unternehmenskultur ökonomische Funktionen. Diese ergeben sich aus drei Problemen, welche die Zusammenarbeit im Unternehmen erschweren:[135]
- Dauerhaftigkeit,
- Unvollständige Verträge und
- Unvorhergesehene Ereignisse.
Die Beziehungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, aber auch die der Mitarbeiter untereinander, sind in der Regel von dauerhafter Natur. Dies erschwert die Interessenkoordination der Beteiligten zunächst dadurch, daß die Eigeninteressen des Einzelnen durch die Unternehmensinteressen überlagert werden können. Weiterhin können verzerrte Zeitpräferenzen vorliegen, so daß das Erreichen kurzfristiger Ziele die langfristigen verdrängt und damit das Erzielen effizienter Ergebnisse gefährdet. Letztlich kann auch der Fall existieren, daß die Mitarbeiter sich in der Einschätzung der Sachlage einig sind und nur die Lösungsansätze voneinander abweichen. Aus der Abkehr der Annahme vollständiger Information in der NIÖ ergibt sich, daß auch Arbeitsverträge unvollständig sind. Die im vorhergehenden Kapitel erläuterten Annahmen machen die Problematik ihrer Absicherung deutlich. Besonders die Gefahr des opportunistischen Verhaltens des Vertragspartners schafft hohe Transaktionskosten, wenn man versucht, die wahre Einstellung des Gegenübers in Erfahrung zu bringen. Ebenso können umfangreiche Kontrollmechanismen mit einem differenzierten Geflecht an Konventionalstrafen notwendig werden, um den Abschluß des Vertrags überhaupt zu ermöglichen.[136] Besonders schwierig ist die Situation, wenn zu der Unvollständigkeit der Verträge auch noch unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Als Lösungsmöglichkeit wurde bereits auf die Verwendung von Institutionen, Einbringung von Identität und Reputation verwiesen. Daher soll im folgenden untersucht werden, wie die Unternehmenskultur Defizite bei der Abwicklung von Transaktionen lösen kann.
Die Abbildung 3 zeigt vorab, wie mittels der Unternehmenskulturfunktionen die Problematik der unternehmensinternen Transaktionen gelöst werden kann, die durch die dauerhaften Beziehungen, unvollständige Verträge und unvorhergesehene Ereignisse auftritt.
[...]
[1] Vgl. hierzu und zum folgenden Sokianos (1996), S. 41 f.
[2] Vgl. O.V. (1998), S. 13. So stieg beispielsweise allein in Deutschland die Zahl der Fusionen von 1180 im Jahr 1993 auf ca. 1900 im Jahr 1998. Über diesen Trend hinaus wird durch die Einführung des Euro eine weitere Steigerung der Fusionswelle erwartet.
[3] Vgl. Kreuz / Diedrichs (1998), S. 29.
[4] Vgl. Schein (1991), S. 25.
[5] Unternehmenskultur und Organisationskultur, sowie der Einfachheit halber nur Kultur, werden im folgenden synonym verwendet.
[6] Vgl. WEßLING (1992), S. 23.
[7] Der Begriff Humankapital wird in Kapitel 2.1. definiert.
[8] Im weiteren Text wird zusammenfassend „der Mitarbeiter“ an Stelle von „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ genannt.
[9] Bleicher spricht anstelle von „Humankapital“ von „Humanpotential“. Damit impliziert er, daß eine volle Entfaltung der Bestandteile des Humankapitals nicht automatisch erfolgt, sondern von unterschiedlichen, stark beeinflussenden Faktoren abhängt. Vgl. Bleicher (1987), S. 23.
[10] Vgl. Caspers (1996), S. 274.
[11] Diese These begründet de Geus damit, daß die niedrigen Zinsen zeigen, daß das Kapital nicht knapp ist, während Unternehmen mit den höchsten Wachstumsraten hauptsächlich Wissen oder Beratung verkaufen. Daraus folgt, daß der Faktor Mensch zum knappen Gut wird. Daneben kommt auch eine Studie von Falk / Thiele zu dem Ergebnis, daß vor allem ein ausreichender Fachkräftenachwuchs stark gefährdet ist. Vgl. Falk / Thiele (1993), S. 47 ff.
[12] Vgl. de Geus (1998), S. 195.
[13] Auf die Einordnung der Quasirenten in den Kontext der NIÖ wird in Kapitel 3 näher eingegangen. Hier soll vorerst nur die Existenz der Quasirenten als Argument für die Notwendigkeit der Absicherung von Humankapital dargestellt werden.
[14] Vgl. Picot / Dietl (1990), S. 179.
[15] Vgl. Hauser (1991), S. 112.
[16] Robbers weist daraufhin, daß auch auf der Mitarbeiterseite eine Quasirente entstehen kann. Der Mitarbeiter kann sein spezifisches Wissen nicht in jeder beliebigen anderen Stelle einsetzen und ist daher eventuell auch vom Unternehmen abhängig. In diesem Fall wird der Preis für das Humankapital zur Verhandlungssache. Vgl. Robbers (1993); S. 13 und Schumann (1992), S. 388.
[17] Vgl. bspw. Steger (1993), S. 189 f.; Rosenstiel (1990), S. 131 ff.; Krulis-Randa (1983), S. 142 f. und Wever (1989) S. 25 ff.
[18] Vgl. Rosenstiel (1986), S. 90.
[19] Vgl. Rosenstiel (1990), S. 137.
[20] Erstaunlich angesichts dieser Erkenntnisse ist, daß dies von den interviewten Praktikern nicht oder nur sehr eingeschränkt festgestellt werden kann. Vgl. Anhang S. A10, S. A21 und S. A30.
[21] Vgl. hierzu und zum folgenden Krulis-Randa (1983) S. 143 f.
[22] Vgl. Wever (1989) S. 27 ff.
[23] Ob die Unternehmenskultur in der Lage ist, dies zu bewerkstelligen, kommt im Kapitel 2.3 zum Ausdruck.
[24] Vgl. Fischer (1992), S. 495.
[25] Vgl. Grässle (1993), S. 13.
[26] Aktuelles Beispiel hierzu bildet die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Nach der Fusion der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Coopers & Lybrand mit Price Waterhouse verließen ein Großteil der Investmentbanker das Unternehmen. Als Folge davon entzogen sich auch einige der zahlungskräftigsten Kunden der weiteren Zusammenarbeit mit PricewaterhouseCoopers. Vgl. Steppan (1998), S. K2.
[27] Vgl. Necker (1998), S. 20.
[28] Vgl. Stangier (1996), S. 17 f. Der Autor spricht in diesem konkreten Fall sogar davon, daß es meist falsch ist, erfahrenes Fachpersonal in den Vorruhestand zu schicken, weil die kurzfristigen Einsparungen oft immense Kosten nach sich ziehen. Denn insbesondere bei relativ homogener Altersstruktur entsteht ein Loch an Erfahrungen.
[29] Vgl. Boerner / Maier / Schramm (1996), S.20 f.
[30] Neben dem hier näher betrachteten Ansatz von Schein wird in der Literatur z.B. noch häufig auf die 7-S-Strategie von Peters und Waterman (1982), die Helden- und Ritentheorie von Deal und Kennedy (1982), oder die clanartigen Organisationen nach Ouchi (1981) zurückgegriffen.
[31] Vgl. BÖGEL (1993), S. 586.
[32] Vgl. hierzu und zum folgenden Schein (1995), S. 29 ff., sowie Schein (1984), S. 4.
[33] Vgl. Scholz (1990), S.28 f.
[34] Vgl. Chiang (1991), S. 94.
[35] Eine andere Auffassung besagt, daß ein und dasselbe Merkmal in zwei Unternehmen verschiedene Werte darstellen kann. So kann z.B. ein offenes Büro entweder auf eine auf Zusammenarbeit eingerichtete Arbeitseinstellung hinweisen, oder auf eine starke Kontroll- funktion. Vgl. Nahavandi / Malekzadeh (1993), S. 11.
[36] Vgl. Kaspers (1987), S. 4.
[37] Vgl. Schein (1995), S. 34.
[38] Vgl. Boerner / Maier / Schramm (1996), S. 18. Zwar wird an dieser Stelle auch auf den größeren Einfluß der Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Unsicherheit des bisherigen Arbeitsplatzes auf die Fluktuationsneigung hingewiesen. Aber das ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.
[39] Vgl. hierzu und zum folgenden O.V. (1987), S. 2 ff.
[40] In Kapitel 4.2.1 wird das Thema Betriebsklima ausführlich behandelt.
[41] Vgl. Rosenstiel (1990), S. 144 ff.
[42] Vgl. Kiechl (1989), S. 44.
[43] Dabei soll an dieser Stelle nicht über die Möglichkeit der Gestaltung der Unternehmenskultur diskutiert werden, da dies nicht unmittelbar dem Ziel der vorliegenden Untersuchung dienlich ist.
[44] Vgl. hierzu und im folgenden Krell (1991), S. 148 ff.
[45] An dieser Stelle verweist Krell darauf, daß die Gefahr einer Annäherung an einen nationalsozialistischen Arbeits- und Gemeinschaftsethos besteht.
[46] Vgl. Dolles (1997), S. 258.
[47] Als Kooperationsbeschränkungen können zum Beispiel Zeit, Gesundheit, Fähigkeiten oder Kapazitäten gelten.
[48] Vgl. Bleicher (1991), S. 114.
[49] Sattelberger (1991), S. 224.
[50] Vgl. Beyer (1993), S. 188 f.
[51] Vgl. bspw. Schein (1995), S.115. Auch von Praktikerseite wird dieser Schritt für notwendig erachtet. Vgl. Anhang, S. A29.
[52] Lat.: colere - pflegen.
[53] Vgl. Bonus (1992), S. 2.
[54] Vgl. Bonus (1996), S. 56.
[55] Vgl. Krappmann (1982), S. 9.
[56] Vgl. Bonus (1992), S. 4.
[57] Identifikation kann als systematische Kombination von Selbstentwicklung und Identität interpretiert werden. Vgl. Conrad (1992), Sp. 1044. Vor allem im weiteren Argumentationsverlauf wird Identifikation aufgrund der geringen Differenz zur Identität mit derselben gleichgesetzt.
[58] Vgl. Claessens (1980), S. 70 ff.
[59] Vgl. Bonus (1992), S. 5 f. Olie weißt darauf hin, daß Identifikation meist nur aufgrund gemeinsamer Erfahrungen möglich ist. Das sei häufiger das Problem bei Fusionen oder Akquisitionen, eine Identifikation mit der neuen Unternehmung sei meist unmöglich, da die gemeinsamen Erfahrungen sich erst im Laufe der Zeit einstellen. Vgl. Olie (1994), S. 38.
[60] Dies hat schon Adam Smith mit seinem Stecknadelbeispiel deutlich gezeigt. Vgl. Smith (1990), S. 9 ff.
[61] Vgl. Matje (1996), S. V. Vizjak dagegen deutet die Identität des Unternehmens als den Kern, der sich aus den grundlegenden Eigenschaften wie Struktur, Verfassung, Politik und Kultur entwickelt hat. Im Umkehrschluß bezeichnet er die Unternehmenskultur als Tiefenstruktur des Unternehmens, als einen Bestandteil der Identität. Vgl. Vizjak (1989), S. 155.
[62] Vgl. Bleicher (1984), S. 495.
[63] Vgl. Bonus(1992), S. 7.
[64] Ob eine Unternehmenskultur als stark oder schwach bezeichnet wird, hängt davon ab, inwieweit sich die Mitarbeiter mit den unternehmensbezogenen Werten und Normen identifizieren. Je ausgeprägter, desto stärker ist die Kultur. Vgl. Heinen (1987), S. 29 ff. Dabei ist eine starke Unternehmenskultur nicht zwangsläufig die bessere. Zwar wird dieser Form in der Literatur aufgrund von Prägnanz, einem hohem Verbreitungsgrad und hoher Verankerungstiefe in bezug auf den Unternehmenserfolg eine größere Bedeutung beigemessen, aber gleichzeitig besteht die Tendenz zur Abschließung oder Blockierung neuer Orientierungen. Außerdem kann es aufgrund traditioneller Fixierung zu einem grundsätzlichen Mangel an erforderlicher Flexibilität kommen. Vgl. Steinmann / Schreyögg (1997), S. 619 ff.
[65] Vgl. Bonus (1994), S. 3. Auch an dieser Stelle verweist Bonus auf den lateinischen Ursprung: Lat.: instituere - aufstellen.
[66] Vgl. North (1990), S. 6.
[67] Vgl. Bonus (1995), S. 4.
[68] Unter Transaktionskosten versteht man Nebenkosten eines Erwerbes von Verfügungsrechten über ein Gut mit vorgegebenen Qualitäts- und Liefereigenschaften, die nicht ins Endprodukt miteingehen und in einer Welt mit vollkommener Information entfallen. Vgl. Grossekettler (1995), S. 4 f. Im folgenden Abschnitt 3.2 wird die Senkung von Transaktionskosten insbesondere mit Blick auf unvorhergesehene Ereignisse und unvollständige Verträge durch Institutionen näher erläutert.
[69] North bezeichnet eine solche Gruppe als Organisation. Andere Organisationen sind z.B. Parteien, Verbände oder Kooperationen. Vgl. hierzu und zum folgenden North (1990), S.
4 f.
[70] Vgl. hierzu und zum folgenden Dietl (1983), S. 71 ff.
[71] Dietl nennt als Beispiel das allgemeine Wahlrecht als fundamentale Institution und eine Steuergesetzänderung sekundär.
[72] Vgl. Abb. 2.
[73] Vgl. Bonus (1994a), S. 9.
[74] Als Beispiel hierfür nennt Bonus das Spätstadium der Sowjetunion, in dem man die Fahnen der gescheiterten Visionen noch vor sich her trug. Vgl. Bonus (1995), S. 6.
[75] Die Kultur einer Gruppe und Gruppenidentität sind als Synonyme zu betrachten. Vgl. Schein (1985), S. 50. Damit ist auch Unternehmenskultur gleich Gruppenidentität, da das Unternehmen als Gruppen von Menschen zu bezeichnen ist.
[76] Vgl. Bonus (1995), S. 9 f.
[77] Vgl. Bonus (1995), S. 11 f.
[78] Vgl. Schrader / Lüthje (1995), S. 272 ff.
[79] Vgl. Bonus / Weiland (1995), S. 34 f.
[80] Die Grundaussage der Principal-Agent-Theory ist die prekäre Beziehung zwischen den Vertragspartnern, hier soll aber gezeigt werden, wie mit Hilfe der Unternehmenskultur die Beziehung abgesichert werden kann.
[81] Vgl. Robbers (1993), S. 74.
[82] Vgl. Alchian / Demsetz (1972), S. 783.
[83] Vgl. Caspers (1996), S. 274.
[84] Vgl. Robbers (1993), S. 79.
[85] Vgl. Williamson (1985), S. 1.
[86] Vgl. Bonus / Weiland (1995), S. 39 f. Williamsons Definition beinhaltet, daß bei einer Transaktion eine Tätigkeitsphase endet und eine neue beginnt. Diesen Sachverhalt versucht Bonus mit seiner Sichtweise des Sphärenübergangs zu umgehen.
[87] Vgl. Krüsselberg (1992), S. 33.
[88] Vgl. Coase (1937), S. 393 f.
[89] Vgl. Williamson (1975), S. 20 ff.
[90] Vgl. Williamson (1985), S. 44. Der Autor schreibt, daß er auch gerne den Einfluß der Menschenwürde auf die ökonomische Organisation behandelt hätte, aber aus praktischen Gründen darauf verzichtet habe.
[91] Vgl. Simon (1976), S. XXVIII.
[92] Vgl. Picot / Dietl (1990), S. 179.
[93] Vgl. Williamson (1985), S. 46. Die Unsicherheit wird im folgenden Abschnitt 3.2.3 intensiv betrachtet.
[94] Vgl. hierzu und zum folgenden Williamson (1985), S. 47.
[95] Vgl. Bonus (1987), S. 102.
[96] Williamson bezieht diese Ausprägungen in erster Linie auf den Versicherungsmarkt. Es ist jedoch kein Grund erkennbar, warum sie nicht auch auf andere Situationen übertragbar sein sollten.
[97] Gerade letzteres ist aufgrund der unvollständigen Information sehr schwierig und läßt sich, wie noch zu zeigen sein wird, am besten durch Vertrauen und Reputation regeln. In diesem Kontext sollte Kooperationsvertrag dann als Arbeitsvertrag gedeutet werden, als Kooperation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
[98] Vgl. hierzu und zum folgenden Williamson (1985), S. 52 ff.
[99] Die Definition und Problematik der Quasirenten wurde bereits in Kapitel 2.1 erläutert.
[100] Vgl. BONUS (1995), S. 42.
[101] Dabei geht Williamson davon aus, daß diese Aufzählung nicht abgeschlossen ist. Die Erläuterung der Punkte bezieht sich auf die Interpretation von Schumann. Vgl. Schumann (1992), S. 440 f.
[102] Idiosynkratisches Wissen bedeutet Spezifität aufgrund von Erfahrung oder bestimmten Fähigkeiten in der Abwicklung von Produktionstätigkeiten und durch das Kennenlernen von Besonderheiten im Zeitablauf, das nicht weitergegeben werden kann.
[103] Der Begriff der „Geisel“ geht in das Mittelalter zurück, als verfeindete Königshäuser ihre Kinder austauschten, um Konflikte zu vermeiden. Wenn es trotzdem zu Auseinandersetzungen kam, wurde mit Tötung der Geiseln gedroht. Vgl. Hauser (1991), S. 118.
[104] Vgl. Schumann (1992), S. 439 f.
[105] Vgl. Bonus / Weiland (1995), S. 42.
[106] Vgl. Williamson (1985), S. 58.
[107] Vgl. hierzu und zum Folgenden Bonus (1995), S. 42.
[108] Vgl. Williamson (1985), S. 60.
[109] Dieses Problem stellt sich nicht, wenn es um standardisierte Produkte oder Dienstleistungen geht, die durch ein Polypol bereitgestellt werden und gleichzeitig von einer Vielzahl
von Abnehmern nachgefragt werden. In diesem Fall kann der Markt die eher kurzfristigen Bindungen zufriedenstellend lösen. Vgl. Bonus / Weiland (1995), S. 41 f.
[110] Vgl. hierzu und zum folgenden Bonus / Weiland (1995), S. 41.
[111] Vgl. MacNeil (1978), S. 863.
[112] Vgl. Bonus (1987), S. 103.
[113] Für den vorliegenden Zusammenhang ist allerdings die Wirkung nach innen von primärer Bedeutung. Trotzdem sollte die Außenwirkung, z.B. auch aufgrund von Rückkopplungsmöglichkeiten, nicht unterschätzt werden.
[114] Vgl. hierzu und zum folgenden Williamson (1985), S. 61 ff.
[115] Vgl. Picot / Dietl (1990), S. 179.
[116] Unter einem bilateralen Monopol ist die Marktform zu verstehen, bei der sich jeweils nur ein Anbieter und ein Nachfrager gegenüber stehen. Dadurch sind sie voneinander abhängig, da sie nicht anderweitig kaufen bzw. verkaufen können. Folglich ist die Preisbildung in dieser Situation sehr schwierig und wird meist über Verhandlungen gelöst. Vgl. Schumann (1992), S. 300 f.
[117] Die fundamentale Transformation kann auch zu einem Monopson führen, was bedeutet, daß ein Nachfrager einer Vielzahl Anbieter gegenüber steht, aber dieser Aspekt ist für die vorliegende Arbeit nicht interessant.
[118] Vgl. Williamson (1985), S. 62.
[119] Vgl. Bonus (1987), S. 91.
[120] Vgl. Bonus (1992), S. 7 ff.
[121] Vgl. Bonus / Weiland (1995), S. 41.
[122] Vgl. Bonus (1998), S. 61.
[123] Vgl. Kapitel 3.3.
[124] Diese Schlußfolgerungen beziehen sich auf die Aussagen des Kapitels 3.1.
[125] Vgl. hierzu und zum folgenden Rürup / Sesselmeier (1998), S. 33 f.
[126] Vgl. Nahavandi (1993), S. 16.
[127] Vgl. Robbers (1993), S. 94.
[128] Vgl. Kapitel 3.3.2.
[129] Außerbetriebliche Gründe, das Unternehmen zu verlassen, könnten z.B. sein, daß ein Mitarbeiter bereits finanziell abgesichert ist und nicht mehr arbeiten müßte oder die Identifikation mit dem Unternehmen die privaten sozialen Beziehungen ersetzt. Vgl. bspw. Anhang, S. A30.
[130] Vgl. Robbers (1993), S. 120 f.
[131] Vgl. Anhang, S. A21.
[132] Vgl. Föhr / Lenz (1991), S. 116 f.
[133] Vgl. Kapitel 3.1.
[134] Vgl. Böckenholt / Homburg (1990), S. 1160 ff.
[135] Vgl. hierzu und zum folgenden Föhr / Lenz (1991), S. 123 ff.
[136] Vgl. Krüsselberg (1992), S. 46.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Osthorst (Autor:in), 1999, Unternehmenskultur als Instrument zur Sicherung von Humankapital im Unternehmen. Eine institutionenökonomische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185425
Kostenlos Autor werden



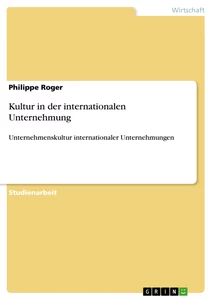



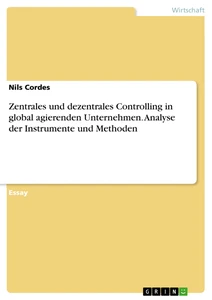



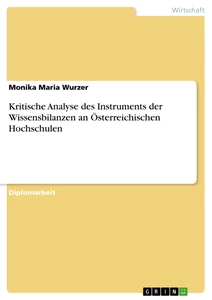




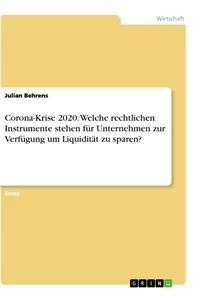



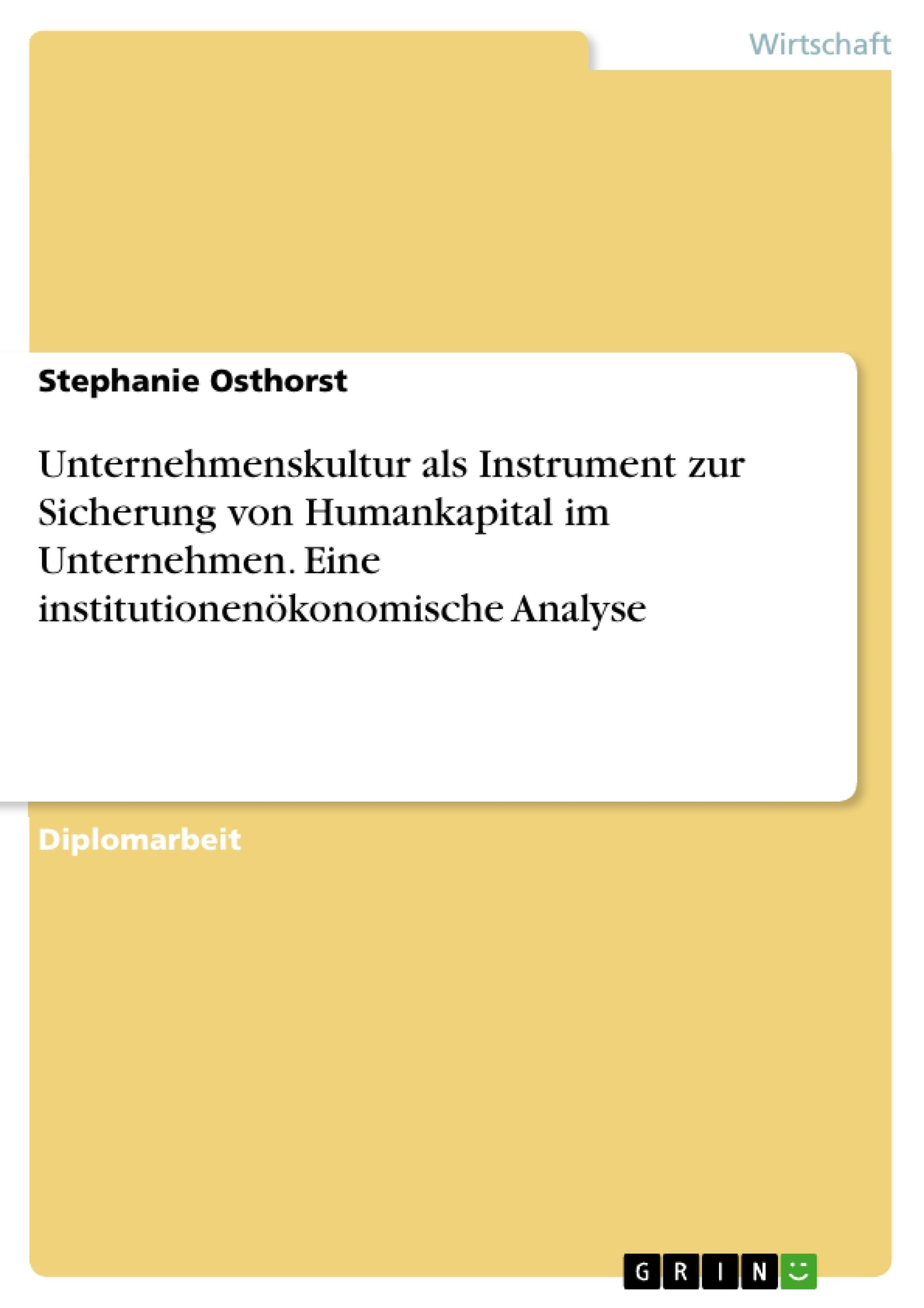

Kommentare