Leseprobe
Inhalt
Vorwort
1. Barrieren und Barrierefreiheit
1.1 Barrieren
1.2 Barrierefreiheit
2. Wahrnehmung visueller Informationen
2.1 Prinzip der geschlossenen Informationskette
2.2 Prioritätenmodell
2.3 Kontraste
2.3.1 Leuchtdichtekontrast (photometrischer Kontrast)
2.3.2 Farbkontrast
2.3.3 Physiologischer Kontrast
3 Beschreibung des Personenkreises
3.1 Definition des Begriffs Sehschädigung
3.2 Vielfalt der Augenerkrankungen
4 Visuelle Barrieren
4.1 Verbesserte visuelle Informationen nützen allen
4.2 Finanzierung
5. Kriterienkatalog
5.1 Grundsätzliche Empfehlungen für die Gestaltung
5.1.1 Kontrast
5.1.2 Farben
5.1.3 Helligkeit
5.1.4 Schrift
5.1.5 Form
5.2 Informationsträger
5.2.1 Piktogramme
5.2.2 Anbringung
5.2.3 Pflege
5.2.4 Beleuchtung
5.2.5 Schilder als Teil von Leitsystemen
5.3 Gestaltung visueller Informationen in Fußgängerbereichen des öffentlichen Verkehrsraums
5.3.1 Gehwege
5.3.1.1 Breite des Gehwegs
5.3.1.2 Oberflächen
5.3.1.3 Bodenindikatoren
5.3.1.4 Begrenzung des Gehwegs
5.3.1.5 Radwegabgrenzungen
5.3.2 Verkehrsknotenpunkte
5.3.2.1 Fußgängerüberwege
5.3.2.2 Das Grazer T
5.3.2.3 Fußgängerfurten
5.3.2.4 Fußgängerschutzinseln
5.3.3 Hindernisse
5.3.3.1 Nicht auskragende Hindernisse
5.3.3.2 Hindernisse mit hüfthoher Beinfreiheit
5.3.3.3 Hindernisse in Kopfhöhe
5.3.3.4 Parkende Fahrzeuge
5.3.3.5 Negativhindernisse
5.3.3.6 Baustellenabschrankungen
5.3.3.7 Telefonzellen
5.3.3.8 Kunstwerke
5.4 Gestaltung visueller Informationen an Fahrzeugen und Anlagen des ÖPNV
5.4.1 Bushaltestellen
5.4.2 Straßenbahnhaltestellen
5.4.3 Straßenbahnen und Busse
5.4.4 Bahnhöfe
5.5 Gestaltung visueller Informationen in und um öffentliche Gebäude
5.5.1 Treppen
5.5.1.1 Stufenmarkierungen
5.5.1.2 Handläufe
5.5.2 Rampen
5.5.3 Aufzüge
5.5.4 Flure und Innenräume
5.5.4.1 Türen
5.5.4.2 Glaswände und Glastüren
5.5.4.3 Beleuchtung
5.5.5 Sanitärräume
6. Untersuchung
6.1 Öffentlich zugängliche Orte und Plätze
6.1.1 Adenauerplatz
6.1.2 Bismarckplatz
6.1.3 Hauptstraße
6.1.3.1 Richtlinien für das Aufstellen von Gegenständen vor Geschäften
6.1.4 Marktplatz
6.1.5 Kornmarkt
6.1.6 Mittermaierstraße
6.1.7 Marktplatz Neuenheim
6.1.8 Haltestellen und Straßenbahnen
6.1.8.1 Haltestelle Blumenthalstraße
6.1.8.2 Haltestellen an der neuen Linie 26 nach Kirchheim
6.1.8.3 Haltestelle Adenauerplatz
6.1.8 Straßenbahnen
6.1.9 Baustellen
6.2 Öffentlich zugängliche Gebäude
6.2.1 Augenklinik
6.2.2 Hauptbahnhof
6.2.3 Kurfürsten-Passage
6.2.4 Rathaus
6.2.5 Schloss Heidelberg
6.2.5.1 Bergbahn
6.2.5.2 Schloss
6.2.5.3 Deutsches Apotheker-Museum
6.2.6 Kundenzentrum der Stadtwerke
6.2.7 Stadtbücherei
6.2.8 Bürgerämter
6.2.8.1 Bürgeramt Handschuhsheim
6.2.8.2 Bürgeramt Kirchheim
6.2.9 Bank
6.2.10 Alte und neue Universität
6.2.11 Lebensmittel Einkaufen
6.2.11.1 Rewe-Supermarkt
6.2.11.2 Lokaler Hofladen
7. Zusammenfassung und Ausblick
8. Literatur
Abbildungen
Tabellen
Vorwort
Etwas sprichwörtlich „mit anderen Augen zu sehen“ ist oft sinnvoll, da es einem zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen verhilft. Indem ich mich im Zuge dieser wissenschaftlichen Arbeit in die Lage von sehbehinderten Menschen versetzte, konnte ich die Stadt Heidelberg, in der ich lebe, auf eine ganz neue Weise kennen lernen. Mein Blick wurde geschärft für die Gestaltung döffentlichen Raumes im Bezug auf Sehbehinderte und, wie deutlich werden wird, auch im Bezug auf alle Menschen. Es ist erfreulich, dass die verantwortlichen Planer vermehrt ihr Augenmerk auf dieses Thema legen. Konkrete Vorschläge für eine sehbehindertengerechte Gestaltung der Umwelt liegen vor, dennoch besteht teilweise großer Nachholbedarf bei deren Umsetzung.
Die Hausarbeit besteht aus einem theoretischen Teil, in dem Kriterien aus der Fachliteratur zusammengestellt werden, und einem praktischen Teil, in dem über Untersuchungen an ausgewählten Orten in Heidelberg berichtet wird, die nach diesen Kriterien durchgeführt wurden. Wann immer das Fotografieren möglich und sinnvoll war, werden die Ergebnisse von Fotos begleitet. Alle „Foto“ stammen vom Verfasser. Die jeweiligen Quellen der „Abbildungen“ sind angegeben.
1. Barrieren und Barrierefreiheit
1.1 Barrieren
Der Begriff „Barrierefreiheit“ steht im Zentrum dieser Arbeit mit dem Titel: „Barrierefreiheit: Die Umsetzung visueller Informationen in der Stadt Heidelberg“. Um mich diesem Begriff langsam anzunähern, möchte ich Böhringer folgend (2003, 46) zuerst den Begriff „Barriere“ klären. In ähnlichem Sinne gebraucht werden laut Wörterbuch (wiktionary) unter anderem die Begriffe Sperre, Straßensperre, Schranke, Schlagbaum, Barrikade, Hindernis, Durchgangshindernis, Hürde, Erschwernis, Versperrung, Verwehrung, Wegsperre, aber auch das Wort Behinderung. Der Begriff „Barriere“ beschreibt demnach „ein Hindernis, welches Räume trennt oder abgrenzt“ (ebd.). Im übertragenen Sinne, in dem der Begriff in dieser Arbeit verwendet wird, bezieht er sich auf Hindernisse, welche Menschen die gleichberechtigte Teilhabe an einem oder mehreren Lebensbereichen erschweren oder verwehren. Dies kann beispielsweise die Bordtoilette in vielen Flugzeugen sein, welche für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht nutzbar ist, weil kein Bordrollstuhl zur Verfügung steht und dieser auch nicht durch die Türe passen würde. Oder eine Sprachbarriere, auf die nicht nur gehörlose, sondern auch hörende Menschen (z.B. im Auslandsurlaub) stoßen. Es gibt finanzielle Barrieren, die es sozialschwächeren Familien erschweren, ihren Kindern Zugang zu Musik- oder Sportvereinen zu gewähren. Hinzu kommen weniger offensichtliche Barrieren, wie z.B. Internetseiten, zu deren Bedienung man unbedingt eine Maus benötigt. Da viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen diese aber nicht bedienen können, sollten alle Angebote einer Webseite auch mit der Tastatur nutzbar sein, um als barrierefrei gelten zu können.
Auf Barrieren kann man demnach in allen Lebensbereichen treffen, auch als Nicht- Behinderter. Menschen mit Behinderungen stoßen allerdings wesentlich häufiger auf Barrieren. Der Begriff „Behinderung“ wird laut § 2 Abs. 1 SGB IX wie folgt definiert:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“
Denkt man nun speziell an Barrieren im öffentlichen Raum für Menschen mit Behinderungen oder betrachtet Broschüren zu diesem Thema, trifft man häufig zuerst auf die Gruppe der Rollstuhlfahrer (vgl. Böhringer 2003, 46). Eine für Rollstuhlfahrer unüberwindbare Treppe stellt für viele Menschen den Prototyp einer Barriere im öffentlichen Raum dar. Der Rollstuhlfahrer wird landläufig gerne als Prototyp aller Menschen mit Behinderungen gesehen. Dies wird unter anderem darin deutlich, dass als Symbol für Menschen mit Behinderungen, wie man es z.B. an Toiletten oder Parkplätzen findet, das Piktogramm eines Rollstuhlfahrers gewählt wurde. Da der Fokus vieler Menschen in Entscheidungspositionen auf Barrieren für Rollstuhlfahrer liegt, wurden diesbezügliche Barrieren in den vergangenen Jahren großenteils beseitigt. Treppen und hohe Stufen wurden im Zuge von Umbaumaßnahmen nachträglich oder bei Neubauten von vornherein durch geeignete Rampen ergänzt, um einen barrierefreien Zugang für diese Personengruppe zu ermöglichen. Ich werde in der vorliegenden Arbeit aufzeigen, dass es allerdings eine große und wachsende Gruppe von Menschen gibt, die in ihrem Alltag auf spezielle Barrieren stoßen, die der Gesellschaft allgemein und speziell auch den Personen, welche den öffentlichen Raum gestalten, noch weniger bekannt sind. Es wird deutlich werden, dass diese visuellen Barrieren allgegenwärtig sind, und dass deren Beseitigung allen Menschen dient.
1.2 Barrierefreiheit
Der angestrebte Idealzustand (zugegebener Maßen eine Utopie) ist die völlige Abschaffung aller Barrieren, also die Barrierefreiheit. „Es bedeutet nicht trennend, nicht zu behindern, also eine Hindernisfreiheit“ (Hohenester/Linhart-Eicher 2001, 6).
Das Thema barrierefreies Gestalten des öffentlichen und städtischen Raumes wird schon länger diskutiert. So trafen sich beispielsweise im Mai 1995 Vertreter aus verschiedenen europäischen Städten in Barcelona, um den Europäischen Kongress „Die Stadt und die Behinderten“ abzuhalten. Abschließend formulierten sie die so genannte „Barcelona Erklärung“. Darin werden „Standards zur Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten für behinderte Menschen in den und durch die Kommunen“ (Aktion Mensch e.V., Aktion Grundgesetz) gesetzt.
Die Vereinbarung fünf der Erklärung fordert, dass die Kommunen „Personen mit Behinderungen Zugang zu allen [ ] Informationen über die städtische Gemeinschaft und das Gemeinwesen“ ermöglichen. In der Vereinbarung sechs wird der Zugang „zu Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten und allgemein zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde“ gefordert (ebd.). Unter zehntens verständigten sich die Kongressteilnehmer darauf, dass die Kommunen öffentliche Plätze und Gebäude für Menschen mit Behinderungen umgestalten (vgl. ebd.). Die elfte Vereinbarung besagt, „dass sich Personen mit Behinderungen ohne Einschränkung ihrer Mobilität in der Stadt bewegen können“ (ebd.). Unter 17. wird eine „Vereinheitlichung und Verallgemeinerung von Reglements und Vorschriften sowie der Verbreitung von Zeichen und Symbolen und anderen Informationsträgern für jeden Behinderungstyp“ angestrebt (ebd.). Viele Städte nahmen diese Erklärung an, wie beispielsweise die Stadt Granz im April 1997 (Hohenester/Linhart-Eicher 2001, 5).
Nur wenige Monate nach der Barcelona Erklärung, im September 1995, fasste der Gemeinderat der Stadt Heidelberg einen Grundsatzbeschluss zu barrierefreiem Bauen. Städtischer Hoch- und Tiefbau, Ampelanlagen und Freiflächen sind demnach barrierefrei zu bauen; falls dies im Einzelfall nicht oder nur teilweise umgesetzt wird, muss es begründet werden. Bei nichtstädtischen Bauvorhaben gelten die Regelungen der Landesbauordnung und der DIN (vgl. Amt für Soziale Angelegenheiten und Altenarbeit Heidelberg, 27).
Böhringer zitiert einen Entwurf für ein Bundesgleichstellungsgesetz für behinderte Menschen: Laut diesem Papier herrscht Barrierefreiheit, wenn alle Menschen Zugang zu den gestalteten Lebensbereichen haben, diese auf die übliche Weise und, soweit dies technisch möglich ist, eigenständig nutzen können (vgl. Böhringer 2002, 6). Dieses Gesetz trat am 1. Mai 2002 unter der Bezeichnung „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (Behindertengleichstellungsgesetzt, BGG) in Kraft. In §4 definiert es Barrierefreiheit schließlich folgendermaßen:
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ (Bundesministerium der Justiz).
§8 BGG schreibt vor, dass „zivile Neubauten sowie große zivile Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes“ und „sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr“ barrierefrei zu gestalten sind (ebd.).
Auf Landesebene in Baden-Württemberg übernimmt das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (L-BGG) vom Juni 2005 in §7 die 8 Vorschriften des Bundes zur „Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr“ (Sozialministerium Baden-Württemberg).
Trotz aller Bemühungen wird es nie gelingen, alle Barrieren im öffentlichen Raum vollständig aufzuheben. Finanzielle Gründe dürfen hierbei allerdings nicht ausschlaggebend sein, und es wird gezeigt werden, dass sie es bei guter Planung auch nicht sein müssen. Beispielsweise entstehen aber häufig Konflikte, wenn die Interessen des Denkmalschutzes hinsichtlich Erhalt von Erscheinungsbild, Baustruktur und Substanz eines Gebäudes mit Bemühungen wetteifern, das gleiche Gebäude mit einem barrierefreien Zugang auszustatten (vgl. Hohenester/Linhart- Eicher 2001, 66). Vor allem in historisch gewachsenen Altstädten lassen sich nötige Veränderungen oft nur schwer umsetzen, da z.B. in engen Gassen häufig ein Platzproblem herrscht oder das Ersetzen der Pflastersteine durch Asphalt aus ästhetischen Gründen nicht erwünscht ist. Ich beziehe mich wieder auf die Gruppe der Rollstuhlnutzer, wenn ich anführe, dass man aus Umweltschutzgründen z.B. nie alle Waldwege und Aussichtspunkte rollstuhlgerecht ausbauen wird.
Ein weiteres Problem ergibt sich dort, wo die Bedürfnisse verschiedener Gruppen bezüglich einer barrierefreien Umgestaltung des öffentlichen Raumes aufeinanderprallen und sich widersprechen. Ein leidiges Paradebeispiel hierfür ist der Konflikt zwischen Rollstuhlfahrern und Sehgeschädigten bezüglich der Bordsteinabsenkung (vgl. Böhringer in Stemshorn 1994, 357-358). Die eine Gruppe würde von einer völligen Einebnung des öffentlichen Verkehrsraumes profitieren. Für die andere Gruppe würde dies den Verlust von elementaren taktilen Orientierungspunkten im Straßenverkehr bedeuten und somit eine lebensbedrohliche Gefahr darstellen. Um beiden Gruppen gerecht zu werden, gilt eine Bordsteinhöhe von drei Zentimetern als angemessen, da Sehgeschädigte, die auf dem Langstock angewiesen sind, diese Höhe gerade noch taktil wahrnehmen können und Rollstuhlfahrer sie gerade noch überwinden können.
2. Wahrnehmung visueller Informationen
Bei der Orientierung in unserer Umwelt nehmen wir bis zu 90 Prozent der Informationen visuell auf (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 15). Dabei müssen wir ständig aus einer unendlichen Flut an Reizen diejenigen herausfiltern und auswerten, welche in der jeweiligen Situation für uns bedeutsame Informationen beinhalten. Wir gleichen dabei die neuen Eindrücke mit unseren Vorkenntnissen, Erwartungen und Hypothese ab. Bereits Goethe formulierte: „Ein jeder hört nur, was er versteht.“ Analog dazu nimmt man auch Dinge visuell leichter wahr, die man kennt oder erwartet oder einordnen kann (vgl. Echterhoff in Böhringer 2003, 97). Gelingt dieser Vorgang, sind wir mobil und können selbstständig unseren Alltag bestreiten. „Übersehen“ wir wichtige Informationen, das heißt wir sehen sie, nehmen sie aber nicht wahr, so verlieren wir die Orientierung oder geraten gar in gefährliche Situationen (vgl. Krug 2011, 105).
Es gibt bestimmte allgemeine Faktoren, welche die visuelle Informationsaufnahme beeinflussen können. Die im Folgenden beschriebenen Elemente sollten bei der Planung visueller Informationen berücksichtigt werden.
2.1 Prinzip der geschlossenen Informationskette
Informationen müssen in Form einer geschlossenen Informationskette geplant werden. „Redundanz in Form von visuellen, akustischen und taktilen Informationen optimieren die Befriedigung des Informations- und Orientierungsbedarfs“ (Krug, 2001, 107). Diesem Prinzip folgend wird beispielsweise den Fahrgästen in vielen Bussen und Straßenbahnen die Betätigung der Haltewunschtaste optisch und zusätzlich akustisch mitgeteilt. Bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sollte eine geschlossene Trankportkette entstehen, besonders insbesondere wenn mehrere Verkehrsmittel nacheinander genutzt werden, um ein Fahrziel zu erreichen. Nicht nur Sehbehinderte profitieren davon, wenn diese geschlossene Trankportkette von einer auf sie bezogenen geschlossenen Informationskette begleitet wird (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 35).
Anforderungen an geschlossene Informationsketten sind (vgl. ebd.):
- Beständigkeit von Zielangaben
- Beständigkeit von Erläuterungen
- Beständigkeit von Zwischenzielen
- Beständigkeit von Zielen
- fortlaufendes Einhalten von Prinzipien der räumlichen Anordnung
- fortlaufendes Einhalten von Gestaltprinzipien innerhalb einer geschlossenen Informationskette
- Verwendung identischer Piktogramme sowie identischer Abkürzungen
2.2 Prioritätenmodell
Je nach Wichtigkeit kann man durch Anordnung und Gestaltung Informationen nach Prioritäten abstufen, denn nicht jeder visuellen Information muss die höchste Stufe an Helligkeit, Leuchtdichte, Farbkontrast oder Größe zugewiesen werden. So werden z.B. die Notausgänge in Gebäuden auffällig gekennzeichnet, die Türe einer Putzkammer wird aber weit weniger auffällig beschriftet. Informationen werden nach ihrer Priorität in drei Stufen eingeteilt:
Priorität 1 erhalten Informationen, die vor Gefahren warnen und Hinweise für Notfälle geben. Dies betrifft beispielsweise die oben erwähnten Kennzeichnungen von Notausgängen und Rettungswegen, Hinweise auf Baustellen und Hindernisse mit Stolpergefahr.
Priorität 2 erhalten Informationen mit Entscheidungsfunktionen, wie Fahrpläne, Hinweis- und Informationstafeln.
Priorität 3 erhalten Informationen mit Leitfunktion, wie die Kennzeichnung von Routen oder die Wiederholung von Informationen, für deren Erkennen ausreichend Zeit zur Verfügung steht oder Alternativen vorhanden sind (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 38-39).
2.3 Kontraste
Da Kontraste zusammen mit beispielsweise der Farbgebung und der Form eine wesentliche Komponente der Gestaltung visueller Informationen darstellen, möchte ich die einzelnen Kontraste kurz definieren:
Wenn sich zwei angrenzende Flächen in Helligkeit und/ oder Farbe unterscheiden, wird dies als Kontrast empfunden (vgl. Lindner in Bundesministerium für Gesundheit 1996, 115). Es wird hauptsächlich zwischen Leuchtdichtekontrast (photometrischer Kontrast) und Farbkontrast unterschieden (vgl. ebd., 22ff). Weiter gibt es noch physiologische Kontraste.
2.3.1 Leuchtdichtekontrast (photometrischer Kontrast)
Die Leuchtdichte ist die von einem Objekt reflektierte, also der Wahrnehmung zur Verfügung stehende Helligkeit. Sie wird in Candela pro Quadratmeter (cd/m2 ) gemessen (vgl. Krug 2001, 115). Der Leuchtdichtekontrast oder photometrische Kontrast gibt an, wie stark sich ein Objekt und dessen Hintergrund in ihrer Helligkeit unterscheiden. Leicht nachvollziehbar ist dies bei Schwarz-Weis-Kopien: Wenn man zwei ehemals farbige Flächen auf der Kopie noch gut unterscheiden kann, war der Leuchtdichtekontrast der Farben hoch genug; kann man keinen Unterschied mehr erkennen, so war er zu gering. Den Leuchtdichtekontrast K zwischen einem Objekt und dessen Hintergrund kann man mit folgender Formel berechnen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LO ist dabei die Leuchtdichte des Objekts, LS die des Hintergrundes. Man erhält Werte zwischen den Maximalwerten -1 und +1. Ein positiver Wert ergibt sich, wenn das Objekt heller ist, als der Hintergrund, ein negativer Wert im gegenteiligen Fall. Es ist dem Auge größtenteils egal, ob der Hintergrund heller ist als das Objekt oder umgekehrt. Eine Ausnahme besteht z.B. bei der Gestaltung von Schrift (siehe betreffendes Kapitel). Wichtig ist, dass ein ausreichender Unterschied zwischen den Leuchtdichten besteht und dass das Objekt dadurch zu erkennen ist. Darum wird normalerweise der absolute, positive Wert des Unterschieds der Leuchtdichten angegeben (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 23ff). Somit beschreibt ein Wert von 1,0 den höchsten Leuchtdichtekontrast. Einen Wert von 0 erhält man, wenn kein Kontrast vorliegt.
2.3.2 Farbkontrast
Unabhängig vom Leuchtdichteunterschied können sich Objekte auch durch ihre Farbe vom Hintergrund abheben. Diese Farbkontraste können Menschen mit Farbsinnstörungen häufig nicht nutzen, da beispielsweise Menschen mit der am häufigsten auftretenden Rot/Grün-Störung die beiden Farben als Grautöne wahrnehmen. Sie können diese daher nur anhand von Leuchtdichteunterschieden unterscheiden (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 25). Das bedeutet, dass z.B. ein rotes Piktogramm auf einem grünen Hintergrund überhaupt nicht gesehen wird, wenn die beiden Farbtöne dieselbe Leuchtdichte besitzen. Interessant ist, dass leichte Farbkontraste auch durch die Farbsättigung ein und derselben Farbe erzeugt werden können.
2.3.3 Physiologischer Kontrast
Weiter gibt es noch Phänomene, bei denen die Netzhaut Kontraste verstärkt. Man nennt dies physiologische Kontraste. Deutlich wird dieses Phänomen, wenn man dieselbe graue Fläche vor einem schwarzen und zum Vergleich vor einen weißen Hintergrund platziert: Vor dem schwarzen Hintergrund wirkt sie heller als vor dem weißen. Wie man Helligkeit empfindet, hängt also von der jeweiligen Umgebung sowie bei Sehgeschädigten zusätzlich von individuellen körperlichen Gegebenheiten ab (vgl. Krug 2001, 115).
3 Beschreibung des Personenkreises
3.1 Definition des Begriffs Sehschädigung
Der Bereich der Sehschädigungen ist vielfältig. Unter diesem Oberbegriff werden sozialrechtlich und ophthalmologisch „die verschiedenen Ausprägungsgrade von Seheinschränkungen“ zusammengefasst (Krug 2001, 15). Sie werden unter anderem mit den Begriffen Sehbehinderung, hochgradige Sehbehinderung und Blindheit beschrieben (vgl. Walthes 2003, 51).
Die Sehschärfe (Visus), genauer der Fernzentralvisus nach optimaler Refraktionskorrektur, wird als Hauptkriterium für die Klassifikation von Sehschädigungen genutzt (vgl. Hofer 2008, 28; Krug 2001, 15; Walthes 2003, 51). Der Visus lässt sich mit folgender Formel berechnen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Die Normalentfernung ist diejenige Entfernung, in der ein Sehzeichen einer bestimmten Größe mit einem Visus von 1,0 gerade noch erkannt werden kann“ (Walthes 2003, 51).
Ebenso werden Gesichtsfeldeinschränkungen berücksichtigt. Es gibt beispielsweise Menschen mit stark eingeschränktem Gesichtsfeld < 5°, die als blind gelten, daher Blindengeld beziehen und im Alltag auf Blindentechniken angewiesen sind, aber scharf sehen können und z.B. Kleingedrucktes (in Schwarzschrift) ohne Hilfsmittel lesen können. Dies kann bei unwissenden Passanten, die einen Langstocknutzer z.B. beim Studieren eines kleinen Fahrplans beobachten, zu Irritationen führen.
Als grobe Faustregel lassen sich Sehschädigungen in die oben genannten drei Gruppen einteilen, wobei Menschen mit einem Visus von 0,3 bis 0,05 (30-5% Sehschärfe) sehbehindert genannt werden. Hochgradige Sehbehinderung wird an einem Visus von 0,05 bis 0,02 (5-2%) festgemacht. Bei einer Sehschärfe kleiner 0,02 (<2%) spricht man von Blindheit (vgl. Nenning, in Böhringer 2003, 18). Gemessen wird jeweils nach bestmöglicher Refraktion auf dem besseren Auge.
Etwas differenzierter werden Sehschädigungen in Deutschland auch in fünf Gruppen eingeteilt, die sich auf die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (1984) und den Deutschen Bildungsrat (1973) beziehen (vgl. Rath 1987, 19-20). Diese Einteilung wird auch heute noch genutzt (vgl. Hofer 2008, 28; Krug 2001, 16; Walthes 2003, 51). Sie lautet folgendermaßen:
- Gruppe 1
Gröbere einseitige Einschränkung des Sehvermögens (der Sehschärfe):
1. Auge mind. 1,0 2. Auge 0,3 und weniger
- Gruppe 2
Mäßige beidseitige Einschränkung des Sehvermögens:
1. Auge 0,7-0,4
- Gruppe 3
Sehbehinderung:
1. Auge 0,3-0,067
- Gruppe 4
Hochgradige Sehbehinderung:
1. Auge 0,05 (1/20)-0,03 (1/35)
- Gruppe 5
2. Auge 0,7-0,4
2. Auge 0,3 und weniger
2. Auge 0,05 und weniger
Blindheit oder der Blindheit gleichzustellen:
auf dem besseren Auge 0,02 (1/50) und weniger Ergänzt wird, dass eine Verschlechterung des Sehvermögens zusätzlich durch „Ausfälle des Gesichtsfeldes und Störungen des Licht- oder Farbsinns sowie der Augenbeweglichkeit“ bedingt werden kann (Rath 1987, 19-20). Diese Ausfälle werden im folgenden Schaubild mit einbezogen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Graphische Darstellung der Einteilung von Funktionseinschränkungen des Sehens (ebd.)
Detaillierte Angaben zur Einstufung der Sehschädigungen nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen findet man in der „Anlage zu §2 der Versorgungsmedizin-Verordnung vom 10. Dezember 2008“. Dort werden den einzelnen Schädigungen (z.B. Gesichtsfeldeinschränkungen, Augenmuskellähmungen, Lähmungen des Oberlides, Verlust des Auges, usw.) die Grade der Schädigungsfolgen (GdS) bzw. die Grade der Behinderung (GdB) zugeteilt. Die Versorgungsämter beziehen sich darauf, z.B. bei der Vergabe der Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis.
Das „dreidimensionale Faktorenmodell des funktionalen Sehvermögens“ nach A. L. Corn bezieht noch mehr Variablen zur Klassifikation von Sehfunktionseinbußen mit ein:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Dreidimensionale Faktorenmodell des funktionalen Sehvermögens nach Corn (Rath 1987, 24)
Neben den visuellen Fähigkeiten wie Sehschärfe und Gesichtsfeld, welche den bisher genannten Einteilungen zugrunde liegen, werden hier vielfältige individuelle Voraussetzungen sowie visuelle Außenreize, also externe Faktoren berücksichtigt. Die unzähligen Möglichkeiten der Beziehungen und Gewichtungen der einzelnen Variablen verdeutlichen die Komplexität und Individualität der verschiedenen Sehschädigungen.
Die neuere „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet Behinderungen des Sehens ebenfalls umfassend. Wie im folgenden Schaubild zu sehen ist, klassifiziert die ICF Körperstrukturen, Körperfunktionen, sowie Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe). Die Kategorien stehen in gegenseitiger Wechselwirkung. „Zusammengenommen ergibt sich daraus eine mögliche Festlegung der Aktivität und Teilhabe eines Menschen mit seinen vorhandenen Ressourcen, Problemen und Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen“ (Hofer in Lang 2008, 33).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (ICF 23)
Für die vorliegende Untersuchung bedeutsam sind hierbei die Umweltfaktoren. Sie bilden „die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (ICF, 123). Im Dreidimensionalen Faktorenmodell nach Corn werden, auf Sehschädigung bezogen, „visuelle Außenreize“ genannt. Dazu zählen Farbe, Kontrast, Zeit, Raum und Beleuchtung (siehe Abbildung 2). Bei der ICF finden sich unter „natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt“ z.B. auch Lichtintensität (e2400) und Lichtqualität (e2401) (ICF, 131). Der Bereich der Umweltfaktoren ist der Punkt, an dem diese Arbeit zu Barrierefreiheit durch Verbesserung visueller Informationen ansetzen möchte, denn zumindest der von Menschen geschaffene Teil der materiellen Welt ist veränderbar. Die Umweltfaktoren beziehen sich jeweils auf die Person, deren Situation beschrieben werden soll. Ob ein Umweltfaktor einen Förderfaktor oder eine Barriere darstellt, hängt demnach von der jeweiligen Person ab. Genannt wird hier das oben erwähnte Beispiel von dem Konflikt zwischen Rollstuhlfahrern und Blinden bezüglich Bordsteinabsenkungen, auf das ich noch eingehen werde (vgl. ICF, 123). Ich werde aufzeigen, dass es auch innerhalb der Gruppe der Sehbehinderten zu Konflikten kommen kann, da nicht alle Sehbehinderten die gleichen Bedürfnisse bezüglich der Gestaltung visueller Informationen haben.
3.2 Vielfalt der Augenerkrankungen
Es gibt viele verschiedene Augenerkrankungen, die eine Sehschädigung zur Folge haben. „Die Ursachen für diese Schädigungen sind vielfältig, sie lassen sich grob in hereditäre (vererbte), genetisch-, stoffwechsel- und umweltbedingte, aber auch in prä-, peri- und postnatale Schädigungsformen einteilen“ (Walthes 2003, 51). Der Ort der Schädigung, die durch Erkrankung oder Alterung entstand, kann im vorderen Bereich des Auges, im mittleren oder im hinteren liegen. Ferner kann die Weiterleitung der Seheindrücke durch den Sehnerv oder deren Verarbeitung im Gehirn gestört sein.
Je nach Erkrankung haben die Betroffenen gegebenenfalls unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich der Gestaltung visueller Informationen. So darf beispielsweise Schrift für Personen mit stark eingeschränktem Gesichtsfeld aber gutem Visus, nicht zu groß sein, da sie sonst nur Teile eines einzelnen Buchstabens, aber keine ganzen Silben auf einmal sehen können. Im Gegensatz dazu benötigen Menschen mit schlechter Sehschärfe vergrößerte Schriftzeichen, um lesen zu können.
Stellvertretend möchte ich eine häufig auftretende Augenkrankheit herausgreifen: Tabelle 1 zeigt das Sehverhalten einer Person im Frühstadium einer degenerativen Netzhauterkrankung (Retinopathia Pigmentosa) in verschiedenen Situationen. Es wird deutlich, dass der Betroffene bei geeigneter Beleuchtung und gutem Kontrast Sehendentechniken nutzen kann; im ungünstigen Fall müssen aber Sehbehindertenund sogar Blindentechniken angewendet werden:
Tabelle 1: Das Sehverhalten einer Person mit einer degenerativen Netzhauterkrankung (Retinopathia Pigmentosa) (nach Hyvärinen 2001, aus Walthes 2003, 52).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Allgemein kann man festhalten, dass sehbehinderte Menschen in unserer Gesellschaft keine vernachlässigbare Minderheit sind. Die demographische Entwicklung lässt darauf schließen, dass die Zahlen weiter ansteigen werden, denn das Risiko einer Sehbehinderung steigt mit dem Alter (vgl. Nenning in Böhringer 2003, 25). Genaue Zahlen über sehbehinderte Menschen lassen sich nur schwer erheben. Die Schätzungen reichen von einer Million bis zu 4,5 Millionen Betroffener in Deutschland (vgl. Rühlemann in Böhringer 2003, 71; Lindner ebd., 75). Wie gesagt treten Sehschädigungen im Alter häufiger auf. Bereits jeder vierte Deutsche über 65 Jahren (vgl. Nenning in Böhringer 2003, 16) leidet an einer solchen Informationsbehinderung (vgl. ebd., 18).
Dass eine optimale, also möglichst barrierefreie visuelle Gestaltung der Umwelt sehr bedeutsam ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass sich vier Fünftel der sehbehinderten Menschen hauptsächlich visuell orientieren (vgl. Loeschcke in Böhringer 2002, 122). Hinzu kommen normalsichtige Menschen, denn laut Echterhoff sind auch Personen, die in Eile sind oder unter Stress stehen, in dieser Situation sehbehindert (vgl. Echterhoff in Böhringer 2003, 96). Ich werde noch auf diese Erweiterung des Kreises derer, die von besser gestalteten visuellen Informationen profitieren, eingehen.
4 Visuelle Barrieren
Was mit Barrieren und Barrierefreiheit im Allgemeinen gemeint ist, wurde bereits skizziert. Ich möchte nun zum Kern dieser Arbeit, zur Barrierefreiheit im Bezug auf visuelle Barrieren übergehen. Visuelle Barrieren sind Hindernisse visueller Art. Durch schlechte Planung und Gestaltung können visuelle Informationen so dargeboten sein, dass sie von bestimmten Menschen nicht, nur teilweise oder deutlich langsamer wahrgenommen werden können. Somit erschweren visuelle Barrieren die Teilhabe an bestimmten Lebensbereichen oder bringen Menschen sogar in gefährliche Situationen.
Im folgenden Kriterienkatalog gebe ich Empfehlungen und Forderungen wieder, die zu einer Verbesserung der Wahrnehmung visueller Informationen im öffentlichen Raum führen. Selbstverständlich muss damit zuerst bei der einzelnen Person begonnen werden, indem beispielsweise durch Hilfsmittel, wie z.B. Brillen oder Lupen, die Sehleistung soweit als möglich verbessert wird. Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, muss die Umwelt entsprechend angepasst werden (vgl. Krug 2001, 114).
4.1 Verbesserte visuelle Informationen nützen allen
Bedenkenswert ist, dass von den Verbesserungen nicht allein Sehbehinderte Menschen profitieren, die häufig wegen ihrer Orientierungsprobleme ihren Aktionsbereich einschränken, um Unsicherheiten und Unfälle zu vermeiden (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 6). Ich erwähnte bereits Herrn Prof. Echterhoff, der auch Personen als sehbehindert bezeichnet, „die in Eile sind oder die unter Stress stehen“ (Echterhoff in Böhringer 2003, 96). Wann immer Entscheidungen getroffen werden, müssen daher visuelle Informationen gut, das heißt klar und leicht verständlich gestaltet sein. Dann erreicht z.B. der gehetzte Geschäftsmann sein Ziel schneller. Rettungswege und Notausgänge werden im Notfall besser gefunden, und Helfer können sich im Notfall schneller orientieren und somit schneller am Unfallort sein. In Extremsituationen wie Gedränge oder gar (Massen-) Panik sowie bei Schneefall, Nebel oder nächtlichem Stromausfall ist die Sicht stark eingeschränkt (vgl. Bolay in Stemshorn 1994, 345), sodass selbst Normalsichtige in ihrem Sehen behindert, also sehbehindert sein können. „Die Überlegungen, wie eine Fußgängerverkehrsfläche für Blinde und Sehbehinderte sicherer gestaltet werden kann, tragen also entscheidend dazu bei, sie auch für Nichtbehinderte unfallärmer zu machen“ (ebd.).
Weiter zählen zu den mobilitätseingeschränkten Personen, die von verbesserten Informationsangeboten profitieren, immer mehr ältere Menschen, kleine Kinder, Schwangere, Menschen mit Kinderwagen oder Gepäck sowie vorübergehend eingeschränkte Menschen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 131). Man bezeichnet „barrierefreies Bauen“ daher vermehrt auch als „lebenslagengerechtes Bauen“ und schließt so auch Behinderungen mit ein, die nicht dauerhaft sind oder die in bestimmten Lebensphasen eintreten können (vgl. Tinnes 2007,170). In einem konkreten Beispiel behindert ein Kinderwagen mit zwei weinenden Kindern das Elternteil in vergleichbarem Maße dabei, schnell und gefahrlos einen Weg zurück zu legen, wie dies auch eine Augenmuskellähmung oder eine Visusminderung tun könnte. Böhringer (in Stemshorn 1994, 359) nennt die genannte Personengruppe zusammenfassend die „schwächeren Verkehrsteilnehmer“. An anderer Stelle spricht er von den „Normalbehinderten“ (2003, 51). Ich finde, dies verdeutlicht treffend, dass jeder Mensch mal mehr und mal weniger behindert und somit mal mehr und mal weniger auf optimal gestaltete visuelle Informationen angewiesen ist.
4.2 Finanzierung
Die häufig geäußerte Kritik bezüglich der Finanzierbarkeit ist ungerechtfertigt, denn bezieht man rechtzeitig, also bereits in der Planungsphase der Bauvorhaben, die barrierefreie Gestaltung mit ein, ergeben sich „kaum nennenswerte Mehrkosten“ (König 1997, 8). Außerdem sind, wie oben erläutert, keine isolierten Speziallösungen zu bezahlen, sondern Verbesserungen für die Allgemeinheit. In der folgenden Untersuchung in der Stadt Heidelberg werden Bespiele dafür aufgezeigt werden, dass nachtägliche Baumaßnahmen mit teils erheblichen Mehrkosten verbunden sind und es daher sinnvoller ist rechtzeitig an Barrierefreiheit zu denken.
5. Kriterienkatalog
Besonders wichtig sind optimal gestaltete visuelle Informationen an Orten, an denen folgende Voraussetzungen vorliegen:
- „Hohes Sicherheitsbedürfnis, insbesondere der Sehbehinderten (z.B.
Fahrbahnüberweg und Verkehrsinseln für Fußgänger, Bahnsteige, Treppen, Baustellen und andere gefährdende Hindernisse: Straßenund Bahnhofsmöbel, Absperr- und Schutzgitter, Werbeträger, Masten aller Art in Verkehrsräumen, die für Fußgänger zugänglich sind, insbesondere auf Gehwegen),
- Eingeschränkte Übersichtlichkeit des Straßenraumes bzw. öffentlich zugänglicher Gebäude (z.B. Fußgängerbereiche, große städtische Knotenpunkte, Mischflächen, große Plätze, große Hallen und Gebäudebereiche),
- Hoher Nutzungsbedarf, bzw. hohe Frequentierung von Bereichen, Einrichtungen und Objekten (z.B. Eingänge, Haltestellen, Bahnhöfe, Wartebereiche, Schalterbereiche, Telefonzellen, WC usw.) insbesondere für Behinderte, und
- dort, wo mehrere dieser Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen (so treffen z.B. auf Bahnhöfen und Umsteigeknoten des ÖPNV fast alle genannten Kriterien zu).“ (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 27).
Bei der Auswahl der untersuchten öffentlich zugänglichen Gebäude und Ort wurden diese Voraussetzungen berücksichtigt.
5.1 Grundsätzliche Empfehlungen für die Gestaltung
5.1.1 Kontrast
Mit dem Motto des Sehbehindertentags im Jahr 2000 Kontraste helfen schwachen Augen „wurde die berechtigte Forderung sehbehinderter Menschen zum Ausdruck gebracht, Farb- und Helligkeitskontraste als optimale Unterscheidungsmerkmale im öffentlichen Bereich verstärkt einzusetzen“ (Nenning, in Böhringer 2003, 18), da diese Menschen häufig unter verminderter Kontrastempfindlichkeit leiden, die medizinisch nicht ausreichend beseitigt werden kann. Ein Normalsichtiger kann beispielsweise bei Tageslicht Kontraste von K = 0,01 gerade noch erfassen. Der Schwellenkontrast bei Sehbehinderten liegt dagegen bei K = 0,28 bis 0,45 bei hellen Objekten auf dunklem Hintergrund und bei K = 0,45 bis 0,70 bei dunklen Objekten auf hellem Hintergrund (ebenfalls bei Tageslicht). Für Sehbehinderte und Normalsichtige sind Kontraste von ungefähr K = 0,9 optimal (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 116).
Die Tabelle 2 ordnet den drei Prioritäten empfohlene Kontrastwerte zu:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Empfehlungen für Kontrastwerte (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 42)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Herr Böhringer kritisiert diese Forderungen bezüglich der Kontrastwerte für die drei Prioritäten. Bei der Gestaltung schriftlicher Informationen würden in der Werbebranche aufgrund aufwendiger wahrnehmungspsychologischer Untersuchungen grundsätzlich hohe Kontraste verwendet. Es sei daher absurd, „schriftliche Informationen im öffentlichen Beriech bewusst kontrastarm zu gestalten, so dass sie unauffällig sind und leicht übersehen werden können“ (Böhringer 2002, 95-96). Gemeint ist damit, dass für Schriften und Piktogramme lediglich ein Kontrastwert von K > 0,50 empfohlenen wird, obwohl Sehbehinderte deutlich höhere Kontraste von ungefähr K = 0,9 (siehe oben) als optimal erleben. Damit sie möglichst vielen Sehbehinderte zugänglich sind, fordert Böhringer bei schriftlichen Informationen und Piktogrammen im öffentlichen Raum stets mit hohen Kontrasten von K 0,83 zu arbeiten. Damit stellt er das Prioritätenmodell in Frage. Persönlich kann ich Böhringers Kritik gut folgen: Zwar sind Informationen, die vor Gefahren warnen (Priorität 1), in der Tat wichtiger als Informationen mit Entscheidungsfunktion (Priorität 2), doch erscheint es auch mir fraglich, ob man letztere deshalb bewusst schlechter lesbar darstellen sollte.
5.1.2 Farben
Leuchtdichtekontraste sollten durch Farbkontraste unterstützt werden. Dies gelingt am besten, wenn auf Farbkombinationen mit geringen Leuchtdichteunterschieden verzichtet wird [z.B. Weiß und Gelb (Hell/Hell), Blau und Schwarz (Dunkel/Dunkel)]. Hilfreich sind dagegen Farbkombinationen mit hohen Leuchtdichteunterschieden (wie z.B. Schwarz auf Weiß), die Verwendung einer unbunten Komponente (z.B. Weiß, Schwarz, Grau), die Kombination von Komplementärfarben (z.B. Gelb auf Blau) und die Verwendung von Rot als ausschließlich dunkle Komponente (z.B. Weiß auf Rot), damit das hellere Zeichen auch von Menschen mit Rot/Grün-Störung erkannt wird (Bundesministerium für Gesundheit, 1996 27-28). Rot und Grün sollten nie kombiniert werden.
In der folgenden Tabelle 3 werden einige Farbkombinationen empfohlen und den jeweiligen Prioritäten zugeordnet:
Tabelle 3: Empfehlungen für Farbkombinationen (Bundesministerium für Gesundheit, 1996, 40)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.3 Helligkeit
Um die Aufmerksamkeit zu erwecken, bedürfen visuelle Informationen einer gewissen Mindestleuchtdichte - nur dann werden Kontraste wahrgenommen. Für Sehbehinderte optimal ist eine gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung von 100 bis 500 cd/m2 (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 41-42). Auch die Oberfläche der Zeichen und Markierungen selbst muss eine gewisse Helligkeit aufweisen. Blendungen durch zu viel Licht sind zu vermeiden. In der Tabelle 4 werden den drei Prioritäten verschiedene Leuchtdichtewerte zugeordnet und Beispiel gemacht:
Tabelle 4: Leuchtdichten auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen (ebd.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.4 Schrift
Bei der Gestaltung von Schrift wird auf die DIN 1450 verwiesen. Dort wird eine Linienbreite der Zeichen von 1/7 bis 1/8 der Schriftgröße gefordert. Der Zeichenabstand sollte ebenfalls je nach Schrift ca. 1/7 betragen. Der Abstand zwischen den Worten sollte mindestens 3/7 der Schriftgröße ausweisen, der Zeilenabstand ca. 11/7. Eine Zeile sollte nicht mehr als 65 Zeichen enthalten. Wichtig ist es, serifenlose, also schnörkellose Schriftarten zu wählen (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 31-32). Die Lesbarkeit wird auch erhöht, wenn grundsätzlich die Groß- und Kleinschreibung angewandt wird. Besonders bei Schildern wird diese Empfehlung häufig nicht berücksichtigt, indem alles in Großbuchstaben geschrieben wird.
Der Tabelle 5 kann man empfohlene Schriftgrößen entnehmen. Je nach Wichtigkeit der Informationen muss man sie aus bestimmten Entfernungen lesen können. Der 26 Grundsatz „je größer, desto besser“ trifft nicht grundsätzlich zu: Steht man z.B. direkt vor einem Schild mit sehr großer Schrift, tritt man automatisch so weit zurück, bis man es völlig überblicken und somit dessen Inhalt erfassen kann. Viele Menschen mit Gesichtsfeldeinschränkungen können ihre Leseentfernung allerdings nicht vergrößern, da sie zusätzlich unter einer Visusminderung leiden.
Tabelle 5: empfohlene Schriftgrößen (Bundesministerium für Gesundheit, 1996, 32)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgrund der geringeren Leuchtdichte im Umfeld sind helle Buchstaben auf dunklem Hintergrund (Positivkontrast) schlechter zu lesen als dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund] (Negativkontrast). Daher sollten helle Zeichen auf dunklem Hintergrund (z.B. weiße Schrift auf schwarz) um ca. 25 Prozent größer dargestellt werden als dunkle Zeichen auf weißem Hintergrund (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 1996, 28). Herr König verwirrt mit Untersuchungen der TU Dresden, die zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen seien als das Forschungsprojekt Kontrastoptimierung. Er macht dann aber exakt dieselbe Aussage, wie das Forschungsprojekt (vgl. König 1997, 83). Weiter empfiehlt er, Schrift nicht mit Grau- oder Pastelltönen zu unterlegen, da dies den Kontrast mindert (vgl. König 1997, 51). Auf Kursivschrift und Unterstreichungen sollte ebenfalls verzichtet werden (vgl. ebd. 83).
5.1.5 Form
Um die visuelle Informationsaufnahme zu erleichtern, sollten Objekte klare Formen haben, das heißt keine überflüssigen Details aufweisen (vgl. Krug 2001, 124). Dies betrifft auf der zweidimensionalen Ebene z.B. unnötige Serifen einiger Schriftarten (siehe oben). Wenn möglich sollten sich der Zweck und die Form eines Objektes aufeinander beziehen. Beispielsweise identifiziert man einen Papierkorb in Form eines Drachens, bei dem der Abfall durch das geöffnete Maul einzuwerfen ist (so gesehen in diversen Freizeitparks), schlechter als Papierkorb als Abfallbehälter in der gewohnten rechteckigen oder runden Form.
Besonders bei Dunkelheit sind auch normalsichtige Menschen auf klare Formen angewiesen, um Objekte zu erkennen, da die Zapfen bei schlechten Lichtverhältnissen nicht arbeiten und somit „die höchste Auflösungsfähigkeit der Makula entfällt“ (Bundesministerium für Gesundheit 1996, 17f). Ebenfalls sotten Objekte nicht zu groß gestaltet werden, da man sonst den Wald vor lauter B ä umen nicht sieht . Hinzu kommt, dass Sehbehinderte oft, wie oben beschrieben, aufgrund von Visusminderungen und/oder Gesichtsfeldeinschränkungen den Abstand zu Objekten, die sie betrachten möchten, nicht frei wählen können (vgl. Krug 2001, 124). Wenn beispielsweise in einem Gebäude die Nummern der Stockwerke im jeweiligen Foyer raumhoch als Reliefs im Putz dargestellt sind, kann man sie leicht übersehen, weil man sie nie mit genügend Abstand betrachten kann.
5.2 Informationsträger
Die Übersichtlichkeit eines Gebäudes oder einer Stadt hängt in erster Linie von baulichen Gegebenheiten ab. Zusätzlich dazu - und nicht stattdessen - sollten Schilder und Hinweistafeln eingesetzt werden. Sie sind die gebräuchlichste Form von Informationsträgern (vgl. Loeschcke in Böhringer 2002, 125). Informationen werden dort in Form von Schrift und Bildzeichen präsentiert. Schilder sollten sparsam angebracht werden, da ein Schilderwald zum einen unschön aussieht, zum anderen die einzelnen Schilder weniger beachtet werden und möglicherweise sogar eher verwirren, wenn die Informationsmenge nicht auf das Wesentliche reduziert ist (siehe Abbildung 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Absurder Schilderwald (Wikipedia)
Wie oben erläutert, werden hierbei keine Speziallösungen für Sehbehinderte angestrebt, sondern alle Schilder sollten optimal gestaltet werden, was auch Normalsichtigen die Informationsaufnahme erleichtert (vgl. Nill in Stemshorn 1994, 370).
Die Anforderungen an die allgemeine Gestaltung der Farb- und Leuchtdichtekontraste sowie der Schriftzeichen und Piktogramme wurden bereits in den jeweiligen Abschnitte oben beschrieben.
5.2.1 Piktogramme
Mit Piktogrammen können Informationen kürzer, also sowohl platzsparender als auch schneller wahrnehmbar dargestellt werden als durch Schrift. Mit Hilfe von Schrift fällt es allerdings leichter eindeutige Aussagen zu machen. Daher erzielt man mit einer Kombination von Schrift und Bildzeichen häufig die besten Ergebnisse. Am schnellsten erkennt man Zeichen, die man bereits kennt. Dies führt uns z.B. die Werbebranche täglich vor Augen. Ob man das Fastfood-Restaurant mit dem gelben „M“ schließlich betritt oder vorbei geht, bleibt einem selbst überlassen; erkannt hat man es jedenfalls, ob man wollte oder nicht, aufgrund der zahlreichen Vorerfahrungen mit diesem Firmenlogo. Bei Piktogrammen sollte immer die einfachste, unkomplizierteste Darstellung gewählt werden (vgl. Barker et al. 1995, 129). Die Darstellung einer hustenden Person, die drohend ihren Finger gegen ihren rauchenden Tischnachbarn erhebt, ist als Piktogramm einer durchgestrichenen Zigarette verständlicherweise deutlich unterlegen.
Im öffentlichen Bereich müssen sich Bildzeichen nach den DIN-Vorschriften richten (vgl. Krug 2001,124-125). Die Forderungen des Prinzips der geschlossenen Informationskette (siehe oben) nach fortlaufenden Gestaltungsprinzipien, in diesem Fall nach Verwendung identischer Piktogramme, werden dadurch flächendeckend erfüllt. Allerdings müssen diese teils international genutzten Zeichen auch optimal gestaltet sein. Im Handbuch [ ] zur Verbesserung von visuellen Informationen im öffentlichen Raum wird eine verbesserte Version des üblichen Piktogramms für die Kennzeichnung von Rettungswegen (Foto 1) gemäß DIN 66079 vorgestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Foto 1: Altes Piktogramm zur Kennzeichnung von Rettungswegen in Weiß auf Grün
Gemäß der vorgeschlagenen Farbkombinationen (siehe Tabelle 3) ist Weiß auf Grün der Priorität 2 zugeordnet. Für die Kennzeichnung der Rettungswege wird nun stattdessen Gelb auf Lila vorgeschlagen - eine Kombination, die der ersten Priorität zugeordnet ist (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 90-91). Außerdem wurde der Pfeil, welcher die Fluchtrichtung angibt vergrößert, was zusätzlich die Deutlichkeit der Aussage des Zeichens erhöht. Die bevorzugte Farbkombination Gelb auf Lila erhielt man durch Untersuchungen mit ca. 250 Sehbehinderten. Obwohl für die alte und die neue Kombination jeweils ein starker Kontrast von K = 0,99 angegeben wird, sei Gelb auf Lila zu bevorzugen, da das Grün in der Realität nicht so intensiv, der Kontrast dadurch schwächer sei (vgl. in Böhringer 2003, 109). Dieser Meinung sind auch die Teilnehmer einer Fachtagung, die davon ausgehen, dass der angegebene Kontrastwert von Weiß auf Grün auf die Messung unter Laborbedingungen zurück zu führen ist (vgl. Nagel in Böhringer 2002, 110). Mir stellt sich die Frage, inwieweit es praktikabel ist, die vorhandene und gewohnte Farbkombination zu ersetzen. Technisch möglich und sinnvoll wäre es sicherlich. Bedenken bezüglich einer Verwirrung durch verschiedene Farben in der Übergangszeit sind eher unbegründet. Ein Beispiel dafür, dass ein Farbwechsel durchaus funktioniert ist die Umstellung der Leitfarbe der Polizei in Baden- Württemberg von Grün auf Blau. Sie hat nicht zu einem Chaos geführt, auch wenn derzeit grüne und blaue Polizeiautos nebeneinander unterwegs sind. Allerdings wäre es besser überregional die Farben der Schilder zu wechseln. Die international einheitliche Gestaltung ist gerade bei Rettungswegkennzeichnungen äußerst hilfreich.
5.2.2 Anbringung
Auch wenn der Satz trivial klingt: Bevor man die Informationen eines Schildes entnehmen kann, muss das Schild zuerst gefunden werden. Dies stellt speziell für sehbehinderte Menschen oft ein Problem dar. Schilder sollten daher dort positioniert werden, wo man sie vermuten würde: das bedeutet „in a logical position“ (Barker et al. 1995, 123), und nicht etwa an einem Ort, an dem zufällig noch ein Platz dafür frei war. Diesen Eindruck machen beispielsweise die Bestimmungen bezügliche des Jugendschutzes, die in einigen Gaststätten an Stellen ausgehängt sind, an denen man sie kaum sehen kann.
Damit sie auch für Kinder, kleine Menschen und Rollstuhlfahrer erreichbar sind, sollten Hinweisschilder wie z.B. Fahrpläne in einer Höhe von ca. 1,30 m angebracht werden (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 1996, 69). Damit Langstockbenutzer freistehende Schilder oder Schaukästen rechtzeitig erkennen und sie nicht unterlaufen, müssen sie so aufgestellt sein, dass man nicht mit dem Langstock darunter geraten kann. Bei einer Bodenfreiheit von über 60 cm sind Langstocknutzer gravierend gefährdet (vgl. Bolay in Stemshorn 1994, 344); sie sollte deshalb möglichst nicht mehr als 30 cm betragen. Besser sind unten geschlossene Befestigungen, oder Schaukästen auf ausreichend großen und kontrastreichen Sockeln, die sowohl taktil mit dem Stock als auch visuell wahrnehmbar sind (vgl. Krug 2001, 128). Wenn Informationen zum Schutz hinter Glas angebracht werden, kommt es häufig zu weiteren Problemen für Sehbehinderte und Normalsichtige: Um Reflexionen zu vermeiden, dürfen nur entspiegelte Scheiben verbaut werden. Um den Gebrauch von Lupen zu ermöglichen, muss der Informationsträger direkt hinter dem Glas angebracht sein (vgl. König 1997, 83). Schon ein Abstand von wenigen Zentimetern, wie man ihn z.B. bei Vitrinen findet, verhindert die Nutzung von Lupen. Auch sollte die Bildung von Kondenswasser vermieden werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Moritz Döhner (Autor:in), 2011, Barrierefreiheit - Die Umsetzung visueller Informationen in der Stadt Heidelberg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185062
Kostenlos Autor werden












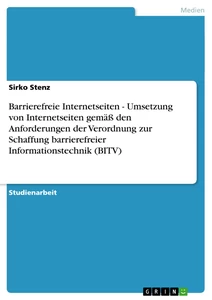

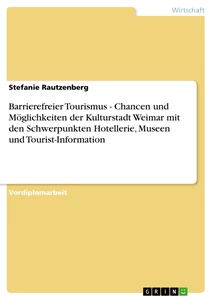
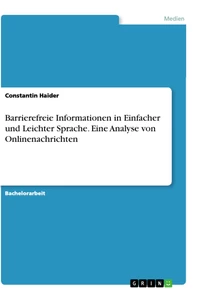


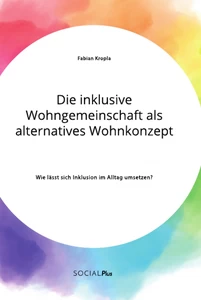
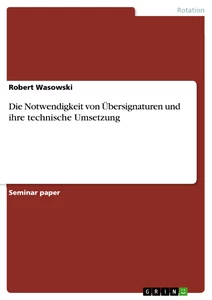
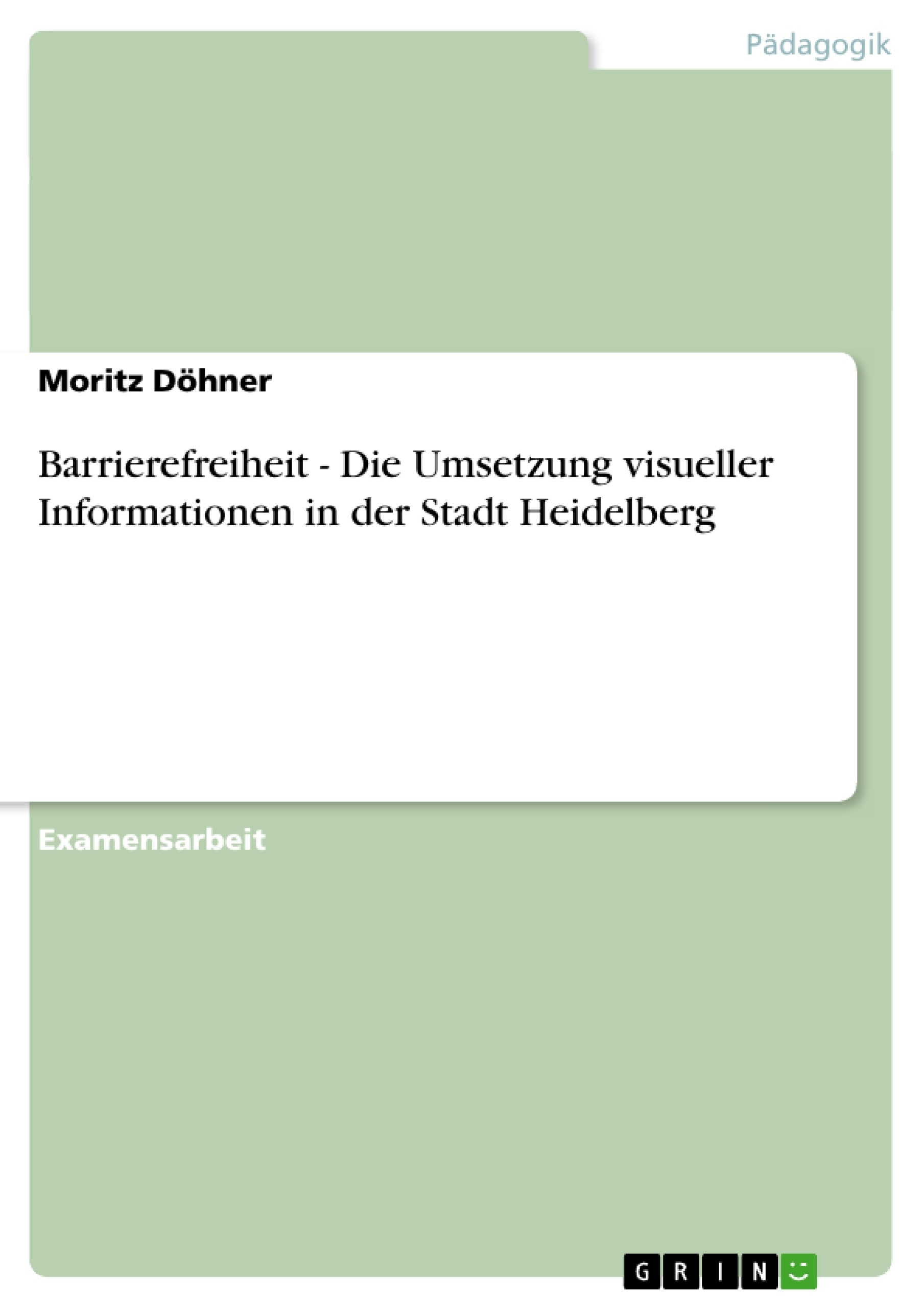

Kommentare