Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Beziehung
2.1 Der Mensch - vor und nach seiner Geburt
2.1.1 Die Wahrnehmungsentwicklung
2.1.2 Das Selbstempfinden
2.2 Die Bindungstheorie - ein Exkurs
2.2.1 Bindungstypen
2.2.2 Bindungsthesen
2.2.3 Kritik
2.3 Die Interaktion von Mutter und Kind
2.3.1 Erkenntnisse und Verlauf
2.3.2 Aufforderung zum Tanz
2.3.3 Wirkung und Auswirkung
3 Die Krise
3.1 Psychische Störungen im Wochenbett
3.1.1 Postpartale Dysphorie
3.1.2 Posttraumatische Belastungsstörung
3.1.3 Postpartale Psychose
3.2 Die Wochenbettdepression
3.2.1 Screening und Diagnose
3.2.2 Symptomatik
3.2.3 Befunde und quantitative Ursachenforschung
3.2.4 Hypothesen und qualitative Ursachenforschung
3.2.5 Ein neuer Ansatz
3.3 Die Interaktion in der Depression
3.3.1 Unmittelbare Auswirkungen auf das Kind
3.3.2 Langzeitfolgen
4 Die Therapie
4.1 Therapeutische Angebote
4.1.1 Erste Hilfen
4.1.2 Psychopharmakologische und physische Therapie
4.1.3 Psychotherapie
4.2 Musiktherapie
4.2.1 Musiktherapie nach Schwabe
4.3 Musiktherapeutisches Rahmenkonzept zur Behandlung der Wochenbettdepression
4.3.1 Die Mutter - erste Phase
4.3.2 Das Kind - zweite Phase (Zwischenphase)
4.3.3 Mutter und Kind - dritte Phase
5 Schlussbemerkungen
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Am Anfang dieser Arbeit stand eine Begebenheit: Eine Freundin - gerade Mutter geworden - äußerte die Befürchtung, sie hätte nicht genug Gefühle für ihr Kind. Daraufhin beruhigte sie ihre Schwester mit dem Rat, sich keine Sorgen zu machen, denn das wäre normal. Sie selbst hätte ihr Kind auch erst nach einem Jahr lieben können.
Abgesehen von einer überraschenden Erkenntnis über die großzügige Auslegung des Begriffes „normal“, stellte ich mir die Frage: Welche Voraussetzungen braucht eigentlich ein Kind, um seelisch stabil, angstfrei und gesund die Beziehung zu sich selbst, zur Welt und zu einem anderen Menschen aufzubauen? Und was passiert mit dem Kind, wenn die Mutter - die all diese Aspekte zunächst verkörpern und ermöglichen soll - nicht funktioniert?
Bei weiterer Recherche stellte sich heraus, dass besonders psychische Krisen einer Mutter in der Zeit nach der Geburt erhebliche Auswirkungen auf den seelischen Zustand des Kindes haben können. Die postpartale Depression - auch Wochenbettdepression genannt - ist dabei ein häufig diagnostiziertes und in Industrieländern zunehmendes psychisches Phänomen. Und es scheint der Kenntnisstand von Hebammen und Ärzten auf der einen und die Akzeptanz von Angehörigen und dem sozialen Umfeld auf der anderen Seite so gering zu sein, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte. Um Langzeitschäden zu vermeiden, muss der Zustand der Mutter möglichst schnell gebessert werden ohne dabei die Kindesentwicklung zu gefährden.
Es gibt eine ganze Reihe Konzepte, die sich mit der Therapie dieser Störung befassen und gleichzeitig die gesunde Entwicklung des Kindes zu fördern versuchen. Allerdings ist die Zahl der tatsächlichen Therapieeinrichtungen im Vergleich zum Bedarf so gering, dass meist nur schwere Ausprägungen der Wochenbettdepression sofort behandelt werden können. Oft geben erst Verhaltensauffälligkeiten des Kindes Rückschlüsse auf eine Erkrankung der Mutter, was bereits für einen deutlich pathologischen Verlauf spricht.
Deshalb sollen im folgenden hermeneutischen Zugang nicht nur Erkenntnisse aktueller Forschungsergebnisse und Hypothesen zum genannten Thema erläutert werden. Am Ende soll auch der Versuch einer möglichst realitätsnahen, theoretischen Konzeption für eine Therapie stehen, die inhaltlich dem musiktherapeutischen Studiengang entspricht, in dessen Rahmen diese Arbeit verfasst wird.
Anzumerken ist, dass aus Gründen der Übersicht und einem praktischen und praxisnahen Ansatz ausschließlich die Beziehung und Therapie von Mutter und Kind betrachtet wird, auch wenn in manchen Fällen andere und weitere Bezugspersonen betroffen sind. Der Zeitraum beschränkt sich dabei auf die ersten sechs Monate nach der Geburt, weil in dieser Zeit eine signifikante Häufung der postpartalen Depressionen festgestellt wurde. Die Entwicklung des Kindes hat außerdem innerhalb des ersten halben Jahres häufig noch keine nachhaltig pathologischen Schäden erfahren und ermöglicht so eine leichtere Umsetzung eines eher ambulant orientierten Therapiekonzeptes.
Es schien mir weiterhin notwendig, sowohl den Wahrnehmungsraum des Neugeborenen in seiner gesunden, aber auch den der Mutter in seiner kranken Form zu betrachten, um im dritten Teil den therapeutischen Bedarf als auch die Chancen zu ermitteln, die für Mutter und Kind daraus erwachsen.
Im ersten Teil sollen die Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung der MutterKind-Beziehung erläutert werden. Dazu werden die biologische, aber vor allem die Wahrnehmungsentwicklung des Säuglings und seine frühen Kompetenzen betrachtet. Dies soll besonders anhand von Daniel Sterns Konzept zur Entwicklung des Selbstempfindens verdeutlicht werden.1 Der darauf folgende, nicht unkritische Ausflug in die Bindungstheorie soll den Stellenwert der frühen Interaktion für die spätere Entwicklung beleuchten. Die Interaktion zwischen Mutter und Kind selbst wird in Verlauf und Wesen im Anschluss daran beschrieben.
Der zweite Teil beschäftigt sich - nach einem generellen Überblick über die psychischen Störungen im Wochenbett - ausführlich mit der postpartalen Depression in Diagnostik, Symptomatik und Verlauf. Die Entstehungs-, Bedingungs- und Bedeutungszusammenhänge, sowie ihre unterschiedlichen Interpretationen werden untersucht - nicht ohne den abschließenden Versuch einer eigenen Entwicklungshypothese zu wagen. Analog zum ersten Teil wird die Interaktion dann unter dem Eindruck der depressiven Krise beschrieben und ihre kurz- und langfristigen Auswirkungen auf das Kind verdeutlicht.
Der dritte Teil beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Therapieangeboten bei depressiven Erkrankungen im Allgemeinen und mit der Mutter-Kind-Therapie bei der Wochenbettdepression im Besonderen. Dabei wird der Fokus zunächst auf vorhandene psychotherapeutische und musiktherapeutische Ansätze gelegt. Dazu wird der Begriff Musiktherapie generell erklärt und das meinem Konzept zugrunde liegende Musiktherapieverständnis nach Schwabe.2 Den Abschluss bildet der Versuch einer rein theoretischen, musiktherapeutischen Konzeption zur kombinierten Behandlung von Mutter und Kind bei depressionsbedingten Interaktionsstörungen.
2 Die Beziehung
Was eine Kinderseele, Aus jedem Blick verspricht! So reich ist doch an Hoffnung, Ein ganzer Frühling nicht. (Heinrich Hoffmann von Fallersleben)
Die erste Beziehung, die im Folgenden beleuchtet werden soll, besteht aus zwei Teilen. Das Gedicht „Kinderseele“ spricht beide passenderweise an - die Kompetenzen des Kindes einerseits, aber auch etwaige Zuschreibungsversuche durch sein erwachsenes Gegenüber andererseits.
Im ersten halben Jahr nach der Geburt ist diese Beziehung ein Wechselspiel der regulierenden Handlungen und der damit verbundenen Empfindungen, dass vor allem über die Augen („aus jedem Blick...“) erfolgt. Dabei meint Beziehung eher ein „Bezogensein“, ohne das die gesunde Entwicklung des Kindes nicht möglich ist. Die fühlbare Beziehung zwischen Mutter und Kind beginnt erst nach diesem halben Jahr des „Einschwingens“, also der reinen Interaktion. In ihr werden dann die erlebten und erfahrenen Gefühle selbst zum Gegenstand des Austausches.
Zu einer Beziehung gehören mindestens zwei. Denn auch den Bezug zu uns selbst können wir nur herstellen, wenn uns in der frühen Kindheit ein zugewandtes Gegenüber zur Verfügung gestanden hat - im Idealfall die Mutter, im besten Fall der Vater, im Ausnahmefall einfühlsame Groß- oder Pflegeeltern.
Schon vor der Geburt entwickeln wir eine Ahnung davon, dass wir immer an etwas oder an jemanden gebunden sind - sei es nun körperlich oder seelisch. Die Selbstverständlichkeit mit der sich unser Körper, seine Funktionen, unsere Wahrnehmung und unser Gefühl in Beziehung zueinander und zu einer warmen, haltenden Umgebung entwickeln, lässt uns erwarten, dass diese Verbindung nie verloren geht. Das Gefühl des Gewolltseins, aber vor allem die Begegnung mit der Mutter auf unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung (d.h., die vorgeburtliche Interaktion) schaffen dabei ein erstes Selbstverständnis und Selbstverstehen.
Die Geburt, die dann diese Einheit auflöst, wird von Mutter und Kind getrennt erlebt. In einer kurzen Zeit der Erholung, die zunächst vor allem haltende, schützende Versorgung zum Thema hat, muss dieses Schwellenereignis verarbeitet werden.
Danach kommt es darauf an, einen neuen Bezug zueinander herzustellen - in einen neuen Modus der Begegnung zu treten. Der neugeborene Mensch ist dabei kompetent in seiner radikalen, unverstellten Echtheit. Seine Sprache ist die direkte, weil er das gemeinsame Erleben mit der Mutter sucht. Der Säugling kann das souverän, weil er sich in existenziellen Zusammenhängen (Bezügen) als autonomes Selbst und als solches wirksam erlebt. Die Bezüge werden nicht nur situativ, affektiv und intensiv als verschieden erlebt, sondern auch als getrennt vom und am Gegenüber wahrgenommen. Die Mutter wiederum bringt ihr gesamtes Wesen mit all den Erfahrungen, Fantasien und Vorstellungen in die Beziehung ein und reguliert so die Empfindungen ihres Kindes.
Wie bei zwei Menschen, die sich bisher in einer Polonaise bewegt haben und abrupt einander zugewendet werden, müssen Mutter und Kind sich nun auf den Tanz einigen, der eine Verbindung zueinander und eine Beziehung miteinander möglich macht. Je nachdem wie synchron und stimmig sich dieser Tanz - also die Interaktion von Mutter und Kind - gestaltet, kann er eng oder weit getanzt werden. Das Kind wird später durch sein Verhalten in Bezug auf die Mutter anzeigen, ob die frühe Interaktion ein anmutender Tanz oder eher ein „Distanz“ war.
Wesentlich für die seelische Entwicklung ist jedoch, dass er überhaupt gelingt. Denn dann gibt sich unter seinem eigentlichen Namen zu erkennen - Liebe.
2.1 Der Mensch - vor und nach seiner Geburt
Das Wissen darüber, wie ein Mensch entsteht, welche Entwicklungen er vollzieht und welche Einflüsse ihn prägen hat sich in den letzten dreißig Jahren enorm erweitert. Immer feinere technische Verfahren ermöglichen es uns, immer früher in die Lebenswelt eines Ungeborenen einzutauchen. Besonders die Hirnforschung konnte den höchst individuellen Zusammenhang von Umweltreizen und der Entwicklung des Nervensystems nachweisen.3 Und dies wiederum macht bereits den Embryo zu einer Person mit eigenen Entwicklungen und eigenen Erfahrungen. Die Vorstellung des Unfertigen oder gar Minderwertigen scheint damit überholt. Im Gegenteil sind wir nach der Empfängnis eher die Essenz unseres späteren Selbst - radikal ursprünglich und nachhaltig beeindruckbar. Oder wie es der Embryologe Erich Blechschmidt formuliert:
„Ein Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch und verhält sich von Anfang an als ein solcher. Und zwar in jeder Phase seiner Entwicklung von der Befruchtung an.‘[1]
Die Körperstrukturen des Menschen bilden sich nicht nur einfach heraus, sondern werden zeitgleich auch in ihren Funktionen erprobt. So kann man noch während der Entwicklung der Arme schon deren Greifbewegungen erkennen. Und weil dies natürlich auch für die Entwicklung von Nervenzellen und damit den psychischen Funktionen gilt, geht beispielsweise der Embryologe Jaap van der Wal davon aus, dass die Körperbildung auch ein psychischer Prozess ist und damit menschliches Verhalten.[2]
Mit der Entwicklung der Sinne tritt der Mensch zunehmend in Kontakt mit seiner unmittelbaren Umgebung, besonders mit der Mutter. Jetzt geben nicht mehr nur die Hormone durch die Nabelschnur Auskunft über deren Befindlichkeit und Emotionalität. Auch der Herzschlag der Mutter, ihre Atmung, ihre Bewegungen, ihre Berührungen und ihre Stimme prägen von nun an das Verhältnis des Ungeborenen zu sich und der Welt.
Während der Tastsinn schon in der Embryonalperiode nachweisbar ist, werden Geschmack und Geruch im zweiten Schwangerschaftsmonat, Gehör im dritten und das Sehen im fünften Monat angelegt. Am Ende des sechsten Monats werden Vibration, Druck, Temperatur und Schmerz im ganzen Körper wahrgenommen. Das Herausbilden der Eigenwahrnehmung wird durch die Sinnesentwicklung angeregt und verläuft parallel zu ihr. So kann schon vor der Geburt beobachtet werden, wie das Ungeborene am Daumen lutscht oder sich die Augen reibt, gähnt oder Schluckauf hat. Manche Kinder drücken wiederholt die Nabelschnur ab und verschaffen sich so anscheinend einen Kick durch die entstehende Unterversorgung. Solange sie Platz im Mutterleib haben, können Ungeborene von einer Seite zur anderen schwimmen und sich dabei wie Leistungsschwimmer von den Innenwänden abstoßen.
Im Verlauf der Entwicklung fangen die Kinder an zwischen den rein biologischen Funktionen, Geräuschen und Reizen im Mutterleib, sowie den aktiven Kontaktaufnahmen - zunächst durch die Mutter und später durch andere Menschen außerhalb - zu unterscheiden. Sie erhöhen ihre Aktivitäten deutlich, wenn sie Geräusche, Stimmen oder Musik aus der Außenwelt wieder erkennen. Sie sind zurückhaltend, wenn es der Mutter emotional schlecht geht oder können ihr Missfallen durch Tritte äußern, wenn sie mit einer Situation unzufrieden sind. Es ist beobachtet worden, wie ein Kind im Mutterleib bei einer Fruchtwasserentnahme abwehrend auf die Nadel schlug oder bei einer Operation im Mutterleib den Finger des Chirurgen umklammerte.
Vertraut mit der warmen, klar begrenzten und haltenden Umgebung des Mutterleibes, kommt die Geburt als ein Schock - als das erste Schwellenereignis für den neuen Menschen.[3] Die Entwicklung, die das neugeborene Kind in den Wochen nach der Geburt macht ist vor allem geprägt durch enorme Anstrengungen, sich der neuen Umgebung anzupassen. Der Kinderarzt Donald Winnicott nannte diesen Zustand schwerelos. Der Halt des Mutterleibes sei verschwunden und dieser Zustand mache Angst.[4]
Doch eigentlich ist es umgekehrt. Schwerelos und leicht fühlt sich das Kind im Mutterleib. Die volle Wucht der Schwerkraft trifft es nach der Geburt und drückt es nieder. Es kostet unglaubliche Kraft und dauert ein paar Wochen bis dieser Schock überwunden und die neue Umgebung akzeptiert wurde. Biologisch gesehen entwickeln sich in den ersten sechs Monaten nach der Geburt vor allem Bewegungskoordination und Gleichgewichtskontrolle. Für die Wahrnehmungsintegration muss sich das Kind im Raum verorten können. Die angeborenen Reflexe sollen diese Anpassung an die neue Umgebung erleichtern.
So gibt es den Suchreflex bei Berührungen, den Saug- und Schluckreflex oder auch den Greifreflex, der vor dem Fallen schützen soll.
Im Laufe der nächsten Monate wird der neue Raum Stück für Stück erweitert. Dabei hilft vor allem die Kontrolle über die Augen- und Nackenmuskulatur und eine klare optische Wahrnehmung. Denn jetzt kann sich das Kind Bilder von der Umgebung machen, auch wenn es sich selbst bewegt. Die Bewegungen werden ausladender und Tiefenunterschiede können erkannt werden. Ab dem sechsten Monat beginnt das Krabbeln. Damit ist die Eroberung des Raumes nahezu komplett, denn jetzt kann das Kind selbst den Abstand zu den Dingen (und Menschen) bestimmen.
2.1.1 Die Wahrnehmungsentwicklung
Die vermeintliche Passivität nach der Geburt wurde von der psychoanalytische Entwicklungspsychologie lange als autistische Phase beschrieben. Und natürlich kann sich der neue Mensch erst aktiv seiner Umgebung zuwenden, wenn er den Verlust der alten überwunden hat. Dass aber die Wahrnehmung und das Erleben differenziert sind, soll nun erörtert werden.8
Der Säuglingsforschung ist es zu verdanken, dass wir heute ungleich mehr über die Kompetenzen und Wahrnehmungsleistungen von Neugeborenen wissen. Allerdings waren es zunächst Sigmund Freud und seine Psychoanalyse, die sich für das Erleben und die Wahrnehmung des Säuglings interessierten - wenn auch nur im Rückblick. Durch die Rekonstruktion frühkindlicher Konflikte und ihrer Deutung aus der Perspektive der Patienten schloss man auf die Realität von Neugeborenen allgemein. Das Ergebnis war ein eindimensionales Wesen, das nach dem Lustprinzip vor allem satt sein und schlafen wollte. Es wurde auf Nahrungsaufnahme und Ausscheidung begrenzt (orale und anale Phase), war nicht in der Lage Sinneseindrücke zu unterscheiden oder gar zwischen sich selbst und anderen Menschen.
Die Psychoanalytikerin Margaret S. Mahler schuf ein Entwicklungsmodell, das aus einer autistischen, einer symbiotischen und einer Loslösungs-, sowie einer Individuationsphase (intrapsychische Abgrenzung und Autonomie) im ersten Jahr nach der Geburt bestand. Verwendet wurde dieses Modell vor allem, um sich seelisch krankhafte Zustände zu erklären. Man schloss beispielsweise bei autistischen oder psychotischen Kindern auf das Unvermögen die autistische oder die symbiotische (weil grenzenlose) Phase zu überwinden.[5]
Und auch wenn Freud den Umstand der fehlenden Beobachtungsdatenlage von Säuglingen und Kleinkindern kritisiert, hat er selbst nie Direktbeobachtung betrieben. Auch Margaret S. Mahler arbeitete rein theoretisch und sogar der Entwicklungspsychologe Jean Piaget schloss nur von den vorhandenen oder nicht vorhandenen Fähigkeiten seiner älteren Kinder auf ihre Kompetenzen im Säuglingsalter.[6]
Die Direktbeobachtung und verschiedene Untersuchungsmethoden der Säuglingsforschung - auch mittels feiner Aufnahmetechniken, die es zu Freuds Zeiten noch nicht gab - haben Licht ins Dunkel der Fähig- und Fertigkeiten eines Neugeborenen gebracht. Einige Ergebnisse sollen hier zusammengefasst werden:[7] Das neugeborene Kind kann bereits kurz nach der Geburt schwarz-weiße Kreise von schwarz-weißen Streifen unterscheiden. Mit einem Monat sind sie sogar in der Lage, rosa von rot zu unterscheiden.
Zwischen dem zweiten und vierten Monat können Säuglinge Gesichter wahrnehmen - oder auch, ob einzelne Gesichtsteile (Nase, Augen) an der falschen Stelle sitzen. Mit spätestens einem halben Jahr erkennen sie Trauer, Freude oder Überraschung in einem Gesicht. In manchen Untersuchungen wurde dies bereits kurz nach der Geburt beobachtet. Und je nach Gesichtsausdruck konnten unterschiedliche Aktivitäten im autonomen Nervensystem gemessen werden. Das bedeutet: Neugeborene sind nicht nur einfach erregt oder unerregt, sondern sie erleben anscheinend auch emotional unterschiedliche Qualitäten von Erregung.
Innerhalb der ersten sieben Monate nach der Geburt kann das Kind ein Gesicht, dass es nur von der Seite gesehen hat, von vorne wieder erkennen und umgekehrt.
Dabei ist es in der Lage ein Gesicht trotz unterschiedlicher Ausdrücke, wie Freude oder Ärger wieder zu erkennen. Ein Kleinkind kann sogar ein Gesicht, das es nur eine Minute gesehen hat eine Woche im Gedächtnis behalten.
Eine Geschichte, die die Mutter vor der Geburt vorgelesen hat wird nach der Geburt erkannt, auch wenn sie jemand anderes vorliest - besonders aber, wenn es die Mutter tut. Schon mit einem Monat können Neugeborene die Laute „B“ und „P“ voneinander unterscheiden.
Darüber hinaus ist ein Säugling in der Lage Sinneseindrücke zu verknüpfen. So bevorzugt er Filme in denen Bild und Ton synchron sind. Spielt man Kleinkindern ab dem sechsten Monat einen langen Ton vor, bevorzugen sie eine durchgezogene Linie. Bei unterbrochenen Tönen bevorzugen sie unterbrochene Linien.
Zwischen dem zweiten und dritten Monat können Säuglinge Scheiben und Ringe, die sie blind ertastet haben auf Bildern wieder erkennen. Und wenn man ihnen einen Schnuller mit Noppen in den Mund gibt (ohne dass die Neugeborenen ihn sehen) und kurz darauf zwei Bilder von Schnullern zeigt - auf einem einer mit Noppen, auf dem anderen einer ohne - sehen sie bevorzugt den Noppenschnuller an.[8] Diese Wahrnehmung kann als ganzheitlich betrachtet werden, denn Kinder sind von Geburt an in der Lage eine bestimmte Sinneswahrnehmung auf eine andere zu übersetzen. Die Säuglingsforschung bezeichnet diese Art der Wahrnehmung als amodal oder auch kreuzmodal .[9]
2.1.2 Das Selbstempfinden
Die beobachtbaren Kompetenzen des Kleinkindes sind auch ein wesentlicher Beleg für die Annahme, dass der Mensch ein handelndes und interagierendes Wesen ist - spätestens von seiner Geburt an. Das vom Psychoanalytiker und Säuglingsforscher Daniel Stern entwickelte Konzept der Selbstempfindung als einer Art „Ebene des unmittelbaren Erlebens“ ist seiner Meinung nach Grundlage für die menschliche Entwicklung:[10] „Er [der Begriff des Selbstempfindens, Anm. d. Verf.] beschreibt den Prozeß, in dem die Erfahrung, die das Subjekt im Umgang mit sich selbst und der Welt der Objekte macht, geordnet, verarbeitet und organisiert wird.[11]
Sterns Modell besteht aus mehreren Entwicklungsphasen, die nie ganz abgeschlossen sind und sich teilweise überlagern.[12] Innerhalb der ersten zwei Monate nach der Geburt entwickelt sich das „auftauchende Selbst, das keine Verwechslung von „Selbst“ und „Nichtselbst“ zulässt, denn der Säugling reagiert auf soziale Vorgänge wie es die Säuglingsforschung durch Direktbeobachtung herausgefunden hat. Der neugeborene Mensch fühlt bereits den Unterschied von Selbst und sozialer Umgebung ohne schon darüber zu reflektieren.
Ab dem dritten Monat entwickelt sich laut Stern das Kernselbstempfinden, das aus drei Teilen besteht, denen jeweils ein spezifisches Gedächtnis zugeordnet werden kann:
1. Das kohärente Selbst erlebt sich in der Wahrnehmung von Zusammenhängen. Das bezieht sich sowohl auf Formen, den Ort, die Zeit oder auch die Intensität und Bewegung von Reizen, die von sich oder anderen Objekten ausgehen. Und auch wenn die Entwicklung des Kernselbstempfindens an sich erst später beginnt, ist die Selbstkohärenz in Teilen bereits angeboren.
Dass ein Gesicht weiterhin besteht und wiedererkannt wird, auch wenn sich sein Ausdruck oder seine Position ändern, macht den Wahrnehmungszusammenhang in der Form aus. Dass sich der Kopf in Richtung eines Geräusches bewegt, weil ein dazugehöriges Bild - ein optischer Reiz - „erwartet“ wird, belegt die Kohärenz des Ortes. Dass Bild und Ton bei einem Film als synchron bevorzugt werden, spricht für die angenommene gemeinsame Zeitstruktur. Die Kombination von hellem Licht und lauter Musik wird bereits drei Wochen nach der Geburt als passend bevorzugt - was für einen Wahrnehmungszusammenhang in der Intensität von Reizen spricht. Und schließlich kann man die Bewegung eines Menschen mit Hilfe von Punkten am Computer simulieren. Diese Sequenz wird von Kleinkindern bevorzugt - anders als eine zufällige Bewegung von Punkten. Das bedeutet es wird ein Zusammenhang von einem Körper und seinen biologischen Bewegungen angenommen.
Eine Entwicklung und Reifung des Selbstgefühls und vor allem seine Beständigkeit wäre allerdings nicht möglich, wenn die unterschiedlichen Wahrnehmungen nicht auch Spuren im Gedächtnis hinterlassen würden. So ordnet Stern dem kohärenten Selbst ein Wahrnehmungsgedächtnis zu, das die Unterscheidung von Selbst und Anderen nachhaltig fördert.[13]
2. Das handelnde Selbst erlebt sich als Urheber und Unterbrecher von Handlungen. Dies ist vielleicht die eindeutigste Erkenntnis aus Sterns Modell und bezeichnet die Selbstwirksamkeit des Kindes und seine Grenzen. Der Säugling erlebt sich ab dem dritten Monat nach der Geburt als handelnd ohne eine bewusste Erwartung vom Ergebnis seiner Handlung zu haben. Ein kausaler Zusammenhang wird also nicht gedanklich vorweg genommen. Allerdings macht der Säugling die Erfahrung, dass sein Handeln immer einen Effekt auf das Selbst hat und nur manchmal auch auf andere Objekte (Personen). Dieses Grundschema ist fundamental für das Getrenntheitserleben des Selbst vom Anderen.
Ein weiterer Aspekt des handelnden Selbst ist die unglaublich motivierende Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Nicht - wie in der Psychoanalyse lange angenommen - vor allem die Triebe und ihre Befriedigung beeinflussen die Entwicklung eines Menschen, sondern eine Erfahrung der Kontingenz, des Zusammenhangs, der Ab- und Übereinstimmung von sozialen Beziehungen und Handlungsprozessen. Ein neugeborenes Kind, das nach einer bestimmten
Bewegung immer einen Schluck Milch erhält, wird diese Bewegung auch weiterhin initiieren, auch wenn es satt ist. Grund dafür ist die Lust am Zusammenhang - nicht die gesuchte Befriedigung durch das Ergebnis.
Dem handelnden Selbst ist ein Bewegungsgedächtnis zugeordnet. Bereits rein hirnphysiologisch kann man die Entwicklung der Nervenbahnen analog zu Bewegungsmustern nachweisen.[14] So wird nicht nur das Selbstgefühl des Kindes diffus in einen Spannungszustand der Erwartung gesetzt sondern auch konkret der Körper - so wie bei einem Erwachsenen, der erlernte Bewegungen auch unbewusst (wie nebenbei) ausführen kann.
3. Ab dem dritten Monat beginnt sich das Affekt erlebende Selbst zu entwickeln. Durch die Beobachtung des Gesichtsausdrucks bei Säuglingen konnten im ersten halben Jahr nach der Geburt mindestens sechs Gesichtsausdrücke diskreter Affekte nachgewiesen werden: Ekel, Überraschung, Neugier, Freude, Traurigkeit und Ärger. Ab dem sechsten Monat nach der Geburt kommt noch Furcht hinzu.[15] Die Forschung ging lange davon aus, dass Affekte bei Kleinkindern zwar differenziert ausgedrückt, aber nicht differenziert erlebt werden. Der Gesichtsausdruck wurde als Teil der evolutionsbiologischen Entwicklung verstanden, der sogar bis zum 18. Monat nach der Geburt noch „geübt“ wird. Die Übereinstimmung von Ausdruck und Affekt wurde als Lernprozess des sozialen Wesens betrachtet.[16]
Der Affekt hat aber erstens immer eine Signalfunktion - in Mimik, Gestik oder nur körperlich - die Handlung nach sich zieht oder ziehen soll (also auch motivierend ist). Zweitens konnten in der Psychotherapie außerdem Zusammenhänge zwischen der Biografie eines Kleinkindes und seinem Wesen in Haltung, Mimik und Ausdruck nachgewiesen werden.[17]
Ein dritter Punkt, der für den frühen differenzierten Zusammenhang von Ausdruck und Affekt spricht ist die Tatsache, dass sich die Grundstruktur von Gefühlen auch im Erwachsenenalter kaum verändert. Von der reinen Erregung des Nervensystems bis hin zu Mustern des Gesichtsausdrucks, der Stimme und der Körperhaltung bleiben Affekte weitgehend konstant. Die Anlässe, die Vermittlung und Beeinflussung durch das Denken, sowie die Intensität können verschieden sein. Aber die Färbung von Affekten, ihre Zuordnung und ihre Bandbreite bleiben eindeutig.[18] Der Affektausdruck ist also von Geburt an Ausdruck des Selbstgefühls an sich und Teil der Beziehung zwischen Selbst und Umwelt. Gemütsregungen werden erlebt, diskret ausgedrückt und konkret wahrgenommen, ohne dass sie zum Gegenstand des bewussten Handelns oder des absichtsvollen Austausches werden.
Aber das Kleinkind zeigt nicht nur Ausdrücke von Gefühl, sondern kann sie in spezifische Zusammenhänge bringen und in ihrer Intensität und Tönung am Gegenüber wahrnehmen. Deshalb ordnet Stern diesem Teil des Kernselbst auch ein Affektgedächtnis zu. Damit das Selbsterleben stabil bleibt und sich entwickeln kann, müssen erlebte Gefühlsausdrücke gespeichert werden - und dies nicht nur in der Art des Affektes, sondern auch in seiner Qualität. Denn genau wie Handlungen eine bestimmt Qualität haben, können auch Affekte vital sein.[19]
Diese Vitalitätsaffekte werden wie die Sinneswahrnehmung an sich (u.a. von Musik, Geruch, Licht, Körperkontakt) unterschiedlich stark und intensiv wahrgenommen. Die Fröhlichkeit eines Elternteils kann sich durch Gesang und wiegende Bewegung äußern oder durch eine plötzliche stürmische Umarmung des Kindes. Die Worte wiegend und stürmisch definieren hier zwei unterschiedliche Qualitäten eines Basisaffektes - nämlich Freude. Ein Kleinkind bringt diesen Affektausdruck in Zusammenhang mit der Handlung, die ihn begleitet oder ihm folgt und speichert diesen Eindruck bereits sensomotorisch. Das Affektgedächtnis schafft also einen kontextuellen und differenzierten Zusammenhang von Situation und Gefühl, ohne dass dieser Vorgang ein bewusster Denkprozess wäre. Die Übereinstimmung (auch in der Intensität) von Affektausdruck und Handlung beeinflusst die gesunde Selbstentwicklung des Kindes.
Alle drei Teile des Kernselbst belegen die Theorie, dass sich der Säugling als getrennt von anderem erlebt. Dies ist die Grundvoraussetzung für ein gefühltes Miteinander und gelingende Interaktion. Die komplexe Erlebniswelt und die Kompetenzen des neugeborenen Menschen zu unterschätzen oder sie nicht akzeptieren zu können, führt oft zu einer tränenreichen Säuglingszeit. Denn so aktiv wahrnehmend, so authentisch und direkt, so radikal ehrlich wie in dieser vorsymbolischen Zeit ohne innere Konflikte und deren Abwehr, ohne die „Vorstellung vom Paradies“ wird das Kind nie wieder sein.
Und letztendlich wird auch unser ganz persönlicher Sinn des Lebens durch die Art und Weise bestimmt, wie selbstwirksam wir uns wahrnehmen, wie bezogen wir uns fühlen, wie lustvoll wir Zusammenhänge und neue Wege erforschen und wie offen wir Gefühle zeigen und erfahren.
2.2 Die Bindungstheorie - ein Exkurs
Bindung bedeutet Schutz und sichert das Überleben des Individuums und der Art. So könnte man die verhaltensbiologische Funktion dieses unsichtbaren, emotionalen Bandes zwischen Eltern und Kindern zusammenfassen. Und diese Aussage verweist gleichzeitig auf den Kern der Bindungstheorie - dass Bindung ein angeborenes, motivationales System ist.[20]
In den fünfziger Jahren entwickelte der Arzt und Psychoanalytiker John Bowlby diese Theorie, weil er sich fragte, warum Kinder so unterschiedlich auf die Trennung oder den Verlust der Mutter reagierten. Das Ergebnis seiner Forschung - und später auch der von Mary Ainsworth - war eine Einteilung in unterschiedliche Bindungstypen, anhand derer man die Qualität der Bindung zwischen Mutter und Kind bestimmen konnte.[21]
Die Qualität der Bindung wiederum trifft eine Aussage darüber, welches Verhältnis das Kind zu sich selbst und seiner Umwelt entwickelt. Deshalb wird die Bindungsentwicklung heute nicht mehr singulär betrachtet, sondern immer auch im Zusammenhang mit dem Explorationsverhalten des Kindes. Das Lernen, die Neugier, die Fantasie und das Spielverhalten sind elementar von der Bindung zu einer Bezugsperson abhängig.[22]
2.2.1 Die Bindungstypen
Die unterschiedlichen Bindungstypen lassen sich zunächst grob in „sicher“ und „unsicher“ einteilen. Sicher gebundene Kinder haben insgesamt ein positives Bild von sich und ihren Bezugspersonen, vor allem was die Erwartungen an jene angeht. Die Kinder äußern ihre Gefühle direkt, auch in emotional belastenden Situationen. Ihr Spielverhalten ist unbefangen und die Umgebung wird von ihnen spontan und neugierig entdeckt. Bei Verunsicherung oder Erschöpfung suchen sicher gebundene Kinder Trost bei ihrer Bezugsperson, die sich als unterstützend und vertrauenswürdig erwiesen hat. Sie teilen sich schnell mit, nehmen Zuwendung an und sind dadurch in der Lage, Anspannungen schnell abzubauen. Bei einer Trennung protestieren sie lautstark, lassen sich aber durch die (zurückgekehrte) Bezugsperson schnell beruhigen.[23]
Bindungsunsicherheit kann sich verschieden äußern, deshalb ist diese Kategorie nochmals unterteilt worden. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder reagieren in Trennungssituationen wenig bis gar nicht. Sie wirken unbeteiligt, unterbrechen ihr Spiel nicht und scheinen desinteressiert zu sein. Bei der Rückkehr der Mutter vermeiden die Kinder den Kontakt besonders körperlich und reagieren ablehnend. Es ist zu vermuten, dass sich die Mutter als primäre Bezugsperson sowohl emotional als auch körperlich häufig entzogen hat, oder sogar negativ auf die Kontaktaufnahme des Kindes reagiert hat. Die Trennungserfahrung ist beim Kind neurophysiologisch als Anspannung und Belastung nachweisbar und kann deshalb nicht nur als resignative Reaktion interpretiert werden.[24]
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder reagieren extrem auf Trennungen. Sie schreien, weinen und klammern sich an die Mutter. Trotz deren Rückkehr lässt sich das Kind dann nicht beruhigen und äußert sich widersprüchlich, sowohl aggressiv als auch Nähe suchend. Die Bindungsforschung geht deshalb davon aus, dass sich die Mutter selbst als ambivalente Bindungsperson gezeigt hat. Die Unberechenbarkeit ihrer Reaktion führt beim Kind zu einer geringen Frustrationstoleranz und verhindert gleichzeitig entspanntes Spiel- und Explorationsverhalten. Denn durch die permanente Angst, die Bezugsperson verlieren zu können, wird das Bindungsverhalten zu schnell aktiviert.[25]
Weil es in den Studien eine Gruppe von Kindern gab, die sich nicht eindeutig zu einer der genannten Typen zuordnen ließ, führte die Forschung ein Zusatzklassifikation ein - die des unsicher-desorganisiert/desorientierten Bindungstypen. Im Grunde ist diese Zuordnung eine Zusatzcodierung, denn selbst bei sicher gebundenen Kindern können Sequenzen eines desorientierten, stereotypen oder unterbrochenen Verhaltens auftreten. Läuft das Kind nach einer Trennung der Mutter entgegen kann es passieren, dass es abrupt stehen bleibt (einfriert) oder sich umdreht und von der Mutter wegläuft. Ist dieses Verhalten stärker ausgeprägt, wird die Bindungsqualität als unsicher eingestuft. Über die Ursachen dieses Verhaltens herrscht Uneinigkeit. In Studien konnte eine deutliche Häufung des unsicher-desorganisierten Musters in klinischen Risikogruppen (u.a. Betroffene von Trennung, Verlust, Misshandlung, Missbrauch, Frühgeburt) festgestellt werden.[26]
Aber auch Kinder von Eltern, die ihrerseits frühe negative Erfahrungen machen mussten, weisen überzufällig ein desorientiertes Verhaltensmuster auf - ohne dass ihre Beziehung zueinander an sich als unsicher oder ambivalent eingestuft werden könnte.31
2.2.2 Bindungsthesen
Die Bindungstheorie beruht letztendlich auf drei zentralen Thesen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
„1. Unterschiedliche Bindungserfahrungen mit den Eltern machen individuelle Unterschiede des Kindes im Vertrauen zu sich und anderen aus.
2. Unterschiedliche Bindungserfahrungen mit den Eltern beeinflussen die
Bereitschaft bei emotionaler Belastung um Hilfe zu bitten oder Hilfe zu geben.
3. Unterschiedliche Bindungserfahrungen mit den Eltern beeinflussen die
Fähigkeit im Kindes- und später Erwachsenenalter Freundschaften und Bindungen aufzubauen.“[27]
Als Garant für eine sichere Bindung wird die mütterliche Feinfühligkeit im ersten Jahr nach der Geburt angesehen - also das spontane, echte und unreflektierte Verhalten der Mutter in der Interaktion mit ihrem Kind. Dazu gehört ihr Vermögen, die kindlichen Signale und Bedürfnisse wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und nicht nur angemessen, sondern auch unmittelbar auf sie zu reagieren.[28] Die Folge davon ist ein weiterer wesentlicher Punkt in der Bindungstheorie: Die Entwicklung innerer Arbeitsmodelle. Demnach entwickelt das Kind im ersten Jahr
nach der Geburt sozusagen ein Drehbuch, das sich als Ergebnis der[29]
Interaktionserlebnisse zwischen ihm und der Mutter in Trennungs- und Gemeinsamkeitssituationen darstellt. Anhand dieses Drehbuchs wird das Kind zukünftig sein Verhalten aus Nähe und Distanz ausrichten und es damit vorhersagbar machen. Das Kind handelt also kausal. Die Bindungsforschung ging lange davon aus, dass sich ab einem bestimmten Alter dieses Bindungsverhalten nicht mehr oder nur minimal verändern lässt.
2.2.3 Kritik
Die Erkenntnisse der Bindungsforschung haben der Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie enorm weitergeholfen. Als Gegenentwurf zur analytischen Triebtheorie war die Bindungstheorie sogar dringend notwendig. Dennoch mangelt es nicht an Kritik, die vor allem die Absolutheit und Starre des Bindungsverhaltens betrifft.[30]
Wenn das innere Arbeitsmodell tatsächlich nur kurze Zeit flexibel wäre, dann wäre sämtliche psychotherapeutische oder sozialpädagogische Arbeit auf diesem Gebiet hinfällig.[31]
Daniel Stern vertritt die These, das innere Arbeitsmodell wäre nur das Gerüst und Interaktionserfahrungen wären seine Bausteine, die lebenslang erneuert, ausgetauscht oder getilgt werden können.[32]
Im ersten Teil dieser Arbeit habe ich außerdem darauf hingewiesen, dass Kleinkinder keinen bewusst berechnenden, also kognitiven Zusammenhang von Ursache und Wirkung herstellen. Demnach wäre das innere Arbeitsmodell - das laut Bindungstheorie auf Erfahrung basiert - ein unbewusstes, gefühltes und damit schwer zu fassendes Konstrukt. Vielleicht ist es eher noch eine frühe Form der unbewussten Bewältigung, die die gemachten Erfahrungen mit den verbundenen Affekten verknüpft und als intuitiv wiederholbar einstuft oder eben nicht.
[...]
[1] ebd., zit. n. Ustori, 2010, S. 10
[2] vgl. ebd., S. 10 f.
[3] Modus und Verlauf der Geburt, sowie auftretende Geburtstraumata und ihre Auswirkungen auf Kind und Mutter wurden und werden umfangreich erforscht, u.a. durch Ludwig Janus und Franz Renggli, sowie Michel Odent oder Isabelle Azoulay. Hier soll dies deshalb nicht Thema sein. Im 2. Teil wird allerdings die Geburt als eventueller Auslöser für psychische Erkrankungen der Mutter beleuchtet.
[4] vgl. Winnicott, 1998, zit. nach Herrmann 2006, S. 38
[5] vgl. Wikipedia im WWW unter URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mahler. Dass dieses Modell heute noch gelehrt oder vertreten wird, ist einer gewissen Fachidiotie und Weiterbildungsresistenz zu verdanken. Die (auch nur begriffliche) Pathologisierung von menschlichen Entwicklungsprozessen verstellt den Blick auf die situativen, individuellen Phänomene in der Beziehungsgestaltung. In der therapeutischen Beziehungsarbeit halte ich diesen Vorgang für altmodisch und sogar unredlich.
[6] s. Dornes, 2009, S. 33
[7] vgl. dazu ebd., S. 34 ff., Baer, S. 76 ff.
[8] ebd., ebd.
[9] vgl. Baer, S. 77; vgl. Domes, S. 43
[10] s. Stern, 1992, S. 20 ff.; vgl. Domes, S. 92 ff.
[11] Domes, S. 80
[12] Da sich diese Arbeit maximal auf die Zeit des ersten halben Jahres nach der Geburt beschränkt, sollen hier nicht alle Phasen ausführlich dargestellt werden. Nur so viel: Die dritte Phase entwickelt sich zwischen dem 9. Und 18. Monat und ist laut Stern die des „subjektiven Selbst", das den Wunsch nach (Mit-) Teilung der eigenen Empfindungen beinhaltet. Damit ist das Selbst kein rein „gefühltes" mehr, sondern auch ein denkendes, weil bewusst handelndes. Die vierte und letzte Phase ist die des „verbalen Selbst", die durch die Sprachentwicklung eine völlig neue Perspektive der Bezogenheit schafft. Die o.g. Wahrnehmungs-Zusammenhänge sind nicht mehr zwingend, weil sie jetzt auch symbolisiert werden können. Dies wiederum beinhaltet auch die Erfahrung der Trennung von Denken und Gefühl, die laut Stern den Übergang vom Kleinkind zum Kind ausmacht (vgl. Stern, 1992).
[13] Im Grunde kann man hier von einer Art Erwartung der Zusammenhänge (nicht der kausalen, sondern der existentiellen) reden, die wie gesagt nicht bewusst ist, d.h. symbolisiert und vorgestellt wird sondern eher gefühlt. Irritiert wird dieses Selbstgefühl erst, wenn die Einheit nicht oder nicht mehr wahrnehmbar ist (ohne dass das Kind sich dem Warum bewusst wäre). Die Stabilität des Selbst und die gesunde Wahrnehmungsentwicklung ergibt sich also aus der Stabilität und Fortdauer der gefühlten Kohärenz.
[14] vgl. Hüther/Krens
[15] vgl. Dornes, S. 120. Der Begriff Affekt soll hier als Gemütsregung verstanden werden, die in der hier betrachteten Lebensphase vor allem Teil sensorischer und perzeptueller Prozesse ist - also präkognitiv und präsymbolisch (s. ebd., S. 126). Zu den diskreten, bzw. den Basiseffekten gehören diejenigen, die kulturell unabhängig, d.h. im Gesichtsausdruck gleich und universell als Affekte verstanden werden (vgl. ebd., S. 113).
[16] s. Lewis/Michalson 1985, S. 165, zit. n. ebd., S. 121. Dornes kritisiert das und sagt dazu: „Lernen ist notwendig, um Ausdruck und Gefühl voneinander zu trennen, nicht aber, um sie zusammenzubringen." (ebd.)
[17] vgl. ebd. S. 125 ff.
[18] ebd.,S. 130
[19] vgl. Domes, S. 84 ff. Die ausführliche Beschäftigung mit den Affekten ist wesentlich und dient der Vorbereitung auf die Untersuchung des Beziehungserlebens von Mutter und Kind im zweiten und eines möglichen Therapieansatzes im dritten Teil.
[20] vgl. Haug-Schnabel, 2004, S. 144
[21] Geschehen zum Thema hat soll - wenn es um das primäre Gegenüber geht - der Mutter ein Vorzug gegeben werden.
[22] vgl. Seiffge-Krenke, 2006, S.5
[23].vgl. Haug-Schnabel, S. 147 ff. Legendär ist der „strange situation test" (Fremde-Situation-Test) von Mary Ainsworth. Durch ein Mini-Drama, bei dem das Kind (im Alter von 11-18 Monaten) zwei Mal kurz von der Mutter getrennt wird, sollte das Bindungsverhalten aktiviert werden. Je nachdem wie die Reaktion ausfiel, konnten Rückschlüsse auf die Bindungsqualität geschlossen werden (vgl. Grossmann u. Grossmann, 2003, zit. n. ebd.).
[24] vgl. Klußmann/Nickel, 2009, S. 23
[25] vgl. Haug-Schnabel, S. 148. Psychopathologisch lässt sich dieses Verhalten fast als symbiotisch bezeichnen. Nicht wenige Analytiker sehen einen engen Zusammenhang zwischen mütterlichem Bindungsverhalten und psychischen Störungen im Erwachsenalter. Die Trennung macht einerseits Angst. Allerdings wird der permanente Verschmelzungswunsch andererseits auch als angsteinflößend empfunden, weil er das eigene Handeln (Explorieren) einschränkt (vgl. Schank, 2003, S. 5)
[26] vgl. Brisch, 2010, S. 52 ff. Die Einführung dieser Zusatzkategorie scheint mir ein Umstand zu sein, der die ganze Theorie in Frage stellt. Denn wenn sich hier das Verhalten der Kinder nicht vorhersagen lässt, ist seine Kategorisierung unnötig.
[27] vgl. Main/Hesse 1990, zit. n. ebd., S. 60. Eine mögliche Erklärung liefert die Epigenetik die nachweist, dass sich extreme Erfahrungen der Elterngeneration in den Genen niederschlagen können (imprinting) und sich somit bereits durch die Befruchtung der Eizelle an die nächste Generation übertragen. Und dies beeinflusst nachhaltig deren phänotypische, d.h. morphologische, physiologische und psychologische Entwicklung(vgl. u.a. Kegel, 2009).
[28] Grossmann/Grossmann, 2003, zit. n. Haug-Schnabel, S. 148
[29] vgl. ebd., S. 149. Ich werde im nächsten Kapitel darauf eingehen.
[30] vgl. u.a. Stahlmann, 2007
[31] vgl. ebd., S. 150. Im Gegenteil kann ja gerade dieser „Nähe-und-Dis-Tanz" in der Beziehung von Patient und Therapeut (wieder) relevant und die Beleuchtung/Bearbeitung seiner Strukturen und Muster wesentlicher Teil einer Therapie sein.
[32] s. Stern, 1992, zit. n. Brisch, 2010, S. 89 f.
- Arbeit zitieren
- Philipp Telschow (Autor:in), 2011, "Das Kind ist da - die Seele kalt". Auswirkungen der Wochenbettdepression auf die Beziehung zum Kind und Musiktherapie als Ausweg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184881
Kostenlos Autor werden




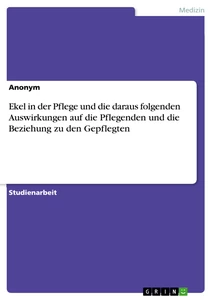

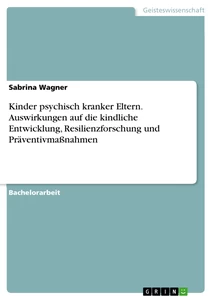








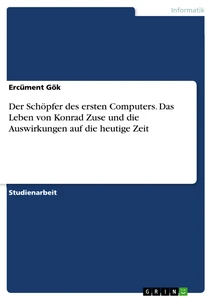




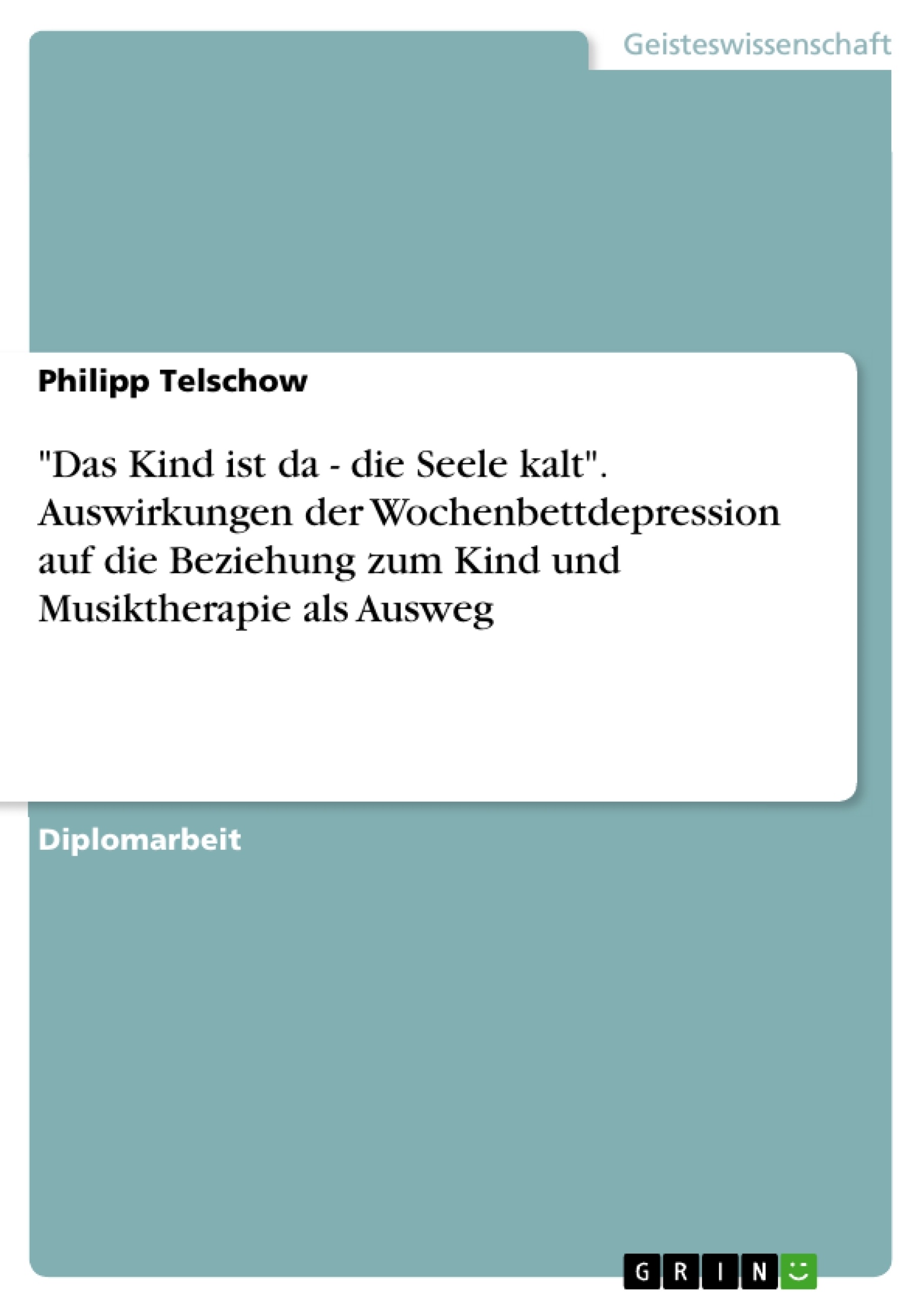

Kommentare