Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Entwicklung der Palliativmedizin
1.2 Begriffserklärungen und Definitionen
1.3 Therapieziele und Diagnostik in der Palliativmedizin
1.4 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE) - Patientenregister und Forschungsinstrument
1.5 Sonographie
2 Fragestellung
3 Methodik
3.1 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE)
3.2 Abteilungsinterne Dokumentation
3.3 Allgemeine Anmerkungen zur Methodik und Statistik
4 Ergebnisse
4.1 ErgebnisseHOPE
4.1.1 Teilnehmende Einrichtungen an HOPE und DIA-Modul-Rücklauf der HOPEDokumentation
4.1.2 Demographische Daten und Verweildauer des Gesamtkollektivs HOPE
4.1.3 Demographische Daten und Verweildauer der HOPE-Patienten mit DIA-Modul
4.1.4 Auswertung der Rücksendung des DIA-Moduls
4.1.5 Auswertung DIA-Modul Teil I: Mikrobiologische Untersuchungen (DI1a.-DI2)
4.1.6 Auswertung DIA-Modul Teil II: Bildgebende Verfahren (DI3a.-DI8.)
4.1.7 Auswertung DIA-Modul Teil II: Probleme bei der Durchführung / Beurteilbarkeit
4.1.8 Auswertung DIA-Modul Teil I + II: „technisch-analytisches Ergebnis"
4.2 Datenauswertung der Palliativstation der UMG
4.2.1 Demographische Daten und Verweildauer der Patienten der Palliativstation Göttingen
4.2.2 Auswertung der Sonographieergebnisse der UMG-Patienten
5 Diskussion
5.1 Allgemeiner Kontext der Untersuchung
5.2 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE)
5.2.1 HOPE als Patientenregister und Qualitätssicherungsinstrument
5.2.2 Teilnehmende Einrichtungen an HOPE und Nutzer des Moduls Diagnostik (DIA)..
5.2.3 DemographischeDaten
5.2.4 Diagnostik-Modul (DIA)
5.2.5 DIA-Modul Teil I: Mikrobiologie
5.2.6 DIA-Modul Teil II: Bildgebung
5.2.7 DIA-Modul Teil II: Probleme bei der Durchführung und Beurteilung
5.2.8 DIA-Modul I+II: „technisch-analytisches Ergebnis"
5.3 Sonographien der Palliativstation der Universitätsmedizin Göttingen
5.3.1 Allgemeines und Hintergrund der Studie
5.3.2 Demographische Daten und Verweildauer der UMG-Patienten
5.3.3 Auswertung der UMG-Patienten
5.4 Schlussfolgerungen
6 Zusammenfassung
7 Anhang
7.1 Dokumentationsbögen
7.1.1 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE) Basisbogen
7.1.2 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE) Modul Diagnostik
7.2 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE) Patienteninformation und Einverständniserklärung
7.3 Tabellen
7.3.1 Tabelle von der Homepage der DGP- Kurzinformationen HOPE 2008
7.3.2 Frequenzen der Sonographie im hausärztlichen Bereich
7.4 Dokumentationsbogen der UMG-Patienten
7.5 Englischsprachige Definition „Palliative care" gemäß WHO
(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 2009):
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1: Grundsätze derPalliativmedizin
Tabelle 2: Auflistung teilnehmender Einrichtungen
Tabelle 3: Gegenüberstellung derdemographischen Daten und der Verweildauerder
Patienten mitDIA-Modulzum GesamtkollektivHOPE
Tabelle 4: Verteilung dereinzelnen Verfahren im DIA-Modul
Tabelle 5: Auflistung der therapeutischen Konsequenzen
Tabelle 6: Prozentuale Verteilung dereinzelnen Verfahren
Tabelle 7: Aus bildgebender Diagnostik resultierende therapeutische klinische Konsequenzen
Abbildung 1: Probleme bei derDurchführung OS
Abbildung 2: Probleme bei derDurchführung PS
Tabelle 8: Ergebnisse „technisch/analytisches Ergebnis“
Abbildung 3: Anteile dereinzelnen Verfahren an den Konsequenzen
Tabelle 9: TeilnehmendeEinrichtungen undAnzahlderdokumentierten Patienten in HOPE im Zeitraum 1999 - 2008.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Entwicklung der Palliativmedizin
Das 1967 in London eröffnete St. Christopher's Hospice wird als das weltweit erste Hospiz der modernen Hospiz- und Palliativbewegung angesehen (Twycross, 1980). Gegründet wurde es von Cicely Saunders, die als wichtigste Vorreiterin und Vordenkerin der heutigen Palliativmedizin und Hospizarbeit gilt. C. Saunders formulierte 1977 folgende Grundsätze der Palliativmedizin:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Grundsätze der Palliativmedizin (Saunders, 1977)
Von da an entwickelten sich in Großbritannien die Hospizidee und die Palliativmedizin rasch weiter (Twycross, 1980). Erst 16 Jahre nach 1977 wurde in Deutschland die erste Palliativstation mit Hausbetreuungsdienst eröffnet. Sie entstand durch Prof. Pichlmeier als Förderprojekt der Deutschen Krebshilfe in Köln an der Chirurgischen Universitätsklinik (Klaschik et al., 2000; Sabatowski et al., 2001). Die Entwicklung verlief anfangs langsam, 1990 existierten erst 3 Palliativstationen, erst nachdem 1991 durch das Ministerium für Gesundheit in jedem Bundesland eine Palliativstation gefördert wurde, kam sie relativ schnell voran. Im Jahre 2000 existierten bereits 62 deutsche Palliativstationen, davon waren fünf Universitätskliniken angegliedert (Klaschik et al., 2000; Sabatowski et al., 2001). Zum Untersuchungszeitpunkt im Jahre 2007 gab es bundesweit bereits 142 Palliativstationen (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, 2007).
Im Vergleich entwickelte sich die palliativmedizinische Aus-, Fort- und Weiterbildung in Deutschland wesentlich langsamer und noch immer unzureichend (Röglin, 1998; Sabatowski et al., 2001). Der erste Lehrstuhl für Palliativmedizin wurde 1999 in Bonn eingerichtet, weitere folgten in Köln, Aachen, München und Göttingen (Dietz, 2009). Im Jahr 2002 wurde Palliativmedizin als fakultatives Fach in die Approbationsordnung aufgenommen und erst im Jahr darauf (2003) führte die Deutsche Ärztekammer (DÄK) die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin für Fachärzte ein. Im Juni 2009 wurde Palliativmedizin als Pflichtlehr- und Prüfungsfach in die ärztliche Approbationsordnung aufgenommen (Nauck, 2009). Auch wenn es durch die beeindruckende Zunahme palliativmedizinischer stationärer Einrichtungen (Radbruch et al., 2002) und die Einführung von einheitlichen Dokumentations- und Qualitätssicherungssystemen in den letzten Jahren zu einer deutlichen Entwicklung und Verbesserung in der palliativmedizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung für Ärzte und Studenten gekommen ist (Klinkhammer, 2007), bestehen noch immer Defizite (Klaschik, 2001; Lang et al., 2006; Nauck und Radbruch 2002; Nauck et al., 2008).
Auch heute noch wird Palliativmedizin als „junge Disziplin mit großem Potential" mit rasanter Entwicklung bezeichnet (Harstensstein, 2002; Klinkhammer, 2007).
1.2 Begriffserklärungen und Definitionen
Bei der Behandlung von Krankheiten unterscheidet man zwei unterschiedliche Therapieansätze: die kurative Therapie und die palliative Behandlung. Die kurative Medizin legt ihren Schwerpunkt auf die "Heilung" (curare, lat. = heilen) und Lebenserhaltung bzw. -Verlängerung. Es werden Therapien und Nebenwirkungen toleriert, die oft mit einer erheblichen Verschlechterung und Einschränkung der Lebensqualität des Patienten einhergehen. Die Palliativmedizin hingegen befasst sich nicht mit dem Heilen von Krankheiten, sondern mit dem „Schutz“ („pallium", der Mantel) des Patienten, der Linderung seiner Symptome („palliare", lindern), dem Erhalt seiner bestmöglichen Funktionsfähigkeit und seiner Lebensqualität/Zufriedenheit, wenn keine Heilung mehr möglich ist. Oft sind die Übergänge von kurativer zu palliativer Behandlung fließend. Im angelsächsischen Sprachgebiet differenziert man zwischen „Palliative Care" und „Palliative Medicine". „Palliative Medicine" beschreibt im angelsächsischen Sprachgebiet die ärztlichen Maßnahmen und kann definiert werden als „Untersuchungen und Behandlungen von Patienten mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen und eingeschränkter Lebenserwartung, bei denen der Schwerpunkt der Behandlung die Lebensqualität ist" (Doyle et al., 2005). Unter „Palliative Care" hingegen versteht man die „Palliative Betreuung" des Patienten mit allen nur möglichen multidisziplinären Versorgungsmöglichkeiten (Ärzte, Pflegepersonal, Sozialarbeitern, Psychologen usw.). Da im deutschen Sprachgebrauch die Trennung dieser beiden Begriffe nicht existiert, ist „Palliativmedizin" mit „Palliative Care" gleichzusetzen (DGP, 2003). Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten kurz erörtert:
Palliativmedizin:
In der Literatur findet man viele Definitionen des Begriffs Palliativmedizin, im Grunde aber sind sie sich alle sehr ähnlich und treffen die gleichen Kernaussagen.
Definition der World Health Organization (1990):
"Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung der Schmerzen, anderer Krankheitsbeschwerden, psychologischer, sozialer und spiritueller Probleme höchste Priorität besitzt." (World Health Organisation 1990, vgl. Anhang 7.5 aktuelle und erweiterte Definition englische Version) Definition der European Association for Palliative Care (2004):
Palliativmedizin ist eine aktive, ganzheitliche Betreuung von Patienten, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden. Bei der palliativen Behandlung stehen die Symptomkontrolle, die Schmerztherapie und die psycho-soziale Betreuung der Patienten im Vordergrund. Mit ihrem interdisziplinären Ansatz erfasst die Palliativmedizin nicht nur den Patienten, sondern auch seine Familie und sein soziales Umfeld. Dem Patienten soll die seinen Bedürfnissen angepasste bestmögliche ambulante oder stationäre Betreuung und Versorgung geboten und ermöglicht werden. Die Palliativmedizin bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen natürlichen Prozess des Lebens. Sie will diesen weder aufschieben noch herauszögern. Ihr Ziel ist es, dem Patienten die bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu ermöglichen.
(www.eapcnet.org/about/definition.html)
Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (2007):
„Palliativmedizin ist die Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung die Lebensqualität ist.“ (www.dgpalliativmedizin.de)
Nach den oben aufgeführten Definitionen beschäftigt sich die Palliativmedizin nicht nur mit der Finalphase, sondern auch mit früheren Krankheitsphasen (Rehabilitations-, Präterminal- und Terminalphase) (Jonen-Thielemann, 2007). Somit ergeben sich ganzheitliche, multidisziplinäre und multizentrische Aufgaben der Palliativmedizin. Das Hauptziel der Palliativmedizin ist die Verbesserung der Lebensqualität für den Patienten und seine Angehörigen (www.who.int).
Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst die Palliativmedizin, wie auch im Curriculum Palliativmedizin aufgeführt, folgende Inhalte und Prinzipen (Müller et al., 1997):
1. physischeAspekte (medikamentöse Symptomkontrolle, Flüssigkeitssubstitution in der Terminalphase, interventionelle Therapie und Physiotherapie in der Palliativmedizin)
2. psychische, soziale und spirituelle Aspekte (Berücksichtigung der psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse des Patienten, der Angehörigen und des Behandlungsteams sowohl bei Krankheit, beim Sterben und in der Zeit danach)
3. ethische und rechtliche Fragen (intensive Auseinandersetzung mit speziellen Fragen der Kommunikation, der Ethik, der Arzt-Patientenbeziehung, Selbstbestimmung des Patienten, Grenzen der Behandlung, Sterbehilfe und Sterbebeistand)
Die im Curriculum Palliativmedizin aufgeführten Inhalte und Ziele können unter verschiedenen organisatorischen Rahmenbedingungen sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich verfolgt werden. Der stationäre Bereich (Palliativstationen und Hospize) ermöglicht die Betreuung und Behandlung von Patienten, die durch den ambulanten Bereich (ambulanter Palliativdienst, ambulanter Hospizdienst, niedergelassene Ärzte mit palliativmedizinischer Weiterbildung) nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Ziel der stationären Einrichtungen sollte es, falls erwünscht, sein, dem Patienten das Sterben zu Hause in seiner vertrauten Umgebung bei seinen Angehörigen und Freunden zu ermöglichen. Im Rahmen der palliativmedizinischen Betreuung werden physische, psychische, soziale, spirituelle sowie ethisch-rechtliche Aspekte berücksichtigt.
Palliativpatient:
„Palliativpatienten" haben eine begrenzte Lebenserwartung und leiden an den Symptomen einer inkurablen, progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung. Dies ist die Beschreibung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (2003) und der European Association for Palliative Care (2010) in Anlehnung an die Definition der Weltgesundheitsorganisation (1990). Die Mehrzahl der Palliativpatienten ist tumorkrank, aber auch Patienten mit unheilbaren neurologischen und chronisch internistischen Erkrankungen werden palliativmedizinisch betreut.
1.3 Therapieziele und Diagnostik in der Palliativmedizin
Unter der Palliativtherapie versteht man die antineoplastische Therapie, die bei fehlendem kurativem Ansatz Einfluss auf die Tumorerkrankung selbst nimmt (Klaschik, 2001). Genauso wie die Übergänge von kurativer zu palliativer Therapie oft fließend sind, befinden sich die Patienten in einem dynamischen Prozess und durchlaufen mehrere Phasen, die im Rahmen der Behandlungsoptionen berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist dabei, sich im Therapieverlauf das unmittelbare Therapieziel immer wieder bewusst zu machen, dieses zu hinterfragen und einen eventuellen Therapieabbruch, wenn es die Situation des Patienten erfordern sollte, zu akzeptieren (Samonigg et al., 2000). Eine gebräuchliche Einteilung der Lebensphasen palliativmedizinischer Patienten, die durch die Kölner Palliativmedizinerin Dr. Jonen- Thielemann (2007) formuliert wurde, unterscheidet Rehabilitations-, Präterminal-, Terminal- und Sterbephase. Die Einordnung erfolgt klinisch nach erwarteter Prognose und Aktivität. Der Schwerpunkt palliativmedizinischer Behandlung liegt in der Rehabilitationsphase. In dieser Phase der letzten Monate - selten Jahre - des Lebens wird ein trotz Fortschreiten der Erkrankung weitgehend normales, aktives Leben angestrebt (Klaschik, 2001). Häufige Symptome von Palliativpatienten sind: Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Husten, Obstipation, intestinale Obstruktion, Verwirrtheit, Geruchsbildung oder präfinale Rasselatmung (Conill et al., 1997; Grond et al., 1994; Aulbert, 1998; Radbruch et al., 2003). Bei der symptomorientierten medikamentösen Therapie kommt der ethische Konflikt zwischen einer Verzögerung des Sterbeprozesses mit möglicher Verlängerung von Leid und einer möglichen Lebensverlängerung mit guter Lebensqualität zum Tragen. Hier sollte im Team und mit dem Patienten und seinen Angehörigen ein Konsens gefunden werde, der die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten respektiert (Aulbert et al., 2008).
Zu dem grundsätzlichen Einsatz von Diagnostik findet man in der Literatur keine konkreten Aussagen und Untersuchungen. Es scheint, als ob die Tatsache, dass die Palliativmedizin ein multidisziplinäres Querschnittsfach mit unterschiedlichen Fachrichtungen ist, kaum allgemeine Aussagen zu diagnostischen Standards zulässt. Es existieren zwar zahlreiche Leitlinien zu speziellen Teilgebieten der Palliativmedizin und in der palliativen Onkologie: medikamentöse Schmerztherapie, Prinzipien der medikamentösen antineoplastischen Systemtherapie, Leitlinien der Radionuklidtherapie bei schmerzhaften Knochenmetastasen, Prinzipien der modernen Strahlentherapie usw., für die Gesamtheit palliativmedizinischer Behandlungen und den Einsatz von Diagnostik gibt es aber bisher keine umfassenden Leit- oder Richtlinien (Becker-Schwarze, 2007).
1.4 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE) - Patientenregister und Forschungsinstrument
Die 1996 vom Bundesgesundheitsministerium initiierte Arbeitsgemeinschaft mit dem Auftrag der Entwicklung eines Dokumentationssystems zur standardisierten Erfassung von personen-, krankheits- und therapiebezogenen Daten zum Aufnahmezeitpunkt und Behandlungsende von Palliativpatienten in den verschiedenen Einrichtungen entstand in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). In Kooperation kam 2002 der heutige Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV, damals Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG Hospiz)) hinzu. Die Hospiz- und Palliativ-Erhebung (HOPE) wird seit 1999 im jährlichen Rhythmus durch eine große Anzahl von Einrichtungen angewendet, so dass die Datenbank von HOPE mittlerweile auf einen großen Datenpool mit 16983 Patientendatensätzen zurückgreifen kann (vgl. Anhang 7.3), mit dessen Hilfe repräsentative Auswertungen zur Palliativversorgung in Deutschland möglich sind.
Die große Zahl der beteiligten Einrichtungen, die Tatsache, dass sich HOPE auf die klinische Praxis bezieht und die regelmäßige Anpassung mit Erweiterung des Systems führen dazu, dass HOPE mittlerweile als Qualitätssicherungsinstrument mit Benchmarkingfunktion eingesetzt wird (Radbruch et al., 2002; Radbruch und Nauck, 2008). Der zweiseitige Basisbogen wird als Standarddokumentation für Palliativpatienten von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin empfohlen (Bausewein et al., 2007). Die erhobenen Daten geben Aufschluss über die betreuten Patienten, Therapiemaßnahmen und -erfolge und ermöglichen einen Vergleich zwischen den teilnehmenden Einrichtungen. Die Einführung von weiteren Modulen auf der Basis von spezifischen Forschungsfragen erweitert das Patientenregister zu einer Forschungsplattform. Finanziert wird HOPE durch die DKG, die DGP, den Deutschen Hospiz- und PalliativVerband und die Firma Mundipharma Limburg. Für die Teilnahme an HOPE gibt es keine speziellen Voraussetzungen. Es ist lediglich die Ernennung einer Kontaktperson, die an einem Vorbereitungstreffen teilnimmt und die die Datenerhebung in ihrer Einrichtung koordiniert, erforderlich. Die Anmeldung kann wahlweise zur Online-Dokumentation oder zur handschriftlichen Dokumentation erfolgen. Informationen und Anmeldeformulare sind auf folgenden Homepages: www.dgpalliativmedizin.de,www.palliativmedizin.ukaachen.de und www.hope-clara.de abrufbar oder schriftlich über die dort angegebenen Adressen anzufordern. Im Jahre 2009 wurde erstmalig für die Einrichtungen, die eine Papierdokumentation wünschten, eine Schutzgebühr von €65 für die Basisbögen und €10 für jedes weitere Modul (für Druck und Dateneingabe für bis zu 30 Patienten) erhoben. Die Online-Dokumentation in der internetbasierten elektronischen Datenbank CLARA (Clinical Analysis, Research and Application, auf www.hope-clara.de) blieb kostenfrei (Deutsche Gsellschaft für Palliativmedizin, 2009). Vor Studienbeginn werden die Patienten von Ärzten und/oder dem Pflegepersonal über die Studie informiert und geben schriftlich ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung der Daten (vgl. Anhang 7.2).
Das modulare System von HOPE besteht aus der sogenannten Kerndokumentation (Basisbogen), der vom Pflegepersonal und/oder dem Arzt, von Psychologen, Sozialarbeitern oder Ehrenamtlichen aus Sicht des Betreuerteams ausgefüllt wird. Es werden demographische und erkrankungsspezifische Daten (Erstdiagnose, Metastasierung bei Tumorerkrankungen, relevante Begleiterkrankungen, körperliche Symptome, pflegerische und psychosoziale Daten) erfasst (vgl. Anhang 7.1.1). Des Weiteren existieren verschiedene Fragebögen/Module mit spezifischen Fragestellungen zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen (vgl. 3. Methodik). So wurde 2007 unter anderem erstmals das von der Untersucherin entwickelte Modul zur erweiterten Diagnostik (DIA) eingesetzt und ausgewertet, indem der Einsatz von spezifischen Verfahren (mikrobiologische und bildgebende Verfahren) und deren Folgen und Konsequenzen für Palliativpatienten abgefragt wurden, das unter anderem Grundlage für diese wissenschaftliche Arbeit ist.
HOPE wurde bereits in der Vergangenheit zu wissenschaftlichen Fragestellungen herangezogen (Bausewein et al., 2005; Radbruch et al., 2000) und ist damit wesentliche Grundlage für Forschung in der Palliativmedizin in Deutschland.
1.5 Sonographie
Die Sonographie ist deutschlandweit das am häufigsten eingesetzte nichtinvasive bildgebende Verfahren und gängiger Bestandteil der erweiterten klinischen Untersuchung (Kassenärztliche Bundesvereinigung, 2009). Sie ist problemlos verfügbar, basiert auf dem Einsatz nichtionisierender Strahlen und unterliegt im Gegensatz zu anderen Schnittbildverfahren keinen patientenbezogenen Kontraindikationen. Zudem erlaubt die kontinuierliche Bildgebung in Echtzeit die Beantwortung morphologischer und funktioneller Fragestellungen (Mariani und Setlaj, 2010). Es dient zur Statuserhebung und hilft bei der Beantwortung vieler differentialdiagnostischer Fragen. Es findet seinen Einsatz in nahezu jedem medizinischen Fachgebiet. Da die Palliativmedizin ein multidisziplinäres Fach ist und mit vielseitigen klinischen Fragestellungen konfrontiert wird, ist es auch hier ein ideales bildgebendes Verfahren. Fragestellungen an die sonomorphologische Bildgebung in der Palliativmedizin zielen u.a. auf das Erkennen von tumor- oder therapieassoziierten Komplikationen, die Abklärung eventuell spezifisch behandelbarer Symptome wie Schmerzen, Luftnot, Erbrechen, die prognostische Neueinschätzung im Hinblick auf Tumorwachstum und - Dynamik ab. Zu diesen Fragestellungen gibt es in der Literatur einige Studien, die den Einsatz von Ultraschall, zum Zweck der Diagnostik empfehlen. Mit dem Einsatz moderner Ultraschalldiagnostik können Komplikationen früher erkannt und behandelt werden. Ebenfalls ermöglicht die Sonographie ein schnelles Staging und eine Abschätzung und Einschätzung der aktuellen gesundheitlichen Situation des Patienten. Die Tatsache der Unschädlichkeit der eingesetzten Schallwellen und die leichte und fast flächendeckende Verfügbarkeit ist ein weiterer Vorteil für den Einsatz in der Palliativmedizin. Zudem können einige wichtige Befunde wie z.B. Harnstau oder das Erkennen freier Flüssigkeit auch rasch vom nichtgeübten Untersucher erlernt und angewendet werden (Gebel, 2000). Die Studie „Bedside ultrasound- experience in palliative care units" (Gishen und Trotman, 2009) geht sogar davon aus, dass ein stationseigenes Ultraschallgerät auf Palliativstationen zu einer Liegezeitverkürzung führt, weil unnötige Wartezeiten in der für die Sonographie zuständigen Abteilung und Wege dorthin vermieden werden können (Gishen und Trotman, 2009). Einen weiteren Vorteil sehen Gishen und Trotman in der Flexibilität und Vielseitigkeit des Einsatzes. Zwar führte Gishen die meisten Untersuchungen (52,5%) zum Nachweis eines Aszites und einer anschließenden sonographisch gesteuerten Punktion durch, er schreibt aber auch, dass die Sonographie bei der Darstellung und Beurteilung der harnableitenden Organe, der Pleura, der abdominellen Metastasensuche, bei Blasenfunktionsstörungen oder bei Fragestellungen bezüglich tiefer Beinvenenthrombosen sinnvoll ist. Einen weiteren ganz anderen Benefit sehen die Autoren in der Einsparung der Kosten. Gishen zufolge kostet eine sonographische Untersuchung in einem radiologischen Zentrum ca. £ 67 (Department of Health, 2007). Diese Kosten schließen aber nicht weitere Betreuungs- oder Transportkosten ein. Im Vergleich dazu betrugen die Kosten pro Untersuchung in Gishens Studie ca. £ 20. Aus Gishens Studie ziehen die Autoren (Gishen und Trotman, 2009) das Fazit, dass der Einsatz von modernen Untersuchungstechniken in der Palliativmedizin durchaus ratsam ist und gefördert werden sollte, da dies ihrer Meinung nach zu einer Verbesserung der Behandlung führt („We belive that by adopting a proactive technical approach the use of this technique can enhance the quality of care we give our patients." (Gishen und Trotman, 2009, S.43)). Leider gibt es zu dem allgemeinen Einsatz der Sonographie in der Forschung kaum weitere wissenschaftliche Studien. Dieser Umstand führte zu der Fragestellung, welche Bedeutung sonographische Untersuchungen in der Palliativmedizin haben und was für Konsequenzen sich daraus ergeben.
2 Fragestellung
Aus den oben dargestellten wissenschaftlichen Grundlagen ergibt sich die Frage, ob und mit welcher Indikation nichtinvasive Diagnostik in dem palliativmedizinischen Setting zum Einsatz kommt. Zu diskutieren ist ebenfalls die Problematik der Belastung für die Patienten und ob sich diese evtl. minimieren ließe. Die vorliegende Untersuchung soll erstmalig dokumentieren, in welchem Ausmaß und mit welcher klinischtherapeutischen Relevanz nichtinvasive Diagnostik im palliativmedizinischen Alltag eingesetzt wird. Dies erfolgt am Beispiel der mikrobiologischen Labordiagnostik und der Bildgebung (Sonographie, konventionelles Röntgen, Schnittbildgebung (CT/MRT) und nuklearmedizinische Diagnostik).
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Auswertung der 70 sonographischen Untersuchungen, die auf der Palliativstation am Universitätsklinikum Göttingen (Abteilung Palliativmedizin, Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin) durchgeführt und dokumentiert wurden. Diese sollen beispielhaft für nichtinvasive diagnostische Maßnahmen - unter den genannten Aspekten der therapeutischen Relevanz und der Belastung für den Palliativpatienten - diskutiert werden.
Im Einzelnen sollen, anhand der Ergebnisse der HOPE-Studie und der abteilungsinternen Sonographien insbesondere folgende Fragen beantwortet werden:
- In welchem Ausmaß findet in der stationären Palliativmedizin nichtinvasive Diagnostik statt? Wie viele Patienten erhielten nichtinvasive Diagnostik? Welchen Stellenwert hat die Sonographie in der Palliativmedizin?
- Gibt es einen Unterschied in der Einsatzhäufigkeit zwischen Palliativstationen und onkologischen Stationen?
- Nach welchen Untersuchungen (bildgebende-/ mikrobiologische Verfahren) kam es wie häufig und in welchem klinischen Ausmaß zu welchen therapeutischen Konsequenzen?
- Welche Probleme traten bei der Durchführung von diagnostischen Maßnahmen auf? Wie belastend ist die nichtinvasive Diagnostik für den Patienten?
- Gibt es Möglichleiten, die Belastungen, die durch die Durchführung für den Patienten entstehen, zu minimieren?
- Wie häufig kam es zu Problemen bei der Beurteilbarkeit des mikrobiologischen Laborergebnisses bzw. der Bildgebung?
Durch die Beantwortung dieser Fragen soll ein Zustandsbericht des bisherigen Einsatzes nichtinvasiver Diagnostik in stationären palliativmedizinischen Versorgungsbereichen gegeben werden, um daraus Möglichkeiten zur Verbesserung der Behandlung von Palliativpatienten abzuleiten. Dabei werden mit Hilfe einer quantitativen Datenerfassung erstmalig der besondere Aspekt der Sonographie als alleiniges bildgebendes Verfahren und deren Relevanz und Konsequenzen für die Patienten im palliativmedizinischen Setting betrachtet.
3 Methodik
Die vorliegende Untersuchung zur Beantwortung der oben gestellten Fragen basiert auf zwei Datenquellen: die der Hospiz- und Palliativerhebung HOPE und die der abteilungsinternen Dokumentation.
3.1 Hospiz- und Palliativerhebung (HOPE)
Um die in der Einleitung und Abschnitt 2 gestellten Fragen zu beantworten, wurde von der Untersucherin das Modul Diagnostik (DIA) der Hospiz- und Palliativerhebung, in dem Aspekte zur Qualität und Quantität von bildgebenden und mikrobiologischen Verfahren abgefragt wurden, entwickelt und ausgewertet. Weiterhin wurden die Teilergebnisse des Basisbogens (sog. Kerndokumentation) der HOPE-Dokumentation im Erhebungszeitraum von März bis Juni 2007 ausgewertet, um weitere demographische Fakten und spezielle Informationen der Patienten zu nutzen. Zusätzlich wurden 70 Ultraschalluntersuchungen auf der Palliativstation der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) erfasst und ausgewertet.
Die Hospiz- und Palliativerhebung HOPE beinhaltet die Erfassung grundlegender Daten palliativmedizinisch oder in einem Hospiz behandelter und begleiteter Patienten in stationären oder ambulanten Versorgungseinrichtungen. HOPE wird durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) und die Firma Mundipharma Limburg gefördert und arbeitet seit 1999 mit Palliativstationen, onkologischen Stationen, stationären Hospizen und ambulant tätigen Ärzten zusammen, die zur Teilnahme an der Dokumentation eingeladen werden.
Bei HOPE werden über den Zeitraum vom 15.03. - 15.06. eines jeden Jahres Daten von maximal 30 Patienten einer teilnehmenden Einrichtung nach Einholung einer schriftlichen Einverständniserklärung pseudonymisiert erfasst. Eine Dokumentation der Daten erfolgt überwiegend online mit einer zu diesem Zweck eingerichteten Datenbank (www.hope-clara.de) oder handschriftlich auf den angeforderten und ausgedruckten Dokumentationsbögen. Der über ein Kennwort und einen Zugangscode geschützte Online-Zugang war über den gesamten Dokumentationszeitraum eingerichtet, die Daten konnten von der eingebenden Einrichtung eingesehen und ggf. korrigiert werden. Die Dokumentationsbögen sollten bis zum 30.6.2007 online in die Datenbank eingetragen oder auf Papier ausgefüllt und per Post zur Auswertung versandt werden. Dokumentationsbögen, die nach dem 30.06.2007 eintrafen, wurden nicht mehr in die Auswertung einbezogen. Patienten, die während der Dokumentationsphase entlassen worden sind, durften bei einer Wiedervorstellung nicht erneut in die Dokumentation aufgenommen werden.
Zur Dokumentation standen folgende Bögen zur Verfügung:
- Basisbogen: Es sollten mindestens zwei Basisbögen pro Patient ausgefüllt werden, einer zu Beginn (Aufnahmebogen) und einer am Ende (Abschlussbogen) (vgl. Anhang 7.1). Mit Hilfe dieser Dokumentationsbögen wurden grundlegende Eckdaten der medizinischen Krankheitsvorgeschichte, der aktuellen klinischen, pflegerischen und psychosozialen Problematik und der stattgehabten therapeutischen Interventionen zu Beginn, im Verlauf und am Ende einer (stationären oder ambulanten) Behandlung (Entlassung bzw. Versterben) dokumentiert.
Des Weiteren konnten von den teilnehmenden Einrichtungen optional verschiedene Modulbögen angefordert und ausgefüllt werden:
- DIA: Erfassung von diagnostischen Maßnahmen
In dem speziell für diese Fragestellung von der Untersucherin neu entwickelten Modul wurden beispielhaft für diagnostische Maßnahmen in der Palliativmedizin die Daten von Patienten mit mikrobiologischen und bildgebenden Verfahren (Sonographie, Röntgen, CT/MRT und nuklearmedizinischer Diagnostik) dokumentiert (vgl. Anhang 7.1). Die ausfüllende Person konnte in dem Modul DIA nicht nur Angaben zu der Qualität und Quantität der durchgeführten Untersuchungen machen, sondern auch über die therapeutische Relevanz und die Probleme, die während und durch die Untersuchung für den Patienten entstanden sind. Der Bogen sollte einmalig retrospektiv bei der Entlassung des Patienten ausgefüllt werden.
Darüber hinaus konnten folgende Module konsekutiv von den teilnehmenden Einrichtungen ausgefüllt werden:
[...]
- Arbeit zitieren
- Dr.med. Ruth Sürig (Autor:in), 2011, Ausmaß und therapeutische Relevanz nichtinvasiver Diagnostik in der Palliativmedizin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183846
Kostenlos Autor werden





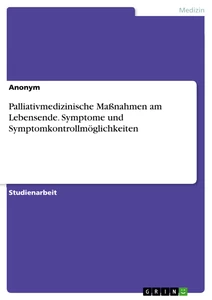
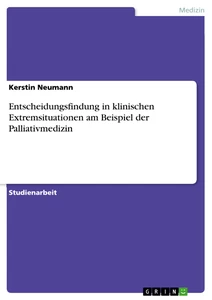

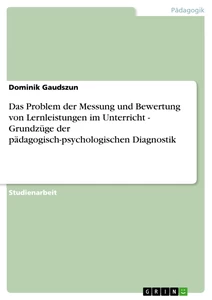



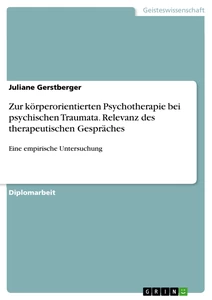






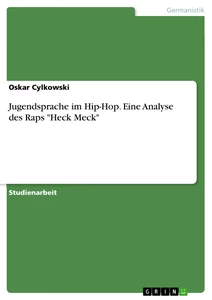
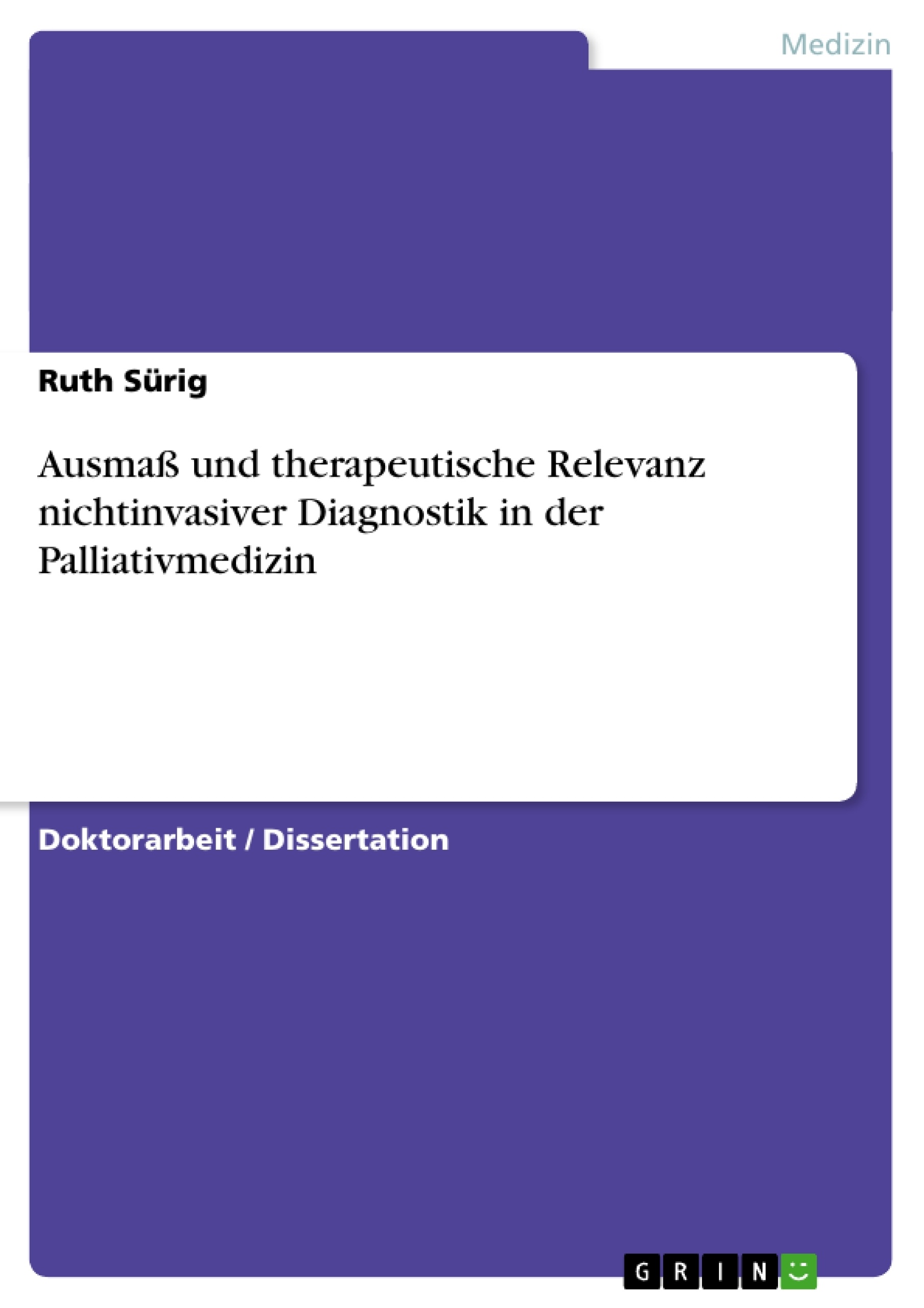

Kommentare