Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung
2.1 Die organisierte Selbsthilfe in den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems
2.1.1 Definition der Selbsthilfe und Einordnung der verschiedenen Organisationsformen
2.1.2 Entstehung und Entwicklung der Selbsthilfe
2.1.3 Ökonomische Aspekte der Selbsthilfe
2.2 Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitssystem
2.2.1 Formen der kollektiven Patientenbeteiligung
2.2.2 Gesetzliche Grundlagen kollektiver Patientenbeteiligung
2.2.2.1 Die Patientenbeteiligungsverordnung als Inhalt des GKV-Modernisierungsgesetzes
2.2.2.2 Entwicklungen zum geplanten Patientenrechtegesetz
2.2.3 Die Einbindung von Patientenvertretern in politische Institutionen am Beispiel des Gemeinsamen Bundesausschuss
2.2.4 Erfahrungen zur Patientenbeteiligung aus verschiedenen Perspektiven
2.2.5 Legitimation als Grundvoraussetzung für die Vertretung kollektiver Interessen
3. Methodisches Vorgehen in Theorie und Praxis
3.1 Fragestellungen der Untersuchung
3.2 Methodik der qualitativen Sozialforschung
3.2.1 Das qualitative Experteninterview als angewandte Forschungsmethode
3.2.1.1 Vorbereitung der Interviews
3.2.1.2 Entwicklung und Anwendung des Leitfadeninterviews
3.2.2 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode
4. Darstellung der Ergebnisse
4.1 Auswertung der Experteninterviews
4.1.1 Form der Einbindung
4.1.2 Vereinbarkeit politischer Beteiligung und genuiner Aufgaben
4.1.3 Qualifikation
4.1.4 Optionen zur Verbesserung
4.1.5 Auswirkungen für den individuellen Patienten
4.2 Ergebnisse weiterer Rückmeldungen
5. Diskussion
5.1 Diskussion zentraler Ergebnisse
5.2 Weiterführende Fragestellungen
5.3 Kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns
6. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang 1: Anschreiben Interviewpartner
Anhang 2: Begleitschreiben von Frau Professor Dierks
Anhang 3: Leitfadeninterview
Danksagung
Die vorliegende Magisterarbeit ist Teil meines Public Health-Studiums am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover. Für die Betreuung von dieser Seite möchte ich mich recht herzlich bei Frau Professor Dr. Marie-Luise Dierks und Herrn Professor Dr. Volker Amelung bedanken.
Die Arbeit ist im Rahmen meines Praktikums bei dem forschenden Arzneimittelunternehmen GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG entstanden. Mein Dank gilt meiner Vorgesetzen Ilka Einfeldt für ihre Unterstützung sowie meinen Kollegen für die konstruktive Kritik und die motivierenden Worte.
Mein ganz besonderer Dank gilt den Interviewpartnern, die mir für meine Magisterarbeit ihr Vertrauen entgegengebracht haben und durch ihre Offenheit diese Arbeit überhaupt ermöglichten. Ebenso habe ich mich sehr über die vielen weiteren Rückmeldungen und das große Interesse an der Studie gefreut.
Besonders wichtig für eine möglichst fehlerfreie und methodisch korrekte Erstellung dieser Arbeit waren Mareile Heineke, Katharina Hoier und Britta Migos, denen ich hiermit meinen Dank für die Unterstützung während der Phase meiner Magisterarbeit und für die jahrelange Freundschaft aussprechen möchte.
Abschließend möchte ich mich bei meinen Eltern und Großeltern für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strukturen der Selbsthilfe in Deutschland
Abbildung 2: Vom Patienten zum Bürger – Rollen der Nutzer des Gesundheitswesens
Abbildung 3: Beteiligungsmodelle für Bürger- und Patientengruppen
Abbildung 4: Kontinuierliche Beteiligung von Patienten- vertretern und –vertreterinnen in unterschiedlichen Gremien des deutschen Gesundheitswesens
Abbildung 6: Die Sitzverteilung im Gemeinsamen Bundesausschuss
Abbildung 7: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell
Abbildung 8: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Durch das im Jahr 2004 verabschiedete GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) wurde die Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen festgeschrieben und somit die Einbeziehung von Patientenvertretern[1] in gesundheitspolitische Gremien wie den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ermöglicht. Das professionelle Gesundheitssystem zeigt durch die zunehmende Beteiligung von Patienten, dass die Kompetenzen der Betroffenen für die Entscheidungsfindung der Gesundheitspolitik eine Rolle spielen. Das Interesse an der Einbeziehung der Meinungen von Patienten steigt, da die Betroffenenperspektive eine Ergänzung der Positionen von Politik, Leistungserbringern und Kostenträgern bieten kann und zusätzlich damit die Erwartung an eine verstärkte Legitimation für gesundheitspolitische Entscheidungen verbunden ist.
Die Relevanz der Thematik ergibt sich aus der aktuellen Diskussion um die Rechte von Patienten und die kollektive Patientenbeteiligung. Das geplante Patientenrechtegesetz, welches noch im Jahr 2011 verabschiedet werden soll, und die derzeitige Debatte um eine Neustrukturierung des G-BA führen dazu, dass neben den klassischen Rollen der Leistungserbringer und Kostenträger auch die Rolle weiterer Akteure, wie die der Patienten, neu definiert und positioniert werden kann.
Die Selbsthilfe in organisierten Strukturen existiert in vielen Gebieten unserer Gesellschaft. Die vorliegende Magisterarbeit konzentriert sich auf die gesundheitsbezogene Selbsthilfe. In diesem Bereich bestehen verschiedene Arten der Formierung, wie Selbsthilfegruppen, -organisationen oder –Kontaktstellen. Ohne auf eine Definition der einzelnen Arten zu verzichten, fasst diese Arbeit die bestehenden Formen unter dem Begriff „Selbsthilfezusammenschluss“ zusammen.
Mit der vorliegenden Magisterarbeit soll die Frage beantwortet werden, welche Auswirkungen die Möglichkeiten der Partizipation auf politischer Ebene für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe haben. Unter Beachtung indikationsspezifischer Unterschiede der Selbsthilfezusammenschlüsse soll die Auswirkung der Beteiligung an politischen Prozessen auf die grundlegende Arbeit der Selbsthilfe untersucht werden. Die Einschätzung der eigenen Kompetenz für die Wahrnehmung der politischen Aufgaben und die Gestaltung zukünftiger Weiterentwicklungsoptionen für die politische Beteiligung werden erfragt und aufgezeigt. Abschließend soll die Analyse zeigen, wie sich nach Meinung der Selbsthilfevertreter die politische Beteiligung der Selbsthilfe auf die Situation der Patienten in Deutschland auswirkt.
Den Hintergrund für die Beantwortung der Forschungsfragen liefern qualitative Experteninterviews mit Patientenvertretern aus den Reihen der Selbsthilfe, die als offene und teilstandardisierte Leitfadengespräche durchgeführt wurden. Ausgehend von einem indikationsspezifischen Untersuchungsansatz, der sich auf den Vergleich von Erkrankungen mit hoher Prävalenz und Erkrankungen seltener Art bezieht, wurden zehn Patientenvertreter befragt, welche die kollektiven Beteiligungsrechte der Selbsthilfe auf politischer Ebene wahrnehmen.
Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel die gesundheitsbezogene Selbsthilfe anhand ihrer verschiedenen Definitionen beschrieben. Ein Überblick der verschiedenen Organisationsformen von Selbsthilfezusammenschlüssen dient der Einführung in den Themenbereich, mit dem sich die Arbeit auseinandersetzt, sowie der Einordnung der Fragestellungen in das umfangreiche Gebiet der Selbsthilfe. Über die Entstehung und Entwicklung der Selbsthilfe hinaus wird auf deren ökonomische Aspekte eingegangen.
Weiterhin dient das zweite Kapitel dazu, Grundlagen der Patientenbeteiligung und der kollektiven Patientenrechte, eingeordnet in die Strukturen des deutschen Gesundheitssystems vorzustellen. Als Einführung des Kapitels werden die Rollenveränderung des Patienten im Gesundheitswesen und die Begründung für eine zunehmende Patientenbeteiligung beschrieben. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen werden die Patientenbeteiligungsverordnung und das geplante Patientenrechtegesetz vorgestellt. Die konkrete Umsetzung der Patientenbeteiligung wird am Beispiel des G-BA beleuchtet. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und Berichte von aktiven Patientenvertretern ergänzen die theoretischen Grundlagen um den aktuellen Stand der Forschung.
Um wichtige Entscheidungen, die für die gesundheitlichen Belange eines Kollektives gelten, fällen zu können, bedarf es der Legitimation der ausgewählten Entscheidungsträger. Dieser Frage nach der notwendigen Legitimation wird zum Abschluss der theoretischen Grundlagen nachgegangen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Begründung zur Wahl des methodischen Vorgehens, den theoretischen Grundlagen zur Methodik und deren praktischer Anwendung. Das Untersuchungsdesign wird ausführlich beschrieben und begründet, um die Nachvollziehbarkeit der Studie zu gewährleisten.
Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews analysiert und auf indikationsspezifische Unterschiede untersucht. Die Aussagen werden vorab entwickelten Kategorien zugeordnet und bezogen auf den Indikationsunterschied vergleichend dargestellt.
Des Weiteren werden Informationen, die anhand von Gesprächen, welche sich über die systematische Befragung hinaus ergeben haben, Eingang in das vierte Kapitel finden. Diese Ergebnisse werden deutlich getrennt von den Ergebnissen der qualitativen Interviews dargestellt.
Das Resultat der Analyse mündet im fünften Kapitel in die Diskussion. Zu Beginn werden die zentralen Ergebnisse diskutiert und die Forschungsfragen beantwortet. Es folgt die Entwicklung von weiterführenden Fragestellungen. Die kritische Betrachtung des gewählten Untersuchungsdesigns bildet den Abschluss der Diskussion.
Im sechsten Kapitel folgen das Fazit der Arbeit und ein Ausblick auf die zukünftige Gestaltung der Patientenbeteiligung in den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems.
Diese Magisterarbeit entstand in Zusammenarbeit mit dem Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover und dem forschenden Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG. Eine Veröffentlichung dieses Dokuments oder von Auszügen ist nur mit Zustimmung beider Parteien möglich.
2. Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung
An dieser Stelle soll der theoretische Rahmen, in den das Forschungsgebiet eingebettet ist, ergänzt um den aktuellen Stand der Forschung, dargestellt werden.
2.1 Die organisierte Selbsthilfe in den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems
Nach Definition der Weltgesundheitsbehörde (WHO) ist Gesundheit „ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 1946: 1). Neben der weiten Verbreitung dieser Begriffsbestimmung unterliegt sie zeitgleich großer Kritik, die sich auf das definierte vollkommene Wohlbefinden bezieht. Laut dem Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (SVR) ist dieser Zustand ein „utopisches Maximum an Gesundheit“ (2002: 74). Der SVR, beauftragt durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), setzt sich in seinem Gutachten 2000/2001 zur Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem Begriff Gesundheit, dessen individueller Bedeutung und Tragweite auseinander. Denn neben zahlreichen allgemeinen Definitionen von Gesundheit ist dieser Zustand letztlich ein subjektiv geprägter Begriff. Er lässt sich nicht ausschließlich an Morbiditäts- und Mortalitätszahlen messen, sondern beinhaltet eine weite Bandbreite an subjektiven Einflüssen. Soziale, psychische und physische Faktoren können individuell gewichtet werden und sich dementsprechend auf das Empfinden von und den Umgang mit Krankheit auswirken (SVR 2002: 73-75).
In der Bevölkerung besteht breiter Konsens darüber, dass Gesundheit ein sehr wichtiges Gut ist. Nicht zuletzt, weil der Grat zwischen Gesundheit und Krankheit schmal ist und „jeder gesunde Mensch ein potenzieller Patient“ (Hänlein/Schroeder 2010: 48) sein kann. Ist die Gesundheit bedroht, kann der Austausch mit anderen Betroffenen Unterstützung und Halt bieten. Diese Form von Beistand und der damit verbundene Wissenstransfer können in Selbsthilfegruppen stattfinden und sind speziell im Gesundheitsbereich weit verbreitet. Etwa 75 % aller Selbsthilfegruppen befassen sich mit gesundheitlichen Belangen (Matzat 2009: 349).
Auch der SVR bescheinigt der Selbsthilfe eine wichtige Funktion im Gesundheitswesen, „die sowohl quantitativ als auch qualitativ einen erheblichen Teil der Gesundheitsversorgung abdeckt und nicht durch das professionelle System ersetzt werden könnte“ (SVR 2002: 296).
2.1.1 Definition der Selbsthilfe und Einordnung der verschiedenen Organisationsformen
Die Definition von Selbsthilfe ist sehr vielseitig und „umfasst ein weites Spektrum von Bedeutungen und Assoziationen“ (Borgetto 2002: 5). Der Begriff an sich ist „umgangssprachlicher Natur“ und kann auch durch das Hinzufügen des Gesundheitsbezuges nicht näher eingegrenzt werden, da beide Begriffe ein „alltagsbezogenes, ausgedehntes Assoziations- und Handlungsfeld“ aufweisen (Grunow 2006: 1053). Dennoch versuchen sich verschiedene Autoren an einer Definition, wie beispielsweise Alf Trojan, ehemaliger Direktor des Instituts für Medizin-Soziologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der Selbsthilfe als Oberbegriff für „ alle individuellen und kollektiven Handlungsformen ´Betroffener´, die der Vorbeugung und besseren Bewältigung von Krankheiten, psychischen und sozialen Problemen ohne Inanspruchnahme bezahlter professioneller Dienste dienen“ (1986: 38) versteht.
Bernhard Borgetto, Diplom-Soziologe in der Abteilung für Medizinische Soziologie der Universität Freiburg, kritisiert diese Definition hinsichtlich ihrer begrifflichen Unschärfe durch das nicht Ausschließen der möglichen Fremdhilfe durch Laien und beschreibt die Selbsthilfe selbst folgendermaßen: „Gesundheitsbezogene Selbsthilfe umfasst individuelle und gemeinschaftliche Handlungsformen und bezieht sich idealtypisch auf die Beseitigung eines gesundheitlichen Mangels oder die Lösung eines gesundheitlichen (oder gesellschaftlich verursachten) Problems durch die jeweils Betroffenen unter Ausschluss von Fremdhilfe, d.h. formal organisierter professioneller Hilfe und der Hilfe nicht betroffener Laien“ (2002: 5).
Eine Beschreibung aus den Reihen der Selbsthilfe heraus, die durch Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG Selbsthilfe)[2] formuliert wurde, benennt als Gesundheitsselbsthilfe die Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen. Zurückzuführen ist diese auf die verschiedenen Bewegungen der Behindertenselbsthilfe, der Suchtselbsthilfe sowie der Selbsthilfe chronisch Erkrankter (Danner/Nachtigäller/Renner 2009: 5).
Aus einer gesundheitspolitischen Sicht beschreibt Rolf Rosenbrock, Professor für Gesundheitspolitik und Mitglied des SVR, die Selbsthilfe. Er definiert sie als „ein alter und nach wie vor wachsender und blühender Zweig im Gebüsch des Systems der Gesundheitssicherung. Die gesundheitlichen, zivilgesellschaftlichen und ökonomischen Leistungen sowie die Bindungskraft von Selbsthilfe sind eindrucksvoll und haben bislang noch jede `Gesundheitsreform` und jeden gesundheitswissenschaftlichen Paradigmenwechsel überstanden“ (2001: 39).
Es wird deutlich, dass Selbsthilfe ein breites Spektrum umfasst und dass die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln entsprechend andere definitorische Akzente setzt. Das Grundprinzip der Selbsthilfe, die Betroffenenkompetenz wird nicht explizit erwähnt, soll aber an dieser Stelle Eingang in die Begriffsbestimmung finden. Ergänzt um Eigeninitiative und ein erhebliches Maß an Engagement führt dies zu einer hohen Akzeptanz bei Betroffenen und ihren Angehörigen (GKV-Spitzenverband 2009: 6).
Ausgangspunkt der Selbsthilfe ist bei einer engen Betrachtung die Lösung von Beschwerden durch das Individuum selbst. Diese Eigenhilfe oder auch individuelle Selbsthilfe wird häufig durch die Unterstützung von Dritten ergänzt. Als Dritte können unter dem Begriff sozialer Selbsthilfe die Familie, das nähere Umfeld oder auch Kontakte aus einer Selbsthilfegruppe gelten, die keinen beruflichen Hintergrund haben, der sie für die professionelle Pflege qualifiziert (Grunow 2006: 1053). Die kollektive oder auch gemeinschaftliche Selbsthilfe meint die gegenseitige Unterstützung innerhalb von Selbsthilfezusammenschlüssen, die speziell für den Austausch Betroffener initiiert wurde (Borgetto 2004: 79-80).
Eine weitere Unterscheidung wird zwischen den Begriffen Selbsthilfe und Fremdhilfe vollzogen. „Selbsthilfe umfasst alle individuellen und gemeinschaftlichen Handlungsformen, die sich auf die Bewältigung eines gesundheitlichen oder sozialen Problems (Coping) durch die jeweils Betroffenen beziehen. Fremdhilfe bezeichnet demgegenüber sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Hilfe von nicht betroffenen Laien oder Fachleuten/Experten“ (Borgetto 2004: 80). Zwischen diesen unterschiedlichen Formen der Hilfe bestehen „fließende Übergänge und/oder enge Verflechtungen“ (Grunow 2006: 1067) und daher ist eine präzise Abgrenzung in der Praxis nicht immer möglich. Unabhängig davon, welche Form der Selbsthilfe ausgeübt wird, sollte sie im besten Falle eine Ergänzung des professionellen Systems darstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch überwiegend die Meinung vertreten, dass die Tätigkeiten der Selbsthilfe als „Leistungen zur Bedarfsdeckung und Bedürfnisbefriedigung außerhalb des professionellen Gesundheitssystems“ (Trojan 2003: 324) gelten. Die Annahme, dass der Staat viele Bereiche der gesundheitlichen Versorgung für die Bürger nicht adäquat abdecken kann, trägt zur wachsenden Bedeutung der Selbsthilfe bei (Kaufmann 2010: 236). Jedoch hat die Selbsthilfe das Potential, dass sie gemeinsam mit der „Staatshilfe […] keine sich ausschließenden Alternativen, sondern komplementäre Perspektiven auf den Gesamtprozess der Wohlfahrtsproduktion“ (Kaufmann 2010: 232) bieten kann.
Grundlegende Prinzipien des deutschen demokratischen Staates sind laut Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) für die Bundesrepublik Deutschland Subsidiarität und Solidarität (Bundesministerium der Justiz 1949: 20). Demnach orientiert sich auch das Gesundheitssystem an diesen Grundsätzen. „Unter Gesundheitssystem versteht man den Gesamtbereich der Organisation gesundheitlicher Versorgung durch Ärzteschaft, Kassen und (regulierend) Gesundheitspolitik. Das Gesundheitssystem und seine Akteure sind in erster Linie verantwortlich für die Qualität, Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung“ (Hart 2003: 336). Subsidiarität greift in diesem System an erster Stelle und bedeutet, dass jedes Individuum der Gesellschaft seinen Möglichkeiten entsprechend für sich selber einsteht. Sind diese Möglichkeiten vollends erschöpft, bietet das nähere Umfeld wie die Familie Unterstützung. Der Staat und die Gesellschaft dienen als Hilfefunktion in letzter Instanz und vertreten den Grundsatz der Solidarität, nach dem die Fürsorge für Bürger übernommen wird, die durch Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit oder andere Schicksalsschläge Unterstützung benötigen.
Das Solidaritätsprinzip ist die Grundlage des deutschen Sozialversicherungssystems. „Selbsthilfeinitiativen haben eine neue Form sozialer Solidarität entwickelt, die auf der zwischenmenschlichen Verbundenheit vor dem Hintergrund gemeinsamer Betroffenheit aufbaut, die sich zwischen die bekannten Formen familiärer und religiös motivierter Nächstenliebe schiebt und dafür eine heute notwendige Ergänzung darstellt“ (Engelhardt u. a. 1995: 192).
Nach aktuellen Erkenntnissen des Diplom Psychologen Jürgen Matzat (2009: 349), Leiter der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen[3], werden in Deutschland rund 100.000 Selbsthilfegruppen gezählt, die ergänzt werden von über 100 Selbsthilfeorganisationen und etwa 300 Selbsthilfekontaktstellen. Diese quantitative Aussage ist unter der Annahme zu betrachten, dass die Schätzung abhängig ist von der jeweiligen Definition des Begriffes Selbsthilfe. Die häufig sehr unterschiedlichen Angaben, die in der Literatur zu finden sind, unterstreichen die Problematik, die mit der quantitativen Erhebung verbunden ist.
Grob unterscheiden lassen sich Selbsthilfezusammenschlüsse in Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen[4]. Einen Überblick liefert die Abbildung 1, die die verschiedenen Zusammenschlüsse auf lokaler Ebene sowie auf Landes- und Bundesebene abbildet. Anschaulich lassen sich hieran die Struktur der Selbsthilfe erkennen. Deutlich wird, dass die Ebenen nicht immer strikt voneinander getrennt werden können und dass speziell auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen ein fließender Übergang von der regionalen Ebene zur Landes- und Bundesebene stattfindet. Dies begründet sich in der geringen Anzahl Betroffener in einer spezifischen Region und die damit häufig verbundene bundesweite Organisation, die Vernetzung sowie Interessenvertretung stärkt (GKV-Spitzenverband 2009: 11). Die bundesweite Organisation zur Vertretung jener Belange ist die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.V. (ACHSE), die derzeit 90[5] Mitgliedsorganisationen zählt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Selbsthilfelandschaft in Deutschland, Stand 2008 (Quelle: vereinfachte Darstellung,
http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/NAKOS-Studien-1-2007-4.3.pdf)
Zu den bekanntesten und ausführlichsten Definitionen der unterschiedlichen Selbsthilfe-Zusammenschlüsse gehören die des GKV-Spitzenverbandes. Dessen im Jahr 2000 erstmals veröffentlichter Leitfaden zur Selbsthilfeförderung beschreibt die Selbsthilfelandschaft im deutschen Gesundheitswesen und regelt die finanzielle Förderung von Selbsthilfezusammenschlüssen nach § 20c des Sozialgesetzbuches der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V). Im Jahr 2009 wurden sowohl die Begriffsbestimmungen als auch die Förderrichtlinien überarbeitet. Daran beteiligt waren die BAG Selbsthilfe, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. (Der Paritätische), die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) und die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), welche als maßgebliche Spitzenorganisationen der Selbsthilfe gelten (GKV-Spitzenverband 2009: 10-31). Folgend werden die unterschiedlichen Zusammenschlüsse mit ihren Hauptmerkmalen, Strukturen und Aufgabengebieten dargestellt.
Selbsthilfegruppen sind laut Leitfaden „freiwillige Zusammenschlüsse von betroffenen Menschen auf örtlicher Ebene, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung eines bestimmten Krankheitsbildes, einer Krankheitsursache oder –folge und/oder psychischer Problemen richtet, von denen sie entweder selbst oder als Angehörige betroffen sind“ (GKV-Spitzenverband 2009: 10). Durch ihre gemeinnützige Arbeit wollen Selbsthilfegruppen dazu beitragen, Betroffenen einen lebenswerten Alltag zu ermöglichen. Neben dem Austausch von Wissen und Erfahrungen, der in regelmäßigen Gruppentreffen stattfindet, richtet sich das Informationsangebot auch an die interessierte Öffentlichkeit. Die Arbeit wird überwiegend von Ehrenamtlichen übernommen und professionelle Akteure des Gesundheitssystems werden lediglich bei Bedarf hinzugezogen. Weiterhin vertreten Selbsthilfegruppen die gemeinsamen Anliegen aller Mitglieder gegenüber dem näheren Umfeld und der Politik (GKV-Spitzenverband 2009: 10). Sowohl dieses Bedürfnis als Interessenvertretung zu fungieren, als auch der finanzielle Bedarf von Selbsthilfegruppen steigen seit vielen Jahren (Trojan u. a. 1986: 41). Dieter Grunow (2006: 1061), Professor für Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, beschreibt die Entstehung von Selbsthilfegruppen kritisch als Folge etwaiger Mängel im Gesundheitssystem. „Selbsthilfegruppen sind Ersatz für fehlende familiäre Netze; sie gehen kritisch mit den Leistungen professioneller Dienste um; sie sollen Kosten sparen und sind scheinbar leicht politisch-administrativ zu steuern“ (Borgetto 2001: 13).
Selbsthilfeorganisationen wiederum sind Zusammenschlüsse, die „auf ein bestimmtes Krankheitsbild oder eine gemeinsame Krankheitsursache oder eine gemeinsame Krankheitsfolge spezialisiert sind“ (GKV-Spitzenverband 2009: 10). Sie agieren über die regionale Ebene hinaus, zählen mehr Mitglieder als Selbsthilfegruppen und verfügen meist über hauptamtliches Personal. Die Vertretung von Interessen durch Kontakte zu politischen Institutionen sowie den Leistungserbringern und Kostenträgern des Gesundheitswesens steht im Mittelpunkt des Handelns von Selbsthilfeorganisationen (Trojan u. a. 1986: 41). Die überwiegende Anzahl der Selbsthilfeorganisationen ist auf Bundesebene Zusammenschlüssen wie der BAG Selbsthilfe, der DAG SHG, dem Deutschen Behindertenrat (DBR) oder dem Paritätischen beigetreten. Die verbandliche Interessenvertretung, um die Belange von Patienten zu stärken, zählt zu den zentralen Aufgaben der benannten Verbände (GKV-Spitzenverband 2009: 11).
Selbsthilfekontaktstellen verfolgen das Ziel, eine Verbindung zwischen dem professionellen Gesundheitssystem und den Strukturen der Selbsthilfe zu schaffen (Trojan 2003: 327). Sie sind „örtlich oder regional arbeitende, professionelle Beratungseinrichtungen mit hauptamtlichem Personal“ (GKV-Spitzenverband 2009: 12) und bieten Unterstützung für Selbsthilfegruppen sowohl bei der Gründung als auch bei der kontinuierlichen Arbeit. Ihr Zweck ist es weiterhin, die Gesellschaft über die Möglichkeiten der Selbsthilfe zu informieren und dem einzelnen Interessierten konkrete Ansprechpartner vor Ort zu vermitteln. Sie „verstehen sich als Agenturen zur Stärkung der Motivation, Eigenverantwortung und gegenseitigen freiwilligen Hilfe. Sie nehmen eine Wegweiserfunktion im System der gesundheitsbezogenen und sozialen Dienstleistungsangebote wahr und können dadurch zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur beitragen“ (GKV-Spitzenverband 2009: 12).
Die Definitionen der Zusammenschlüsse geben gleichzeitig Auskunft darüber, welchen Aufgaben auf jeweiliger Ebene nachgegangen wird. Die Ziele, die mit diesen Tätigkeiten erreicht werden sollen, können in unterschiedlichem Maße realisiert werden. Während die Beratung von Betroffenen und der gegenseitige Erfahrungsaustausch als erfolgreich gewertet werden und mittelfristige Ziele wie die Aufklärung und Sensibilisierung des näheren Umfeldes von Betroffenen ebenfalls zufriedenstellend sind, erreichen Maßnahmen mit erheblicher Reichweite wie eine Einstellungsveränderung der Leistungserbringer bisher nur in geringem Maß ihr Ziel (Trojan 2003: 325).
2.1.2 Entstehung und Entwicklung der Selbsthilfe
Die Entwicklung der Selbsthilfe basiert grundsätzlich auf den Menschen, die sich ihr anschließen und sie mit ihrem Engagement stärken. In Deutschland ist nur ein geringer Teil der Bevölkerung Mitglied eines Selbsthilfezusammenschlusses, wobei hier auf eine unzureichende Datenlage zurückgegriffen werden muss. Obwohl bis zu 80% der erwachsenen Bürger in Deutschland die Selbsthilfe als wichtig erachten, engagieren sich je nach Zählung nur 0,5 – 4% aktiv. Diese Aussage geht auf verschiedene Studien zurück, die Grunow (2006: 1063-1064) zusammenfasst und mit der Annahme hinterlegt, dass der Großteil derer, die sich vorstellen könnten in einer Selbsthilfegruppe aktiv zu werden, sich eher in der Rolle des Helfenden und nicht des Hilfebedürftigen sehen.
Weitere Vermutungen besagen, dass Betroffene häufig nicht mehr über die nötige Eigenkompetenz, die auch mit Fähigkeiten gleichgesetzt werden kann, verfügen, um sich Selbsthilfe-Initiativen anzuschließen (Trojan 1986: 51-52). „Im Zusammenhang mit der niedrigen Beteiligung wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass ausreichende sprachliche und selbstreflexive Kompetenzen nur bei Mittelschichtsangehörigen vorhanden und die Möglichkeit zur Teilnahme daher nur auf bestimmte Bevölkerungskreise begrenzt seien“ (Borgetto 2001: 15).
Zu den ersten Selbsthilfegruppen zählen die „Anonymen Alkoholiker“, deren Gründung bereits auf das Jahr 1956 zurückgeht. Im Anschluss erfährt die Selbsthilfe bis in die 70er-Jahre jedoch keine besondere Beachtung. Erst zwei universitäre Forschungsprojekte, worunter eines den Grundstein für die DAG SHG legte, rückten die Selbsthilfebewegung wieder mehr in den Fokus des Gesundheitswesens (Borgetto 2002: 14-15).
Da eine Unterstützung seitens der Familie und des engeren Umfeldes nicht immer gewährleistet werden kann, wurde die Selbsthilfe für viele ihrer Mitglieder als Alternative identifiziert und so in ihrer Weiterentwicklung unterstützt (Trojan 2003: 325). Grunow (2006: 1054-1056) beschreibt weitere Gründe, die dazu führten, dass die Selbsthilfe wieder an Beachtung und Zuspruch gewonnen hat. Hierzu zählt er die von den Betroffenen empfundene Qualitätsabnahme der medizinischen Versorgung und dem gleichzeitigen Akzeptanzverlust gegenüber medizinischem Fachpersonal, die finanzielle Unsicherheit, die mit einer Erkrankung häufig einhergeht oder auch die defizitäre politische Steuerung des Gesundheitswesens. Diese Auflistung wird ergänzt um den Anstieg chronischer Erkrankungen, deren Betroffene sich aufgrund der lang anhaltenden Krankheitsgeschichte eher in der Selbsthilfe organisieren, und den wachsenden Bildungsgrad, der den Patienten, gemeinsam mit dem unbegrenzten Informationszugang über das Internet, in seiner Mündigkeit stärkt und die Wissensasymmetrie zwischen Arzt und Patient verringern kann (Matzat 2001: 90-91). Besonders der Austausch mit weiteren Betroffenen und die Aussicht darauf, anderen Unterstützung bieten zu können, tragen maßgeblich zu den Motiven des Anschließens an eine Selbsthilfegruppe bei (Grunow 2006: 1061).
An Bedeutung gewinnt die Selbsthilfe auch in den neuen Medien. Neben professionellen Internetauftritten organisieren sich besonders junge Betroffene zunehmend über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Hier wird eine Entwicklung verzeichnet, die auf der einen Seite die unkomplizierte Kommunikation über große Entfernungen ermöglichen kann, was besonders bei seltenen Erkrankungen die Suche nach anderen Betroffenen erleichtern kann, aber auf der anderen Seite die Gefahr birgt, dass der direkte Austausch in regionalen Gruppen abnimmt und keine jungen Betroffenen folgen, die ehrenamtliche Aufgaben in der Selbsthilfe übernehmen.
2.1.3 Ökonomische Aspekte der Selbsthilfe
„Angesichts der Ökonomisierung des Gesundheitssystems treten die Selbsthilfeleistungen erst dann in das Blickfeld der Gestaltungsentscheidungen, wenn diesen auch Kosten zugeordnet werden können. Daraus lässt sich die geringe Beachtung der individuellen und sozialen Selbsthilfe erklären: Sie gilt solange als unbeobachtete alltägliche Selbstverständlichkeit, bis die Leistungsbasis (z.B. soziale Netze) erodiert ist und nach Alternativen gesucht wird“ (Grunow 2006: 1072). Dieses Zitat unterstreicht den engen Zusammenhang zwischen ökonomischen Aspekten und dem Ansehen der Selbsthilfe sowie der scheinbar notwendigen quantitativen Zuordnung für eine Daseinsberechtigung. Des Weiteren macht es aufmerksam auf die Relevanz der individuellen Selbsthilfe, die das Gesundheitssystem finanziell stark entlastet.
Der Bedarf finanzieller Ressourcen von Selbsthilfezusammenschlüssen steigt stetig an (Trojan u. a. 1986: 41). Dies ist begründet durch wachsende Bedarfe, die mit der Entwicklung der Selbsthilfe in Zusammenhang stehen. Angefangen bei Büromaterialien über Personal bis hin zu Lobbytätigkeiten summieren sich die Kosten, die die Selbsthilfe zu tragen hat (Geißler 2004: 315-320).
Maßgeblich wird die Finanzierung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe durch den bereits erwähnten § 20c des SGB V geregelt. Der Leitfaden zur Selbsthilfeförderung mit den notwendigen Förder-Richtlinien wurde erstmals im März 2000 vorgelegt. Da die Umsetzung in der Praxis jedoch auf massive Kritik seitens der Selbsthilfe stieß, wurde der Leitfaden in Zusammenarbeit mit der BAG Selbsthilfe, dem Paritätischen, der DAG SHG und der DHS im Jahr 2009 überarbeitet. Die daraus resultierende Trennung der Gelder in eine kassenübergreifende Gemeinschaftsförderung und eine kassenindividuelle Förderung wird als Schritt in die richtige Richtung gewertet, erfüllt jedoch noch nicht vollständig die Forderungen der Selbsthilfe nach mehr Transparenz bei der Mittelvergabe. In einer Stellungnahme formulieren die vier an der Weiterentwicklung beteiligten Organisationen Fragen nach der uneinheitlichen Förderung in den verschiedenen Bundesländern oder auch nach einer aussagekräftigen Datenlage zur Förderung, um mehr Planungssicherheit zu erhalten (Spitzenorganisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe 2009).
Die Realisierung der finanziellen Unterstützung erfolgt auf Bundesebene durch die verschiedenen Verbände der Krankenkassen und auf Landesebene durch die verantwortlichen Landesverbände und ihre Krankenkassen. Kassenübergreifend fließen 50% des gesamten Budgets, das sich aus einem Betrag von 0,55 Cent[6] pro gesetzlich Versichertem ergibt, als pauschale Beträge in die Haushalte der Selbsthilfe. Laut Aussage des GKV-Spitzenverbandes erfolgen die Zahlungen nach Antragstellung durch die Organisationen stets unbürokratisch. Über die kassenindividuelle Förderung kommen die übrigen 50% speziellen zeitlich begrenzten Projekten zugute. Voraussetzung ist auch hier die schriftliche Antragstellung. Gelder, die nicht verwendet wurden, gehen im darauf folgenden Jahr in die kassenübergreifende Förderung über (GKV-Spitzenverband 2009: 22-30).
Grunow und Matzat (2006: 1974 und 2001: 92) weisen jedoch darauf hin, dass diese Regelung nicht verhindert, dass der festgelegte Betrag pro Versichertem immer noch nicht voll ausgeschöpft wird. Vertreter der BAG Selbsthilfe kritisieren, dass der Betrag pro Versicheren lediglich einen Anteil von 0,03% des Gesamtbudgets ausmacht und damit den geringen Stellenwert der Gesundheitsselbsthilfe gegenüber Krankenkassen und Gesundheitspolitik unterstreicht (Danner/Nachtigäller/Renner 2009: 3).
Grundsätzlich werden Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen gefördert, die Auflagen wie eine gesundheitsbezogene Ausrichtung, Neutralität und Unabhängigkeit sowie die Ausführung der Aufgaben durch Betroffene erfüllen. Weitere Fördervoraussetzungen umfassen die Offenlegung der finanziellen Situation, Kooperation mit den Krankenkassen oder auch die Öffnung des Zusammenschlusses für neue Mitglieder. Neben weiteren speziellen Auflagen für Selbsthilfeorganisationen auf Bundes- und Landesebene, für örtliche Selbsthilfegruppen und für Selbsthilfekontaktstellen wird ebenfalls klar definiert, welche Verbände, Einrichtungen oder Gruppen von der Förderung ausgeschlossen sind (GKV-Spitzenverband 2009: 16-19).
Nicht zu vernachlässigen ist jedoch der Aspekt, dass eine durch den Gesetzgeber veranlasste finanzielle Unterstützung auch Pflichten mit sich bringt. Grunow nennt hier beispielsweise die „Verpflichtung zur Mitwirkung an Beratungsprozessen und zur ´Sicherstellung` einer Selbsthilfe-Infrastruktur“ (2006: 1069). Die Selbsthilfe wird somit von Politik und Öffentlichkeit in die Pflicht genommen, einen Beitrag zum Gesundheitswesen zu leisten.
Neben der finanziellen Unterstützung durch die gesetzliche Krankenkasse bestehen weitere Möglichkeiten des Mittelzuflusses an die Selbsthilfe. Während das BMG und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Zusammenschlüsse auf Bundesebene fördern, haben die Bundesländer unterschiedliche Grundlagen für ihre Unterstützung auf Landesebene entwickelt. Gemein ist der bundes- und landesweiten Förderung, dass sie seit mehreren Jahren abnimmt. Basierend auf dem § 31 Absatz 1 Nr. 5 des Sozialgesetzbuches der Gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) kann auch die Gesetzliche Rentenversicherung die Selbsthilfe unterstützen. Diese freiwillige Förderung geht vorrangig an Selbsthilfeorganisationen. Der größte Anteil finanzieller Mittel generiert sich jedoch aus den Mitgliedsbeiträgen, sogenannten Eigenmitteln (Hundertmark-Mayser u. a. 2004: 27-29).
Weitere Einnahmequellen der Selbsthilfe können Spenden und Sponsorings sein. „Unproblematische Finanzierungsmechanismen sind allein Mitgliedsbeiträge und Spendengelder. Hingegen ist sowohl bei staatlichen Geldern als auch bei einer Förderung durch Unternehmen (im Allgemeinen der pharmazeutischen Industrie) nicht auszuschließen, dass der Geldgeber seine Mittel an Bedingungen knüpft, die die Arbeit des Verbandes in Mitleidenschaft ziehen“ (Geißler 2004: 337). Um dieser Befürchtung entgegen zu wirken, sind sowohl auf Seiten der Selbsthilfe als auch auf Seiten der Arzneimittelhersteller Verhaltenskodizes entwickelt worden, die die Unabhängigkeit der Selbsthilfe gewährleisten sollen.
Die ganzheitliche Betrachtung der ökonomischen Aspekte der Selbsthilfe schließt auch die Untersuchung eines ökonomischen Nutzens mit ein. Denn neben der sozialen und politischen Bedeutung stellt die Selbsthilfe auch „ökonomische Ressource für das System der Gesundheitssicherung dar, einerseits jenseits der durch Markt und Staat organisierten Hilfen, andererseits im Versorgungsgeschehen selbst“ (Trojan 2003: 321). Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirkt sich also die Existenz von Selbsthilfezusammenschlüssen positiv auf die finanzielle Situation des Gesundheitssystems aus. Jedoch ist diese Kosteneinsparung aus methodischer Sicht nur schwer nachzuweisen (Trojan 2003: 326). Hier schließt sich die Fragestellung an, ob eine Kosteneinsparung die grundlegende Daseinsberechtigung für die Selbsthilfe darstellt. Viele Faktoren, die durch den aktiven Austausch innerhalb der Selbsthilfe begünstigt werden, lassen sich nicht in Zahlen messen (Rosenbrock 2001: 28).
2.2 Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitssystem
Es folgt eine Übersicht der Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitssystem unter Einbeziehung des Forschungsstandes zur Thematik. Hinzugezogen werden publizierte Studien zum Themengebiet und Erfahrungsberichte von Patientenvertretern.
Laut Trojan kommt „ein modernes Gesundheitssystem ohne eine aktive Mitwirkung der Leistungsadressaten, also der Laien bzw. Patienten, nicht aus“ (2003: 321). An dieser Definition lässt sich erkennen, welche Schwierigkeit bei der genauen Begriffsbezeichnung der Bürger im Gesundheitswesen besteht, die zusätzlich durch die Möglichkeit des Wechsels zwischen diesen Rollen verstärkt wird. In der Literatur finden sich Begriffe wie Patient, Laie, Verbraucher, Leistungsadressat oder auch Leidender[7]. Gemein haben diese Bezeichnungen, dass sie Passivität ausdrücken (Trojan 2003: 331). Jedoch hat sich die Rolle des Bürgers in den letzten Jahren deutlich verändert und er rückt zunehmend in die Position des Partners, des Kunden oder auch des Bewerters im Gesundheitswesen (Dierks u. a. 2006: 7). Der SVR (2002: 283) hat sich auf den Ausdruck “Nutzer“ verständigt, der als Sammelbegriff gelten soll.
Die Bezeichnung des Nutzers als Bewerter, Kontrolleur und Kritiker von Gesundheitsleistungen basiert auf „dem schon lange vorgetragenen Idealbild des mündigen Patienten und der ursprünglich vor allem demokratie-theoretisch begründeten Forderung nach politischer Partizipation der Patienten im gesellschaftlichen Teilsystem Gesundheitswesen“ (Trojan 2003: 332). Jedoch befindet sich der Nutzer an dieser Stelle „im Spannungsfeld zwischen Paternalismus und Autonomie“ (Dierks/Schwartz 2001: 802). Der Paternalismus beschreibt die ursprüngliche Arzt-Patient-Beziehung, die durch eine Wissensasymmetrie gekennzeichnet ist. Der Arzt verfügt über das medizinische Wissen, diagnostiziert die Erkrankung und bestimmt die Behandlung. Der Patient findet sich in diesem Modell in der Rolle des Kranken, der auf die Entscheidungen des Behandlers angewiesen ist. Auch wenn seit den 1970er Jahren die partnerschaftliche Beziehung zwischen Arzt und Patient forciert wird, hat dies noch nicht vollständig Eingang in die Praxis gefunden. Darüber hinaus muss auch das Recht derer akzeptiert werden, die Behandlungsentscheidungen bewusst ihrem Arzt überlassen wollen, denn nicht jeder Patient will die Aufgabe der partizipativen Entscheidungsfindung im Erkrankungszustand auf sich nehmen (Dierks/Schwartz 2003: 317).
Patienten gelten als „Experten in eigener Sache, da nur sie authentisch über die Wahrnehmungen der Betroffenen und deren Folgen für die aktuelle oder weitere Behandlung berichten können“ (Dierks/Schwartz 2003: 320). Dieses Zitat knüpft an der eingangs beschriebenen Vorstellung Trojans von einem modernen Gesundheitssystem an und es unterstreicht die Wichtigkeit der Einbeziehung von Patienten, der sich auch Selbsthilfevertreter anschließen.
Die mit der Einbindung verbundenen Ziele der Patientenbeteiligung benennt Christoph Nachtigäller (2001: 99), Vorsitzender der ACHSE sowie ehemaliger Bundesgeschäftsführer der BAG Selbsthilfe und damit ein langjähriger Vertreter der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Zum einen erhoffen sich die verschiedenen Beteiligten im Gesundheitswesen demokratische Strukturen in der gesundheitlichen Versorgung, eine Ausrichtung vom Bedarf her gesehen und die generelle Verbesserung der Qualität auf allen Ebenen des Gesundheitssystems.
Auch der SVR spricht sich in seinem Gutachten für die Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten der Bürger aus. Er empfiehlt eine „angemessene Beteiligung von Betroffenen in wichtigen Beratungsgremien“ (2002: 346). Es stellt sich die Frage, wie die Bezeichnung „angemessen“ in diesem Zusammenhang definiert wird. Der SVR (2002: 324) schließt sich der Meinung der Arbeitsgruppe um Dieter Hart, Professor für Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen und Robert Francke[8], Professor für öffentliches Recht an der Universität Bremen an, die sich dafür aussprechen, die Patientenvertreter mit dem Verfahrens- und Beteiligungsrecht auszustatten und erste Umsetzungen genau zu begleiten.
Bürger werden auf verschiedenen Ebenen in das Gesundheitswesen einbezogen. Anschaulich verdeutlicht dies Abbildung 2 aus einem Beitrag von Marie-Luise Dierks, Leiterin des Forschungsschwerpunktes Patientenorientierung und Gesundheitsbildung und Studiengangsleitung des Ergänzungsstudiengangs Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Friedrich Wilhelm Schwartz, Gesundheitswissenschaftler, Mediziner und ehemaliger Vorsitzender des SVR. Die Darstellung verdeutlicht gleichzeitig erneut die unterschiedlichen Bezeichnungen des Nutzers im Gesundheitssystem und ordnet diese verschiedenen Argumenten zu. Unter medizinischen und ethischen Aspekten wird die Rolle des Nutzers auf der Mikroebene vom passiven Kranken über den Partner hin zum Koproduzenten aufgezeigt. Dies zeigt die Bandbreite von der traditionellen paternalistischen Beziehung zwischen Arzt und Patienten bis zu der Beteiligung des Patienten an medizinischen Entscheidungen.
Weitere Rollen auf der Mesoebene sind die des Kunden und des Bewerters. Hier wird der zunehmenden Bedeutung von Qualitäts- und Ökonomieargumenten Beachtung geschenkt, unter denen sich der Nutzer zu einem Bewerter von Gesundheitsleistungen entwickelt. Ökonomische Aspekte treffen auch auf den Nutzer als Versicherten einer Krankenkasse zu und beschreiben somit die Mesobene. „Durch die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse ist den Versicherten die Teilnahme an der Selbstverwaltung und damit die Mitgestaltung der den Krankenkassen obliegenden Aufgaben eröffnet“ (Dierks/Schwartz 2003: 316). Bezogen auf die freie Kassenwahl, die 1996 eingeführt wurde, nehmen Versicherte ihre Autonomie durchaus in Anspruch. Weniger ausgeprägt wird jedoch die Möglichkeit genutzt, über die Sozialwahl die Mitbestimmungsrechte in der eigenen Krankenkasse wahrzunehmen (Etgeton 2009: 106).
Auf der Makroebene steht der Nutzer als Bürger und im Zusammenhang mit demokratischen Argumenten kann er das Interesse an einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung sowie an der Beteiligung an Entscheidungsprozessen des Gesundheitssystems äußern (SVR 2002: 331).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Vom Patienten zum Bürger – Rollen der Nutzer des Gesundheitswesens (Quelle: Dierks/Schwartz 2003: 315)
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Makroebene und beschäftigt sich folgend mit dem wachsenden „Selbstverständnis der Selbsthilfe als Interessenvertretung aller vom jeweiligen Problem Betroffener zu fungieren“ (Trojan u. a. 1986: 41). Zuvor nahmen Leistungserbringer und Krankenkassen für sich in Anspruch, sich für die Belange der Patienten einzusetzen (Köster 2005: 78). Nachtigäller macht deutlich, dass dies auch von der Selbsthilfe so wahrgenommen wird: „Ärzte, Therapeuten, Krankenkassenvertreter, Politiker bemühen sich um den Patienten, sind an ihm interessiert. Viele der genannten Beteiligten im Gesundheitswesen unterbreiten nicht nur das Angebot, sondern nehmen für sich in Anspruch, als Einzelperson ebenso wie als Institution, Patienten zu vertreten, für sie zu sprechen“ (2001: 96).
Jedoch bestehen verschiedene Argumente für die Beteiligung der Nutzer des Gesundheitssystems. Aus einer verfassungspolitischen Sicht heraus ist festzustellen, dass eine Beteiligung derer, die das Gesundheitssystem durch die Zahlung von Steuern und Versicherungsbeiträgen finanzieren, berechtigt ist und den demokratischen Grundsätzen entspricht. „Die Beteiligung der Bürger und Patienten an ihrer persönlichen Gesundheitsversorgung beruht auf den fundamentalen Grundsätzen der menschlichen Autonomie und der Menschenrechte. Jeder Mensch hat das Recht, zu entscheiden, was mit seinem eigenen Körper geschieht, vorausgesetzt er [...] ist sich der vollen Tragweite seiner [...] Entscheidung bewusst“ (Vienonen 2000: 58).
Die gesundheitspolitische Sichtweise besagt, dass in Anbetracht begrenzter Ressourcen deren Verteilung innerhalb des gesamten Gesundheitssystems transparent gestaltet und von allen Beteiligten getragen werden muss. „Entscheidungen können nicht ausschließlich auf epidemiologischen, ökonomischen oder technokratischen Argumenten basieren und auch nicht schlicht den Marktmechanismen überlassen werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Gesundheitssystem der Verwirklichung von Werten und Prioritäten dient, die die Bevölkerung für wichtig hält. Die breiteste Unterstützung und Akzeptanz gesundheitspolitischer Ziele wird erreicht, indem man die demokratische Qualität von Entscheidungsprozessen in diesem Bereich stärkt“ (Markenstein 2000: 83-84). Durch diese demokratische Qualität erhofft man sich ebenfalls ein besseres Verstehen der politischen Strukturen und Prozesse sowie die Förderung des sozialen Zusammenhalts im Sinne der Solidarität. Weiterhin kann die demokratische Beteiligung aller Akteure des Gesundheitswesens an politischen Entscheidungsprozessen zu einer Verbesserung der Legitimation jener Entscheidungen führen (Coulter 2000: 139).
Für die Beteiligung benötigen die Nutzer Kenntnisse über die Strukturen des Gesundheitswesens mit seinen rechtlichen Bestimmungen und sie müssen in der Lage sein, sich Wissen anzueignen und auch lernen, die Kräfteverhältnisse im Gesundheitssystem einschätzen zu können (Vienonen 2000: 61). „Dieses Empowerment, d.h. die Befähigung der Öffentlichkeit zur Einflussnahme auf die Planung und Organisation der Gesundheitsversorgung, ist ein Instrument, um die repräsentative Demokratie neu zu beleben und das reibungslose Funktionieren grundlegender sozialer Einrichtungen – einschließlich des Gesundheitswesens – zu gewährleisten. Ziel dabei ist es, durch die Einbeziehung der Bevölkerung ein Gegengewicht zum Einfluss der Ärzte auf den Entscheidungsprozess zu schaffen und so die Ausgewogenheit innerhalb des Gesundheitssystems zu fördern“ (Vienonen 2000: 61-62). Dieses Zitat ist als unvollständig zu bewerten, da es ausschließlich von einem Gegenwicht der Ärzte spricht und versäumt die Krankenkassen, die ebenfalls Einfluss auf die Entscheidungen des Gesundheitswesens nehmen, explizit zu erwähnen.
Es ist ersichtlich, dass das Thema Gesundheit in unserer Gesellschaft von Interesse zahlreicher Akteure ist, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen. Das jeweilige Handeln dieser Beteiligten im Rahmen von gesundheitspolitischen Prozessen begründet sich auf diesen Zielen. Grob unterschieden werden die Akteure in politische Institutionen, wie Parteien und Regierungen, in Industrieunternehmen, in die Kostenträger, in Akteure der gesundheitlichen Versorgung und in die Betroffenen. Während die Politik das Interesse verfolgt, der Bevölkerung eine adäquate gesundheitliche Versorgung zuzusichern, bei dem sie sich im Spannungsfeld zwischen der optimalen Versorgung und der Finanzierung dieser befindet (Geißler 2004: 48, vgl. bei Engelhardt 1988: 37-39), sind Industrieunternehmen marktwirtschaftlich orientiert. Auch wenn Gesundheit nicht den Definitionen eines normalen Marktes entspricht, müssen sie wirtschaftlich arbeiten. Die Kostenträger, zu denen Krankenkassen und weitere Sozialversicherungsträger zählen, sind primär daran interessiert, die Kosten der gesundheitlichen Versorgung möglichst gering zu halten. Sie beschäftigen sich wie die Politik dabei ebenfalls mit der Balance zwischen finanziellen Ressourcen und den Anforderungen an eine adäquate Versorgung ihrer Versicherten (Badura 2000: 39). Die Akteure der gesundheitlichen Versorgung wie Ärzte, Therapeuten oder Apotheker wollen in ihrer Therapiefreiheit uneingeschränkt sein und sich auf ihre Patienten konzentrieren. Diese wiederum stellen ihre eigene Gesundheit in den Fokus und wollen möglichst schnell geheilt werden. Weitere Interessen der Patienten orientieren sich an finanziellen Aspekten und diese Forderung einer möglichst geringen finanziellen Belastung stellen sie an die gesetzliche Krankenversicherung (Hänlein/Schroeder 2010: 49-50).
Ressourcen, Kompetenzen und Macht spielen bei der Realisierung dieser Auswahl an Zielen eine große Rolle und sind unter den Beteiligten sehr unterschiedlich verteilt (Rosenbrock/Gerlinger 2006: 18).
Bei der Frage, ob Patienteninteressen als schwache oder starke Interessen einzustufen sind, lässt sich feststellen, dass bei der individuellen Arzt-Patient-Beziehung durch die erwähnte Wissensasymmetrie teilweise eine geringe Durchsetzungskraft seitens des Patienten, abhängig von der Schwere der Erkrankung oder auch dem Bildungsniveau, ausgemacht werden kann (Hänlein/Schroeder 2010: 52-54). Selbsthilfezusammenschlüsse vertreten die gemeinsamen Interessen jedoch gebündelt und daher können „Patienten durch heterogene Verbände eine nicht unbeachtliche Unterstützung im Hinblick auf ihr Behandlungsinteresse erfahren [...], so dass zwar kaum von einem `starken` Interesse gesprochen werden kann, andererseits aber auch nicht von extremer Schwäche“ (Hänlein/Schroeder 2010: 54).
2.2.1 Formen der kollektiven Patientenbeteiligung
Übergeordnet lässt sich Patientenbeteiligung in individuelle und kollektive Beteiligung unterscheiden. Unter der individuellen Beteiligung versteht man die Kommunikation zwischen dem einzelnen Patienten und seinem behandelnden Arzt, die auf der bereits erwähnten Mesoebene stattfindet. Die kollektive Beteiligung beschreibt die systematische Einbindung von Bürgern in Entscheidungen des Gesundheitswesens.
Grundlage der vorliegenden Arbeit ist die Auseinandersetzung mit kollektiven Beteiligungsoptionen, die Hart (2005: 10) in Umfragebeteiligung, Verfahrensbeteiligung, Beratungsbeteiligung und Entscheidungsbeteiligung unterteilt. Der Abbildung 3 kann eine tabellarische Übersicht der aufeinander folgenden Beteiligungsmodelle entnommen werden. Bei Zitation dieser wird die Einteilung häufig auf drei Formen verkürzt, indem die Möglichkeit der Umfragebeteiligung unerwähnt bleibt. Diese nach Hart als schwächste Form der Patientenbeteiligung definierte Möglichkeit dient dazu, Meinungen und Präferenzen der Betroffenen einzuholen. Die darauf folgende Verfahrensbeteiligung wird durch mündliche oder schriftliche Stellungnahmen ausgeübt, welche die Informationsgewinnung der Entscheidungsträger unterstützen soll. Die nächste Stufe, die aktive Beteiligung an Beratungen und Diskussionen, definiert die Beratungsbeteiligung. Die finale Ebene der Partizipation ist die Entscheidungsbeteiligung, die durch das Mitentscheidungsrecht gekennzeichnet ist und die die Möglichkeit der direkten Mitgestaltung von Entscheidungen bietet. Bürger können einen Prozess demnach von Anfang an begleiten oder lediglich an bestimmter Stelle in die Kommunikation einbezogen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Beteiligungsmodelle für Bürger- und Patientengruppen (Quelle:
http://wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_ggw/wido_ggw_aufs1_ 0105.pdf)
Die größte Diskussion im Bezug auf die Rechte beinhaltet die stärkste Form der Beteiligung, das Stimmrecht. Die Positionen der verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens hierzu werden in Kapitel 2.2.4 vorgestellt.
2.2.2 Gesetzliche Grundlagen kollektiver Patientenbeteiligung
Gesetzliche festgelegte Rechte sind grundlegend wichtig, da ohne sie keine Verbindlichkeit gewährleistet werden kann (Hart 2005: 11). Die gesetzlichen Regelungen der kollektiven Patientenbeteiligung stehen in einem engen Zusammenhang mit den Patientenrechten und „in beiden Themenbereichen, die sich vielfach überschneiden, geht es um Formen der Einbeziehung von Patienten, Versicherten und Bürgern in Kommunikationsprozesse in individuellen und kollektiven Beziehungen, in erster Linie also in der Arzt/Patient-Beziehung und dann auf der Ebene von Systementscheidungen durch Institutionen im Gesundheitswesen“ (Hart 2005: 8). Patientenbeteiligung gilt als folgend auf die individuellen Patientenrechte und ist demnach jüngerer Natur (Hart 2003: 336).
Auf internationaler Ebene wurden kollektive Patientenrechte maßgeblich im Jahr 1994 durch die WHO eingefordert. In der „Declaration on the Promotion of Patients´ Rights in Europe” wird auf die Wichtigkeit der Partizipation verwiesen. Sie besagt, dass Patienten über ein kollektives Recht zur Beteiligung auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, bei der Planung und Evaluierung von Dienstleistungen sowie dem Umfang, der Qualität und Funktion des Systems verfügen (WHO 1994:13).
Auf nationaler Ebene sorgte im Jahr 2004 das in der Einleitung bereits erwähnte GMG für eine wichtige Stärkung der kollektiven Beteiligungsrechte. Vorherige Gesundheitsreformen schenkten dem Patienten eher wenig Beachtung. Der Fokus lag auf den Bestrebungen, Versorgungsleistungen und Ausgaben in Einklang zu bringen und darüber hinaus wurden Patienten als Risiken und Fälle definiert (Pitschas 2006: 452).
Die damalige Regierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen führte im Rahmen des GMG die Verordnung zur Beteiligung von Patientinnen und Patienten in der Gesetzlichen Krankenversicherung, kurz Patientenbeteiligungsverordnung (Pat.BeteiligungsV), und das Amt eines Patientenbeauftragten ein. Die sogenannten „Maßnahmen zur Stärkung der Patientensouveränität“ führten dazu, dass Patientenvertreter künftig in Form einer dritten Bank an den Beratungen im G-BA, im Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und in der Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung in der stationären Versorgung (BQS) teilnehmen konnten und dass die Patientenbelange sowohl auf politischer Ebene als auch in der Öffentlichkeit durch ein zentrales Amt vertreten wurden (Dierks u. a. 2006: 8).
Im Jahr 2007 wurde das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) verabschiedet, welches die Selbsthilfe gestärkt hat, indem es die materiellen Rahmenbedingungen verbessert hat (Hänlein/Schroeder 2010: 58). Durch die Einrichtung der Stabstelle Patientenbeteiligung war es das Vorhaben, „gezielt für die organisatorischen Koordinierungsnotwendigkeiten, aber auch für die fachliche Unterstützung bei Antragstellungen gesonderte personelle Ressourcen“ (Bronner 2009: 218) bereitzustellen.
2.2.2.1 Die Patientenbeteiligungsverordnung als Inhalt des GKV-Modernisierungsgesetzes
Die Pat.BeteiligungsV ist Bestandteil des GKV-Modernisierungsgesetzes der rot-grünen Koalition aus dem Jahr 2004 und verankert als § 140f im SGB V. Hierin werden die Anforderungen für die Beteiligung beschrieben, die auf dieser Grundlage anerkannten Organisationen aufgeführt und das Verfahren der Beteiligung geregelt. Der § 1 der Verordnung beschreibt die Anforderungen an maßgebliche Organisationen, um als Interessenvertretung für die Patientenbeteiligung anerkannt zu werden. Maßgebliche Inhalte sind eine dauerhafte, neutrale und unabhängige Repräsentation von Patienteninteressen, die durch den Kreis der Mitglieder untermauert wird und den demokratischen Grundsätzen entspricht. Unter § 2 werden die anerkannten Organisationen aufgeführt und das Vorgehen bei Anzweiflung der unter § 1 festgelegten Anforderungen beschrieben. § 3 verweist kurz auf die Möglichkeit der Antragstellung weiterer Organisationen auf Anerkennung. Unter § 4 werden die Verfahrensregeln für die Beteiligung genauer beschrieben. Diese besagen, dass die anerkannten Organisationen untereinander beraten müssen, welche sachkundigen Personen für thematisch spezifische Beratungen benannt werden sollen. Mindestens die Hälfte dieser Personen soll aus eigener Betroffenheit heraus berichten können. Diese Regelung des Betroffenheitsprinzips unterliegt jedoch nur einer „Soll“-Funktion. Weiterhin besagt der § 4, dass für Sitzungen relevante Unterlagen rechtzeitig und vollständig den Patientenvertretern zur Verfügung zu stellen sind, damit ausreichend Zeit für die Einarbeitung und die Möglichkeit einer Stellungnahme gewährleistet sind (Bundesministerium der Justiz 2003).
Zu den vier anerkannten Organisationen[9] zählen
- der Deutsche Behindertenrat (DBR),
- die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP),
- die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) und
- die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv).
Während es sich beim DBR um einen Zusammenschluss der Patientenselbsthilfe handelt, sind die anderen drei in der Pat.BeteiligungsV benannten Organisationen der Patientenberatung zuzuordnen.
Der DBR[10] wurde 1999 gegründet und versteht sich als Aktionsbündnis, das aus 44 Organisationen besteht, die sich alle für die Interessen und Belange von behinderten Menschen und chronisch Erkrankten sowie deren Angehörigen einsetzen. Mitglied werden können Organisationen, die einen Sitz in mindestens fünf Bundesländern vorweisen können, denen mindestens 750 Einzelmitglieder angehören und die die Eigenschaft eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins aufweisen. Die Interessen von über 2,5 Millionen Betroffenen werden durch den DBR verbandsübergreifend vertreten. Dennoch ist zu betonen, dass es sich beim DBR nicht um einen Dachverband handelt und dass die einzelnen eigenständigen Organisationen selbst für sich und ihre Mitglieder eintreten. Die Aufgaben des DBR erstrecken sich von der Anregung zum Austausch unter Betroffenen über das Voranbringen der Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens für Betroffene bis hin zum Abbau von Diskriminierung gegenüber behinderten und chronisch kranken Menschen.
Die BAGP[11] entstand 1989 aus dem Zusammenschluss von bereits existierenden PatientInnenstellen und –Initiativen mit dem Ziel Ressourcen zu bündeln und mehr Handlungskompetenzen zu erlangen. Um den Status eines gemeinnützigen Vereins vorzuweisen, ist die BAGP eine Arbeitsgruppe der GesundheitsAkademie e.V.. Zu den Aufnahmekriterien zählen u. a. ein niedrigschwelliges und dokumentiertes Beratungsangebot und die aktive Mitarbeit in der BAGP. Als Aufgaben nennt die BAGP die Beratung und Unterstützung von Patienten, die Entgegennahme von Patientenbeschwerden und die Wahrnehmung von Beteiligungsrechten. Die Arbeitsgemeinschaft beschreibt sich selbst als „kompetenten Ansprechpartner im Gesundheitswesen“, der als Lobbyist unabhängig von Leistungserbringern, Kostenträgern, der Industrie und auch der Politik für Patienten eintritt.
Die DAG SHG[12] wurde bereits im Jahr 1982 gegründet und ist ein Fachverband, der sich um die Belange von Selbsthilfegruppen kümmert. Im Gegensatz zum DBR und der BAGP bestehen für die Aufnahme in die DAG SHG keine hohen Anforderungen und jede natürliche und juristische Person, die sich für den Verein einsetzen will, kann gegen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag nach Zulassung durch den Vorstand Mitglied werden. In den Mittelpunkt rückt die Arbeitsgemeinschaft ihr Ziel, Menschen zu motivieren, sich in der Selbsthilfe zu engagieren. Zahlreiche Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit, der Beitrag zu einer höheren Anerkennung von Selbsthilfegruppen oder die Unterstützung von Gruppen bei Gründung und der täglichen Arbeit sollen dieses Ziel forcieren. Die DAG SHG leistet durch ihre Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) und drei weitere Kontaktstellen[13] der Selbsthilfe einen hilfreichen Beitrag
Der vzbv[14] wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist die Dachorganisation von 42 Verbraucherverbänden, die sich aus 16 Verbraucherzentralen sowie 26 weiteren Verbänden zusammensetzen und gemeinsam über 20 Millionen Mitglieder zählt. Geschlossen ist es deren Ziel, die Interessen von Verbrauchern in Deutschland zu vertreten. Neben dem Fachbereich 3: Gesundheit, Ernährung, zu dessen Aufgaben die Patientenvertretung zählt, verfügt der Verband über fünf weitere Fachbereiche[15], in denen insgesamt rund 100 Mitarbeiter tätig sind. Zu den satzungsgemäßen Organen des Bundesverbandes gehören der Vorstand, die Mitgliederversammlung und der Verwaltungsrat, welcher über die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet. Für diese Aufnahme berechtigt sind die Verbraucher-Zentralen der Bundesländer und juristische Personen oder Personenvereinigungen, die überregional vertreten sind, anbieterunabhängig agieren und die Förderung des Vereinszweckes unterstützen. Finanziert werden die Tätigkeiten des vzbv durch das Bundesverbraucherministerium, durch Einnahmen aus dem Verkauf von Verbraucher-Ratgebern und über die Einwerbung von Projektmitteln. Zu den Aktivitäten gehören die Unterstützung der Mitgliedsverbände bei der Gewährleistung einer hochwertigen Beratung und das Einsetzen für Verbraucherrechte in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene, um Rahmenbedingungen für einen fairen und transparenten Markt zu schaffen.
Mit der Benennung der vorgestellten Organisationen sieht die Politik die Voraussetzung für eine legitime Auswahl von Patientenvertretern gewährleistet, denn „eine der wesentlichen Aufgaben der Patientenbeteiligung ist es, bei den Entscheidungen des Bundesausschusses für mehr Transparenz und Nutzerorientierung zu sorgen“ (Etgeton 2009: 224). Aufgrund der Heterogenität zahlreicher Zusammenschlüsse und der Konkurrenz, die an manchen Stellen innerhalb der Gesundheitsselbsthilfe bemerkbar ist, kann dies jedoch auch zu Schwierigkeiten führen (Köster 2005: 80-81).
Indem die maßgeblichen Organisationen für die Benennung der Patientenvertreter verantwortlich sind, wird deutlich, dass die Gesundheitsselbsthilfe als grundlegend für die Patientenbeteiligung angesehen wird. „Patientenvereinigungen bilden eine wichtige Quelle, auf die Politiker bei der Entwicklung der Bürgerbeteiligung zurückgreifen können“ (Markenstein 2000: 87).
2.2.2.2 Entwicklungen zum geplanten Patientenrechtegesetz
Im Sommer 2010 gab der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Wolfgang Zöller bekannt, ein Patientenrechtegesetz initiieren zu wollen. Ziel ist es, die bestehenden Rechte für Patienten, die bisher u. a. im Sozialrecht, im Zivilrecht oder auch im Strafrecht verankert sind, zentral zu bündeln. Auf diese Weise sollen Patientenrechte transparenter und auch einklagbar werden. Nach Gesprächen mit verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens, unter denen auch mehrere Selbsthilfezusammenschlüsse vertreten waren, konnten Ende März 2011 in einem Grundlagenpapier erste Eckpunkte für das geplante Gesetz veröffentlicht werden. Der SVR benennt die Vorteile eines Patientenrechtegesetzes, welches einerseits dafür sorgen kann, „dass kompetente Patienten ihre Rechte nutzen, andererseits stärkt die konkrete Formulierung, Veröffentlichung und Umsetzung von Patientenrechten die Position des Patienten gegenüber den Professionellen des Systems“ (SVR 2002: 333).
Die kollektive Patientenbeteiligung wird in dem Grundlagenpapier an vorletzter Stelle genannt und in ihrer bestehenden Festlegung laut Pat.BeteiligungsV beschrieben (Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung/Bundesministerium für Gesundheit/Bundesministerium der Justiz 2011: 18).[16] Der nicht näher definierte Verweis auf eine Stärkung dieses Rechts ist laut Verbraucherschutz nicht weitgehend genug. Die vom vzbv ausgehende Forderung nach einem Stimmrecht in Gremien der Selbstverwaltung wird von Gesundheitsstaatssekretär Stefan Kapferer jedoch zurückgewiesen und nicht als Bestandteil des Patientenrechtegesetzes betrachtet (Ärzte Zeitung 05.04.2011). Sowohl die DAG SHG als auch die BAG Selbsthilfe streben ebenfalls nach einem Stimmrecht in Verfahrensfragen, um eine Kommunikation aller Akteure auf Augenhöhe zu gewährleisten (DAG SHG 2011: 7-8). Die BAG Selbsthilfe definiert diese Art des Stimmrechts noch spezifischer, indem sie hier die vier maßgeblichen Organisationen als stimmberechtigt sieht. Die Verfahrensordnung betreffen können beispielsweise Vertragsbelange oder auch die Auswahl von Sachverständigen, die zu Beratungen hinzugezogen werden können (BAG Selbsthilfe 2011: 12).
Auch die Bundesärztekammer (BÄK) hatte die ersten Entwürfe des Gesetzes 2010 stark kritisiert und bezieht sich dabei auf den Standpunkt, dass die individuellen Patientenrechte im Behandlungsvertrag ausreichend gesichert seien. In ihrer Argumentation stützen sich die Vertreter des 113. Deutschen Ärztetages auf den Euro Health Consumer Index 2009, der seit 2005 jährlich vom Health Consumer Powerhouse in Brüssel veröffentlicht wird. Dieser Index ermittelt die Unterschiede 33 europäischer Gesundheitssysteme, indem er die Bereiche Patientenrechte und Patienteninformationen, E-Health, Wartezeiten für eine Behandlung, Behandlungsergebnisse, Umfang und Reichweite der bereitgestellten Dienstleistungen und Zugang zu Arzneimitteln untersucht und vergleicht. Als Datengrundlage hierfür dienen öffentliche Statistiken, Patientenbefragungen und Studien, die Health Consumer Powerhouse selber durchführt. Die Ergebnisse besagen, dass das Vorhandensein eines Patientenrechtegesetzes nicht zwangsläufig zu einem besseren Gesundheitssystem führt (Björnberg u. a. 2009: 13-14). Ohne die Angabe näherer Gründe zeigt sich der BÄK-Präsident Ulrich Montgomery[17] jedoch mittlerweile zuversichtlich und äußert gegenüber der Presse die Meinung, dass die jetzigen Ergebnisse auf die vorbildliche Kooperation aller Akteure zurück zu führen sei. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband bewerten das Grundlagenpapier positiv (Deutsches Ärzteblatt 22.03.2011).
Unter den Parteien im Bundestag ist man sich einig, dass ein Patientenrechtegesetz notwendig ist. Bezüglich der kollektiven Patientenbeteiligung geht die SPD am weitesten und spricht sich in ihrem „Entwurf für ein modernes Patientenrechtegesetz“ für ein Stimmrecht der Patientenvertreter in allen Entscheidungen und somit über die Verfahrensordnung hinaus aus (Steinmeier und Fraktion 2010: 2-5).
Ungeachtet dessen, von welcher Seite und in welchem Grad eine Stärkung der Patientenrechte gefordert wird, sollte berücksichtigt werden, inwieweit die Patienten „in der Lage sind, ihre Rechte in Erfahrung zu bringen, und inwieweit diese Rechte kontrolliert und revidiert werden können“ (Markenstein 2000: 88). Ohne eine Aufklärung der Bevölkerung wird ein Patientenrechtegesetz in der Praxis nicht in vollem Maße genutzt werden.
Die weitere Planung sieht vor, dass das Gesetz noch 2011 verabschiedet werden soll.
2.2.3 Die Einbindung von Patientenvertretern in politische Institutionen am Beispiel des Gemeinsamen Bundesausschuss
An dieser Stelle soll die konkrete Patientenbeteiligung in politischen Institutionen näher beschrieben werden. Der Abbildung 4 des Robert Koch-Institutes (RKI), einer Einrichtung zur Krankheitsüberwachung und Prävention auf Bundesebene, ist die Patientenbeteiligung in verschiedenen politischen Gremien auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu entnehmen und es ist somit ersichtlich, dass Patientenbeteiligung auf allen politischen Ebenen stattfindet[18].
Das oberste Gremium im deutschen Gesundheitssystem, angesiedelt auf Bundesebene, ist das BMG. Es gibt für viele Aufgabenbereiche Rahmenvorgaben vor, deren Erfüllung aufgrund regionaler Unterschiede den Ministerien in den einzelnen Bundesländern überlassen wird. „Dabei sind die Akteure auf der Mesoebene keineswegs auf die Rolle eines politischen Erfüllungsgehilfen beschränkt. Vielmehr sind sie im politischen Prozess selbst von eigenständiger Bedeutung“ (Rosenbrock/Gerlinger 2006: 14).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Kontinuierliche Beteiligung von Patientenvertretern und –vertreterinnen in unterschiedlichen Gremien des deutschen Gesundheitswesens (Quelle: vereinfachte Darstellung, Dierks u. a. 2006: 9)
Durch die Abbildung lässt sich zeigen, unter welchen Bedingungen die Einbindung erfolgt und mit welchen jeweiligen Rechten die Vertreter jeweils ausgestattet sind. Ebenfalls ersichtlich ist die Unterscheidung der Beteiligungsrechte. Vom bloßen Recht der Anhörung über die Möglichkeit, beratend beizutragen bis hin zur Einbeziehung mittels Stimmrecht reichen die Beteiligungsrechte. Hier ist die bereits erwähnte Unterscheidung zu der Einteilung nach Hart zu sehen. Während in den RKI-Tabellen von nur drei Formen der Beteiligung die Rede ist, differenziert Hart (2005: 10) das Anhörungsrecht in Umfrage- und Verfahrensbeteiligung.
Jüngst wurde aufgezeigt, in welchen Gremien der Patientenbeteiligung aber auch Grenzen gesetzt werden. Die Bundesregierung hat eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach einer Patientenbeteiligung in der Ständigen Impfkommission (STIKO) abgelehnt. Als Begründung wurde die Besetzung der STIKO mit Experten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen angeführt, derer es keine Ergänzung von Patientenvertretern bedarf (Deutscher Bundestag Drucksache 17/5673 2011).
Aufgrund der weiten Bandbreite verschiedener Gremien soll wegen seiner politischen Bedeutung und den umfassenden Entscheidungsbefugnissen der Fokus auf die kollektiven Beteiligungsmöglichkeiten im G-BA gerichtet werden. Auch durch die vorangegangen vorgestellten Forderungen für eine Weiterentwicklung der Patientenbeteiligung im Rahmen des Patientenrechtegesetzes wird die Bedeutung des G-BA deutlich, denn gemein haben alle diese Forderungen, dass sie konkret die Beteiligung im G-BA benennen. In diesem Gremium, welches häufig auch als „kleiner Gesetzgeber“ (Bronner 2009: 212) tituliert wird, kann auf eine mittlerweile knapp siebenjährige Erfahrung mit der Einbeziehung von Patientenvertretern zurückgeblickt werden.
Der G-BA wurde im Januar 2004 nach Verabschiedung des GMG durch die Zusammenlegung der Bundesausschüsse der Ärzte und Krankenkassen, der Bundesausschüsse der Zahnärzte und Krankenkassen sowie des Koordinierungsausschusses Krankenhaus gegründet (Bronner 2009: 211). Ziel dieser Neugründung war es, auch den stationären Bereich in die Selbstverwaltung einzubeziehen und das Treffen von Entscheidungen gemeinsam durch alle Akteure zu gewährleisten, so dass ein „Interessenausgleich zwischen Kassen und Leistungserbringern“ (Köster 2005: 79) erzielt werden kann. Mit der gemeinsamen Selbstverwaltung ist „die eigenverantwortliche Verwaltung bestimmter öffentlicher Angelegenheiten durch selbständige öffentlich-rechtliche Organisationseinheiten mit Beteiligung der Betroffenen unter Rechtsaufsicht des Staates“ (Schroeder 2009: 190) gemeint.
Als oberstes Beschlussgremium dieser Selbstverwaltung definiert der G-BA im Auftrag des BMG den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Weitergabe von Entscheidungen gilt als Maßnahme, um unpopuläre Entscheidungen, die bei der Bevölkerung auf Missgunst stoßen könnten, politikfern beschließen zu lassen (Heberlein 2005: 67-68). Der G-BA gilt daher auch als „Puffer für den Staat“ (Köster 2005: 87). Diese Taktik erreicht jedoch nur bedingt ihr Ziel, da dem Großteil der Bevölkerung der G-BA in seiner Funktion nicht geläufig ist und sie daher die Verantwortung generell der Politik zuschreiben (Köster 2005: 89).
Auch wenn der G-BA über viel Spielraum in seinen Entscheidungen verfügt, kann er nicht völlig frei entscheiden, denn nach § 94 Abs. 1 SGB V ist das BMG berechtigt, Einwand gegen vorgelegte Beschlüsse des G-BA zu erheben und diese neu bearbeiten zu lassen (Schroeder 2009: 189).
Neben der Festlegung des Leistungskataloges in Form von Richtlinien, übernimmt der G-BA eine wichtige Funktion bei der Qualitätssicherung der ambulanten sowie der stationären Versorgung (Rosenbrock/Gerlinger 2006: 146). Darüber hinaus ist der G-BA berechtigt, Aufgaben weiter zu delegieren. Für die Bewertung von Arzneimitteln aufgrund einer „wissenschaftlichen Fundierung der Entscheidungen“ (Köster 2005: 80) ist das IQWiG eingerichtet worden.
Dorothea Bronner (2009: 213-215), Geschäftsführerin des G-BA, beschreibt, wie der G-BA nach dem GKV-WSG in seiner Zusammensetzung sowohl in strukturellen als auch in inhaltlichen Belangen neu ausgerichtet wurde. Anhand der Abbildung 6 lässt sich ersehen, dass der G-BA insgesamt zwölf stimmberechtigte Mitglieder besitzt. Diese verteilen sich auf den Vorsitzenden, zwei unparteiische Mitglieder und jeweils fünf Mitglieder der Kostenträger sowie fünf Mitglieder der Leistungserbringer. Während die Kostenträger durch den GKV-Spitzenverband vertreten werden, stellen die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die KBV und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) die Vertreter der Leistungserbringer. Zusätzlich nehmen an den Sitzungen maximal fünf Patientenvertreter teil, die sich jedoch durch das nicht vorhandene Stimmrecht von den anderen Mitgliedern unterscheiden. Die Mitglieder üben ihre Aufgaben im G-BA ehrenamtlich aus, was dem Aspekt zugute kommt, dass „Erfahrungen aus dem Versorgungsalltag [...] unmittelbar einfließen“ (Bronner 2009: 214) können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Die Sitzverteilung im Gemeinsamen Bundesausschuss
(Quelle: http://www.g-ba.de/institution/service/illustrationen/)
Im Folgenden soll die Patientenbeteiligung am Beispiel des G-BA näher erläutert werden. Mit der Begründung, dass der Großteil potentieller Patientenvertreter mittels ihrer Zugehörigkeit zu einem Selbsthilfezusammenschluss Mitglied der BAG Selbsthilfe ist, übernimmt diese die Benennung und Entsendung, indem sie aus einem Pool von etwa 200 Patientenvertretern auswählt. Die entsandten Personen müssen eine unabhängige und neutrale Stellung in einer bundesweit ausgerichteten Organisation aufweisen, um akkreditiert werden zu können. Aufgrund der zahlreichen Sitzungen in verschiedenen Gremien wird eine hohe Anzahl von Patientenvertretern benötigt, die die Beteiligungsrechte wahrnehmen (Danner 2006: 29-31).
„Dem Gesetzgeber lag daran, dass die Vertretung möglichst wenig durch `Verbandsfunktionäre` als vielmehr durch unmittelbar Betroffene und aktive Patienten erfolgt. Deswegen haben nicht in erster Linie die Verbände einen Sitz im Gemeinsamen Bundesausschuss, sondern sie sind verpflichtet, sachkundige Personen zu nennen“ (Stötzner 2004: 139).
Eine qualifizierte sowie kontinuierliche Mitarbeit der Patientenseite und die gleichzeitige Einhaltung der vorgesehenen Beteiligung von Betroffenen wird gewährleistet, indem es eine feste Gruppe von ständigen Patientenvertretern gibt und einen Pool betroffener Vertreter, die zu indikationsspezifischen Themen hinzugezogen werden (Stötzner 2004: 139). Martin Danner (2006: 31-32), Geschäftsführer der BAG Selbsthilfe, begründet diese ständige Vertretung von sogenannten Koordinatoren, die es zu jedem Themengebiet gibt, mit der Arbeitsweise, die in den jeweiligen Ausschüssen herrscht. Ein regelmäßiger Wechsel aller Patientenvertreter sei im Sinne der Ergebnisorientierung nicht zielführend.
Die Patientenvertreter besitzen in den Beratungen des G-BA ein Mitberatungs- und Antragsrecht, aber bisher kein Stimmrecht. Es kommt jedoch erschwerend hinzu, dass für den G-BA keine Verpflichtung besteht, die Stellungnahmen der Patientenvertreter nachweisbar in die Entscheidungen einzubeziehen (Heberlein 2005: 72).
In Kapitel 2.2.2.2 zeichnete sich bereits ab, dass ein Stimmrecht kontrovers diskutiert wird. Mit einem Stimmrecht sind verschiedene Aspekte verknüpft. Dafür spricht, dass der Forderung nach einer Kommunikation auf Augenhöhe mit den Leistungserbringern und Kostenträgern nur durch gleichberechtigte Rechte, zu denen das Stimmrecht zählt, genüge getan werden könnte (Köster 2005: 85). Dies müsste jedoch in Einklang gebracht werden mit der Verantwortung, die ein Stimmrecht für die Selbsthilfe bedeuten würde. Für getroffene Entscheidungen wäre die Selbsthilfe mit in die Verantwortung genommen. Bisher sind die aktiven Patientenvertreter im Grunde frei in ihren Entscheidungen und müssen offiziell keine Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Dies verhindert jedoch nicht, dass sie sich häufig von der Öffentlichkeit in die Pflicht genommen fühlen (Köster 2005: 85).
Es ist hilfreich, einheitliche Positionen zu erarbeiten, da bei einem Stimmrecht Geschlossenheit seitens der Patientenvertreter unabdingbar wäre. Die Vertreter unterschiedlicher Indikationen können jedoch durchaus verschiedene Meinungen vertreten. Speziell im Hinblick auf eine verschärfte Diskussion um begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen und die möglichen Maßnahmen der Rationierung und Priorisierung kann die Kompromissfindung unterhalb der Patientenvertreter erschwert werden (Köster 2005: 88). Und „Vielstimmigkeit in den Verhandlungen würde dazu führen, dass die Anliegen der Patientenvertreter kein Gehör finden“ (Angerhausen 2006: 109).
Für ein generelles Stimmrecht in allen Belangen bedarf es nach Meinung der DAG SHG einer Stärkung der bisherigen Strukturen und Ressourcen der Selbsthilfe (DAG SHG 2011: 7-8). „Politische Interessenvertretung ist immer mit finanziellem und materiellem Aufwand verbunden“ (Geißler 2004: 109) und die Bänke unterscheiden sich stark in diesen Ressourcen.
Es wurde bereits an mehreren Stellen betont, dass die Selbsthilfevertreter ihre Aufgaben häufig ehrenamtlich ausführen und daher auch keine Bezahlung für ihre Tätigkeit erhalten. Hinzu kommt, dass sie sich die Informationen, die sie für die Beratungen benötigen, selbst erarbeiten müssen und nicht wie Vertreter der Kassen- oder Leistungserbringerseite auf Mitarbeiter, die ihnen zuarbeiten, zurückgreifen können. Die Arbeit in politischen Gremien kommt zu den grundlegenden Aufgaben, die in der Selbsthilfe zu erfüllen sind, hinzu. Die Zusammenarbeit mit den anderen Bänken kann demnach nicht auf Augenhöhe stattfinden.
Insgesamt wird der Patientenbeteiligung eine positive Auswirkung auf den G-BA bescheinigt. Ein breites Spektrum der Selbsthilfe kann sich einbringen und so besteht die Möglichkeit, dass neben den großen Verbänden auch die Vertreter kleiner Gruppen einbezogen werden, die spezifischen indikationsbezogenen Sachverstand einbringen (Heberlein 2005: 70). Es ist jedoch wichtig, dass Patientenbeteiligung so gestaltet ist, dass die Beteiligten ihr „Engagement als attraktiv und lohnend“ (Dierks 2003: 316) empfinden.
Dies könnte über die nötige Anerkennung innerhalb der Gesellschaft der überwiegend ehrenamtlich ausgeführten Tätigkeiten erfolgen. Sicherlich wirken sich aber auch Erfolge der bisherigen Patientenbeteiligung und das gemeinsam Erreichte positiv auf das Empfinden der eigenen Arbeit aus.
Stefan Etgeton (2009a: 224-227), ehemaliger Referatsleiter Gesundheit beim vzbv, gibt einen Überblick der bisherigen Erfolge aber auch Misserfolge, die auf die Patientenbeteiligung im G-BA zurückzuführen sind. Beispielsweise konnte die Chronikerrichtlinie neu verabschiedet werden, indem die bisherigen Parameter für die Festlegung des Schweregrades einer chronischen Erkrankung um den Aspekt Lebensqualität ergänzt wurden. Als weitere Erfolge können die Verhinderung von Versorgungslücken durch die Heilmittelrichtlinien oder auch die Fahrtkostenübernahme für maßgeblich in der Mobilität eingeschränkte Patienten verbucht werden. Letzterer Fall zeigt jedoch auch, dass die Umsetzungen in der Praxis, bedingt durch infrastrukturelle Probleme, noch nicht ausgereift sind und dass hier weiterhin Handlungsbedarf besteht.
2.2.4 Erfahrungen zur Patientenbeteiligung aus verschiedenen Perspektiven
Borgetto (2001: 18) schätzt die bisherige Forschung auf dem Gebiet der Selbsthilfe als stark fragmentiert ein. Er kritisiert, dass vorherige Studien vorab nicht ausführlich analysiert werden und somit auch keine systematische Fortführung bisheriger Ergebnisse verfolgt werden könnte.
Daher sollen an dieser Stelle wissenschaftliche Studien zur Patientenbeteiligung sowie weitere Erkenntnisse aus Sicht der Patientenvertretern selbst und der Selbstverwaltung als Grundlage für das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit dienen.
Aus allen Perspektiven beziehen sich die Meinungen und Erfahrungsberichte zum größten Teil auf die Patientenbeteiligung im G-BA. Dies ist der bereits beschriebenen Bedeutung und Entscheidungsbefugnis geschuldet. Die Abläufe und Auswirkungen der Beteiligung in weiteren Gremien sind bisher nur wenig systematisch erfasst.
Grundlegend ist es wichtig, zu unterscheiden, ob die Aussagen sich auf die Zeit vor oder nach Verabschiedung des GMG beziehen.
Laut Evelyn Plamper und Michael Meinhardt sind „Erfahrungen mit kollektiver Patientenvertreterbeteiligung an Entscheidungen auf nationaler Ebene in Deutschland noch jung und wenig untersucht“ (2008: 81). Aufgrund dieser Tatsache untersuchten sie die Patientenbeteiligung speziell im G-BA und veröffentlichten 2008 und 2009 zwei aufeinander aufbauende Studien. Während die Studie „Patientenvertreterbeteiligung an Entscheidungen über Versorgungsleistungen in Deutschland“ ein quantitatives Vorgehen verfolgte und auch die BQS einbezog, richtete sich die Studie „Beteiligung von Patientenvertretern im Gemeinsamen Bundesausschuss“ mittels eines qualitativen Verfahrens an die Patientenvertreter. Zielsetzung beider Studien war es, die Umsetzung der Pat.BeteiligungsV systematisch zu untersuchen, da bis zum Zeitpunkt der Erhebung nur einzelne Aussagen der Patientenvertreter vorlagen.
Die Ergebnisse beider Studien besagen, dass es an finanziellen und materiellen Ressourcen für die Patientenvertreter fehlt und dass zu Beginn eine bessere Einarbeitung in die Strukturen und die Arbeitsweisen des G-BA gewünscht ist. Es bedarf nach Sicht der Befragten mehr Aufklärung, um auch neue Selbsthilfevertreter für die Beteiligung im G-BA zu motivieren (Plamper/Meinhardt 2008: 84-85).
Die Zufriedenheit der Mitarbeit wird insgesamt als schwankend erfasst. Dies steht in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Ausschüssen, aber auch mit der als unzureichend bewerteten Transparenz der Entscheidungsfindung, die von vielen als unverständlich und an Betroffene schwer vermittelbar eingestuft wird (Meinhardt/Plamper/Brunner 2009: 100-101).
Die Patientenvertreter befinden sich im Spannungsfeld zwischen der Erfüllung fachlicher Anforderungen und dem Anspruch, aus einer Betroffenenperspektive heraus berichten zu können. Die meist ehrenamtliche Vertreter haben zu wenig Zeit, um sich in die Themen einzuarbeiten. „Eine hauptamtliche Ausübung der Patientenvertretung ist aber nicht anzustreben, da viele Patientenvertreter ihre Legitimation vor allem aus der Arbeit und dem unmittelbaren Kontakt mit Patienten an der Basis beziehen“ (Meinhardt/Plamper/Brunner 2009: 102).
Weitere Ergebnisse besagen, dass das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern und Leistungserbringern als gut einzustufen ist. Die Patientenvertreter fühlen sich überwiegend ernst genommen und wertgeschätzt, jedoch wurde von einigen Befragten der letztendliche Einfluss der eigenen Meinungen verhaltend bewertet (Plamper/Meinhardt 2008: 84).
Hinsichtlich eines Stimmrechtes lautete das Ergebnis, dass die Mehrzahl der Befragten sich für ein Stimmrecht ausspricht, welches sie jedoch an Bedingungen wie die Ausstattung mit mehr Ressourcen oder einen besseren Austausch auch innerhalb der Selbsthilfe knüpfen (Meinhardt/Plamper/Brunner 2009: 99). Es ist nicht ersichtlich, ob ein generelles Stimmrecht oder ein Stimmrecht in Verfahrensfragen gemeint ist.
Insgesamt bewerten die Patientenvertreter in beiden Studien die Patientenbeteiligung als Erfolg und als einen wichtigen Schritt in die vermeintlich richtige Richtung (Meinhardt/Plamper/Brunner 2009: 102).
Eine weitere Untersuchung fand bereits vor Verabschiedung des GMG 2004 statt und kann somit Unterschiede zur Beurteilung der Beteiligung vor Einführung der Pat.BeteiligungsV aufzeigen. Die als Telefonbefragung angelegte qualitative Studie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit den Akteuren des Gesundheitssystems, erfasst aber auch die Möglichkeiten der Partizipation. Diese werden im Gegensatz zur Einschätzung, die 2008 und 2009 erhoben wurden, wesentlich schlechter eingestuft. Die Ergebnisse besagen, dass sich 61,4%, der Beteiligten schlecht eingebunden fühlen und nur 11,9% die Beteiligung als gut bewerten. Bei der Frage, in welchen Bereichen eine stärkere Einbindung gewünscht ist, fielen die meisten Stimmen mit Abstand auf politische Prozesse (Dierks/Seidel 2005: 146-147). Einig mit den aktuellen Ergebnissen ist man sich hinsichtlich der personellen und finanziellen Ressourcen. Ein Ausbau der Partizipation ist nur möglich, wenn die Strukturen dementsprechend angepasst werden (Dierks/Seidel 2005: 147).
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien decken sich größtenteils mit den subjektiven Berichten verschiedener Patientenvertreter. In ihrem Fazit nach einjähriger Patientenbeteiligung beschreiben Danner und Matzat eine „strukturelle Unterlegenheit“ (2005: 153), die dem Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen geschuldet ist. Dies beobachtet auch Karin Stötzner, Patientenbeauftragte für Berlin und Mitglied in zahlreichen Gremien rund um die Vertretung von Patientenbelangen, kritisch. „Bedenkt man die schmale Ausstattung der meisten Selbsthilfeverbände im Vergleich zu den professionellen institutionellen Strukturen bei Krankenkassen und Ärzten, so muss die enorme Leistung der Verbände besonders hervorgehoben werden. Der ehrenamtliche Anteil an der neuen Vertretungsaufgabe ist beachtlich“ (Stötzner 2004: 140).
Danner (2006: 29) gibt ferner zu bedenken, dass es die Selbsthilfe vor eine große Herausforderung stellt, die nötige Anzahl qualifizierter Patientenvertreter zu finden, die sich der Aufgabe der Beteiligung stellen wollen. Irene Kolb-Specht, ehemalige Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Baden-Württemberg, beschreibt diese Aufgabe als „schier unlösbar“ (2006: 4), denn Patientenvertreter fühlen sich häufig nicht kompetent genug und fordern daher eine Rolle in politischen Entscheidungen nur vereinzelt ein (Trojan 2003: 333).
Weiterhin wird die Patientenbeteiligung dahingehend kritisiert, dass die Materialien für Sitzungen im G-BA erst kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, so dass die Auseinandersetzung mit komplexen Themen zeitlich begrenzt und eingeschränkt wird (Danner/Matzat 2005: 151). Dies kann die Akzeptanz der Patientenvertreter schwächen, denn diese „hängt auch von der Wahrnehmung der Fachlichkeit der Vertreterinnen und Vertreter ab“ (Angerhausen 2006: 109).
Das bereits in der Studiendarstellung angesprochene Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Bänken, bewertet auch Danner (2006: 34) kritisch. Während bei den Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Stab an Mitarbeitern im Hintergrund steht, der Unterlagen vorbereitet und seine Vertreter auf die Sitzungen vorbereitet, müssen Patientenvertreter sich dies selbst aneignen und sich häufig in gänzlich neue Themenkomplexe einarbeiten.
Die Patientenvertreter haben „im Hinblick auf die inhaltlichen Ergebnisse [...] das erste Jahr ihrer Beteiligung verhalten positiv bewertet“ (Heberlein 2005: 75). Laut Etgeton besteht der Eindruck, dass die „Patientenbeteiligung zu einer Veränderung der Kultur des Gremiums beigetragen hat“ (2009a: 227). Allein die Präsenz der Patientenvertreter hat Veränderungen in althergebrachte Diskussionsprozesse angestoßen und dazu geführt, dass Kassen und Leistungserbringer sichtlich bemüht sind, ihre Positionen gut zu begründen, um auch die Akzeptanz der Patientenvertreter zu erlangen.
Auch auf Seiten der Patientenvertreter hat sich gezeigt, dass die Diskussionen mit den anderen Bänken dazu führt, dass für das gesamte System mehr Verständnis entwickelt und dieser Systembezug in eigene Anliegen eingebracht wird (Köster 2005: 84). „Die Zusammenarbeit mit den beiden traditionellen `Bänken` des Gemeinsamen Bundesausschusses (Leistungserbringer und Krankenkassen) funktioniert [...] erstaunlich gut“ (Danner/Matzat 2005: 151).
Nach knapp sieben Jahren praktizierter Patientenbeteiligung und der anfänglichen Erfolgsverbuchung des Beteiligungsrechtes „macht sich allerdings auch schon ein wenig Ernüchterung und Ungeduld breit. So werden im Koordinierungskreis bereits einzelne Stimmen laut, wonach die Rahmenbedingungen der Patientenbeteiligung alsbald und das Recht auf Mitberatung mittelfristig in ein Recht auf Mitentscheidung fortentwickelt werden müssen – auch zur Rechtfertigung des nicht unerheblichen Aufwands der ehrenamtlichen Patientenvertreter“ (Kolb-Specht 2006: 6).
Die Sicht der Selbstverwaltung wird durch Rainer Hess, dem Vorsitzenden des G-BA, veranschaulicht. Er sieht eine Problematik in den begrenzten Ressourcen der Patientenvertreter, die sich negativ auf die adäquate Repräsentation der Betroffenensicht auswirken kann, da bei weitem nicht alle Themengebiete fachlich abgedeckt werden können. Er stellt sich die Frage, wie dieses Problem gelöst werden könnte und spricht sich gegen eine Professionalisierung der Selbsthilfe aus. Diesbezüglich sieht er die Betroffenenkompetenz, das Herzstück der Patientenbeteiligung, in Gefahr und die Zunahme von professionellen Verbandsvertretern, die sich für die Patientenbelange einsetzen, bewertet er kritisch (Köster 2005: 83). Würde die Betroffenenkompetenz in den Hintergrund rücken, die ursprünglich für mehr Legitimation der Entscheidungen des G-BA sorgen sollte, wäre dies nicht im Sinne der Selbstverwaltung.
2.2.5 Legitimation als Grundvoraussetzung für die Vertretung kollektiver Interessen
Legitimation ist eine Voraussetzung, um für Entscheidungsfindungen berechtigt zu sein und um Akzeptanz für diese Entscheidungen zu erfahren. Die Legitimationsanforderungen, die in Zusammenhang mit der Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen stehen, müssen auf zwei Seiten gewähr-leistet sein. Zum einen stellt sich die Frage nach der Legitimation der Patientenvertreter, welche die Belange aller Betroffenen vertreten, zum anderen muss die Legitimation der Selbstverwaltung, welche grundlegende Entscheidungen für die gesundheitliche Versorgung der Bürger trifft, gegeben sein.
Wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt, wird die Patientenbeteiligung grundlegend gut geheißen und findet auch aus verfassungs- sowie gesundheitspolitischer Sicht nachvollziehbare Argumente. Bei der Ausübung dieser Beteiligung wird jedoch die Legitimation der Beteiligten in Frage gestellt (Nachtigäller 2001: 99-100).
Mit Einführung der kollektiven Patientenbeteiligung wurde entschieden, dass die Wahrnehmung durch die in der Pat.BeteiligungsV benannten Organisationen erfolgt und diese somit als Vertreter für Patienteninteressen einstehen. Aufgrund von Konkurrenz und Heterogenität innerhalb der Selbsthilfe führte diese Benennung jedoch nicht zu einer von allen Seiten akzeptierten Legitimation (Köster 2005: 80-81). Kritiker beschreiben die Auswahl der benannten Organisationen als „recht willkürlich“ (Krau-se/Rothgang 2005: 206), da sie ohne nähere Begründung durch den Gesetzgeber festgelegt sind. Es fehlen demokratische Wahlen, die es dem Patienten ermöglichen, die Personen zu benennen, die seiner Meinung nach die Interessenvertretung für Patienten wahrnehmen sollen (Krau-se/Rothgang 2005: 204).
Speziell gegenüber der Vertretung durch den vzbv besteht Kritik. Hierbei „handelt es sich nicht um Selbsthilfe-, sondern um advokatorisch tätige Organisationen. Es gibt diesbezüglich unterschiedliche Erscheinungsformen. Für Verbraucherberatungsstellen ist die Beratung von Patienten eine von vielen Dienstleistungen“ (Hänlein/Schroeder 2010: 54). Die Vertreter des Verbraucherschutzes verfügen somit nicht über das Grundprinzip der Selbsthilfe, die Betroffenenkompetenz.
Es gilt zu bedenken, dass das Verfahren der Benennung von Patientenvertretern für die Vertretung kollektiver Rechte ein großes Maß an Transparenz benötigt, das am ehesten durch eine öffentliche Ausschreibung dieser Positionen oder die Ernennung von Patientenvertretern durch ein Ministerium erreicht werden kann. Eine Gefahrenquelle bei der Hinzuziehung von Patientenvertretern wird in der möglichen Einflussnahme auf die Selbsthilfe durch Firmen oder Verbände, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, gesehen (Rieser 2000).
„Neben der, von Politik und Gesellschaft zu leistenden rechtstheoretischen Klärung, wie etwa Auswahlverfahren für Patienten- und Selbsthilfevertreter rechtsstaatlich zu gestalten sind, ist auch die Selbsthilfe in der Verantwortung hier noch stärker notwendige Vertretungsstrukturen zu schaffen“ (Bindert 2001: 142). Dieses Zitat unterstreicht, wie wichtig es ist, dass auch die Selbsthilfe selbst zur ihrer eigenen Legitimation beiträgt. Regelungen sollen nicht ausschließlich von außen herangetragen werden, sondern können ebenso von innen wachsen. Vertreter der Selbsthilfe benennen verschiedene Kriterien, die ihrer Meinung nach diese geforderten Vertretungsstrukturen gewährleisten. So bezieht sich Etgeton (2009: 108) auf die jahrelange Erfahrung und die gewachsenen Strukturen der Selbsthilfe, die grundsätzlich bereits für eine Legitimation der Vertretung von Patienteninteressen sprechen. „Volksvertreter sind prinzipiell legitimiert, die Interessen der Nutzer im Gesundheitswesen zu vertreten“ (SVR 2002: 332), so lautet auch die Meinung des SVR.
Weiterhin trägt die politische, industrielle, kommerzielle und konfessionelle Unabhängigkeit zu den Ansprüchen einer legitimierten Wahrnehmung der Patienteninteressen bei und wird zusätzlich gestärkt durch das Engagement Betroffener und den Grundsätzen eines eingetragenen Vereins, welche auf demokratischen Prinzipien basieren (Danner/Nachtigäller/Renner 2009: 7-8).
Bei Vorstellung der Pat.BeteiligungsV wurde bereits erläutert, dass die benannten Organisationen in ihrer Satzung ein demokratisches Verfahren zur Binnenlegitimation der Vertreter aufweisen müssen, denn eine „Akzeptanz der Patientenbeteiligung wird gewährleistet, in dem die Vertreterinnen und Vertreter in ihren Positionen als legitim erachtet werden“ (Angerhausen 2006: 109). Darüber hinaus müssen die Zusammenschlüsse „über Mechanismen verfügen, sich Informationen und Rückmeldungen zu beschaffen, wie sich die Politik weiterentwickelt“ (Nestmann 2001: 198).
Die Frage nach der Realisierung der Anforderungen an die Selbsthilfe führt zu den Argumenten, die gegen eine legitime Ausübung der Beteiligungsrechte sprechen. Die vorkommende Heterogenität in der Selbsthilfe, die auch innerhalb eines Erkrankungsbildes bestehen kann, erschwert die Durchsetzung von Interessen durch mangelnde Geschlossenheit. Die bestehende Kritik an der Auswahl der benannten Organisationen führt zu einem Repräsentativitätsproblem.
Hinzu kommt, dass die Selbsthilfe innerhalb der Gesellschaft nur über einen niedrigen Bekanntheitsgrad verfügt, was zu einem geringen Rückhalt führt. Dieser fehlende Rückhalt gilt ebenso durch die Politik, die Krankenkassen und die Vertretung der Leistungserbringer. Zusätzlich mangelt es an personellen und finanziellen Ressourcen, sowie Fachkenntnissen für die Vertretung kollektiver Interessen (Geißler 2004: 314-315).
„Der derzeitige Stand der Patientenbeteiligung an Entscheidungsprozessen des G-BA kann [...] letztlich nicht überzeugen und ist eher als Beginn einer Entwicklung, denn als ihr Ende anzusehen: Auf der einen Seite ist die Forderung begründbar, dass die Patientenvertreter dadurch aufgewertet wer-den sollen, dass ihnen ein volles Stimmrecht verliehen wird und damit die Mitwirkungsmöglichkeiten der Patienten erhöht werden. Auf der anderen Seite, kann genauso gefordert werden, dass die Rolle dieser demokratisch nicht legitimierten selbst ernannten Patientenvertreter (wieder) weiter ein-geschränkt wird, um so die heraufbeschworenen Legitimationsprobleme zu lösen“ (Krause/Rothgang 2005: 204).
Die Frage der Legitimation auf Seiten der Patientenvertreter verschärft sich mit Zunahme der Forderung nach einem Stimmrecht (Bindert 2001: 142). Bisher ist nicht absehbar, in welche von Krause und Rothgang aufgezeigte Richtung diese Entwicklung gehen wird. Auch das Patientenrechtegesetz macht keine näheren Angaben zur Ausgestaltung der kollektiven Patientenbeteiligung.
Ebenfalls von Belang ist die Entscheidungsberechtigung der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitssystem. Denn Legitimationsbedarfe bestehen auf beiden Seiten. Speziell die Legitimation des G-BA wird auf Grund seiner umfangreichen Befugnisse häufig in Frage gestellt. Mit den Vertretern aus Krankenkassen, KBV, KZBV und der DKV wird das Ziel verfolgt, dass diese im Namen ihrer Organisationen agieren. Diese Art von Zusammensetzung eines Gremiums, bei dem nicht jeder einzelne Vertreter einbezogen wird, ist aus demokratischer und rechtlicher Sicht nicht stringent. In der Praxis hat dies bisher noch zu keinen Einschränkungen für den G-BA geführt (Heberlein 2005: 68).
Jedoch vermehren sich, wie bereits in der Einleitung angedeutet, aktuell die Forderungen nach erhöhter Transparenz der Arbeit und der Entscheidungen des G-BA. Eine aktuell diskutierte Änderung der Regelung zur Benennung der unparteiischen Vorsitzenden, die sich als Inhalt des neuen Versorgungsgesetzes abzeichnet, verfolgt das ernannte Ziel, zu einer erhöhten Legitimation des G-BA beizutragen. Entweder sollen die Unparteiischen durch den Gesundheitsausschuss des BMG oder durch die Trägerorganisationen vorgeschlagen werden. Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Benennenden und dem G-BA kommen, läge die Aufgabe der Benennung beim BMG (BMG: 65).
Die Einbeziehung der Patientenvertreter sollte ursprünglich die Legitimation des G-BA stärken. Mittlerweile steht die Selbstverwaltung jedoch vor dem Widerspruch, dass dieser geplante Abbau von Legitimationsdefiziten mit seiner Umsetzung dazu geführt hat, dass nun auch die Patientenvertreter ihre Legitimation beweisen müssen. Ingo Heberlein (2005: 64-70), Professor an der Hochschule Fulda und Vertreter des Sozialverbandes Deutschlands im G-BA, stellt die Frage, ob die Einbeziehung von Patienten überhaupt das Legitimationsproblem des G-BA lösen könnte und beantwortet dies mit einem eindeutigen Nein. Durch die fehlende demokratische Wahl von Patientenvertretern können diese mit ihrer Beteiligung die Legitimation nicht positiv beeinflussen. Da es sich um eine Verbandsvertretung handelt, ist jeder einzelne Patientenvertreter nicht demokratisch gewählt, sondern von den in der Pat.BeteiligungsV benannten Organisationen ausgewählt. Daher werden „rechtliche Zweifel der demokratischen Legitimation des G-BA [...] durch die Beteiligung von Patientenvertretern nicht beseitigt“ (Heberlein 2005: 70).
Jedoch wurden erst kürzlich Vorschläge unterbreitet, die sich positiv auf die Legitimation der Patientenvertreter auswirken könnten. Angelehnt an das Schöffenwahlrecht sind Qualifikationskriterien für potentielle Patientenvertreter denkbar, die in der Pat.BeteiligungsV festgeschrieben werden. Weiterhin könnte ein Vorschlagsverfahren für die Benennung der indikations-spezifischen Patientenvertreter etabliert werden, demnach das BMG eine Vorschlagsliste der Patientenzusammenschlüsse prüft und diese dem Parlament zur Wahl vorlegt (Dierks 2011). Legitimation ist eine Voraussetzung, um für Entscheidungsfindungen berechtigt zu sein und um Akzeptanz für diese Entscheidungen zu erfahren. Die Legitimationsanforderungen, die in Zusammenhang mit der Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen stehen, müssen auf zwei Seiten gewährleistet sein. Zum einen stellt sich die Frage nach der Legitimation der Patientenvertreter, welche die Belange aller Betroffenen vertreten, zum anderen muss die Legitimation der Selbstverwaltung, welche grundlegende Entscheidungen für die gesundheitliche Versorgung der Bürger trifft, gegeben sein.
3. Methodisches Vorgehen in Theorie und Praxis
Grundlegende Erkenntnisse und den aktuellen Stand der Forschung zur Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitssystem lieferte eine intensive Literaturrecherche, deren Ergebnisse im zweiten Kapitel vorgestellt wurden. Qualitative Interviews mit Patientenvertretern, die in gesundheitspolitischen Gremien beteiligt sind, bilden die Grundlage der empirischen Untersuchung und sollen die bisher gewonnen Erkenntnisse um zusätzliche Informationen ergänzen.
3.1 Fragestellungen der Untersuchung
Das Forschungsinteresse des qualitativen Untersuchungsdesigns zu „Beteiligungsmöglichkeiten an gesundheitspolitischen Prozessen als Herausforderung für die Selbsthilfe“ konzentriert sich auf die Einbindung von Patientenvertretern in politische Gremien des deutschen Gesundheitssystems. Mit dem Begriff Einbindung ist die Einbeziehung von Patientenvertretern in gesundheitspolitische Diskussionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene nach den vorangegangen beschriebenen Beteiligungsoptionen gemäß Hart (2005: 10) gemeint.
Die Auswertung findet unter Beachtung indikationsspezifischer Unterschiede statt und bezieht sich auf Erkrankungen mit hoher Prävalenz auf der einen Seite und Erkrankungen seltener Art auf der anderen Seite. Prävalenz ist das epidemiologische Maß für die Häufigkeit einer Erkrankung, folglich zeichnen sich Erkrankungen mit hoher Prävalenz durch ein häufiges Vorkommen in der Bevölkerung aus. Unter seltenen Erkrankungen versteht man Krankheiten, von denen aus epidemiologischer Sicht nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen betroffen sind. Insgesamt werden weltweit etwa 5.000 verschiedene seltene Krankheiten gezählt[19].
Ziel der Untersuchung ist es, zu ermitteln, wie die Patientenvertreter ihre Tätigkeit in dieser Art Gremien beurteilen und wie zufrieden sie mit der praktischen Ausgestaltung der Beteiligung sind. Es wird untersucht, wie die Aufgaben der kollektiven Beteiligung sich auf die genuinen Tätigkeiten der Selbsthilfe auswirken und wie kompetent sich die Personen bei der Erfüllung dieser Aufgaben fühlen.
Darauf basierend werden Weiterentwicklungsoptionen für die politische Einbindung im Sinne einer Verbesserung der Belange von Betroffenen erfragt. Von weiterem Interesse ist die Einschätzung der Patientenvertreter bezüglich der Auswirkungen der kollektiven Beteiligungsrechte auf die Situation der Patienten in Deutschland.
Demnach ergeben sich folgende Fragestellungen:
1. In welcher Form ist die organisierte gesundheitsbezogene Selbsthilfe in gesundheitspolitische Institutionen und Entscheidungsprozesse eingebunden?
2. Wie wirkt sich die politische Einbindung auf die grundlegenden Aufgaben innerhalb der Arbeit im eigenen Zusammenschluss aus?
3. Wie qualifiziert fühlen sich Patientenvertreter in der Wahrnehmung politischer Aufgaben?
4. Welche Verbesserungsoptionen bestehen bezüglich der Einbindung von Patientenvertretern in politische Institutionen und Entscheidungsprozesse?
5. Wie wirkt sich die politische Beteiligung der Selbsthilfe auf die Situation der Patienten in Deutschland aus?
Die Hauptfragestellung lautet, welche Herausforderungen sich durch die Beteiligungsmöglichkeiten an gesundheitspolitischen Prozessen für die Selbsthilfe ergeben und ob Unterschiede zwischen der Vertretung von Erkrankungen mit hoher Prävalenz und Erkrankungen seltener Art bestehen.
Darüber hinaus ist von Interesse, wie die Reaktionen auf die Interviewanfrage generell ausfallen und ob neben Zu- und Absagen für die Interviews weitere Mitteilungen eingehen. Diese sollen deutlich getrennt von den Ergebnissen der systematischen Analyse dargestellt werden.
Der indikationsspezifische Forschungsansatz begründet sich in dem Interesse zu untersuchen, ob aufgrund der hohen Prävalenz eines Krankheitsbildes dessen politische Bedeutung anders eingeschätzt wird als bei seltenen Erkrankungen.
3.2 Methodik der qualitativen Sozialforschung
Sowohl die qualitative als auch die quantitative Sozialforschung verfolgen das Ziel, einen Bereich der sozialen Umgebung genau zu untersuchen, um im Anschluss mit Hilfe der gewonnen Ergebnisse die bestehenden Theorien zu dem Sachverhalt weiterzuentwickeln (Gläser/Laudel 2010: 24). Die Methoden der qualitativen Sozialforschung basieren „auf der Interpretation sozialer Sachverhalte, die in einer verbalen Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert. Sie standardisieren die Informationen über die sozialen Sachverhalte nicht (oder zumindest nicht im selben Ausmaß wie quantitative Methoden). Die Komplexität sozialer Sachverhalte wird nicht so sehr bei der Datenerhebung, sondern erst im Prozess der Auswertung schrittweise reduziert“ (Gläser/Laudel 2010: 27).
Die qualitative Sozialforschung bietet sich für Themen aus dem Bereich Public Health an, da sie dazu beiträgt, Lebenswelten zu untersuchen. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung kann durch die offene Art der qualitativen Methode ein tiefer Zugang zu der Sicht der Individuen, die mit dieser Lebenswelt vertraut sind, erschlossen werden. Speziell bezogen auf die Patienten im Gesundheitswesen sind „die wissenschaftliche Begleitung der Prozesse und die Evaluation der Effekte einer Etablierung der neuen Rollen und Aufgaben der Nutzer auf die Effektivität und die Effizienz des Systems“ (Dierks 2003: 321) wichtige Aufgabenbereiche von Public Health.
Um die Nachvollziehbarkeit der Analyse zu gewährleisten, finden die für die quantitative Forschung geltenden Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auch in der qualitativen Forschung Anwendung. Aufbauend auf diesen Stärken wird die Textanalyse anhand folgender Aspekte durchgeführt. Nach Philipp Mayring (2007: 12), Psychologe, Soziologe und Pädagoge sowie Mitbegründer der qualitativen Inhaltsanalyse, sind dies die detaillierte Dokumentation aller Verfahrensschritte sowie die sogenannte Regelgeleitheit, welche die Einhaltung der Verfahrensregeln bezeichnet, damit das gesamte Vorgehen und die Darstellung der Ergebnisse auch von Dritten nachvollzogen werden können. Zusätzlich soll Nähe zum untersuchten Gegenstand bestehen und die Analyse der Ergebnisse soll auf Grundlage der bisherigen theoretischen Erkenntnisse durchgeführt werden. Des Weiteren ist der Beleg aller Interpretationen mit handfesten Argumenten nötig und im Sinne der kommunikativen Validierung sollen die Ergebnisse durch erneutes Vorlegen oder die Diskussion mit den Interviewpartnern auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Durch die Entwicklung von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und einem Vergleich dieser Ansätze verfolgt die qualitative Forschung anhand der sogenannten Triangulation das Ziel, einzelne Ansichten zu einer ganzheitlichen Betrachtung zusammenzufügen.
Da die qualitative Forschung primär der Hypothesenbildung und weniger der Hypothesenüberprüfung dient, ist das Ziel der Untersuchung, neben dem Beitrag von neuen Erkenntnissen zum Themengebiet, abschließend Thesen aufstellen zu können, die Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen schaffen. Dieses Vorhaben „ist ein klassischer Bereich qualitativer Forschung“ (Mayring 2007: 20).
3.2.1 Das qualitative Experteninterview als angewandte Forschungsmethode
Die gewählte Forschungsmethode ist das qualitative Experteninterview, konzipiert als leitfadengestützte Befragung. Das Leitfadeninterview als Erhebungsmethode dient dazu, den Interviewpartner in einer natürlichen Gesprächssituation offen und frei zum Themengebiet berichten zu lassen und ihm die Möglichkeit zu bieten, thematische Schwerpunkte zu setzen. Unter Berücksichtigung der Relevanzsetzung des Interviewpartners kommt dem Interviewer die Aufgabe zu, darauf zu achten, dass dennoch alle relevanten Themen behandelt werden. Die konkrete Reihenfolge der erzählgenerierenden Fragen ist nicht zwingend vorgegeben und orientiert sich an dem Verlauf des jeweiligen Interviews (Gläser/Laudel 2010: 42). Der Leitfaden ist lediglich theoretisch vorstrukturiert, um eine thematische Vergleichbarkeit der Interviews zu gewährleisten. Das Prinzip der Offenheit steht jedoch „in einem gewissen Widerspruch zu der Aufgabe des Leitfadeninterviews, in begrenzter Zeit spezifische Informationen zu mehreren verschiedenen Themen zu beschaffen“ (Gläser/Laudel 2010: 131).
Eine Variante des Leitfadeninterviews ist das Experteninterview. Es wurde als Erhebungsmethode gewählt, da die befragten Personen Experten auf ihrem Gebiet sind, hier über ein spezifisches Wissen verfügen und durch die Form des Interviews dieses Wissen weitergeben. “Experten sind ein Medium, durch das der Sozialwissenschaftler Wissen über einen ihn interessierenden Sachverhalt erlangen will“ (Gläser/Laudel 2010: 12). Im untersuchten Fall bezieht sich dies auf die Vertretung Erkrankter und deren Angehöriger und die Beteiligung in politischen Gremien im deutschen Gesundheitssystem durch in der Selbsthilfe aktive Patientenvertreter.
Wichtige Voraussetzung für ein Experteninterview ist die vorherige intensive Auseinandersetzung mit dem Thema durch den Interviewer. Daher wurden im Vorfeld die theoretischen Hintergründe der Patientenbeteiligung recherchiert. Vor jedem Interview wurden zudem Informationen über die spezifische Indikation und den Selbsthilfezusammenschluss, dem der jeweilige Patientenvertreter angehört, eingeholt. Dieses Vorwissen ist unabdingbar, um Berichte seiner Tätigkeit in einem Zusammenhang bringen zu können, gezielte Fragen zu stellen und um auf Antworten des Interviewpartners adäquat reagieren zu können. Der Experte ermöglicht dem Forscher folglich einen Einblick in seine Erfahrungen.
3.2.1.1 Vorbereitung der Interviews
Die Vorbereitung der Interviews beinhaltet verschiedene aufeinander folgende Schritte wie die Auswahl der Interviewpartner, die Kontaktaufnahme und die Terminplanung.
„Der Inhalt eines Interviews wird neben dem eigenen Erkenntnisinteresse vor allem durch den Interviewpartner bestimmt. Die Auswahl von Interviewpartnern entscheidet über die Art und die Qualität der Informationen, die man erhält“ (Gläser/Laudel 2010: 117-118). Die Interviewpartner sollten sich durch ihr Engagement in der Selbsthilfe und speziell durch Erfahrungen in der Arbeit auf politischer Ebene auszeichnen. Die Beteiligung in mindestens einem Gremium, welches sich mit zentralen gesundheitspolitischen Fragestellungen beschäftigt, qualifiziert die Interviewpartner für den Einschluss in die Untersuchung.
Der erste Ansatz zur Auswahl potentieller Interviewpartner erfolgte über die Kontaktaufnahme zur Stabstelle Patientenbeteiligung des G-BA. Die Möglichkeit, die Interviewanfragen über eine Liste aller Patientenvertreter, die im G-BA vertreten sind, zu verschicken, ließ sich nicht realisieren.
Die endgültige Kontaktaufnahme zu Selbsthilfezusammenschlüssen erfolgte anhand der Adress-Datenbank „Grüne Adressen“ der NAKOS. Hier finden sich insgesamt 376 Adressen[20] von Selbsthilfezusammenschlüssen aus den Bereichen Gesundheit, Psychosoziales und Soziales[21]. Die gelisteten Selbsthilfezusammenschlüsse zu gesundheitlichen Belangen wurden per E-Mail angeschrieben. Eine kurze Vorstellung der geplanten Befragung, die Einschlusskriterien für geeignete Interviewpartner und ein Begleitschreiben von Frau Professor Dierks waren Inhalt des Anschreibens[22]. Das Begleitschreiben sollte dazu dienen, die Motivation zur Teilnahme zu erhöhen und die wissenschaftliche Betreuung durch die Medizinische Hochschule zu untermauern. Hinzugefügt wurden die Kontaktdaten der Interviewerin, um für den gesamten Verlauf der Studie als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. Die Informationen über die geplante Befragung dienen der Einhaltung von forschungsethischen Aspekten und entsprechen somit dem Prinzip der informierten Einwilligung (Gläser/Laudel 2010: 158-159).
Dieses Vorgehen stieß jedoch bei der BAG Selbsthilfe auf Kritik. Kurz nach dem Versand der ersten Anfragen meldete sich eine Vertreterin der Dachorganisation mit dem Angebot Kontakte zu vermitteln, wenn vorab im Koordinierungsausschuss die Fragen des geplanten Interviews für adäquat er-achtet würden. Aufgrund der fortgeschrittenen selbständigen Kontaktaufnahme zu möglichen Interviewpartnern wurde das Angebot der BAG Selbsthilfe dankend abgelehnt. Dennoch wurde der Fragebogen angefordert und darauf verwiesen, dass möglicherweise den Mitgliedern angeraten werden würde, nicht an der Befragung teilzunehmen. Darüber hinaus ging keine weitere Nachricht der BAG Selbsthilfe ein.
Die erste Kontaktaufnahme erfolgte, wie beschrieben, schriftlich per E-Mail mit dem Ziel „die Person soweit über die Studie aufzuklären, dass sie auf Grundlage der Informationen eine freiwillige Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme treffen kann“ (Schmacke u. a. 2009: 15). Dieses Vorgehen erwies sich im Hinblick auf die Rekrutierung der vorab geplanten Anzahl von zwölf Interviewpartnern als zielführend und somit konnte auf eine telefonische Nachfassaktion verzichtet werden. Von den insgesamt 156 angeschriebenen Selbsthilfezusammenschlüssen, davon 132 aus dem Bereich der Erkrankungen mit hoher Prävalenz und 24 Vereinigungen aus dem Gebiet der seltenen Erkrankungen, meldeten sich in einem Zeitraum von fünf Wochen insgesamt 84 zurück. 49 Personen stimmten der Teilnahme an einem Interview zu, welche sich auf sechs Vertreter seltener Erkrankungen und 43 Vertreter hoch prävalenter Erkrankungen verteilten. Insgesamt 26 davon teilten mit, dass sie nicht Mitglied in politischen Gremien sind, sich aber dennoch für ein Interview zur Verfügung stellen würden.
33 Zusammenschlüsse erteilten eine Absage. Gründe hierfür waren mangelnde zeitliche Ressourcen oder die Tatsache, dass die entsprechende Vereinigung nicht in politischen Gremien aktiv war. Letzterer Aspekt führte häufig dazu, dass dennoch ein grundsätzliches Interesse an einem Interview und an dem Austausch über weitere Themen, welche die Selbsthilfe betreffen, geäußert wurde.
Das Vorhaben der indikationsspezifischen Analyse, welches im Vorfeld konzipiert wurde, ließ sich anhand der Rückmeldungen der Patientenvertreter gut realisieren. Zu Beginn konnten sowohl sechs Interviewtermine mit Patientenvertretern hoch prävalenter Erkrankungen als auch sechs Termine mit Vertretern seltener Erkrankungen vereinbart werden. Auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen waren keine weiteren Zusagen zu verzeichnen. Von den Zusagen hoch prävalenter Erkrankungen wurden die ersten sechs Zusagen ausgewählt. Weiter Interviews waren in Anbetracht der zeitlichen Ressourcen der Interviewerin nicht realisierbar. Nach Abschluss der Terminplanung wurde eine Zusage auf Seiten der seltenen Erkrankungen wieder zurückgenommen und zusätzlich stellt sich bei der Durchführung der Interviews heraus, dass ein Vertreter der Erkrankungen mit hoher Prävalenz der Tonbandaufnahme nicht zustimmte, so dass letzten Endes für beide Indikationsbereiche jeweils fünf Interviews in die systematische Auswertung einfließen konnten.
Im Vorfeld des jeweiligen Interviewtermins wurde der Interviewpartner per E-Mail kontaktiert, um den Termin zeitnah anzukündigen und um die Themenbereiche des Interviews vorab zu benennen. Auf diesem Wege verfügten alle Interviewpartner über den gleichen Informationsstand.
Es fanden ebenfalls Gespräche mit Personen statt, die sich außerhalb der systematischen Erfassung zum Themengebiet austauschen und ihre Meinungen und Erfahrungen mitteilen wollten. Die Ergebnisse dieser Gespräche und die schriftlichen Stellungnahmen von Personen, die nicht an der Befragung teilnehmen, aber dennoch ihren Standpunkt deutlich machen wollten, sollen ebenfalls Eingang in die Ergebnisse finden. Denn auch wenn diese Informationen nicht mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und deutlich von der systematischen Analyse getrennt dargestellt werden, ergeben auch sie interessante und erwähnenswerte Aspekte.
3.2.1.2 Entwicklung und Anwendung des Leitfadeninterviews
Auf Basis des angeeigneten Wissens und der Auseinandersetzung mit veröffentlichten Studien zum Forschungsgebiet wurde der Leitfaden für das Interview entwickelt, der alle relevanten Bereiche, die mit den Forschungsfragen in Zusammenhang stehen, beinhaltet und als Grundlage für die Datenerhebung dient.
An erster Stelle der Leitfadenentwicklung stand die Sammlung von Stichpunkten zur Thematik, die im Anschluss zu Fragen formuliert wurden. Zielsetzung bei der Entwicklung der Fragen ist die kurze, prägnante und eindeutige Formulierung, die sich nach Möglichkeit an der Alltagssprache orientiert (Schmacke u. a. 2009: 15).
Das Interview bestand aus sechs Themenbereichen, die sich an den Forschungsfragen orientierten. Es handelte sich dabei um Angaben zur Tätigkeit in der Selbsthilfe, die Art der Beteiligung auf politischer Ebene, die Vereinbarkeit genuiner Aufgaben und politischer Beteiligung, Weiterentwicklungsoptionen sowie die Auswirkungen politischer Beteiligung auf die Situation der Patienten. Weitere Fragen zu jedem Themenbereich wurden genutzt, um nach Möglichkeit alle Aspekte, die mit der Frage in Zusammenhang stehen und beantwortet werden sollen, erfassen zu können. Zusätzlich wurden Aufrechterhaltungsfragen angewandt, um weitere Informationen zu einer Frage zu erhalten[23].
Die Fragen des Leitfadens waren dementsprechend ausgerichtet, dass sich die Dauer des Interviews voraussichtlich auf einen zeitlichen Rahmen von 45 Minuten belaufen würde. Diese Konzeption war notwendig, um die Rücklaufquote zu erhöhen, da davon auszugehen war, dass Patientenvertreter über knappe zeitliche Ressourcen verfügen und daher bei einer Interviewdauer von weniger als einer Stunde eher mit einer Zusage gerechnet werden konnte.
Zu Beginn erfolgte die Abfrage von demografischen Daten wie beispielsweise Alter, Bildungsgrad und beruflicher Tätigkeit, um eine spätere Analyse anhand dieser Fakten zu ermöglichen. Die darauf folgenden Themengebiete sollen folgend vorgestellt und mit der verbundenen Intention näher beschrieben werden.
Die erste Frage nach der Tätigkeit in der Selbsthilfe des Interviewpartners diente als sogenannte „Eisbrecher“-Frage, die einen Einstieg in das Thema liefern soll (Gläser/Laudel 2010: 147-148). Mit der Aufforderung, etwas über die eigenen Aufgaben zu erzählen, sollte darüber hinaus der Rahmen der Aktivität in der Selbsthilfe ermittelt und auch hier die Grundlage für eine spätere Auswertung mittels dieser Anhaltspunkte gelegt werden.
Den Einstieg in den konkreten Themenbereich des Forschungsgebietes lieferte die Frage nach der Art der Einbindung in politische Gremien, die sich mit gesundheitlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Hier sollte ermittelt werden, über welche Institutionen vordergründig berichtet und wie diese Arbeit wahrgenommen wird. Daher wurde die Frage bewusst offen formuliert. Bei der weiten Bandbreite an Gremien und den unterschiedlichen Arten der Einbindung ist für Außenstehende häufig nicht ersichtlich, wo welcher Patientenvertreter von welchem Zusammenschluss eingebunden ist. Bei Bedarf wurde diese Frage um Nachfragen, wie nach der Beteiligung in weiteren Gremien oder zu den Vor- und Nachteilen der Einbeziehung, ergänzt.
Es folgte die Frage nach der Vereinbarkeit der Arbeit auf politischer Ebene und den genuinen Aufgaben der Selbsthilfe: Welche Vor- und Nachteile bestehen an dieser Schnittstelle und begünstigen sich die beiden Aufgabenbereiche möglicherweise?
Ein weiterer Themenkomplex bezog sich auf die Qualifikation der Patientenvertreter. Es wurde erfragt, wie kompetent sie sich in der Ausübung der kollektiven Beteiligungsrechte fühlen und worin sich diese Kompetenz begründet.
Um Ideen und Ansätze für eine Weiterentwicklung der kollektiven Beteiligungsrechte zu eruieren und Handlungsoptionen für die zukünftige Beteiligung zu entwickeln, wurde die Frage nach einer möglichen Verbesserung der Einbindung an die Patientenvertreter gestellt.
Der letzte Themenbereich konzentrierte sich auf die konkrete Situation des einzelnen Patienten. Erfragt werden sollte, wie die Patientenvertreter die Auswirkungen ihres Engagements auf den individuellen Patienten beurteilen und erleben. Auf diese Weise sollten die Einschätzung des Erfolges der eigenen Arbeit sowie die Wahrnehmung des Engagements nach außen ermittelt werden.
Durch die teilstandardisierte Form der Befragung wird die spätere Vergleichbarkeit der Interviews gewährleistet. Die Teilstandardisierung bezieht sich auf eine einheitliche Einleitung des Interviews, die eine kurze Vorstellung der Interviewerin und der geplanten Studie beinhaltete. Zu den weiteren Instruktionen im Vorfeld des Interviews gehörten die Kommunikationsregeln, die Erläuterungen zum Datenschutz sowie die dazugehörige Einholung des Einverständnisses für die Tonbandaufnahme.
Der Tonbandaufnahme stimmten bis auf einen Interviewpartner alle befragten Personen zu. In diesem Fall wurde das Interview dennoch durchgeführt. Die Ergebnisse werden aufgrund der nicht vorliegenden Transkription gesondert ausgewiesen. Weiterhin wurden die Interviewpartner vorab darüber informiert, was im Anschluss mit den gewonnen Informationen passiert und nach welchen Aspekten sie ausgewertet werden. Es wurde über den Ablauf des Interviews und die Methodik der Befragung unterrichtet, so dass die Interviewten sich darauf einstellen konnten, dass es sich um sechs Themenbereiche handelt, die nach Möglichkeit frei beantwortet werden sollen und nur bei Bedarf um Nachfragen ergänzt werden können. Die Einleitung diente dazu, eine angenehme Gesprächsatmosphäre aufzubauen und mögliche Fragen im Vorfeld zu klären, so dass das Interview ungestört durchgeführt werden konnte (Schmacke u. a. 2009: 18-20).
Die Interviews wurden im Zeitraum vom 01. bis 28. April 2011 durchgeführt und fanden wochentags entweder am Vor- oder am Nachmittag statt. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und ohne eine Vergütung. Aufgrund großer regionaler Unterschiede der Interviewpartner, die bereits vorab vermutet werden konnten, wurde die Variante des Telefoninterviews gewählt. Unter Berücksichtigung der damit entstehenden Nachteile, wie nicht vorhandener direkter Interaktion zwischen Interviewer und Interviewtem und der fehlenden Möglichkeit der Beobachtung von äußeren Gegebenheiten und Körpersprache, seien jedoch auch die Vorteile, die diese Variante mit sich bringt, zu erwähnen. Die Praktikabilität lässt unkomplizierte Terminabsprachen zu, welche sich positiv auf den zeitlichen Aufwand auswirken und zusätzlich ist die Variante des Telefoninterviews die kostengünstigere (Gläser/Laudel 2010: 153-154).
„Wie die Fragebögen der quantitativen Befragungen ist [...] auch der Interviewleitfaden zunächst ein Instrument, das teilweise auf noch ungeprüften Annahmen über das Untersuchungsfeld basiert. Es kann sein, dass die entworfenen Fragen nicht das bewirken, was sie bewirken sollen. Deshalb sollte man den Leitfaden vor der eigentlichen Untersuchung testen, indem man ein oder mehrere Probeinterviews mit Menschen führt, die den späteren Interviewpartnern vergleichbar sind“ (Gläser/Laudel 2010: 150). Dank der hohen Anzahl von Interviewpartnern konnte vorab ein Probeinterview realisiert werden. Dies war sehr hilfreich bezüglich der Sicherheit bei der Interviewdurchführung. Es stellte sich heraus, dass zwei der weiteren Fragen im Endeffekt nicht im näheren Zusammenhang mit dem jeweiligen Themenbereich standen und daher gelöscht werden konnten. Um auf mögliche Nachfragen besser vorbereitet zu sein, wurden alternative Beschreibungen der Themenbereiche formuliert und konkrete Beispiele zu bestimmten Aspekten vorbereitet.
Den Abschluss jedes Interviews bildeten der Dank für die Teilnahme und das Angebot, die fertig erstellte Magisterarbeit auf elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurde darauf verwiesen, dass die bereits im Vorfeld ausgetauschten Kontaktdaten der Interviewerin für weitere Nachfragen und Anmerkungen genutzt werden können.
3.2.2 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode
Die qualitative Inhaltsanalyse ist die gewählte Auswertungsmethode der Leitfadeninterviews. Sie gilt als bewährt für die Analyse von qualitativen Interviews und „will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategorien bearbeitet“ (Mayring 2002: 114). Das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell von Mayring dient einem systematischen Vorgehen, welches eine nachvollziehbare und transparente Analyse gewährleistet. Das Ablaufmodell beinhaltet die in Abbildung 7 dargestellten aufeinander folgenden Stufen, deren einzelne Schritte folgend beschrieben werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Quelle: Mayring 2007: 54)
Die Festlegung des Materials meint in der vorliegenden Arbeit die durchgeführten Interviews. Das Material wurde dahingehend reduziert, dass Aussagen, die nicht mit den Forschungsfragen in Zusammenhang stehen, nicht näher untersucht wurden.
Zur Analyse der Entstehungssituation wird festgehalten, dass die Interviews, denen freiwillig zugestimmt wurde, per Telefon von der Autorin geführt worden sind und daher keine näheren Angaben zur Umgebung gemacht werden können. Die teilstandardisierten, offen gehaltenen Interviews verliefen alle ohne Störung und die Interviewpartner befanden sich entweder in ihrem Büro oder Zu Hause.
Der qualitativen Inhaltsanalyse und genauer gesagt der formalen Charakteristika des Materials zugrunde liegt die sorgfältige und vollständige Transkription des erhobenen Materials, womit die Übertragung der gesprochenen Interviewinhalte in ein schriftliches Dokument gemeint ist (Mayring 2002: 89). Mit Hilfe des kostenlosen Computerprogramms „F4“ wurden die als MP3-Dateien vorliegenden Interviews verschriftlicht. Es bestehen keine einheitlichen Regeln für das Vorgehen (Gläser/Laudel 2010: 193-194), daher gelten folgende Grundsätze für diese Untersuchung: Unterbrechungen im Gespräch werden durch Punkte gekennzeichnet, nichtverbale Äußerungen wie Lachen oder Räuspern werden in Klammern gesetzt und auf betonte Worte wird durch Unterstreichung verwiesen. Den Interviewpartnern wird das Kürzel B für Befragter und eine fortlaufende Nummer zugewiesen. Bei der zweiten Überarbeitung der Transkriptionen werden im Nachhinein Inhalte, die den Sachverhalt nicht ändern, wie „äh“ oder „ne“, gestrichen (Mayring 2002: 91). Zusätzlich soll diese zweite Überprüfung die Transkriptionen auf den richtigen Wortlaut überprüfen und alle Informationen, die mit der spezifischen Erkrankung oder dem Selbsthilfezusammenschluss in Verbindung stehen, anonymisieren. Die Transkription nimmt viel Zeit in Anspruch. Man geht von einer Transkriptionszeit von 1:6 aus und daher wird darauf hingewiesen, dass dies von Anfang an in einem genauen Zeitplan bedacht werden sollte oder dementsprechend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen (Gläser/Laudel 2010: 193).
Die Richtung der Analyse ist auf die Möglichkeiten der Beteiligung an gesundheitspolitischen Prozessen und den damit verbundenen Herausforderungen für die Selbsthilfe ausgelegt. Die Texte sollen Auskunft über die damit verbundenen Fragestellungen geben.
Unter der theoretischen Differenzierung der Fragestellung versteht Mayring, dass „die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein muss, theoretisch an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in aller Regel in Unterfragestellungen differenziert werden muss“ (2007: 52). Die Fragestellungen der Untersuchung wurden bereits in Kapitel 3.1 genannt. Ein Überblick der bisher veröffentlichten Studien, an denen angeknüpft werden soll, war Bestandteil der theoretischen Grundlagen.
Die Bestimmung der Analysetechnik bedeutet, sich für eine der drei Formen des Interpretierens zu entscheiden. Zur Wahl stehen die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Da die vorliegende Untersuchung die deduktive Kategorieentwicklung anwendet und damit das Ziel verfolgt, die Textinhalte den anhand der Fragestellungen vorab festgelegten Kategorien zuzuordnen, wurde die strukturierte Analysetechnik, genauer gesagt die inhaltliche Strukturierung gewählt. Deren Sinn ist es, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitet entwickelte Kategorien [...] bezeichnet. Nach der Bearbeitung des Textes mittels des Kategoriensystems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material [...] pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring 2007: 89).
Für die Definition der Analyseeinheit wird das Material in Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheiten aufgeteilt. Die Kodiereinheit meint den kleinsten Textbestandteil, der einer Kategorie zugeordnet werden kann. Darauf folgen die Kontexteinheit, welche den größten Textbestandteil festlegt und die Auswertungseinheit, die bestimmt, welche Textstücke nacheinander ausgewertet werden (Mayring 2007: 53). Zu einer Kodiereinheit gehört demnach ein Satz, der einer Kategorie zugeordnet werden kann und die Kontexteinheit meint alle Fundstellen innerhalb eines Interviews.
Die Abbildung 8 zeigt die Analyse des Materials anhand des Ablaufmodells der strukturierenden Inhaltsanalyse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Quelle: Mayring 2007: 84)
Bei den verschiedenen Formen der strukturierenden Inhaltsanalyse, der neben der inhaltlichen auch die formale, die typisierende sowie die skalierende Strukturierung angehören, unterscheiden sich der zweite und der achte Schritt. Bei der inhaltlichen Strukturierung steht an zweiter Stelle die Festlegung der Kategorien, die sich aus der Theorie und den Fragestellungen der vorliegenden Arbeit ableiten. Sie lauten:
K1: Form der Einbindung
K2: Vereinbarkeit genuiner Aufgaben und politischer Beteiligung
K3: Qualifikation
K4: Weiterentwicklungsoptionen
K5: Auswirkungen für den individuellen Patienten
Es folgte die Bearbeitung des Materials und die Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien (Mayring 2007: 82-89). An dieser Stelle fanden die Regeln der Zusammenfassung Anwendung. Das manuell mittels einer Word-Datei in Tabellenform durchgeführte Vorgehen beinhaltete drei Schritte. An erster Stelle stand die Paraphrasierung, bei der Textbestandteile gestrichen wurden, die keine weitere Bedeutung für den Erkenntnisgewinn hatten. Zusätzlich wurden ausschmückende Redewendungen gestrichen und Aussagen verkürzt. Darauf folgte mit dem zweiten Schritt die Generalisierung. Diese verallgemeinerte die Paraphrasen auf ein Abstraktionsniveau, welches wiederum die Grundlage für die Reduktion, die Zuordnung zu den Kategorien, bildete (Mayring 2007: 61).
In einer ersten Tabelle wurden die fünf Interviews mit Patientenvertretern aus dem Bereich der seltenen Erkrankungen ausgewertet und den fünf Kategorien zugeordnet. Es folgte der Durchlauf der Zusammenfassung für die weiteren fünf Interviews aus dem Bereich der Erkrankungen mit hoher Prävalenz. Anhand dieser Tabellen erfolgt die Auswertung der Interviews.
Die vollständige Durchführung der Analyse erfolgt immer unter Beachtung der Rückprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material und unterstreicht somit den zirkulären Vorgang der qualitativen Forschung (Mayring 2007: 83-89).
Die Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung erfolgt getrennt von der nicht bewerteten Darstellung der Ergebnisse im fünften Kapitel.
Der gesamte Vorgang der qualitativen Inhaltsanalyse findet unter Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien statt.
4. Darstellung der Ergebnisse
Dieses Kapitel beinhaltet die Darstellung der gewonnen Ergebnisse anhand der vorab aufgestellten Kategorien. Die gewonnen Informationen werden nach Indikationsgruppen getrennt voneinander vorgestellt und in der unter Punkt fünf folgenden Diskussion verglichen.
Nach Abschluss der Ergebnis-Darstellung der qualitativen Interviews werden die erhobenen Aussagen aus weiteren Rückmeldungen auf die Interviewanfrage dargestellt.
Durch aussagekräftige Zitate[24] wird an gegebener Stelle der Bezug zu den ursprünglichen Interviews veranschaulicht und die Bedeutung der Aussagen untermauert.
4.1 Auswertung der Experteninterviews
An erster Stelle sollen die demographischen Daten, die zu Beginn jedes Interviews erhoben wurden, dargestellt werden. An der Untersuchung nahmen insgesamt fünf Frauen und fünf Männer teil, was einer ausgewogenen Verteilung der Geschlechter entspricht. Deren Aufteilung in die zwei übergeordneten Indikationsbereiche verhält sich wiederum folgendermaßen: Drei weibliche und zwei männliche Interviewpartner aus dem Gebiet der Interessenvertretung von seltenen Erkrankungen und zwei weibliche und drei männliche Interviewpartner aus dem Gebiet der Erkrankungen mit hoher Prävalenz.
Das Geburtsjahr der Interviewpartner streckt sich von 1938 bis 1978. Vier der Befragten gaben an, sich bereits im Ruhestand zu befinden.
Die Tätigkeit in der Selbsthilfe wird von sieben der Befragten ehrenamtlich ausgeführt. Zwei Interviewpartner befinden sich in einem Angestelltenverhältnis und bei einer Person besteht neben der Funktion als Angestellter ein Ehrenamt. Die Interviewpartner erfüllen alle Leitungspositionen wie Vorsitzender oder Geschäftsführer und gehören teilweise zu den Gründungsmitgliedern des jeweiligen Zusammenschlusses. Trotz ihrer Leitungsfunktion geben ausnahmslos alle Interviewpartner an, weiterhin Beratungsarbeit auszuführen. In einigen Fällen wird sie in Vertretungsfällen übernommen, in anderen Fällen gehört sie zu den festen regelmäßigen Aufgaben.
Die folgende Auflistung[25] soll eine Auswahl der weiteren genannten Tätigkeiten, welche in die Aufgabenbereiche der Patientenvertreter fallen, aufzeigen:
- Kontakt zu Medizinern
- Organisation von Veranstaltungen
- Betreuung der Mitgliederzeitschrift
- Pflege der Homepage
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Lobbying
- Einwerbung von finanziellen Mitteln
Als Motivation zur Beteiligung in der Selbsthilfe nennen alle Interviewpartner die eigene Betroffenheit als Erkrankter oder als Angehöriger eines Erkrankten.
4.1.1 Form der Einbindung
An erster Stelle war von Interesse, in welcher Form die Patientenvertreter auf politischer Ebene einbezogen sind, in welchen konkreten Gremien eine Beteiligung vorzuweisen ist und wie die Ausgestaltung dieser Beteiligung wahrgenommen wird.
„Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass wir versuchen, auf allen Ebenen, eben nicht nur Bundesebene, sondern auch Land darunter und Ort darunter den jeweils wesentlichen politischen Ansprechpartner zu finden. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, das ist auch ein bisschen immer so ein eine Frage [...] der persönlichen Chemie.“ (B6: 78-82)
Dieses Zitat beschreibt das Vorhaben, sich umfassend im gesundheitspolitischen Bereich zu beteiligen. Auf allen Ebenen des Systems werden Kontakte geknüpft, um Anliegen zu kommunizieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Interessen durchzusetzen. Gleichzeitig beschreibt es die unterschiedlichen Erfolge dieser Absichten.
In den Interviews mit den Patientenvertretern aus dem Bereich der Erkrankungen mit hoher Prävalenz werden zahlreiche verschiedene Möglichkeiten und Ebenen genannt, über die eine Einbindung in politische Strukturen wahrgenommen wird. Es bestehen Einzelnennungen zu der Beteiligung an runden Tischen, die sich mit politischen Themen befassen, der Einbindung in Zusammenschlüsse von medizinischen Fachkreisen, die ihre Themen an Gremien der Gesundheitspolitik weitergeben oder dem Erarbeiten von Stellungnahmen. Für die Interviewpartner zählt auch die Mitgliedschaft in der BAG Selbsthilfe, dem Paritätischen oder dem Kindernetzwerk als Dachorganisationen zur Beteiligung in gesundheitspolitischen Institutionen. Nach Aussage eines Interviewpartners ist es das Ziel, die Interessen zu bündeln, da als eigenständiger Zusammenschluss die Interessen nicht in umfassender Form umgesetzt werden können.
Durch die Interviewpartner werden die Möglichkeiten der Beteiligung in die fachliche Zusammenarbeit und in die rein politische Entscheidungsfindung unterschieden. Während erst genannte nach Angaben der Patientenvertreter gut funktioniert und produktiv abläuft, wird die politische Entscheidungsfindung durch interessengelenkte Diskussionen erschwert.
Die Beteiligung im G-BA steht in den Interviews im Vordergrund. Das IQWiG oder das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA-Institut) werden nur vereinzelt genannt, so dass keine näheren Angaben für einen Vergleich dazu gemacht werden können. Zum AQUA-Institut lässt sich jedoch sagen, dass dieses zu der fachlichen Arbeit gezählt und die Beteiligung demnach als gut eingestuft wird.
Auch wenn einzelne Interviewpartner die Arbeit im G-BA als passiv und mit geringer Einflussaufnahme auf die Entscheidungen verbinden, wird sie grundsätzlich begrüßt und als positiv bewertet.
„Also die Einbindung im G-BA erleb ich so, dass sie [….] relativ passiv ist. […] Wenn man allerdings dann etwas vortragen möchte, was in seinem Bereich relevant ist, dann hab ich schon das Gefühl, dass wirklich alle Vertreter des G-BA einem zuhören und das was man sagt auch ernst nimmt und nicht denkt, […] die Patienten können sowieso sagen, was sie wollen.“ (B8: 100-110)
Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und Kostenträgern wird als Gewöhnungsprozess beschrieben, der sich im Laufe der letzten Jahre in kleinen Schritten verbessert hat.
„Also die vielen Akteure, die sich ja auch immer wieder bei diesen ganzen, sag ich mal, Treffen und Beiräten und so weiter, da treffen, die kennen sich dann auch im Laufe der Jahre und man weiß natürlich auch bestimmte Grundpositionen. […] Und ich glaube, man setzt sich auseinander, man anerkennt die andere Perspektive aber trotzdem ist es auch ein sehr konstruktives Miteinander. Also ich habe, jetzt muss ich sagen, selten so Frusterlebnisse gehabt, wo ich gedacht habe, na das funktioniert jetzt nun gar nicht oder ich bin hier nun von schlechten Menschen umgeben. Also eigentlich fühle, ich fühle mich eigentlich auch ernst genommen.“ (B10: 196-205)
Es wird aber deutlich gemacht, dass die verschiedenen Akteure sich nicht auf Augenhöhe befinden und speziell die finanziellen sowie personellen Ressourcen dabei eine Rolle spielen. Während die Vertreter der Leistungserbringer und Kostenträger über Mitarbeiter verfügen, die ihnen zuarbeiten, müssen Patientenvertreter sich selbst in die jeweilige Thematik einarbeiten.
Es werden verschiedene Anforderungen benannt, die an die Beteiligung in gesundheitspolitischen Gremien und den direkten Kontakt zu Politikern, Leistungserbringern oder Kostenträgern geknüpft sind:
- gute Vorbereitung
- Kompetenz
- Geduld
- Vertrauen
- Kompromissbereitschaft
- Verfolgung realistischer Ziele
- Fähigkeit, Rückschläge verkraften zu können
- aktive Mitarbeit
- Aufklärung der eigenen Mitglieder über die Arbeit auf politischer Ebene
„Das ist auch ´ne Sache des gegenseitigen Vertrauens […], wenn dann auch die andere Seite merkt, dass man […] sie respektiert und dass es uns um die Sache geht, was wir erreichen wollen und auch nicht unangemessene Forderungen stellt, geht es eigentlich ganz gut, also dann laufen wir relativ offene Türen ein. Aber wie gesagt, das sind immer so kleinere Schritte.“ (B7: 154-158)
In der Gruppe der seltenen Erkrankungen geben alle Befragten an, im G-BA als Patientenvertreter aktiv zu sein. Weitere Gremien werden auch auf Nachfrage hin nicht genannt. Die Einbindung in Dachorganisationen wird im weiteren Sinne als politische Beteiligung erwähnt. Neben der BAG Selbsthilfe wird hier auf die Mitgliedschaft in der ACHSE verwiesen. Als weitere Möglichkeit der Interessenvertretung auf politischer Ebene wird die Funktion eines Bundestagsabgeordneten als Schirmherren genannt. Dieser kann kurze Wege innerhalb der Politik nutzen und der zugehörige Patientenvertreter bewertet im Interview dieses Vorgehen als den besten Einfluss über den der Zusammenschluss für die Interessenvertretung verfügt.
Die Strukturen und Arbeitsweisen im G-BA werden als intransparent und somit als schwer durchschaubar beschrieben.
„Ich erleb´ das manchmal […] ein Stück weit als eigene Welt, die da so vor sich hinarbeitet.“ (B1: 97-98)
Über die Anfänge der Arbeit im G-BA äußert sich ein anderer Patientenvertreter in zwei Aussagen folgendermaßen:
„ Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukam. Wenn ich das gewusst hätte, hätt´ ich´s wahrscheinlich auch abgeblockt (lachen). Also erste Meinung, so nach der ersten und zweiten Sitzung. Heute seh ich das anders. “ (B2: 81-83)
„Also wir sind ins kalte Wasser geworfen worden. Alle Patientenvertreter, die dort anwesend waren, und keiner wusste so richtig, was auf einen zukommt. Und wir waren teilweise auch so was von geschockt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, geschockt, was da abgeht.“ (B2: 139-142)
Die Zusammenarbeit der Akteure untereinander wird unterschiedlich wahrgenommen. Während ein Interviewpartner sich akzeptiert und ernst genommen fühlt, überwiegt bei den weiteren Befragten das Gefühl, unterlegen zu sein.
„Es ist also manchmal sehr schwierig bei den Entscheidungsträgern, da auf ja Akzeptanz zu stoßen. […] Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Selbsthilfe zähneknirschend oftmals da geduldet ist aber eigentlich ist mein persönlicher Eindruck, wär man vielleicht hier und da lieber unter sich.“ (B4: 92-95)
Der Kontakt der Patientenvertreter seltener Erkrankungen zu den Leistungserbringern und Kostenträgern wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die Erkrankung häufig nicht bekannt ist und die Selbsthilfe sich an erster Stelle erklären muss.
„Und das ist die Problematik bei uns (Erkrankung), dass man die einfach auch in den Gremien einfach immer noch ewig, ewig erläutern muss und mit Beispielen belegen muss.“ (B5: 104-106)
4.1.2 Vereinbarkeit politischer Beteiligung und genuiner Aufgaben
Die Vereinbarkeit der politischen Beteiligung und der grundlegenden Aufgaben der Patientenvertreter, welche anfangs durch die „Eisbrecher-Frage“ aufgezählt wurden, ist der Aspekt, der unter der zweiten Kategorie zusammengefasst wird. Die Frage soll deutlich machen, wo und in welcher Form die Patientenvertreter eine mögliche Belastung durch die politische Beteiligung erfahren oder ob beide Aufgabengebiete sich auch sinnvoll ergänzen können.
Die Vertreter der Erkrankungen mit hoher Prävalenz sind sich geschlossen einig, dass die politische Beteiligung viel Zeit in Anspruch nimmt, welche für andere Aufgaben fehlt. Die steigenden Anforderungen können bedingt durch die knappen Ressourcen zu einer Überforderung der Selbsthilfe führen.
„Das ist sicherlich ein großes Problem für alle im Moment, dass […] die Anforderungen an die Selbsthilfe in jeder Hinsicht größer, größer, größer werden. [...] Und die Menschen trotzdem versuchen ehrenamtlich das auf die Beine zu stellen und damit eventuell riskieren, dass sie schlechte Arbeit machen.“ (B6: 266-270)
„Das ist viel mehr Zeitdruck, viel mehr Termine, viel mehr weg sein. Dass wir irgendwie zwischen Tür und Angel Sachen machen müssen. Im Zug sich vorbereiten oft, weil man´s vorher gar nicht dazu kommt alles zu lesen.“ (B7: 233-236)
Wie in einem Interview betont, kann dies so weit führen, dass Aufgabenbereiche im politischen Kontext, die neu hinzukommen wie im konkreten Beispiel die Nutzenbewertung von Arzneimitteln durch das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG), von vornherein ausgeschlossen werden, da die Mitarbeit auf diesem Gebiet nicht zu leisten wäre.
Bei mehreren Zusammenschlüssen kommt erschwerend hinzu, dass die eigenen Mitglieder den hohen Stellenwert der politischen Arbeit, den alle Interviewpartner betonen, nicht erkennen.
„Man muss auch über den Vorstand hinaus den Mitgliedern erst mal vermitteln, […] was man da macht und warum diese Arbeit so wichtig ist. Weil viele Mitglieder, die sagen, ja lasst die doch reden, mir ist es wichtig, dass meine regelmäßigen Treffen bei mir vor Ort stattfinden. Mir ist wichtig, dass ich meine Zeitung bekomme und was ihr dann in Berlin oder sonst wo diskutieren wollt, das interessiert mich nicht so wirklich. Also da muss man auch wirklich Überzeugungsarbeit bei den eigenen Mitgliedern leisten.“ (B8: 162-168)
Zu den positiven Aspekten zählen die Auswirkungen, welche die politische Beteiligung mit sich bringt. Die Bereiche können sich sinnvoll ergänzen, wenn die Arbeit auf politischer Ebene dazu beiträgt, dass die Patientenvertreter bereits früh über Informationen verfügen, die sie in der Ausübung ihrer Basisarbeit unterstützen. Sie können ihre Mitglieder frühzeitig informieren und eigene Interessen in den politischen Gremien einbringen. Zusätzlich erhält die Selbsthilfe einen Gewinn an Aufmerksamkeit und Bekanntheit.
„Selbst wie zum Beispiel im Gemeinsamen Bundesausschuss, wo ja nur die beratende Funktion da ist, denk ich, hat das schon gewissen Einfluss, wenn man da mitreden kann, weil [...] man kann die Menschen doch wieder mehr auf den Sachverhalt zurückführen. Da geht es nicht nur um Geld oder Fälle, sag ich mal so, sondern man kann doch deutlich machen, dass es auch um Menschen geht. Das sehe ich als Vorteil an.“ (B10: 230-235)
Auf Seiten der Patientenvertreter seltener Erkrankungen besteht Einigkeit darüber, dass die politische Beteiligung viel Zeit in Anspruch nimmt. Weiterhin wird angemerkt, dass politische Prozesse langwierig und häufig nicht nachvollziehbar sowie die Inhalte der politischen Arbeit schwer an die Mitglieder zu vermitteln sind.
Die politische Beteiligung kann die Basisarbeit auch begünstigen wie folgende Beispiele zeigen:
„Aber die Tatsache, dass ich die Aktion Berlin in Angriff genommen habe, gibt einen Schub wieder. Wir sind dabei, wir werden angefordert, wir sind mitten drin in der Arbeit und es tut sich endlich was. Und das gibt einfach so´n Motivationsschub.“ (B2: 228-230)
„ Vor-, nur Vorteile. Nachteile kann es gar nicht geben, weil die Politiker, [...] die die Gesundheitspolitik macht, kann die Seltenen nicht kennen. Und da müssen die Patientengremien einbezogen werden.“ (B2: 195-197)
Mehrere Vertreter der seltenen Indikationen betonen, dass die politische Arbeit mit der Hoffnung verbunden ist, dass die öffentliche Wahrnehmung der seltenen Erkrankungen gestärkt und der Bekanntheitsgrad erhöht wird. So nimmt der Stellenwert der politischen Beteiligung für alle Interviewpartner eine hohe Position ein.
4.1.3 Qualifikation
Die Qualifikation ist besonders wichtig für die Wahrnehmung der Beteiligungsmöglichkeiten, denn die fachliche Kompetenz der Patientenvertreter steht in engem Zusammenhang mit der Akzeptanz durch die weiteren Akteure des Gesundheitswesens. Die Interviewpartner der Erkrankungen mit hoher Prävalenz schätzen ihre eigene Qualifikation bis auf eine Ausnahme als gut ein. Die Ausnahme bildet der jüngste Teilnehmer der Untersuchung.
„Also die Qualifikation würd ich sagen, hab ich nicht. [...] als ich im Januar das erste Mal da war, mir das angehört hab, hat ich mich zwar eingelesen, das was gemacht wird, aber wirklich viel verstanden hab ich beim ersten Mal nicht.“ (B8: 222-224)
Die Basis für die eigene Qualifikation sehen die meisten Befragten in ihrem Beruf und in ihrer langjährigen Erfahrung in der Selbsthilfe, sowohl in der Basisarbeit als auch auf politischer Ebene. Speziell die erste Zeit der politischen Beteiligung mit der Phase der Einarbeitung wird als schwierig beschrieben.
„Ich mach´ das jetzt mittlerweile sechs Jahre, ich würde aber sagen, mindestens zwei Jahre war ich Lehrling.“ (B9: 233-234)
Unterstützung für die politische Arbeit finden die Patientenvertreter überwiegend bei der BAG Selbsthilfe, der Stabstelle Patientenbeteiligung des G-BA oder über Fortbildungen, die der G-BA oder auch das IQWiG organisieren. Weiterhin werden vereinzelt der DBR, der Paritätische, das Kindernetzwerk oder Ärzte, zu denen ein enger Kontakt besteht, genannt. Bei der Frage nach der Unterstützung ergab sich in einem Interview die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, von den Gremien fortgebildet zu werden, in denen man letztendlich Entscheidungen beeinflussen will.
Themenbereiche, für die sich mehr Qualifikation gewünscht wird, sind beispielsweise juristische Kenntnisse, der Bereich der ökonomischen Studien oder auch der Qualität im Gesundheitswesen. Die Problematik hierbei bezieht sich auf die an anderer Stelle bereits erwähnten knappen Ressourcen, die dazu führen, dass zwar grundsätzlich Interesse an der Weiterbildung besteht, dass aber der damit verbundene zeitliche Aufwand nicht erbracht werden kann.
Anknüpfend an den Aspekt einer Professionalisierung der Selbsthilfe wird auch unter der Kategorie „Qualifikation“ auf diesen Bereich eingegangen.
„Das ist eine gewisse Gratwanderung. Einerseits noch authentisch zu sein als Betroffener und auf der anderen Seite erfordert dieses ganze Mitwirken auch ´ne hohe Kompetenz.“ (B10: 181-183)
An die eigene Qualifikation werden demnach eine Menge Anforderungen gestellt. Neben der Glaubwürdigkeit bedarf es eines Verstehens politischer Strukturen, einer Menge Erfahrung und guter Kommunikationsfähigkeit, um die Anliegen der Selbsthilfe präzise auf den Punkt bringen zu können.
Unter den Vertretern der seltenen Erkrankungen fühlen sich alle Interviewpartner entsprechend qualifiziert, um ihr Amt zu erfüllen. Die Aussagen reichen von „ausreichend“ (B1: 132) bis „sehr gut“ (B3: 183). In zwei Interviews wird besonders die Qualifikation im Bereich des medizinischen Wissens zum Erkrankungsbild hervorgehoben, welche dazu befähigt, die Seite der Leistungserbringer zur spezifischen Indikation aufzuklären.
„Denke ich, ist gerade bei mir schon ein größeres Wissen da und ja, da kann ich schon meine Kompetenzen dann einbringen und [...] konnte auch hier und da schon mal was auch im medizinischen Bereich Medizinern gegenüber, die keine wenig Kenntnis über die (Erkrankung) haben, da konnte ich schon hier und da dann auch mal ´ne Meinung richtig stellen.“ (B4: 189-193)
Die Qualifikation wird hauptsächlich auf den beruflichen Lebenslauf und die Erfahrung in der Selbsthilfe zurückgeführt. Die erste Zeit auf politischer Ebene und speziell im G-BA wurde als schwierig wahrgenommen.
„Ich hab´ mich im Internet schlau gemacht, was ist der G-BA? Ich hatte ´n Lebtag noch nichts davon gehört.“ (B2: 318-319)
In mehreren Interviews wird geäußert, dass Interesse an mehr Wissen besteht aber dieses konträr zu der hohen Belastung steht. Es ist aufwendig, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten.
Bei der Unterstützung durch die Dachorganisationen der Selbsthilfe oder auch die Stabstelle Patientenbeteiligung ergaben sich bei der Auswertung unterschiedliche Ergebnisse. Während jedoch bezüglich der Stabstelle Patientenbeteiligung von mehreren Interviewpartnern geäußert wird, dass man sich einen Ausbau des Kontaktes und der Unterstützung wünscht und nur ein Patientenvertreter auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stabstelle zurück blicken kann, verhält es sich bei den Dachorganisationen andersherum. Speziell die Unterstützung durch die ACHSE wird von den meisten Interviewpartnern als wertvoll bewertet und nur durch einen Patientenvertreter bemängelt. Der Beistand durch die BAG Selbsthilfe, das Kindernetzwerk oder den eigenen medizinischen Beirat wird in wenigen Fällen ergänzend genannt.
„Da vertrauen wir voll auf die ACHSE, die ihre Juristen da sitzen haben, die ihre Mediziner sitzen haben und die, denke ich einfach, schöpfen das was geht aus und noch darüber hinaus. Also, die sind sehr fordernd ist der falsche Ausdruck, aber sehr innovativ und auf allen Bereichen. [...] Also ich denke, dass wir uns im Verband, in unserem kleinen Verband, mittlerweile darauf verlassen können, dass die alles tun, was für uns wichtig ist.“ (B2: 375-381)
4.1.4 Optionen zur Verbesserung
Jeder Interviewpartner der Gruppe „Erkrankungen mit hoher Prävalenz“ äußerte sich mit eigenen Ideen zu einer möglichen Verbesserung der bisherigen Organisation der kollektiven Beteiligung der Selbsthilfe auf politischer Ebene. Genannt wurde die Entwicklung eines Leitfadens, der eindeutig benennt, wie die Arbeitsweisen des G-BA aussehen, wie die Beteiligung im G-BA erfolgt und mit welchen Anforderungen diese verbunden ist. So würden Selbsthilfezusammenschlüsse über eine Grundlage verfügen, um zu entscheiden, ob sie diese Anforderungen erfüllen können. Weiterhin wurde angeregt, eine Stelle zu schaffen, die gesundheitspolitische Themen sammelt und aufbereitet, so dass die Selbsthilfe diese Informationen bei Bedarf abrufen kann. Solche Formen der Vorbereitung von Patientenvertretern werden beispielsweise den ständigen Patientenvertretern, den Dachorganisationen oder direkt dem G-BA zugeordnet. Weiterhin bedarf es eines Abbaus von Hemmungen der Selbsthilfevertreter gegenüber der Politik.
„Viele Menschen, die sehr sinnvoll in der Selbsthilfe sind und sehr gut arbeiten in der Selbsthilfe, haben sofort Angst und Scheuklappen, wenn es darum geht, in irgendwelche politischen Institutionen zu gehen, dort vielleicht irgendwie […] mitzuarbeiten oder oder. Weil es sofort heißt, das ist Politik, das ist eine Stufe drüber und die nehmen mich nicht ernst. Es müsste also von Seiten der Politik versucht werden, klar zu machen ja so ungefähr, wir sind das Volk, ihr seid das Volk. Das ist dasselbe. Das hielte ich für sehr viel besser, dann könnte die Arbeit in den politischen Institutionen vereinfacht werden in jeder Hinsicht. Und ansonsten halte ich es für durchaus überlegenswert eben zu gucken, wie ist eine finanzielle Regelung insofern möglich, dass es eine gewisse Art von Gleichstellung gibt.“ (B6: 301-310)
Ein Interviewpartner geht speziell auf die Möglichkeit einer Professionalisierung der Selbsthilfe ein.
„Das Spezielle wirklich auch der Selbsthilfe befürchte ich, geht verloren, wenn diejenigen, die die Vertretung machen, praktisch nur noch Profis sind und nicht mehr aus ihrer Alltagstätigkeit heraus das machen. Also [...] dass sie erst mal selber gar nicht mehr betroffen sind.“ (B7: 219-222)
Der Diskussion um ein Stimmrecht für Patientenvertreter stehen die Interviewpartner aus dem Bereich der häufigen Erkrankungen insgesamt positiv gegenüber. Man ist sich einig, dass ein Stimmrecht sinnvoll und notwendig ist. Es werden jedoch Einschränkungen in Bezug auf die fehlenden Rahmenbedingungen gemacht, welche für die Ausübung solch eines Rechtes durch die Selbsthilfe gegeben sein müssten. Als zusätzliche Problematik wird auf die mangelnde Geschlossenheit innerhalb der Selbsthilfe hingewiesen, welche die Handhabung eines Stimmrechtes erschweren würde.
„Generell kann ich das schlecht sagen, denn es ist folgendes, da wir ja natürlich im demokratischen System über Mehrheiten beschließen, bedeutet das natürlich auch immer, dass man Halbdinge mit beschließen muss, von denen man selber vielleicht gar nicht so überzeugt ist, aber vielleicht denkt, im Prinzip wär´s doch sinnvoll. Es ist sehr schwierig. Selbsthilfe ist eigentlich sehr individuell aufgestellt und jede Gruppe kämpft für ihre eigenen Betroffenen.“ (B6: 116-121)
Es steht die Frage im Raum, ob ausschließlich die ständigen Patientenvertreter oder auch die indikationsspezifischen ein Stimmrecht ausüben sollten. Beide Meinungen werden in der Gruppe der Erkrankungen mit hoher Prävalenz vertreten. Das Recht für beide Typen der Patientenvertreter zeigt sich anschaulich in folgendem Zitat:
„Es sollte [...] keine Patientenvertreter erster und zweiter Klasse geben.“ (B9: 472)
Auf Seiten der seltenen Erkrankungen richten sich die Aufgaben für die Zukunft auch an die Selbsthilfe selbst. Man muss einen Beitrag zur Definition der eigenen Rolle im Gesundheitswesen leisten und die Geschlossenheit untereinander fördern. Es wird aber auch mehr Unterstützung durch die Dachorganisationen und für die Arbeit im G-BA speziell durch die ständigen Patientenvertreter eingefordert.
„Also die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Da gibt es auch verschiedene Seminare, aber vielleicht könnte man das noch erweitern. Grundsätzlich so´n Tagesseminar, wie geht man mit der Politik um. [...] Das steht zwar immer irgendwo in irgendwelchen Formblättern und Zuschriften. Aber mal etwas komprimiert dargestellt, was hat man erreicht, wo will man hin, wie kommt man da hin und wie kann man die Einzelnen schulen, dass man das in geeigneter Form an geeigneter Stelle einbringt. Das fehlt mir noch so´n bisschen. Also so´n Art Koordinator dafür. Die BAG hat zwar Geschäftsführer, der sich darum kümmert aber der ist kaum erreichbar. Im Prinzip dann ist ´n Vorstand, die sieht man [...] hauptsächlich [...] in der Zeitung abgebildet [...] beim Besuch vom Bundespräsidenten oder Bundeskanzlerin. Das ist schön gut aber ich meine so ´ne [...] politische Koordination. [...] Also so ein eine Person auf die man, die darauf fixiert ist, auf die man zugehen kann. [...] Also es ist jetzt keine Beschwerde, aber es ist viel-leicht einfach so mal darüber nachzudenken, wie man das verbessern kann in den Dachverbänden so. Einzelverbände ist schlecht, die kommen da oben nicht hin. […] Da wünsche ich mir so einen politischen Koordinator im Dachverband. Den finde ich derzeit auch nicht bei der ACHSE.“ (B3: 253-280)
Mit der Forderung nach mehr fachlicher Expertise zu seltenen Erkrankungen in den politischen Gremien des Gesundheitswesens wird beklagt, dass das spezifische Wissen an vielen Stellen fehlt.
Im Hinblick auf ein mögliches Stimmrecht vertritt im Kollektiv der seltenen Erkrankungen ein Patientenvertreter die eindeutige Meinung gegen ein Stimmrecht, während die weiteren Befragten sich dafür aussprechen.
„Also ich sehe also zum Beispiel gerade wenn man das neuen AMNOG-Gesetz sieht, da finde ich es absolut nicht angebracht, dass wir als Patientenvertreter, wenn es um Preisverhandlungen und solche Dinge geht, dass wir da ein Stimmrecht haben, weil ich wüsste nicht, wie ich ´ne Position einnehmen sollte, gegenüber ´ner Pharmaindustrie, die einen hohen Preis verlangt [...]. Ich wüsste nicht, wie ich da abstimmen sollte. Da wird man dann nur zum Büttel von gewissen Wirtschaftsinteressen [...] und da halte ich es für wichtiger, dass das neutrale Leute machen, die eben nicht direkt finanzielle Interessen eingebunden haben. Und das ist man als Selbsthilfevertreter nie. Man ist immer bei seinen Leuten natürlich und damit auch nie völlig ganz neutral.“ (B1: 207-216)
Mit dem Patientenrechtegesetz haben sich die meisten Patientenvertreter zum Zeitpunkt der Erhebung nicht näher befasst. Es lagen keine Kenntnisse zu näheren Inhalten des geplanten Gesetzes vor. Dies gilt sowohl für die Gruppe der Vertreter hoch prävalenter Erkrankungen als auch für die Patientenvertreter der seltenen Erkrankungen.
„Also davon gehört habe ich schon. Also dass es so ein Gesetz geben soll. Allerdings ist der Informationsfluss, was denn da jetzt drin steht, doch eher zäh und bei uns noch nicht so angekommen, so dass wir uns da auch noch keine Meinung zu gebildet haben.“ (B8: 317-319)
Keiner der Befragten aus beiden Gruppen streitet ab, dass es sich dabei theoretisch um ein wichtiges Vorhaben handelt. Jedoch besteht von vielen Seiten Skepsis gegenüber den Auswirkungen eines solchen Gesetzes. Die Reichweite wird als gering eingestuft und die Umsetzung als schwierig. Laut Aussage eines Interviewpartners muss bedacht werden, dass mit Rechten auch immer Pflichten verbunden sind und diese bedarf es zu definieren.
4.1.5 Auswirkungen für den individuellen Patienten
Die Auswirkungen auf die Situation des individuellen Patienten werden von den Vertretern der Erkrankungen mit hoher Prävalenz sehr unterschiedlich eingeschätzt. Von keinen über schwache bis hin zu positiven Auswirkungen ist die Rede. Hinzu kommt die Annahme, dass die politischen Entscheidungsprozesse so langwierig sind, dass der individuell Betroffene die konkreten Folgen im Nachhinein nicht mit der Beteiligung der Selbsthilfe in Verbindung bringt.
„Es bedeutet also im Endeffekt, dass die Selbsthilfe selber normal weiter lebt, also im Endeffekt ihre Gruppenarbeit macht, ihre Informationen macht und so weiter und so weiter. In der Zwischenzeit arbeitet dieser politische Prozess und irgendwann gibt es eine neue Regelung, die für die Patienten vielleicht positiv ist. Das wird dann einfach so genommen und die Arbeit, die dahinter steckt [...] wird aber selten so gesehen.“ (B6: 363-368)
Die Rolle der Selbsthilfe wird jedoch als wichtig im politischen Prozess eingeschätzt.
„Man merkt ja auch, dass der Wettbewerb strenger wird mit diesen ganzen Rabattverträgen und so weiter und da gilt es jetzt, so sag ich mal Schlimmeres zu verhindern und dafür, glaub ich, ist die Patienten- oder die Selbsthilfebeteiligung schon sehr wichtig. Also dem sich entgegen zu stellen und immer dran zu erinnern, dass es hier Individuen sind und keine Fälle oder Mengen.“ (B10: 526-530)
In den Interviews mit Patientenvertretern aus dem Bereich der seltenen Erkrankungen zeigt sich, dass knappe Finanzen als Grund für die geringen Auswirkungen betrachtet werden.
„Also es kommt beim Patienten an, aber noch zu wenig. Und ja, es hängt immer am Geld, das sich zu wenig tut. Es ist logisch, es kostet.“ (B2: 429-432)
Auch wenn die Situation der Patienten in Deutschland von einem Patientenvertreter als gut eingestuft wird, überwiegt in dieser Gruppe die Meinung, dass die Auswirkungen ihrer politischen Beteiligung noch schwach sind und beim Patienten erst spät ankommen.
„Direkt beim Betroffenen [...], habe ich den Eindruck, dass nicht viel ankommt. Ja, es wird sicherlich vieles […] wahrgenommen und es wird vieles, was die Patientenvertreter dann fordern, es wird zur Kenntnis genommen. Hier und da [...] werden dann auch Vorschläge übernommen, aber letztendlich, letztendlich den Betroffenen, da kommt meiner Meinung nach noch nicht so viel an.“ (B4: 296-300)
Ein wichtiger Aspekt für die Vertreter seltener Indikationen ist die Wahrnehmung innerhalb der Öffentlichkeit. Die Arbeit auf politischer Ebene kann dazu beitragen, dass die Erkrankung bekannter wird und daher nimmt die Öffentlichkeitsarbeit einen hohen Stellenwert für einige Zusammenschlüsse ein.
Die Patientenvertreter berichten auf die Frage nach den Auswirkungen für die Patienten häufig über konkrete Erfolge und Misserfolge, die sich auf individuelle Fälle beziehen.
„Also richtige Misserfolge wüsst ich jetzt nicht. Aber dafür, muss ich sagen, ist mein Gedächtnis auch gar nicht gut für Misserfolge (lachen). Ich hake sie immer gern ab und guck´ dann was man machen kann (lachen).“ (B7: 455-457)
Diese Beispiele der Auswirkungen für die eigenen Mitglieder werden mit den persönlichen Erfolgserlebnissen der eigenen Arbeit in Zusammenhang gebracht.
„Also da sehen wir schon unsere persönlichen Erfolge in unserer Arbeit.“ (B4: 310-311)
4.2 Ergebnisse weiterer Rückmeldungen
Bei Nennung der Fragestellungen in Kapitel 3.1 wurde erwähnt, dass auch die Reaktionen auf die Interviewanfrage generell von Interesse sind.
Es erfolgten zahlreiche verschiedene Rückmeldungen der kontaktierten Selbsthilfezusammenschlüsse. Von der Absage ohne Angabe näherer Gründe über das Interesse, die Arbeit im Anschluss zu erhalten bis hin zur Vermittlung weiterer Kontakte und sehr ausführlichen Antworten per E-Mail unterschieden sich die Reaktionen. Auch Hinweise zur Bearbeitung des Themas wurden gegeben und Fragestellungen angeregt.
Durch wiedergegebene Aussagen und Zitate aus fünf ausführlichen E-Mails, zwei Telefonaten und dem bereits erwähnten nicht auf Tonband aufgezeichneten Interview soll ein Eindruck von der Bandbreite der Antworten allgemein und der Einschätzungen speziell zur politischen Beteiligung vermittelt werden. Um diese Aussagen rechtmäßig zu veröffentlichen, wurde im Vorfeld eine Einverständniserklärung der wiedergegebenen Personen eingeholt.
Auch wenn keine politische Beteiligung ausgeübt wurde und in den meisten Fällen bewusst war, dass die Einschlusskriterien für die Untersuchung nicht erfüllt wurden, teilten viele angeschriebene Selbsthilfevertreter ihre Erfahrungen und Einstellungen schriftlich mit. Zwei der angeschriebenen Patientenvertreter äußerten darüber hinaus das Interesse an einem Telefonat, um mehr über die Magisterarbeit zu erfahren.
Häufig wurde ausgesagt, dass der Zusammenschluss nicht direkt auf politischer Ebene agiere, sondern einer der Dachorganisationen, wie der BAG Selbsthilfe oder dem Paritätischen, angehöre, denn „man will sich einmischen“. Mehrfach wurden auch die bereits durch Literatur belegten mangelnden personellen und finanziellen Ressourcen als Grund für fehlendes politisches Engagement genannt . „Aktive Mitarbeit in politischen Gremien ist in der Praxis nur für Selbsthilfeorganisationen leistbar, die sich bezahlte Mitarbeiter leisten und diese für die politische Arbeit freistellen können. Als Konsequenz wird die politische Arbeit vermutlich primär den Interessen großer Verbände gerecht“. Eine weitere Meinung zur finanziellen Situation der Selbsthilfe lautete, dass „es segensreich und finanziell entlastend wäre, wenn die Selbsthilfe durch finanzielle Zuwendungen im Stande wäre, eine aktive Beteiligung im gesundheitspolitischen Bereich leisten zu können. So gäbe es ein Gleichgewicht im ´Gesundheits-Markt`“.
Auch generell wurde das Thema Finanzen angesprochen und kritisiert. Eine langfristige Planung sei mit den Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse nicht möglich und das Verfahren der Antragsstellung sei sehr kompliziert und langwierig.
Die Vertretung durch Dachorganisationen wurde in einem der Telefongespräche als nicht ausreichend bewertet. „Das kostet viel Geld und man wird mit E-Mails überschüttet“, so äußerte sich der Selbsthilfevertreter. Es besteht die Einschätzung, dass große Organisationen, die sich für ein weit verbreitetes Krankheitsbild einsetzen, vermehrt unterstützt werden. Im Zusammenhang mit dieser Aussage äußerte die entsprechende Person, sie gehe fest davon aus, dass indikationsspezifische Unterschiede bei der Vertretung von Patienteninteressen auf politischer Ebene bestünden.
Ein weiterer Punkt, der sich auf die Dachorganisationen bezieht, ist der Umstand, dass einer der Selbsthilfezusammenschlüsse erfahren musste, dass aufgrund der jungen Gründung und dem bereits durch einen anderen Zusammenschluss vertretenen Krankheitsbild, eine Aufnahme sowohl in die BAG Selbsthilfe als auch in die ACHSE verweigert worden ist. Gründe für die Existenz mehrerer Selbsthilfevereinigungen, die sich derselben Indikation widmen, sind häufig als unüberwindbar empfundene Unstimmigkeiten unter den engagierten Personen.
Hinzu kommt die Aussage, dass „die Mitgliedschaft bei einer der gemäß Pat.BeteiligungsV anerkannten Organisationen zusätzliche Unkosten bedeutet, [...] Zahlung von Beiträgen an die übergeordnete Organisation. Ob die Interessen und das Wissen der Selbsthilfeorganisation dann auch so in den Bundesausschuss transferiert werden, bleibt eine offene Frage. Die Möglichkeit, eine eigenständige Anerkennung zu beantragen, bedeutet einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand für eine Selbsthilfeorganisation“. Hier wird Kritik an der Regelung zur Benennung der maßgeblichen Organisationen und der damit verbundenen Vorgaben zur Benennung der Patientenvertreter geäußert.
Eine der Absagen enthielt die Information, dass äußerst negative Erfahrungen mit der Beteiligung in politischen Gremien gemacht wurden und dass daraus die Einstellung resultiert, sich mit dem Thema gar nicht mehr auseinandersetzen zu wollen. Deutlich wird dies durch folgendes Zitat: „Meine Erfahrungen mit dem G-BA und anderen Gremien sind so katastrophal, dass allein der Begriff `G-BA` bei mir Aggressionen weckt. […] Meine Antwort auf die Frage, ob Patientenvertreter an gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden, ist ein riesengroßes NEIN. Um zu diesem Schluss zu kommen, brauchen wir keine 45 Minuten Interview“. Ein anderer Selbsthilfevertreter beschreibt die Patientenvertreter als „reine Alibifiguren“ und der G-BA als politisches Gremium wurde als „größte korrupte Organisation“ beschrieben.
Von anderer Seite wird dem G-BA aber auch Positives zugesprochen. Der Vorsitzende des G-BA läge viel Wert auf die Meinung der Patientenvertreter und fordere alle Beteiligten stets auf, zu Entscheidungen zu kommen, die diese Meinungen berücksichtigen. So könne auch ohne ein Stimmrecht durchaus Einfluss auf die Beratungen im G-BA genommen werden. Das Stimmrecht sieht dieser Patientenvertreter dagegen unter den bestehenden Verhältnissen als nicht zielführend. „Erst wenn gefestigte Strukturen innerhalb der Selbsthilfe bestehen und eine Kommunikation mit den anderen Bänken auf Augenhöhe möglich ist, ist ein Stimmrecht sinnvoll“. Dazu müsse die Selbsthilfe in ihren Strukturen gefestigt, adäquate Personen ausgewählt und eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Nach Meinung dieses Patientenvertreters komme für die politische Beteiligung erschwerend hinzu, dass „einheitliche Positionierung unter den verschiedenen Patientenvertretern häufig schwierig zu erreichen“ sind, denn „jeder verfolgt eigene Interessen“. Es wurde ebenfalls einer der Aspekte, der bereits in den theoretischen Grundlagen thematisiert wurde, genannt: „Wer mit abstimmt, ist auch mit verantwortlich“. Aber auch ohne Stimmrecht „entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, die Beschlüsse wären mit Zustimmung der Patientenvertreter getroffen“, so die Meinung eines Selbsthilfevertreters. Dieses werde durch die Medien zusätzlich verstärkt.
Auch gegenüber den Ämtern innerhalb der Politik erhebt ein Selbsthilfevertreter Kritik. Während Gesundheitsminister angeblich den Kontakt nur zu namhaften großen Selbsthilfezusammenschlüssen suchen würden, wurde das Amt des Patientenvertreters als „Beruhigungspille für Patienteninteressen“ beschrieben, da keine Auswirkungen der Tätigkeiten, die mit dem Amt in Zusammenhang stehen, zu spüren seien.
Der Vertreter eines Zusammenschlusses berichtet von dem Vorgehen, die Meinungen der eigenen Mitglieder über Datenerhebungen beispielsweise bei Fortbildungen zu erfassen. So können Interessen und Präferenzen bezüglich der Arbeit auf politischer Ebene erfasst, weiter gegeben und im Sinne der eigenen Mitglieder gestaltet werden.
5. Diskussion
Die Ergebnisse der Untersuchung werden folgend im Hinblick auf die Fragestellungen diskutiert und mit Hilfe wissenschaftlicher Literatur näher beleuchtet. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die kritische Reflexion des Untersuchungsdesigns.
5.1 Diskussion zentraler Ergebnisse
Die Diskussion der zentralen Ergebnisse erfolgt zum einen auf Basis der systematisch ausgewerteten Interviews und zum anderen durch die Resultate der weiteren Rückmeldungen.
Im Hinblick auf die demographischen Daten der Interviewpartner lässt sich feststellen, dass der jüngste Teilnehmer eine Ausnahme unter den Patientenvertretern darstellt, da sich der Großteil der Befragten im mittleren Lebensalter befindet oder bereits in Rente ist. Weitere Unterschiede, die auf das Alter zurückzuführen sind, werden im Zusammenhang mit der Qualifikation der Patientenvertreter diskutiert.
Mit sieben ehrenamtlich Tätigen unter den Interviewpartnern zeigt sich, dass die Tätigkeit in der Selbsthilfe ein Amt ist, das nur selten finanziell entschädigt wird und das auf Engagement aus den eigenen Reihen angewiesen ist. Denn ebenfalls ist deutlich geworden, dass die eigene Betroffenheit, direkt oder als Angehöriger, auslösender Faktor für die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung in der Selbsthilfe ist.
Die Übernahme von Beratungsaufgaben durch die Interviewpartner begründet sich in der Einstellung, dass die Beratung am Herzen liegt und auf diese Weise der Kontakt zur Basis gehalten werden kann. Dies ist durchaus sinnvoll, um befähigt zu sein, die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Die Übernahme der Beratungsarbeit kann aber auch einem Mangel an personellen Ressourcen geschuldet sein.
In Kapitel 3.2.1.2 wurde erwähnt, dass zur ersten Frage nach der Form der Einbindung bewusst kein spezielles gesundheitspolitisches Gremium ausgewählt und vorab festgelegt wurde, um zu eruieren über welche Institutionen die Interviewpartner berichten und worauf der Fokus gelegt werden würde. Der Fokus richtet sich in allen Interviews auf die Beteiligung der Patientenvertreter im G-BA. Die Nachfrage nach weiteren Gremien verlief speziell bei den Interviews mit Vertretern seltener Erkrankungen erfolglos. In wenigen Fällen wurde auf Seiten der Erkrankungen mit hoher Prävalenz eine Beteiligung im IQWiG, im AQUA-Institut oder in verschiedenen Arbeitskreisen benannt. Aufgrund der geringen Informationen hierzu lässt sich jedoch keine indikationsspezifische Analyse vornehmen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zusammenschlüsse der Erkrankungen mit hoher Prävalenz in das politische Gefüge bereits besser eingebunden sind und dass zu diesen Erkrankungen aufgrund ihrer hohen Anzahl Betroffener mehr Austausch auf politischer Ebene ermöglicht wird.
Der G-BA wird eindeutig mit dem Begriff „gesundheitspolitisches Gremium“ assoziiert und für die Patientenvertreter spielt er eine zentrale Rolle für die Vertretung ihrer Interessen. Die in der Literatur beschriebene hohe Bedeutung und der Beiname „kleiner Gesetzgeber“ (Bronner 2009: 212) spiegeln sich in den Ergebnissen.
In beiden Gruppen konnte verzeichnet werden, dass die Mitgliedschaft in und die Vertretung durch die Dachorganisationen für die Patientenvertreter zu der Beteiligung auf gesundheitspolitischer Ebene zählen und meist eine große Rolle spielen. Bei den Seltenen fokussiert sich dies auf die ACHSE, was bei der Ausrichtung der ACHSE, dem Einsatz speziell für die seltenen Erkrankungen, erwartet werden konnte.
Es besteht weiterhin eine deutliche Unterlegenheit der Selbsthilfe gegenüber den Leistungserbringern und Kostenträgern. Diese wird deutlich durch die unterschiedlichen personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen, die in beiden Gruppen kritisiert wurden. Hinzu kommt, dass dieser Vorteil der anderen Bänke durch „etablierte informelle Kommunikationskanäle außerhalb der offiziellen Agenda“ (Danner/Matzat 2005: 153) begünstigt werden kann. Die Vernetzung im Gesundheitswesen könnte sich auch auf etablierte Patientenvertreter auswirken, die Kontakte nutzen, um Informationen frühzeitig zu erhalten oder Interessen über andere Akteure des Gesundheitswesens einzubringen. In beiden Gruppen werden Vorgehensweisen genannt, wie die Beteiligung über weitere Kontakte angegangen werden kann. Zum einen über die direkte Ansprache einzelner Politiker, die für Fragen der Gesundheitsversorgung verantwortlich sind und zum anderen über die Schirmherrschaft eines Abgeordneten, der die kurzen Wege innerhalb der Politik im Sinne des Selbsthilfezusammenschlusses nutzen kann.
Es zeigt sich aber bei der Zusammenarbeit mit Leistungserbringern auch, dass von mehreren Patientenvertretern ein Gewöhnungsprozess beschrieben wird, der dazu führt, dass man sich nähert und besser kooperiert. Für die seltenen Erkrankungen kommt erschwerend hinzu, dass die Ärztevertreter im G-BA sich nicht mit den speziellen Erkrankungen auskennen und somit die Patientenvertreter vorerst über die Indikation Aufklärung leisten müssen.
Bezüglich der Vereinbarkeit von politischer Beteiligung und den genuinen Aufgaben der Selbsthilfe bestehen nur geringe Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen. Sowohl alle Vertreter der Erkrankungen mit hoher Prävalenz als auch alle Vertreter seltener Erkrankungen sprechen der politischen Beteiligung einen hohen Stellenwert zu. Sie sind sich einig, dass dafür jedoch ein hoher zeitlicher Aufwand in Kauf genommen werden muss, welcher zum Nachteil der grundlegenden Aufgaben anfällt. Es zeigt sich demnach, dass die politische Beteiligung, bezogen auf den Arbeitsaufwand, eine zusätzliche Belastung für die Selbsthilfe bedeutet und dass die politische Beteiligung zu Lasten der genuinen Aufgaben der Selbsthilfe anfällt. Es besteht die Gefahr durch die politische Beteiligung „Energie und Engagement zu binden, die für andere Formen der Vertretung von Patienteninteressen jenseits der Tagesordnungspunkte im Gemeinsamen Bundesausschuss oder für praktische Formen der alltagsnahen Selbsthilfe unter Betroffenen dringend gebraucht werden“ (Danner/Matzat 2005: 154).
„Bei vielen aktiven Menschen in der Selbsthilfe erlebe ich sehr hohe Erwartungen an die eigene Rolle und das eigene Tun. Aus dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber den Betroffenen gerät die Grenze der eigenen Belastbarkeit schnell aus dem Blickfeld“ (Janotta 2007: 74). Problematisch kann es werden, wenn Patientenvertreter die Erfüllung ihrer Aufgaben mit zu hohen Erwartungen verknüpfen und den eigenen Anspruch nicht erfüllen können. Ein schonender Umgang mit den vorhandenen Ressourcen ist für die Patientenvertreter unabdingbar, um konstant ihre Tätigkeit ausüben zu können und auch die Qualität der Arbeit zu gewährleisten.
Rosenbrock beschreibt die Aufgabe, der sich die Selbsthilfe im Rahmen neuer Beteiligungsrechte stellen muss: „Diese Entwicklungen konfrontieren die Selbsthilfegruppen und –organisationen neben der Aufwertung auch mit dem Problem, die Spontaneität, das Informelle, das Offene und Nicht-Geregelte im Selbsthilfe-Geschehen unter veränderten Erwartungen und Rahmenbedingungen unbeschädigt zu erhalten und weiter zu entwickeln“ (2001: 39). Die Schwierigkeit, den eigenen Mitgliedern die politischen Prozesse und deren Bedeutung für die Selbsthilfe nahe zu legen, die Vertreter beider Gruppen beschreiben, spiegelt die als intransparent beschriebenen politischen Vorgänge. Es bedarf eines eigenen Verstehens der Prozesse, um die politischen Vorgänge vermitteln zu können.
Laut den Interviewpartnern beider Gruppen bestehen aber auch Vorteile, die das politische Engagement mit sich bringt und welche sich gewinnbringend auf die grundsätzlichen Aufgaben der Selbsthilfe auswirken. Es wurde oftmals betont, dass die Beteiligung in politischen Gremien den Informationsfluss begünstigt und somit der Arbeit vor Ort zugute kommt. Die eigenen Mitglieder können frühzeitig aus zuverlässiger Quelle informiert werden und die Interessen der Selbsthilfe können in die Politik und die entscheidenden Gremien getragen werden. Diese Ausführungen zu den Vor- und Nachteilen der Erfüllung beider Aufgabengebiete ähneln sich in beiden Gruppen.
Auf Seiten der seltenen Erkrankungen kommt hinzu, dass die öffentliche Wahrnehmung der Seltenen als positiver Aspekt der Arbeit auf politischer Ebene gewertet wird. Die anderen Akteure werden auf Erkrankungsbilder und Problematiken aufmerksam gemacht und dies kann sich weiter entwickeln zu einer verbesserten öffentlichen Wahrnehmung der seltenen Erkrankungen innerhalb der Bevölkerung.
Die Tatsache, dass viele Patientenvertreter seit mehreren Jahren auf politischer Ebene und speziell im G-BA aktiv sind, belegt, dass die hohen Anforderungen in Kauf genommen werden und die Vorteile und Erwartungen, die mit der politischen Beteiligung verknüpft sind, überwiegen.
Die Qualifikation ist verknüpft mit der Zeit, welche die Interviewpartner bereits auf politischer Ebene aktiv sind. So erklären sich jene Aussagen, die besagen, dass die Einarbeitung in Strukturen und Abläufe schwierig sind, aber die selbst eingeschätzte Qualifikation mit der Zeit zunimmt.
Bis auf die Ausnahme des jüngsten befragten Patientenvertreters geben alle Interviewpartner an, sich ausreichend bis sehr gut qualifiziert zu fühlen. Die Ergebnisse besagen, dass diese Qualifikation auf Erfahrung sowohl im beruflichen Leben außerhalb der Selbsthilfe als auch durch die Selbsthilfearbeit direkt zurückgeführt wird. Daraus und aus den Rückblicken einiger Interviewpartner, die eine schwierige Einarbeitungsphase beschreiben, ergibt sich die Notwendigkeit, neue Patientenvertreter besser zu unterstützen und zu fördern. Die erwähnten Einführungsseminare des G-BA, die einmal im Jahr stattfinden, sind nicht zielführend, wenn Patientenvertreter bereits Monate vorher im G-BA mitarbeiten und sich ihr Wissen selbst aneignen müssen.
Unterstützung erhalten die Patientenvertreter von verschiedenen Seiten. Speziell in der Gruppe der Erkrankungen mit hoher Prävalenz werden zahlreiche Anlaufpunkte, wie die Dachorganisationen BAG Selbsthilfe, der Paritätische sowie der DBR, oder auch die Stabstelle Patientenbeteiligung und die Fortbildungen durch den G-BA und das IQWiG genannt. Bei den seltenen Erkrankungen liegt der Schwerpunkt der erfahrenen Unterstützung bei der ACHSE.
Im Gegensatz zu den Erkrankungen mit hoher Prävalenz, die mehrfach über die gute Unterstützung der Stabstelle Patientenbeteiligung berichten, sind die Erfahrungen der Seltenen hier schlechter. Dies könnte zurück zu führen sein auf eine längere politische Aktivität der Selbsthilfezusammenschlüsse weit verbreiteter Erkrankungen und damit verbundenen Kontakten sowie bestehenden organisatorischen Strukturen.
Die Patientenvertreter fühlen sich besonders sicher auf dem Gebiet des medizinischen Wissens. Bei seltenen Erkrankungen können die Patientenvertreter zuweilen sogar den Ärzten medizinische Sachverhalte erklären. Qualifikationsbedarf sehen einige Interviewpartner auf den Gebieten der rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Verstehen und Interpretieren von gesundheitsökonomischen Studien. Der Wunsch nach mehr Qualifikation auf diesen Gebieten geht jedoch immer mit der Aussage, dass zeitliche Ressourcen für Fortbildungen knapp sind, einher. Eine Weiterbildung ist durch die bestehenden Anforderungen an Patientenvertreter und die Möglichkeiten der Ausweitung der Rechte aber unabdingbar. Die Organisation der Weiterbildung und die fachliche Unterstützung könnten weiterhin durch die beteiligten Organisationen und Zusammenschlüsse übernommen sowie ausgebaut werden. Begründen lässt sich dies dadurch, dass sie „den direkten Kontakt zu den Vertreterinnen und Vertretern haben, den fachlichen und Erfahrungshintergrund kennen und zum anderen auch über den Kontakt zur Basis verfügen, mit der ein begleitender Diskussionsprozess entwickelt werden kann, der die Entwicklung und Formulierung von Patienteninteressen erst ermöglicht“ (Angerhausen 2006: 111). Um diese Unterstützung gewährleisten zu können, bedarf es eines Finanzierungsmodells, welches die Unabhängigkeit der Selbsthilfe nicht in Frage stellt. Denkbar wäre ein privatrechtlicher Fonds, in den Leistungserbringer, Kostenträger und die öffentliche Hand einzahlen (Angerhausen 2006: 111).
Zurückgehend auf die Themenbereiche der Qualifikation ist eine „Ausgewogenheit zwischen ärztlichem, wissenschaftlichem oder juristischem Expertentum auf der einen Seite und der Kompetenz aufgrund persönlicher Erfahrungen, eigener Betroffenheit und des Kontaktes zu Patienten auf der anderen Seite“ (Meinhardt/Plamper/Brunner 2009: 102) notwendig. Mit dieser Aussage sprechen sich die Autoren gegen eine Professionalisierung der Selbsthilfe aus, bei der sich Vertreter ohne die geforderte Betroffenenkompetenz für Patienteninteressen einsetzen würden und was anhand der Wahrnehmung der Patientenbeteiligung durch den vzbv bereits geschieht. Die Diskussion um die Professionalisierung steht in einem engen Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und dem Verbesserungspotential kollektiven Beteiligung der Selbsthilfe.
Die Frage nach den Optionen hinsichtlich einer Verbesserung der kollektiven Beteiligungsrechte auf politischer Ebene ergab, dass die Interviewpartner zu diesem Aspekt über zahlreiche Ideen verfügen. Sowohl in der Gruppe der hoch prävalenten Erkrankungen als auch in der Gruppe der seltenen Erkrankungen bestehen durch die Patientenvertreter selbst konkrete Vorstellungen, wie zukünftig die Patientenbeteiligung gestaltet werden kann. Die hohe Anzahl an Vorschlägen indiziert, dass Verbesserungsmaßnahmen notwendig und gewünscht sind.
Von Vertretern der seltenen Erkrankungen wird angebracht, dass die Herausforderungen nicht ausschließlich nach außen gegeben werden, sondern dass die Selbsthilfezusammenschlüsse hier durchaus auch selbst aktiv werden wollen. Eine der größten Herausforderungen besteht bezüglich der mangelnden Geschlossenheit innerhalb der Selbsthilfe. „Die Vertreterinnen und Vertreter der Patienteninteressen müssen von außen als Einheit wahrnehmbar sein, sie müssen Geschlossenheit zeigen und ein gemeinsames Profil (entwickeln)“ (Angerhausen 2006: 109). Andernfalls werden die Patientenvertreter keine Erfolge vermelden können.
Zusätzlich wichtig für die Zukunft und zu den Aufgaben der Selbsthilfezusammenschlüsse gehörend sind der Abbau von Hemmungen gegenüber der politischen Arbeit, bei dem es zusätzlich eines Entgegenkommens der weiteren Akteure des Gesundheitswesens bedarf und die Rückkopplung der Arbeit auf politischer Ebene an die eigenen Mitglieder. Es muss den Patientenvertretern gelingen, das Vertrauen und die Unterstützung der Mitglieder vor Ort zu erhalten, was wiederum der Geschlossenheit der Gesamtheit der Selbsthilfe zugute kommt.
Es bietet sich beispielsweise die Vorgehensweise eines Patientenvertreters an, dessen Meinung über die weiteren Rückmeldungen einbezogen ist, und der von der Nutzung interner Seminare berichtet, um Meinungen, Wünsche und Präferenzen der eigenen Mitglieder zu erheben, welche anschließend in die weitere politische Arbeit einfließen können. Über diesen Weg können auf Ortsebene die individuell betroffenen Mitglieder informiert und bei Interesse darüber hinaus auch einbezogen werden.
Von Seiten der Vertreter seltener Erkrankungen wird außerdem angemahnt, dass das spezifische Wissen zu ihren Indikationen bei den Leistungserbringern und Kostenträgern fehlt. Dies unterstreicht den Unterschied zu Erkrankungen mit hoher Prävalenz, die meist über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen, und bestärkt die Zusammenschlüsse der Betroffenen mit seltenen Erkrankungen in ihrem Vorgehen großen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit zu legen und die politische Beteiligung auch als Möglichkeit für mehr Beachtung zu sehen.
Grundsätzlich findet sich unter den Aussagen der Interviewpartner immer wieder die Forderung nach einem Ausbau der kollektiven Patientenbeteiligung. Möglich wäre dies durch das von den Dachorganisationen offiziell geforderte Stimmrecht in Verfahrensfragen. Da sich in den bisherigen Entwürfen zum Patientenrechtegesetz keine Stärkung in Richtung Stimmrecht findet, sollte diese Forderung zukünftig auch in Richtung GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VSG) formuliert werden.
Speziell für den G-BA wird im Rahmen des geplanten GKV-VSG, welches die aktuelle Regierung aus CDU/CSU und FDP Anfang 2012 verabschieden möchte, eine Neustrukturierung diskutiert[26]. Im Fokus der Kritik stehen die starren Arbeitsweisen, welche sich nicht an neuen Entwicklungen orientieren und die „angeblich ineffizienten, undemokratischen, teuren und somit letztlich als klientelistisch identifizierten Gremien“ (Schroeder 2009: 189), denen die Verfolgung von Eigeninteressen nachgesagt wird. Die Neustrukturierung bezieht sich vorrangig auf die Benennung der unparteiischen Mitglieder und die geplante Neuregelung bezüglich der Abstimmung von Beschlüssen, welche besagt, dass lediglich die Leistungserbringerorganisationen mitentscheiden, die von der Thematik betroffen sind. Eine Weiterentwicklung der Beteiligung der Patientenvertreter wird im vorliegenden Referentenentwurf bisher nicht thematisiert und sollte daher von den Dachorganisationen der Selbsthilfe forciert werden (BMG 2011: 65).
Der SVR regt in seinem Gutachten an, die Einbeziehung der Bürger in das Gesundheitswesen über die Parteien zu organisieren. „Denkbar wäre […], dass die Politik, und hier insbesondere die Parteien, ihr Organisationspotenzial in gesundheitspolitischen Themen erweitern und `sachverständige Bürger` eines neues Typus neben den `Gesundheitspolitikern` des traditionellen Typs, die im Kontext des Körperschaften der allgemeinen Volksvertretung operieren, hervorbringen. Die Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten kann dabei für politische Parteien die Herausforderung darstellen, im Rahmen ihrer Funktion der Förderung der öffentlichen Meinungsbildung die bisher weitgehend unbeachtet gebliebenen Interessen und Anliegen von Bürgern als Patienten und Nutzer von Gesundheitsleistungen stärker aufzugreifen und politisch zu organisieren, und im Rahmen ihrer Funktion bei der Auslese politischen Führungspersonals kompetente und nicht durch professionelle oder verbandliche Loyalitäten gebundene Bürgervertreter hervorzubringen“ (2002: 332).
Hieran knüpft die Thematik der grundlegenden Debatte bezüglich der Auswahl der Patientenvertreter an. „Bis heute fehlen Spitzenverbände der Patienten weitgehend (bzw. sind von fraglicher Legitimiertheit aufgrund einer geringen organisatorischen Basis oder ungeklärten Interessenverflechtungen). Dies stellt eine wichtige Lücke für Partizipation auf der Makroebene dar. In anderen Ländern, z.B. Großbritannien, ist die Organisation hier weiter fortgeschritten“ (SVR 2002: 332).
Laut Ruth Schimmelpfeng-Schütte (2006: 21), Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht Celle, führte dieses Fehlen einer Interessenvertretung von gesetzlich Versicherten dazu, dass Selbsthilfezusammenschlüsse die Aufgabe der Interessenvertretung übernommen haben. Dies ist ihrer Meinung nach kein Konzept für die Zukunft, denn die Entscheidungen, die im G-BA getroffen werden, beziehen sich auf die Rechte von gesetzlich Kran-kenversicherten und dieses Kollektiv schließt nicht alle Patienten mit ein. Neben den etwa 90 % gesetzlich Versicherten in Deutschland verfügen andere über eine private Krankenversicherung oder in wenigen Fällen auch über keinerlei Versicherungsschutz. Daher spricht sie sich für eine organisierte Interessenvertretung von gesetzlich Versicherten aus. Ob bei dieser Form der Interessenvertretung die Diskussion um die Legitimation der Patientenvertretung abklingen würde, bleibt jedoch fraglich.
Die Vorbereitung der Patientenvertreter für ihre politische Arbeit wurde bereits unter dem Aspekt der Qualifikation angesprochen. Mit der Erstellung des beschriebenen Leitfadens oder der Intensivierung der Fortbildungsmöglichkeiten unterbreiten die Interviewpartner auch für diesen Bereich selbst Vorschläge, die der Verbesserung dienen sollen und den Empfehlungen vieler Wissenschaftler entsprechen. „Analog zu den Public Health-Aufbaustudiengängen könnten Weiterbildungsmaßnahmen für SozialwissenschaftlerInnen, erfahrene SelbsthilfevertreterInnen aber auch für Professionen des Gesundheitswesens, die Kooperationen initiieren und befördern wollen, konzipiert werden“ (Stark 2001: 61).
Matzat´s Forderung für die Zukunft lautet: „Die Selbsthilfe könnte sich zur `vierten Säule unseres Gesundheitswesens` entwickeln – ganz im Sinne der These von der Ko-Produktion von Gesundheit durch Behandler und Behandelte – und stellt für viele eine, wenn nicht die große Hoffnung für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesen dar. Sie sollte politisch, finanziell und wissenschaftlich angemessen, d.h. stärker als bisher gefördert werden“ (2001: 95). Auch Rosenbrock (2001: 33) bestätigt, dass speziell die derzeitige finanzielle Situation der Selbsthilfe hemmend auf die Möglichkeiten der Weiterentwicklung wirkt.
Über das Patientenrechtegesetz sind die meisten der Interviewpartner zum Erhebungszeitraum nicht näher informiert und es besteht bezüglich dieses Aspektes kein gravierender Unterschied zwischen den verschiedenen Indikationsgruppen. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass aktuelle Themen nicht zeitnah bearbeitet werden können, da der generelle Arbeitsaufwand zu hoch ist oder dass das Thema noch nicht relevant ist für einige Zusammenschlüsse, da bisher nur Eckpunkte formuliert wurden.
Grundsätzlich wird die Bündelung der bestehenden Patientenrechte in einem Gesetz von den Interviewpartnern begrüßt. Das Patientenrechtegesetz kann durchaus als politisches Signal gedeutet werden, das die Rolle des Patienten im Gesundheitswesen aufwertet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Umsetzung in der Praxis realisiert werden kann. Und um ihre Rechte wahrnehmen oder auch einklagen zu können, müssen Patienten zuerst auch über diese Rechte informiert werden.
Bemängelt wird in diesem Kontext auch der Informationsfluss. Viele Vertreter äußern den Wunsch nach einer Stelle im Gesundheitswesen, die politische Themen verständlich aufbereitet und der Selbsthilfe bei Bedarf zur Verfügung stellt.
Die Möglichkeit eines Stimmrechtes für Patientenvertreter sprechen viele Interviewpartner bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Interviews von selbst an.
Auch wenn die Patientenvertreter in beiden Gruppen sich überwiegend für ein Stimmrecht aussprechen, betonen viele von ihnen dass die notwendigen Rahmenbedingungen innerhalb der Selbsthilfe dafür noch fehlen. Die bereits angesprochene Heterogenität innerhalb der Selbsthilfe und fehlende Finanzen werden dazu in beiden Kollektiven angemahnt.
Die Gefahr, die mit einem Stimmrecht verbunden wäre, ist die bestehende Drittelparität unter den Leistungserbringern, Kostenträgern und Patientenvertretern. „Es könnte `schick` sein, sich mit der Patientenbank gegen die andere zu verbünden“ (Köster 2005: 85).
In einem engen Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Selbsthilfe steht die Diskussion um deren Professionalisierung. In wenigen Interviews wurde auch dieser Aspekt thematisiert. Dass die Richtung in diese Entwicklung gesehen wird, zeugt davon, dass über die jetzigen Rahmenbedingungen der Selbsthilfe hinaus gedacht wird.
„Die `Professionalisierung` der Selbsthilfe wird fortschreiten. Dies erhöht einerseits ihre Qualität als Dienstleistungserbringer und stärkt individuelle Kompetenz von Patienten; andererseits steht sie im Widerspruch zum Selbsthilfegedanken als Ergänzungs- manchmal auch Gegenkonzept zu professioneller Versorgung“ (Matzat 2001: 93). Für die Zukunft ist es die Aufgabe, den Ursprungsgedanken der Selbsthilfe mit ihrer Betroffenenkompetenz aufrecht zu erhalten und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Für Borgetto kann eine Professionalisierung nur gelingen, wenn realisiert werden könnte „in den Selbsthilfegruppen und –organisationen professionelle Arbeitskräfte zu finanzieren, die die Betroffenen von Verwaltungs- und Dienstleistungstätigkeiten so entlasten, dass sie ihr spezifisches Selbsthilfepotential noch immer entfalten können“ (2001: 22).[27]
Bezüglich der Frage nach den Auswirkungen auf den individuellen Patienten, unterscheiden sich die Meinungen bei den Vertretern der Erkrankungen mit hoher Prävalenz stark, während im Kollektiv der Vertreter seltener Erkrankungen die Auswirkungen überwiegend als schwach oder nicht existent angesehen werden.
Es zeigt sich, dass die Betroffenen die Auswirkungen häufig nicht auf eine Beteiligung der Selbsthilfe zurückführen. Die Verbindung ist nicht erkennbar und darüber hinaus können bei einigen Patienten auch grundlegende Kenntnisse des Gesundheitswesens fehlen, so dass sie erlebte Einschränkungen direkt ihrer Krankenkasse, dem behandelnden Arzt oder der Politik allgemein zuschreiben und über die Existenz und Funktion des G-BA nicht informiert sind. Da die gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland gemessen an der Gesamtanzahl Betroffener eine geringe Mitgliederzahl besitzt, ist vielen Betroffenen offenbar nicht bewusst, wer die Vertretung von Patienteninteressen wahrnimmt.
Auch generell gilt häufig, dass „wertvolles Erfahrungswissen […] mangels Transfermöglichkeiten auf gesundheits- und gesellschaftspolitischer Ebene […] nicht repräsentiert ist. Zum einen können dadurch wichtige Ressourcen nicht systematisch genutzt werden, zum anderen fühlen sich engagierte Betroffene durch Nicht-Achtung brüskiert und ziehen sich zurück“ (Stark 2001: 60).
Die Auswirkungen werden durch die Interviewpartner meist auf konkrete Fälle eigener Mitglieder bezogen. Diese Erlebnisse werden häufig als persönliche Erfolge oder Misserfolge beschrieben. Dies zeigt deutlich, dass das Ehrenamt nicht nur als Arbeit gesehen wird, sondern sich darüber hinaus auswirkt.
Die Äußerungen, dass Misserfolge schnell abgehakt und die nächsten Aufgaben in Angriff genommen werden sowie die Auffassung, dass auch Teilerfolgen Positives abgewonnen werden kann, zeigen, dass viele Selbsthilfevertreter eine optimistische Grundeinstellung besitzen und ihrer Tätigkeit mit viel Willenskraft und Engagement nachgehen.
Im Bereich der seltenen Erkrankungen wird die politische Beteiligung zusätzlich auch als Chance angesehen, die Wahrnehmung der Seltenen in der Öffentlichkeit zu stärken. Durch die Betonung der Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich ein Unterschied zu weit verbreiteten Erkrankungen, deren Bekanntheitsgrad wesentlich höher ist, so dass die Selbsthilfe in diesem Bereich weniger auf Aufklärung der Bevölkerung bedacht ist. Mehr Bekanntheit und Verständnis bedeutet für den individuellen Patienten letztendlich mehr Akzeptanz und auch eine positive Auswirkung auf die Diagnosefindung und die Beziehung zum behandelnden Arzt.
Die Ergebnisse der weiteren Rückmeldungen beinhalten sehr subjektive Erfahrungen, die keiner systematischen Analyse unterworfen werden konnten, und dennoch geben sie einen Einblick in die Heterogenität der Meinungen, denen die politische Beteiligung der Selbsthilfe unterliegt.
Anhand der Aussagen, die durch die weiteren Rückmeldungen gewonnen werden konnten, lässt sich feststellen, dass diese Meinungen negativer ausgefallen sind als die Aussagen der systematisch ausgewerteten Interviews. Bei einigen Selbsthilfevertretern besteht eine Frustration bezüglich der nicht bestehenden Möglichkeit der politischen Beteiligung oder den sehr schlechten Erfahrungen auf der politischen Ebene und teilweise resultiert daraus ein vollständiges Zurückziehen aus diesem Aufgabengebiet.
Der Verweis auf Diskrepanzen innerhalb eines Erkrankungsbildes und die damit verbundene Existenz mehrerer Zusammenschlüsse beschreibt die Parallel-Strukturen innerhalb der Selbsthilfe und ihre negativen Auswirkungen. Die dadurch verhinderte Mitgliedschaft in den Dachorganisationen führt dazu, dass der Weg auf die politische Ebene stark erschwert wird, denn die Dachorganisationen, speziell die BAG Selbsthilfe, sind der „Türöffner“ für die Benennung zum politischen Patientenvertreter.
Wie bei den vorab diskutierten qualitativen Interviews ist auch bei den weiteren Rückmeldungen zu erkennen, dass der G-BA das meist genannte politische Gremium ist und dadurch wird erneut die Bedeutung dieser Institution unterstrichen. Im Gegensatz zu den unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb der qualitativen Interviews wird in den weiteren Rückmeldungen überwiegend von schlechten bis sehr schlechten Erlebnissen mit dem G-BA oder Ansichten über denselben berichtet.
Der Bericht über das Vorgehen, die eigenen Mitglieder zu ihren Vorstellungen der politischen Beteiligung zu befragen, könnte hilfreich sein, um der teils schwierigen Vermittlung der Wichtigkeit der Arbeit auf politischer Ebene, von der in einigen Interviews berichtet wurde, entgegen zu wirken. Durch den Einbezug erhält man die Akzeptanz und Unterstützung der Mitglieder und kann sie direkt an der politischen Arbeit teilhaben lassen. Zusätzlich wird über die Tätigkeiten auf politischer Ebene und deren Auswirkungen informiert.
Das Thema Finanzen war im Grunde nicht Bestandteil der Untersuchung aber viele der Antworten beinhalteten diesen Aspekt, da er elementar wichtig ist für die Arbeit in der Selbsthilfe. Entgegen der Aussage des GKV-Spitzenverbandes, der die finanzielle Unterstützung der Selbsthilfe durch die Krankenkassen als unbürokratisch beschreibt, sieht die Realität laut Patientenvertretern anders aus. Und dies wirkt sich über die finanzielle Absicherung der grundlegenden Aufgaben selbstverständlich auch auf die Möglichkeiten der politischen Beteiligung der Selbsthilfe aus.
Die verschiedenen Rückmeldungen auf die Interviewanfrage und auch das Interesse, die fertiggestellte Arbeit zu erhalten, zeigen, dass es begrüßt wird, dass die Selbsthilfe als Thema zur genaueren Untersuchung ausgewählt wurde. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass ein großer Anteil der kontaktierten Selbsthilfevertreter die Befragung nutzt, um auch auf die jeweilige Situation aufmerksam zu machen und Missstände aufzuzeigen. Es zeigte sich deutlich das Bedürfnis danach, sich mitzuteilen und Aufmerksamkeit zu erhalten. Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit ist dies eine wichtige Aufgabe der Selbsthilfe, um ihr Ansehen und ihren Zuspruch in der Gesellschaft zu stärken, denn für die Selbsthilfe besteht weiterhin die Herausforderung, dass nur ein geringer Anteil der Betroffenen sich einer Selbsthilfegruppe anschließt.
5.2 Weiterführende Fragestellungen
Anschließend an die Beantwortung der Forschungsfragen ergeben sich weiterführende Fragestellungen, die Anlass zu künftiger Forschung geben.
Angesichts der Tatsache, dass überwiegend über die Beteiligung der Patientenvertreter im G-BA berichtet wurde, wäre es interessant, die Patientenbeteiligung in weiteren Gremien des Gesundheitswesens systematisch zu untersuchen. Dies ließe sich am ehesten mit Unterstützung des jeweiligen Gremiums realisieren, denn dieses ist in der Lage, jene Patientenvertreter, die für eine Untersuchung in Frage kommen, zu benennen.
Gemäß dem Fall, dass das geforderte Stimmrecht in Verfahrensfragen für Patientenvertreter in Kraft tritt, wäre eine Befragung sinnvoll, die nach einer Erprobungsphase erhebt, ob ein Unterschied bezüglich der Zufriedenheit mit der Einbindung, der Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und Kostenträgern sowie erreichten Interessen eingetreten ist.
Interessant wäre es, zu untersuchen, ob in einem weiteren Sinne ein Indikationsunterschied festzustellen ist. Während diese Untersuchung aufgrund ihrer Anzahl der Stichprobe einen globaleren Indikationsunterschied vorgenommen hat, könnte eine weitere Untersuchung, die möglicherweise in quantitativer Form durchgeführt wird, in Indikationsgruppen wie Onkologie, Erkrankungen der Atemwege, Herzkreislauferkrankungen und weitere aufgeteilt werden.
Die angesprochene Nutzung informeller Kommunikationswege durch die Leitungserbringer und Kostenträger wirft die Frage auf, inwiefern auch Patientenvertreter bereits über solche Art der Kontakte verfügen, die ihnen bei der Interessenvertretung behilflich sein können.
Die kurz thematisierte Möglichkeit der Professionalisierung der Selbsthilfe nimmt eine hohe Relevanz im Bezug auf die Weiterentwicklung der Selbsthilfe ein, sowohl ihrer Basisarbeit als auch speziell ihrer politischen Arbeit. Eine nähere Untersuchung der damit verbundenen Argumente und möglichen Auswirkungen bildet einen interessanten Forschungsansatz.
5.3 Kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns
Die kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns benennt die methodischen Schwierigkeiten der vorliegenden Arbeit und gibt Hinweise für Verbesserungen.
Generell werfen Kritiker der qualitativen Sozialforschung einen „mangelnden Theoriebezug und willkürliches (methodisch nicht kontrolliertes) Arbeiten vor. Datenerhebung und –auswertung der qualitativen Sozialforschung seien nicht reproduzierbar und nicht verlässlich“ (Gläser/Laudel 2010: 24-25). Dem ist entgegen zu stellen, dass die qualitative Forschung dazu in der Lage ist, besondere Charakteristika menschlichen Verhaltens zu analysieren und zu interpretieren (Gläser/Laudel 2010: 25).
Die Art des indikationsspezifischen Ansatzes stellt sich anhand der Rückmeldungen als gut durchführbar heraus. Eine tiefer gehende Spezifikation nach einzelnen Erkrankungsbildern hätte aufgrund der Anzahl von zehn Interviewpartnern wenig Aufschluss geben können und zusätzlich die Anonymisierung der Patientenvertreter erschwert.
Ausgehend von den Patientenvertretern der Erkrankungen mit hoher Prävalenz hätten mehr als insgesamt zehn Interviews realisiert werden können. Auf Seiten der seltenen Erkrankungen konnten jedoch wesentlich weniger positive Rückmeldungen, die sich für die Befragung eigneten, vermerkt werden. Dies war aufgrund der Auflistung der Grünen Adressen, bei denen der Anteil von Zusammenschlüssen hoch prävalenter Erkrankungen deutlich überwiegt, voraussehbar. Möglicherweise hätte eine Kontaktaufnahme zur ACHSE zu einer höheren Beteiligung geführt.
Durch mehr zeitliche Ressourcen wäre es zusätzlich möglich gewesen, das Vorgehen zur Rekrutierung von Interviewpartnern besser mit der BAG Selbsthilfe anzusprechen, was sich ebenfalls positiv auf die Beteiligung hätte auswirken können.
Die Auswahl geeigneter Interviewpartner ist als schwierig einzustufen, da eine offizielle Liste nicht einsehbar ist. Durch die breite Ansprache über die Grünen Adressen erklärten sich zwar zahlreiche Personen aus der Selbsthilfe für ein Interview bereit, jedoch fehlte bei einigen die Erfüllung der Einschlusskriterien. Das Benennen der sechs Themengebiete direkt im ersten Anschreiben hätte zu einer genaueren Beschreibung der Untersuchung führen können und somit den Patientenvertretern aufgezeigt, wo das Forschungsinteresse besteht. Dennoch ergaben sich auch durch die Zusagen der Patientenvertreter, welche die Einschlusskriterien nicht erfüllten, informative Gespräche.
Bezogen auf das Anschreiben hätte weiterhin explizit erwähnt werden sollen, dass die Interviews auf Tonband aufgenommen werden sollen, um eine Verweigerung der Tonbandaufnahme beim Interviewtermin zu vermeiden.
Die Wahl des Telefoninterviews zeigte sich grundsätzlich als erfolgreich. Es besteht bei dieser Form jedoch immer die Gefahr, dass Interviewpartner bei persönlichem Kennenlernen und direkter Interaktion noch mehr Informationen preisgeben gegeben hätten. Ein Interviewpartner sprach dieses Vorgehen an und verweigerte aufgrund fehlenden Vertrauens die Tonbandaufzeichnung.
Bei der Durchführung der Interviews wäre an einigen Stellen ein genaueres Nachfragen von Vorteil gewesen. Es konnte festgestellt werden, dass von Termin zu Termin mehr Sicherheit bezüglich der Handhabung des Interviewleitfadens entwickelt wurde. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass die vorab festgelegten Themenbereiche durch die freien Erzählungen der Patientenvertreter um viele weitere Aspekte ergänzt wurden. Es entstanden demnach durch die Gespräche Ideen und Anregungen zu Themengebieten, die noch erfasst werden könnten. Aufgrund der gewünschten Vergleichbarkeit der Interviewinhalte wurde jedoch darauf verzichtet, den Leitfaden im Laufe der Termine zu verändern.
Die bewusste Offenheit der Frage nach der Art Gremium, in das die Patientenvertreter eingebunden sind, führte dazu, dass überwiegend der G-BA genannt wurde. Die erhoffte Nennung weitere Gremien erfolgte nur in wenigen Interviews und bot daher keine Basis für einen indikationsspezifischen Untersuchungsansatz. Bei einer geringen Stichprobe empfiehlt es sich, ein spezifisches Gremium zu benennen und konkrete Patientenvertreter für die Befragung zu rekrutieren. Wenn dabei zusätzlich die Möglichkeit geboten wird, direkt mit Unterstützung des jeweiligen Gremiums an die potentiellen Interviewpartner heran zu treten, vermeidet dies eine breit angelegte Anfrage bei Selbsthilfezusammenschlüssen, die nicht auf politischer Ebene agieren und erleichtert somit das frühzeitige Einhalten der Einschlusskriterien.
Die Abgrenzung der Themengebiete und die genaue Zuordnung zu den vorgegebenen Kategorien erwiesen sich während der systematischen Auswertung in manchen Fällen als schwierig, da die Informationen teilweise schwer zu trennen waren.
Nicht zu vergessen sind die unterschiedlichen Voraussetzungen der Patientenvertreter, die nicht gänzlich ausgeglichen werden können. Unterschiede bestehen bezüglich der Erfahrung in der Vertretung von Patienteninteressen, der Erfahrung in der grundlegenden Selbsthilfearbeit und den verschiedenen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Unterschiedliche Ergebnisse können auch auf die Strukturen der Selbsthilfezusammenschlüsse oder auch auf mögliche Abweichungen zwischen Ehrenamtlichen und Angestellten in der Selbsthilfe zurückzuführen sein.
Die Untersuchung ist vor dem Hintergrund zu bewerten, dass bei einer Anzahl von zehn Interviewpartnern keine empirisch abgesicherten Erkenntnisse ermittelt werden können. Es werden subjektive Einschätzungen ermittelt und Trends aufgezeigt.
6. Fazit und Ausblick
In diesem abschließenden Fazit werden die wichtigsten Aspekte der Arbeit reflektiert sowie die Beantwortung der Forschungsfragen zusammengefasst.
Die durch die vorliegende Arbeit gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass ein Indikationsunterschied zwischen Erkrankungen hoher Prävalenz und Erkrankungen seltener Art auf einige Themengebiete der Befragung zutrifft.
Deutlich zeigt sich jedoch in beiden Kollektiven, dass die Beteiligung im G-BA für die Patientenvertreter eine große Rolle einnimmt. Die dort stattfindende Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und Kostenträgern wird unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Häufig ist sie auf die Erfahrungen in einzelnen Gremien und mit einzelnen Vertretern der anderen Bänke zurückzuführen. Nach Meinung mehrerer Interviewpartner ist bezüglich der Zusammenarbeit jedoch eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Problematisch bleiben für alle Interviewpartner die fehlenden materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen. Für die Patientenvertreter der seltenen Erkrankungen kommt erschwerend hinzu, dass die durch sie vertretene Indikation den anderen Akteuren häufig unbekannt ist. Daraus ergibt sich allgemein ein hoher Stellenwert für die Öffentlichkeitsarbeit.
Die kollektive Patientenbeteiligung im deutschen Gesundheitswesen bringt hohe Anforderungen an die Selbsthilfe mit sich, die häufig zu Lasten der genuinen Aufgaben anfallen. In der Untersuchung zeigte sich ein großes Engagement für die Vertretung von Patienteninteressen seitens der Interviewpartner und ein hohes Vertrauen in ihre eigene Qualifikation und die damit verbundenen Kompetenzen, welche meist auf jahrelange Erfahrung sowohl in der Selbsthilfearbeit als auch im Berufsleben zurückgeführt werden.
Die Frage nach möglichen Optionen zur Verbesserung der kollektiven Patientenbeteiligung an die Patientenvertreter selbst und die Diskussion der Ergebnisse hat bereits mehrere Empfehlungen für die Praxis hervorgebracht. Hervorzuheben ist hier sowohl der formulierte Arbeitsauftrag an die eigenen Reihen als auch die geforderte Unterstützung durch die Dachverbände sowie die weiteren Akteure des Gesundheitswesens. Die Vertreter der seltenen Erkrankung sehen besonders hohen Handlungsbedarf in der Definition der Rolle der Selbsthilfe und einer Positionierung im Gesundheitswesen.
Eine wichtige Rolle spielt weiterhin der Rückhalt innerhalb des eigenen Zusammenschlusses, der jedoch in mehreren Interviews als ausbaufähig beschrieben wird.
Der nächste Schritt in Richtung Weiterentwicklung der Patientenbeteiligung ist das angestrebte Stimmrecht in Verfahrensfragen. Wie beschrieben, bieten aktuell sowohl das Patientenrechtegesetz als auch das GKV-VSG die Möglichkeit, Forderungen zu adressieren.
Die interviewten Patientenvertreter sprechen sich überwiegend für ein Stimmrecht aus, welches sie jedoch an die beschriebenen verbesserten Rahmenbedingungen knüpfen und somit die Ergebnisse bisherigen Studien zu diesem Aspekt untermauern.
Nach Einschätzung der Patientenvertreter verbindet der individuelle Patient die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens nicht mit einer Beteiligung der Patientenvertreter ausgeführt durch die Selbsthilfe. Hier zeigt sich, dass auf Seiten der seltenen Erkrankungen die Einschätzung schlechter ist als auf Seiten der Erkrankungen mit hoher Prävalenz.
Die bestehenden Forschungsarbeiten zur Beteiligung der Selbsthilfe auf politischer Ebene werden durch die vorliegende Untersuchung ergänzt, indem die Patientenvertreter differenziert werden und auf indikationsspezifische Unterschiede eingegangen wird. Weiterhin werden aktuelle Entwicklungen diskutiert und Empfehlungen für die Praxis gegeben.
Das überaus positive Entgegenkommen der zu Beginn kontaktierten Selbsthilfevertreter zeigt, dass diese die Forschung auf dem Gebiet der Selbsthilfe sehr begrüßen und durch ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Forschung aktiv teilhaben wollen. Diese Aufgeschlossenheit bietet eine gute Grundlage für weitere Untersuchungsvorhaben.
Für die Zukunft wünschenswert ist eine strukturierte abgestimmte Forschungslandschaft, die bestehende Ergebnisse miteinander verknüpft und somit eine solide Grundlage für neue Forschungsfragen bildet. Diese Aufgabe der Begleitung, Untersuchung und Unterstützung der Selbsthilfe kann durch die Public Health-Forschung erfüllt werden.
Das Thema der Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen wird weiterhin von Bedeutung bleiben. Doch trotz der Debatte um eine Neustrukturierung des G-BA, die sich nach Erhebung der Interviews intensiviert hat, wird die kollektive Patientenbeteiligung in den aktuellen Gesetzgebungsverfahren nicht explizit thematisiert. Sowohl in den bisherigen Entwürfen des Patientenrechtegesetzes als auch in denen des GKV-VSG findet sie nur wenig Beachtung. Es bleibt abzuwarten, ob konkrete Änderungen verabschiedet werden.
Patienten wollen ihren Einfluss auf das Gesundheitswesen verstärken und benötigen daher eine gefestigte und klar definierte Position neben der Politik, den Leistungserbringern und den Kostenträgern. Die kollektive Patientenbeteiligung bietet hierbei die Chance, die Stimme der Patienten zu stärken. Die Herausforderung lautet, das Gleichgewicht zwischen politischer Beteiligung und der Basisarbeit der Selbsthilfe zu finden. Bei der Wahrnehmung der Interessenvertretung der Patienten im deutschen Gesundheitssystem sollen Betroffenenkompetenz und Professionalität Eigenschaften sein, die sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern ergänzen.
Literaturverzeichnis
Ärzte Zeitung (05.04.2011): Verbraucherschützer wollen im GBA mehr Macht für Patienten, URL: http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/648383/verbraucherschuetzer-wollen-gba-macht-patienten.html [Stand: 06.04.2011].
Angerhausen, Susanne (2006): Das PatientInnennetzwerk NRW, in: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Patientenbeteiligung. Die neue Herausforderung für die Selbsthilfe. Dokumentation einer Fachtagung, KOSKON NRW, Düsseldorf, S. 105-111.
Badura, Bernhardt (2000): Reform des Gesundheitswesens durch Aktivierung der Bürger, Versicherten und Patienten Eine Einführung, in: Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung. Ideen, Ansätze und internationale Erfahrungen, Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 10, BZgA, Köln, S. 34-40.
BAG Selbsthilfe (2011): Stellungnahme der BAG Selbsthilfe zum Antrag der SPD-Fraktion: „Für ein modernes Patientenrechtegesetz“ (BT- DrS 17 /907), URL: http://www.bag-selbsthilfe.de/tl_files/stellungnahme_der_bag_selbsthilfe_patientenrechtegesetz_-_anh._am_26.01.2011.doc [Stand: 02.04.2011].
Bindert, Franz-Josef (2001): Gesundheitspolitische Erwartungen an die Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 139-145.
Björnberg, Arne/Cebolla Garrofé, Beatriz/Lindblad, Sonja (2009): Euro Health Consumer Index 2009, URL: http://www.healthpowerhouse.com/files/Report%20EHCI%202009%20091005%20final%20with%20cover.pdf [Stand: 10.02.2011].
Borgetto, Bernhard (2004): Selbsthilfe und Gesundheit. Analysen, Forschungsergebnisse und Perspektiven in der Schweiz und in Deutschland, Verlag Hans Huber, Bern.
Borgetto, Bernhard (2002): Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland. Stand der Forschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Borgetto, Bernhard (2001): Selbsthilfeforschung in Deutschland, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 13-27.
Bronner, Dorothea (2009): Der Gemeinsame Bundesausschuss und die Gesundheitsreform 2007: Auch künftig Organ der Selbstverwaltung, in: Schroeder, Wolfgang/Paquet, Robert (Hrsg.), Gesundheitsreform 2007, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 211-221.
Bundesministerium der Justiz (2003): Verordnung zur Beteiligung von Patientinnen und Patienten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (Patientenbeteiligungsverordnung – PatBeteiligungsV), URL: http://www.gesetze-im-internet.de/patbeteiligungsv/BJNR275300003.html [Stand:15.01.2011]
Bundesministerium der Justiz (1949): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf [Stand: 01.07.2011].
Bundesministerium für Gesundheit (2011): Referentenentwurf. Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung, URL: http://www.mtd.de/cms/images/stories/referentenentwurf.pdf [Stand: 28.06.2011].
Coulter, Angela (2001): Stärkung des Einflusses von Patienten, Verbrauchern und Bürgern – Die Effektivität politischer Instrumente, in: Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung. Ideen, Ansätze und internationale Erfahrungen, Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 10, BZgA, Köln, S.138-151.
Danner, Martin/Nachtigäller, Christoph/Renner, Andreas (2009): Entwicklungslinien der Gesundheitsselbsthilfe. Erfahrungen aus 40 Jahren BAG SELBSTHILFE, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 01/2009, Springer Verlag, Berlin, S. 3-10.
Danner, Martin (2006): Patientenbeteiligung nach dem GMG, in: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Patientenbeteiligung. Die neue Herausforderung für die Selbsthilfe. Dokumentation einer Fachtagung, KOSKON NRW, Düsseldorf, S. 25-39.
Danner, Martin/Matzat, Jürgen (2005): Patientenbeteiligung beim Gemeinsamen Bundesausschuss – ein erstes Resümee, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch 2005, DAG SHG, Gießen, S.150-154.
Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung/Bundesministerium für Gesundheit/Bundesministerium der Justiz (2011): Grundlagenpapier Patientenrechte in Deutschland, URL: http://www.patientenbeauftragter.de/front_content.php?idart=56 [Stand: 05.04.2011].
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (2011): Stellungnahme der DAG SHG e.V. zum Antrag der Fraktion der SPD BT-Drs. 17/907 „Für ein modernes Patientenrechtegesetz“, URL: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a14/anhoerungen/e_Patientenrecht/Stellungnahmen/17_14_0097_9_.pdf [Stand: 05.04.2011].
Deutscher Bundestag Drucksache 17/5673 (2011): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Birgitt Bender, Dr. Harald Terpe, Elisabeth Scharfenberg. weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/5466, Berlin, URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/056/1705673.pdf [Stand 18.05.2011].
Deutsches Ärzteblatt (22.03.2011): Regierung will Patientenrechte stärken – Eckpunkte für Gesetz, URL: http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/45180/Regierung_will_Patientenrechte_staerken_-_Eckpunkte_fuer_Gesetz.htm [Stand: 05.04.2011].
Dierks, Christian (2011): Good Governance – bitte auch für den G-BA, Ärzte Zeitung, URL: http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/661132/good-governance-bitte-gba.html [Stand: 12.07.2011].
Dierks, Marie-Luise/Seidel, Gabriele/Horch, Kerstin/Schwartz, Friedrich Wilhelm (2006): Bürger- und Patientenorientierung in Deutschland, Gesundheitsberichterstattung für Deutschland, Heft 32, Robert Koch-Institut, Berlin.
Dierks, Marie-Luise/Seidel, Gabriele (2005): Gesundheitsbezogene Selbsthilfe und ihre Kooperationen mit den Akteuren in der gesundheitlichen Versorgung – Ergebnisse einer Telefonbefragung, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch 2005, DAG SHG, Gießen, S. 137-149.
Dierks, Marie-Luise/Schwartz, Friedrich Wilhelm (2003): Patienten, Versicherte, Bürger - die Nutzer des Gesundheitswesen, in: Schwartz, Friedrich Wilhelm/Badura, Bernhard/Busse, Reinhard/Leidl, Reiner/Raspe, Heiner/Siegrist, Johannes et al (Hrsg.), Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen, Urban & Fischer Verlag, München, Jena, S. 314-321.
Dierks, Marie-Luise/Schwartz, Friedrich Wilhelm (2001): Rollenveränderungen durch New Public Health. Vom Patienten zum Konsumenten und Bewerter von Gesundheitsdienstleistungen, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 08/2001, Springer Verlag, Berlin, S. 796-803.
Engelhardt, Hans Dietrich/Kandler, Jakob/Stark, Wolfgang/Wex, Thomas (1995): Qualitativ-Sozialpolitische und Quantitativ-Ökonomische Analysen als Hilfsmittel für sozialpolitische Entscheidungen, in: Engelhardt, Hans Dietrich/Simeth, Angelika/Stark, Wolfgang u.a. (Hrsg.), Was Selbsthilfe leistet… Ökonomische Wirkungen und sozialpolitische Bewertung, Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau, S. 189-200.
Etgeton, Stefan (2009): Patientenbeteiligung in den Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 01/2009, Springer Verlag, Berlin, S. 104-110.
Etgeton, Stefan (2009a): Patientenbeteiligung im Gemeinamen Bundesausschuss, in Schroeder, Wolfgang/Paquet, Robert (Hrsg.), Gesundheitsreform 2007, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 222-228.
Geißler, Jens (2004): Organisierte Vertretung von Patienteninteressen. Patientenorganisationen als gesundheitspolitische Akteure in Deutschland, Großbritannien und den USA, Verlag Dr. Kovac, Hamburg.
GKV-Spitzenverband (2009): Leitfaden zur Selbsthilfeförderung. Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V vom 10. März 2000 in der Fassung vom 6. Oktober 2009, GKV-Spitzenverband, Berlin.
Gläser, Jochen/Laudel, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Grunow, Dieter (2006): Selbsthilfe, in: Hurrelmann, Klaus/Laaser, Ulrich/Razum, Oliver (Hrsg.), Handbuch der Gesundheitswissenschaften, Juventa Verlag, Weinheim, München, S. 1053-107.
Hänlein, Andreas/Schroeder, Wolfgang (2010): Patienteninteressen im deutschen Gesundheitswesen, in: Clement, Ute/Nowak, Jörg/Scherrer, Christoph/Ruß, Sabine (Hrsg.), Public Governance und schwache Interessen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 47-61.
Hart, Dieter (2005): Patientenrechte und Bürgerbeteiligung. Befunde und Perspektiven 2004, in: GGW 1/2005, S. 7-13.
Hart, Dieter (2003): Einbeziehung des Patienten in das Gesundheitssystem, in: Schwartz, Friedrich Wilhelm/Badura, Bernhard/Busse, Reinhard/Leidl, Reiner/Raspe, Heiner./Siegrist, Johannes et al (Hrsg.), Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen, Urban & Fischer Verlag, München und Jena, S. 333-339.
Heberlein, Ingo (2005): Die Aufgabenstellung des Gemeinsamen Bundesausschusses und die Rolle der Patientenvertretung, in: Jahrbuch für kritische Medizin 42, Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen, Argument Verlag, Hamburg, S. 64-77.
Hundertmark-Mayser, Jutta/Möller, Bettina/Ballke, Klaus/Thiel, Wolfgang (2004): Selbsthilfe im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 23, Robert Koch-Institut, Berlin.
Janota, Bernd (2007): Neue Anforderungen an die Selbsthilfe – oder: Ein Tag im Leben von Frau Hellmann, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch 2007, DAG SHG, Gießen, S. 71-80.
Kaufmann, Franz-Xaver (2010): Selbsthilfe und Wohlfahrtsstaat, in: Dahme, Heinz-Jürgen/Wohlfahrt, Norbert (Hrsg.), Systemanalyse als politische Reformstrategie, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 228-240.
Köster, Gudrun (2005): Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss, in: Jahrbuch für kritische Medizin 42, Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen, Argument Verlag, Hamburg, S. 78-90.
Kolb-Specht, Irene (2006): Bürgerorientierung und –beteiligung im Gesundheitswesen: Vom Wollen und Können… - Erfahrungen aus Baden-Württemberg mit der Patientenbeteiligung nach § 140f SGB V, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch 2006, DAG SHG, Gießen, S. 132-138.
Krause, Ulla/Rothgang, Heinz (2005): Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozessen im Gesundheitssystem, in: Helmert, Uwe/Schumann, Helge/Jansen-Bitter, Hildegard (Hrsg.), Souveräne Patienten? Die Wiederentdeckung des Patienten im 21. Jahrhundert, MaroVerlag, Augsburg, S. 189-209.
Markenstein, Loes F. (2001): Verbesserung der Bürger- und Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen – Konzepte und Schlüsselthemen, in: Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung. Ideen, Ansätze und internationale Erfahrungen, Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 10, BZgA, Köln, S. 82-89.
Matzat, Jürgen (2009): Selbsthilfebewegung und Psychotherapie, in: Psychotherapie im Dialog (PiD), 4/2009, S. 347-352.
Matzat, Jürgen (2001): Freiburger Thesen: Zu den Entwicklungsperspektiven für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 90-107.
Mayring, Philipp (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Beltz Verlag, Weinheim.
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung, Beltz Verlag, Weinheim.
Meinhardt, Michael/Plamper, Evelyn/Brunner, Helmut (2009): Beteiligung von Patientenvertretern im Gemeinsamen Bundesausschuss. Ergebnisse einer qualitativen Befragung, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 01/2009, Springer Verlag, Berlin, S. 96-103.
Nachtigäller, Christoph (2001): Entwicklungsbedarf und Entwicklungsperspektiven für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen aus der Sicht der Selbsthilfe, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 96-107.
Nestmann, Lawrence (2001): Bürger- und Patientenbeteiligung als Notwendigkeit für sinnvolle Veränderungen, in: Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung. Ideen, Ansätze und internationale Erfahrungen, Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 10, BZgA, Köln, S. 196- 199.
Pitschas, Rainer (2006): Mediatisierte Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss als Verfassungsproblem, in: MedR, Heft 8, S. 451- 457.
Plamper, Evelyn/Meinhardt, Michael (2008): Patientenvertreterbeteiligung an Entscheidungen über Versorgungsleistungen in Deutschland. Die Perspektive der Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss und der Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 01/2008, Springer Verlag, Berlin, S. 81-88.
Rieser, Sabine (2000): Patientenvertreter: Wie findet man die Richtigen?, Deutsches Ärzteblatt, URL: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&id=25340&p= [Stand: 01.03.2011].
Rosenbrock, Rolf/Gerlinger, Thomas (2006): Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung, Verlag Hans Huber, Bern.
Rosenbrock, Rolf (2001): Funktionen und Perspektiven gesundheitsbezogener Selbsthilfe im deutschen Gesundheitssystem, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von (Hrsg.), Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 28-40.
Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2002): Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Bd 1. Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation. Gutachten 2000/2001, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Schimmelpfeng-Schütte, Ruth (2006): Die Zeit ist reif für mehr Demokratie in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Konzept für eine kollektive Entscheidungsbeteiligung der Versicherten im Gemeinsamen Bundesausschuss, in: MedR 2006, Heft 1, S. 21-25.
Schmacke, Norbert/Müller, Veronika E./Richter, Petra/Stamer, Maren (2009): Ethik und Datenschutz im Kontext qualitativer Forschung – Konzept der Arbeits- und Koordinierungsstelle Gesundheitsversorgungsforschung (AKG) im Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt Bremen e.V., URL: http://www.akg.uni-bremen.de/downloads/Ethik_und_Datenschutz.pdf [Stand: 28.02.2011].
Schroeder, Wolfgang (2009): Soziale Selbstverwaltung: Von der klassischen Beteiligungs- zur professionalisierten Effizienzsituation?, in: Schroeder, Wolfgang/Paquet, Robert (Hrsg.), Gesundheitsreform 2007, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 188-197.
Spitzenorganisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe (2009): Erfahrungen der Selbsthilfe mit der Umsetzung der Neuregelung der Selbsthilfeförderung der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20c SGB V, URL: http://www.dag-selbsthilfegruppen.de/site/data/DAGSHG/Umsetzung20cDAGSHG-DHS-BGS-PARI-2009-05-29.pdf [Stand: 08.03.2011].
Stark, Wolfgang (2001): Selbsthilfe und Patientenorientierung im Gesundheitswesen – Abschied von der Spaltung zwischen Professionellen und Selbsthilfe?, in: Borgetto, Bernhard/Troschke, Jürgen von, Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen, Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheitswissenschaften, Freiburg, S. 47-66.
Steinmeier, Frank-Walter und Fraktion (2010): Für ein modernes Patientenrechtegesetz, Drucksache 17/907, URL: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a14/be_b/Dokumente/1705227_Patientenrechteegsetz_vom_23022011_BT-Drs_17_00907.pdf [Stand: 04.04.2011].
Stötzner, Karin (2004): Selbsthilfeunterstützung und Patientenbeteiligung, in: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.), Selbsthilfegruppenjahrbuch 2004, DAG SHG, Gießen, S. 136-145.
Trojan, Alf (2003): Der Patient im Versorgungsgeschehen: Laienpotential und Gesundheitsselbsthilfe, in: Schwartz, Friedrich Wilhelm/Badura, Bernhard/Busse, Reinhard/Leidl, Reiner/Raspe, Heiner./Siegrist, Johannes et al (Hrsg.), Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen, Urban & Fischer Verlag, München, Jena, S. 321-333.
Trojan, Alf/Deneke, Christiane/Behrendt, Jörn-Uwe/Itzwerth, Ralf (1986): Die Ohnmacht ist nicht total. Persönliches und Politisches über die Selbsthilfegruppen und ihre Entstehung, in: Trojan, Alf (Hrsg.), Wissen ist Macht, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 12-85.
Vienonen, Mikko A. (2001): Von einer Ethik der Ignoranz hin zur Bürgerbeteiligung, in: Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung. Ideen, Ansätze und internationale Erfahrungen, Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 10, BZgA, Köln, S. 58- 64.
Weltgesundheitsorganisation (1994): A Declaration on the Promotion of Patients´ Rights in Europe, URL: http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf [Stand: 30.03.2011].
Weltgesundheitsorganisation (1946): Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.810.1.de.pdf [Stand: 10.02.2011].
Anhang 1: Anschreiben Interviewpartner
Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau,
ich bin Studentin der Gesundheitswissenschaften an der Medizinischen Hochschule Hannover und derzeit Praktikantin in der Abteilung Patient Relations des forschenden Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline.
Mit der fachlichen Unterstützung meiner Professorin Marie-Luise Dierks, deren Begleitschreiben Sie im Anhang finden können, arbeite ich aktuell an der Erstellung meiner Magisterarbeit mit dem Thema „Beteiligungsmöglichkeiten an gesundheitspolitischen Prozessen als Herausforderung für die Selbsthilfe“. Hierfür möchte ich qualitative Telefoninterviews mit Patientenvertretern durchführen, die aktiv in politischen Gremien, wie beispielsweise dem Gemeinsamen Bundesausschuss, der Bundesärztekammer oder dem Bundesministerium für Gesundheit, beteiligt sind. Ziel der Arbeit ist es die Einschätzung der Patientenvertreter zu ihrer Beteiligung an gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen zu ermitteln und diese auf indikationsspezifische Unterschiede zu untersuchen.
Die Dauer des Interviews wird auf ca. 45 Minuten eingeschätzt. Die gewonnen Daten werden im Anschluss selbstverständlich anonymisiert und systematisch ausgewertet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie selbst für ein Interview zur Verfügung stehen würden oder mir einen anderweitigen Ansprechpartner nennen könnten.
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Anne Kathrin Simon
Anhang 2: Begleitschreiben von Frau Professor Dierks
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang 3: Leitfadeninterview
Leitfadeninterview
Vorab:
- Vorstellen
- Erklären, wozu das Interview dient
- Datenschutz zusichern und Einverständniserklärung dazu einholen
- Erlaubnis für Tonbandaufnahme einholen
Demografische Daten:
Geschlecht
Geburtsjahr
Schulabschluss
Beruf
Ehrenamtliche Tätigkeit oder Anstellung in der Organisation
1. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über Ihre Tätigkeit in der Selbsthilfe.
Intention der Frage:
- „Eisbrecher“-Funktion
- Einleitende Frage, die nicht negativ behaftet ist
- Personen und ihre Funktion einordnen und später vergleichen können
- Offene Frage, um dem Interviewten frei assoziieren zu lassen
Weitere Fragen, die gestellt werden, wenn Interviewter nicht vorab von allein darauf eingegangen ist:
- Welche Funktion erfüllen Sie in Ihrer Organisation?
- Welche Aufgaben sind mit dieser Funktion verbunden?
- Über welche Erfahrungen verfügen Sie auf diesem Gebiet?
2. In welcher Form sind Sie und Ihre Organisation in gesundheitspolitische Institutionen eingebunden?
Intention der Frage:
- Analysieren auf welche politische Einbindung und auf welche Institution der Fokus gelegt wird und wie über diese Einbindung berichtet wird
Weitere Fragen:
- In welche Institutionen sind Sie eingebunden und seit wann? Beispiele: G-BA, BÄK, BMG (Bundes-, Landes-, Kommunalebene)
- Wie erleben Sie diese Einbindung?
- Wie funktioniert Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und Kostenträgern?
- Welche Vor- und Nachteile sehen Sie?
3. Wie wirkt sich die politische Einbindung auf Ihre Arbeit in der eigenen Organisation aus?
Intention der Frage:
- Belastung eruieren
- Herausfinden, ob und wo Probleme bestehen und wem diese zugeschrieben werden
Weitere Fragen:
- Wie lässt sich die politische Arbeit mit Ihren grundlegenden Aufgaben in der Organisation vereinbaren?
- Welchen Stellenwert hat die politische Einbindung für sie (für Organisation aber auch persönlich)?
- Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Vereinbarkeit beider Aufgaben?
4. Wie qualifiziert fühlen Sie sich in ihrer Rolle als Patientenvertreter in politischen Institutionen?
Intention der Frage:
- Eigene Kompetenz ermitteln und einschätzen
- Wahrnehmung der eigenen Rolle
Weitere Fragen:
- Fühlen Sie sich in der Wahrnehmung dieser Aufgabe sicher?
- Worauf basiert ihre Kompetenz?
- Welche Unterstützung erhalten Sie und von wem (eigene Organisation, BAG Selbsthilfe, Stabstelle Patientenbeteiligung)?
- Welche Unterstützung würden Sie sich von wem wünschen? Wo könnte die Qualifizierung erfolgen?
- Wo besteht Ihrer Ansicht nach Qualifizierungsbedarf? Welche Themengebiete?
5. Wie könnte aus ihrer Sicht die Einbindung von Patientenvertretern in politische Institutionen verbessert werden?
Intention der Frage:
- Anregungen für die zukünftige Gestaltung von kollektiver Patientenbeteiligung zusammentragen
- Kritik erfassen
Weitere Fragen:
- Wie kann eine Weiterentwicklung der Beteiligungsoptionen gestaltet werden?
- Haben Sie Wünsche und Verbesserungsvorschläge?
- Was halten Sie von dem geplanten Patientenrechtegesetz?
- Wie stehen Sie zu der Diskussion um ein Stimmrecht für Patientenvertreter?
6. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die politische Beteiligung der Selbsthilfe auf die Situation der Patienten in Deutschland aus?
Intention der Frage:
- Sichtweise zum Erfolg der eigenen Arbeit eruieren
Weitere Fragen:
- Welche Erfolge und Misserfolge ließen sich in der Vergangenheit verzeichnen?
- Welche Auswirkungen kann der individuelle Patient spüren?
Erläuterungen zum Leitfadeninterview:
Zu Beginn des Interviews erfolgt eine standardisierte Einleitung, um zu gewährleisten, dass alle Interviews unter gleichen Voraussetzungen geführt werden und alle Interviewpartner die gleichen Instruktionen erhalten.
Die weiteren Fragen decken die Aspekte ab, die erfasst werden sollen. Das Nachfragen erfolgt demnach nur, wenn der Interviewte nicht von selber auf diese Punkte eingeht.
Mögliche Aufrechterhaltungsfragen:
- Können Sie das näher beschreiben? Wie war das …? Wie erleben Sie das …?
- Was bringen Sie noch mit diesem Aspekt in Verbindung?
- Wie genau darf ich mir das vorstellen?
[...]
[1] Aus Gründen des Leseflusses wird ausschließlich die maskuline Form verwendet, was in keinem Fall der Diskriminierung dienen soll.
[2] ehemals Bundesarbeitsgemeinschaft für Behinderte e.V. (BAGH)
[3] angesiedelt am Universitätsklinikum Giessen und Marburg
[4] Eine ausführliche Beschreibung der Institutionen der Patientenunterstützung findet sich bei Schienkiewitz, Anja/Dierks, Marie-Luise (2001): Beratungseinrichtungen, Patientenorganisationen und Verbraucherschutz, in: Dierks, Marie-Luise/Bitzer, Eva-Maria/Lerch, Magnus u.a. (Hrsg.), Patientensouveränität. Der autonome Patient im Mittelpunkt. Arbeitsbericht Nr. 195 der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart, S. 179-194.
[5] Stand: 10.03.2011, URL: http://www.achse-online.de/
[6] Stand 2009
[7] Eine ausführliche Betrachtung einzelner Rollen findet sich bei Dierks, Marie-Luise/Schwartz, Friedrich Wilhelm (2001): Rollenveränderungen durch New Public Health Vom Patienten zum Konsumenten und Bewerter von Gesundheitsdienstleistungen, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 08/2001, Springer Verlag, Berlin, S. 796-803.
[8] Vollständiges Gutachten: Hart, Dieter/ Francke, Robert (2002): Patientenrechte und Bürgerbeteiligung. Bestand und Perspektiven, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 01/ 2002, Springer Verlag, Berlin, S. 13-20.
[9] Um den aktuellsten Stand zur Beschreibung der benannten Organisationen wiederzugeben, basieren die folgenden Ausführungen auf der jeweiligen Internetpräsenz.
[10] http://www.deutscher-behindertenrat.de/ [Stand: 22.02.2011].
[11] http://www.gesundheits.de/bagp/ [Stand: 22.02.2011].
[12] http://www.dag-shg.de/site/ [Stand: 22.02.2011].
[13] Koordination für Selbsthilfekontaktstellen in Nordrhein-Westfalen (KOSKON), Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Gießen und Selbsthilfe-Büro Niedersachsen
[14] http://www.vzbv.de/go/ [Stand: 22.02.2011].
[15] Fachbereich 1: Finanzdienstleistungen; Fachbereich 2: Bauen, Energie, Umwelt; Fachbereich 4: Wirtschaft und Internationales; Fachbereich 5: Infrastruktur; Fachbereich 6: Kommunikation
[16] Weitere Inhalte des Grundlagenpapiers unter: Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung/Bundesministerium für Gesundheit/Bundesministerium der Justiz 2011: 2-8.
[17] Zum Zeitpunkt der Aussage noch Vizepräsident, seit Juni 2011 ist Ulrich Montgomery Vorsitzender der BÄK.
[18] Eine weitere Tabelle zeigt die Ad-hoc-Beteiligung von Patientenvertretern und –vertreterinnen: Dierks u. a. 2006: 9.
[19] Aktuelle Zahlen wurden der Homepage der ACHSE entnommen, URL: http://www.achse-online.de/cms/die_achse/warumachse/ warumachse.php. [Stand: 13.03.2011].
[20] Stand 2010
[21] http://www.nakos.de/site/adressen/gruen/ [Stand: 20.03.2011].
[22] Anschreiben und Begleitschreiben sind bitte dem Anhang zu entnehmen.
[23] Die ausformulierten Fragen sind bitte dem Leitfadeninterview im Anhang zu entnehmen.
[24] Die Zitate werden durch in Klammern gesetzte Kürzel des Befragten und Zeilenangabe dem entsprechenden Interviewpartner und der jeweiligen Textstelle zugeordnet.
[25] beliebige Reihenfolge
[26] Weitere Inhalte des Referentenentwurfes unter: Bundesministerium für Gesundheit (2011): Referentenentwurf. Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung, URL: http://www.mtd.de/cms/images/stories/referentenentwurf.pdf.
[27] Die Professionalisierung der Selbsthilfe ist ein umfassendes Themengebiet, das im Rahmen dieser Magisterarbeit nicht näher untersucht werden kann.
- Arbeit zitieren
- Anne Kathrin Simon (Autor:in)Marie-Luise Dierks (Reihenherausgeber:in)Gabriele Seidel (Reihenherausgeber:in), 2011, Beteiligungsmöglichkeiten an gesundheitspolitischen Prozessen als Herausforderung für die Selbsthilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183757
Kostenlos Autor werden




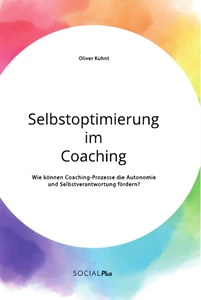









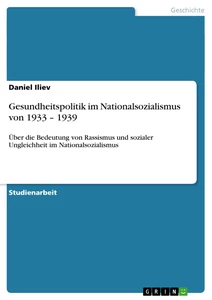







Kommentare
Hallo Anne Kathrin, vielen Dank für Deine schöne Arbeit, bin erst x nur drüber geflogen, vielen Dank!
An Deiner Stelle würde ich sie jedoch nicht verschenken. Du hast ne Menge Arbeit gehabt, lass es Dir entlohnen! ;o))
Lieben Gruß, Andrea