Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
0 Einleitung
1 Frauen und Kunst
1.1 Historische und ästhetische Dimension
1.1.1 Künstlerinnen auf dem Weg ins 20. Jahrhundert
1.1.1.1 Bildende Künstlerinnen in der Gesellschaft
1.1.1.2 Studienbedingungen
1.1.1.3 Arbeitskultur
1.1.1.4 Kunst als Ausdruck männlicher Dominanz
1.1.1.5 Künstlermythos
1.2 Feministische und Ästhetische Dimension
1.2.1 Künstlerinnen im 20. Jahrhundert
1.2.1.1 Die Feministische Welle der 1960er und 1970er Jahre
1.2.1.2 Kunst und Feminismus nach
1.2.2 Künstlerinnen im 21. Jahrhundert
1.2.2.1 Feministische Kunstwissenschaften
1.2.2.2 Die Problematik des LABELS „Feministische Kunst“
1.2.2.3 Die Bedeutung weiblicher Kunst
1.2.2.4 Studienbedingungen
1.2.2.5 Arbeitsbedingungen
1.2.2.6 Marktwert
1.3 Politische und Ökonomische Dimension
1.3.1 Beruf Künstler und Prekariat
1.3.2 Politische Instrumente
1.3.2.1 Gender Mainstreaming
1.3.2.2 Sozialpolitik
1.3.2.3 Familienpolitik
1.3.2.4 Stiftungen
1.3.3 Ökonomische Realität
2 Der Kunstmarkt
2.1 Marktmacht und Kanonisierungseffekte
2.2 Bedeutung weiblicher Kunst als Ware
2.3 Der Primärmarkt
2.3.1 Künstler und Künstlerinnen
2.3.2 Sammler
2.3.3 Galeristen
2.3.4 Art Consultants
2.3.5 Kunstkritiker
2.3.6 Künstlerische Bildungsstätten
2.3.6.1 Lehrende
2.3.6.2 Studenten
2.4 Der Sekundärmarkt
2.4.1 Museen
2.4.1.1 Museumsauftrag und –erfüllung
2.4.1.2 Museumspolitik und Gender
2.4.1.3 Museum und Markt
2.4.1.4 Feministischer Sonderweg - Frauenmuseen
2.4.2 Stiftungen, Preise und Stipendien
2.4.3 Messen
2.4.4 Auktionshäuser
3 Expositionskultur von Künstlerinnen in Berlin im 21. Jahrhundert
3.1 Berlin – Metropole Zeitgenössischer Kunst
3.1.1 Expositionskultur in Berlin
3.2 Methodischer Vorgang
3.3 Untersuchungsobjekte, Evaluation und Auswertung
3.3.1 Staatliches Museum
3.3.1.1 Der Hamburger Bahnhof
3.3.2 Landesmuseum
3.3.2.1 Die Berlinische Galerie
3.3.3 Stiftungsprojekt
3.3.3.1 Die Temporäre Kunsthalle
3.3.4 Kunstvereine
3.3.4.1 KW – Kunstwerke
3.3.4.2 NGBK – Neue Gesellschaft für Bildende Kunst e.V
4 Diskussion und Resümee
III. Literatur- und Quellenverzeichnis
IV. Anhang
Eidesstattliche Erklärung
I. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II. Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ausstellungen nach Beteiligung in % im Hamburger Bahnhof 2000-2010
Tab. 2: Ausstellungen nach Beteiligung in % in der Berlinischen Galerie 2004-2010
Tab. 3: Ausstellungen nach Beteiligung in % in der Temporären Kunsthalle 2008-2010
Tab. 4: Ausstellungen nach Beteiligung in % in den KW 2000-2010
Tab. 5: Ausstellungen nach Beteiligung in % in der NGBK 2000-2010
Abstract
Zur Einführung in die Thematik und die Problemstellung, auf denen die vorliegende Masterarbeit basiert, seien an dieser Stelle einige Thesen und Bemerkungen formuliert. Des weiteren sollen die Museumslandschaft Berlins und die entsprechenden Untersuchungsgegenstände kurz erläutert werden.
Gegenstand der vorliegenden Masterarbeit ist die Untersuchung von Ausstellungen Zeitgenössischer Kunst im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2010 im Hinblick auf die Beteiligung von Künstlerinnen. Untersuchungsfeld ist die Metropole für Zeitgenössische Kunst, Berlin. Untersuchungsobjekte sind das staatliche Museum: Der Hamburger Bahnhof – Museum für die Kunst der Gegenwart, das Landesmuseum: Die Berlinische Galerie, das stiftungsgeförderte Kuratorenprojekt: die zwischen 2008 und 2010 existierende Temporäre Kunsthalle sowie zwei nicht-staatliche Institutionen, zum einen die KW - Kunstwerke und die NGBK – Neue Gesellschaft für Bildende Kunst.
Ausgangsthese ist hierbei, dass Zeitgenössische Kunst von Künstlerinnen in entsprechenden Museen und Institutionen unterrepräsentiert ist. Obwohl die Studiengänge der Bildenden Kunst überwiegend von Frauen besucht werden, ist die Expositionskultur männlich dominiert. Künstlerinnen haben im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen Schwierigkeiten, nach dem Studium in den Arbeitsmarkt einzusteigen und angemessen vertreten zu werden. Im Besonderen sind hierbei mehrere Thesen anzuführen. Zum einen ist Kunstgeschichte geprägt vom Mythos des Genies (Berger, 1982). Dieses Klischee ist männlich besetzt, was dazu führt, dass Künstlerinnen noch immer nicht ernst genommen werden. Zum anderen stellen erfolgreiche Künstlerinnen eine Ausnahme dar, die somit die Regel der erfolglosen Künstlerinnen bestätigt, sowie die darauf aufbauende These, dass erfolgreiche Künstlerinnen durch den Stil der Appropriation Art männliche Kunststile kopieren (Graw, 2003), vordergründig, um inhaltlich die Vorbehalte gegenüber weiblicher Kunst auszuräumen. All diese Thesen sind mit der feministischen Kunsttheorie des 20. Jahrhundert verbunden, die als Basis für die zeitgenössische wissenschaftliche Auseinandersetzung dient und Deutungsmuster zulässt.
In die Analyse flossen statistische Werte aus den Jahren 1995 - 2000 ein, die der Deutsche Kulturrat zum Thema „Frauen in Kunst und Kultur“ im Jahre 2001 veröffentlichte und die die verschiedenen Ebenen und Marktteilnehmer des Kunstsystems in den Fokus nahm. Hierauf beruhen viele Anstöße für die Interpretation der Auswertung der untersuchten Museen bzw. Institutionen.
Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl politischer Mittel, welche die Gleichstellung der Frau zum Ziel haben und deren Wirkungsmacht in der vorliegenden Arbeit an den Institutionen Zeitgenössischer Kunst untersucht werden sollen. Ausgangsthese hierbei ist, dass sich durch die politischen Instrumente ein Wandel in der Gesellschaft vollzieht, der in allen Bereichen des Lebens einen Paradigmenwechsel hin zur Gleichberechtigung der Geschlechter möglich macht. Im Besonderen sei hier die Möglichkeit zu nennen, dass durch die vermehrte Präsenz von Frauen in den Führungsebenen, und so auch in den Museen, aber auch durch den Wandel des gesellschaftlichen Geschlechterkonsens die Förderungsintensität für Frauen automatisch zunimmt.
0 Einleitung
Die ,feministische Welle’ der 1970er Jahre hat den entscheidenden Anstoß für die Veränderung der Stellung der Frau in der Gesellschaft gegeben. Ihre Nachwirkungen auf dem Weg in eine gleichberechtigte Zukunft sind heute an den um die Jahrtausendwende getroffenen politischen Entscheidungen zur Förderung und Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen des Leben ablesbar. Diese wiederum haben alte Geschlechterrollen und Ressentiments aufgeweicht und schaffen heute für Künstlerinnen ein Klima in dem selbstbestimmte Entfaltung und Ausübung ihrer Profession in Koordination von Familie und Beruf möglich ist. Im Kunstmarkt weisen Ausstellungen wie „Elle“, von 2008 bis 2011 im Centre Pompidou in Paris, die ihren Fokus ganz auf die in den Sammlungsbeständen enthaltenen Arbeiten von Künstlerinnen legte, in diese Richtung.
Feministischer Aktionismus in den 1970er Jahren war – zumindest was die Kunst angeht - der erste Akt zum Wandel der Geschlechterverhältnisse; denn noch wurde Kunst von Frauen unterbewertet und Künstlerinnen folgten den männlichen Leitbildern, um Anerkennung und Erfolg haben zu können. In den 1980er Jahren geriet der Kunstmarkt in die Spirale der marktpolitischen Abhängigkeiten und der Konkurrenzdruck verschärfte das Verhältnis zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Nachdem der Geschlechterkampf stagnierte, lenkten 1985 die Guerilla Girls als Projektgruppe zur Publikation der Differenz von ausgestellten Künstlerinnen und abgebildeten Frauen im Museum of Modern Art, New York (MoMA) erneut den Blick auf dieses Thema. Das ausgehende und das neue Jahrtausend brachten neben den politischen Entwicklungen für eine Gleichberechtigung der Geschlechter auch provokante Thesen zur erneuten Rückbesinnung auf „traditionelle Rollen“[1]. Im Zuge der Abwendung vom negativ konnotierten Begriff ‚Feminismus’, hin zu dem so genannten „Cooling out“[2] und der Forderung nach einem neuen ‚Feminismus’ im Zusammenhang mit der Quoten-Debatte, stellt sich die Frage, inwieweit die gesellschaftspolitischen Ansätze für Künstlerinnen zu einer Veränderung der Marktbedingungen geführt haben und wie sich diese in der Ausstellungskultur widerspiegeln. Eine umfassende Erhebung von Daten, die die Bereiche aller Kunstmarktteilnehmer und –faktoren betrifft, wie etwa Hochschulen, Galerien, Kunstpreise, Sammlungen, Messen und Auktionen, wäre nötig, um ein aussagefähiges Bild der komplexen Gesamtsituation zu zeichnen, was jedoch im Zuge des Umfangs vorliegender Arbeit nicht zu bewältigen ist. In der Analyse der gewählten Institutionen hoffe ich jedoch, einen Einblick in die Verbindung von Politik und Kunstmarkt geben zu können, der die besonderen Marktfaktoren beleuchtet und Aufschlüsse über marktinhärente Konditionen zulässt, damit aus diesen Daten konstruktive Mittel zur Förderung für Künstlerinnen erwachsen und der geschlechterbezogenen Debatte neue Anstöße gegeben werden können.
1 Frauen und Kunst
1.1 Historische und ästhetische Dimension
1.1.1 Künstlerinnen auf dem Weg ins 20. Jahrhundert
1.1.1.1 Bildende Künstlerinnen in der Gesellschaft
Künstlerinnen im 19. und 20. Jahrhundert hatten in ihrer Berufswahl eine ungleich schwierige Entscheidung zu treffen. Allein die Tatsache in der biologischen und sozialen Rolle der Frau geboren zu sein, bedeutete zu diesem Zeitpunkt ein limitiertes Leben im Hinblick auf Selbstbestimmung, Freiheit, gesellschaftlicher Anerkennung und wirtschaftlichem Auskommen. Die Stellung und die Rolle der Frau waren gesellschaftlich normiert und bekamen durch die patriarchal geprägte Gesellschaftsstruktur ihre Legitimation; so bemerkte Karl Scheffler 1938: „In der Geschichte hat die Frau zu keiner Zeit eine Rolle als produktive Künstlerin gespielt. Das alleine wäre schon ein entscheidendes Argument.“[3]. Damit betont er die Unzulänglichkeit von Frauen als Künstlerinnen.
Weibliche Stimmen, die sich äußerten, waren selten bzw. blieben ungehört, wie in Carol Duncans Beschreibung der europäischen Avantgarde erkennbar wird:
„Already in the late nineteenth century, European high culture was disposed to regard the male-female relationship as the central problem of human existence. The art and literature of the time is marked by an extraordinary preoccupation with the character of love and the nature of sexual desire. But while a progressive literature and theater gave expression to feminist voices, vanguard painting continued to be largely a male preserve.(...) serious and profound art –and not simply erotive art- is likely to be about what men think of women.“[4]
Im Folgenden soll speziell auf die Umweltbedingungen für Künstlerinnen zu dieser Zeit eingegangen werden, um die historischen Umstände darzustellen, die wiederum Einfluss auf das Bild von zeitgenössischen Künstlerinnen haben und zur Analyse herangezogen werden können.
1.1.1.2 Studienbedingungen
Betrachten wir historische Zeugnisse, die in ihren Ansichten und Meinungen auf unsere Zeit nachwirken und als Erklärungsmuster für die Entwicklung bis zum jetzigen Stand verweisen, wird deutlich, dass sich Kunst in der Gesellschaft als Männerdomäne behaupten konnte. So schreibt Karl Scheffler 1938: „(...) die Kunst ist vom Mann für den Mann gemacht; sie konnte nur entstehen, weil die männliche Einseitigkeit ihrer als Medium zur Harmonie bedarf.“[5] Und weiter: „In einem Amazonenstaate könnte es weder Kultur, Geschichte noch Kunst geben. Denn der Frau ist die Kunst nicht notwendig.“[6]
Eng verknüpft hat Scheffler seine Theorien auch mit dem Ansatz, dass Frauen männlichen Vorbildern nacheifern, der in Teil 1.2.1.1 Die feministische Welle der 1960er und 1970er Jahre bezüglich der Theorie der Appropriation Art von Isabel Graw nochmals interessant werden wird: „Zwingt sie sich zur Kunstarbeit, so wird sie gleich männisch. Das heißt: sie verrenkt ihr Geschlecht, opfert ihre Harmonie und gibt damit jede Möglichkeit aus der Hand, original zu sein.“[7]
Betrachtet man diese Sicht der Dinge, nimmt es nicht Wunder, dass es um die Studienbedingungen für Frauen im ausgehenden 19. Jahrhundert mehr als schlecht bestellt war. So wurden Frauen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu kunstgewerblichen Schulungen zugelassen. Auch die Reputation der Arbeiten war negativ gefärbt. So war die Rede von „Putzsucht, Beschäftigungswut, unersättlichem Vergnügen am Dekorieren“[8], u.ä. Wie dieses Faktum noch in der Moderne nachwirkt, zeigt ein Gespräch zwischen Künstlerinnen in Berlin aus dem Jahr 1989, in denen eine Künstlerin darauf hinweist, wie sehr die hochschulinterne Stimmung männlich dominiert war: „Kunst ist etwas für Männer, aber ausgesprochen hat es niemand.“[9]
Diese Entwicklung ist zunächst auf die beschränkten Studienaufnahmemodi zurückzuführen:
„In allen europäischen Staaten war den Frauen bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts der Zugang zum Studium an den Kunstakademien verwehrt. In Ausnahmefällen erhielten sie Sondergenehmigungen, die dann wiederum mit zusätzlichen Behinderungen einhergingen, von denen männliche Künstler nicht betroffen waren. Künstlerinnen, die während dieser 400jährigen Epoche (...) zu Ansehen gelangten (...), wurden zu einem Mann (Meister) in die Lehre gegeben.“[10]
Trotz der allmählichen Öffnung der Hochschulen für Frauen war künstlerischer Erfolg für diese unerwünscht und wurde erfolgreich verhindert, indem Frauen nicht zum Aktstudium zugelassen wurden, welches einen Maler jedoch erst den Meisterstatus erreichen ließ. Wie Renate Berger in ihrer Sozialgeschichte über Künstlerinnen zur Jahrhundertwende beschreibt, war Frauen der Zugang zu künstlerischem Erfolg trotz der Öffnung von Kunstakademien und privaten Kunstschulen nicht möglich. „Darüber hinaus waren sie aufgrund dessen, was für ihr Geschlecht als schicklich galt, auf bestimmte Gattungen der Kunst festgelegt - so vor allem auf die Malerei, bevorzugter Weise auf kleinformatige Porträts, Genreszenen, Andachtsbilder und Stillleben. Die sowohl hinsichtlich persönlicher Reputation als auch kommerziell erfolgreichste Gattung, die Historienmalerei, blieb im Wesentlichen Metier der Männer, denn Künstlerinnen fehlte dafür entscheidende Voraussetzung: das Aktstudium, von dem sie (...) aus moralischen Gründen weiter ausgeschlossen waren.“[11]
Für die emanzipatorischen Schübe, die die Kontroverse zwischen den Geschlechtern um die Jahrhundertwende antrieben und schließlich zur Gründung von Damen-Akademien führten und die Berufswahl ,Künstlerin’ greifbarer scheinen ließen, spricht auch die Gründung des „Vereins der Künstlerinnen zu Berlin“, der in einer Ausstellung von 1929 mit dem Thema „Die Frau von Heute“ die Porträtmalerei wieder aufleben lassen wollte. Besonders wichtig war dabei die Betonung der Unterschiedlichkeit des Blickes der Frau, nämlich der Malerin, auf die Frau im Gegensatz zum Blick der männlichen Maler auf die von ihm Porträtierten, der zur „schmeichelnden Erotik“[12] neigte.
Ellen Spickernagel fasst dies zusammen, indem sie den „(...) von Männern beherrschten Wissenschafts- und Ausbildungsbetrieb (...)“[13] betont, der auf institutioneller Ebene den Erfolg von Frauen verhinderte und damit auch die Darstellung und Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft einschränkte. Linda Nochlin erweitert dies in ihrem Essay um die ideologische Ebene, die den männlichen Geniekult behandelt, auf den in 1.1.1.4 Kunst als Ausdruck männlicher Dominanz noch näher eingegangen wird.
1.1.1.3 Arbeitskultur
Solange Frauen nicht gleichberechtigt sind und auch in ihrer Arbeit nicht anerkannt werden, kann und wird es kein Umdenken auf gesellschaftlicher Ebene und somit in der Unternehmenskultur geben. Daran anknüpfend erfolgt eine Darstellung zur Wertschätzung von Frauen als Künstlerinnen um 1900, deren Eindruck die Entwicklung der Arbeitskultur von Frauen geprägt hat. Hierzu sei an dieser Stelle nochmals Scheffler zitiert: Die Frau solle „vor allem nicht glauben, es auch als schöpferische Gestalterin dem Manne gleich tun zu können.“[14] Denn „das Talent der Frau reicht nur aus für das Langhafte, Dekorative und Ornamentale; ihr Geschmack ist Kind der Reizsamkeit und nicht kritisch organisierend. Sie bildet sich nicht selbständig eine Technik, eine künstlerische Handschrift unter dem Zwange eines entschiedenen Willens. Und darum ist sie denn auch nichts weniger als eine Zeichnerin.“[15]
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die im 20. Jahrhundert. vorherrschende patriarchale Unternehmensstruktur. Frauen waren bis dahin strikt von der Erwerbswelt abgekoppelt und verrichteten ihre Arbeit im Haus, also in der Reproduktionsleistung. Im Zuge von Krisen und Kriegswirren und dem Beginn der Industrialisierung wurde nun jedoch die Erwerbsarbeit von Frauen notwendig. Dass hierbei häufig die Kunst als Arbeitsfeld gewählt wurde, bewertet Scheffler wie folgt: „Daß (...) nun die Gebiete der Kunst vor allem bevorzugt werden, liegt nahe. Mit Recht fürchtet die Frau sich mehr als der Mann vor der sozialen Deklassierung. Den Mann ehrt schließlich jede Arbeit, wenn er sie gut zu vollbringen versteht; (...) die Frau aber gewinnt selten etwas anderes als den Arbeitslohn; ihre Tätigkeit ist ideenlos im Sinne der Allgemeinheit. Und das eben ist das Deklassierende.“[16] In der Kunst kann sich die Frau „am leichtesten dem Selbstbetrug hingeben (...), ihre Arbeit wäre schöpferisch.“[17] Auch hier wird wieder deutlich, wie die Geringschätzung der biologischen Rolle auf die soziale Rolle wirkt und schließlich auch die weibliche Arbeitskraft und Produktionsleistung abwertet.
1.1.1.4 Kunst als Ausdruck männlicher Dominanz
Ein besonderer Blick soll in diesem Zusammenhang auf die männliche Dominanz in der Malerei über die Jahrhunderte hinweg gerichtet werden. Dies betrifft nicht nur die überwiegend männlichen erfolgreichen Maler, sondern auch den durch Gesellschaft und Konvention vorgegeben Blick auf Frauen und das Formen ihrer sozialen Rolle. So spricht Carol Duncan in ihrem Essay über ,Virility and Domination’ zur Zeit des Fin de siecle über die Malweise und den damit einhergehenden Ausdruck der Schöpfer: „(...) European Artists began painting pictures with a similar and distinctive content. (...) these paintings forcefully asser the virile, vigorous and uninhibited sexual appetite of the artist. I am referring to the hundreds of pictures of nudes and women produced by the Fauves, Cubists, German Expressionists and other vanguard artists. As we shall see, these paintings often portray women as powerless, sexual subjugated beings. By portraying them thus, the artist makes visible his own claim as a sexually dominant presence.“[18] Frauen waren also im Museum vorwiegend als männliche Projektionen und Imaginationen sichtbar. Diese Historie lässt sich nur schwer abschütteln, bzw. verleugnen und, so ist anzunehmen, wirkt auf die Entwicklung der heutigen Sichtweise nach. Gleichzeitig lassen sie in ihrer Reflektion aber auch ein Aufweichen festgefahrener und eingespielter Normen zu und geben in ihrer Erkenntnis Anlass zur Wandlung des status quo.
Einreihen lassen sich in diese Feststellung die Vorbehalte und Abwehrhaltungen gegenüber Künstlerinnen durch das männlich dominierte Kunstsystem in den 1970er Jahren. So berichtet Judy Chicago: „Manche Frauen hatten versucht, mit ihrer Kunst etwas über sich selbst auszusagen; das stellte die männliche Wahrnehmung der Frau in Frage und enthüllte, dass die männliche Kunst nur eine partielle, keine umfassende Wahrnehmung der Realität ist.“[19] Kunst von Frauen war also neben der ökonomischen auch eine inhaltliche Bedrohung für Künstler. Hier zeigt sich die männliche Wahrnehmung der Künstlerinnen als Konkurrenz und die damit verbundene Gefahr, das Metier und also den Markt streitig gemacht zu bekommen. Künstlerinnen wurden also nicht als Ergänzung einer künstlerischen Erfahrung wahrgenommen, sondern als Bedrohung, die es abzuwehren, wenn nicht gar zu bekämpfen galt.
1.1.1.5 Künstlermythos
Männer als Künstler und die daraus folgende Prägung von Gesellschaft und Zeitgeist stehen in direkter Linie zu der in christlicher Tradition patriarchal geprägten Hierarchienfolge.
„Der alte Künstlermythos, das heute immer noch bzw. wieder gängige Künstlerbild, bietet keine “Anknüpfungsmöglichkeit“; das weibliche Geschlecht ist im Mythos von den Abkömmlingen des männlichen göttlichen Geschlechts nicht vorgesehen.“[20]
Der Mann wird hier in die direkte Nachfolge eines männlichen Gottes gestellt; er entdeckt und entfaltet das Göttliche in sich, das nicht erklärbare und ihm willkürlich geschenkte Talent des Schöpfens, das selbst wieder als Nachahmung des göttlichen Aktes gilt. Frauen können in dieser Konstruktion nicht vorkommen, sind sie doch in der christlichen Theologie nach dem Mann, sowohl zeitlich als auch ideell, erschaffen. Abgesehen von dieser mystisch-religiösen Theorie überträgt sich diese Struktur auf patriarchale Gesellschaftssysteme, in denen Wissen, Bildung und Karrieren über die männliche Linie gefördert und vererbt werden. Zudem trifft sie im 19. Jahrhundert auf die Figur des ‚Dandy’ und später ‚Bohemiens’, der das Göttliche und Kreative als besondere Gegenposition verkörpert:
„Die angeborenen, gottähnlichen Fähigkeiten (...) verbunden (...) mit körperlichen oder geistigen Gebrechen, psychischen, ökonomischen oder sozialen Leiden, traten mit dem 19. Jahrhundert immer stärker im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Außenseitertum auf. Der Mythos vom Künstler begann sich aufs Engste mit dem des ‚Bohemiens’ zu verzahnen, dem Gegenbild zur Regulierung, Normierung und Maßhaltung in der bürgerlichen Gesellschaft. Eingeschrieben sind hier Exzess, Zügellosigkeit und Gesetzlosigkeit, die – als das sozial ’Andere’ – den Ausschluss aus der bürgerlichen Gesellschaft mit sich bringen.“[21]
Diese besondere Stellung des Künstlers als Vermittler von Inspiration und Kreativität, als Schöpfer in einer patriarchal christlichen Kultur, prägt den Geniekult. Außergewöhnliche Fähigkeiten oder Begabungen waren bei Frauen hingegen immer negativ besetzt und wurden mystifiziert, was in der Geschichte in Hexenverbrennungen und Teufelsaustreibungen mündete. Diese Auslegung prägte auch moralische und ethische Vorstellungen, was für das jeweilige Geschlecht schicklich sei. Bis in die Ausübung von Berufen und bei Künstlerinnen die Begrenzung auf bestimmte Kunstgattungen[22] sind diese gesellschaftlichen Konventionen nachzuverfolgen.
1.2 Feministische und Ästhetische Dimension
1.2.1 Künstlerinnen im 20. Jahrhundert
1.2.1.1 Die Feministische Welle der 1960er und 1970er Jahre
1.2.1.1.1 Ausstellen als Politikum
„Why have there been no great women artists?“[23] In diesem, für die feministische Kunstwissenschaft tonangebenden Essay sprach Linda Nochlin erstmals die mangelnde Präsenz weiblicher Kunst in der Öffentlichkeit an. Dabei zeichnet sie nach, wie durch die Liberalisierung in den 1960er Jahren Frauen den öffentlichen Raum entdeckten und ihre Kunst sichtbar wurde. Sie schreibt: „In den 70er Jahren schien es bildenden Künstlerinnen zu gelingen, sich (...) von der über den “männlichen Blick“ definierten Formensprache (...) zu lösen. Das Nachvollziehen der Unterdrückung und Fesselung des “Weiblichen“ am eigenen Körper (...) signalisierte (...) den Beginn der Befreiung aus diesem Leiden.“[24]
Vermehrte Exposition bedingte jedoch noch keine Veränderung in den Museen, vielmehr wurden hierdurch bestehende Diskrepanzen erst recht deutlich, wie Jenny Sorkin bemerkt: „Regardless institutional sexism and disregard were early universal social and economic realities for women artists during the 1970s. All-women exhibitions were a direct response to the widespread absence of women artists’ work from museums and public culture at large.“[25] Die Aktionen von Künstlerinnen waren also geprägt von einem politischen Impetus und im Zuge dieser Energie setzte sich eine erhöhte Ausstellungszahl im Verbund mit anderen Frauen durch: „Occuring primarily in Western Europe and Anglophone countries during the 1970s, all-women exhibitions stood on the precipice of feminist activism. (...) As a recurring global tendency, the all-women group exhibition functions as a unique placeholder in the larger social history of feminism, mirroring the frenetic intensity of organised political acitivity without the same expectations of either mainstream visibility or widespread social change.“[26]
1.2.1.1.2 Anerkennung über Aneignung
Die Ausstellungsentwicklung als Protestkultur des Feminismus schließt, wie oben bereits erwähnt, noch nicht die Einbindung von Künstlerinnen in die staatlichen Institutionen ein. Die der Subkultur entsprungenen Ausstellungen streben nach der Aufmerksamkeit, die allein das Museum als ein Instrument von gesellschaftspolitischer Relevanz geben kann. Dieses Streben nach Anerkennung ist nicht nur für alle Künstlerinnen von Bedeutung, sondern wird auch zum Ziel einer jeden einzelnen Künstlerkarriere. Isabell Graw erwähnt in ihrer Arbeit eine interessante Variante dieser Bestrebungen, die bis in die ästhetische Formulierung künstlerischer Arbeiten reicht. Sie bemerkt dazu, dass sich in den 1970er Jahren die Kunstform der „Appropriation Art“ etablierte, bei der Künstlerinnen sich häufig an den Vorlagen ihrer männlicher Kollegen orientierten. „Begehrenswert erscheint die als attraktiv empfundene gesellschaftliche Stellung des männlichen Künstlers und damit verbunden ist Begeisterung für seine künstlerische Arbeit.“[27] Hierbei wird vor allem deutlich, wie sehr auch der Inhalt künstlerischer Arbeiten von Künstlerinnen vom gesellschaftlichen Zeitgeist und den damit verbundenen geschlechterbezogenen Parametern entscheidend beeinflusst wurde. Hierbei knüpft Graw noch einen richtungweisenden Gedanken an den Umgang von Künstlerinnen mit Tradition, da sie das selbstverständliche Recht dieses Umgangs aufgrund der in 1.1.1.1 und 1.1.1.2 Studien- und Arbeitsbedingungen genannten historischen Entwicklungsphasen erst spät erlangten und daher eine besondere Herausforderung im Umgang mit Tradition sehen, dem die Kunstform der Aneignung hilft, „dieser Übermacht des kunstgeschichtlich Sanktionierten zu begegnen.“[28]
Diese radikale Wendung von Künstlerinnen zu einer eigenen Stimme über das Ausweichen in die Varianz der Arbeiten anerkannter Kollegen erscheint vor dem Hintergrund von Berichten über die emanzipatorischen Ausstellungen Ende der 1970er Jahre als überlebensnotwendiges Prinzip. So wird beispielsweise die Ausstellung „Frauen machen Kunst“ (1976-77) als Griff nach den Sternen verurteilt. Als Reduktion der Leistung von Künstlerinnen wird diskriminierende Argumentation ins Feld geführt. Feministische Tendenzen seien in der männlichen Kunst bereits enthalten und weder zu übertreffen, noch zu korrigieren. Oder aber es wird unterstellt, die Beziehung zu einem bedeutenden Künstler habe auf die Frau abgefärbt und ihr die Möglichkeit gegeben, von dieser genialen Inspiration zu profitieren. Der Mann und Künstler gilt hier als Ursprung jeglichen Produktionsaktes.[29]
Judy Chicago erkennt in ihrer Biographie diese Appropriationsleistung an, analysiert sie aber auch als den Grund, warum Künstlerinnen nicht erfolgreich sind: „Wenn meine Bedürfnisse, Werte und Interessen sich von denen männlicher Künstler unterscheiden, die in die Werte der Gesellschaft eingebettet waren, dann hatte ich die Verpflichtung, zur Entwicklung einer Gemeinschaft beizutragen, die für mich und andere Künstlerinnen Relevanz besaß. Ich ahnte allmählich: Der Grund dafür, dass es so wenig bekannte Künstlerinnen gab, war darin zu suchen, dass die bestehende Kunstszene nicht wirklich den Bedürfnissen der Künstlerinnen entsprach, falls sie nicht bereit waren, genau das zu tun, was ich getan hatte – Kunst zu machen, die sich nicht direkt mit ihrer Erfahrung als Frauen auseinandersetzte. Vielleicht musste ich zusammen mit anderen Frauen eine Kunstszene in allen ihren Aspekten entwickeln: Kunst machen, Kunst ausstellen, verkaufen und vertreiben; andere Frauen künstlerische Techniken zu lehren, über Kunst zu schreiben und unsere eigene Kunstgeschichte zu erarbeiten - eine Kunstgeschichte, die uns erlauben würde, die Beiträge der Künstlerinnen in Vergangenheit und Gegenwart zu entdecken.“[30] Sie erkennt, dass die Auseinandersetzung, das sich Abreiben an der Geschlechterfrage und das Nacheifern einen begrenzenden Rahmen darstellen und dass eine eigene Kunstgeschichte nur durch ein Herauslösen aus diesen uralten Strukturen und Autoritätsverhältnissen möglich ist.
1.2.1.2 Kunst und Feminismus nach 1989
1.2.1.2.1 Differenz als Kategorie
In den 1980er und 1990er Jahren bestimmten Themen einer multikulturellen[31] Gesellschaft den Diskurs.[32] Dies spiegelte sich auch im Kunstmarkt wider, u.a. durch einen Fokus auf Minderheiten, das Andere und die Differenz.[33] Was auf der einen Seite eine schon lange nötige Öffnung des Kunstmarktes bedeutete, trug andererseits die Gefahr in sich, genau diese Teilnehmer auf ihr jeweiliges Auswahlkriterium zu beschränken und somit auch ihre Kunst nur in diesem Lichte zu rezipieren. Eine freie Rezeption ist damit unmöglich und ein Kunstschaffen, das sich dessen bewusst ist, ebenfalls nicht frei, sondern vielmehr geleitet vom Widerstand gegen Konvention. Man mag anfügen, dass ein Widerstand gegen Konvention generell den künstlerischen Impetus initiiert oder seine Aussagekraft erst stark und spannend macht, also das Kunstwerk in seiner Wertung stimuliert, jedoch kann bei einer eingeschränkten Analyse und Interpretation von Kunstwerken unter diskriminativem Blickwinkel nicht mehr von einer neutralen Kritik die Rede sein und es muss von unausgeglichenen Voraussetzungen zwischen KünstlerInnen bezüglich der Erkenntnis ihres Werkes ausgegangen werden.
1.2.1.2.2 Künstlerinnen als Inspirationsquelle
Die Einflussgröße von Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt erfährt erneut durch Linda Nochlin einen entscheidenden Hinweis, den sie in einer Reflexion 30 Jahre nach ihrem bahnbrechenden Essay formuliert: „(...) I would like to indicate the impact (...) of the new women’s production on the work of male artists. (...) in the beginning was Duchamp, but it seems to me that many of the most radical and interesting male artists working today have (...) felt the impact of that gender-bending, body-conscious wave of thought generated by women artists, overtly feminist or not.“[34] Künstlerinnen bescheinigt sie hier eine Einflussgröße, die von männlichen Kollegen nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt oder übergangen wird, die aber, ob offensichtlich oder nicht, unleugbar vorhanden ist.
1.2.2 Künstlerinnen im 21. Jahrhundert
1.2.2.1 Feministische Kunstwissenschaften
Angestoßen wurde durch den feministischen, der Postmoderne verpflichteten Essay von Linda Nochlin „Why have there been no great women artists?“, auch ein ganzer Zweig der Kunstgeschichte und –wissenschaft. Man führe sich das Projekt der Guerilla Girls aus dem Jahre 1985 vor Augen, das zum ersten Mal in Form einer Performancekunstaktion die Realitäten in den Museen publikumswirksam öffentlich machte.
1.2.2.2 Die Problematik des LABELS „Feministische Kunst“
1.2.2.2.1 Feminismus 2.0
Man fragt sich angesichts der Debatten zum Feminismus und den immer neuen Kontroversen, an dem sich die Geister stets wieder entzünden und scheiden, welche Früchte die feministische Welle der 1970er Jahre zum jetzigen Zeitpunkt trägt.
„Meines Erachtens ist es aber eben die gesellschaftliche Ebene, die nie erreicht wurde, weshalb der Feminismus auch zu etwas Stigmatisiertem wurde.“[35]
Die Kunsthistorikerin Edith Krebs spricht vom Gender-Begriff, der als universitäre Größe zu einer akademische Disziplin verkommen ist. „Es gibt so was wie einen Berufsfeminismus, aber keine Frauenbewegung mehr. Es fehlt die Rückkopplung an ein politisches Ziel.“[36] Auch René Zechlin bemerkt die mangelnde Relevanz des Feminismus als politischen Terminus, da dieser sich zu sehr von der Realität entfernt habe: „Es ist ein Problem, dass sich Feminismus und Gender als Wissenschaft von der Alltagswirklichkeit abgelöst haben.“[37] Andrea Geyer bemerkt dies auch in der Erfahrung als Künstlerin: „Und dann ist es unglücklicherweise der Fall, dass Feminismus als Thema, oder eigentlich als Praxis, sehr unmodisch geworden ist, zuweilen unter anderen Künstlerinnen, denn es scheint eh kein Ende des Sexismus in Sicht zu sein und eine Konfrontation mit Kuratoren, Galeristen oder Kollegen wird als der Mühe nicht Wert, als lästig angesehen – zumal der Feminismus schon seit Jahren auf taube Ohren trifft.“[38]
Folgt man einer Aussage, die sich auf eine Studie des MIT (Massachusetts Institute of Technology) aus dem Jahre 1998 bezieht, sind Begriffe wie „Frauenförderung“ und -quotierung negativ konnotiert. Die Diskriminierung von Frauen sei in den 1990er Jahren zwar sehr subtil gewesen, habe sich jedoch im kollektiven Unterbewusstsein verankert und wurde so von Männern als auch Frauen getragen.[39] „Zu einer solchen Sicht tendieren insbesondere gut ausgebildete Frauen der oberen Mittelschicht, die sich bewusst sind, dass sie mit nahezu gleichen Chancen an der Gestaltung des öffentlich-politischen Lebens teilnehmen, sofern sie einigermaßen klug im Gefüge existierender Strukturen agieren. Das Desinteresse an Ideen und Formen des Feminismus aufgrund fehlender greifbarer Ziele auf der einen Seite und die Akzeptanz bestehender Strukturen auf der anderen Seite wird auch als „Cooling Out“ bezeichnet. „(...) Es handelt sich (...) also um einen latenten Zustand, der unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung die Bewegung des Feminismus als abgeschlossen begreift.“[40]
Dazu Toril Moi aus ihrer Praxis als Dozentin: „Seit Mitte der Neunzigerjahre ist mir aufgefallen, dass der Feminismus nicht mehr zu den zentralen politischen und persönlichen Anliegen der meisten meiner Studierenden gehört. (...) Zu Beginn frage ich die Studierenden, ob sie sich als Feministen begreifen. Die Antwort ist meist Nein. Wenn ich sie frage, ob sie die Freiheit, Gleichheit und Gleichberechtigung von Frauen befürworten, antworten sie immer mit Ja. Bedeutet das aber nicht, dass sie alle Feministen sind? frage ich. Die Antwort darauf ist fast immer: Naja, wenn sie DAS mit Feminismus meinen, dann sind wir alle Feministen. Doch wir würden uns nie als Feministen BEZEICHNEN. (...), wenn sie sich als Feministen bezeichneten, hielten andere sie für streitbar, herrisch, aggressiv, intolerant, und – das Schlimmste von allem-, dass sie dann Männer hassen müssten.“[41]
Auch Geyer betont die Unzulänglichkeit bzw. negative Konnotation des Begriffs Feminismus unter Studentinnen im 21. Jahrhundert. Als Reaktion auf die Frage nach offenen Geschlechterfragen äußersten sich die 15 befragten Studierenden mit einem „starken Widerstand gegen den Begriff Feminismus, weil er für die meisten ein historischer ist und heutzutage unbrauchbar, weil die weiblichen Studenten sich in dieser Hinsicht nicht diskriminiert fühlen und glauben, sie würden lediglich aufgrund ihrer Arbeit bewertet. Sie sagen, der Feminismus schreibe lediglich vor, dass die einen die Opfer und die anderen die Täter sind (...), ständig eine Kluft wieder einschreibe, die sich nicht mit ihrer Erfahrung decke und darüber hinaus auch nicht produktiv sei, sondern sie zu Geiseln von Stereotypen mache, mit denen sie sich überhaupt nicht wohl fühlten.“[42]
Sicherlich ist auch hier die Bewertung feministischer Aktivitäten für ein heute so in Verruf geratenen Begriff ausschlaggebend. So berichtet Linda Conolly über Aktivistinnen in den 1970ern: „Sie galten als völlig abgedrehte Frauen, die das gesamte moralische Gefüge unterminieren und die Gesellschaft ins Verderben stürzen wollten.“[43]
Andrea Geyer spricht von einem sich wandelnden Identitätsbegriff als Feministin, den sich jede Generation neu zu suchen und zu bestätigen habe.[44] Diese Identität ist zudem einer ständigen Veränderung unterworfen, weshalb Geyer an dieser Stelle vor allem für eine flexible Organisationsform plädiert, die die Falle umgeht, Stereotype oder Hierarchien auszubilden und somit wieder in einer erstarrten feministischen Begrifflichkeit zu landen, die sich im Gegensatz zu einem patriarchalen, also hierarchischen und autoritären System aufbaut.
Interessant wird diese Tatsache für die Betrachtung der Kunst von Künstlerinnen im Hinblick auf ihren feministischen und somit negativ konnotierten Charakter, der auf ihre Kunst in eben jener Weise zurückstrahlen müsste. Durch die Kategorisierung einer weiblichen Kunst als feministische Kunst wäre der Blick auf das Werk verengt und andere Ebenen und Inhalte würden ausgeblendet.
Hierbei zeigt sich in der Moderne ein großer Wandel. Waren in den 1960er und 1970er Jahren noch feministische Themen bei ‚weiblicher Kunst’ und Kunstwissenschaft federführend, so stellt sich heute die Frage, ob in der Postmoderne dieser Zugang nicht geradezu anachronistisch wäre, seien doch feministische Themen mit kämpferischem Duktus abgeschlossen. Uta Grosenick veröffentlichte vor diesem Hintergrund 2001 „Women Artists“, in dem sie Künstlerinnen aus dem 20. und 21. Jahrhundert vorstellt, die es “geschafft“ haben, ohne jedoch den einförmigen Blick im Sinne der feministischen Analyse auf diese geworfen zu haben. Die Frage, ob dieser Blick nicht mehr notwendig bzw. nicht mehr zeitgemäß sei, ist im Zuge der weiteren Betrachtungen zu dieser Arbeit negativ zu beantworten. Die Formel „Feminismus“ ist in eine Schieflage gerutscht, die ihrer Entsprechung in der Realität entbehrt. So zitiert Ute Thon in ihrem Artikel über „Die Lüge der Emanzipation“ den Hochschulprofessor Arno Rink, der den untergeordneten Rang von Künstlerinnen damit begründet, dass „während sich die männlichen Studenten zu Cliquen zusammenschlössen und zur besseren Vermarktung die Produzentengalerie "Liga" gründeten, (...) sich junge Studentinnen in Experimenten und Emotionen verzetteln.“[45] Gleichzeitig weist Rachel Mader darauf hin, dass in der aktuellen Kunstwissenschaft die These vertreten wird, Frauen hätten ausschließlich Erfolg, wenn sie sich in ihrer Kunst mit “ihren“, also feministischen Themen, auseinandersetzten.[46] Sie erfasst also ein Paradox, was zum einen das Label „Feminismus“ als negativ interpretiert, zum anderen aber feministische Kunst als positive Ausrichtung bewertet, die zum Erfolg führt. Wie diese Diskrepanz nun bezüglich der Ausstellungspraxis von Künstlerinnen zu bewerten ist, bleibt offen. Jedoch verspricht allein schon das Spannungsfeld eine Relevanz für den Kunstdiskurs und somit eine gewisse Einflussgröße auf Ausstellungspraxis und Kunstmarkt.
1.2.2.3 Die Bedeutung weiblicher Kunst
1.2.2.3.1 Feminismus als diskriminierender Begriff
Künstlerinnen werden nicht nur mit den Kategorien des Kunstmarkts konfrontiert, sondern sind auch stets in der Position, den weiblichen Blick als vorrangige Prägung ihres Werkes ertragen zu müssen. Ohne Zweifel ist diese Thematik als Einschätzung und zur Analyse der künstlerischen Arbeit von Belang, jedoch trägt sie eine über Jahrhunderte aufgebaute negative Konnotation. Vor allem die Herabwertung weiblicher Kunst zu „dekorativer Kunst“ aus männlichen Künstlerkreisen, die damit die vermeintlich drohende Gefahr der weiblichen Konkurrenz zu vereiteln suchen, macht dies deutlich. So lassen Le Corbusier und Amédée Ozenfant im Jahre 1918 Bezug nehmend auf den Stil und die Rolle von Künstlerinnen verlauten:„There is a hierarchy in the arts: decorative art at the bottom, and the human form at the top. Because we are men.“[47]
Wie diese Beurteilung weiblicher Kunst bis in die heutige Zeit Relevanz besitzt, zeigen die Erfahrungen der Künstlerin Andrea Geyer:
„Ich bin mir der Diskriminierung, die in den Künsten herrscht und unter der auch ich leide, sehr wohl bewusst. Das Feld dieser Praxis ist grundsätzlich entlang sich überschneidenden Achsen strukturiert: Geschlecht, Rasse, Sexualität, Klasse, Ethnizität, Fähigkeiten, Nationalität, Alter sowie andere Linien von Privilegien und Macht. Angefangen mit der Anerkennung einer individuellen Kunstpraxis, Sichtbarkeit und Wert (...).“[48]
Die Kunsthistorie zeigt diese Entwicklung. Um nicht unter dem Begriff „Frauenkunst“ als negativem Ausdruck für nicht vollständige oder unzureichende Werke geführt zu werden, griffen Künstlerinnen in den 1970er Jahren zu drastischen Mitteln. So berichtete die Künstlerin Judy Chicago, dass Künstlerinnen Namen wählten, die möglichst keine Aussage über das Geschlecht machen sollten, und, dass Materialien wie etwa Textil, Naturmaterialien, Küchenutensilien oder andere Dinge, die mit der weiblichen Alltagswelt verknüpft sind, tabuisiert wurden, um nicht in einen abschätzigen Kontext gesetzt zu werden. Andere vornehmlich als männlich wahrgenommen Materialien und Gegenstände hingegen wurden favorisiert, wie etwa Metall und Autos, um die “interessanten“ Themen zu bearbeiten und ernst genommen zu werden.[49]
Wie bereits Isabell Graw in ihrer Theorie zur Appropriation Art feststellt, wird der Kunstbetrieb noch Ende der 1980er wie folgt bewertet: „Das Überschreiten der Geschlechtergrenze, das Orientieren an Kollegen und fachlichen Vorbildern, die Identifikation mit der herkömmlichen oder avantgardistischen Kunstgeschichte, implizieren für die Künstlerin einen Bruch: die scheinbar normale Identifikation mit dem Männlichen.“[50] Und Judy Chicago berichtet weiter: „Das höchste Kompliment, das man einer Künstlerin damals machen konnte, war die Feststellung, ihre Sachen sähen aus, als habe ein Mann sie gemacht.“[51]
Auch auf dem Kunstmarkt zeigte sich die Schwierigkeit, mit Arbeiten von Künstlerinnen Erfolg zu haben: „Galeristen und Museumsdirektoren wollten sich meine Arbeiten gar nicht erst ansehen oder falls sie es taten, geschah es nur oberflächlich. Im günstigsten Fall machten sie unpassende oder herablassende Bemerkungen.“[52]
1.2.2.3.2 Medialer Auftrag
Dieser Geschlechterkonflikt in Verbindung mit dem stigmatisierten Begriff des Feminismus scheint im 21. Jahrhundert abgeschlossen, doch zeigt die Heftigkeit der Reaktionen bei diesen Themen deutlich, inwieweit noch Klischees und Stereotype - zumindest unterschwellig - vorhanden sind. Andrea Geyer dazu: „Diskriminierung/Sexismus kann ein herausforderndes Thema in der Klasse sein, denn es ist ein vertracktes, es wird im Kontext der Kunst oft mit Qualitätsansprüchen zusammengebracht, und wenn eine Professorin das Thema anspricht, wird dies häufig als eine Abwehrhaltung und/ oder als die Folge mangelnden persönlichen Erfolges abgetan. (...) Es wird kein einziger Vorschlag gemacht, wie anders zu handeln wäre (...) und weder gab es ein funktionierendes, in sich geschlossenes, alternatives System.“[53]
Bezüglich von Ausstellungen weiblicher Kunst wird hier die Frage interessant, inwieweit man ’nur’ eine Exposition präsentiert oder aber ein kalkuliertes Prinzip zur Anwendung kommt. Weibliche Kunst mit dem inhärenten Feminismuslabel ist Trägerin von gesellschaftspolitischer Relevanz. In ihr zeigt sich sowohl der Blick von Frauen auf die Gesellschaft, auf das Bild der Frau, als auch in ihrer Rezeption die Resonanz wie im Verkauf die Nachfrage, der Wert. All dies kann als Spiegel des Zeitgeistes gelten und Form, Dauer, Inhalt, Intensität u.a. entwerfen so gemeinsam das Image von weiblicher Kunst und Frauen in der Gesellschaft. Wie damit umzugehen ist, dass Geschlechterfragen auch durch Ausstellungen in den offenen Dialog treten, scheint noch unklar. So Katy Deepwell: „Konzepte der >Performanz< von Gender in Rollenspielen, in der Fotografie und Videokunst sind weit verbreitet (...), doch die Frage nach den >Wirkungen< dieser Bilder auf die Betrachter und danach, was sie über Formen von Subjektivität aussagen, muss oftmals erst noch formuliert werden, vor allem, wenn es um eine Bewertung der kulturellen Produktion von Frauen geht.“[54]
Nicht zu vergessen ist hierbei auch die Darstellung von Frauen und Feminismus in den Medien, die den Zeitgeist unweigerlich widerspiegelt und beeinflusst. Im 21. Jahrhundert ist die Medienlandschaft konfrontiert mit der Rückkehr traditioneller Frauenrollen im Geiste des Neoliberalismus - siehe Bücher wie das „Eva-Prinzip“ der Tagesschau-Moderatorin Eva Herrmann oder amerikanische TV-Serien wie „Mad Men“ und „Sex and the City“, die in ihren Erzählungen die klassischen Romantisierungseffekte zwischen den Geschlechtern nachvollziehen. Ob dies ein letztes Aufbäumen eines sozialen Konservatismus ist oder nur das Durchspielen von alten Rollenmustern zum Amüsement der Massen, sei dahingestellt. Jedoch sind die Medien Ausdruck unserer Gesellschaft und prägen kulturell bedingte Definitionen. Auch die Rolle der Frau, die politischen Forderungen, der gesellschaftliche Dialog sind davon beeinflusst wie auch die Wertung, die daraus folgt.
1.2.2.4 Studienbedingungen
Die Studienbedingungen im 21. Jahrhundert haben sich zu Gunsten der Studentinnen entwickelt. Zulassungsbeschränkungen für Frauen in künstlerischen Studiengängen gibt es heute nicht mehr. Vielmehr sind über 50% der Studierenden in künstlerischen Fachrichtungen Frauen.[55] Betrachten wir die noch junge Geschichte dieser Karriere, verdient diese Tatsache durchaus Beachtung. Wie in Kapitel 1.1.1.2 dargestellt, wurden Frauen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu kunstgewerblichen Schulen zugelassen oder es wurden sogenannte Damenakademien gegründet, bevor sich die deutschen Akademien um 1900 für Studentinnen öffneten. Das Aktstudium war untersagt, ebenso war die Studiendauer kürzer als die der männlichen Kollegen.[56]
Auch in den 1980er Jahren lag der Anteil der weiblichen Kunststudentinnen noch deutlich unter dem der Männer, die ihre Kommilitoninnen verächtlich zur Kenntnis nahmen; zudem gab es keine Professorinnen.[57] Gisela Breitling über ihr Studium: „Frauen waren Gäste in diesem Studium, sie waren auch dabei, wollten auch Kunst machen, wollten auch etwas, das die anderen, die Männer, eigentlich taten. Sie waren Sonderfälle, unter Umständen auch begabt“[58].
Wie Andrea Geyer berichtet, ist dieser Feminismus im 21. Jahrhundert in weite Ferne gerückt und Kunststudentinnen schätzen ihre Bewertung auf dem Kunstmarkt noch blauäugig als gleichberechtigt ein. So „(...) wird Diskriminierung von nicht wenigen der heutigen Studierenden als Mythos abgetan. Denn sie gehen davon aus, dass man tatsächlich die Wahl hat, teilzunehmen oder nicht, sich über diese Form der Diskriminierung hinwegzusetzen. Und dieses Privileg der Wahl ist ihnen durch ihre individuelle, hervorragende Qualität als Künstlerinnen gegeben, wodurch sie die Beschränkungen konventioneller Labels hinter sich lassen können und werden“[59].
Kunststudentinnen sehen sich also gleichberechtigten Startchancen gegenüber, schließen jedoch daraus, dass auch die Kunstmarktstrukturen nach dem Studium in gleicher Weise geebnet sind. Inwieweit diese Vermutung zutrifft und welche Marktakteure hier Einfluss ausüben, wird in Kapitel 2 näher erläutert werden.
1.2.2.5 Arbeitsbedingungen
1.2.2.5.1 Familienfalle
Im 20. Jahrhundert, durch Kriege und technischen Fortschritt erforderlich, kam die Arbeitskraft von Frauen zum Einsatz, was sich durch die Liberalisierungsbewegung in den späten 1960er Jahren noch verstärkte. Seitdem ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen kontinuierlich angestiegen. Im hier betrachteten Zeitraum zwischen 2000 und 2010 sogar um nahezu 10% von 57,7% auf 65,1%, womit die weiblichen Erwerbstätigen zwar noch hinter den männlichen liegen (75,3%, 2010), aber dem Trend der Gleichberechtigung auf das Recht auf Arbeit entsprechen. Der Anteil der Erwerbslosen ist in den Jahren 2000-2010 relativ stabil (um die 10% pro Geschlecht) und der weibliche Anteil liegt stets nur knapp unter dem der männlichen Erwerbslosen. Interessant ist die Aufschlüsselung der Berufsgruppen; so ist der Frauenanteil im Berufsfeld der Angestellten besonders hoch (55,9%, 2009), bei Beamten liegt er bei rund 40% (2009), bei den Selbstständigen und Arbeitern bei 31,1% bzw. 30,2%. Künstler, die von ihrer Arbeit hauptberuflich leben können, sind unter die Selbstständigen zu zählen. Dass hier der Anteil von Frauen im gesamten Feld nur bei 30% liegt, lässt Rückschlüsse auf die Höhe von hauptberuflich arbeitenden Künstlerinnen zu, die demnach sehr gering sein muss. Erschreckend ist in diesem Zusammenhang auch der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Frauen, der 2009 81,7% ausmachte, wobei der der Vollzeitbeschäftigten jedoch nur 35% betrug. Das bestärkt die These von Frauen mit Familie, die einen Beruf in Teilzeit ausüben, um die restliche Zeit dem Unternehmen „Familie“ zu widmen.[60]
Entsprechend antworten in einer Umfrage zur Lebens- und Arbeitssituation von Künstlerinnen 70%, Kinder großgezogen zu haben, von denen 40% ihre beruflichen Pläne auf später verschoben haben, weil familiäre Verpflichtungen ihnen zu wenig Raum für ihre künstlerische Arbeit ließen. Die Hälfte der Künstlerinnen hat ihr Atelier in ihrer Wohnung oder ihrem Haus.[61] Diese persönlichen Entscheidungen folgen relativ konventionellen Mustern und werden von einigen politischen Instrumenten, wie dem Ehegattensplitting unterstützt. (siehe dazu Kapitel 1.3). Auch die Arbeitssituation eines Selbstständigen mit dem Atelier im Haus lässt meist nicht genügend Abgrenzung gegenüber den familiären Aufgaben zu. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für die Verwirklichung einer Karriere.
Bei der Entwicklung der Selbstständigkeit fällt neben der Akademisierung eine zunehmende Feminisierung auf. „Insbesondere der wachsende Zustrom hochqualifizierter Künstlerinnen hat (…) zu den Wachstumsraten von freiberuflichen bzw. selbstständig arbeitenden Künstlern beigetragen.“[62]
1.2.2.5.2 Cooling Out und Männerbünde
„Frauen haben heute, so scheint es zumindest, viele Möglichkeiten der beruflichen, persönlichen, sexuellen und sozialen Selbstverwirklichung erlangt. Sie dürfen wählen, sie sind überwiegend berufstätig (wenn auch während der Familienphase mehrheitlich allenfalls in Teilzeit), sie werden als Konsumentinnen in der Werbung angesprochen, Gender wird gemainstreamt... Aber eben: cooling out.“[63]
„Der Begriff „Cooling Out“ impliziert eine Illusion der Chancengleichheit bezüglich der Berufsmöglichkeiten von Akademikerinnen. Statistisch gesehen sind nur wenige Frauen erfolgreich. Denen, die nicht auf der Karriereleiter vordringen, wird vorgeworfen selbst Schuld zu sein, da sie ja alle Möglichkeiten hatten.“[64]
Hanne Lorecks Aussagen als Kunsthistorikerin und Hochschulprofessorin an der Hochschule für Freie Kunst, Hamburg bestätigen diese Ergebnisse: „Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der aufgenommenen Kunststudentinnen und den Möglichkeiten des Feldes gemessen an den Strukturen des Marktes ist hoch. In meiner Praxis als Dozentin für Kunstwissenschaft und Kunsttheorie ist es mir wichtig, Künstlerinnen als Vorbilder in der Hochschule zu präsentieren. Die überwiegende Anzahl an Einladungen und Gastvorstellungen gehen an Männer, weshalb dieser Tatsache etwas entgegengesetzt werden muss. So unsinnig die statistische Einteilung auch scheint, gilt es immer noch diesem Ungleichgewicht entgegenzuarbeiten.“[65]
Die Frage nach der vielbesprochenen „gläsernen Decke“, die Frauen immer noch nicht durchstoßen können und die im Kunstmarkt auf die Vertretung durch eine Galerie oder generell auf Kontakte in der Kunstwelt übertragen werden kann, findet eine interessante Antwort in der von Catarina Sandberg 2008 aufgestellten These zur ’unbewussten Homophilie’. ’Homosociality’ nennt sie das Phänomen der geschlossenen Männerbünde. Sie glaubt, dass hier nicht absichtliche, sondern unbewusste Ausgrenzung am Werke ist. In der Praxis bedeutet dies, dass wenn ein neues Mitglied ausgewählt werden soll, man sich instinktiv jemanden aussucht, der ähnlich aussieht. „Befördert werden Menschen, deren Loyalität man sich sicher sein kann. (...) Frauen können den ewigen Kreislauf der Männerförderung tatsächlich stören – indem sie Frauen fördern. Damit ist ihre Loyalität zweifelhaft und ein wesentliches Kriterium für Förderungswürdigkeit nicht erfüllt. ’Veränderungswiderstand’ heißt das Phänomen in der Fachsprache.“[66]
Auch auf den Kunstmarkt findet sich diese „gläserne Decke“: „Tatsächlich lässt sich beobachten, dass Männer den Kunstmarkt bestimmen. In den einschlägigen Rankings gibt es nur wenige erfolgreiche Frauen.“[67]
Ob an dieser Stelle eine Quotenregelung, wie sie für die Führungsetagen und Mitarbeiterstäbe von Unternehmen festgesetzt wurde, greifen könnte, ist fraglich. Zu komplex und undurchsichtig ist der Kunstmarkt mit seinen Akteuren und seinem Produkt, der Kunst, die eben nicht nach genormten betriebswirtschaftlichen Schemata produziert und gehandelt wird. Die Antwort auf die Frage, warum es im Kunstsektor keine wirkliche Gleichberechtigung gibt, könnte sein, die einzelnen Marktteilnehmer und Arbeitssituationen durchleuchten und an etwaigen Stellen mit einer Quotierung eine Hilfestellung geben. So etwa in den Führungs- und Mitarbeiterebenen öffentlicher Einrichtungen, wie Universitäten und Museen. Die freie Marktwirtschaft, Galerien, Messen, Sammler, Medien sind davon ausgeschlossen und in diesem Zusammenhang gilt es besonders das Produkt Kunst als Ware individueller Ästhetik, Vorliebe und Produkt-Käufer-Beziehung zu betrachten, (siehe Kapitel 2).
1.2.2.6 Marktwert
Künstlerinnen verdienen wie in 1.3.1 dargestellt bis heute weniger als ihre männlichen Kollegen.
„Merkwürdigerweise gilt das Problem des ungleichen Lohns als gelöst – auch wenn eine Künstlerin wie Tracy Emin noch immer in einer Fernsehsendung auf die niedrigeren Preise der Werke von Künstlerinnen hinweist, und trotz der Tatsache, dass statistische Erhebungen in Europa zeigen, dass Frauen in den Künsten schlechter bezahlt werden, in Museen und internationalen Biennalen, wie auch auf dem (allgemeinen) Arbeitsmarkt, unterrepräsentiert sind.“[68]
Isabell Graw geht in ihren Ausführungen zu Anerkennung und Wert noch einen Schritt weiter. Sie unterscheidet zwischen Anerkennung von Autoritäten als Insidern, also Kunstmarktteilnehmern wie Künstlerkollegen, Museen, Sammlern, Kritikern, deren Meinungen sich widersprechen können, und somit zum Dissens zwischen finanziellem Erfolg und ideeller Wertschätzung führen.[69]
Eine interessante Wendung ist die Erkenntnis, dass der Erwerb eines Bildes wiederum hierarchisches Potential in sich trägt und somit der Marktwert in eine persönliche Beziehung gebracht wird. So beschreibt Carol Duncan sowohl, wie ein Bild selbst als Ausschnitt den Geschlechtsbegriff objektiviert und ein Abbild männlicher Projektion wird, als auch wie der Kauf eines Bildes als Metapher für die soziale und auch sexuelle Hierarchie zwischen Sammler und Künstler werden kann: „According to their paintings, the liberation of the artist means the domination of others; his freedom requires his unfreedom. Far from contesting the established social order, the male-female relationship that these paintings imply – the drastic reduction of women to objects of specialized male interests - embodies on a sexual level the basic class relationship of capitalist society. In fact, such images are splendid metaphors for what the wealthy collectors who eventually acquired them did to those beneath them in the social as well as the sexual hierarchy.“[70]
Das bedeutet unweigerlich die Auseinandersetzung vom Wert weiblicher Kunst gegenüber dem Wert als Frau, (siehe Kapitel 2.2).
1.2.2.5.1 Künstler in gesellschaftlicher Funktion
Der Künstler repräsentiert die kreative Individualität und steht somit „für den symbolischen Bedarf bürgerlicher Identität“ und habe damit in „transformierter Form sicher bis heute Geltung“[71], wie Sabine Kampmann, sich auf Wolfgang Rupperts Ausführungen zum Sozialbild des Künstlers berufend, formuliert. Die Frage nach einem Leitbild oder einer Verkörperung eines individuellen kreativen Gefühls gewinnt vor allem in Anbetracht der Tatsache Bedeutung, dass Frauen nicht nur die Hälfte der Bevölkerung stellen, sondern auch immer mehr das öffentliche Bild der Gesellschaft prägen und mitbestimmen. In einer in diesem Maße fortschreitenden Entwicklung ist die Verkörperung weiblicher Kreativität als Spiegel der gesellschaftlichen Prozesse so logisch wie unabdingbar. Das Aufbrechen von Grenzen innerhalb der Künstlermythologie entspricht daher vielleicht eher der Etablierung von neuen Funktionen und Mythen, die in den gesellschaftlichen Ansatz von weiblicher Kunst greifen. Noch 1980 wird auf diese Einseitigkeit der Künstlerrolle und -wahrnehmung hingewiesen: „Ein tiefverwurzeltes, der Mythologie anverwandtes Ursprungsdenken, an dessen Anfang der Mann – Schöpfer, Gott, Pygmalion – stand, belastet nach wie vor die Wahrnehmung bzw. Wahrnehmungsweisen, die die Kreativität von Frauen nicht zur Kenntnis nehmen.“[72] Diese Aussage formuliert eine Station auf dem Weg zum heutigen Stand von Künstlerinnen in der Gesellschaft und dem Kunstmarkt, der jedoch zumindest in der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr den Tatsachen entspricht.
1.3 Politische und Ökonomische Dimension
1.3.1 Beruf Künstler und Prekariat
Der Beruf der Künstlerin und die Rolle der Frau unterliegen wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt im 21. Jahrhundert einem starken Wandel. Nicht zuletzt ist dies auch der Veränderung unserer Gesellschaft insgesamt zuzuschreiben. Der von Beck in den 1980er Jahren formulierte Individualisierungsprozess[73], den Schulze in den 1990er Jahren weiter fasst und die Erlebnisgesellschaft mit immer größer werdenden Freiräumen beschreibt, findet auch politisch Ausdruck in den Arbeitsmodellen um die Jahrtausendwende. KünstlerInnen sind von jeher als Selbstständige mit der Disziplinierung ihrer Arbeitszeit und Eigenvermarktung konfrontiert. Im Sinne des von Richard Florida geprägten Begriffes der „Creative Class“[74] sehen sich KünstlerInnen nun in eine Gemeinschaft von anderen Erschaffern kreativer Produkte gestellt, die als Masse das Prekariat zu einem festen Begriff in der Arbeitswelt haben werden lassen. Die wachsende Kreativbranche erlebt dabei nach Florida zum einen wachsenden wirtschaftlichen Erfolg. Dahingegen haben KünstlerInnen durch die ökonomische Sonderstellung ihrer Produkte, wie der Verfügbarkeit als Einzelstück, Produktionszeitraum, der Preisbildung u.a. mit besonderen Marktbedingungen zu kämpfen. Der „Bohemian Index“, der laut Florida für das Blühen einer Stadt als Wirtschaftsstandort entscheidend ist, verlangt nach politischen Instrumenten, die alle Mitglieder der kreativen Klasse unterstützen.
„The Bohemian Index turns out to be an amazingly strong predictor of everything from a region's high-technology base to its overall population and employment growth. Five of the top ten and twelve of the top twenty Bohemian Index regions number among the nations top twenty high-technology regions. Eleven of the top twenty Bohemian Index regions number among the top twenty most innovative regions.“[75]
Für Künstlerinnen ist die Unterstützung durch die Politik noch drängender, da das Lohngefälle zu ihren männlichen Kollegen noch immer besteht. „Zum 1. Januar 2007 konnte aufgrund der Vorausschätzungen der Versicherten ein Durchschnittseinkommen von 11.094 Euro im Jahr errechnet werden. Das Einkommen der Künstlerinnen lag mit 9.483 Euro im Jahr noch unter dem der Künstler (Jahresdurchschnittseinkommen 12.452 Euro).“
1.3.2 Politische Instrumente
Die politischen Mittel mögen im Berufsfeld von Künstlerinnen anders greifen, da dieses von anderen Faktoren, besonders inneren und äußeren Umständen stärker beeinflusst ist, wie etwa Arbeitszeit, kreative Phase, Projektgelder, Aufträge etc. Jedoch haben die politischen Instrumente die Möglichkeit, durch eine Breitenwirkung in allen gesellschaftlichen Ebenen anzusetzen und so ein Umdenken in der Gesellschaft anzuregen.
„Die Durchsetzung von feministischen Themen ist zuerst einmal eine politische Frage. Wenn die Gleichberechtigung politisch gewollt wäre, dann wäre bis heute wesentlich mehr erreicht, als bis dato erreicht worden ist.“[76]
In diesem Sinne sind also politische Mittel indirekte oder direkte Ansätze zur Förderung von Frauen jeden Alters in der Ausübung ihres Berufes, im hier untersuchtem Fall als Künstlerin. Im Folgenden sollen die politischen Instrumente, ihre Entwicklung und ihr Einfluss speziell auf die Berufslaufbahn von Künstlerinnen dargestellt werden. Die Familienpolitik erhält dabei eine besondere Betrachtung, da bei der Analyse erfolgreicher Künstlerinnen anzunehmen ist, dass sich bei ihnen, wie auch bei Frauen in anderen Berufen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sprich der Kinderwunsch, nachteilig auf die Karriere auswirken.[77]
1.3.2.1 Gender Mainstreaming
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist es eine der wichtigsten politischen Aufgaben, die Möglichkeiten für Frauen in Arbeit und Gesellschaft zu verbessern und die Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu garantieren.[78] Dabei soll zum einen „die Diskriminierung von Frauen als Ursache der ungleichen Lebensverhältnisse von Frauen und Männern beseitigt werden; zum anderen sollen die sozialen Folgen dieser Ungleichheit beseitigt und gleiche Lebenschancen wie gleiche Teilhabe von Frauen an den gesellschaftlichen Ressourcen erreicht werden“[79].
Bereits seit 1995/96 sind mehr Frauen als Männer in deutschen Universitäten eingeschrieben. Reiner Küppers führt im Bereich der Ausbildung an, dass das Abitur zu 55% und über die Hälfte der universitären Abschlüsse von Frauen gemacht werden.[80] Schlichtweg als „Verschwendung von Ressourcen“ bezeichnete das Amt für Forschung und Bildung die Tatsache, dass nur ein Drittel aller Doktorandenstellen, 30% der Lehrtätigen, 10% der C3-Professuren, 6,3% der C4-Professuren sowie in privaten Forschungseinrichtungen nur 5,1% in leitender Tätigkeit und in der Privatwirtschaft unter 11% Frauen in Managementpositionen besetzt sind. „Eine moderne Demokratie kann es sich nicht leisten, Frauen als Minderheit zu behandeln.“[81]
1999 wurde das Programm „Frauen und Arbeit“ mit dem Titel „Equal Opportunities 1999“ gegründet, zeitgleich wurde ein Budget für „Strategien zur Durchsetzung von Chancengleichheit von Frauen in Bildung und Forschung“ eingerichtet. Ziele sind die Anpassung des Lohns, die Zahl von Frauen in Managementpositionen zu erhöhen sowie klassische Männerberufe für Frauen zu öffnen. Zeitgleich laufen Programme, die Mädchen und Lehrerinnen mit dem Internet oder anderen männlich besetzten Interessengebieten vertraut machen wie etwa „Frauen ans Netz“, oder „women in science“.
[...]
[1] Vgl. Eva Hermann, Das Eva-Prinzip, 2006.
[2] Vgl. Katharina Pfühl, Von Frau zu Gender und zurück? Oder: Warum Paradoxien sich nicht von selbst erklären, in: S.Schaschl/ B.Steinbrügge/ R.Zechlin, 2008, S. 190f.
[3] K. Scheffler, 1938, S. 73.
[4] Carol Duncan, Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting, in: N.Broude/M.D.Garrard, 1982, S. 296.
[5] K. Scheffler 1938, S. 29.
[6] Ebd.
[7] Ebd., S. 33.
[8] Vgl. R. Berger, 1982, S. 87ff.
[9] Zusammenfassung aus Gesprächen mit Künstlerinnen, A. Eromäki/ R. Herter/ I. Wagner-Kantuser, 1989, S. 135.
[10] Nabakowski/ Sander/ Gorsen, 1980, S. 194.
[11] Karin Gludovatz, Porträt des Künstlers als junger Gott, in: Sexy Mythos – Selbst- und Fremdbilder von Künstler/innen, Buch zur Ausstellung, NGBK, 2006, S. 51.
[12] Elsa Herzog in: Katalog, Die Frau von heute, 1929, S. 3.
[13] E. Spickernagel, Geschichte und Geschlecht: Der feministische Ansatz, in: Belting/ Dilly/ Kemp/ Sauerländer/ Warnke, 19965, S. 336.
[14] K. Scheffler, 1938, S. 39.
[15] K. Scheffler, 1938, S. 59.
[16] Ebd., S. 106.
[17] Ebd.
[18] Carol Duncan, Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting, in: N.Broude/ M.D.Garrard, 1982, S. 293.
[19] J. Chicago, in: R. Berger, 1987, S. 381.
[20] Ernst Kris/ Otto Kurz: Die Legende vom Künstler, 1980, in: A.Eromäki/ R.Herter/ I.Wagner-Kantuser, 1989, S. 160.
[21] Beatrice von Bismarck, Sexy after all these years, in: Sexy Mythos – Selbst- und Fremdbilder von Künstler/innen, Buch zur Ausstellung, NGBK, 2006, S. 29.
[22] Vgl. Karin Gludovatz, Porträt des Künstlers als junger Gott, in: Sexy Mythos – Selbst- und Fremdbilder von Künstler/innen, Buch zur Ausstellung, NGBK, 2006, S. 51.
[23] Essay von Linda Nochlin, 1970.
[24] A. Eromäki/ R. Herter/ I. Wagner-Kantuser, 1989, S. 139.
[25] Jenny Sorkin, in: L.G. Mark, 2007, S. 459f.
[26] Ebd., S. 460.
[27] I. Graw, 2003, S. 40.
[28] I. Graw, 2003, S. 78.
[29] Vgl. Nabakowski/ Sander/ Gorsen, 1980, S. 186f.
[30] J. Chicago, in: R. Berger, 1987, S. 379.
[31] Der Begriff multikulti ist seit Anfang der 90er Jahre in Gebrauch. Vgl. Schriften des Instituts für Deutsche Sprache, 2004, S. 222.
[32] Man vergleiche auch die parallel in der Werbung als ein Beispiel für ‚visual art’ sich vollziehende Wandlung von plakativer Ästhetik hin zu einer authentischen Image-Kampagne, die an gesellschaftliche Transformation geknüpft war; so schmückte sich z.B. Benetton sich als erster global player mit multiethnischen Werbebotschaften.
[33] Vgl.: I. Graw, 2003, S. 81.
[34] Linda Nochlin, Why have there been no great women artists?, Thirty years after, in: C. Armstrong/ C. de Zegher, 2006, S. 28.
[35] Sabine Schaschl in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 260.
[36] Aus dem Roundtablegespräch im Kunsthaus Baselland vom 6. September 2006, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 183.
[37] René Zechlin während der Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst in Lüneburg am 18. Oktober 2006, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 214.
[38] Andrea Geyer in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 234.
[39] Vgl. S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 168.
[40] Ebd.
[41] Toril Moi, Ich bin zwar keine Feministin, aber... – Wie aus dem Feminismus ein F-Wort wurde, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 219.
[42] Andrea Geyer, Anmerkungen zur Lehre der Kunst und des Feminismus, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 234.
[43] Linda Conolly über irische Feministinnen während der Podiumsdiskussion am 4. November 2006 in der Lewis Glucksmann Gallery, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 243.
[44] Vgl. Andrea Geyer in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 232.
[45] Arno Rink, zitiert in: Ute Thon, „Die Lüge Emanzipation“, in: Art. Das Kunstmagazin, Nr. 8, H. August, 2005, S. 50ff.
[46] Vgl. R. Mader, 2009, S. 18.
[47] Le Corbusier und Amédée Ozenfant, zitiert in: N. Broude/ M.D. Garrard, 1982, S. 316.
[48] Andrea Geyer, Anmerkungen zur Lehre der Kunst und des Feminismus, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 233.
[49] J. Chicago, in: R. Berger, 1987, S. 374.
[50] A. Eromäki/ R. Herter/ I. Wagner-Kantuser, 1989, S. 160.
[51] J. Chicago, in: R. Berger, 1987, S. 374.
[52] Ebd.
[53] Andrea Geyer, Anmerkungen zur Lehre der Kunst und des Feminismus, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 233f.
[54] Katy Deepwell, in: H. Munder, 2006, S. 52.
[55] Vgl. Statistisches Bundesamt, Studierende an Hochschulen -Vorbericht- Wintersemester 2010/2011. Fachserie 11 Reihe 4.1 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeHochschulenVorb,templateId=renderPrint.psml, S.70 f, Stand: 05.07.2011.
[56] Vgl. R. Berger, 1982, S. 87ff.
[57] G. Breitling, in: R. Berger, 1987, S. 354ff.
[58] Ebd.
[59] Andrea Geyer, Anmerkungen zur Lehre der Kunst und des Feminismus, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 233.
[60] Alle Angaben beziehen sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes: Mikrozensus, veröffentlich von der Bundeszentrale für politische Bildung, 2010, www.bpb.de, Stand: 19.02.2010.
[61] Claudia Nolte, Grußwort, in: Gabriele Münter Preis, 1997, S. 8.
[62] „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht der Enquete-Kommission, 2007, S. 290.
[63] Katharina Pfühl, Von Frau zu Gender und zurück? Oder: Warum Paradoxien sich nicht von selbst erklären, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 190f.
[64] Bettina Steinbrügge während der Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst in Lüneburg am 18. Oktober 2006, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2003, S. 212.
[65] Hanne Loreck während der Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst in Lüneburg am 18. Oktober 2006, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2003, S. 212.
[66] Hamann/ Linsinger, 2008, S. 118f.
[67] Sabine Schaschel während der Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst in Lüneburg am 18. Oktober 2006, in: S.Schaschl/B.Steinbrügge/R.Zechlin, 2008, S. 213.
[68] Katy Deepwell, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 251.
[69] Vgl. I. Graw, 2003, S. 36.
[70] Carol Duncan, Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting, in: N.Broude/M.D.Garrard, 1982, S. 311.
[71] Sabine Kampmann, Some Girls Are Bigger Than Others, in: Sexy Mythos – Selbst- und Fremdbilder von Künstler/innen, Buch zur Ausstellung, NGBK, 2006, S. 110.
[72] Nabakowski/ Sander/ Gorsen, 1980, S. 202.
[73] U. Beck, 1986.
[74] R. Florida, 2002.
[75] Ebd., S. 260.
[76] Bettina Steinbrügge während der Podiumsdiskussion in der Halle für Kunst in Lüneburg am 18. Oktober 2006, in: S. Schaschl/ B. Steinbrügge/ R. Zechlin, 2008, S. 215.
[77] 40% der befragten Künstlerinnen gaben an, aufgrund des Familienwunsches die Karriere bewusst nach hinten verschoben zu haben, siehe: Claudia Nolte, Grußwort, in: Gabriele Münter Preis, 1997, S. 8.
[78] Vgl. Gender Mainstreaming, Publikation des Ministeriums für Bildung und Forschung, 2001.
[79] Mechthild Cordes, Gleichstellungspolitiken: Von der Frauenförderung zum Gender Mainstreaming, in: Becker/ Kortendieck, 2010, S. 924.
[80] Vgl. Gender Mainstreaming, Publikation des Ministeriums für Bildung und Forschung, 2001.
[81] Ebd.
- Arbeit zitieren
- Felicitas Aull (Autor:in), 2011, Sexismus in der Kunst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183133
Kostenlos Autor werden








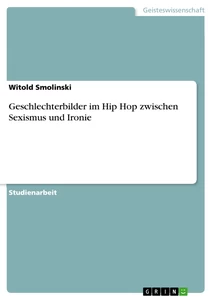







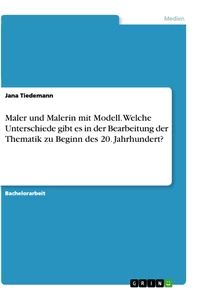


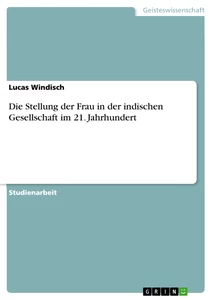


Kommentare