Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Angst- und Panikstörungen
2.1 Begriffsdefinition und Divergenz
2.2 Angsterkrankungen
Exkurs Diagnostikkriterien
2.3 Generalisierte Angststörung
2.3.1 Klassifikation
2.3.2 Symptomatik
2.3.3 Prävalenz und Komorbidität
2.4 Panikerkrankungen
2.4.1 Panikstörung
2.4.2 Klassifikation
2.4.3 Symptomatik
2.4.4 Prävalenz und Komorbidität
Zwischenfazit zu
3 Ätiologie und Erklärungsansätze
3.1 Bindungstheoretischer Ansatz nach Bowlby und Ainsworth
3.1.1 Bindungstypen nach Bowlby
3.1.2 Psychopathologische Konsequenz der Bindung
3.2 Psychoanalytischer Ansatz nach Freud
Exkurs (Angst-)Abwerhmechanismen
3.3 Lerntheoretischer Ansatz
3.3.1 Anwendung der Konditionierung auf Angst- und Panikstörungen
3.3.2 Systematische Desensibilisierung
3.3.3 Massierte Konfrontation
3.4 Kognitive Ansätze
3.4.1 Angstmodell nach Lazarus
3.4.2 Kognitionsmodell der Angst nach Wells
3.4.3 State-Trait Angstmodell nach Spielberger
Zwischenfazit zu3
4 Traditionelle Bewältigungsstrategien bei Angst- und Panikstörungen
4.1 Erkrankung als Stress (Stress-Diathese Modell)
4.2 Stressbewältigungsprozess gemäß Lazarus
4.3 Theorie zur Ressourcenerhaltung nach Hobfoll (multiaxiales Coping)
4.3.1 Individuellesvs. Soziales Coping Zwischenfazit zu
5 Analyse des Austausches von Betroffenen in Internetforen
5.1 Erläuterung des Methodischen Vorgehens
5.1.1 Grundlage der qualitativen Analyse dieser Arbeit
5.1.2 Zugrundeliegende Forschungsfrage der Analyse
5.1.3 Definitorische Erläuterung zum vorliegenden Material/ Bestimmung des Analysegegenstands
5.1.4 Was ist ein Internetforum?
5.1.5 Wie wird in einem Internetforum kommuniziert?
5.1.6 Überprüfung der Aussagekraft der Dokumente
Zwischenfazit zu 5.1
5.2 Thematisierung der Erkrankung in Internetforen - Strukturierung des
Untersuchungsgegenstands
5.2.1 Einstieg in das Forum
5.2.1.1 Vorstellung neuer Teilnehmer
5.2.1.2 Motivation der Betroffenen zur Teilnahme am Forum
5.2.1.3 Berichte über die persönliche Krankheitsgeschichte
5.2.2 Informationsaustausch überdie Krankheit
5.2.2.1 Das Wissen über die eigene Erkrankung erweitern
5.2.2.2 Abklärung der Symptomatik mit anderen Betroffenen
5.2.3 Austausch über therapeutische und medikamentöse
Behandlungsmöglichkeiten
5.2.3.1 Therapeutische Behandlung - Therapeutensuche und Therapieberichte
5.2.3.2 Medikamentöse Behandlung - Pro und Kontra zur Medikamenteneinnahme
5.2.3.3 Die Rolle forenmitwirkender Experten
5.2.4 Erfahrungsaustausch im Umgang mit der Krankheit
5.2.4.1 Austausch über die Auswirkungen der Störung in Familie und Partnerschaft
5.2.4.2 Die Krankheit als Belastungsprobe für Angehörige
5.2.4.3 Schilderung von Rückschlägen und Erfolgserlebnissen
Zwischenfazit zu 5.2
5.3 Internetforen als Hilfe zur Bewältigung
5.3.1 DerNutzen des Austauschs
5.3.1.1 Das unterstützende Element
5.3.1.2 Das anonyme Element
5.3.1.3 Das ungebundene Element (Zeit und Raum)
5.3.2 Die Gefahren des Austauschs
5.3.2.1 Das isolierende Element
5.3.2.2 Das verschlimmernde Element
5.3.2.3 Das anonyme Element II
Zwischenfazit zu
6 Schlussbetrachtung und Ausblick111 Appendix
Fragestellung und Ergebnisse der offenen Umfrage
Datenverzeichnis zu den Diagrammen 1 bis 4
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Nun mal keine Panik auf der Titanic“ oder „Sei doch kein Angsthase“, sind zwei der wohl allseits bekannten Redewendungen aus dem Alltag. Wenn Angst und Panik allerdings nicht, wie in diesem Fall, scherzhaft angebracht werden, sondern Menschen wahrhaftig unter diesen Erscheinungen leiden, dann meint man eine andere Dimension, die der krankhaften Angst. Die vorliegende Arbeit soll sich mit eben diesem Phänomen der chronischen und ungesunden Ausprägungen von Angst beschäftigen.
Dazu soll in einem ersten Schritt eine Einführung in das Thema der Angst- und Panikstörungen vorgenommen werden. Darin soll geklärt werden, um welche medizinische Ausprägung es sich dabei im Einzelnen handelt und wie sie von einander abzugrenzen sind. Daran sollen sich nachfolgend jene Theorien und Ansätze anschließen, welche versuchen, die Ursachen des Phänomens der gestörten Angst und Panik zu erklären. Um ein weitläufiges Bild der möglichen Gründe für solch eine Erkrankung darstellen zu können, werden dazu verschiedene psychologische Paradigmen herangezogen. Unterjenen Ätiologietheorien soll sich jedoch keine als die einzige oder ausschließliche Begründung für die Entstehung von Angst- und Panikstörungen verstehen. Sie sollen eher ergänzend zueinander aufgefasst werden, um die möglichen Entstehungswurzeln einer solchen Erkrankung in einem umfassenden Rahmen abbilden zu können. Der daran angeschlossene thematische Block soll sich mit den traditionellen Bewältigungsmethoden, wie sie auch bei psychischen Erkrankungen zum Einsatz kommen, beschäftigen. Hierzu werden ebenfalls differenzierte Theorien vorgestellt, die ihrerseits jeweils eine eigene Art der Bewältigung vorsehen.
Im Anschluss daran, soll dann der empirisch-analytische Teil dieser Arbeit folgen, der zunächst mit einer Einführung zu der Thematik der Internetforen beginnt. Dieses theoretische Vorwissen ist notwendig, um die daran angeschlossene Analyse von Forenbeiträgen angemessen verstehen zu können. Die Forschungsfrage, die der Analyse zu Grunde liegt, soll wie folgt lauten: „Wie kommunizieren Menschen mit Angst-und Panikstörungen in Internetforen untereinander?“ Um diese Frage beantworten zu können, wird neben den Themen, die diskutiert werden (also das Was), ein spezieller Fokus auf die Art und Weise der Kommunikation (das Wie) mit den dahinter stehenden Motiven gerichtet. Der darauf folgende Themenblock soll sich mit dem möglichen Nutzen und den möglichen Gefahren eines internetbasierten Austausches beschäftigen und aufzeigen, wo Betroffene Vor- und auch Nachteile bei dieser Art der Bewältigung sehen.
Das letzte Kapitel soll sich abschließend als kritische Fragestellung verstehen, wie der Austausch von Menschen mit Angst- und Panikstörungen via Internetplattform tatsächlich bei der Bewältigung der Störung helfen kann und welche Bedeutung dies für den zukünftigen Umgang mit der Erkrankung haben kann. Mit der Diskussion dieser Frage und den möglichen Prognosen für die Zukunft der Bewältigung von Angst- und Panikstörungen soll diese Arbeit dann schließen.
2. Angst- und Panikstörungen
2.1 Begriffsdefinition und Divergenz
Bei der Betrachtung psychischer Krankheitsbilder, wie sie beispielsweise von Laien vorgenommen wird, begegnet man häufig dem folgenden Fehler: Begriffe me Angst und Panik werden entweder synonym oder nur mit leichten Unterscheidungen verwendet. Obwohl im alltäglichen Gebrauch Floskeln wie panische Angst erleben durchaus eine Gültigkeit inne haben, so gilt es doch bei der fachlichen Untersuchung dieser Phänomene klar zu unterscheiden. Das folgende Kapitel soll diese Unterscheidung herausarbeiten und aufzeigen, welche mögliche Gemeinsamkeiten die beiden Störungsbilder verbinden und an welchen Punkten genau sie voneinander divergieren. Um diese Trennung auch formell zu unterstützen, soll in einem ersten Schritt der Bereich der Angsterkrankungen näher betrachtet werden. Im Anschluss daran wird der Fokus dann auf das Areal der Panikerkrankungen gelegt. Das darauf folgende Zwischenfazit soll abschließend zu dem Kapitel auf die deutlichsten Unterschiede der beiden Störungsbilder hinweisen.
2.2 Angsterkrankungen
Um den Bereich der Angsterkrankungen genau erfassen zu können, ist es im Vorfeld notwendig zu klären, ab wann Angst zu einer Erkrankung wird.
Angst in ihrer ursprünglichen Natur ist wesentlicher Bestandteil des menschlichen Wesens. Es ist ein Gefühl, das wir kognitiv als auch physiologisch wahrnehmen können. Kognitiv in sofern, als dass unsere Aufmerksamkeit gesteigert und unser Geist für neue Reize geschärft wird. Auf der physiologischen Ebene macht sich Angst beispielsweise durch einen erhöhten Herzschlag, eine flachere Atmung, eine erhöhte Anspannung der Muskeln sowie ein Feuchtwerden der Hände und Füße bemerkbar. In ihrer reinsten Form erfüllt sie für uns eine Schutzfunktion: sie informiert uns durch körperliche Signale reale und gefährliche Situationen zu erkennen und steuert zudem vegetative Prozesse, die uns eine schnellere Flucht aus solchen Situationen ermöglichen können. Durch diesen zweiseitigen Prozess derWarnung hat Angst evolutionistisch zum Überleben des Menschen beigetragen. Somit gilt sie nicht nur als eines der intensivsten menschlichen Gefühle, sondern auch als eines der wichtigsten.
Wenn Angst aber über dieses gesunde Maß hinaus Warnungen an den Menschen abgibt und dies auch in Situationen geschieht, die in keiner Weise (lebens-) bedrohlich sind, so muss man sich der Frage stellen, ob es sich dabei nicht um eine Störung des Angstmechanismus handelt. Der Begriff Störung soll in diesem Fall nicht abwertend gemeint sein: „Psychologischpsychiatrische Begriffe wie 'gestört', 'krank', 'psychogen' oder 'psychosomatisch', und ihre jeweilige semantische Bedeutung sind kulturell determiniert und für die so Diagnostizierten folgenreich.“1, hält Sigrun SCHMIDT-TRAUB fest. Obwohl dieser Aussage unbestritten Glauben geschenkt werden kann, so soll in dieser Arbeit der Störungsbegriff synonym zum Wort Erkrankung benutzt werden, und keinesfalls einen determinierenden Charakter in sich tragen. Er soll vielmehr darauf hinweisen, dass die teilweise unkontrollierbaren Ängste das Leben der Betroffenen selbst stören, und es in erheblichen Maße beeinträchtigen können. Um nun also von einer Störung sprechen zu können, muss in einem ersten Schritt geklärt werden, ab wann Angst über ein normales Level hinaus geht, und wie sich krankhafte Angst von der gesunden Form unterscheidet. HOFFMANN führt dazu aus: „Pathologische Ängste werden dagegen durch objektiv nicht bedrohliche Situationen ausgelöst, bestehen über die auslösende Situation hinaus und sind im Ausmaß gegenüber dem Anlass unangemessen.“2 MORSCHITZKY konkretisiert zudem: „Bei krankhaften Ängsten steht die Intensität der Angst in keinem realen Verhältnis zum Ausmaß der subjektiv erlebten Bedrohung. Die Betroffenen wissen dies, können ihren unangemessenen Angstaffekt jedoch nicht unter Kontrolle bringen.“3 und spezialisiert darüber hinaus, dass jene unangemessenen und krankhaften Ängste unter drei unterschiedlichen Bedingungen auftreten können:
„1. Die Bedrohungseinschätzungistfalsch. Ein Beispiel ist die Fehleinschätzung von wenig oder nicht bedrohlichen Umständen als sehr bedrohliche Gegebenheiten (z.B. bei Phobien).
2. Die Alarm- oder Bedrohungsstrukturen selbst sind gestört, d.h. es liegen Krankheitsprozesse des Gehirns vor. Ein Beispiel ist die spontane und anfallsweise Angst (z.B. epileptische Angstattacken als Folge von Störungen des mediobasalen Schläfenlappens).
3. Das Warnsignal Angst klingt nichtab. Es erfolgt keine Gewöhnung, sondern vielmehr eine Erregungs- und Angsteskalation. Ein Beispiel ist die posttraumatische Belastungsstörung mit anfangs angemessener, später immer ausufernder Angst.“4
Diese krankhaften Ängste können vielerlei Ursachen haben, die zum Teil sehr greifbar und einfach zu erklären sind. Ein Beispiel dafür wäre eine so genannte objektzentrierte Phobie, wie sie beispielsweise bei einer Spinnenphobie vorliegt. Hierbei lässt sich deutlich sagen, wovor genau eine Person Angst entwickelt hat. Das Objekt „Spinne“ ist real und greifbar. Auch wenn Menschen die sich vor Spinnen fürchten gemäß Morschitzky eine falsche Bedrohungseinschätzung vornehmen, so lässt sich für außen-stehende Personen in diesem Fall die Angst vor dem Objekt logisch erklären und aufgrund des weit verbreiteten Ekels vor Spinnen zum Teil sogar nachvollziehen.
Jedoch ist das Spektrum von Angsterkrankungen ebenso weit gestreut wie facettenreich. In anderen Fällen ist der Angstauslöser nicht so einfach zu deuten. Ein Exempel bei dem dies so ist, ist die „Generalisierte Angststörung“, kurz GAS, die in diesem Abschnitt im Fokus des Interesses stehen soll. Bei diesem Störungsbild lässt sich kein greifbares und reales Objekt, wie bei der oben genannten Spinnenphobie, ausmachen. Die Frage, die sich hierbei aufdrängt ist also: Wovor fürchten sich Personen, die an einer generalisierten Angststörung leiden? Um genau diese Frage beantworten zu können, bedarf es der Notwendigkeit eines Kriteriums, welches in der Lage ist, gestörte Angst in ihren einzelnen Bereichen und Facetten klassifizieren zu können.
Exkurs Diagnostikkriterien
In der klinischen Praxis haben sich zu diesem Zweck zwei Klassifikationshandbücher durchgesetzt. Zum einen das von der „Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung“ (kurz APA) entwickelte Diagnostisches und Statistisches Handbuch PsychischerStörungen, was unter der Kurzform DSM bekannt wurde. Die erste Auflage dieses Werkes erschien 1952 unter dem Titel DSM I, welches damals noch ausschließlich in englischerSprache geführt wurde. Durch die weltweite Vernetzung der vergangenen Jahrzehnte wurden Übersetzungen auch in die deutsche Sprache möglich. Die stetige Weiterentwicklung des Handbuches (die römischen Ziffern bilden die jeweilige Auflage ab) ermöglichte das Erscheinen der zuletzt aktuellsten Version in deutscher Sprache unter dem Titel: DSM-IV-TR, im März 2003. Das TR steht in diesem Fall für das Wort Textrevision, welches darauf hindeutet, dass der Weg für das folgende DSM-V bereits geebnet worden ist. Inhaltlich unterteilt das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wie es im Originaltitel genannt wird, psychische Krankheiten in 16 Kategorien und zwei Achsen, in die eine Erkrankung, je nach Diagnose eines Fachmannes, eingeordnet werden kann.
Zum anderen erwies sich in der Praxis das Internationale Klassifikation derKrankheiten, welches im englischen Originaltitel International Classification of Diseases heißt, als überaus hilfreich. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation (kurz: WHO) für den englischsprachigen Markt, vornehmlich aber die USA herausgegeben und seine Wurzeln ragen weit in das 19. Jahrhundert zurück. Dieses Handbuch ist allerdings nicht international universell, so dass es in Deutschland vom „Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information“ (kurz DIMDI) unter dem aktuellen Titel „ICD-10-GM“ herausgegeben wird. Das GM bezieht sich auf die deutschsprachige Modifikation (german modification). Der Aufbau des ICD-10 unterscheidet sich grundsätzlich zum DSM-IV, da es sich um ein drei Band starkes Werk handelt, das sich inhaltlich mit einer einachsigen Klassifikation begnügt. Krankheiten lassen sich gemäß ICD-10 alphanumerisch durch die Codierung von A00 bis Z99 und in ihrer Ausprägung hierarchisch (z.B.: F40.0= Agoraphobie, F40.1= Soziale Phobie etc.) unterteilen. Insgesamt werden 21 Krankheitskapitel erfasst, die ihrerseits wiederum 261 Krankheitsgruppen unter sich vereinen.
Im Vergleich zum Diagnostisches und Statistisches Handbuch PsychischerStörungen erscheint das Internationale Klassifikation derKrankheiten somit das weitaus umfangreichere und detailliertere Handbuch zu sein.
Keines der beiden Werke bildet jedoch den alleinigen und perfekten Leitfaden zur Klassifikation psychischer Störungen ab, weswegen häufig beide Werke zu Rate gezogen werden. Darüber hinaus gibt es sowohl für das DSM-IV, als auch für das ICD-10 negative Stimmen, die die Einteilung und Darstellung der Krankheiten stark kritisieren. Besonders in den USA werfen diverse Journalisten den mitwirkenden Ärzten (und anderen Autoren) des DSM-IV vor, Geld von der Pharmaindustrie anzunehmen, um bestimmte Krankheitsbilder als eigene Diagnose zu kategorisieren und somit den Verkauf bestimmter Psychopharmaka zu fördern. In der Ausgabe der New York Times vom 17. Dezember 2008 griff der Journalist Benedict Carey diese Vermutungen kritisch auf:
„Scientists who accepted the invitation to work on the new manual - a prestigious assignment - agreed to limit their income from drug makers and other sources to $10,000 a year for the duration of the job. (...) This being the diagnostic manual, where virtually every sentence is likely to be scrutinized, critics have said that the policy is not strict enough. They have long suspected that pharmaceutical money subtly influences authors’ decisions. Industry influence was questioned after a surge in diagnoses of bipolar disorder in young children. Once thought to affect only adults and adolescents, the disorder in children was recently promoted by psychiatrists on drug makers’ payrolls.“5
Dieser Vorwurf wird auch in der Dokumentation des Senders Arte „Das Glück aus der Dose“ aufgegriffen. Obwohl die Dokumentation ihren Fokus auf die Behandlung von Kindern mit bipolaren Störung gelegt hat, ist auch das Thema der Geldmacherei mit verschriebenen Medikamenten wichtiger Bestandteil: „Die Absicht dieser Diagnose ist meines Erachtens, eine Rechtfertigung für das Benutzen und den Verkauf möglichst vieler Medikamente (...)“, so der Psychiater Dr. Dominick Riccio.6
Dr. John Abramson, eine ehemaliger Psychologe, der heute als Dozent tätig ist, schrieb den Bestseller „Overdosed America“. Er kritisiert in der Dokumentation:
„Es gibt sicherlich einen Zusammenhang zwischen der Finanzierung und der Entstehung und Verbreitung der Erkenntnisse. Man könnte meinen, dass Ärzte, die Kindern helfen wollen, ihr Ziel nur mit teuren Medikamenten erreichen, an Stelle der alternativen Methoden, die es schon vor den Medikamenten (...) gab.“7
Darüber hinaus kritisiert HOFFMANN: „Obwohl das DSM vorgibt, vom Konzept her neutral zu sein, begünstigt es eindeutig das biologische Krankheitsverständnis.“8 Somit lässt sich erkennen, dass die Anerkennung der Handbücher zur Klassifikation psychischer Störungen auch heute noch sehr wohl umstritten ist. Trotz dieser Vorwürfe gilt das DSM-IV nach wie vor als verlässlicher Leitfaden zur Klassifikation und gilt neben dem ICD-10 aufgrund seiner ausführlichen Einteilung in der Praxis großen Zuspruch.lm Folgenden soll nun eine genauere Betrachtung der Störungsbildererfolgen, die im Fokus der weiteren Untersuchung stehen sollen.
2.3 Generalisierte Angststörung
Der nachstehende Abschnitt soll sich eingehender mit dem Krankheitsbild der der GAS befassen und neben den klassifizierenden Merkmalen der Störung, die Haupt- und Nebensymptomatik an Beispielen darstellen und den Verlauf der Störung aufzeigen. Dazu werden jeweils einzelne Unterpunkte gebildet, um formell zwischen den einzelnen Kategorien unterscheiden zu können. Das therapeutische Vorgehen bei Patienten mit generalisierter Angststörung soll in diesem Kapitel noch keine Bedeutung finden, da dies im weiteren Verlauf unter Kapitel 4 „Traditionelle Bewältigungsstrategien bei Angst- und Panikstörungen“ noch intensiver behandelt wird.
2.3.1 Klassifikation
Wie bereits in 2.2 erwähnt, spielen die diagnostischen Handbücher DSM-IV und ICD-10 eine bedeutende Rolle bei der Klassifikation psychischer Krankheiten. Durch ihren unterschiedlichen inhaltlichen Aufbau, stimmen sie jedoch nicht immer in der genauen Einteilung einer Krankheit überein. Gerade im Bereich der Angststörungen divergieren die beiden Leitfäden stark von einander. Aufgrund dessen, soll nun auf den bedeutsamsten Unterschied bei der Klassifikation von Angststörungen zwischen DSM-IV und ICD-10 hingewiesen werden.
Während das DSM-IV Angststörungen als eine Erkrankung des (frühen) Erwachsenenalters klassifiziert, räumt das ICD-10 der GAS auch einen Bestand im Kindesalter ein. Unter dem Kapitel F41.1 kategorisiert es Angststörungen von Erwachsenen mit der Diagnose „Generalisierte Angststörung“. Für das Kindesalter wird aber eine eigene Diagnose gestellt. Unter F93.8 ist der Punkt „Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters“ zu finden, der mit „Störung mit Überängstlichkeit“ Ängste im Kindesalter unabhängig zum Erwachsenenalter diagnostiziert. Darüber hinaus umfasst die Klassifikation des DSM-IV zahlreichere andere Störungen unter dem Begriff Angststörungen, die gemäß ICD-10 als eigene Störungen zu betrachten sind, wie beispielsweise Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen oder Störungen, die mit Substanzindikation (z.B. Drogen, Medikamente, Alkohol) in Verbindung stehen.
2.3.2 Symptomatik
Allen Unterschieden zum Trotz, benennen beide Werke das gleiche Hauptsymptom bei Patienten mitGeneralisierter Angststörung: ständiges Sorgen.9 Neben diesem, dem wichtigsten charakteristischen Symptom der GAS, nennt das DSM-IV folgende weitere Diagnosekriterien, von denen mindestens drei aus sechs bei einer Person vorliegen müssen, damit die Störung als gesichert gilt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.110 : Diagnosekriterien der Generalisierten Angststörung
Das Zusammenspiel von körperlichen und kognitiven Symptomen wird auch anhand der Klassifikationskriterien des ICD 10 deutlich, welches neben dem Sorgen bis zu 22 weitere Symptome aufzählt, von denen mindestens insgesamt vier, zumindest aber eins aus der Kategorie „Vegetative Symptome“ auftreten müssen, die Herzklopfen oder Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern und Mundtrockenheit umfasst. Die Begleiterscheinungen werden weiterhin unterteilt in „Symptome, die den Brustkorb oder Bauchbereich betreffen“, wie beispielsweise Übelkeit, Magen-Darmbeschwerden oder Beklemmungsgefühle, „Psychische Symptome“ wie Schwindelgefühle, Gefühle der Unwirklichkeit, Angst vor Kontrollverlust und der Angst zu sterben. Darüber hinaus folgen „Allgemeine Symptome“, beispielsweise Empfindungen wie Kribbeln oder Kälteschauer, „Symptome der Anspannung“ wie Nervosität, Verspannungen der Muskeln oder Schluckbeschwerden sowie „Andere unspezifische Symptome“ wie beispielsweise Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit und Schlafbeschwerden.11
Darüber hinaus stimmt das ICD-10 mit dem DSM-IV überein, dass die Symptomatik nicht auf eine andere organische Erkrankung oder Substanzmissbrauch zurückzuführen ist.
Im Unterschied zum Diagnostisches und Statistisches Handbuch PsychischerStörungen bildet das internationale Klassifikation der Krankheiten jedoch noch andere psychische Störungen als Differentialdiagnose ab, sodass die Kriterien nicht denen einer Panikstörung, einer phobischen Angststörung, einer Zwangs- oder einer hypochondrischen Störung zuzuordnen sein dürfen. Diese Abgrenzung bestätigt noch einmal, dass das ICD-10 als diagnostisches Handbuch inhaltlich detaillierter angelegt ist. Fraglich bleibt aber gerade bei der Betrachtung der Differentialdiagnose, wie klar man von den oben genannten abzugrenzenden Erkrankungen trennen kann, da Symptome häufig in mehr als nur einem einzigen Krankheitsbild auftreten. Dieser Aspekt soll am Ende dieses Kapitels noch ausführlicher aufgegriffen werden, während an dieser Stelle dem Hauptcharakteristikum der GAS noch einmal besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.
Beide Handbücher benennen den mentalen Prozess des Sich-Sorgens als ausschlaggebendes Merkmal einer generalisierten Angststörung. BECKER beschreibt diesen Prozess wie folgt: „Sorgen sind Gedankenketten, die sich mit möglichen bedrohlichen zukünftigen Ereignissen beschäftigen. Sie werden begleitet vom Gefühl der Angst und als belastend erlebt. Eigentlich sind Sorgen eine Art mentaler Problemlösung.“12 Zu diesem Schluss kommen auch ERTLE, SCHNEIDER und MARGRAF, die aus der Sicht der Betroffenen festhalten: „Zunächst schreiben Personen mit Generalisierter Angststörung den Sorgen an sich eine positive Funktion zu. Sie sorgen sich, um sich auf mögliche schlimme Ereignisse 'vorzubereiten', sich selbst vor Enttäuschungen oder geliebte Personen zu schützen.“13
Diese Schutzfunktion der Sorgen hat somit einen noch nicht krankhaften Effekt. Das Sich-Vorstellen einer schlimmen und gefürchteten Situation ermöglicht ein geistiges Durchleben, sowie gleichzeitig ein Überstehen derselben und bietet auch eine Chance mögliche Handlungen vorzudenken (Beispiel: „Wenn abc passiert, das wäre ganz schlimm, aber dann könnte ich ja xyz tun, um es zu ertragen“). Die Inhalte der Sorgen drehen sich um alltägliche Themenbereiche wie Finanzen, Gesundheit, Familie oder Beruf. ERTLE et al. gehen weiterhin davon aus, dass durch genau diesen Prozess des mentalen Vorbereitens der Glaube an die Schutzfunktion negativ verstärkt werden könnte.14 Sobald das Sorgen jedoch über diese schützende Funktion hinaus geht, und der Prozess selbst für die Betroffenen zu einem belastenden und einschränkendem Zustand wird, handelt es sich nach WELLS um so genannte „Metasorgen“15 (englisch: „meta-worry“), also Sorgen über das Sorgen selbst, welche laut den bereits genannten diagnostischen Handbüchern einen zentralen Aspekt der Pathologie der generalisierten Angst darstellt.16
Darüber hinaus neigen Menschen mit GAS in ambivalenten Situationen, die sowohl gefährlich als auch als ungefährlich interpretiert werden können, dazu diese Situationen eher als gefährlich einzustufen. Zudem deuten ERTLE, SCHNEIDER und MARGRAF ergänzend an, dass: Patienten mit Angststörungen dazu tendieren, angstbezogene Informationen auf Kosten der Wahrnehmung anderer Informationen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“17 Im folgenden Abschnitt soll nun die Verbreitung der Generalisierten Angststörung und möglicher Begleiterkrankungen näher betrachtet werden.
2.3.3 Prävalenz und Komorbidität
Unter dem Begriff „Prävalenz“ definiert das deutsche Wörterbuch der Fremdwörter: „Prävalenz die]-: 1. Überlegenheit; das Vorherrschen. 2. die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines Zeitraumes bestehendes Häufigkeitsrate einer Krankheit (med.)“18 Für die Bearbeitung dieser Arbeit dient die medizinische Definition als Grundlage. Dabei ist die Prävalenz von der Inzidenz abzugrenzen, da diese nur die Anzahl der Weuerkrankungen erfasst. Prävalenzen werden häufig in Monatsabständen von 6,12 oder24 Monaten angegeben, obwohl auch häufig eine Lebenszeitprävalenz errechnet wird.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich Wissenschaftler immer eingängiger mit der Verbreitung von Angststörungen beschäftigt. Dazu wurden groß angelegte Studien vornehmlich in den USA, aber auch in Deutschland durchgeführt. Eine von ihnen ist die so genannte MFS, die Münchener Followup-Studie, die von WITTCHEN et al. in den achtziger und neunziger Jahren anhand der DSM-Ill Kriterien durchgeführt, und schließlich 1993 veröffentlicht wurde. Befragt wurden Menschen in der BRD im Alter von 18 bis 65 Jahren. Neben der GAS wurden zudem die Krankheitsbilder der Panikstörung, der Agoraphobie, derSpezifischen und der Sozialen Phobie sowie der Zwangsstörung untersucht. Während sich für die soeben aufgezählten Erkrankungen durchaus Daten mit Höchstwerten von bis zu 8,0% (Soziale Phobie) erfassen ließen, so konnten für die Generalisierte Angststörung kein Ergebnis erstellt werden.19
In einer vergleichbaren amerikanischen Studie aus dem Jahr 1994, der National Comorbidity Survey20, bei denen Menschen im Alter von 15 bis 54 Jahren befragt wurden, zeigte sich für die GAS ein Wert von 5,0%. Dies lässt den Schluss zu, dass Anfang der neunziger Jahre entweder noch keine fundierte Diagnose derGeneralisierten Angststörung in Deutschland vorlag, oder, dass die Erkrankung durch andere überlappende Symptome anderer psychischer Störungen (wie beispielsweise einer Major Depression) verdeckt wurde.
Nur 5 Jahre später erfasste die Early Developmental Stages of Psychopathology Study, kurz EDSP, die Ende der neunziger Jahre anhand der DSM-IV Kriterien durchgeführt wurde, eine Lebenszeitprävalenz der GAS von 0,8 %. Zielgruppe dieser Befragung waren 14 bis 24Jährige, die in Deutschland lebten. Dieser Anstieg lässt sich ungeachtet der Altersgruppe mit Sicherheit auf die präziseren Diagnosekriterien des DSM-IV im Vergleich zu Vorgängerversion zurückführen. Heute wird die GAS auf eine Prävalenz von circa 5% geschätzt:
„Die GAS ist ein recht häufige Angststörung, ungefähr 4-7% der Bevölkerung sind betroffen. Bei Frauen kommt die Störung etwas häufiger vor als bei Männer (sic). Die Störung beginnt im Alter von Mitte 20. Sie setzt i. Allg. allmählich ein und verläuft chronisch. (...) Die GAS ist die am häufigsten vorkommende Angststörung im Alter, die häufig erst - und vor allem bei Frauen - in späteren Lebensjahren einsetzt.“21
Darüber hinaus, scheint die GAS, die Angststörung mit der höchsten Komorbiditätsrate, also der Rate mit der höchsten Anzahl an weiteren, zeitgleich auftretenden Erkrankungen, zu bilden. GERLACH benennt 90,5 %22 und SCHMIDT-TRAUB geht sogar von 92%23 aus, wovon am häufigsten die Agoraphobie als komorbide Erkrankung auftritt. Für die Bearbeitung dieses Themas wird die Agoraphobie unter dem Punkt 2.4.4 noch genauer erklärt.
Als zweithäufigste Erkrankung gelten Depressionen, gefolgt von spezifischen und sozialen Phobien. Dies hat zur Folge, dass die Literatur einstimmig beschreibt, dass bis zu 50% der Menschen, die an einer Angststörung leiden, ein Minimum von zwei weiteren psychischen Erkrankungen aufweisen. Gerade im Rahmen der Diagnostik, ist dies ein besonders wichtiger Fakt, da möglicherweise die Symptome einer komorbiden Erkrankung im Vordergrund des Patienten stehen und die Angststörung lange unerkannt bleibt.
2.4 Panikerkrankungen
Wie bereits unter dem Punkt 2.1 erläutert, handelt es sich bei Angst und Panik nicht um die gleichen Phänomene. Ebenso unterschiedlich sind auch die daraus resultierenden Krankheitsbilder. Obwohl sich viele Parallelen zurGeneralisierten Angststörung ziehen lassen, soll derfolgende Abschnitt sich intensiv mit der Panikstörung befassen, die als eigenes Störungsbild zu verstehen ist. Interessant mag an dieser Stelle die Herkunft des Wortes „Panik“ sein. MARGRAF und SCHNEIDER führen seine Entstehung auf die griechische Mythologie zurück:
„So ist etwa das Wort »Panik« von dem Namen des altgriechischen Hirtengottes Pan abgeleitet. Pan zeichnete sich durch ein solch hässliches Äußeres aus, dass seine Mutter aufsprang und ihn verlies, als sie sah, was sie in die Welt gesetzt hatte. [...]Am meisten zürnte er, wenn man ihn im Schlaf störte, [...]. Dann neigte er dazu, Menschen ebenso wie Viehherden in plötzlichen Schrecken zu versetzen. Die dergestalt Überraschten flohen in heller Aufregung und viele von ihnen vermieden den Ort des Geschehens fortan. Pan half aber auch den Athenern, als diese von den Persern angegriffen wurden, indem er bei den Angreifern eine »panische« Angst auslöste und sie so in die Flucht schlug.“24
2.4.1 Panikstörung
Diagnostisch wird die Panikstörung meist von zwei Seiten betrachtet, nämlich anhand einer auftretenden Komorbidität mit oder ohne Agoraphobie. In einem ersten Schritt soll nun die Klassifikation der Panikstörung gemäß der bereits in angesprochenen Leitfäden DSM-IV und ICD-10 vorgenommen werden. Die darauf folgende Symptomatik soll anschließend die Grundproblematik der Störung aufdecken, also die Symptome nennen, die für die Diagnostik der Krankheit im Vordergrund stehen. Danach soll auch hier die Prävalenz dieser Störung betrachtet werden und unter dem gleichen Abschnitt folgt im Anschluss die Komorbidität mit detaillierterem Bezug auf die Agoraphobie.
2.4.2 Klassifikation
Ausschlaggebendes Merkmal für die Klassifikation einer Panikstörung ist das Auftreten von sogenannten Panikattacken. Diese werden von COMER wie folgt beschrieben: wiederholte, abgegrenzte Anfälle von Panik, die plötzlich auftreten und innerhalb von zehn Minuten ihren Höhepunkt erreichen.“25 Das „Paniknetz, ein Therapiezentrum des Psychotherapie-Verbund für Panikstörungen in Münster, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, definiert sie so: „Bei einer Panikattacke oder auch Panikanfall oder Angstattacke handelt es sich um einen Anfall starker Angst, der plötzlich, wie aus heiterem Himmel über den Betroffenen hereinbricht und der Körper bestimmte Alarmsignale produziert.(s/cj (...).“26 Zudem sind sie von einer Reihe körperlicher Symptome begleitet, wie das DSM-IV klar aufzählt:
„Eine klar abgrenzbare Episode intensiver Angst und Unbehagens, bei der mindestens 4 der nachfolgend genannten Symptome abrupt auftreten und innerhalb von 10 Minuten einen Höhepunkt erreichen:
(1)Palpitationen, Herzklopfen OderbeschleunigterHerzschlag,
(2)Schwitzen,
(3)Zittern oder Beben,
(4)Gefühl der Kurzatmigkeit oder Atemnot,
(5)Erstickungsgefühle,
(6)Schmerzen oder Beklemmungsgefühle in der Brust
(7)Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden,
(8)Schwindel, Unsicherheit, Benommenheit oder der Ohnmacht nahe sein,
(9)Derealisation (Gefühl der Unwirklichkeit) oder Depersonalisation (sich losgelöst fühlen),
(10) Angst die Kontrolle zu verlieren oder Verrückt zu werden,
(11) Angst zu sterben,
(12) Parästhesien (Taubheit oder Kribbelgefühle)
(13) Hitzewallungen oder Kälteschauer.“27
Wie bereits bei der Klassifikation der GAS, schließt sich das ICD-10, unter der Kennung F 41.0 Panikstörung (episodisch paraxymaie Angst), inhaltlich den DSM-IV Kriterien an. Als einzigen Unterschied unterteilt es die körperlichen Symptome in Unterkategorien wie „Vegetative Symptome“ (Herzklopfen, Schweißausbrüche u.ä.), „Symptome, die Thorax und Abdomen betreffen“ (Unruhegfühl im Magen, Atmenbeschwerden oder Beklemmungsgefühle), „Psychische Symptome“ (Angst vor Kontrollverlust, Gefühl „auszuflippen“, Angst zu Sterben) sowie „Allgemeine Symptome“28 (Wärme-/ Kälteempfindungen, Gefühl von Kribbeln). Zudem grenzt es ein weiteres Mal die Panikattacken nach den oben genannten Kriterien von ähnlich gearteten Attacken ab, die sich als Folge einer anderen psychischen Erkrankung diagnostizieren ließen. Darüber hinaus muss bei der Diagnose klarvon möglichen externen Auslösern einer Attacke wie beispielsweise dem Konsum von Drogen, der Einnahme von Medikamenten oder anderen Substanzen differenziert werden, die das Körperbewusstsein verändern können (wie beispielsweise große Mengen Koffein oder Nikotin).
Beide Manuale deuten zudem darauf hin, dass es sich bei Panikattacken nicht um eine eigene Störung handelt, sondern diese als immer wiederkehrender Bestandteil der Panikstörung zu verstehen sind. Darüber hinaus spielt die Befürchtung, eine weitere Attacke erleiden zu können, die in der folgenden Symptomatik noch genauer erklärt wird, eine wichtige Rollte bei der Klassifikation, da sie gemäß DSM-IV mindestens einen Monat nach einer Panikattacke bestehen muss.29
2.4.3 Symptomatik
Wie bereits angedeutet, sind die stetig wiederkehrenden Panikattacken das grundlegendste Symptom der der Panikstörung. Die bei diesen Attacken wahrgenommenen körperlichen Beschwerden können von den Betroffenen dabei nicht mit einem externen Reiz verknüpft werden, sodass sie in den Glauben versetzt werden ernsthaft erkrankt zu sein. Neben den physiologischen Merkmalen, wie sie im obigen Abschnitt bereits aufgezähltwurden, setzen darüber hinaus auch noch kognitive Symptome den Erkrankten zu, die sich häufig durch eine Angst vor Kontrollverlust, vor dem Tod oder Angst vor dem Verrücktwerden äußern. Da sie keine äußeren Reize für das Auftreten ihrer Panik als Auslöser verantwortlich machen können, werden diese kognitiven Symptome durch das Fehlen einer klar benennbaren Ursache verstärkt, was wiederum die körperlichen Symptome einer Attacke kräftigt. In diesem Fall sprechen Experten oft von einem „Teufelskreis der Angst“ wie MARGRAF und SCHNEIDER an einem bildhaften Beispiel verdeutlichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 230 : Teufelskreis der Angst
Die in dieser Abbildung gekennzeichneten „Äusseren Reize“, werden von den Betroffenen meist unbewusst wahrgenommen und hängen stark von dem physiologischen und psychologischen Wohlbefinden, derjeweiligen Tagesform, ab. Nach der Wahrnehmung dieser Reize, stellt sich ein Gefühl der Gefahr bei den Betroffenen ein, das im nächsten Schritt angstauslösend wirkt. Die aufkommende Angst führt zu Veränderung der Physiologie, welche bei dem Betroffenen als körperliche Symptome wahrgenommen werden. Auf Grund dieser nun veränderten Körperreaktionen entsteht wiederum der Gedanke der Gefahr. Diese Verkettung von Gedanken, Wahrnehmung und körperlichen Symptomen entwickeln sich zu einem sich wiederholenden Prozedere, welches sich in der Regel selbst aufrecht erhält und dazu führen kann, dass Menschen, die eine Panikattacke erlitten haben, ein Vermeidungsverhalten entwickeln, welches eine erneute Attacke verhindern soll. Dies ist dann das sichtbare Verhalten einer Person. Die Psychologen und Therapeuten des „Paniknetz“ Münster definieren dieses Verhalten wie folgt:
„Während einer Panikattacke suchen die Betroffenen oft Hilfe bei Begleitpersonen, rufen den Notarzt oder versuchen, sich an einen sicheren Ort zu flüchten (meist das eigene Zuhause). Viele Betroffene versuchen, angstauslösende Orte und Situationen möglichst vollständig zu meiden.(...) Die gefürchteten Situationen können in Begleitung oder durch sogenannte "Sicherheitssignale" (Medikamente, Telefonnummer des Arztes...) oft besser durchgestanden werden. Diese Verhaltensweisen führen jedoch nicht zu einer Besserung der Erkankung (sic).“30
Genau dieses Verhalten ist es, wie bereits in 2.4.1 angedeutet, das gemäß DSM-IV mindestens einen Monat nach einer Attacke bei einem Betroffenen vorliegen muss, um neben den Panikattacken selbst die Kriterien der Diagnose „Panikstörung“ zu erfüllen. Es wird auch häufig als „Angst vor der Angst“ bezeichnet.
2.4.4 Prävalenz und Komorbidität
Im Gegensatz zur GAS ergaben sich bei der Münchener Followup-Studie und der Early Developmental Stages of Psychopathology Study, auf die auch das Kapitel 2.3.3 bereits Bezug nimmt, erhebliche Unterschiede bei Betrachtung der Lebenszeitprävalenz. Während bei der MFS kein Wert für die Generalisierte Angststörung erfasst werden konnte, so kam die Studie zu 2,4% bei der Diagnose Panikstörung. Die EDSP ermittelte eine Lebenszeitprävalenz von 1,6%, immerhin ein doppelt so hoher Wert im Vergleich zur Generalisierten Angststörung. Allgemein geht man abervon einer großen Fluktuation aus, wie auch MARGRAF und SCHNEIDER darlegen: „Insgesamt schwankt die Lebenszeitprävalenz für die Panikstörung zwischen 0,5% und 4,7% (...)“31. Als Mittelwert gehen sie von circa 2,7% aus. SCHMIDT-TRAUB fügt noch hinzu, dass eine Lebenszeitprävalenz, die alleinig für Panikattacken gilt, von unglaublichen 22,7% besteht. Somit erlebt jeder fünfte Mensch in seinem Leben mindestens eine Panikattacke.32
Als unbestritten gilt jedoch, das Frauen fast doppelt so oft unter einer Panikstörung leiden als Männer. Zudem zählen auch allein lebende Personen, Arbeitslose, Geschiedene und verwitwete Personen, zu dem Kreis, bei dem die Störung häufiger auftritt.33
Wie bereits in 2.3.3 erwähnt, weisen Angststörungen als häufigste komorbide Komponente die Agoraphobie auf. Dabei handelt es sich um eine sehr einschränkende Erkrankung, die mit einem immensen Vermeidungsverhalten einhergeht, wie aufder Internetseite von „Paniknetz“ beschrieben wird:
„"Agoraphobie" ist ein griechisches Wort und bedeutet soviel wie "Angst (phobie) vor offenen Plätzen (agora)". Psychologen meinen damit heute aber eine Angst vor einer Vielzahl von Situationen, die die Betroffenen meiden. Diese Situationen sind dadurch gekennzeichnet, dass eine Flucht schwierig oder peinlich sein könnte oder aber dass Hilfe im Notfall nicht rechtzeitig zu erwarten wäre.“34
Dies kann sogar soweit führen, dass die betroffenen Personen die alltäglichen Situationen nicht mehr bewältigen können, wie beispielsweise Einkäufen, mit dem Auto/Bus zu fahren oder sich in einer großen Menschenmenge aufzuhalten. Häufig verlieren diese Menschen aufgrund ihrer ausgeprägten Agoraphobie auch das Vertrauen in sich und ihre Umgebung, so dass es zu einer völligen Isolation von der Außenwelt kommen kann. Dies hatzum Teil die schwerwiegende Konsequenz, dass Betroffene, aufgrund ihrer Panikattacken und dem starken Vermeidungsverhalten, überdurchschnittlich viele Fehltage an ihrem Arbeitsplatz haben, wie auch FAUST vermutet: „Panikattacken wird inzwischen auch ein hoher volkswirtschaftlicher Schaden zugerechnet, nicht zuletzt durch die gehäufte Zahl der Fehltage, die mehr als bei den meisten körperlichen Erkrankungen ausmachen sollen.“35 Im schlimmsten Fall kann dies zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, was eine drohende Isolation im negativen Sinne fördert.
Jedoch stellt die Agoraphobie nicht die einzige komorbide Erkrankung dar, auch der Medikamenten- und/oder Alkoholmissbrauch, sowie Depressionen begleiten die Panikstörung in einer Vielzahl der Fälle. MARGRAF und SCHNEIDER berichten von 71,4% mit affektiver Störung, wie beispielsweise einer Depression, oder einer bipolaren Störung, von 28,6% mit einer Medikamentenabhängigkeit und circa 50% der Erkrankten litten zudem unter einer Alkoholabhängigkeit.36 SCHMIDT-TRAUB fügt ergänzend hinzu:
„Im Vergleich zur reinen Panikstörung gilt Agoraphobie mit Panikstörung als die schwerwiegendere Störung [...], denn sie beginnt früher, dauert länger, führt zu mehr Behinderung und recht häufig zu Achse I-, jedoch selten zu Achse Il-Komorbiditäten (DSM-IV).“37
Aufgrund dessen ist bei der Differentialdiagnose unbedingt darauf zu achten, welche Symptome bei der betroffenen Person im Vordergrund der Erkrankung stehen. So ist es durchaus denkbar, dass in einem ersten Schritt eine Entwöhnung von Suchtmitteln stattfinden muss, bevor eine Therapie gegen die Panikstörung begonnen werden kann.
Zwischenfazit zu 2
Nach eingehender Erläuterung der beiden Krankheitsbilder ist die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen „Angst“ und „Panik“ deutlich geworden. Während es bei der Generalisierten Angststörung in erster Linie um den pathologischen Sorgenprozess und die Bewertung desgleichen geht, steht bei der Panikstörung das Vermeidungsverhalten nach einer erlittenen Panikattacke im Vordergrund. Obwohl viele der aufgezählten physiologischen und kognitiven Symptome in beiden Störungen Vorkomm]en und sich gegenseitig überlappen können, ist es bei der Diagnose ungemein wichtig, die Störungen klar von einander zu trennen.
Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass die Erkrankungen nicht in Folge von Substanzmissbrauch entstanden sind, da dies eine Änderung des therapeutischen Vorgehens mit sich zöge. Bei der Klassifikation der beiden Krankheitsbilder gelten das ICD-10 und das DSM-IV trotz massiver Kritik noch immer als die wichtigsten Leitfäden, um die Diagnosekriterien derjeweiligen Erkrankung abzubilden.
3. Ätiologie und Erklärungsansätze
Der nun folgende Abschnitt soll sich mit verschiedenen Theorien zur Entstehung von Angst-und Panikstörungen befassen. Darunter sollen die Gesamtheit der Einflüsse gefasst werden, die eine solche Erkrankung entweder auslösen oder eine Entwicklung begünstigen können. Der Begriff der „Ätiologie“ stammt aus dem Anwendungsgebiet der Medizin und bezeichnet die Ursachenlehre von Krankheiten.38 Häufig wird synonym auch der Begriff der Pathogenese verwendet.
Einige dieser Theorien sollen in ihrem Kern kurz dargestellt werden, um die unterschiedlichen Herangehensweisen von Erklärungsversuchen aufzuzeigen. Dabei soll eine Konzentration auf die wichtigsten Thesen des jeweiligen Ansatzes genügen.
3.1 Bindungstheoretischer Ansatz nach Bowlby und Ainsworth
Wie sooft bei psychischen Erkrankungen, suchen Therapeuten und Psychologen auch bei Angst- und Panikstörungen in der Kindheit der Betroffenen Person nach Ursachen, die für die Entstehung der Krankheit verantwortlich gemacht werden können. Eine dieser Theorien ist der bindungstheoretische Ansatz von Bowlby und Ainsworth, die sich mit dem Stadium derfrühen Kindheit befasst haben. John Bowlby forschte eingehend auf dem Gebiet der Bindungsforschung. Seine Forschungsergebnisse erzielte er aus Beobachtungen klinischer Untersuchungen, zu denen er als ausgebildeter Kinderpsychiater umfangreichen Zugang hatte. GRAWE schreibt über ihn: „Bowlby postulierte als Erster explizit ein angeborenes Bedürfnis, die physische Nähe einer primären Bezugsperson zu suchen und aufrechtzuerhalten.“39 Der Begriff der Bezugsperson muss nicht unbedingt die leibliche Mutter des Kindes sein. Es kann sowohl auch der Vater oder eine andere Person sein, wie beispielsweise die Großeltern. In den meisten der untersuchten Fällen stellte aber die Mutter des Kindes die Bezugsperson dar. Die Bindung zu dieser Person sichert gemäß Bowlby nicht nur das materielle Überleben des Kindes (durch die Versorgung mit Nahrung), sondern erfüllt darüber hinaus auch eine Schutzfunktion wie LANG darlegt: „In indirekter Weise vermittelt sie dem Kind eine Grundsicherheit in Bezug auf seine soziale und nicht-soziale Umwelt.“40
Somit ist die Interaktion mit dieser Person für das Kind und seine Entwicklung ungemein wichtig, da Bowlby davon ausging, dass die Bindungsmuster eines Kindes für sein späteres Leben und Erleben seiner Umwelt einen großen Einfluss ausüben.41
3.1.1 Bindungstypen nach Bowlby
Bei seinen Forschungen unterschied Bowlby zwischen vier verschiedenen Bindungsmustern, die auch Bindungsqualität genannt werden und die im Folgenden kurz veranschaulicht werden sollen. Der erste Typ benennt er als „sicher-gebunden“42. Die Kinder, die diesem Typ folgen, haben ein sicheres Verhältnis zu ihrer Bezugsperson. Sie haben die Erfahrung gemacht, sich auf diese verlassen zu können und ihr gegenüber ihre Bedürfnisse und Gefühle frei äußern zu können. Als Reaktion zeigen die Bezugspersonen sicher gebundener Kinder eine feinfühlige und aufmerksame Rückmeldung. SCHLEIFFER fasst eine sichere Bindung wie folgt zusammen:
„Bindungssicherheit ist als Beziehungskonstrukt in erster Linie Ausdruck des Vertrauens, welches das Kind in die Antwortbereitschaft seiner Bezugsperson setzt.“, und führt weiterhin aus: „Eine ausreichend sichere Bindung ist die Basis für angstfreie Neugier und Erkundungsbereitschaft und damit für das Lernen.“43
Somit hängen eine sichere Bindung und eine unbeschwerte Exploration dicht zusammen. Darüber hinaus kann eine sichere Bindung zudem ein beschützendes, auf die Zukunft gerichtetes Element in sich tragen wie SCHLEIFFER erklärt: „Eine frühe sichere Bindungsqualität schien negative Veränderungen im Elternverhalten gewissermaßen zu puffern.“44 So ist es auch wenig verwunderlich, dass Kinder mit sicherer Bindungsqualität in den meisten Fällen ein positives Selbstkonzept entwickeln, bei anderen Kindern häufig als beliebt gelten und in späteren Kommunikationssituationen selbstbewusst auftreten.
Anders äußert sich das hingegen bei dem zweiten Typ den Bowlby als „unsichervermeidend“ charakterisiert. Diese Kinder können sich nicht vollkommen auf eine feinfühlige Reaktion ihrer Bezugsperson verlassen und reagieren so weniger selbstbewusst als Kinder mit sicherer Bindung. Da sie erwarten, dass ihre geäußerten Wünsche und Bedürfnisse wahrscheinlich nicht feinfühlig zurück gekoppelt werden, vermeiden sie es diese zu zeigen. Bei der Vermeidung stehen insbesondere negative Erregungen wie Trauer, Wut, Enttäuschung und Angst im Vordergrund.
Das dritte Bindungsmuster stellt die „unsicher-ambivalente“ Bindung dar. Dieser Typ zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder die Rückkopplung ihrer Bezugsperson nicht eindeutig Vorhersagen können. Es kann die mögliche Reaktion nur schlecht oder nicht ausreichend vorhersehen, was zu einer erhöhten Unsicherheit führt. Der Fokus richtet sich stark auf die Bezugsperson, da sie höchstwahrscheinlich gerade in jenen Momenten vermehrt rückkoppelt, in denen sie antworten muss, wie beispielsweise in Problemsituationen. Dieser Lerneffekt für das Kind, kann weiterführend negative Folgen nach sich ziehen, wie SCHLEIFFER darlegt:
„Ein Kind, das gelernt hat, überwiegend und vorhersehbar als Problemkind adressiert zu werden, wird seine kommunikative Beteiligung auch in der Folgezeit [...] bevorzugt durch problemerzeugendes Verhalten herzustellen und aufrechtzuerhalten suchen45.“
Sie sind also stets darum bemüht, die Verlässlichkeit ihrer Bezugsperson abzufragen.
Dieses Muster äußert sich auch in Verhaltensweisen wie der Suche nach einer extremen Nähe, einem regelrechten Klammern. Dies verlangt von dem Kind seinerseits einen ungemein großen zeitlichen Aufwand, sodass es die neugierige Erkundung seiner Umwelt durch dieses Verhalten vernachlässigt.
Der letzte Typ wird gemäß Bowlby als „desorientiert-unsicherer“ eingestuft. Dieses Muster unterscheidet sich ein wenig von den anderen drei Typen, da es sich durch keine klar strukturierten Verhaltensweisen charakterisieren lässt, mit denen das Kind versuchen könnte, eine feinfühlige Antwort seiner Bezugsperson zu erzeugen. In vielen Fällen ist sich das Kind nicht sicher, ob es sich positiv oder negativ zu seiner Bezugsperson verhalten und sich ihr gegenüber eher passiv-abweisend oder aktiv-annähernd geben soll. Diese Widersprüchlichkeit des Verhaltens, welche in beiden Ausprägungen auftreten kann, wird als unangemessen und desorganisiert beschrieben. Das Auftreten dieses Bindungstyps ist von besonderem Interesse. SCHLEIFFER formuliert dazu: „Während in repräsentativen Stichproben etwa 15% aller Kinder dieses zusätzliche Bindungsmuster aufweisen, findet man es bei Hochriskiogruppen, d.h. Bei Kindern, die mit multiplen Risikofaktoren konfrontiert sind, in etwa 80% der Fälle.“46 Zu diesen Risikofaktoren werden unter anderem die familiären Lebensverhältnisse, sowie materielle Sicherheit des Elternhauses, Bildungsgrad und Gesundheitszustand der Eltern gezählt. Misshandlungen und Missbrauch von Kindern fällt auch unter diese Gruppe. Besonders auffällig ist, dass es bei Müttern mit psychischer Instabilität zu einer gegenseitigen AngstKopplung zwischen ihr und dem Kind kommen kann: „Das Kind erlebt es, dass es, wiewohl selbst ängstlich, gerade mit seiner Angst die Mutter ängstigt. Diese Reaktion auf Seiten der Bindungsperson muss wiederum das Kind ängstigen [,..].“47
Gerade in Bezug auf die Entstehung von Angst, wäre es somit wissenswert zu erfahren, welche Auswirkung das jeweilige Bindungsmuster für die weitere psychische Entwicklung des Kindes hat.
Der folgende Abschnitt soll versuchen, dieser Frage nachzukommen.
3.1.2 Psychopathologische Konsequenz der Bindung
Bevor mögliche Konsequenzen unsicherer Bindungen genannt werden können, ist zuerst einmal wichtig zu erwähnen, dass ein Bindungsmuster nicht unveränderlich ist. Trotzdem lässt sich festhalten, dass eine Veränderung eines Bindungstyps in frühen Lebensjahren einfacher zu vollziehen ist als in fortgeschrittenen, wie KlßGEN vermutet: „Die Modifikation eines internalen Arbeitsmodells ist möglich, aberje älter man wird, desto mehr Erfahrungen werden in das Arbeitsmodell integriert und desto schwieriger wird dessen Umstrukturierung.“48
Somit ist ein unsicher-vermeidendes Bindungsmuster nicht für den Rest des Lebens eines Kindes vorgegeben, es kann sich jedoch mit der Zeit und den Erfahrungen, die das Kind aufgrund dieses Typs macht, umso mehr festigen.
Einigkeit besteht darüber hinaus, dass die psychopathologische Konsequenz einer sicheren Bindung von allen Bindungstypen am wenigsten zu erschüttern ist. SCHLEIFFER vermutet zudem, dass sich eine sichere Bindung besonders im Kindes- und Jugendalter stark auf die Entwicklung von sozialen Ressourcen in möglichen Partnerschaften und im Kontakt zu Gleichaltrigen auswirkt.49 Des Weiteren begünstigt eine sichere Bindung ebenso die Fähigkeit, mit Problemlagen oder Belastungen besser umzugehen und dieser schneller und effektiver zu bewältigen. Im Umkehrschluss dazu lässt sich generell gehalten formulieren, dass eine unsichere Bindung, welchem Typ auch immer sie nun entsprechen möge, eher einen ungünstigen Grundstein für die weitere Entwicklung eines Kindes legt. Es liegt demzufolge nahe, dass Kinder mit einer unsicheren Bindung einer höheren Gefährdung unterliegen, psychische Krankheiten zu entwickeln. In Bezug auf Angststörungen hält LANGE noch einmal abschließend fest:
„Obwohl prospektive Studien über den Zusammenhang zwischen unsicherer bzw. ambivalenten Bindung und sozialer Angst fehlen, lässt sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse vermuten, dass Kinder ohne Bindungssicherheit ein höheres Risiko haben, im Erwachsenenaltereine Soziale Angststörung zu entwickeln.“50
3.2 Psychoanalytischer Ansatz nach Freud
Das zweite Modell zur Erklärung von Entstehungen von Angst- und Panikstörungen soll dem psychoanalytischen Ansatz gemäß Sigmund Freud folgen. Freud, der als der Begründer der Psychoanalyse bekannt ist, ordnete aufkommende Ängste, die sich als eine langfristige Störung manifestieren, als „Angstneurose“51 ein. Dieser Theorie zufolge handelt es sich bei einer solchen Neurose um einen Konflikt ambivalenter Triebregungen, die durch äußere Umstände (wie beispielsweise Erwartungen der Umwelt) zu einer massiven inneren Zerrissenheit führen können. Die Entstehung der Angst führt Freud laut seiner Triebtheorie auf sexuelle (libidöse) Wünsche zurück, denen nicht nachgekommen werden konnte oder, sodass sich als Folge dieser Nichtbefriedigung große Frustration entsteht.52 BODESOHN bringt es so auf den Punkt: „Es handelt sich hierbei also um die Aufstauung sexueller Energie ohne angemessene Entladung.“53 Als weiteren Ansatz nennt Freud Störungen der Eltern-Kind Beziehungen als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Neurose. So können sowohl eine extreme Überbehütung als eine Vernachlässigung (durch längere Trennungsphasen) sowie eine Überforderung des Kindes durch die Bezugsperson (vgl. 3.1) die frühkindliche Psyche massiv beeinflussen und Entstehungen von Panikstörungen im späteren Verlauf des Lebens begünstigen.54
Im Laufe seiner Arbeit entwickelte Freud zwei Begrifflichkeiten, die zu unterscheiden sind: Realangst und neurotische Angst. Unter Realangst definiert er jene Angst, die bei einer realen Gefahrensituation auftritt. Sie ist diejenige, die ein mögliche Kampf- oder Fluchtreaktion des Menschen in Gang setzen kann und die der Situation angemessen ist. Bei neurotischer Angst handelt es sich gemäß Freud um zwei zu differenzierende Formen: 1. die frei flottierende oder auch diffuse Angst und 2. die phobische Angst. Bei der ersten Form handelt es sich um eine objekt-unabhängige Angst mit unspezifischem Charakter, die sich, über längere Zeit erlitten, zu einer Angstneurose manifestieren kann. Bei der phobischen Angst handelt es sich um die Angst vor einem bestimmten Objekt, so wie wir sie heute auch als Phobie kennen.55
Die zentrale Theorie zur Entstehung von Angst gemäß Freud ist, dass sie „das Zentralproblem der Neurosen ist, da die Angst das Ergebnis unzureichender Maßnahmen der Angstbewältigung vom Ich ist.“56 Dadurch revidiert Freud seine erste Theorie zur Angstentstehung, welche unbefriedigte Konflikte der Libido als Auslöser bezeichnete.
Somit reiht sich die Angstentstehung in das Modell zur Struktur der Persönlichkeit mit den konkurrierenden Variablen Ich, Es, und Über-Ich ein. Um die aufkommende Angst nicht erleiden zu müssen reagiert das Ich mit der Aktivierung der Angstabwehr, mit Hilfe von psychischen Abwehrmechanismen. Sollten diese aber nicht ausreichen oder die Situation nicht bewältigen können, so können neurotische Ängste entstehen.57 MORSCHITZKY fügt hinzu: „Wenn die Angstabwehr versagt, wird die Gefährdung durch die einbrechenden Triebimpulse vom Ich bewusst erlebt, was einerseits zu Angst als Symptom führt, andererseits dem Ich als Signal für eine drohende Reizüberflutung dient.“58 Als Folge dieses Prozesses kann es zu einer Rückkopplung der Angst kommen, bis sie schließlich in einer Panikattacke münden kann.
Exkurs (Angst)-Abwehrmechanismen
Freud ging in seinen Lehren davon aus, dass die Psyche den Druck der normalen aber auch außergewöhnlich starken Belastungen des Lebens nicht ohne weiteres Stand halten kann.
Besonders dann greift die menschliche Psyche seines Erachtens auf internale Schutzmaßnahmen zurück, den so genannten Abwehrmechanismen. Diese sind psychische Strategien, die für all jene Konflikte benutzt werden, bei dem die Triebsteuerung eines Menschen mit dessen Moralvorstellungen in Konkurrenz steht59. Im Folgenden nun eine Aufstellung der Abwehrmechanismen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.360 : Abwehrmechanismen gemäß Freud
Um verstehen zu können wie diese Mechanismen wirken können sollen nun ein paar ausgewählte Beispiele folgen:
- 1. Beispiel Isolierung: Hier kann es bei Menschen, die einer Zwangsstörung unterliegen dazu kommen, dass sie sich emotional völlig von der angstauslösenden Situation (-wenn sie den Zwängen beispielsweise nicht folgen können und dann ein ängstlicher Leidensdruck entsteht-) gedanklich völlig abkoppeln. Die Situation ist den Personen bewusst, nur haben sie die emotionale Bindung dazu abgeschaltet, was es ihnen ermöglicht objektiv ihre Zwänge zu thematisieren.
- 2. Beispiel Verleugnung: Bei diesem Abwehrmechanismus kommt es häufig vor, dass Menschen die an einer Angststörung leiden, die Symptome zwar wahrnehmen aber nicht einsehen wollen, dass es sich um eine psychische Krankheit handelt. Oft werden bei diesem Abwehrmechanismus auch organische Gründe für eine psychische Erkrankung vorgeschoben, obwohl die Person körperlich gesund ist.
- 3. Beispiel Rationalisierung: Hierbei legitimieren Personen, die z.B. unter Panikattacken eiden durch die schlichte Einsicht „Ich bin krank und somit nicht funktionstüchtig“ den Rückzug aus dem sozialen Alltag. Die Erkrankung wird dabei nicht mit einem Versuch einer Therapie angegangen, sondern dient als Entschuldigung, nicht mehr am sozialen Miteinander teilhaben zu können.
- 4. Beispiel Identifikation: In diesem Fall kann eine Identifikation auch mit einer Person erfolgen, die etwas schlimmes erlitten hat und sich mit diesem Elend selbst identifiziert. Beispielsweise kann ein Mensch mit Agoraphobie sich schnell mit jemandem identifizieren, der in einer Menschenmenge einen Kreislaufzusammenbruch oder einen Herzinfarkt erlitten hat. Gerade wenn diese Menschen dem Phobiker besonders nahe stehen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er glaubt, ebenso in einer solchen Situation einen Zusammenbruch oder Infarkt zu erleiden.
Abschließend bleib festzuhalten, dass die Theorien von Sigmund Freund heutzutage etwas kritischer betrachtet werden. Darüber hinaus ist es unerlässlich zu erwähnen, dass nicht bei jedem Menschen mit psychischer Erkrankung automatisch bestimmte Abwehrmechanismen in gleicher Art und Weise in Kraft treten. Sollte man der psychoanalytischen Theorie folgen, so ist jeder Einzelfall individuell zu betrachten.
3.3 Lerntheoretischer Ansatz
Zur Erklärung von Angst- und Panikstörungen soll nun auch der lerntheoretische Ansatz betrachtet werden. Dieserentstammt aus dem psychologischen Paradigma des Behaviorismus. Der Ansatz geht von der Annahme aus, dass menschliche Wesen in Reiz-Reaktions- und Reiz-Folge-Beziehungen ihr Wissen aus der Umwelt in sich aufnehmen und sie durch diesen Prozess lernen. Zu diesem Wissen zählen auch die Erfahrungen von Gefühlen und Verhaltensweisen wie Freude, Trauer, Neid, Glück und im weiteren Fokus stehend: Angst.61 Zwei der grundlegenden Modelle, die erklären sollen wie diese Lernprozesse von statten gehen, werden nun eingehender beleuchtet. Im Augenmerk sollen dabei die „klassische Konditionierung“ sowie die „operante Konditionierung“ stehen. Begründer der „klassischen Konditionierung“ war der russische Physiologe Iwan Pawlow (1849 -1936). Mit seinen berühmten Experimenten an Hunden wies er Anfang des 20. Jahrhunderts einen Zusammenhang von Reizen und assoziativem Lernen nach. Zu Beginn seines Experimentes folgte auf einen unkonditionierten Reiz/Stimulus (UCS) eine unkonditionierte Reaktion (UCR).
In diesem Fall muss die Reaktion nicht erst erlernt werden, sondern sie liegt von Natur aus vor. Dies ist im übertragenen Sinne der Fall, wenn einem Menschen beim Geruch eines frisch gebackenen Kuchens das Wasser im Mund zusammen läuft. Diese Reaktion ist automatisiert. Koppelt man nun aber den Geruch dieses Kuchens mit einem anderen, völlig neutralen Reiz (NS), wie beispielsweise einem Musikstück und werden die beiden Reize immer gemeinsam dargeboten, so assoziiert der Mensch nach einiger Zeit den leckeren Kuchen beim Hören des Musikstückes, welches in jenem Fall dann die konditionierte Reaktion (CR) darstellt, da ihm dann auch beim alleinigen Hören des Musikstückes das Wasser im Mund zusammen laufen wird, auch wenn kein Geruch von leckerem Kuchen mehr zu riechen sein wird.62
Ebenso wie der Zusammenhang zwischen Kuchengeruch und Musikstücken angelernt werden kann, können aber auch Angstreaktionen gelernt werden. Als wohl bekanntestes Experiment gilt das des „kleinen Alberts“, welches John B. Watson (1878 -1958), einer der stärksten Verfechter der behavioristischen Theorie, im Jahr 1920 mit seiner Kollegin Rosalie Rayner durchführte.63 Da die Bedeutung der Stimuli bereits im obigen Beispiel verdeutlicht wurden, soll nach der Beschreibung des Experiments eine schematische Darstellung des erlernten Angstprozesses reichen.
Der kleine Albert war ein elf Monate alter männlicher Säugling. In dem Experiment ließen die Wissenschaftler in mit einer weißen Ratte spielen. Diese galt für den Junge als neutraler Reiz.
In einem weiteren Schritt wurde jedes Mal wenn der Junge das Tier anfassen wollte, ein ohrenbetäubendes Geräusch aus dem Hintergrund abgespielt. Das Kind erschrak und weinte schrecklich als es das Geräusch hörte. Nach dem siebten Durchgang wurde der Junge schon bereits dann unangenehm erregt, wenn er nur Blickkontakt zu der Ratte aufnahm.64 Albert hatte also auf negative Art gelernt, die Ratte mit dem lauten Geräusch zu assoziieren. Als Folge dieses Experimentes, kam es zu einer Reizgeneralisierung. Damit ist gemeint, dass das Kind bereits fünf Tage nach dem Versuch die Angst, die es vor der Ratte erlernt hatte, auf andere ähnliche Objekte übertragen hatte, wie beispielsweise Katzen, Hasen oder Kleidungsstücke aus Fell65. Das Experiment gilt aus heutiger Sicht nicht als unumstritten, da die Forscher den Jungen mit dieser immensen Angst unbehandelt entließen. Weitere Erkenntnisse über die weitere Entwicklung des „kleinen Alberts“ fehlen allerdings. So ist es gut möglich, dass er bis an sein Lebensende eine gravierende Angst mit sich trug, die er in diesem Experiment erlernte.
Das folgende Schaubild soll veranschaulichen wie der Prozess des Reiz-Reaktions-Schemas bei der klassischen Konditionierung im oben geschilderten Fall von statten gegangen ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.467 : Reiz-Reaktions Schema der klassischen Konditionierung
Die zweite Lerntheorie ist jene der „operanten Konditionierung“. Vorreiterdieser Annahme war Edward Lee Thorndike (1874-1949), auf dessen Arbeiten sich später dann Burrhus F. Skinner (1904-1990) bezog. Skinnerwares auch derden Begriff „operante Konditionierung“ im Rahmen seiner Forschung zur Lerntheorie in der Mitte des 20. Jahrhunderts prägte. Sein Ansatz, der auch unter dem Begriff „Lernen am Erfolg“ populär wurde, beschäftigte sich nicht nur mit dem Erlernen von Wissen, sondern vielmehr auch mit der Aufrechterhaltung des Gelernten. Der Begriff „operant“ lässt sich aus dem lateinischen Wort „operans/ operantis“ ableiten und bedeutet soviel wie wirksam oder tätig. Auf die Theorie der Konditionierung bezogen lässt es sich als „effektiv“ deuten. Dieses Modell geht folglich von der Hypothese aus, dass Verhalten auch durch den Effekt oder den Nutzen den es in sich trägt beeinflusst und verändert werden kann. Trägt es einen positiven Effekt mit sich, wird es also als angenehm empfunden, so wird das Verhalten verstärkt, was die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens des Verhaltens deutlich erhöht. Treten aber unangenehme Folgen des Verhaltens ein, so ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung umso geringer. Die Konsequenzen eines Verhaltens können sehr vielfältig sein. So kann auch durch ein Vorenthalten einer Belohnung ebenso eine Bestrafung ausgedrückt werden (beispielsweise Liebesentzug), wie durch ein Entgegenbringen einer direkten Bestrafung selbst (beispielsweise Tadel). Zusammenfassend lässt sich das
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Das Modell der operanten Konditionierung mit den Prinzipien der Verstärkung und Bestrafung
Generell stehen die Begriffe positiv und negativ bei diesem Ansatz nicht für eine Wertung, sondern entweder für Zugabe (+) oder Entnahme (-) von Reizen. Das Modell zeigt wie erwünschtes Verhalten durch positive Verstärkung (Lob, Anerkennung, materielle Gegenstände, etc.) und negative Verstärkung (z.B. durch eine Entlastung von Druck) gefördert werden kann. Im Umkehrschluss kann aberauch unerwünschtes Verhalten mit Verstärkung und Bestrafung unterbunden werden.
Der lerntheoretische Ansatz lässt sich noch um das „Lernen am Modell“ erweitern, welches aber hier keine weitere Beachtungen finden soll, um den Rahmen nicht zu sprengen.
Gerade bei derÄtiologie von Angst- und Panikstörungen ist es wichtig zu wissen, dass auch Gefühle erlernt und durch bestimmte Strategien (wie Verstärkung/ Bestrafung) aufrechterhalten werden können. Besonders für das (spätere) therapeutische Vorgehen ist dieses Wissen ausschlaggebend, um den geeigneten Lösungsansatz heraus aus diesem Gefüge von gelernter und aufrechterhaltener Angst und Panik zu finden. Mit diesen Handlungsmöglichkeiten soll sich der nun folgende Abschnitt genauer befassen.
3.3.1 Anwendung der Konditionierung Angst- und Panikstörungen
Bei der therapeutischen Anwendung spielen die Forschungsergebnisse der klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Rolle. Da Lernen als lebenslanger Prozess angesehen wird, gehen die therapeutischen Ansätze von der Annahme aus, dass auch angstsenkendes Verhalten (wieder) erlernt werden kann. Dies kann entweder mit Hilfe einer systematischen Desensibilisierung oder mit einer massierten Konfrontation geschehen. Beide Verfahren sollen nun kurz vorgestellt werden.
3.3.2 Systematische Desensibilisierung
Bei dieser Form der Angstbehandlung soll der Betroffene lernen, bisher erlebte Angstsituationen ohne Angst zu meistern. Die dreistufige Herangehensweise baut auf Expositionserlebnissen auf, die entweder rein mental („in sensu“), oder aber durch tatsächliche Handlungen („in vivo“) durchgeführt werden sollen. Als Einstieg in diese Behandlung wird dem Klienten zunächst ein Entspannungstraining nahe gebracht, bei dem gelernt wird, seinen Körper bewusst anzuspannen um ihn dann nach einer Weile ebenso bewusst zu entspannen.
Das grundlegende Modell dieser ersten Phase ist die progressive Muskelrelaxation66 (kurz: PMR) nach Edmund Jacobson (1888 - 1983). In einem zweiten Schritt wird dann eine Angsthierarchie zusammen mit dem Klienten erstellt, die in mehreren Stufen von den aushaltbaren Situationen bis hin zum Szenario der größten Angst führt. Der Betroffene soll versuchen, sich der nächst höheren, angstbeladenen Etappe Schritt für Schritt anzunähern. Die Einteilung dieser Hierarchie erfolgt in den Schritten von 0 für „nicht angstbeladen“ bis 10 für „am schlimmsten angstbeladen“. Diese Einteilung kann aber auch von 0 bis 100 führen, je nachdem wie die einzelnen Stufen sich von einander unterscheiden. Der dritte Schritt besteht anschließend darin, die ersten beiden miteinanderzu koppeln, ergo: in den angstauslösenden Situationen auf die erlernte Muskelrelaxation (die durch mentale Entspannungsübungen unterstützt werden kann) zurückzugreifen und ein Gefühl der Entspannung eintreten zu lassen. Bei Etappen, bei denen keine Angst auftritt, oder die Angst als nicht belastend erlebt wird, kann ein Weitergehen zu nächst höheren Stufe schneller vorgenommen werden. Sollte der Klient an einer Stufe allerdings seine Angst nicht durch die PMR in den Griff bekommen, so empfiehlt es sich diese erst einmal unbewältigt zu lassen und wieder zurück zu der zuletzt bewältigten Etappe zu gehen, um mit einer besser vorbereiteten Entspannung die angstbeladene Stufe noch einmal in Angriff zu nehmen.
3.3.3 Massierte Konfrontation
Die zweite Form der lerntheoretischen Angstbehandlung geht nicht von einer stufenweisen Annäherung an die Angst aus. Bei der massierten Konfrontation soll der Klient lernen, den Moment der massivsten Angst, so lange auszuhalten, bis sie sich auf ein normales Level senkt. Diese sogenannten angstflutenden Situationen (auch „Flooding“ genannt) zielen auf eine Habituation der Angst ab, und sollen dem Betroffenen als Lerneffekt das Aushaltenkönnen aufzeigen. Gerade bei agoraphobischen Klienten ist dies eine besonders häufig angewandte Methode. Da aber bei gerade diesen häufig ein Verhalten des Entkommens aus der beängstigenden Situation auftritt, empfiehlt REMSCHMIDT: „Damit diese Habituation eintreten kann, ist es in der Konfrontationsbehandlung erwünscht, dass die Angst möglich deutlich auftritt, und Flucht- oderVermeidungsreaktionen unterbunden werden.“67 Im Grenzfall müsste also der begleitende Therapeut den Betroffenen daran hindern, die Situation zu verlassen, um gewährleisten zu können, dass dieser die Übung auch bis zum Angsthabitus erlebt. Diese Methode verlangt vom teilnehmenden Klienten besonders viel Vertrauen in seinen Therapeuten, da dieser ihn gegebenenfalls nötigen muss, in der Situation zu verharren -natürlich nur in einem moralisch und ethisch zulässigen Rahmen. Aus diesem Grund ist eine genaue vorherige Planung des Floodings unerlässlich. Dem Klienten muss bewusst sein, auf welchen psychischen und möglicherweise körperlichen Stress er sich in dieser Exposition begibt, da eine fehlgeschlagene Übung dieser Art das Vertrauensverhältnis zum Therapeuten massiv schädigenden kann. Haben Klienten bereits schon mehrere angstflutende Übungen durchlebt, und verstehen worin der Sinn dieser Übung liegt, kann es auch therapeutisch hilfreich sein, den betroffenen Personen zu Eigenexpositionen zu raten, da gerade in Anbetracht der Kosten und des Zeitaufwandes einer Therapie die Anzahl solcher Übungen zusammen mit dem Therapeuten beschränkt sind.68
Abschließend lässt sich aberfür beide Lernmodelle festhalten, dass sie zeitlich sehr unterschiedlich verlaufen können und weder in der einen, noch in der anderen Methode eine Patentlösung zum bezwingen von Angst- und Panik gesehen werden kann.
3.4 Kognitive Ansätze
Nach der eingehenden Betrachtung verschiedener Paradigmen soll nun abschließend den kognitiven Ansätzen zur Erklärung von Angst- und Panikerkrankungen den gebührenden Platz eingeräumt werden. Dabei sollen die Theorien von Lazarus, Wells und Spielberger im Fokus des Interesses stehen. Während die Bindungstheorie von einer unsicheren Mutter-Kind Bindung, beziehungsweise Bezugsperson-Kind Bindung ausgeht, die psychoanalytischen Theorien eine unzureichende Angstabwehr benennen und die behavioristischen Modelle zur Angstentstehung von einem Reiz-Reaktionsschema als Erklärung sprechen, stehen bei den kognitiven Theorien die Bewertung der angstauslösenden Faktoren und Situationen im Vordergrund. Die folgenden drei Modelle greifen diese Bewertungstheorien auf und versuchen sie mit der Entstehung von Angst- und Panikstörungen zu verknüpfen.
3.4.1 Angstmodell nach Lazarus
Der amerikanische Psychologe Richard Lazarus (1922-2002) war einer der bedeutendsten Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Psychologie. Seinen Annahmen zu folge tritt Angst nur dann auf, wenn ein Individuum sich selbst nicht in der Lage sieht, eine bestimmte Situationen aus eigener Kraft zu bewältigen.69 Der Begriff der Bewältigung spielt in diesem Modell eine große Rolle. Psychologisch lässt er sich so definieren:,,[...], denn er verweist darauf, dass der Mensch seine eingeschätzte und von ihm interpretierte Situation zur Richtschnur seines Erlebens und Handelns macht.“70 MORSCHITZKY fügt hinzu: „Die kognitiven Angsttheorien verstehen Angst als Emotion im Sinne eines physiologischen Erregungszustandes und analysieren primär die mit den Ängsten verknüpften Erwartungen und Bewertungen.“71 Somit nehmen in diesem Modell zur Entstehung der Angst, die Kraft und der Einfluss der Gedanken als Werkzeug der Bewertung (kognitive Komponente) und die tatsächlichen Gegebenheiten der Umwelt in einem dynamischen Prozess eine wichtige Funktion ein. Lazarus bezeichnet eben dies in seiner Theorie als „Transaktion“72. Dabei können die Reize, die zu diesem Bewertungsprozess führen durchaus auch intrinsisch motiviert sein (aufkommende Gedanken, Ideen, Befürchtungen, Wahrnehmung eigener Körperreize etc.) Die Faktoren, die von der jeweiligen Person bewältigt werden müssen, werden als „Stressoren“73 bezeichnet. Je gefährlicher ein Stressor eingeschätzt wird, desto schwieriger empfindet der Betroffene ihn zu bewältigen.
Gemäß Lazarus Theorie ist der Bewertungsprozess (Bewertung → englisch: appraisal) in drei Komponenten aufgeteilt: 1. Primary Appraisal, 2. Secondary Appraisal und 3. Reappraisal.74 Die einzelnen Phasen stellen demnach Bewertungsprozesse dar:
- 1. In der Phase der Primary Appraisal wägt die betroffene Person ab, ob eine Situation für sie als Individuum annehmbar oder bedrohlich ist. Ausschlaggebend ist in dieser Phase, ob die Wahrnehmung der Situation zum Ergebnis hat, dass es sich dabei um einen Stressor handelt. Ist das der Fall, so glaubt die betroffene Person einer Herausforderung oder Bedrohung gegenüber zu stehen, die es zu bewältigen gilt.
- 2. Die darauf folgende Secondary Appraisal dient der Person zu Überprüfung seiner Bewältigungsressourcen. Die Frage die sich hier stellen lassen könnte, lautet: „Welche Mittel habe ich zur Verfügung um diese Situation zu bewältigen?“. Kann ein adäquates Werkzeug zur Bewältigung ausgewählt werden, so kann die Situation stressfrei überwunden werden. Sollte keine befriedigende, oder zumindest ausreichende Ressource zur Verfügung stehen, so entsteht für die Person Stress.
- 3. In der letzten Phase, der Reappraisal, kommt es dann zu einer erneuten Einschätzung der ursprünglichen Situation. Die Person bezieht in diese Neubewertung sowohl die eigenen Bewältigungsressourcen als auch eine mögliche Veränderung der Ausgangssituation mit ein.
Lazarus ging also in seinen Überlegungen davon aus, dass die Entstehung von Angst als eine Art von nicht bewältigter Stressbelastung zu verstehen ist, die maßgeblich von den Bewertungen der betroffenen Person abhängt und beeinflusst werden kann. Diese Theorie soll in Kapitel 4 noch einmal zur Sprache kommen.
Wie bereits in 2.3.2 angedeutet, kann auch ständiges Sorgen als typisch für Menschen mit Angsterkrankungen festgehalten werden, wie der britische Professor Adrian Wells in seinen Forschungen heraus fand. Seine Theorie zur Angstentstehung soll nun genauer beleuchtet werden.
3.4.2 Kognitionsmodell der Angst nach Wells
In seinem Modell stellt WELLS den Unterschied zwischen normalen Sorgen, also denen über Alltäglichkeiten, die jeder Mensch in seinem Leben erlebt und die Wells er als „Typ 1-Sorgen“ benennt, und den so genannten „Metasorgen“, die er als „Typ 2- Sorgen“ (vgl. 2.3.2) kennzeichnet graphisch dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 677 : Kognitives Modell der GAS
Nach WELLS werden die Sorgen des Typ 1 von einem Auslöser angestoßen. Dieser kann sowohl von einem äußeren Ereignis abgeleitet werden (z.B. das Erhalten einer Nachricht), oder intrinsisch motiviert sein (z.B. durch eine Körperempfindung).
Für ein besseres Verständnis des Modells soll nun ein Fallbeispiel den Ablauf verdeutlichen. Angenommen wir das folgende Szenario: Eine verheirateter Mann steht in seiner Küche und spült den Abwasch und hört nebenbei die Radionachrichten. Die Sprecherin berichtet über einen schweren Autounfall auf einer Autobahn mit vielen verletzten und einigen getöteten Personen. Die Frau des Mannes ist an dem Tag für eine Woche auf eine Fortbildung gefahren, mit dem Auto. Das Hören der Nachrichten dient in diesem Fall als Auslöser. In einem weiteren Schritt wählt der Mann unbewusst eine Strategie mit dieser Nachricht umzugehen. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich Sorgen zu machen in einer solchen Situation angebracht ist. Nun beginnt er, sich Sorgen über seine Frau zu machen und spielt im Kopf durch, was ihr möglicherweise passiert sein könnte. Dabei empfindet er eine starke Übelkeit, eine Anspannung seines gesamten Körpers und nimmt an sich selbst eine aufkommende Unruhe wahr, die so stark wird, dass er den Abwasch nicht fortführen kann. Diese Empfindungen sind die Gefühle, die die Sorgen ausgelöst haben. Nun richtet der Mann seine Aufmerksamkeit auf seine ihm Angst machenden Sorgen. Ein Gedanke drängt sich ihm auf: „Ich darf sowas nicht denken! Immer dieses Sorgen! Das macht mich noch krank! Ich muss das unterbinden!“ Dies sind die im Modell genannten negativen Metakognitionen. Der Mann macht sich nun aktiv Sorgen über seinen Sorgenprozess. Genau dadurch werden laut WELLS die Typ 2- Sorgen aktiviert, die in diesem Beispiel mit Gedanken wie: „Ich verliere den Verstand! Wenn ich die Sorgen nicht unterlassen kann, werde ich irre!“ dargestellt werden sollen. Genau diese Gedankengänge regen weitere körperliche Symptome wie Magenkrämpfe oder stärkere Anspannung an, so dass es zwischen den Typ2- Sorgen und den Gefühlen zu einem Aufschaukelungsprozess kommt. Zeitgleich versucht der Mann aber auch seine Gedanken zu kontrollieren, in dem er versucht nicht an die Sorgen zu denken, was aber kognitiv nicht möglich ist. ERTLE, SCHNEIDER und MARGRAF halten zu diesem Punkt fest:,, [...]; diese Metasorgen (Wells, 1995) führen zu verschiedenen kontraproduktiven Verhaltens-weisen, wie bspw. Gedankenunterdrückung, welche die Sorgen verstärken.“75
Darüber hinaus werden auch Verhaltensweisen aktiviert, die dem Sorgen entgegenwirken sollen. In diesem Fall würde der Mann beispielsweise versuchen, seine Ehefrau auf dem Mobiltelefon anzurufen, um sich zu versichern, dass alles in Ordnung ist, oder die gefahrene Strecke seiner Frau mit der Autobahn vergleichen, die in den Nachrichten genannt wurde. All diese Dinge koppeln sich aber verstärkend mit den Metasorgen zurück.
Somit lässt sich anhand des Modells festhalten, dass erst die negativen Metakognitionen den Sorgenprozess ins krankhafte gleiten lassen und dadurch ein pathologischer Befund einer Angststörung begünstigt wird.
3.4.3 State-Trait-Angstmodell nach Spielberger
Die letzte Theorie zur kognitiven Erklärung von Angst- und Panikstörungen soll die des amerikanischen Psychologen Charles D. Spielberger sein. In seinem InventarSTAI (dem State Trait Anxiety Inventory) unterscheidet erzwischen zwei verschiedenen Angstformen: 1. der Eigenschaftsangst (Trait) und 2. der Zustandsangst (State), die unabhängig von einander existieren, aber gemeinsam zum Angsterleben beitragen.76 Unter Eigenschaftsangst (Trait) versteht Spielberger die individuelle Neigung einer Person ängstlich zu sein. Anders formuliert lässt sich damit erfassen, in wie weit und in welchem Ausmaß Ängstlichkeit eine gegebene Eigenschaft eines Individuums darstellt und in welcher Intensität dadurch mit Zustandsangst reagiert wird. Unter Zustandsangst (State) wird dem entsprechend jener Zustand verstanden, die in einer angsteinflößenden Situation auftritt. Kennzeichnende Merkmale der Zustandsangst sind Nervosität, innere Unruhe, Anspannung sowie der Erregung des autonomen Nervensystems.77 Sie können in Ausmaß und Stärke variieren, steigen aber in Bezug auf die bedrohliche Situation stark an. Dies hängt sehr von derjeweiligen Situation und den aversiven Stimuli ab. Um die jeweiligen Angstformen zu ermitteln entwickelte Spielberger ein Inventar, welches aus positiv- und negativ-formulierten Testfragen besteht. Eine Übersetzung in die deutsche Sprache fand ebenfalls statt. Das deutsche State-Trait-Angst-Inventar, das das gleiche Kürzel wie das amerikanische Vorbild trägt, wurde von Lothar Laux et al. für den deutschsprachigen Raum modifiziert. Es besteht aus zwei Skalen mit jeweils 20 Feststellungen, anhand jener sich die Trait- und Stateangst nach Auswertung ablesen lässt. Durchgeführt werden kann dieses Inventar mit Menschen im Alter von 15 bis 70 Jahren. Für die Erfassung der beiden Angstformen im Kindesalter wurde zudem eine kindgerechte Version entwickelt.
Spielberger geht davon aus, dass die Zustandsangst stark mit der Bewertung derjeweiligen Situation, die als bedrohlich oder angsteinflößend erlebt wird, einhergeht.78 Diese These lehnt somit stark an dem Angst-Modell von Lazarus, welches sich auch auf die Bewertungen (englisch: appraisal) einer Person stützt. Zudem unterstreicht Spielbergers Modell die These, dass diese Angst nur in Situationen auftritt, die für den Selbstwert einer Person relevant sind. Ein Beispiel dafür könnte eine Rede einer Person vor seinen Arbeitskollegen oder Chefs sein. Gerade in dieser Situation ist der Selbstwert stark von der Bewertungen der Kollegen und der Vorgesetzten abhängig. Anhand seiner Forschungsergebnisse kommt Spielberger zu der Annahme, dass Menschen mit einer hohen Eigenschaftsangst in selbstwertrelevanten Situationen ebenfalls auch zu einer hohen Zustandsangst neigen.
Zwischenfazit zu 3
Die vorangegangenen Modelle und Theorien haben aufzuzeigen versucht, wie Angst- und Panik entstehen und unter weichen Umständen diese zu ernsthaften Störungen werden können. Obwohl jede Annahme in sich selbst schlüssig ist, so darf nicht vergessen werden, dass diese stark von ihrem psychologisch zugrunde liegenden Paradigma abhängen. Darüber hinaus ist es auch unerlässlich zu erwähnen, dass keine dieser Disziplinen eine alleinige Lösung oder Erklärung zur Entstehung darstellen kann. Letztendlich lässt sich aber zusammenhängend festhalten, dass die Entstehung von Angst ein Prozess ist, der unter vielen Einflussfaktoren zu verstehen ist. SCHMIDT-TRAUB fasst dazu zusammen: „Angststörungen sind mehrdimensional angelegt: Sie haben eine psychologische, körperliche und sozio-kulturelle Dimension, die ätiologische und pathogenetische Erklärungen erschweren.“79 So vielfältig wie die Erklärungsmodelle, sind die darauf aufbauenden therapeutischen Verfahren.
[...]
1 Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörung und Agoraphobie. Ein Therapiemanual. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Göttingen, 2008. S. 13.
2 Hoffinann, Olaf/Hochapfel, Gerd. (Hrsg.)'. Neurotische Störungen und psychosomatische Medizin: Mit einer
EinführunginPsychodiagnostikundPsychotherapie. Edition7. Stuttgart, 2004. S. 79.
3 Morschitzky, Hans\ Angststörungen. Diagnostik, Konzepte, Therapie, Selbsthilfe. 3. Auflage. Wien, 2004. S.14.
4 Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S. 15.
5 Carey, Benedict. Psychiatrists Revise the Book of Human Troubles. In: New York Times. 17. Dezember 2008. Onlinezugriff: http://www.nytimes.com/2008/12/18/health/18psych.html?pagewanted=all (zuletzt: 18. Mai 2009)
6 Arte Dokumentation „Das Glück aus der Dose“. Online Zugriff: http://plus7.arte.tv/de/detailPage/1697660,CmC=2625870,scheduleId=2611290.html (Minute 35:59 - 36:15) (zuletzt: 21. Mai 2009)
7 Arte Dokumentation „Das Glück aus der Dose“. (Fn. 6) (Minute 36:32- 37:06) (zuletzt: 21. Mai 2009)
8 Hoffinann'. Neurotische Störungen und psychosomatische Medizin. (Fn.2) S.82.
9 Becker, Eni/Margraf, Jürgen: Generalisierte Angststörung: Ein Therapieprogramm. Weinheim, 2007. S. 2.
10 Abbildung aus'.Margraf, Jürgen/Schneider, Silvia (Hrsg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen. Berlin, Heidelberg, 2009. S.91.
11 Alle hier aufgezählten Symptome aus '.Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S. 68.
12 Becker, Eni S: Generalisierte Angststörung. In: Margraf, Schneider: Lehrbuch der Verhaltenstherapie. (Fn. 10) S. 89.
13 Ertle, Andrea/ Schneider, Silvia/Margraf, Jürgen: Ängste und Phobien. In: Röhrle, Bernd/ Caspar, Franz/ Schlottke, Peter F. (Hrsg.)'. Lehrbuch der klinisch-psychologischenDiagnostik. Stuttgart, 2008. S. 526.
14 Dieser Gedanke bei: Ertle, Schneider, Margraf. Ängste und Phobien. (Fn. 13) S. 526.
15 Wells, Adrian: Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York, 2008. S. 93.
16 Vgl: Becker, Eni S: Generalisierte Angststörung. In: Margraf, Schneider. Lehrbuch der Verhaltenstherapie. (Fn. 10) S. 89.
17 Ertle, Schneider, Margraf. Ängste undPhobien. (Fn. 13) S. 521.
18 Dudenredaktion, Die: Der Duden. Band 5. 4, aktualisierte Auflage. Mannheim, 2007. S. 1093.
19 Alle unter2.3.3 aufgeführtenDatenaus Studienaus: Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S.15.
20 Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S. 15.
21 Becker, Eni S: Generalisierte Angststörung. In: Margraf, Schneider: Lehrbuch der Verhaltenstherapie. (Fn. 10) S. 89.
22 Gerlach, Alexander, L.: Vorlesung Klinische Psychologie II. Onlinezugriff: https://edcat.uni-muenster.de/bscw2/bscw.cgi/5647557 (zuletzt: 21. Mai 2009) S. 15.
23 Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S. 16.
24 Margraf, Jürgen/ Schneider, Silvia: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn.10) S. 4.
25 Comer, RonaldJ./Sartory, Gudrun (Hrsg.)'. Klinische Psychologie. 6. Auflage. Heidelberg, 2008. S. 130.
26 Paniknetz. Therapiezentrum Münster: „Was ist eine Panikattacke?“ Onlinezugriff: http://www.panikinfo.de/pattacke.html (zuletzt 26. Mai 2009)
27 Schmidt-Traub,Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1)S.16.
28 Vgl: Morschitzky: Angststörungen. (Fn.3) S. 68.
29 Dieser Gedanke bei: Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S. 18.
30 Paniknetz. Therapiezentrum Münster. „Was ist eine Panikstörung (mit/ohne Agoraphobie)“ Onlinezugriff: http://www.panikinfo.de/panik.html (zuletzt 26. Mai 2009)
31 Margraf, Jürgen/Schneider, Silvia: Panikstörungund Agoraphobie.(Fn.lO) S. 9.
32 Dieser Gedanke bei: Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S. 15.
33 Schmidt-Traub, Sigrun: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1) S. 16.
34 Paniknetz. Therapiezentrum Münster. Was ist Agoraphobie? Onlinezugriff: http://paniknetz.de/ (zuletzt 26. Mai 2009)
35 Faust, Volker: Seelische Störungen heute. Wie sie sich zeigen und was man tun kann. München, 1999. S. 30.
36 Dieser Gedanke bei: Margraf, Jürgen/Schneider, Silvia: Panikstörung und Agoraphobie. (Fn.10) S. 10.
37 Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie. (Fn. 1) S. 20.
38 Dudenredaktion, Die: Der Duden. Band 5. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim, 1974. S. 88.
39 Grawe, Klaus: Neuropsychotherapie. Göttingen, 2004. S. 192.
40 Lang, Hermann: Struktur, Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörung. Würzburg, 2007. S. 38.
41 Schleiffer, Roland: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme. In: Julius, Henri: Bindung im Kindesalter: Diagnostikundlntervention. Göttingen, 2009. S. 43.
42 Alle Benennungen der Bindungstypen Bowlbys in diesem Kapitel aus: Schleiffer: Verhaltensauffälligkeiten und
Schulleistungsprobleme. (Fn.42) S. 40,41.
43 Schleiffer: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme. (Fn.42) S. 42.
44 Schleiffer. Verhaltensauffälligkeitenund Schulleistungsprobleme. (Fn. 42) S. 46.
45 Schleiffer. Verhaltensauffälligkeitenund Schulleistungsprobleme. (Fn. 42) S. 44.
46 Schleiffer. Verhaltensauffälligkeitenund Schulleistungsprobleme. (Fn. 42) S. 41.
47 Schleiffer. Verhaltensauffälligkeitenund Schulleistungsprobleme. (Fn. 42) S. 42.
48 Kißgen, Rüdiger: Kontinuität und Diskontinuität von Bindung. In: Julius, Henri: Bindung im Kindesalter: Diagnostik und Intervention. Göttingen, 2009. S.73.
49 Dieser Gedanke bei: Schleiffer. Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme. (Fn. 42) S.44.
50 Lang, Hermann: Struktur, Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörung. (Fn. 41) S.38.
51 Morschitzky: Angststörungen. (Fn. 3) S. 16.
52 Peters, Uwe Hendrik: Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie: mit einem englischdeutschen Wörterbuch im Anhang. München, 2007. S. 36.
53 Bodesohn, Frank. Psychoanalytische Betrachtung der Angst: Die Forschung Sigmund Freuds. München, 2008.
S. 12.
54 Esser, Günther: Lehrbuch der klinischen Psychologie und Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen: Ein Lehrbuch. Stuttgart, 2008. S. 252.
55 Ausführungen zur Realangst und neurotischer Angst aus: Bodesohn: Psychoanalytische Betrachtung der Angst. (Fn. 54) S. 8, 9.
56 Sandjaja, Yen: Angst in Bezug auf die Freudsche Psychoanalyse. München, 2008. S.7.
57 Morschitzky: Angststörungen. (Fn. 3) S. 350.
58 Morschitzky: Angststörungen. (Fn. 3) S. 351.
59 Zimbardo, Phillip G.: Psychologie. 6. Auflage. Berlin, Heidelberg, 1995. S. 488.
60 Abbildung aus: Zimbardo, Phillip G.: Psychologie. (Fn. 60) S. 488.
61 Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S. 302.
62 Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S. 302, 303.
63 Lejrancois, Guy, R. /Leppmann, Peter, K: Psychologie des Lernens. Heidelberg, 1994. S. 20.
64 Dieser Gedanke bei: Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S.303.
65 Dieser Gedanke bei: Myers, David G.: Psychologie: mit 742 meist farbigen Abbildungen und 37 Tabellen. Springer, 2004. S. 344.
66 Kapfhammer, Hans-Peter/Laux, Gerd/Möller, Hans-Jürgen: PsychiatrieundPsychotherapie. Heidelberg, 1999.
S. 783.
67 Remschmidt, Helmut: Praxis der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen: Störungsspezifische
Behandlungsformen undQualitätssicherung. Ausgabe: 2. Köln, 2003. S. 142.
68 Esser, Günther: Lehrbuch der klinischen Psychologie und Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen.
(Fn.55). S. 262.
69 Stopp, Angelika'. Verhaltenam Beispiel Angst. München,2008.S.19.
70 Fröhlich, Werner D.: Wörterbuch Psychologie. München, 2005. S. 102.
71 Morschitzky: Angststörungen. (Fn.3) S. 311.
72 Knoll, Nina/Scholz, Urte/Rieckmann, Nina: Einführung in die Gesundheitspsychologie. Stuttgart, 2005. S. 99.
73 Morschitzky. Angststörungen. (Fn.3) S. 318.
74 Kielholz,Anette: Online-kommunikation: Die Psychologie der neuen Medien für die Berufspraxis. Heidelberg,
2008. S. 104.
75 Ertle, Schneider, Margraf. Ängste undPhobien. (Fn. 13) S. 526.
76
19 Siebeneick, StefanieMaria: Selbstkonzeptgesteuerte Informationsverarbeitung am Beispiel der Ängstlichkeit.
Münster, 1999. S. 8.
77 Morschitzky: Angststörungen. (Fn.3) S. 19.
78 Hoyer, Jürgen: Angstdiagnostik: Grundlagen und Testverfahren. Heidelberg, 2002. S. 161.
79 Schmidt-Traub: Panikstörungund Agoraphobie. (Fn. 1). S. 39.
- Arbeit zitieren
- Nicole Bußmann (Autor:in), 2009, Angst- und Panikstörungen und die Entwicklung von Internetforen als Bewältigungsstrategie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182302
Kostenlos Autor werden





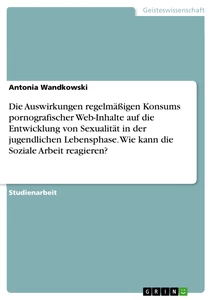





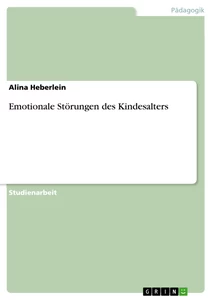










Kommentare