Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit
2. Theoretischer Teil
2.1. Entwicklungstheoretische Grundlagen des Denkens und Lernens von Kindern der mittleren Kindheit
2.1.1. Piagets Entwicklungstheorie
2.1.1.1. Das präoperationale Stadium nach Piaget
2.1.1.2. Das konkret operationale Stadium nach Piaget
2.1.2. Zusammenfassung
2.2. Lerntheoretische Grundlagen
2.2.1. Begriff des Lernens
2.2.2. Behavioristisches Paradigma
2.2.2.1. Medien im Konzept des Behaviorismus
2.2.3. Kognitivistisches Paradigma
2.2.3.1. Medien im Konzept des Kognitivismus
2.2.4. Konstruktivistisches Paradigma
2.2.4.1. Medien im Konzept des Konstruktivismus
2.2.5. Zusammenfassung: Lernparadigmen
2.3. Das Lernportal als Form des Edutainments aufder Schnittstelle zwischen Computerspiel und Lernsoftware
2.3.1. Medien, Computer und Internet in der mittleren Kindheit
2.3.2. Dimensionen von Medien nach Maier
2.3.3. Computerunterstütztes Lernen
2.3.4. Typologie von Lernsoftware
2.3.5. Exkurs: Differenzierung von Aufgabentypen
2.3.6. Typologie von Computerspielen
2.3.7. Charakteristik vom Lernportal als Form des Edutainments und seine Vorteile
3. Praktischer Teil
3.1. Kriterien zur Bewertung von Lernportalen für Grundschüler
3.2. Bewertungsbogen zur Bewertung von Lernportalen
3.3. Das Lernportal „scoyo"
3.3.1. Kurzbeschreibung
3.3.2. Die Startseite des Lernportals „scoyo"
3.3.3. Die Preise für das Lernportal „scoyo"
3.3.4. Aufbau des Lernportals für Klasse 1 bis 4
3.3.4.1. Der Schreibtisch im Lernportal „scoyo"
3.3.4.2. Die Planetenkugel im Lernportal „scoyo"
3.3.4.3. Das Aufgabenbuch im Lernportal „scoyo"
3.3.4.4. Die Themensuche im Lernportal „scoyo"
3.3.4.5. Das Levelsystem im Lernportal „scoyo"
3.3.4.6. „Mein scoyo"
3.3.4.7. Aufbau der Lerneinheiten
3.3.4.8. Aufbau der Aufgaben
3.3.5. „scoyo" für Eltern
3.3.6. „scoyo" für Lehrer
3.3.7. Nachgewiesener Lernerfolg
3.3.8. Didaktische Grundlagen und medienpädagogisches Konzept
3.3.8.1. Problemorientiertes Lernen
3.3.8.2. Alltagsrelevanz der Inhalte
3.3.8.3. Spielerisches und exploratives Lernen
3.3.8.4. Medienpädagogisches Konzept
3.3.8.5. Fachdidaktischer Review
3.3.9. Auszeichnungen
3.3.10. Sonstiges
3.3.11. Bewertung vom Lernportal „scoyo"
3.3.11.1. Zusammenfassende Beurteilung von „scoyo"
3.4. Das Lernportal „Karlchen Krabbelfix"
3.4.1. Kurzbeschreibung
3.4.2. Startseite
3.4.3. Der „Karlchen-Krabbelfix-Club"
3.4.3.1. Mitgliedschaft
3.4.3.2. „Karlchens Welt"
3.4.3.3. Aufgaben
3.4.3.4. Didaktik
3.4.4. „Karlchens Eltern- und Lehrerzimmer"
3.4.5. Bewertung vom Lernportal „Karlchen Krabbelfix"
3.4.5.1. Zusammenfassende Beurteilung von „Karlchen Krabbelfix"
4. Was macht ein pädagogisch wertvolles Lernportal aus?
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
Der Begriff „E-Learning" ist kaum noch aus dem Bildungssystem wegzudenken. Lehrer bilden sich fort, um auf den neuesten Stand von Lernformen zu kommen, die sie ihren Schülern ermöglichen wollen und müssen, Kinder werden schon im Kindergarten auf das Lernen mit dem PC vorbereitet und Eltern stehen dem immensen multimedialen Angebot für ihre Kinder oft ratlos gegenüber. Der Computer und das Internet sind nicht mehr nur bei Freizeitaktivitäten von enormer Bedeutung, sondern gewinnen auch in Bildungsprozessen eine immer wichtigere Rolle.
Während eines Praktikums in einem Multimediaverlag für Kinder stieß ich auf eine Form von Bildungsangebot im Internet, die ich bis dato noch nicht kannte.
Ich bekam zur Aufgabe, Recherchen zu „Lernportalen" im Internet für Schüler im Grundschulalter anzustellen. Der Verlag war gerade mit der Planung eines eigenen Lernportals beschäftigt und benötigte eine Präsentation, bei dem verschiedene Lernplattformen vorgestellt werden sollten.
So verbrachte ich mehrere Wochen damit, Lernportale im Internet ausfindig zu machen, ihren Aufbau zu studieren, ihre Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Vor- und Nachteile zu erfassen und die gewünschte Präsentation anzufertigen.
Meine Recherchen umfassten damals insgesamt acht Lernportale, nämlich „scoyo", „Club Nick", „Karlchen Krabbelfix", „KIDO'Z", „DreiMausclicks.de", „Wissens-Piraten.de", „SecondTeacher" und „bettermarks".
Schon während der Recherchephase konnte ich feststellen, dass diese acht Lernportale in ihrer Struktur, ihren Konzepten und Zielgruppen sehr unterschiedlich waren. Während einige der Portale mehrere Schulfächer berücksichtigten, zum Beispiel „scoyo", konzentrierten andere sich auf ein einziges Schulfach, beispielsweise „DreiMausclicks.de" auf das Fach Mathematik.
Allen Lernportalen gemeinsam war das Ziel, auf spielerische Art und Welse schulrelevante Lerninhalte zu vermitteln und dadurch zu einer Verbesserung der schulischen Leistungen zu führen.
Die Beschäftigung mit den verschiedenen Plattformen führte mich zu der Leitfrage dieser Diplomarbeit.
1.1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit
Die Leitfrage dieser Arbeit soll sein, welche Voraussetzungen Lernportale für Grundschüler im Internet erfüllen müssen, um als pädagogisch wertvoll gelten zu können.
Die Arbeit ist im Hauptteil in zwei Teile gegliedert.
Im ersten, theoretischen Teil meiner Abfassung möchte ich zunächst die entwicklungs- und lerntheoretischen Grundlagen erläutern.
Bei den entwicklungstheoretischen Grundlagen zur mittleren Kindheit konzentriere ich mich auf Piagets Entwicklungstheorie, der mit seiner umfassenden Theorie des Denkens und der Intelligenz die Entwicklungspsychologie auf dem Gebiet der kognitiven Entwicklung stark geprägt hat. Der lerntheoretische Abschnitt beginnt mit einer Darstellung vom Begriff des Lernens, bevor ich auf die drei klassischen Lernparadigmen und das Verständnis von Medien in ihren Konzepten eingehe.
Der letzte Abschnitt des Theorieteils „Das Lernportal als Form des Edutainments auf der Schnittstelle zwischen Computerspiel und Lernsoftware" hat zum Ziel über die Darstellung der Dimensionen von Medien, des computerunterstützten Lernens und der Typisierung von Lernsoftware und Computerspielen, eine Definition darüber zu geben, was als Lernportal verstanden werden kann, wie es in die Medienlandschaft einzuordnen ist und was seine charakteristischen Merkmale und Vorteile sind.
Ein Exkurs über die Differenzierung von Aufgabentypen soll außerdem die Möglichkeiten bei der Gestaltung von Aufgaben aufzeigen.
Der zweite, praktische Teil meiner Arbeit beginnt mit einer Aufstellung von Kriterien, die der Bewertung eines Lernportals dienen können.
Diese Kriterien habe ich zu einem Bewertungsbogen zusammengefasst, den ich exemplarisch auf zwei ausgesuchte Lernportale, „scoyo" und „Karlchen Krabbelfix" anwenden möchte.
Zunächst folgt eine Beschreibung des jeweiligen Lernportals, die aus einer Kurzbeschreibung und einer ausführlicheren Darstellung besteht. In der ausführlichen Darstellung sind beispielsweise Informationen zu den Preisen, der Aufgabengestaltung oder die Einflussmöglichkeiten von Eltern und Lehrern, erläutert. Hier habe ich überwiegend Informationen zusammengefasst, die ich auf den jeweiligen Plattformen finden konnte.
Nach dem Vorstellen des Portals habe ich eine Bewertung mithilfe des Bewertungsbogens vorgenommen. Die Ergebnisse meiner Analyse sind dann in einer abschließenden Zusammenfassung über jedes Portal zu finden.
Im Schlussteil möchte ich mithilfe meiner Ergebnisse aus dem theoretischen und dem praktischen Teil meiner Arbeit eine Antwort auf die genannte Leitfrage geben, welche Voraussetzungen ein Lernportal meiner Meinung nach erfüllen sollte, um als pädagogisch wertvoll gelten zu können.
2. Theoretischer Teil
2.1. Entwicklungstheoretische Grundlagen des Denkens und Lernens von Kindern der mittleren Kindheit
„Kognitive Entwicklung umfasst die Veränderung der Erkenntnisprozesse und des Wissens, der Wahrnehmung, des Denkens, der Vorstellung und des Problemlösens". (Zimbardo 1992, S.72)
Die für alle Kinder gemeinsame Grundschule wurde 1919 unter Abschaffung der gymnasialen Vorschulen eingeführt. Bis auf die sechsjährige Grundschule in Berlin und Brandenburg dauert die Grundschulzeit vier Jahre und hat einen starken didaktischen Veränderungsprozess in den letzten 20 Jahren erlebt.
Die Einschulung zwischen fünf und sieben Jahren stellt einen spürbaren Einschnitt in der Entwicklung des Kindes dar.
Manfred Tücke macht deutlich, dass das Kind nun einen großen Teil in einer externen Institution verbringe und Pflichten übernehmen müsse, wozu es weder prinzipiell noch zur angesetzten Zeit Lust hätte. (vgl. Tücke 2007, S.223)
Dazu komme, dass es im Wettbewerb mit anderen Kindern stehe und seine Leistungen mit denen der anderen verglichen werden würden. Nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild verändere sich, sondern es würden sich auch Veränderungen im Denken und der sozialen Orientierung vollziehen, außerdem erlerne es die wesentlichen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. (vgl. ebd.)
Mit dem Schulbeginn werden laut Tücke die kognitiven Fertigkeiten der Kinder systematisch weiter ausgebildet. Das Gedächtnis würde besser werden, die Interessen ausgeprägter und differenzierter, die Intelligenz nehme zu.
Viele Kinder würden eine zweite Sprache erwerben, andere Kulturen kennenlernen und Musikinstrumente spielen, ein Interesse an Naturphänomenen, sowie gesellschaftlichen Problemen ausbilden und zur Lösung von Aufgaben komplizierte Hilfsmittel wie den Füller und PC benutzen. Bei entsprechender Förderung geschähe die Informationsaufnahme durch das Lesen. (vgl. ebd. S.230)
Tücke betont außerdem, dass die Schule und ihre vermittelten Werte, Inhalte und Methoden der Problemlösung eine besondere Rolle bei der Bewältigung von Aufgaben in der kindlichen kognitiven Entwicklung spielen würden, die entscheidend von kulturellen Rahmenbedingungen, vor allem der Lebenssituation, mitbestimmt sei. (vgl. Tücke 2007, S.237)
Für die Erziehung und Arbeit mit Medien muss beachtet werden, dass Kinder Medien anders begegnen und sie anders wahrnehmen als Erwachsene. Medieninhalte werden individuell unterschiedlich verarbeitet, abhängig vom kognitiven Entwicklungsstand. Mit den Aufgaben in der kognitiven Entwicklung beschäftigte sich besonders intensiv der Schweizer Psychologe Jean Piaget, der eine umfassende Theorie des Denkens und der Intelligenz entwarf, die ich nun näher beleuchten möchte.
2.1.1. Piagets Entwicklungstheorie
Piaget verstand unter Intelligenz „die Fähigkeit, sich allen Aspekten der Wirklichkeit anzupassen" (Siegler 2001, S.35) und unterschied vier Stadien der geistigen Entwicklung in der Kindheit und im Jugendalter, in der sich diese Fähigkeit entwickeln würde: die sensumotorische, die präoperationale, die konkret operationale und schließlich die formal operationale Phase. (zur Unterscheidung der vier Stadien vgl. auch Oerter/Montada 2008, Berk 2005, Zimbardo/Gerrig 2004)1
'Während in Siegler 2001 und Berk 2005 die Begriffe „präoperational", „konkret operational" und „formal operational" verwendet werden (bei Siegler ohne Bindestriche zwischen konkret operational und formal operational, bei Berk mit), sind in Oerter/Montada 2008 und Zimbardo/Gerrig 2004 die Formen „präoperatorisch", „konkret-operatorisch" und „formal-operatorisch" zu finden. Ich habe mich hierfür die Variante von Siegler entschieden, da ich mich bei derfolgenden Darstellung der Stadien überwiegend an Siegler und Berk orientiere.
Die Entwicklungsstadien müssen nach Piaget als aufeinander aufbauend und miteinander in Wechselwirkung stehend verstanden werden.
Mit dem Begriff des Entwicklungsstadiums meint er einen Zeitabschnitt, in dem das Denken und Verhalten eines Kindes eine spezifische geistige Grundstruktur widerspiegelt. Jedes Stadium geht aus dem vorangegangenen Stadium hervor, integriert und transformiert es und bereitet das nachfolgende vor.
Im sensumotorischen Stadium, welches von der Geburt bis zum Alter von zwei Jahren dauert, werden „die Reflexe des Neugeborenen nach und nach in das aktivere Handlungsmuster älterer Säuglinge umgewandelt." (Berk 2005, S.230)
In der präoperationalen Phase, die das Alter von zwei bis sechs oder sieben Jahren umfasse, sei die größte Leistung im Erlernen von Möglichkeiten zu sehen, die Welt symbolisch mit Hilfe von gedanklichen Bildern, dem Zeichnen und der Sprache darzustellen. (vgl. Siegler, S.35.)
Die konkret operationale Phase dauert von sechs oder sieben bis elf oder zwölf Jahren an und ist durch die Fähigkeiten gekennzeichnet, mehrere Perspektiven in Betracht ziehen zu können und Veränderungen, sowie statische Situationen, genau darstellen zu können. (vgl. Siegler, S.36)
Mit etwa elf oder zwölf Jahren erreicht nach Piagets Theorie das Kind dann das vierte und letzte Entwicklungsstadium, das der formalen Operationen. (vgl. ebd.)
In diesem Stadium erlernen Heranwachsende das abstrakte Denken, sie werden fähig, hypothetisch-deduktiv und propositional zu denken.(vgl. Berk 2005, S.523)
Siegler erklärt, dass die Entwicklung im Sinne Piagets von einem Stadium in das nächste durch drei Prozesse geschehe, nämlich die derAssimilation, der Akkomodation und der Äquilibration. (vgl. Siegler, 2001, S.36)
Als Assimiliation könne verstanden werden, dass der Mensch neue Informationen so transformiere, dass sie in ihre existierende Denkweise passen würden, die Akkomodation meine die Art und Weise, „in der Menschen ihr Denken an neue Erfahrungen anpassen" und beim Vorgang der Äquilibration würden Kinder ihre einzelnen Wissensteile über die Welt zu einem Ganzen zusammenfügen (vgl. ebd.).
Der Prozess der Äquilibration erfordere, dass Assimilation und Akkomodation im Gleichgewicht sind und stellt nach Piagets Theorie das Fundament der Veränderung in der Entwicklung dar. (vgl. Siegler 2001, S.38)
Nachfolgend möchte ich auf das präoperationale und das konkret operationale Stadium eingehen, die für die Entwicklung des Denkens in der mittleren Kindheit und dem Verständnis vom Lernen in der Grundschule von Bedeutung sind.
2.1.1.1. Das präoperationale Stadium nach Piaget
Die auffälligste Veränderung in der voroperationalen Stufe, die vom zweiten bis etwa zum sechsten oder siebten Lebensjahr reicht, ist die starke Zunahme in der repräsentierenden oder symbolischen Aktivität. Die Fortschritte in der geistigen Repräsentation erfolgen mit zunehmendem Alter in der Sprachentwicklung und dem Als-Ob-Spiel. (vgl. Berk 2005, S.294 ff.)
Piaget sah die Sprache als flexibelstes Mittel der mentalen Repräsentation an.
Sie ermöglicht es, die Grenzen der gegenwärtigen Erfahrungen zu überwinden. Das Kind erlernt also das Vermögen, sich gleichzeitig mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beschäftigen. Dennoch spielt die Sprache nach Piagets Theorie nicht die Hauptrolle in der kognitiven Entwicklung, sondern die Erfahrungen durch internationalisierte Bilder.(vgl. Berk 2005, S.295)
Durch das Als-Ob-Spiel üben und stärken die Kinder im voroperationalen Stadium die neu erworbenen repräsentierenden Schemata.
Das Spiel löst sich Immer mehr von den Bedingungen des wirklichen Lebens, die damit verbunden sind und wird mit zunehmendem Alter imm]er weniger selbstbezogen.
Es schließt nach und nach komplexere Kombinationen von Schemata ein und das sogenannte soziodramatische Rollenspiel, das Als-Ob mit anderen, taucht auf. (vgl. ebd.)
Neben diesen Fortschritten im Denken sieht Piaget noch einen Mangel darin, symbolische Ansichten anderer von den eigenen zu unterscheiden. (vgl. Berk 2005, S.297)
Die Unfähigkeit, „eine von der eigenen Perspektive abweichende Perspektive einer anderen Person einzunehmen" (Oerter/Montada 2008, S.441), wird Egozentrismus genannt.
Das Kind ist nicht zu Operationen fähig, also geistigen Handlungen, die logischen Regeln gehorchen. Das Denken bleibt auf dem eigenen Standpunkt und das Kind nimmt an, dass die anderen auf die gleiche Weise wahrnehmen, denken und fühlen.
Dieser Egozentrismus ist verantwortlich für das animistische Denken, bei dem angenommen wird, dass unbelebte Dinge ähnliche Lebensmerkmale haben wie Gedanken, Wünsche, Gefühle und Absichten. (vgl. Berk 2005, S.297)
Zusätzlich zum Egozentrismus ist das Kind in der voroperationalen Phase noch unfähig, Invarianz zu erkennen. Mit Invarianz ist die Annahme gemeint, dass bestimmte physikalische Merkmale von Gegenständen auch bei Veränderung der äußeren Erscheinung gleich bleiben.
Das Kind ist also nicht in der Lage, zu konservieren. Es zentriert sich auf einen Aspekt einer Situation, ist leicht abgelenkt von der wahrnehmungsmäßigen Erscheinung der Gegenstände und ignoriert die dynamische Veränderung. (vgl.ebd.)
Zu dieser Unfähigkeit des Erkennens von Invarianz kommt das Unvermögen, in einem Problem mental „eine Reihe von Schritten zu vollziehen und dann die Richtung umzudrehen, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren." (Berk, 2005, S.298)
Die hierarchische Klassifikation, mit der die Organisation von Gegenständen in Klassen und Unterklassen auf Basis von Ähnlichkeiten und Unterschieden gemeint ist, stellt ebenfalls eine Schwierigkeit dar, weil die Kinder noch einem Mangel an logischen Operationen besitzen, eben aufgrund der noch unzureichenden Reversibilität, die Teil jeder logischen Operation sind.
Neuere Forschungen ergaben, dass die Leistung von Kindern bei der Bewältigung von einfachen Aufgaben, die für ihr tägliches Leben relevant sind, viel reifer ist, als Piaget es annahm. (vgl. ebd.)
2.1.1.2. Das konkret operationale Stadium nach Piaget
Zwischen sechs und sieben Jahren tritt das Kind nach Piagets Theorie aus dem präoperationalem Stadium in die Phase der konkret-logischen Operationen über. Dabei kommt es zu einer wesentlichen Weiterentwicklung der kognitiven Wahrnehmungskompetenz.
Das Denken des Kindes wird viel logischer, flexibler und organisierter als in der frühen Kindheit. Während die Fähigkeit zur Invarianz in der präoperationalen Phase aufgrund der Zentrierung noch mangelhaft war, ist das Kind nun zur Dezentrierung fähig. Es kann sich auf verschiedene Aspekte eines Problems konzentrieren und in einer Reihe von Schritten denken. (vgl. Berk 2005, S.390)
Außerdem entwickelt es die Fähigkeit, nicht mehr alles ausschließlich vom eigenen Standpunkt zu betrachten, kann sich in andere Personen einfühlen und andere Meinungen nachvollziehen. Der Egozentrismus der präoperationalen Phase wird überwunden. Kinder besitzen in dieser Phase nicht mehr nur eine einzige Deutungsmöglichkeit und sind in der Lage, zwischen räumlichen und zeitlichen Konzepten zu unterscheiden. Sie haben nun ein genaueres Verständnis von Räumlichkeiten, können mentale Rotationen ausführen und verbessern sich in der Orientierung in kognitiven Landkarten. (vgl. ebd.)
Im Alter zwischen sieben und zehn Jahren können Aufgaben der Einordnung in Klassen gelöst werden, Klassifikationsunterschiede sind nun bewusst.
Auch die Fähigkeit zur Seriation bildet sich aus, das Kind kann Gegenstände jetzt nach quantitativen Dimensionen ordnen und auch mental eine Serie herstellen.
Zwar sind Kinder also insgesamt viel fähigere Problemlöser als im vorangegangenen Stadium, jedoch unterliegt das konkret operationale Denken noch der Einschränkung, dass Kinder nur dann auf eine organisierte, logische Weise denken, wenn sie mit konkreten Informationen zu tun haben. Abstrakte Gedanken bereiten ihnen in dieser Phase noch Schwierigkeiten. (vgl. Berk 2005, S.392)
2.1.2. Zusammenfassung
Mit dem Schulbeginn bilden sich die kognitiven Fähigkeiten des Kindes systematisch weiter.
Nach Jean Piaget, der mit seiner Theorie des kognitiven Denkens einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklungspsychologie des kognitiven Denkens ausübte und vier Stadien der kognitiven Entwicklung unterschied, tritt das Kind durch die drei Prozesse der Assimilation, der Akkomodation und der Äquilibration, zwischen sechs und sieben Jahren aus dem präoperationalem Stadium in die Phase der konkret logischen Operationen über.
Dabei entwickelt sich die kognitive Wahrnehmungskompetenz der Kinder wesentlich weiter. Sie werden viel fähigere Problemlöser als im vorangegangenen Stadium, sind zum Beispiel nun in der Lage, sich auf verschiedene Aspekte eines Problems zu konzentrieren, in einer Reihe von Schritten zu denken, sich in andere Personen einzufühlen, zwischen räumlichen und zeitlichen Konzepten zu unterscheiden oder Aufgaben der Einordnung in Klassen zu lösen.
Das Denken des Kindes in der mittleren Kindheit wird also viel logischer, flexibler und organisierter als in derfrühen Kindheit.
2.2. Lerntheoretische Grundlagen
Kinder besitzen andere Wahrnehmungsfähigkeiten als Erwachsene, die bei der Konzeption und Auswahl der Lernportale berücksichtigt werden müssen. Die Fähigkeit, Medien als Medien gebrauchen zu können, setzt voraus, dass der Medienreiz vom Empfänger als Kommunikationsangebot verstanden wird. Medien wollen dem Rezipienten etwas mitteilen, zeigen und veranlassen, sich selbst ein bestimmtes Bild von der Welt zu machen,
Man nutzt sie, indem man sich von jemandem etwas zeigen lässt. Die Medienrezeption ist also Teil einer sozialen Handlung und nicht bloß eine Reaktion auf eine physische Reizkonstellation.
Der Erwerb der Voraussetzung, sich etwas zeigen lassen zu können, geschieht beim Säugling in Interaktion mit der Bezugsperson. Die Fähigkeit zur „gemeinsamen Aufmerksamkeit" zwischen Kind und Bezugsperson entwickelt sich in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. Das Kind kann dem Blick des Erwachsenen folgen und einen Gegenstand ins Auge fassen, der Erwachsene kann dem Kind also etwas zeigen.
Es gibt zwei Wege, um als Kind Medienumgang zu erwerben und Medienangebote verstehen zu können. Zum einen kann dies durch die Unterstützung seiner Bezugsperson, also beispielsweise durch gemeinsames Fernsehen oder Anschauen von Bildern, zum anderen durch entdeckendes, selbstgesteuertes Lernen geschehen. So kann etwa der Umgang mit Computerspielen oder Hard- und Software durch diese Art des Lernens angeeignet werden. (vgl. Charlton 2004, S.129ff.)
2.2.1. Begriff des Lernens
Die Konzeption von Lernplattformen für Grundschüler im Internet kann ohne eine Beschäftigung mit dem Begriff des Lernens aus lernpsychologischer Sicht nicht vorgenommen werden. Die Lernpsychologie beschäftigt sich mit verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, wie der Mensch lernt und stellt dabei Lerntheorien in den Mittelpunkt, die aus dem „Versuch, die
Kenntnisse über Lernen, d.h. über Lernbedingungen und Lernergebnisse sowie deren Zusammenhänge, zu systematisieren" (Skowronek 1991, S.183) entstehen.
Den vielen verschiedenen Theorien ist gemein, dass ein „Organismus an mindestens zwei verschiedenen Zeitpunkten daraufhin beobachtet werden muss, wie er auf die gleiche Reizsituation reagiert." (Mietzel 2007, S.33)
Bei unterschiedlicher Reaktionen kann also Lernen stattgefunden haben. Lernen ist als ein Prozess zu verstehen, „der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials resultiert" (Zimbardo 2004, S.243) und auf Erfahrung basiert.
Die Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials muss über verschiedene Gelegenheiten hinweg relativ konsistent auftreten und geschieht ausschließlich durch im Gedächtnis gespeicherte Erfahrungen, deren Reaktionen durch Lernen beeinflusst werden. (vgl. ebd.)
Das Verständnis von Lernen hängt jedoch stark von der Perspektive ab, die eingenommen wird.
In den meisten Lehrbüchern wird vor allem auf die drei „klassischen" Hauptströmungen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus eingegangen.
Auf diese Sichtweisen, „wie Lernen zu verstehen ist, nach welchen Gesetzmäßigkeiten es funktioniert, wie es stattfindet und unterstützt werden kann." (Mader/Stöckl 1999, S.12), möchte ich nun näher eingehen, da sie in der Entwicklung von Lernangeboten eine bedeutende Rolle gespielt haben.
2.2.2. Behavioristisches Paradigma
„Der Behaviorismus ist nicht an den im Gehirn ablaufenden spezifischen Prozessen interessiert. Das Gehirn wird als black box aufgefasst, die einen Input (Reiz) erhält und darauf deterministisch reagiert."
(Baumgartner / Payr 1994, S.101)
Die Grundposition des Behaviorismus ist erkenntnisphilosophisch dem sogenannten Objektivismus zuzuordnen, der von einer objektiven, für alle gleichermaßen erfahrbaren Welt ausgeht, die in der internen Struktur des Individuums besser oder schlechter repräsentiert sein kann.(vgl.Wöckel 2002, S.119)
Als Grundannahme behavioristischer Lerntheorien kann bezeichnet werden, dass das Lernen eine beobachtbare Verhaltensänderung darstellt, die als Reaktion auf Umweltreize erfolgt.
Lernen geschieht also dann, wenn eine dauerhafte Veränderung beobachtbaren Verhaltens als Ergebnis von Erfahrung erfolgt ist.
Im Zentrum der Untersuchungen von Behavioristen steht der Zusammenhang zwischen Reizen und Verhaltensreaktionen, während innerpsychische Vorgänge nicht weiter berücksichtigt werden und das Gehirn des Lernenden als black box verstanden wird. Diese black box erhält einen Input (Reiz) und reagiert darauf deterministisch.
Behavioristen glauben, dass ein Großteil des Verhaltens durch einfache Lernprozesse erklärt werden können und viele dieser Lernprinzipien auf alle Organismen anwendbar sind. Sie sind nicht an bewussten, kognitiven Steuerungsprozessen, sondern an Verhaltenssteuerung interessiert. (vgl. Baumgartner / Payr 1994, S.101)
Die behavioristische Lerntheorie ist vor allem auf das Grundprinzip des klassischen Konditionierens zurückzuführen, welches vom russischen Physiologen Ivan Pawlow entwickelt und später dann von Watson modifiziert wurde.
Beim klassischen Konditionieren handelt es sich um eine Grundform des Lernens, bei der ein Stimulus oder ein Ereignis das Auftreten eines anderen Stimulus oder Ereignisses vorhersagt. Das Verhalten, die konditionierte Reaktion, wird vom Organismus durch einen Stimulus hervorgerufen, der seine Wirkung durch eine Assoziation mit einem biologisch bedeutsamen Stimulus erlangte. (vgl. Zimbardo 2004, S.246/247)
So können auch einfache emotionale Reaktionen wie Erregung, Furcht oder affektive Tönung von Einstellungen im Sinne des klassischen Konditionierens erklärt werden, bei dem Signale, die aus Reizen in der Umwelt entstehen, bestimmte Reaktionen hervorrufen. (vgl. ebd.)
In den 1950ern bildete Burrhus Frederic Skinner als einer der Hauptvertreter des behavioristischen Ansatzes das Konzept des operanten Konditionierens heraus, da seiner Auffassung nach das klassische Konditionieren zwar einige Verhaltensweisen, aber nicht die Mehrzahl der von Menschen gezeigten Reaktionen erklären könnte (vgl. Lefrancois 1994, S.33)
Das Lernen als Reiz-Reaktion-Verbindung gewann durch Skinner, der auf der Grundlage von Edward L. Thorndikes „Gesetz des Effekts" (law of effect) Methoden zum Operanten Konditionieren entwickelte, eine wesentliche Erweiterung.
Mit dem Operanten Konditionieren ist eine Lernform gemeint, „bei der sich die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion auf Grund einer Veränderung ihrer Konsequenzen ändert." (Zimbardo 2004, S.263)
Nach Skinner wird die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Verhaltensweisen durch Reaktionen der Umwelt bestimmt. Die Gabe von Verstärkern erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens im Laufe der Zeit, während die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion durch dargebotene Bestrafungsreize sinkt.(vgl. ebd.)
Lernen wird demnach von den Behavioristen als mechanischer Prozess betrachtet, bei dem verstärkte Verhaltensweisen häufiger und erfolglose seltener auftreten. Der Lernende besitzt eine reaktive beziehungsweise passive Rolle beim Lernen, weil das Verhalten eines Organismus und seine Auslöser der Kontrolle der Umwelt unterliegen. Das Lernen aus traditionell behavioristischer Sicht erfolgt nach dem Ablauf Reiz, Reaktion und Verbindung (Assoziation) von Reiz und Reaktion.
Weil mît dieser Anschauung vom Lernen kaum der Erwerb komplexerer Kenntnisse möglich ist, entwickelte sich etwa Mitte des 20. Jahrhunderts ein neues Verständnis vom Lernen. Dieses neue Verständnis stelle ich nach der Auffassung von Medien im Konzept des Behaviorismus dar.
2.2.2.1. Medien im Konzept des Behaviorismus
Medien, Methoden und das verstärkende Lehrerverhalten können im behavioristischen Sinne als Reize dienen, die den Stofftransport und die Stoffaufnahme fördern. (vgl. Wöckel, 2002, S.120)
Didaktische Bestrebungen sollten also die Entwicklung solcher möglichst effektiven Reize implizieren.
Der Lerner, der ein von außen zielgerichtet beeinflussbarer Faktor ist, erhält die vom Medienentwickler zur Verfügung gestellten Methoden und Medien, sowie das verstärkende Lehrerverhalten als Reize dargeboten. (vgl. ebd.)
Skinner und viele anderen Didaktiker entwickelten nach dem Konzept der sogenannten Programmierten Unterweisung zahlreiche Unterrichtsmaterialien, welche „Lernprogramme" genannt wurden und didaktischen Prämissen unterlagen.
Unter anderem sollte der Lernstoff in geordneter und linearer Reihenfolge mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad präsentiert werden und der Schwierigkeitsgrad so zu wählen, dass der Lernende in der Lage ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit richtige Antworten zu geben.
Richtige Antworten mussten dabei unmittelbar verstärkt werden. Weiterhin unterlag der gesamte Lernprozess in seiner Präsentation, der Gestaltung und Verstärkung, der Kontrolle des Lehrenden. (vgl. Wöckel, 2002, S.122) Dieses Verständnis des Lernprozesses geht mit einer Reduzierung auf die passive, rezipierende Funktion des Lernenden einher, der in seiner Individualität nicht berücksichtigt wird.
Das Wissen im Sinne der traditionell behavlorlstischen Didaktik wird also nicht eigenständig, sowie aktive angeeignet und erarbeitet, sondern bleibt im Lernenden „träge", (vgl. Thissen 1999, S.4)
Es kann nicht auf ähnliche Aufgabenstellungen transferiert werden, da die Problemlösefähigkeit nur unzureichend durch die „Nürnberger-Trichter- Didaktik" im Behaviorismus gefördert wird. (vgl. ebd.)
Typische Beispiele für die behavioristische Didaktik sind Übungen, bei denen der Lerner so lange Sprachen, Klavierspielen oder Jonglieren übt, bis auf einen bestimmten Stimulus „automatisch" die gewünschte Reaktion erfolgt. Im Computerbereich gewann der Behaviorismus durch „Drill & Practice"- Software an Bedeutung. Unter dieser Form wird Bildungssoftware verstanden, bei der es hauptsächlich darum geht, vorhandenes Wissen oder vorhandene Fähigkeiten zu trainieren und einzuüben, also beispielsweise Vokabeltrainer, Grammatiktests oder Rechenaufgaben. (vgl. Decker 1998, S.132)
Dabei werden Routine und klar strukturiertes Faktenwissen getestet, Fertigkeiten und Kenntnisse eingeübt und gesichert. Neues Wissen wird bei diesem Softwaretyp nicht oder nur in Ansätzen vermittelt. Übungsprogramme dieser Form sind in beinahe allen Themengebieten, Fächern und Altersstufen vorhanden, im Grundschulbereich sind vor allem Rechen- und Rechtschreibtrainer zu nennen, die ergänzend zum Schulunterricht zu Hause als elektronische Nachhilfe eingesetzt werden und auf einem simplen Frage-Antwort-Schema basiert. Der Lerner erhält Aufgaben in Form von unterschiedlich dargebotenen Rechenaufgaben, Vokabeln oder Fragen, welche er durch Eingabe einer Antwort oder Lösung abarbeitet und auf die nach der Bearbeitung eine sofortige Rückmeldung folgt. Die Eingabe wird unmittelbar als richtig oder falsch bewertet und die Anzahl der richtigen Antworten am Ende eines Lerndurchgangs ausgewertet, sowie in simpler Form (z.B. Schulnotenschema) beurteilt. (vgl. Decker 1998, S.133)
Eine nicht, oder falsch beantwortete Frage wird bei den meisten Programmen so lange gestellt, bis sie korrekt beantwortet wird und es besteht die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad anzuwählen.
Diese Art von Übungsprogrammen wird in der Pädagogik aus didaktischer Sicht als äußerst kritisch bewertet, so zum Beispiel auch von Baumgartner und Payr, die diese Programmkategorie dafür verantwortlich machen, dass „das computerunterstützte Lernen in pädagogischer Hinsicht noch nicht salonfähig geworden ist." (Baumgartner / Payr 1994, S.155)
Auch im WWW findet die behavioristische Didaktik seine Anwendung. Lernstoff wird in linearer Form als Frage-Antwort-Kette mit unmittelbarer Rückmeldung und steigendem Schwierigkeitsgrad präsentiert. Pareigat etwa entwickelte 1998 die Lernumgebung „Würfel und Quader", die Fragen zu Kantenmodellen stellte, welche durch die Auswahl einer Antwortalternative beantwortet werden sollte. Auf diese Antwort folgt dann in Form eines kurzen Hinweises eine Rückmeldung. (vgl. Wöckel 2002, S.121)
2.2.3. Kognitivistisches Paradigma
„Für den Kognitivismus ist das menschliche Hirn keine biack-box mehr, bei der nur Input und Output interessieren, sondern es wird versucht, für die dazwischenliegenden geistigen Prozesse ein theoretisches Modell zu en twickeln. " (Baumgartner / Payr 1994, S.103)
In den späten 1950ern beschäftigten sich einige Psychologen mit der Überlegung, ob Menschen nicht genauso wie Rechenautomaten Informationen verarbeiten, die über die Sinnesorgane dem Gehirn übermittelt, gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.
Zwar gingen diese als kognitive Behavioristen bezeichneten Wissenschaftler noch von einem passiven Lernenden aus, im Unterschied zu den traditionellen Behavioristen setzten sie sich aber mit komplexeren Lernformen wie dem schlussfolgernden Denken, dem Problemlösen und informationsverarbeitenden Prozessen auseinander.
Sie interessierten sich aufgrund der Erfahrungen mit Computern für jene Prozesse, die sich zwischen dem Input und dem Output von Daten befanden, also für die Auswahl, Verarbeitung, Speicherung und das Abrufen von Informationen durch den Lernenden.
Aus dieser Sichtweise entwickelte sich eine Richtung in der Psychologie, die Kognitivismus genannt wird und die das Gehirn, sowie die dort ablaufenden Prozesse zum Gegenstand der Forschung gemacht hat.
Die kognitive Perspektive betont mentale Prozesse, die Verhaltensreaktionen beeinflussen.
Es geht darum, das Wesen menschlichen Intelligenz und des menschlichen Denkens, der Kognition, zu verstehen.
Unter Kognitionen sind alle jene Prozesse des Wissens anzusehen, einschließlich Aufmerksamkeit, Erinnerung und Schlussfolgern, sowie deren Inhalte wie Begriffe und Gedächtnisinhalte. (vgl. Zimbardo 2004, S. 344) Aufgrund der Unmöglichkeit, den menschlichen Geist in diesen dort ablaufenden Prozessen hinreichend und aus direkter Evidenz zu erfassen ist eine Vielfalt an kognitivistischen Ansätzen vorhanden, die jedoch nahezu alle gemeinsam haben, dass der menschliche Denkprozess als Prozess der Informationsverarbeitung aufgefasst wird und den zentralen Aspekt der Forschungen darstellt. (vgl. Süßenbacher 1997, S.46)
Das menschliche Gehirn wird nicht mehr wie im Behaviorismus nur als passiver Behälter aufgefasst, sondern ist in der Lage, Informationen zu verarbeiten und zu transformieren. Als Ziel und Ergebnis eines aktiven Lernprozesses kann also das Wissen angesehen werden.
Eine besondere Rolle spielt im Kognitivismus die Fähigkeit der Problemlösung, also nicht auf bestimmte Reize eine richtige Antwort zu liefern, sondern Methoden zu erlernen, deren Anwendung die richtigen Antworten hervorrufen.
Hier kann meines Erachtens die von Baumgartner und Payr aufgeführte und am Philosophen Gilbert Ryle angelehnte Unterscheidung zwischen Faktenwissen und prozeduralem Wissen gelten, die auch als Grundannahme der modernen Kognitionswissenschaft gilt. (vgl. Baumgartner/ Payr 1994, S. 20)
Im Unterschied zum statischen, deklarativen Wissen („wissen, dass"), welches als eine Art Faktenwissen verstanden und mittels der sprachlichen Äußerung oder einer bildlichen Darstellung repräsentiert wird, ist das „Wissen, wie" mit einer bestimmten Prozedur bzw. einem bestimmtem Verarbeitungsprozess ein gewünschtes Ergebnis erreicht werden kann, nach Ryle die eigentliche für unsere Intelligenz zuständige Geistestätigkeit. Es geht also nicht um das reine Reproduzieren von bereits gelerntem Wissen, sondern um das selbstständige Produzieren neuen, dynamischen Wissens. Die prozedurale Verfahrensweise weist dabei die Merkmale Zielgerichtetheit, die Zerlegung des Gesamtzieles in Teilziele, sowie die Wahl und Beschreibung der für die Umsetzung der Teilziele notwendigen Operationen, auf. (vgl. Baumgartner/ Payr 1994, S. 22)
Als Beispiel für prozedurales Wissen können Kurzanleitungen in öffentlichen Telefonzellen gelten, die dem Benutzer zielgerichtet und in Teilzielen erklären, wie das Telefon benutzt werden soll.
Das „Wissen, wie" (oder „knowing how"), also die Fähigkeit, Problemstellungen selbstständig lösen zu können, wird auch heute noch als Kern des geistigen Verhaltens angesehen und besitzt einen weit höheren Stellenwelt als das „gepaukte" Wissen, weil das deklarative Wissen bloß begrenzt und beschränkt einsetzbar ist. Das prozedurale Wissen kann also als umfassenderes und letztlich auch nützlicheres Wissen angesehen werden. Allerdings muss hervorgehoben werden, dass das dynamische Wissen das statische Faktenwissen zur Voraussetzung hat und darauf zurückgreift, demgemäß statische Grundlagen braucht.
Wenn die Notwendigkeit vom Faktenwissen nicht beachtet wird, ist es nicht möglich, prozedurales Wissen zu erlernen und einzusetzen. (vgl. ebd., S.23)
Da eine weitere Darstellung der informationsverarbeitenden Prozesse den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, möchte ich nun mit dem Verständnis von Medien im Konzept des Kognitivismus fortfahren.
[...]
- Arbeit zitieren
- Christine Seiler (Autor:in), 2011, Lernportale für Grundschüler im Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179770
Kostenlos Autor werden

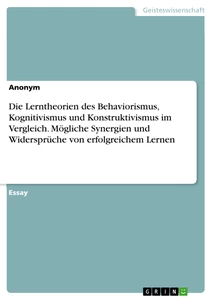




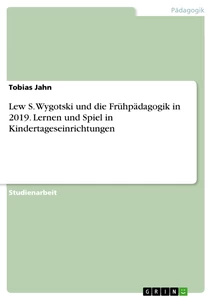











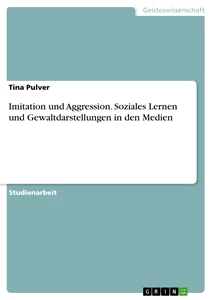

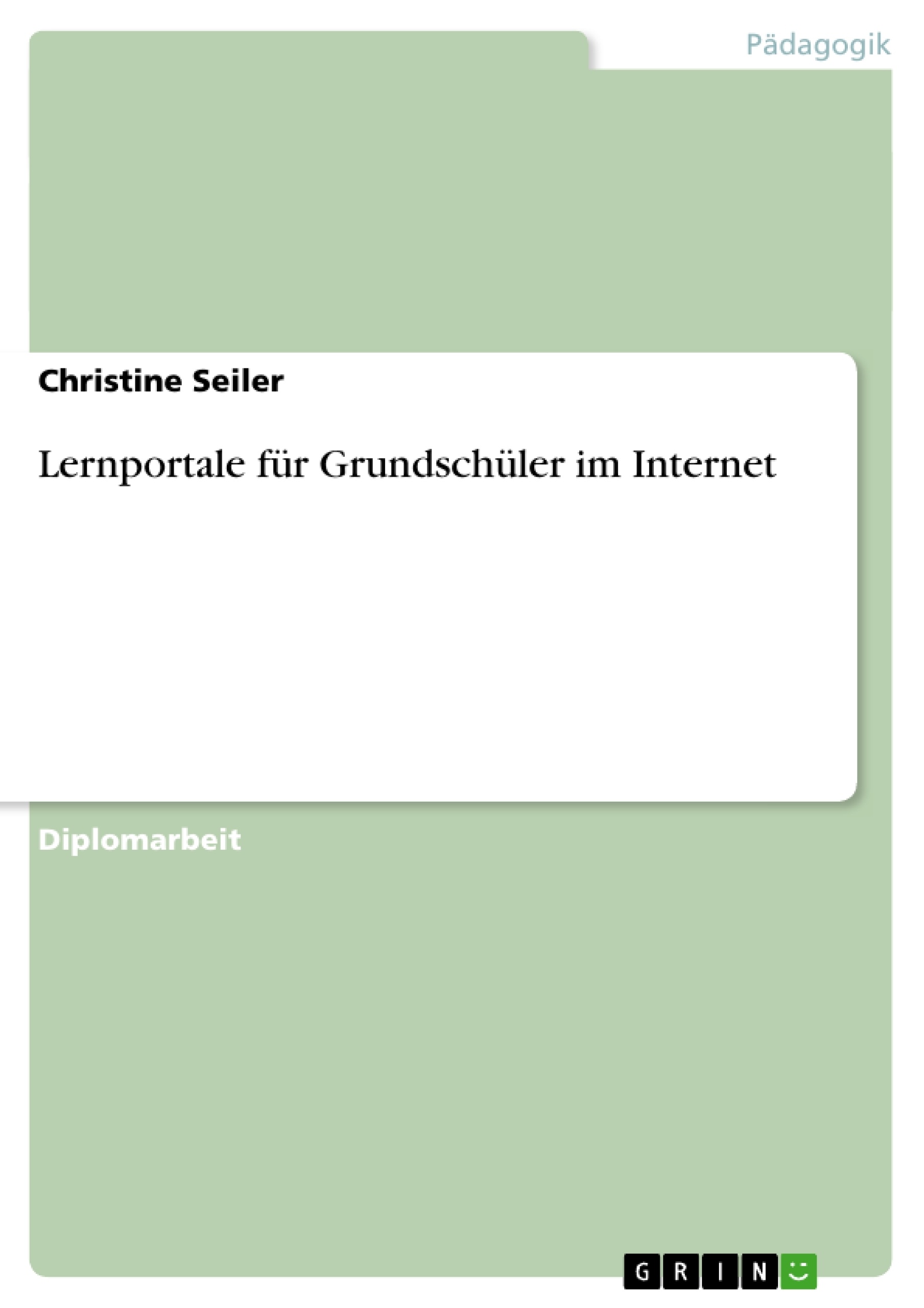

Kommentare