Leseprobe
Inhalt
1. Einführung
2. Hochbegabung
2.1 Geschichte
2.2 Vererbung
2.3 Elite
3. Definitionen von Hochbegabung
3.1 Definitionsklassen
3.2 Hochbegabungsmodelle
3.2.1 3-Ringe-Modell (Renzulli)
3.2.2 Differenziertes Begabungs- und Talentmodell (Gagné)
4. Identifikation
4.1 Erkennung
4.2 Identifikationsverfahren
5. Frühindikatoren
5.1 Säuglingsalter
5.2 Elterliche Beobachtung
5.2.1 Frühlesen
5.2.2 Explorationsverhalten
5.2.3 Informationsverarbeitung
5.2.4 Dyssynchronien
5.2.5 Kreativität
5.3 Elternfragebogen
5.4 Kritik an Checklisten
6. Hochbegabte Kinder in der Familie
6.1 Familienbegriff
6.2 Familiäre Strukturvariablen
6.3 Sozioökonomische Familienbedingungen
6.4 Erziehungsziele
7. Hochbegabung und Gesellschaft
7.1 Vorurteile und Ängste
7.2 Sonderfall Sportförderung
8. Innerfamiliäre Erkennung
8.1 Modell der innerfamiliären Erkennung
8.2 Familie
8.2.1 Erkennung
8.2.2 Entwicklungs- & begabungsspezifische Kenntnisse des Elternteils A
8.2.3 Elternteil-Kind-Beziehung
8.2.4 Innerfamiliäre Bedingungen
8.3 Außerfamiliäre Umwelt
8.3.1 Direktes Umfeld der Familie
8.3.2 Gesellschaft
8.4 Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einführung
In der neueren wissenschaftlichen Literatur zur Hochbegabung besteht ein Konsens darüber, dass ein Großteil der hochbegabten Kinder niemals als solche identifiziert werden. Die Wahrscheinlichkeit, bereits vor dem Eintritt in die Schule identifiziert zu werden, kann als äußerst gering bezeichnet werden. Im vorschulischen Alter werden i.d.R. nur diejenigen Kinder als hochbegabt identifiziert, deren Leistungsvermögen extrem weit über dem Durchschnitt ihrer Alterskameraden liegt.
Der zweite Konsens besteht darüber, dass eine frühestmögliche Identifikation der hochbegabten Kinder erstrebenswert ist, um die Erziehung und Förderung an ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen auszurichten. Darüber hinaus haben Kin- der einen Anspruch darauf, dass ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung schützend und fördernd begeleitet wird. Das gilt natürlich für jedes Kind, unabhängig von einem retardierten, altersgemäßen oder akzelerierten Entwicklungsverlauf.
Demnach müssten die beiden folgenden Aussagen (weitgehend) ohne Widerspruch bleiben: 1) Ein großer Anteil aller hochbegabten Kinder wird nie, ein weiterer großer Anteil erst während der Schulzeit als hochbegabt identifiziert. 2) Eine frühe Identifikation und die daran anschließende Förderung sind die besten Maßnahmen, um einen adäquaten Entwicklungsverlauf des Kindes gewährleisten zu können.
Wenn das tatsächlich zutrifft, müsste die Wissenschaft ihre Hauptanstrengungen da- rauf ausrichten, ein Identifikationsverfahren zu entwickeln, das eine frühzeitige und „massenhafte“ Identifikation der hochbegabten Kinder ermöglicht. Auch die Sonder- pädagogik müsste aus präventiven Überlegungen an diesem Verfahren interessiert sein, um Störungen vorzubeugen, die sich aus den inadäquaten Entwicklungsbedin- gungen ergeben könnten. Allerdings lassen sich die wissenschaftlichen Methoden, mit denen hochbegabte Schüler und Erwachsene identifiziert werden, nicht ohne Weiteres auf die Kinder im vorschulischen Alter übertragen, wie die unbefriedigende Zuverlässigkeit der Testergebnisse im frühen Kindesalter belegt. Außerdem sind die Tests mit jüngeren Kindern sehr zeit- und personalintensiv, besonders wenn sie tat- sächlich einen Großteil der hochbegabten Kinder erfassen sollen, die sonst nicht identifiziert werden.
Eine andere Möglichkeit ist die gezielte Beobachtung von Leistungs- und Verhaltensmerkmalen, die nur oder fast nur hochbegabte Kinder aufweisen. Das setzt allerdings die Existenz solcher Merkmale voraus, die hochbegabte von nicht-hochbegabten Kindern diskriminieren. Obwohl die hochbegabten Kinder keine homogene Gruppe bilden und sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und Entwicklungen teilweise sehr stark voneinander unterscheiden, werden in der Literatur einige charakteristische Merkmale aufgezählt. Diese werden zu sog. Checklisten zusammengefasst und den Eltern vorgelegt, weil diese ihre Kinder - besonders in den ersten Lebensjahren - sehr genau, sehr häufig und in den unterschiedlichsten Situationen beobachten. Allerdings wird die Verwendung dieser Merkmalslisten von den Autoren überwiegend abgelehnt, weil sie keine eindeutigen Ergebnisse liefern.
Aber das Problem bleibt unverändert bestehen: Wie soll eine breite Identifikation der hochbegabten Kinder bereits im vorschulischen Alter gelingen, wenn die Beobachtungen der Eltern nicht in das Verfahren einbezogen werden? Ein Modellprojekt, das in dieser Arbeit mehrfach als Beispiel herangezogen wird, nutzte die Beobachtungen der Eltern als erste Stufe im Identifikationsverfahren. An dem Auswahlverfahren nahmen nur Kinder teil, die von ihren Eltern für das Projekt angemeldet wurden. Zusätzlich wurden die Eltern mit einem Fragebogen (Kap. 5.3) über ihre Beobachtungen befragt. Diese Erkennung der besonderen Begabung durch die Eltern darf allerdings nicht als alleinige Methode zur Identifikation verstanden oder verwendet werden, auch nicht bei eindeutig überdurchschnittlichen Leistungen, sondern immer als ein Teil eines mehrdimensionalen Identifikationsverfahrens.
Wenn man nachvollziehen möchte, welche Faktoren die Qualität der elterlichen Beo- bachtungen beeinflusst, muss man den wechselseitigen Prozess der Erkennung in seiner Umwelt darstellen. Denn die Erkennung der besonderen Leistung findet nicht in einer konstruierten Testumwelt statt, sondern vollzieht sich in der Familie. Das er- fordert bspw. ein Leistungsklima innerhalb der Familie, das überdurchschnittliche Leistungen zulässt und in dem interindividuelle Leistungsunterschiede zwischen den Geschwistern als natürlich akzeptiert werden. Das „Modell der innerfamiliären Erken- nung“ (Kap. 8) besteht aus dem Erkennungsprozess nach Urban und den drei innerund zwei außerfamiliären Ebenen, auf denen die Einflussfaktoren verteilt sind.
Bevor das Modell in seinen Einzelheiten erläutert wird, sollen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den einzelnen Bestandteilen dargestellt werden. Aber zunächst wird im Grundlagenbereich an einigen ausgewählten Beispielen aus der Geschichte ver- deutlicht, dass ein großes Interesse an den außergewöhnlichen Begabungen der Kinder keine Erscheinung der modernen Leistungsgesellschaft ist, wie häufig ange- nommen wird, sondern bereits seit Jahrhunderten Philosophen und Staatsmänner in der ganzen Welt beschäftigte. Sie stellten bspw. bereits damals die Frage, ob die Leistungsfähigkeit des einzelnen Bürgers als nationale Ressource verstanden wer- den kann und überlegten, wie eine optimale Förderung aussehen könnte.
Die elterliche Erkennung ist auf die Hochbegabung des Kindes gerichtet. Da aber keine allgemein anerkannte Definition der Hochbegabung existiert, werden sechs unterschiedliche Definitionsklassen und zwei Hochbegabungsmodelle vorgestellt, die jeweils eine anderer Herangehensweise an das Thema vertreten. Für den Prozess der Erkennung ist dabei besonders die Differenzierung von Begabung und Talent nach Gagné interessant. Die Eltern beobachten die Leistung, erkennen aber im besten Fall die Begabung. Dazu muss diese in einem besonderen Talent zum Ausdruck kommen. Das Modell enthält auch unterschiedliche Einflussfaktoren, die sich auf die Talententwicklung/Begabungsausprägung auswirken.
Im Erkennungsmodell steht die Fähigkeit der Eltern im Vordergrund, aus der Beo- bachtung der kindlichen Leistung auf die potentielle Leistungsfähigkeit zu schließen. Aber welche konkreten Verhaltens- oder Leistungsmerkmale unterscheiden hochbe- gabte Kinder von ihren gleichaltrigen Spielkameraden? Und ab welchem Alter sind sie zu beobachten? Für die Erkennung der besonderen Begabung durch die Eltern ist deren Sensibilisierung für die möglichen Ausprägungen von grundlegender Be- deutung. An fünf Leistungs- und Verhaltensmerkmalen wird diskutiert, wie stark diese ausgeprägt sein können und ob sie durch eine wenig-systematische Beobachtung der Eltern überhaupt als Ausdruck einer besonderen Begabung zu erkennen sind. Und natürlich wird auch die Kritik an der Verwendung von Checklisten dargestellt.
Die familiäre Umwelt bestimmt nicht nur die Umwelterfahrungen des Kindes im vor- schulischen Alter, sondern hat auch einen großen Einfluss auf den Erkennungspro- zess. So scheinen bspw. die sozioökonomischen Familienbedingungen einen direk- ten Einfluss auf die individuellen Erziehungsziele in der Elternteil-Kind-Beziehung zu besitzen, genau wie sie die Reaktion der Umwelt auf die mögliche Erkennung beein- flussen. Für die innerfamiliäre Umwelt des Erkennungsprozesses werden außerdem die Untersuchungen wiedergegeben, die sich mit den Strukturvariablen auseinander- setzen. Danach verändert sich mit dem Stand des Kindes in der Geburtsreihenfolge auch die Wahrscheinlichkeit, dass seine besondere Begabung erfolgreich erkannt wird.
Bei der außerfamiliären Umwelt werden die Ebenen der Gesellschaft und des direkten Umfelds der Familie differenziert, um deren unterschiedlich starken Einflussmöglichkeiten gerecht zu werden. In Kapitel 7 werden die Vorurteile und Ängste beschrieben, die in der öffentlichen Meinung gegenüber Hochbegabten und deren Familien bestehen. Eine stark negative Ausprägung im direkten Umfeld der Familie kann die Eltern zweifeln lassen, ob sie sich mit ihren Beobachtungen an eine Beratungsstelle wenden. Allerdings soll auch dargestellt werden, dass die „sportliche Hochbegabung“ und ihre Förderung einen Sonderfall darzustellen scheint.
Das Kind demonstriert eine besondere Leistung - aber was passiert auf Seiten des Elternteils? Warum kann oder will es die Leistung nicht als Begabungssignale ver- stehen? Oder welche Einflüsse wirken sich besonders hilfreich für die erfolgreiche Erkennung aus? Diesen Fragen soll im Erkennungsmodell nachgegangen werden, um einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Bedeutung die Eltern bzw. die elter- liche Erkennung bei der breiten Identifikation hochbegabter Kinder im vorschulischen Alter einnehmen kann.
2. Hochbegabung
Seit jeher ziehen Menschen eine große Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie eine weit überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit besitzen. Dabei waren die Versuche, diese Menschen und ihre besonderen Fähigkeiten zu umschreiben oder zu bezeichnen, genauso vielfältig und zahlreich wie die Vorstellungen darüber, wie eine solche „Gabe“ entsteht oder woher sie kommt.
Als Einstieg in diese Arbeit soll daher an den historischen Quellen aufgezeigt wer- den, dass viele der „aktuellen“ Diskussionen über eine Eliteförderung, eine spezielle Erziehung der hochbegabten Kinder oder die Vereinnahmung von Hochbegabten als nationale Ressource nicht unbedingt aus der heutigen Leistungs- und Erfolgsgesell- schaft entsprungen sind, sondern bereits vor Jahrhunderten geführt wurden.
Aus diesen Überlieferungen lässt sich entnehmen, dass nicht allein die Vorstellung darüber, welche Bedeutung die Hochbegabten für eine Gesellschaft haben könnten, bereits einige Jahrhunderte alt ist, sondern dass bereits damals konkrete Maßnah- men erdacht wurden, um diese hochbegabten Kinder zu finden und sie ihren Bega- bungen entsprechen zu erziehen. So stellt Platos Zitat, mit dem der geschichtliche Überblick beginnt, die Beschreibung eines frühen Identifikationsverfahren dar.
2.1 Geschichte
„Wir müssen sie von ihrer Jugend an aufwärts beobachten und sie Tätigkeiten ver- richten lassen, in denen sie höchstwahrscheinlich vieles vergessen und in denen sie getäuscht werden können; wer sich erinnert und sich nicht täuschen lässt, muss ausgewählt, und, wer versagt, zurückgewiesen werden. Dies wird der Weg sein.“
Platos Ausführungen zur Identifikation der „besten Naturen“ sind ein sehr anschau- liches Beispiel, aber keineswegs einzigartig in der Geschichte. Bereits der chine- sische Philosoph Konfuzius glaubte an die Suche nach „göttlichen Kindern“, deren Fähigkeiten zum Nutzen aller am Hofe des Herrschers gefördert und als Garanten für nationalen Reichtum dienen sollten. Sehr geschätzt wurden dabei literarische Fähig- keiten, genauso wie unterschiedliche Formen kreativer Phantasie. Von den begabten Kindern, deren Eltern nicht in die Förderung am Hofe eingewilligt hatten, wurde berichtet, dass ihre Talente ohne Förderung und weitere Anreize verkümmerten (Urban, 2004a, S. 19f).
Der Gedanke, die Begabungen einzelner für die Gesellschaft nutzbar zu machen, findet sich nicht nur bei Plato und Konfuzius. Martin Luther sprach sich 1524 dafür aus, die „tüchtigsten unter den Schülern“ länger an der Schule zu unterrichten, damit sie im Anschluss Lehrer und Prediger werden konnten. Sechs Jahre später forderte er einen Schulzwang für die begabtesten Kinder, mehr als zwei Jahrhunderte vor der Einführung der allgemeinen Schulpflicht (Feger, 1988, S. 31). Suleiman, der Große, ließ begabte Jugendliche im türkischen Reich suchen und zum Wohle des ottomanischen Reiches in muslimischer Religion, Kriegskunst und weiteren Fächern unterweisen. Thomas Jefferson, von 1801 bis 1809 der dritte Präsident der Vereinig- ten Staaten von Amerika, sah es als Pflicht des Staates an, die Erziehung vielver- sprechender Schüler zu finanzieren. Jefferson stellte auch fest, dass die Talente „frei unter den Armen wie unter den Reichen“ verteilt seien und sie „nutzlos untergehen, verkommen, wenn sie nicht gesucht und kultiviert werden“. Eine Feststellung, die sich mit den Ergebnissen der empirischen Hochbegabtenforschung nicht belegen lässt, was bei einer kritischen Betrachtung der einzelnen Arbeiten auf die verwen- deten Methoden und Selektionskriterien zurückzuführen ist (Urban, 2004a, S. 20f).
Die inhaltliche Beschäftigung mit dem Phänomen der Hochbegabung lässt sich also weit in die Geschichte zurückverfolgen, während die systematische Auseinander- setzung erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einer Untersuchung Galtons begann. Dort, wo vorher häufig das Wirken einer göttlichen Fügung hinter den außergewöhnlichen Fähigkeiten Hochbegabter vermutet wurde, benannte Gal- ton die genetische Ausstattung als entscheidende Determinante intellektueller Fähig- keiten. Diese konzeptionelle Anlehnung des Begabungsbegriffs an das Konstrukt der Intelligenz gilt es besonders hervorzuheben, denn bis heute wird die Intelligenz als Kerngröße bei der Begabungsdefinition herangezogen (Holling & Kanning, 1993, S. 3). Galton warf mit seiner Untersuchung außerdem die seither viel diskutierte Frage auf, ob eine spezifische Begabung allein auf genetische Faktoren zurückzuführen ist oder Umweltfaktoren an der Begabungsentfaltung beteiligt sind.
Nach Galton erschienen einige Arbeiten, darunter die 1881 veröffentlichten Werke „The Man of Genius“ von Lombroso und „The Insanity of Genius“ von Nisbet, die sich aus einer psychiatrischen Perspektive mit dem Topos des verrückten Genies be- schäftigten, der bis in die Antike zurückreicht und uns heute noch in Redewendungen wie „Genie und Wahnsinn“ und „Early ripe, early rot“ begegnet (Urban, 2004a, 287f). Diese Arbeiten zur Divergenzhypothese der Hochbegabung (u.a. Lange-Eichbaum, 1977) trugen zur Entwertung des Geniebegriffs bei, indem sie „das Merkmal der Genialität kausal als pathologische Äußerung einer gesteigerten Reizbarkeit des Nervensystems definierte[n]“ (Cremerius, 1971, S.7). Der bekannteste Vertreter der Gegenbewegung, der Konvergenzhypothese, Lewis M. Terman, kritisierte u.a. Lombroso für ein impressionistisches und anekdotenhaftes Vorgehen, in dem nur Fälle zur Probe herangezogen werden, welche die angewendete Theorie stützen (Feger, 1988, S. 32).
„Einen Meilenstein in der Geschichte der Intelligenz- und Begabungsforschung stellte die Konzeption des Intelligenzquotienten (IQ) als standardisiertes Maß für intellek- tuelle Leistung durch Stern (1911) da“ (Holling & Kanning, 1999, S. 3). Bis dahin fehlte den Arbeiten zum Thema Hochbegabung ein Instrument, um die zu erwar- tende Leistung eines Menschen prognostizieren zu können, „denn mithilfe der Intelligenzforschung und der Entwicklung von Intelligenztests schien es möglich, einen Faktor zu messen, der Hochbegabung, Genie determinierte“ (Urban, 2004a, S. 23). Davor wurden Arbeiten zur Hochbegabung „ex post facto“ erstellt, also nachdem sich ein Menschen durch eine besondere Leistung als hochbegabt erwiesen hatte. Eine besondere Form dieser Arbeiten stellt die Untersuchung von Cox (1969) im Rahmen der Terman-Studie dar, die aufgrund historischer Protokolle die geistige Ausstattung und die charakteristischen Persönlichkeitsmerkmale in der Kindheit und Jugend von 301 der berühmtesten Menschen der Geschichte festzustellen versucht. Laut Terman stellt diese Arbeit zweifellos eine wichtige Korrelation zwischen den geistigen Fähigkeiten der Kindheit und denen des reifen Lebens fest (Urban, 2004a, S. 37).
Die Ergebnisse der Arbeit, die Lewis M. Terman und seine Mitarbeiter, darunter Cox, 1921 an der Stanford University begannen, prägten die Hochbegabtenforschung über Jahrzehnte hinweg. Untersucht wurde eine Gruppe von 1500 Schülern, die im Sinne der Studie hochbegabt waren. Terman stellte aufgrund der ersten Unter-suchungen u.a. fest, dass die Häufigkeitsanteile in den oberen und obersten IQ-Bereichen „in beträchtlichem Maße größer [sind], als aufgrund der Normalvertei-lungskurve zu erwarten gewesen wäre“ (Urban, 2004a, S. 26). Die erste Folgeunter-suchung, die fünf bis sieben Jahre später durchgeführt wurde, bestätigt die Überle-genheit der Hochbegabtengruppe über die High-School-Zeit. In der Zusammenfas-sung der Untersuchungsergebnisse von 1940 bis 1945 belegt Terman, dass sich das Überspringen von Klassen (Akzeleration) positiv auf die Schul- und Berufslauf-bahn der Hochbegabten auswirkte.
Auf der Grundlage von Beobachtungen, die 40 Jahre nach der Aufnahme der Studie gemacht wurden, versucht Oden, eine langjährige Mitarbeiterin Termans, die Frage zu beantworten, zu welcher Art Erwachsener sich das hochbegabte Kind typischer Weise entwickelt. Ihre Ergebnisse können zur Widerlegung der Divergenzhypothese, einem eigentlichen Ziel der Terman-Studie, herangezogen werden: „Die physische Gesundheit ist nach eigener und Expertenmeinung gut oder sehr gut, die Lebenser-wartungen höher. Fälle von ernster geistiger Erkrankung oder Persönlichkeitsproble-men scheinen nicht häufiger, sondern eher seltener aufzutreten. Verbrechen existiert praktisch nicht“ (ebd., S. 41). Zusätzlich vergleicht Oden die Lebensgeschichte der 100 erfolgreichsten Männer mit denen der 100 am wenigsten erfolgreichen, um die nicht-intellektuellen Faktoren zu erfassen, die Einfluss auf die berufliche Karriere haben. Als besonders unterstützend für eine erfolgreiche Karriere des hochbegabten Kindes wirken sich demnach ein höherer sozioökonomischer Status der Herkunfts-familie, häusliche Stabilität (weniger Scheidungen) und fördernde und fordernde Eltern aus.
Der beeindruckende Umfang der Studie und die einmalige Kontinuität dürfen nicht über die vorhandene Einseitigkeit der Ergebnisse und deren begrenzte Aussagemög-lichkeiten hinwegtäuschen. Diese sind u.a. in den engen Selektionskriterien begrün- det, die diejenigen Kinder ausschließen, die in einem anderen als im intellektuellenSinne hochbegabt sind. Außerdem sind die zeitlichen Abstände zwischen den Unter-suchungen mit sechs bis zwölf Jahren sehr groß, so dass „die dann angestellten Kor-relationsuntersuchungen ... nichts oder wenig über den Entwicklungsprozess der hochbegabten Kinder, über die Interaktionsdynamik von Person und Umwelt aus-sagen“ (ebd., S. 27).
In der Folgezeit nahmen die Arbeiten zum Thema Hochbegabung zu, vorangetrieben auch durch Anregungen aus anderen Forschungsrichtungen wie Guilfords Arbeiten über Kreativität oder politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Einflüsse wie den Sputnik-Schock im Oktober 1957, der zu einer starken Betonung der Naturwis-senschaften und der Mathematik führte. Die große Anzahl der neuen Publikationen bildete auch neue Schwerpunkte in der Forschung heraus, z.B. die Suche nach Begabungsreserven (Feger, 1988, S. 37) oder erwartungswidrigen Minderleistungen (Urban, 2004a, S. 28). Die von Urban (ebd.) vermutete „zyklische Natur“ des Interes-ses an Hochbegabung in der amerikanischen Wissenschaft und Erziehung attestiert Feger (1988, S. 38) auch der amerikanischen Politik, die in einem Jahr die Bega-bungsförderung und deren Finanzierung gesetzlich festschreibt, um sie im nächsten Jahr für den Gedanken der „Integration aller Kinder“ wieder hinten anzustellen.
Die neuere Forschung beschäftigte sich vermehrt mit den Problemen der Erziehung hochbegabter Kinder, indem sie u.a. die Effektivität organisatorischer Maßnahmen wie Enrichment und Akzeleration prüfte (Urban, 2004a, S.29). Darin sahen auch Politiker eine gute Möglichkeit, den Bedürfnissen hochbegabter Schüler gerecht zu werden: „Vorrang sollte die Reform des bestehenden Systems im Innern haben. Das kann schon dadurch geschehen, daß die Möglichkeit zum schnelleren Durchlaufen der Schule verbessert wird, daß zusätzliche Lehrerstunden den Schulen zur Ver-fügung gestellt werden, die auch für spezielle Förderung von Hochbegabten genutzt werden kann“ (Hirche, in: Heitzer, 1984, S. 173).
Auch die Gründung zahlreicher Vereine und Gesellschaften in der ganzen Welt rückte die Bedeutung der Erziehung und Bildung Hochbegabter in den Vordergrund. Denn diese Gruppen, die häufig aus Elterninitiativen heraus entstanden sind, widmen sich mit großem Engagement den sozialen Auswirkungen der Hochbegabung für die Kinder und deren Eltern (Urban, 2004a, S. 31). Die Elterngruppen, die sich vor Ort zusammenfinden, bieten nicht nur die Möglichkeit zum Austausch unter den Eltern, sondern richten auch Förderprogramme und Begegnungsmöglichkeiten für die Kin-der ein und stoßen Initiativen an, wie z.B. Patenschaftsprogramme oder die Ent-wicklung von spezifischem Arbeitsmaterial (Feger, 1988, S. 216f).
Die Möglichkeit für einen internationalen Wissenschaftsaustausch bietet der „World Council for Gifted and Talented Children“. Dessen Ziel ist, eine „weltweite Aufmerk-samkeit zu richten auf hochbegabte und talentierte Kinder und ihren wertvollen mög-lichen Beitrag zum Wohle der Menschheit“ (Urban, 2004a, S. 332).
2.2 Vererbung
Auf William Stern, dessen grundlegende Bedeutung für die Intelligenz- und Bega-bungsforschung bereits angesprochen wurde, geht auch die Bezeichnung „Differen-tielle Psychologie“ zurück. Er stellte fest, dass in der Auseinandersetzung mit den interindividuellen Unterschieden die Frage gestellt werden muss, „wie an dem Zu-standekommen der seelischen Verschiedenheit innere Ursachen (Vererbung, An-lage) einerseits, äußere (Umwelt, Erziehung, Beispiel usw.) andererseits beteiligt seien“ (Stern, zitiert nach Feger, 1988, S. 119).
Aus der wissenschaftlichen Diskussion um diese Fragestellung werden häufig nur die beiden Extrempositionen wahrgenommen, dabei hatte schon Stern auf eine Konver-genz der inneren Anlagen und der äußeren Entwicklungsbedingungen hingewiesen (ebd., S. 121). Inzwischen gelten sowohl die endogenistischen Theorien, nach denen die psychische Entwicklung allein durch den Genotyp bestimmt wird, als auch die exogenistischen Theorien, nach denen eine aktive Umwelt auf einen weit- und tief-gehend beeinflussbaren Menschen einwirkt, als überholt. Der Einseitigkeit beider Ansätze wurden interaktionistische Modelle entgegengesetzt, in denen der Genotyp und die Umwelt aktive Partner sind, „die sich nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern nachgerade erst konstituieren würden“ (Hany, in: Stern & Guthke, 2001, S. 71). Diese Kooperation soll durch eine Gen-Umwelt-Korrelation begünstigt werden, die entweder dadurch entsteht, dass Kinder von ihren Eltern neben den Genen auch ein darauf abgestimmtes Entwicklungsumfeld erhalten (passive Korrelation), die Kinder durch ihre Verhaltensmuster entsprechende Umweltreaktionen auslösen (evokative) oder die Individuen sich eine solche Umwelt suchen oder schaffen, die ihren Anlagen entspricht (aktive) (ebd., S. 71f).
Auch wenn die Extrempositionen inzwischen seltener vertreten werden, bleibt die Antwort auf Sterns Frage weiter heftig umstritten. Denn während das physische Erscheinungsbild des Menschen als weitgehend durch den Genotyp bestimmt gilt, hält sich der Streit um die Vererbung der geistigen Eigenschaften. Klauer (1975) weist auf die Möglichkeit hin, die Umwelt-Erbe-Diskussion zu entschärfen, indem man die Gleichsetzung von „vererbt" mit „unveränderlich" und „erworben" mit „unveränderlich" überwindet und den Schwerpunkt auf die Beeinflussbarkeit legt. „Denn ein Nachweis von Erblichkeit schließt gezielte Beeinflußbarkeit nicht aus, und ein Nachweis von Umwelteinflüssen ist keine Garantie für leicht zu erzielende Begabungsförderung" (S. 19).
Der Grad der möglichen Beeinflussbarkeit eines Menschen ist für das Bildungswesen im Allgemeinen und für die Begabungsförderung im Speziellen von grundlegender Bedeutung, denn beide stellen persistente und kumulative Umwelteinflüsse dar. Auch die Bedeutung des familiären Umfeldes steigt mit den Möglichkeiten der Einflussnahme, gerade in Hinsicht auf die Begabungsentwicklung im vorschulischen Alter, da Kinder in der Bundesrepublik Deutschland i.d.R. erst ab dem dritten Lebensjahr in regelmäßigen Kontakt mit formeller Pädagogik kommen.
Die Forschungsergebnisse zur genetischen Veranlagung sind genauso vielschichtig wie zu den Umwelteinflüssen. Das sieht auch Hany (2001) so, der darauf hinweist, dass die Vererbung kognitiver Merkmale, darunter die Intelligenz, nicht durch einzelne Gene bestimmt wird. Die Normalverteilung der Intelligenzmaße ist ein Zeichen dafür, dass an der Ausprägung mehrere hundert Gene beteiligt sein müssen, denn „eine Normalverteilung ergibt sich statistisch gesehen dann, wenn zahlreiche, voneinander unabhängige Einzelfaktoren mit jeweils beschränkter Wirkung additiv kombiniert werden" (S. 71 f). Als Beispiel für eine gleichzeitige, nachhaltige Beeinflussung der Intelligenz durch die sozialen und kulturellen Umwelteinflüsse führt er den Anstieg der Intelligenzwerte in der Bevölkerung um etwa drei IQ-Punkte pro Jahrzehnt an, „da sich das menschliche Genom durch Spontanmutation so rasch nicht verändern könnte" (ebd., S. 72).
In den zahlreichen Arbeiten der Terman-Studie finden sich sowohl Argumente für eine stärkere Betonung des Genotyps bei der Entwicklung der Intelligenz, als auch für eine stärkere Betonung der Umweltfaktoren. So stellte Oden 1969 u.a. fest, dass diejenigen Kinder die größeren Erfolge im späteren Berufsleben erzielten, die ihre Familie selbst als fördernd erlebt hatten (Kossmann, 2002, S. 16). Und während die Gruppen der erfolgreichsten und der am wenigsten erfolgreichen Mitglieder der Hochbegabtengruppe keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich des Intelligenzquotienten aufwiesen, führte Oden Persönlichkeitsmerkmale, darunter Zielstrebigkeit und Selbstsicherheit, als wichtige Faktoren für die Entwicklung an (Feger, 1988, S. 123). In Bezug auf die genetische Veranlagung der Intelligenz finden sich bei Terman selbst sehr bedenkliche Vorurteile gegenüber Minderbegabten, wenn dieser „bedauert, dass Hochbegabte in aller Regel Partner heiraten, die weniger oder nicht als hochbegabt zu bezeichnen sind, und dass man hier so weit als möglich mit euge- nischer Erziehung entgegenarbeiten sollte" (S. 40).
2.3 Elite
Der Begriff „Elite" wurde schon als Bezeichnung für erkannte Gesellschaftsphänomene verwendet, bevor er von den Sozialwissenschaften übernommen wurde. Seine Bedeutung ist aber bis heute relativ unbestimmt (Braun, 1999, S. 22). Während die Sozialwissenschaften den Elitebegriff auf die Mächtigen in einer Gesellschaft beziehen, ist es für Dreitzel (1962) „keineswegs selbstverständlich, daß die Eliten von vornherein und immer Machtträger sind" (S. 3). Er sieht in der Annahme, dass sich die „objektiv Besten" auch immer an der Spitze von Gruppen, Organisationen und Gesellschaften befinden, das „utopische" Element des Elitebegriffs (ebd., S. 13ff).
In Deutschland ist der Elitebegriff durch historische Erfahrungen und politische Verwicklungen dauerhaft belastet. Braun (1999) führt dabei nicht nur den Nationalsozialismus an, der mit seinen „darwinistisch begründeten Begriffen von ,Elite’ und politischer Führung’ den Elitegedanken mit nur schwer überwindbaren Bedeutungen belastet [hat]" (S. 24), sondern auch die wirtschaftliche und politische Führungselite, die für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich gemacht wurde.
Aber inzwischen stellt nicht nur Urban (2004a) ein weniger verkrampftes Verhältnis im Umgang mit dem Elitebegriff in Deutschland fest, besonders in Bezug auf die Verwendung im Leistungssport (S. 160), wie in Kapitel 7 ausführlich beschrieben wird. Ein aktuelles Beispiel aus der Politik ist die Berichterstattung um die Auswahlprozedur der „Elite-Universitäten", die weitgehend ohne Diskussionen über den Begriff selbst stattfindet.
Der Elitebegriff wird in vielen demokratischen Gesellschaften kontrovers diskutiert, denn er scheint in einem Widerspruch mit dem Gleichheitsanspruch und der demokratischen Theorie der Mehrheitsherrschaft zu stehen (Braun, 1999, S.25). Diese Auseinandersetzungen sind politischen Trends unterworfen: „In die bildungspolitische Landschaft der 70er Jahre paßte es nicht, sich für die Förderung Hochbegabter ... einzusetzen. Die wenigen, die es damals schon taten, zogen den Vorwurf auf sich, ,elitäre’ schul- und bildungspolitische Vorstellungen zu propagieren" (Seeringer, in: Heitzer, 1984, S. 173). Zwei Beispiele für gegenteilige Impulse, die einen liberaleren Umgang mit dem Elitebegriff und der Begabtenförderung beschleunigten, sind der sog. „Sputnik-Schock" in den Vereinigten Staaten von Amerika, der einen Rückstand des amerikanischen Raumfahrtprogramms offensichtlich machte, und die öffentliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der „PISA-Studie" in Deutschland, die ein politisches Programm zur Ernennung von „Elite-Universitäten" nach sich zog.
Für Urban (2004a) steht der Elitebegriff nicht für eine gesellschaftliche Klassenkategorie, sondern synonym für hervorragende Leistungen in unterschiedlichen Bereichen, u.a. dem Geistigen und dem Sozialen (S. 160 f). Dieses Prinzip der Offenheit und Durchlässigkeit von unten, das die Zugehörigkeit zu einer Elite ohne Berücksichtigung sozialer Rangkriterien zulässt, bezeichnet Dreitzel (1962) als das „qualifika- torische Element" des Elitebegriffs. Es bezeichnet diejenigen, die sich für die Zugehörigkeit zu einer Elite als qualifiziert erwiesen haben (S. 43 ff). Dieses Verständnis des Elitebegriffs ist nicht nur die Voraussetzung, um ihn in Bezug auf Hochbegabung anwenden zu können, sondern auch die Verbindung mit dem demokratischen Prinzip der Chancengleichheit: Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, sich über Leistung für die Elite zu qualifizieren. Das setzt ein Klima voraus, „das ganz selbstverständlich zeigt, dass es wünschenswert und normal ist, dass nicht alle gleich sind, sondern dass jeder unterschiedlich und einzigartig ist; dass Normalität eben nicht darin besteht, dass möglichst alle gleich sind oder gemacht werden" (Urban, 2004a, S. 161).
Im Modell der sog. „Leistungselite" sind unterschiedliche Formen der Leistung berücksichtigt, darunter auch sportliche Höchstleistungen, die einige Autoren aus ihren Hochbegabungskonzepten ausklammern (u.a. Webb, Meckstroth & Tolan, 1998, Kap. 1). Dreitzel (1962) teilt die „Inhaber der Spitzenpositionen ... , die auf Grund einer sich wesentlich an dem (persönlichen) Leistungswissen orientierenden Auslese in diese Position gelangt sind" (S. 71), in eine Berufs- und Konsumelite ein. Während sich die Berufselite aus den „Leistungshelden ... der hochmobilen Industriegesellschaft" (ebd., S. 147) zusammensetzt, haben die Mitglieder der Konsumelite „ihre Führungsrolle ... vor allem im Bereich all dessen, was den Menschen in seiner Freizeit’ beschäftigt und was keinen unmittelbaren Bezug zur Berufstätigkeit hat" (ebd.) Braun (1999) weist aber auf die Kritik hin, dass der Begriff der „Leistungselite" eine unnötige Beschränkung des Elitebegriffs auf die Industriegesellschaft darstellt und „zudem jene Führungspersonen ausschließe, die ihre Spitzenpositionen ... aufgrund von ,Charakter-’ und ,Rücksichtslosigkeit’ oder besonderen persönlichen Beziehungen erhalten hätten" (S. 29).
Allen Formen der Elite werden die Merkmale der Absonderung und Steigerung zugeschrieben. Für die „tendenzielle Absonderung", die im Wesen der Selektion begründet liegt, ist die Ursache und der Maßstab der Selektion unerheblich. Die Individuen werden in Relation zu den übrigen Mitgliedern der jeweiligen Gruppe gesetzt und aus dieser herausgehoben, ohne zwangsläufig „über" die anderen gestellt zu werden. Dagegen ist die „Tendenz zur Steigerung" nicht nur Folge, sondern auch Voraussetzung der Selektion, „weil die Auslese aufgrund der Akkumulation verschiedener Ressourcen erfolgt ... . Das Ziel, einer Elite anzugehören, ist eng damit verbunden, Ressourcen bzw. Kapital zu akkumulieren (z.B. Prestige, Macht, sozialer Aufstieg)" (ebd., S. 34). Die „Tendenz zur Steigerung" als Folge der Auslese bezeichnet Braun als die Anhäufung von Funktionen und sozialen Gratifikationen, die „das Interesse am Erhalt von Spitzenpositionen ... erzeugt" (ebd., S. 35).
3 Definitionen von Hochbegabung
In den zahlreichen Arbeiten, die sich mit dem Thema Hochbegabung beschäftigen, findet sich keine einheitliche Definition der Hochbegabung. Torrance (1982) sieht in diesem Fehlen einer allgemein akzeptierten Definition ein Hindernis für diejenigen, die angemessene pädagogische Programme für Hochbegabte fordern. Es sind aber keine Meinungsverschiedenheiten unter den Experten, die eine solche einheitliche Definition verhindern, sondern die ständigen Erweiterungen des Konzepts der Hochbegabung „und daß wir eine ansteigend große Zahl von Wegen gefunden haben, eine größere Anzahl von unterschiedlichen Arten hochbegabter Kinder zu identifizieren“ (S. 31).
Wie zu Beginn dieser Arbeit bereits aufgezeigt, hat sich das Verständnis der Hochbegabung im Laufe der Zeit verändert. Einen großen Einfluss auf die unterschiedlichen Definitionen hat das aktuell vorherrschende Wertesystem der urteilenden Gesellschaft. Roedell, Jackson & Robinson (1989) stellen dazu fest, dass sich die „landläufige Vorstellung von Hochbegabung ... auf manifeste - meist im beruflichen Bereich erbrachte - Spitzenleistung [bezieht]“ (S. 3) und weniger auf Begabungen, die erst mithilfe eines Tests aufgespürt werden müssen. „Was zählt, ist das Produkt der Begabung: die wissenschaftliche Entdeckung, die philosophische Abhandlung, der politische Sieg“ (ebd.). Zu dieser Vorstellung trägt auch Termans Mitarbeiterin Cox (Kap. 2) bei, die für ihre Arbeit nicht nur zeitgenössische, sondern sogar historische Maßstäbe ansetzt.
In mehreren Arbeiten (u.a. Heinbokel, 1988) wird auf den Versuch eines Studenten zu Beginn der 1960er hingewiesen, der eine komplette Auflistung der Definitionen von Hochbegabung erstellen sollte und dieses Vorhaben nach 113 Definitionen abbrach (S. 23). Um in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Hochbegabung nicht von dieser Vielzahl von Definitionen gelähmt zu werden, ist es sinnvoll, die vorhandenen Gemeinsamkeiten der einzelnen Definitionen herauszuarbeiten.
3.1 Definitionsklassen
Feger (1988) wendet zur besseren Übersicht ein Ordnungsschema an, das von Lucito stammt und sechs unterschiedliche Klassen von Definitionen unterscheidet:
1. Ex-post-facto-Definitionen
2. IQ-Definitionen
3. Soziale Definitionen
4. Prozentsatzdefinitionen
5. Definitionen mit dem Schwerpunkt Kreativität
6. Lucitos eigene Definition von Hochbegabung (S. 57 ff)
Diese sechs Definitionsklassen werden im Folgenden vorgestellt und auf die Fragestellung hin untersucht, welche Rolle sie für die Hochbegabung bei Kindern im vorschulischen Alter einnehmen können.
Die erste Definitionsklasse umfasst die Ex-post-facto-Definitionen, nach denen ein Mensch erst dann als hochbegabt bezeichnet werden kann, nachdem dieser eine herausragende Leistung erbracht hat. Diese Definitionen nutzen äußere Merkmale wie Berühmtheit, Einträge in Rekordlisten oder Höhe des Einkommen als Maß für Hochbegabung und kommen vornehmlich in Büchern über geniale Menschen und deren „Karrieren" zur Anwendung. Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, verloren diese Definitionen nach der Entwicklung der ersten Intelligenztests an Bedeutung, da sie keine zuverlässigen Prognosen über individuelle Hochbegabung liefern konnten. Aus diesem Grund werden sie vornehmlich auf Erwachsene angewandt, da „hochbegabte Kinder ... noch nicht die Gelegenheit [hatten], ihre Fähigkeiten voll zu entfalten, und ... daher nicht durch großartige Leistungen auffallen [können]" (Roedell et al., 1989, S. 57).
Eine Anwendung der Ex-post-facto-Definitionen auf Kinder und Jugendliche ist aber möglich, wenn das wesentliche Merkmal der Definitionen erfüllt ist. „Elkes Hochbegabung zeigte sich schon lange vor der Schule; sie war sehr sprachbegabt und las schon mit 5 Jahren Sachbücher und Lexika" (Urban, 2004a, S. 314). Diese Bega bungssignale, die in Elkes Beispiel nicht als solche verstanden wurden, erfüllen ohne Zweifel das Merkmal der „herausragenden Leistung". Denn Elkes Leistungen ragen sowohl im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern, als auch im Vergleich mit den Erwartungen, die in unserer Gesellschaft an Kinder dieses Alters gestellt werden, heraus. Aber die Problematik aller Definitionsklassen ist die Absolutsetzung des jeweiligen Schwerpunkts, denn eine Öffnung der Ex-post-facto-Definitionen für weitere Faktoren könnte bedeuten, dass Urbans Subjektbeschreibung keine endgültige Identifizierung Elkes als hochbegabt darstellen würde, sondern einen wichtigen Impuls für eine umfangreiche Begabungstestung (was sie in der Praxis auch tut).
In der zweiten Definitionsklasse sind die IQ-Definitionen zusammengefasst. In den Studien, die eine solche IQ-Definition verwenden, variieren die Grenzwerte, oberhalb derer von einer Hochbegabung ausgegangen wird. Urban (ebd.) nennt einen Wert von zwei Standardabweichungen nach oben als heutigen Konsenswert, weist aber auch auf Burts Kritik hin, nach der „die Anzahl der in diesem Sinne hochbegabten Kinder als viel zu niedrig eingeschätzt [wird]" (S. 11). Denn Burt bezweifelte, dass die Verteilung der „allgemeinen Intelligenz genau mit der Normalverteilungskurve übereinstimme ... und schlussfolgert, dass z.B. der Anteil der Kinder mit Intelligenzquotienten über 160 12mal größer sei als die Anzahl, die von einer Normalverteilungskurve her angegeben werden kann" (ebd.).
Das Ergebnis eines standardisierten Intelligenztests soll eine zuverlässige Vergleichbarkeit der Menschen ermöglichen, die dieselben Aufgaben bearbeitet haben. Dazu konzentrieren sich die IQ-Definitionen allein auf den Wert, der am Ende der Testauswertung steht, und lassen weitere Datenquellen (z.B. Beobachtungen) und Instrumente (z.B. Kreativitätstests) unbeachtet. Damit kann bereits ein einziger hoher Wert in einem Intelligenztest mit Hochbegabung gleichgesetzt werden. Eine solche eindimensionale Sichtweise wird von zahlreichen Autoren kritisiert, die darauf hinweisen, „daß, wenn der IQ höher als 120 ist, andere Variablen in wachsendem Maße wichtig werden (um von Hochbegabung ... zu sprechen)" (Ponjaert-Kristoffersen & Klerkx, 1982, S. 64). Von einer solchen Variablen, die oberhalb eines IQ von über 120 an Bedeutung gewinnt, berichtet Urban (2004a): „Oberhalb dieses Punktes [spielen] Kreativitätsmaße eine größere Rolle ... für die Voraussage der Leistungen einiger Kinder" (S. 11).
Roedell et al. (1989) weisen darauf hin, dass Testergebnisse keine unumstößlichen Werte darstellen, sondern vielmehr ein Abbild der Leistungsbandbreite. So bedeutet ein um drei Punkte niedrigeres Ergebnis auf der IQ-Skala in einem zweiten Test keinen zwischenzeitlichen Rückschritt in der Entwicklung, genauso wenig wie eine Differenz von drei Punkten zwischen zwei getesteten Personen einen wesentlichen Begabungsunterschied determiniert (S. 30 f). Denn insbesondere bei Kindern sind die Testergebnisse leicht beeinflussbar (z.B. durch Angst vor dem Testleiter) und damit wenig stabil. Daher ist es „notwendig, hilfreich ..., nicht nur mit einem einzelnen (Test-)Instrument zu arbeiten, sondern mehrere, verschiedene Datenquellen und Instrumente einzusetzen" (Urban, 2004a, S. 198). Für Urban stellt ein einzelner hoher Wert in einem Intelligenztest, wenn dieser korrekt durchgeführt wurde, zumindest ein Signal für Hochbegabung dar, denn „es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ein Testergebnis ein zu hohes Fähigkeitspotential vorspiegelt; ... Durchaus wahrscheinlich aber ist, dass das Kind weniger zeigt, als es eigentlich vermöchte" (ebd., S. 197 f).
Die Mindestanforderung, die an eine Intelligenzmessung bei Kindern gestellt wird, ist die Abbildung der gegenwärtigen Fähigkeiten. „In den meisten praktischen Anwendungen wird von einem Test erwartet, daß er sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Leistungsfähigkeit eines Kindes richtig einschätzt" (Roedell et al., 1989, S. 28). Dieser erhöhte Anspruch gilt insbesondere für die Formen der Identifikation, die auf eine Auswahl und Zulassung für pädagogische Förderprogramme für Hochbegabte abzielen. Die Genauigkeit einer solchen Prognose ist sowohl abhängig vom Zeitraum, über den die Vorhersage verlangt wird, als auch vom Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Testung. „Während der frühen Vorschuljahre durchgeführte Intelligenztests lassen generell nur ungenaue Aussagen über die Intelligenz oder Schulleistung des älteren Kindes zu. Allerdings steigt die Vorhersagegenauigkeit von Testergebnissen zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr dramatisch an" (ebd.).
Allerdings umfasst diese zweite Definitionsklasse deutlich weniger Definitionen, als die weite Verbreitung und die lange Geschichte der Intelligenzmessung vermuten lässt. „Insgesamt fällt auf, dass ein enger Bezug zum Intelligenzquotienten vermieden wird, obwohl gerade in früheren Arbeiten so gut wie ausschließlich ... die durch seine Anwendung erhaltenen Messwerte für die Zuordnung zu den Gruppen ,gifted’ oder ,non-gifted’ ausschlaggebend waren" (Urban, 2004a, S. 10).
Bei einer Konzentration auf den Intelligenzquotienten werden die sog. Spezialbegabungen (auch: Sonderbegabungen) nicht berücksichtigt. Aber die Nachfrage und steigende Aufmerksamkeit der Gesellschaft für herausragende Leistungen in allen, auch alltäglichen Bereichen, führte zu einer deutlichen Ausweitung des Begabungskonzepts. Die sozialen Definitionen, aus denen Lucitos dritte Definitionsklasse besteht, schließen eine Vielzahl von unterschiedlichen Begabungen mit ein: „Das talentierte oder begabte Kind zeigt beständig bemerkenswerte Leistungen in jeglicher Art von erstrebenswerten Bemühungen. Deshalb umschließt dieser Begriff nicht nur das intellektuell begabte Kind, sondern auch jene, die sich in Musik, bildnerischen Künsten, Theaterstücke-Schreiben, technischen Fertigkeiten und sozialen Führungsqualitäten vielversprechend zeigen" (Henry, 1958, zitiert nach Holling & Kanning, 1999, S.93).
Die Bedeutung der einzelnen Leistungsbereiche ist in der Forschung nicht unumstritten, da im Gegensatz zur intellektuellen Hochbegabung nur wenige oder gar keine objektiven Testverfahren existieren. Daher lassen sich z.B. sportliche Hochbegabungen vor allem an den gezeigten Leistungen, also den Ergebnissen und Ranglisten, identifizieren und miteinander vergleichen. Denn die Bestimmung von allgemeingültigen, objektiven Kriterien erweist sich als schwierig. Für die Begabungen im musischen Bereich fehlt eine allgemein akzeptierte Definition von Kreativität, von der man auf eine Früherkennung oder einen Entwicklungsverlauf des künstlerischen Talents schließen könnte (ebd.).
Beschreibungen einer sozialen Hochbegabung finden sich zwar sowohl in der nichtwissenschaftlichen, als auch in der wissenschaftlichen Literatur, aber trotzdem sind die Vorstellungen zu diesem Konstrukt sehr vage. Einen Ordnungsversuch unternimmt Abroms, der neben den Führungseigenschaften, die häufig synonym mit sozialer Begabung verwendet werden, drei weitere Bereich aufzählt: die soziale Wahrnehmung, das prosoziale Verhalten und das moralische Urteilen. Nach Abroms umfassen die Führungseigenschaften auch die anderen drei Bereiche, dafür schließt er negative Ausprägungen der Führung (z.B. Gewaltherrschaft) aus der Definition aus (Feger, 1988, S. 88 f).
Prozentsatzdefinitionen, welche die vierte Definitionsklasse bilden, definieren einen bestimmten Anteil einer Gruppe als hochbegabt. Dabei setzt die jeweilige Definition die Auswahl der Gruppe, den Anteil der Hochbegabten und das Messkriterium fest. „Der Begriff hochbegabt umfasst jene Kinder, die ein überdurchschnittliches intellektuelles Potential und die funktionale Fähigkeit besitzen, schulleistungsmäßig zu den oberen 15% bis 20% der Schülerpopulation zu gehören" (Fliegler & Bish, 1959, zitiert nach Urban, 2004a, S. 9). Eine Orientierung an Schulnoten findet sich auch bei anderen Autoren, die den Anteil der Hochbegabten mit 11% (Gowan), gut 10% (Bristow et al.) und 2,5-3% (Webb et al.) niedriger ansetzen. Die zahlreichen Kritiker dieser Definitionen halten dagegen, „daß bei einem Kriterium ,hoher Notendurchschnitt’ viele kreative Talente, die sich im Alltagsleben bewähren, übersehen werden" (Feger, 1988, S. 102).
Wenn die Schulnoten als Messkriterium durch die Testwerte eines Intelligenztests ersetzt werden, überschneidet sich diese Prozentsatzdefinition mit den IQ-Definitionen der zweiten Definitionsklasse. Die Zugehörigkeit des Einzelnen zum Anteil der Hochbegabten ist bei den Prozentsatzdefinitionen wesentlich von der Auswahl der Gesamtgruppe abhängig, denn das Potential jedes einzelnen wird im Verhältnis zum Potential der anderen definiert. Ein Student, der an seiner Universität zu den Leistungsbesten zählt, kann bei einer Ausweitung der Gruppe auf alle Studenten eines Bundeslandes aus den oberen Prozenträngen herausfallen und damit nicht mehr als hochbegabt gelten. Damit bleibt diese Definition „von der willkürlichen Zusammenstellung der Gruppen abhängig" (Kossmann, 2002, S. 22).
Die fünfte Klasse wird aus den Definitionen gebildet, die Kreativität als wesentlichen Faktor für Hochbegabung ausweisen. Urban (2004b) sieht in diesem Zusammenhang von Kreativität und Hochbegabung ein Indiz für ein komplexeres Konzept von Hochbegabung und deren Ursachen, das die verengte Sichtweise ablöst, nach der „ausschließlich quantitativ hoch ausgeprägte Intelligenzfähigkeit als ... Begabungsindikator [akzeptiert wird]" (S. 87). Die Integration der Kreativität als konstitutive Komponente in die Hochbegabungsdefinition lässt aus den Hochbegabten „Wissensproduzenten [werden] und nicht ... bloße hocheffektive Wissensaneigner und - verwerter" (ebd.).
Allerdings ist auch Kreativität kein einheitlich verstandenes Konzept. Die zahlreichen psychologischen Richtungen haben jeweils ein eigenes Verständnis von Kreativität entwickelt, die sich „in sehr unterschiedlicher Weise, wenn überhaupt, in empirische und psychologisch-diagnostische Fragestellungen, geschweige denn psychologischdiagnostische Verfahren, umsetzen lassen" (ebd., S. 111).
Die Definitionen der fünften Klasse führen die Produkte der Hochbegabung auf das glückliche „Zusammenspiel von Intelligenzkomponenten mit Kreativität und Anstrengungsbereitschaft unter günstigen, förderlichen Bedingungen der Mikro- und Makro-Umwelt [zurück]" (ebd., S. 87). Ein multifaktorales Konzept von Hochbegabung erfordert eine umfangreiche Diagnostik, die über standardisierte Intelligenztests hinausgeht, denn „die Breite und Vielfalt intellektueller Begabung ... zeigt sich in der Praxis oft in der Bewältigung wenig strukturierter Probleme, bei denen es keine definierte ,richtige’ Lösung gibt" (Holling & Kanning, 1999, S. 52).
Das jeweilige Konzept von Kreativität bestimmt auch deren Bedeutung für die vorschulische Entwicklung des Kindes. Ein häufig angewandtes Kriterium ist die Neuheit einer Leistung in Bezug auf die Gleichaltrigengruppe. Danach wird eine erbrachte Leistung nur dann als kreativ definiert, wenn sie für die gleichaltrigen Spielgefährten eines Kindes im Vorschulalter neu ist. Mit einer Ausweitung des Kriteriums Neuheit, z.B. auf einen gesamtgesellschaftlichen Bezug, verliert die Kreativität an Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Oerter (1971) bezieht die Neuheit einer Leistung auf das Individuum selbst: „Das Bedürfnis nach Neuem, ein zentrales Motiv für die menschliche Entwicklung (Hunt, 1965) ist in der frühen Kindheit so stark, dass sich das Kind selbst neue Situationen schafft, wenn von außen her keine neuen Reize auftreten" (S. 76).
Als sechste Definitionsklasse sieht Lucito eine selbstentwickelte Hochbegabungsdefinition, die eng auf Guilfords dreidimensionales Strukturmodell des Intellektes bezogen ist. In dieser Definition benennt Lucito nicht nur die Art der intellektuellen Fähigkeiten, die den Hochbegabten auszeichnen, sondern auch deren Anwendung: „Hochbegabt sind jene Schüler, deren potentielle intellektuelle Fähigkeiten sowohl im produktiven als auch im kritisch bewertenden Denken ein derartig hohes Niveau haben, daß begründet zu vermuten ist, daß sie diejenigen sind, die in der Zukunft Probleme lösen, Innovationen einführen und die Kultur kritisch bewerten, wenn sie adäquate Bedingungen der Erziehung erhalten" (1964, zitiert nach Feger, 1988, S. 58).
Lucitos Definition beschränkt sich nicht, wie es Urban (2004a) bei einigen Definitionen bemängelt, auf die bereits entwickelten Fähigkeiten, sondern umfasst auch „die Entwicklungsmöglichkeit von bisher, aufgrund irgendwelcher Bedingungen gehemmten oder nicht geförderten Begabungen und Fähigkeiten" (S. 10). Als Voraussetzung für eine Entwicklung dieser Begabungen und Fähigkeiten nennt Lucito eine Erziehung, die den Bedürfnissen des Hochbegabten angepasst ist.
Auch Marland betont die Bedeutung einer begabungsfördernden Erziehung: „Hochbegabte und talentierte Kinder sind jene, von berufsmäßig qualifizierten Personen identifizierten Kinder, die aufgrund außergewöhnlicher Fähigkeiten hohe Leistungen zu erbringen vermögen. Um ihren Beitrag für sich selbst und für die Gesellschaft zu realisieren, benötigen diese Kinder die Bereitstellung differenzierter pädagogischer Programme und Hilfestellungen, die über die normalen, regulären Schulprogramme hinausgehen. Kinder, die zu hohen Leistungen fähig sind, schließen solche mit gezeigten Leistungen und / oder potentiellen Fähigkeiten in irgendeinem der folgenden Bereiche mit ein:
1. „Allgemeine Intelligenz,
2. Spezifische akademische (schulische) Eignung,
3. Kreatives oder produktives Denken,
4. Führungsfähigkeiten,
5. Bildnerische und darstellende Künste,
6. Psychomotorische Fähigkeiten."
(Marland, 1972, zitiert nach Feger, 1988, S. 77)
Der Gedanke, die Leistungsfähigkeit der Hochbegabten als Beitrag für die Gesellschaft zu verstehen oder zu vereinnahmen, ist keineswegs neu, sondern hat eine Jahrhunderte lange Tradition (Kap. 2). Auch in anderen Definitionen des 20. Jahrhunderts ist diese Idee zu finden: „Hochbegabte Kinder sind solche, die vom Kindergartenalter an bis in ihre Hochschulzeit ungewöhnlich viel versprechend sind in Bezug auf gesellschaftlich nützliche Gebiete" (Havinghurst, zitiert nach Urban, 2004a, S. 9). Auch wenn Havinghurst damit möglicherweise meint, dass ein Hochbegabter seine Fähigkeiten für sich nutzbar machen kann, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, verweist Kirk auf die hervorragende intellektuelle Ausstattung, die grundlegend für die Hochbegabung sei und kritisiert: „Dadurch, dass wir versuchten, in unsere Definition von Begabung wichtige Faktoren wie Führereigenschaften, Leistung und Motivation zu integrieren, vermischten wir unser Konzept über Begabung mit wünschenswerten Erziehungszielen für begabte Kinder" (Kirk, zitiert nach ebd., S. 10).
In einem Artikel, der anlässlich der Gründung der „Gesellschaft zur Förderung hochbegabter Kinder" in der Wochenzeitung „Die Zeit" veröffentlicht wurde, wird sowohl die Vereinnahmung der Hochbegabten durch die Gesellschaft, als auch der daraus resultierende Erziehungsauftrag deutlich: „Die Zukunft einer Nation beruht auf den Fähigkeiten ihrer Kinder; die Bundesrepublik kann es sich nicht leisten, die begabtesten von ihnen links liegen zu lassen. Sie sind unsere bedeutendste natürliche Energiequelle. Sie sind die geistigen Führer, Erfinder und Künstler von morgen, aber sie brauchen heute Hilfe, um sich selbst zum Wohle der Allgemeinheit verwirklichen zu können" (Unger, 1978, zitiert nach ebd., S. 9).
3.2 Hochbegabungsmodelle
Zahlreiche Modelle versuchen, das Zusammenwirken von Anlage- und Umweltfaktoren darzustellen und deren Einfluss auf die Begabungsentwicklung. Die Hochbegabungsmodelle unterscheiden sich vor allem in der Fragestellung, ob sie die Hochbegabung als eine Leistung verstehen oder als Disposition zu hohen intellektuellen Fähigkeiten, die sich nicht im Verhalten manifestieren muss (Holling & Kanning, 1999, S. 6 ff).
Die Modelle, die Hochbegabung als Leistung verstehen und sie damit für prinzipiell beobachtbar halten, grenzen diejenigen aus, die „zwar einen hohen IQ haben, aber in der Schule nur schwache Leistungen erzielen" (ebd.). In den Dispositionsmodellen gelten diese sog. Underachiever als hochbegabt, weil bereits eine entsprechende Anlage als Hochbegabung definiert wird, die sich mit Tests messen lässt.
Zwei Modelle, die häufig in der Literatur zur Hochbegabung erwähnt werden, sollen hier vorgestellt werden. Renzullis „3-Ringe-Modell" von 1979, das Hochbegabung als Schnittmenge dreier Personalmerkmale versteht und „vermutlich wegen seiner Schlichtheit und seiner unmittelbaren Eingängigkeit so starke Akzeptanz gefunden hat" (Feger & Prado, 1998, S. 36). Und das 1993 von Gagné vorgestellte „Differenzierte Begabungs- und Talentmodell", das zwischen Begabung als Anlage und Talent als außergewöhnlicher Leistung differenziert.
3.2.1 3-Ringe-Modell (Renzulli)
Diese mengentheoretische Darstellung (Abbildung 1) besteht aus drei Kreisen, die für die Personenmerkmale „überdurchschnittliche Fähigkeiten", „Kreativität" und „Aufgabenverpflichtung" stehen, und der Schnittmenge dieser drei Kreise, welche die Begabung darstellt.
In den Bereich „überdurchschnittliche Fähigkeiten" fallen „zum einen allgemeine kognitive Fähigkeiten (hohes Niveau im abstrakten Denken z.B.), zum anderen aber spezielle Fähigkeiten, wozu ... [Renzulli] etwa (Arbeite-) Techniken zählt" (ebd., S. 37) oder die Fähigkeit, Informationen in bezug auf ihre Bedeutung für die Problemlösung zu selektieren. Die „Kreativität" stellt eine Form des Lösungsverhalten von Aufgaben und Problemen dar, die sich durch originelles, flexibles und produktives Vorgehen auszeichnet. Unter „Aufgabenverpflichtung" ist die Anstrengungsbereitschaft des Individuums zu verstehen, die kognitive, emotionale und motivationale Komponenten enthält. „Um ein Ziel zu erreichen, muß man sich gedanklich damit auseinandersetzen, sich gefühlsmäßig von diesem Ziel angezogen fühlen und es mit Einsatz und Willensstärke verfolgen" (Holling & Kanning, 1999, S. 8).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: 3-Ringe-Modell nach Renzulli
Nach Renzullis Modell kommt ein Mensch nicht hochbegabt zur Welt, sondern er kann ein hochbegabtes Verhalten entwickeln. Aber nur das Zusammenwirken von überdurchschnittlichen Fähigkeiten, hoher Anstrengungsbereitschaft und hoher Kreativität führt zu einer herausragenden Leistung. Renzulli bezeichnet es als Ziel seiner Hochbegabungskonzeption, einer möglichst großen Gruppe von potentiell Hochbegabten den Zugang zu Fördermaßnahmen zu ermöglichen. Mit der Berücksichtigung der Kreativität und Aufgabenorientierung soll eine Konzentration auf Intelligenztests zur Identifizierung von Hochbegabten vermieden werden (ebd., S. 8 f).
Aber gerade diese zusätzlichen Faktoren werden kritisiert, denn der Faktor der „Aufgabenorientierung“ erscheint nur wenig stabil. Nach Renzullis Modell würde eine Person schon bei einer kurzfristig nachlassenden Anstrengungsbereitschaft, z.B. durch eine emotionale Ablenkung, nicht mehr als hochbegabt definiert werden. Findet die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu der alten Motivationsstärke zurück, würde sie wieder zu den Hochbegabten gezählt werden (Feger & Prado, 1998, S. 36).
Ein weiterer Kritikpunkt des Modells ist die Gleichsetzung von Begabung und Leistung, denn die „übersieht die Tatsache, daß es viele Schüler gibt, die trotz in Intelligenztests nachgewiesener herausragender Fähigkeiten nur schwache Schulleistungen erbringen“ (Holling & Kanning, 1999, S. 9). Dass die Underachiever „trotz ihrer Fähigkeiten nicht als hochbegabt bezeichnet werden, weil ihnen die als notwendig postulierte Motivation (Aufgabenverpflichtung) fehlt ... widerspricht Renzullis eigenem Anliegen, gerade die seiner Meinung nach große Gruppe der zu unrecht nicht als hochbegabt Identifizierten zu entdecken und zu fördern“ (Feger & Prado, 1998, S. 9). Die Kritiker bestreiten nicht die Notwendigkeit der Motivation für das Erbringen einer herausragenden Leistung, sondern plädieren für eine Differenzierung der Begriffe Begabung und Leistung, wie sie Gagné in seinem Modell vornimmt.
3.2.2 Differenziertes Begabungs- und Talentmodell (Gagné)
Um die Differenzierung der Begriffe „Begabung“ und „Talent“ in Gagnés Modell (Abbildung 2) nachzuvollziehen, muss man die Festlegung des Begriffs „Talent“ im deutschen Sprachraum überwinden. Denn während „Talent“ hierzulande im Sinne einer genetischen Disposition definiert wird, verwendet ihn Gagné im Sinne einer herausragenden Leistung: „Talent als weit überdurchschnittliche Performanz auf einem oder mehreren Gebieten“ (Holling & Kanning, 1999, S. 14).
Gagné entwickelte sein Modell der Hochbegabung, um Renzullis fehlende Differenzierung zwischen Begabung und Leistung, die auch in den Weiterentwicklungen (z.B. Mönks „Triadisches Interdependezmodell der Hochbegabung“) nicht nachgeholt wurde, zu überwinden und den Prozesscharakter der Begabungsentwicklung herauszustellen (ebd.).
Als Begabungen definiert Gagné Fähigkeiten, die weitgehend angeboren und noch nicht systematisch entwickelt sind. Deren Wachstum wird nicht ausschließlich von genetischen Komponenten bestimmt, sondern ist auch von der Umweltstimulation abhängig. Die Fähig- und Fertigkeiten, die systematisch entwickelt wurden und die einen Menschen zu einem Experten auf einem Gebiet erheben, bezeichnet er als Talente.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Differenziertes Begabungs- und Talentmodell nach Gagné
Die Kreativität steht in Gagnés Modell als eine Kategorie der Begabungen gleichberechtigt neben anderen und kann an der Herausbildung unterschiedlicher Talente beteiligt sein. Sie ist aber, im Gegensatz zu Renzullis 3-Ringe-Modell, keine Voraussetzung für jedes einzelne Talent. Sehr weit gefasst ist die Kategorie der sensomoto- rischen Begabungen, die sowohl zur detaillierten Klangdifferenzierung des Konzert- Pianisten beitragen kann (als sensorisches Talent), als auch zur herausragenden Schnelligkeit des Bundesligafußballers (als motorisches Talent). Die Kategorie der „anderen Begabungen" bietet eine Erweiterungsmöglichkeit für neu entdeckte oder bislang wenig untersuchte Begabungen (ebd., S. 14 ff).
Den Mittelpunkt dieses Modells, inhaltlich und grafisch, bildet der Herausbildungsprozess der Talente aus den Begabungen, der sich durch Lernen, Training und Übung vollzieht und von internen und externen Katalysatoren beeinflusst wird. Einen wesentlichen intrapersonalen Einfluss übt die Motivation aus, die nicht nur, wie bei Renzulli, zu einer erhöhten Ausdauer bei der Aufgabenbewältigung führt, sondern auch zu einer Ausbildung spezifischer Interessen und gesteigerter Eigeninitiative. Weitere intrapersonale Katalysatoren stellen die Persönlichkeitsfaktoren wie Autonomie und Selbstwertgefühl dar, deren Ausprägung sich laut Gagné allerdings auch bei Gleichbegabten stark unterscheidet (ebd.).
Zu den wirksamen Umweltkatalysatoren gehören neben den Personen, die einen Einfluss auf die Talententwicklung nehmen, und der räumlichen Umgebung, in der das Kind aufwächst, auch die spezifischen Momente im Leben eines Menschen, die z.B. für eine spätere Berufswahl prägend sein können. Unbestritten ist die Wirkung der sog. Interventionen, z.B. als außerschulische Förderprogramme oder sportliches Training. Zusätzlich weist Gagné das Glück und den Zufall als Einflussfaktor für die Entwicklung aus (ebd.).
Die Talente, also die herausragenden Leistungen, können in ganz unterschiedlichen Feldern auftreten, z.B. im akademischen Bereich, in der Musik oder in einer Sportart. Die Herausbildung dieser Talente aus den Begabungen führt über ein systematisches und langwieriges Training, das „aufgrund der scheinbaren Leichtigkeit, mit der sehr talentierte Personen ihre Fertigkeiten ausführen, ... häufig übersehen [wird]" (ebd., S. 16).
Die einzelnen Komponenten des Modells können untereinander Einfluss ausüben. So kann ein Kind, das ein großes Interesse an einem speziellen Wissensgebiet zeigt (Motivation als intrapersonaler Katalysator), mit einer Unterstützung durch einen Lehrer hoffen (Person als Umweltkatalysator). Eine Verbindung zwischen zwei Komponenten, die im Fokus vieler Identifikationsansätze steht, ist die zwischen der Begabung und der Intervention. Denn eine Teilnahme an Fördermaßnahmen ist i.d.R. an den Nachweis einer Begabung geknüpft, z.B. durch einen hohen Wert in einem Intelligenztest.
Nach Gagné kann man nicht gradlinig von einer vorhandenen Begabung auf ein entwicklungsfähiges Talent schließen, denn jede Begabung kann zur Entwicklung unterschiedlicher Talente beitragen. Der Ursprung eines Talents kann also in jeder einzelnen Begabung liegen. Es gibt demnach auch keine einzelne Ausprägung der Begabung, die Voraussetzung für jede Form des Talents ist, wie es Renzulli in seinem Modell postuliert. Auch die Persönlichkeitsfaktoren stellen keine konstituierenden Elemente für eine Hochbegabung dar. „Wenn akzeptiert wird, daß Begabung als natürliche Fähigkeit betrachtet wird, müssen alle Faktoren ausgeschlossen werden, die nichts mit solchen Fähigkeiten zu tun haben" (ebd., S. 17). An der Herausbildung der Talente sind die Persönlichkeitsfaktoren wie Selbstvertrauen oder Motivation zwar beteiligt, aber sie sind keine Bestandteile der Talente selbst.
Das „Differenzierte Begabungs- und Talentmodell" öffnet den Hochbegabungsbegriff, in dem es von einer einseitigen Betonung kognitiver Fähigkeiten abweicht, und stellt gerade die Begabungsdiagnostik vor eine Herausforderung. Denn die Erweiterung der Begabung um kreative, sozioaffektive oder sensomotorische Fähigkeitsbereiche lässt sich bisher noch nicht befriedigend durch Diagnoseinstrumente bestätigen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Lars Riske (Autor:in), 2006, Hochbegabung im vorschulischen Alter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179347
Kostenlos Autor werden

















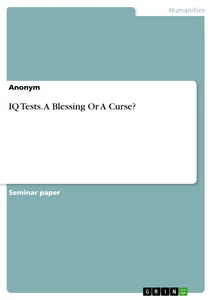




Kommentare