Leseprobe
Gliederung
1 Einleitung
2 Der Japan-Schock
2.1 "...the Japanese know how to manage better..."
2.1.1 Kritik
2.2 The 7-s -managerial molecule
2.2.1 Kritik
2.3. "Like a John Wayne or a Burt Reynolds in pinstripes..."
2.3.1 Kritik
2.4 "Do it, try it, fix it" (Peters/Waterman, 2000, S. 165)
2.4.1 Methoden
2.4.2 Kritik
2.5 Zwischenfazit: Conclusio der vier Pioniere
3 Unternehmenskultur - Ein neues Phänomen ?
3.1 Die Human-Relations Bewegung
3.2 "Culture may be an idea whose time has come" (Smircich, 1983, p. 33 9)
3.2.1 Ökonomische Ursachen
3.2.2 Gesellschaftlicher Wertewandel
3.3 Zweifel an Kontingenztheorien
3.4 Zwischenfazit: Die Renaissance der Unternehmenskultur
4 Theoretische Grundlagen
4.1 Ontologie
4.2 Epistemologie
4.3 Menschenbild
4.4 Methodologie
4.5 Zwischenfazit: Paradigmen der Sozialforschung
5 Zwei Paradigmen und ihre Integration
5.1 Objektivistischer Variablenansatz
5.1.1 Kritik
5.2 Subjektivistischer Metaphernansatz
5.2.1 Kritik
5.3 Integrative Perspektive
5.3.1 Kritik
5.4 Zwischenfazit: Fortschritt durch Integration
6 Definitionsversuch von Unternehmenskultur
7 Das Drei-Ebenen-Modell von E. Schein
7.1 Die drei Ebenen: Artefakte - Werte - Grundannahmen
7.1.1 Artefakte (artifacts) - sichtbar aber schwer zu entschlüsseln
7.1.2 Bekundete Werte (values) - Basis für Problemlösungen
7.1.3 Grundannahmen (basic assumptions) - Die kulturelle Essenz
7.2 Sechs Kategorien als inhaltliche Schemata
7.2.1 Wirklichkeit und Wahrheit
7.2.6 Das Wesen menschlicher Beziehungen
7.3 Zwischenbilanz: Kategorien menschlicher Existenzbewältigung
7.4 Externe Adaption und interne Integration
7.5 Methoden zur Analyse
7.5.1 Methodologie der zehn Schritte
7.5.2 Methodik der Interviews
7.6 Kritik
8 Unternehmenskultur als dynamisches Konstrukt
8.1 Midrange Methodology
8.2 Kritik
9 The Cultural Dynamics Model von Hatch
9.1 Kreismodell und Transformationsprozesse
9.1.1 Proaktive Manifestation: Von Grundannahmen zu Werten
9.1.2 Retroaktive Manifestation: Von Werten zu Grundannahmen
9.1.3 Proaktive Realisation : Von Werten zu Artefakten
9.1.4 Retroaktive Realisation: Von Artefakten zu Werten
9.1.5 Proaktive Symbolisation: Von Artefakten zu Symbolen
9.1.6 Retrospektive Symbolisation: Vom Symbol zum Artefakt
9.1.7 Prospektive Interpretation: Vom Symbol zur Grundannahme
9.1.8 Retrospektive Interpretation: Von der Grundannahme zum Symbol
9.2 Methoden - "The deeply it goes the less complete it is"
9.3 Theorie der Ethnomethodologie
9.4 Kritik
10 Unternehmenskultur, Führung und Managementstrategien im Wandel
10.1 Führung als soziales Phänomen
10.2 Managementstrategien zwischen Autonomie und Kontrolle
10.3 Der St. Gallener Organisationsansatz
10.3.1 Theoretische Grundlagen
10.3.2 Kritik
10.3.3 Capras "Wendezeit"
10.3.4 "Megatrends des Managements"
10.3.5 Normativ- strategisch- operativ
10.3.6 Kultur als Autopilot
10.3.7 Funktionalität von Subkulturen
11 Neue Führungskonzepte
11.1 Attributionstheorien: Das Wahrnehmungsphänomen Führung
11.1.1 Conclusio
11.2 Interaktiv: Die Leader - Member - Exchange (LMX)- Theorie
11.2.1 Entwicklung des Rollenkonzepts
11.2.2 Conclusio
11.3 Transformationale Führung oder „die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meere" (Wunderer, 1995, Sp.237)
11.3.1 Charisma
11.3.2 Zwischenfazit: Motivation auf gesteigertem Niveau
11.3.3 Transformationale Führung, OCB und Stewartship- Modell
11.3.4 Conclusio
11.4 Symbolische Führung : „Man kann nicht nicht symbolisch führen" (Neuberger, 1995, S.252)
11.4.1 Symbolisierte Führung
11.4.2 Symbolisierende Führung
11.4.3 Sinnstiftung oder Manipulation ?
12 Vergleich mit verwandten Konzepten
12.1 Unternehmenskultur und Corporate Identity
12.2 Unternehmenskultur und Organisationsklima
12.2.1 Objektivistischer organisationsbezogener Ansatz
12.2.2 Subjektivistischer personenbezogener Ansatz
12.2.3 Interaktionistischer Ansatz
12.3 Zwischenfazit: Organisationsklima als Manifestationsform von Unternehmenskultur
13 Methoden zur Erfassung von Unternehmenskultur
13.1 Erhebungsbogen zur Erfassung des Betriebsklimas (EEB)
13.2 Kulturfragebogen nach Sourisseaux
13.2.1 Darstellung der Facettentheorie in Grundzügen
13.2.2 Sourisseaux' Kulturfragebogen als Modifikation von Elizurs Konzept
13.2.3 Kritik
13.3 Kultur-Erhebung nach Gontard
13.3.1 Modifizierung des Mapping-Sentence
13.3.2 Entwicklung einer qualitativen Erhebung
13.3.3 Zur Theorie des qualitativen Interviews
13.3.4 Datenerfassung
13.3.5 Auswertung
13.3.6 Gontards Leitfaden
13.4 Ausblick
14 Conclusio
1 Einleitung
"Angepackt" werden müsse noch vieles in diesem Sinne, so klingt es fordernd im Vorwort der deutschen Übersetzung von Peters & Watermans „In Search of Excellence", dem unangefochtenen Bestseller zum Thema Unternehmenskultur.
Was war geschehen, dass Unternehmenskultur, ein Konstrukt mit langer Tradition, eine solch bedeutende Renaissance erfuhr?
Die US-Wirtschaft wurde von der japanischen Konkurrenz überrascht, ohne zu wissen, wie eine adäquate Reaktion aussehen sollte. Zudem waren traditionelle gesellschaftliche Werte ins Wanken geraten. Unternehmens- oder Organisationskultur (beide Begriffe werden im folgenden synonym verwendet) als Allheilmittel gegen ökonomische und moralische Krisen? Zahlreiche populärwissenschaftliche Veröffentlichungen propagierten starke Einheitskulturen als probates Gegenmittel. Die Wissenschaft krankte zur gleichen Zeit an der Erfolglosigkeit kontingenztheoretischer Ansätze.
Linda Smircich prophezeite:"Culture may be an idea whose time has come."
Die folgende Arbeit wird zunächst kritisch die wichtigsten Werke amerikanischer Managementliteratur darstellen, die Unternehmenskultur Anfang der 80er Jahre so ausserordentlich populär gemacht haben (Kap.2).
Im Weiteren werden Gründe für diesen Boom aus verschiedenen Motivlagen heraus erläutert und Traditionslinien der Unternehmenskultur aufgezeigt (Kap.3).
Die ausführliche Darstellung wissenschaftstheoretischer Grundlagen soll die paradigmatischen Gegensätzlichkeiten objektivistischer und subjektivistischer Konzepte verdeutlichen (Kap.4). Die "Wendezeit" (kognitiv, konstruktivistisch, interpretativ und qualitativ) führte zum Erstarken subjektivistischer Ansätze gegen die Dominanz objektivistischer Ansätze.
Es wird aufgezeigt, dass integrative Perspektiven am ehesten geeignet sind, sich dem komplexen Phänomen Unternehmenskultur anzunähern (Kap.5). Es handelt sich um eine Entwicklung, die mutatis mutandis auch für das Konstrukt Organisationsklima gilt (Kap.12).
Die theoretische Vorarbeit macht deutlich, wie schwierig es ist, eine Definition zu formulieren, die der harten Variable und dem schillernden Phänomen Unternehmenskultur gleichermaßen gerecht wird, ohne sogleich in ein "theoretisches Lager" abzudriften (Kap.6).
Im Weiteren werden drei elaborierte wissenschaftliche Modelle zur Unternehmenskultur ausführlich dargestellt. E. Scheins Drei-EbenenModell von 1985 gilt als das Konzept wissenschaftlicher Provenienz, das erstmals tieferliegende Schichten von Unternehmenskultur betrachtete und auch heute noch grundlegenden Charakter besitzt (Kap.7).
S. Sackmann, die führende deutsche Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet, betrachtet Unternehmenskultur als dynamisches Konstrukt und betont eine integrative Sichtweise (Kap.8).
Symbole und Transformationsprozesse stehen im Fokus des Cultural Dynamic Models von M.J. Hatch (Kap.9).
Die drei Modelle zeigen in ihrer Abfolge die stärker werdenden Tendenzen von Interaktion, Konstruktivismus und qualitativer Methodologie.
Diese Entwicklungen bestimmen analog sowohl die Führungsforschung als auch die Organisations- und Management-Theorie. Unternehmenskultur, Führung und Managementstrategien stehen in engem Zusammenhang miteinander, was sich nicht zuletzt im Wandel offenbart.
Selbstorganisationstheorien wie der St. Gallener Ansatz eröffnen völlig neue Perspektiven für Management und Mitarbeiter. Führung gestaltet Rahmenbedingungen für evolutorische Prozesse und Subkulturen gelten als innovatives Potential. Das "Sirenengeheul der Gestaltbarkeit" (Mayrhofer/Meyer, 2004, Sp. 1029) verspricht angesichts dieser Entwicklungen weniger verführbar zu klingen (Kap.10).
Gleiches gilt für die Führungsforschung, die sich immer mehr von klassischen Führungstheorien löst und die Interaktion zwischen Führenden und Geführten in den Mittelpunkt der Forschung rückt. Exemplarisch für Wahrnehmungs-, Deutungs- und Beziehungsphänomene werden die Attributionstheorie, das LMX-Konzept, das Modell der transformationalen Führung und der Ansatz der symbolischen Führung vorgestellt (Kap.11).
Der anschließende Quervergleich mit dem Konstrukt des Organisationsklimas zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Unternehmenskultur, ggf. Integrationsmöglichkeiten und methodische Ergänzungen auf und bereitet auf die schwierige Frage der Messbarkeit vor (Kap.12).
Es wird dargelegt, dass die Facettentheorie aufgrund ihrer konzeptionellen Vermittlung zwischen Theorie und Empirie zur Erfassung des komplexen Phänomens Unternehmenskultur geeignet ist. Sowohl der EEB von Rosenstiel als auch der Wertefragebogen von Elizur basieren auf diesem Konzept. Der Kulturfragebogen von Sourisseaux modifiziert Elizurs Konzept, vernachlässigt aber tiefere Ebenen von Unternehmenskultur. Das Modell von Gontard integriert Organisationsklima als vierte Ebene in das Scheinsche Modell und setzt hier den EEB als komplementäres Erhebungsinstrument ein. Der zusätzliche Einsatz eines modifizierten Wertefragebogens nach dem Muster von Elizur zeigt Diskrepanzen zwischen Klima- und Werteitems auf, die Ausgangspunkt für eine qualitative Erhebung sind. Nach ausführlicher Darstellung der Theorie des qualitativen Interviews wird erkennbar warum das problemzentrierte Interview auf der Basis des Scheinschen Kategoriensystems, integriert in ein multimethodisches Konzept, ein probates Mittel zur Annäherung an tieferliegende Grundannahmen menschlicher Existenzbewältigung sein könnte (Kap.13).
Der Autor der vorliegenden Arbeit fühlt sich, nicht zuletzt aus praktischer Erfahrung, einer integrativen Perspektive und einem behutsamen kultursensitiven Management auf ethischer Grundlage verpflichtet.
2 Der Japan-Schock
Es waren einige populärwissenschaftliche Veröffentlichungen der amerikanischen Managementliteratur Anfang der 80er Jahre, die schlagartig den Begriff der Unternehmenskultur in den Fokus allgemeinen Interesses rückten. Werke von Autoren wie T. Peters & R. Watermann (In Search of Excellence, 1982), T. Deal & A. Kennedy, (Corporate Cultures. Rites and Rituales of Corporate Life, 1982), W. Ouchi (Theory Z. How American Business Can Meet The Japanese Challenge, 1981) sowie R. Pascale & A. Athos (The Art Of Japanese Management, 1981) fanden geradezu euphorischen Anklang. Die Frage nach dem Erfolg dieser vorwiegend im journalistischen Stil verfassten "Anleitungen zum Erfolg", beantwortete sich durch die sozio- ökonomische Krise der US-Wirtschaft Ende der 70er Jahre (Heinen,
1997, S. 4). Dülfer (1991) merkt hierzu an: "In der amerikanisch/japanischen Import/ Export- Beziehung ergab sich für 1984 ein US- Defizit von 15 Mrd. Dollar bei einer ähnlichen Lage im Automobilmarkt" (S.6). Dieser „Japan-Schock" (Schmidt, 2005, S.25) brachte die amerikanischen Managementmethoden nachhaltig auf den Prüfstand, so dass sich erstmals die Frage aufdrängte: "Gibt es eine bessere BusinessMethodik als die amerikanische?" (Dülfer, 1991, S. 6) .
2.1 “...the Japanese know how to manage better...”
(Ouchi, 1981, p. 3)
Um dieser neuen Wettbewerbssituation zu begegnen, stellte Ouchi einen interkulturellen Vergleich zwischen amerikanischen und japanischen Unternehmen an (Dülfer, 1991, S. 7).
Er führt aus, welchen Einfluss das nationale kulturelle Umfeld auf das jeweilige Managementverhalten hat. Dabei kennzeichnet er die kulturelle Umwelt amerikanischer Unternehmen als heterogen, mobil und individuell, die japanischen Betriebe hingegen als homogen, stabil und kollektivistisch. Dieser gesellschaftlichen Makroperspektive entsprechen die jeweiligen Organisationstypen. Eine typische amerikanische Organisation (Typ A) ist gekennzeichnet durch kurzfristige Beschäftigung, schnelle spezialisierte Karrieren, individuelle Verantwortung und explizite Kontrollmechanismen. Das idealtypische japanische Organisationsmodell (Typ J) hingegen ist charakterisiert durch lebenslange Beschäftigung, breit angelegte, aber langsame Karrierewege und weitgehend kollektive Verantwortung bei implizit gesteuerter Kontrolle (vgl. Heinen, 1997, S. 7).
Als Ansatz zur Vermittlung dieser gegensätzlichen Profile entwickelte Ouchi (1981) einen neuen Organisationstypus (Typ Z) in Anlehnung an die MenschenbildTypologie von Mc Gregor:
Mc Gregor felt that these assumptions were primarily of two kinds, which he labelled 'Theory X’ and 'Theory Y'assumptions. A Theory X manager assumes that people are fundamentally lazy, irresponsible, and need constantly to be watched. A Theory Y manager assumes that people are fundamentally hard-working, responsible, and need only to be supported and encouraged (p.69).
Die Transformation von Typ A zu Typ Z erfolgt in einem mehrstufigen Prozess und zielt darauf ab, explizit formale Strukturen des Typs A zur Überwachung und Steuerung (Heinen, 1997, S. 7) zurücktreten zu lassen, sowie Beeinflussung und Steuerung der Organisationsmitglieder in einem Sozialisationsprozess sicherzustellen, dessen Inhalte Kooperationsbereitschaft, Vertrauen und gegenseitige Anerkennung sind.
Durch ein intensives Interaktionsgeflecht entwickelt sich eine stark ausgeprägte, homogene "company culture" (Heinen, 1997, S. 11), die die Schwächen der Typ A- Organisation kompensieren soll.
2.1.1 Kritik
Ouchi gebührt das Verdienst als einer der ersten den Kulturbegriff auf Wirtschaftsorganisationen angewandt zu haben. Trotz Abwandlungen bleibt Ouchis "Hybridmodell" generell zu sehr an dem japanischen Modell angelehnt (Heinen, 1997, S. 12). Die Darstellung der empirischen Ergebnisse der kulturvergleichenden Analyse ist unzureichend und wird keinem wissenschaftlichen Standard gerecht. Explizite Kontrollmechanismen werden durch ein normatives Führungsmodell, welches auf sozialen Werten beruht, abgelöst. Ouchi thematisiert hierbei nur unzureichend, dass eine durch Individualismus geprägte US-Gesellschaft große Probleme mit kollektivistischer Entscheidungsfindung und Verantwortung haben wird (Stähle, 1999, S. 507).
2.2 The 7-s -managerial molecule
Ebenso wie Ouchi gehen Pascale und Athos von einem interkulturellen Vergleich japanischer und amerikanischer Organisationen und ihrem gesellschaftlichen Umfeld aus. Ergebnis dieser Studien war auch hier eine massive Kritik an der amerikanischen Managementpraxis. Auf der Basis ihrer Erkenntnisse entwickelten Pascale und Athos gemeinsam mit Mitarbeitern der Beratungsfirma Mc Kinsey das "7-s-Konzept". Dieses Konzept dient als Basis zur Systematisierung derjenigen Variablen, die Arbeitsweise und Erfolg eines Unternehmens maßgeblich bestimmen (Pascale/Athos, 1982, S. 93 ff.).
Der zentrale Gedanke besteht in der Unterscheidung „harter" und „weicher" Faktoren (Pascale/Athos, 1981, p. 202). "Each of the 'levers' an executive uses, even if he uses 'too few', is important, but the central point is that the FIT among and between them has to be good to get long-term leverage" (1981, p. 202; Hervorhebung v. Verf.).
Als "harte" Variablen werden strategy (Strategie), structure (Struktur) und systems (Systeme) bezeichnet; also der Aktionsplan über die Einsetzung der Mittel, die charakteristische Organisationsform und die Informationsprozesse. Die anderen vier "Hebel" ("levers") sind staff (Personal), skills (Fähigkeiten), style (kultureller Stil) und superordinate goals (übergeordnete Ziele), also die Beschreibung vorhandener Personalkategorien und -typen, ihrer besonderen Fähigkeiten und der spezielle kulturelle Stil des Unternehmens. Die übergeordneten Ziele nehmen eine zentrale Position im 7-s-Modell ("managerial molecule", 1981, p. 202) ein. Sie beziehen sich auf den übergreifenden Zweck der Organisation ("overarching purposes", 1981, p. 81) und enthalten die grundlegenden Bedeutungen der geteilten Wertmaßstäbe. Sie beinhalten somit weit mehr als beispielsweise rein finanzielle Wachstumsziele, indem sie geistige Orientierung und Sinn vermitteln (..."goals, that 'move men’s hearts'", 1981, p.82).
Die Autoren bemängeln die Überbetonung der klassischen, harten Variablen ("overfocus on the 'hard' elements", 1981, p.82) in Bezug auf das "...cold triangle of strategy, structure, and systems ..." (1981, p.82) und fordern die Einbeziehung aller Faktoren und deren gezielte Abstimmung.
Die Betonung des Elements "Stil" (Heinen, 1997, S. 13) verweist auf eine Erweiterung des Führungsbegriffs im Sinne der Vermittlung von Bedeutung und Sinn über symbolhaftes Handeln: "...manager’s behaviour is a powerful form of symbolic communication to people down the line, telling them what he really cares about" (1981, p. 47).
2.2.1 Kritik
Das 7-s-Modell bedeutet im Vergleich zu Ouchi eine Umorientierung auf die Mikroebene der Unternehmung. Die Bedeutung weicher Faktoren wird hervorgehoben, vor allem die explizite Betonung des kulturellen Stils und der übergeordneten Ziele. Unternehmenskultur wird somit zu einer internen Variablen unter anderen. Staehle (1999) kritisiert das 7-s- Modell als "sehr unverbindlich und schlicht" (S. 509); im übrigen bedürfe es keiner Kulturforschung, um zu erkennen, wie wichtig der Umgang mit Mitarbeitern und deren Fähigkeiten sei. Im Sinne einer Konsistenztheorie legt das 7-s-Modell großen Wert auf die Passung der verschiedenen Elemente, vernachlässigt aber die Erkenntnisse der Kontingenztheorie, dass externe Umweltbedingungen zu berücksichtigen sind.
2.3. “Like a John Wayne or a Burt Reynolds in pinstripes...”
(Deal / Kennedy, 1982, p. 37)
Anders als beim 7-s-Konzept, welches auf eine erfolgreiche Passung der verschiedenen Elemente setzt, stellen Deal & Kennedy das "superordinated goal" ("...slogan-like evidence of a paramount belief-...", 1982, p. 6) als das mehr oder weniger alleinige Element ins Zentrum. Es handelt sich hierbei um Unternehmensgrundsätze oder Slogans wie z.B. "IBM means service"(1982, p. 6), die den Mitarbeitern zur Identifikation mit dem Unternehmen dienen, denn, so die Autoren weiter, "...the companies did best over the long haul were those that believed in something "(1982, p. 66). Im Mittelpunkt dieses Kulturverständnisses steht die Mitarbeiter-Orientierung: "We think that people are a companys greatest resource, and the way to manage them is not directly by computer reports, but by the subtle cues of a culture" (1982, p. 15).
Zugleich zeigt sich die stark funktionalistische Ausrichtung der Kultur: „A strong culture is a powerful lever for guiding behavior..." (1982, p.15).
Eine entscheidende Rolle spielen hierbei sogenannte "Helden", die die Werte und Glaubenssätze verkörpern und als Vorbild dienen:"...they create the role models for employees to follow. The hero is the great motivator, the magician, the person everyone will count on when things get tough" (1982, p. 37). "Helden" sind "symbolic figures" (1982, p. 37), die auf oft dramatische Weise zeigen, "...that the ideal of success lies within human capacity " (1982, p. 82).
Des Weiteren werden Riten und Rituale als symbolische Handlungen eingesetzt, und informelle Kommunikationssysteme dienen als Kanäle zur gezielten Verbreitung von Geschichten und Mythen.
Deal und Kennedy entwickelten eine Kulturtypologie zur Klassifikation von Unternehmen. Hierzu wird die Umwelt des Unternehmens nach zwei Merkmalen differenziert, dem Risikograd, der mit dem Geschäft verbunden ist und der Schnelligkeit der Rückmeldung über den Erfolg (vgl. 1982, chap. 6). So ergibt sich beispielweise bei hohem Risiko und schnellem Feedback eine Spekulationskultur ("the tough-guy, macho culture", p.107).
Ausdrücklich betonen die Autoren die Existenz und Bedeutung von Subkulturen, die beispielsweise abteilungsbedingt entstehen. Es wird sogar gefordert: "Encourage each subculture to enrich its own cultural life" ( p.153).
Im normativen Teil (chap.8) wird der „symbolic manager" postuliert, ausgestattet mit Sensibilität für die bestehende Kultur und einem Verständnis für die Bedeutung der Kultur für langfristigen Erfolg ("Symbolic managers are sensitive to culture and its importance for long-term success", p.141). Der kulturbewusste Symbol-Manager ist gleichwohl in der Lage eine prozessuale, behutsame Kulturänderung als Anpassung an eine veränderte Umwelt durchzuführen (chap. 9), wenn er die kulturellen Schlüsselattribute beachtet: "heroes, values, rituals" (p. 176).
2.3.1 Kritik
Der funktionalistisch ausgerichtete Kulturbegriff von Deal & Kennedy fasst Kultur explizit als interne Variable und wichtiges Element zum Erfolg auf. Andererseits ist dieser Ansatz klar kontingenztheoretisch ausgerichtet. Die Umwelt determiniert eindeutig die Charakteristika der Helden, der Werte und der Riten. Die Werte und Glaubenssätze entsprechen in weitem Umfang den Grundwerten der amerikanischen Gesellschaft, wie man besonders deutlich am propagierten Heldentypus eines John Wayne ablesen kann. Zudem wird die Untersuchung von Deal & Kennedy den Standards empirischer Forschung kaum gerecht. Es findet sich zwar zu Beginn eine Auflistung der untersuchten Unternehmen (p. 7), aber es fehlt sowohl ein Kriterium für diese Auswahl als auch eine Erörterung der Methoden. Im Grunde handelt es sich um eine Ansammlung von Anekdoten.
2.4 ”Do it, try it, fix it” (Peters/Waterman, 2000, S. 165)
Es bildet sich eine Tendenz heraus, sich immer mehr der Mikro-Ebene einer Unternehmung zuzuwenden. Kontingenztheoretische Überlegungen, die sehr stark Umwelt- und Situationseinflüsse betonen, treten in ihrer Bedeutung zurück. Die Veröffentlichungen von Deal & Kennedy sowie Peters & Waterman markieren den Beginn einer funktionalistisch- systemorientierten Variablensicht, die den Konsistenztheorien nahe stehen.
Der Bestseller „In search for excellence" von Peters und Waterman aus dem Jahre 1982 verhalf dem Begriff der Unternehmenskultur zu wirklicher Popularität. Neuberger berichtete bereits 1987 von über vier Millionen verkauften Exemplaren in den USA und von der bereits 10. Auflage der deutschen Ausgabe binnen Jahresfrist. Offenbar traf diese Publikation exakt den richtigen, journalistisch brillanten, anschaulich mit vielen Geschichten und Anekdoten angereicherten Ton: "Aus Amerika kommt eine frohe Botschaft. Gute Unternehmensführung gibt es heute nicht nur in Japan" (2000, S. 21). Der japanische Wettbewerbsvorteil wird nur noch zu Beginn kurz zitiert, um sogleich in einen selbstbewussten, optimistischen Ton überzugehen, der das gesamte Buch prägt.
Durch den "offensiven Brustton der Gründerzeit", der Wiederbelebung des Unternehmers ("Der Champion sitzt nicht in Wolkenkuckucksheim...", S. 243), dem Besinnen auf Grundtugenden ("...die Hauptaufgabe des Managements sei es, 'die Herde ungefähr nach Westen zu treiben'", S. 144), dem Angebot einfacher Regeln und Rezepte mit direktem Praxisbezug (Acht Grundtugenden, S. 36-39) und vor allem durch die vernichtende Kritik an den von Rationalität geprägten traditionellen Organisationstheorien ("Paralyse durch Analyse", S. 55), wurde „In Search of Excellence" zur Pflichtlektüre des US-Topmanagements (Dülfer, 1991, S. 11).
2.4.1 Methoden
Peters & Waterman etablierten die Kriterien Innovation und Erfolg zur Gewinnung einer Stichprobe, um ihre Studie durchzuführen. (S. 42-49). Es wurde eine Reihe finanzwirtschaftlicher Kennzahlen über einen Zeitraum von rund 20 Jahren (19611980) erhoben, die Unternehmen als überdurchschnittlich erfolgreich auswiesen. Als innovativ wurden Unternehmen bezeichnet, die es besonders gut verstanden, "...sich laufend an jede Veränderung ihrer Umweltbedingungen anzupassen" (S. 34; Hervorhebung v. Verf.). Innovation wird von den Autoren definiert als "...kontinuierliche^ Strom richtungsweisender Produkte und Dienstleistungen ..." (S. 45). Als Aufforderungskriterien für
Anpassungs- und Veränderungsprozesse gelten veränderte Kundenbedürfnisse, verlagerte Wettbewerbssituationen, eine sich wandelnde öffentliche Meinung, die Wandlungen im Kräfteverhältnis des Welthandels und geänderte staatliche Auflagen.
Mit Hilfe dieser Innovationsindizes wählten Branchenkenner entsprechende Unternehmen aus (vgl. S. 45). Auf der Basis des „7-s- Modells" (s.o.) wurden mit Managern von so ermittelten US-Unternehmen strukturierte Interviews geführt. Als Ergebnis dieser Erhebung kristallisierten die Autoren acht Grundtugenden erfolgreichen unternehmerischen Handelns heraus. Nach dem Motto „Probieren geht über studieren" (S. 36) wurde zunächst das Primat des Handelns als Grundtugend postuliert. Langwierigen rationalen Analysen wurde die zugespitzte Handlungsmaxime des „Do it, Try it, Fix it" (S. 165) gegenübergestellt.
Neben der Forderung nach Kundennähe, der Bindung an das angestammte Kerngeschäft und der Konkretisierung der Grundphilosophie eines Unternehmens durch ein vorgelebtes Wertesystem rückt der Mitarbeiter, auf den es schließlich ankommt, in den Fokus. "Die exzellenten Unternehmen betrachten ihre Mitarbeiter als eigentliche Quelle der Qualitäts- und Produktivitätssteigerung" (S. 37). Dem einzelnen Mitarbeiter werden Handlungsspielräume für Unternehmertum geöffnet, die durch einen unbürokratischen flexiblen Organisationsaufbau und eine "strafflockere" Führungsphilosophie gefördert werden.
Die Autoren stellen heraus, dass es schließlich die „Intensität der Firmenkultur" (S. 39; Hervorhebung v. Verf.) ist, die exzellente Unternehmen kennzeichnet. Je konsequenter die Grundtugenden umgesetzt werden, desto stärker und homogener gestaltet sich die Kultur des Unternehmens. Der funktionalistisch-systemorientierte VariablenAnsatz hält Kultur für messbar und machbar.
2.4.2 Kritik
In forschungsmethodischer Hinsicht ist der Ansatz von Peters & Waterman stark zu kritisieren. War bereits das „7-s-Modell" weder theoretisch abgeleitet noch empirisch untermauert, so gilt gleiches für die Ableitung der acht Grundtugenden als Extrakt der geführten Interviews. Gleichermaßen bleiben die Kriterien für die Stichprobe der Unternehmen, zu der im übrigen eine Kontrollgruppe fehlt, eher diffus und subjektiv.
2.5 Zwischenfazit: Conclusio der vier Pioniere
Aufgerüttelt durch den Japan-Schock wurden interkulturelle Vergleiche angestellt (Ouchi). Dieser Blick der Makroperspektive verengt sich v.a. durch Einführung des „7-s-Modells" immer mehr auf die Mikroebene (Peters/Waterman). Die Lektüre der dargestellten „new management thinkers" (Dülfer, 1991, S. 9) hinterlässt stets den Eindruck, als handle es sich bei Unternehmenskultur um ein völlig neues Konzept.
Aus der Motivlage von Managern und Unternehmensberatern geschrieben, betrachten alle Autoren Unternehmenskultur als Mittel zum Erfolg, das mehr oder weniger problemlos gestaltet und implementiert werden kann (Ebers, 1991, S. 43). Unkritisch wird aus rein praktischem Erkenntnisinteresse ein funktionalistisches Forschungsparadigma zugrundegelegt. Es bleibt offen, was überhaupt unter Unternehmenskultur zu verstehen ist und wie es um die empirische Erfassbarkeit steht. Stattdessen werden Beispiele, Plausibilitäten, offensichtliche Verhaltensweisen und Anekdoten scheinbar beweisführend aneinandergereiht, ohne an methodisch begründete Konzepte anzuschließen.
Dergleichen Ansätze eignen sich nicht zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem komplexen Konstrukt der Unternehmenskultur, wenngleich sie, in allerdings unsystematischer Form, Einzelaspekte enthalten, die auch für eine wissenschaftliche Analyse des Themas von Wichtigkeit sind und daher im weiteren immer wieder aufgegriffen werden. Es wird offensichtlich, dass sich völlig verschiedene Interessengruppen mit sehr unterschiedlicher Motivlage dieses offenbar sehr attraktiven und facettenreichen Konstrukts bemächtigen.
Im weiteren werden folgende Fragen zu beantworten sein:
Ist Unternehmenskultur ein neues Phänomen ?
Welchen Einfluss hat der Wertewandel auf Unternehmenskultur ?
Wie lässt sich Unternehmenskultur definieren und mit wissenschaftlicher Systematik darstellen?
3 Unternehmenskultur - Ein neues Phänomen ?
Ebers (1991, S.42f.) führt zur Frage der Forschungsinnovation eine Zitatensammlung aus den Jahren 1936-1969 an, die exemplarisch zeigt, dass das Thema Unternehmenskultur keineswegs neu und revolutionär ist, sondern eine lange Tradition aufweist. "Disziplingeschichtlich stehen Problembezug und Grundideen der Organisationskulturforschung in der Tradition der Human Relations Bewegung." (Ebers, 1991, S. 49).
3.1 Die Human-Relations Bewegung
Als Ausgangspunkt der HR-Bewegung können die Hawthorne-Experimente gesehen werden (Frieling & Sonntag, 1999, S. 34). Obwohl sich diese Experimente als unzureichend kontrollierte Feldexperimente herausstellten (vgl. Rice, 1982), so wurde doch klar, dass Emotionen und Einstellungen und vor allem zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Arbeitsgruppe die Leistung maßgeblich beeinflussten. Hatte sich die Psychotechnik noch am Individuum orientiert (Ulich, 1998, S. 35), gerieten nun sozialpsychologische Aspekte in den Vordergrund. Die "informelle Organisation" (Ebers, 1999, S. 49) wurde höher bewertet als die formelle Organisationsstruktur. Der Mitarbeiter wurde als Mitglied eines komplexen sozialen Systems betrachtet und galt nicht mehr als ausschließlich ökonomisch motiviert und motivierbar. Der Wechsel des Paradigmenbildes vom "homo oeconomicus" zum "social man", gilt als wichtige Vorstufe der Unternehmenskulturforschung.
Einen wichtigen Beitrag lieferte Kurt Lewin zur Erfassung der subjektiven Seite einer Organisation. In seiner Feldtheorie entwickelt er eine ganzheitliche und phänomenologische Betrachtungsweise als methodischen Zugang (Ebers, 1991, S. 51). Die Gestaltung soziotechnischer Systeme schließt an Lewin an (Ulich, 1997, S. 30).
Die Forschungsergebnisse des Tavistock-Instituts deuteten darauf hin, dass technisch-maschinelle Prozesse auf die Organisation und das Sozialgefüge der Mitarbeiterschaft wirken. Die Organisation wird begriffen als interaktives Netzwerk technischer und sozialer Strukturen. E. Jaques vom Tavistock-Institut bringt es bereits 1951 auf den Punkt, wenn er einer Studie den Titel gibt „The changing culture of a factory" (v.Rosenstiel & Comelli, 2003, S. 429).
3.2 “Culture may be an idea whose time has come“ (Smircich, 1983, p. 339)
Es handelt sich um eine Wiederentdeckung, aber keinesfalls um ein neues Phänomen. Wenn Kulturforschung also eine Traditionslinie zumindest seit den 30er Jahren aufweist, so müssen es äußere Rahmenbedingungen gewesen sein, die die Kulturdebatte in den 80er Jahren dermaßen angefacht haben.
3.2.1 Ökonomische Ursachen
Von der Dominanz der Japaner auf dem Weltmarkt Ende der 70er Jahre, war bereits die Rede. In Zusammenhang mit der Ölkrise und dem militärischen Eklat in Vietnam geriet die USA in eine sozio- ökonomische Krise. Plötzlich standen auch gesellschaftliche Werte auf dem Prüfstand. Als erste Reaktion wurden interkulturelle Vergleiche durchgeführt, bis man sich schließlich besann und die Wettbewerbsstärke auf eine selbsterzeugte Unternehmenskultur zurückführte. Eine krisenhafte Ökonomie als Folge stetig verschärften nationalen und internationalen Wettbewerbs sowie die zunehmende Globalisierung mit der daraus resultierenden Tendenz zu Fusionen, Akquisitionen und Merger" sind stets eine Grundbedingung für neue Kulturdebatten. Es sei nur am Rande erwähnt, dass auch die HR- Bewegung aus der Reaktion auf die Wirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre hervorgegangen war (Ebers, 1999, S. 49).
3.2.2 Gesellschaftlicher Wertewandel
In direktem Zusammenhang mit ökonomischen Krisen oder Strukturänderungen steht immer auch der Wandel gesellschaftlicher Wertorientierungen. Rosenstiel (v.Rosenstiel et al., 1993) betont, dass Unternehmen offene Systeme sind, die mit der sie umgebenden Gesellschaft in vielfältiger Beziehung stehen. Hofstede (1993) berichtet über den französischen Soziologen Max Pages, der von der Kultur der IBM France als "Schreckensgebilde" und "la nouvelle eglise"(S. 204; Hervorhebung v. Verf.) sprach, einer nach dem Diktum von Peters & Waterman hervorragenden und starken Unternehmenskultur. Die französische Gesellschaft ist einerseits stark von Hierarchien und Regeln, andererseits sehr individualistisch geprägt, was dazu führt, sich gegen vereinnahmende, homogene Kulturen zur Wehr zu setzen. Sehr anschaulich beschreiben Mader und Stähle (1991, S. 129145) den schwierigen Prozess der deutschen Wiedervereinigung aufgrund der jahrzehntelangen Einbettung der Unternehmen in völlig unterschiedliche politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Ronald Inglehart (1989, S. 11) spricht von schrittweisem und unmerklichem Wandel, von materialistischen zu postmaterialistischen Werten (seine Studie bezieht sich auf die Jahre 1970-1988) und gründet seine Theorie des Wertewandels in westlichen Zivilisationen auf zwei Schlüsselhypothesen (1989, S. 92 ff).
Die Mangelhypothese besagt, dass man den Dingen den subjektiv größten Wert beimisst, deren Ressourcen begrenzt sind. Die Wertprioritäten setzen sich erst zeitversetzt durch, so dass jemand, der in materieller Not aufwuchs, laut Sozialisationshypothese zeitlebens einer eher materialistischen Haltung folgen wird. Die Werte verschieben sich vom materiellen Pol wie Wirtschaftswachstum, Sicherheit und Ordnung hin zum postmaterialistischen Pol wie Ästhetik, individueller Autonomie und politischer Freiheit.
Klages (1984, zit. nach v.Rosenstiel, 2000, S. 49) stellt einen Rückgang von Pflicht- und Akzeptanzwerten zugunsten von Selbstentfaltungswerten fest. Unverändert ist eine postmoderne Abkehr von traditionell-allgemeingültigen Werten festzustellen. Klages spricht hier vom „Abschleifen der Werte" (Marre, 1997, S. 6). Der zentrale Wert von Arbeit lässt nach, gleichzeitig steigen aber die Ansprüche an Arbeit.
3.3 Zweifel an Kontingenztheorien
Ein weiterer Grund für die Wiederbelebung des UnternehmenskulturKonzepts waren akademische Zweifel am Erkenntniswert und der Praxistauglichkeit kontingenztheoretischer Forschung (Ebers, 1985, S. 20. Die klassisch-situativen Ansätze (z.B. von Lawrence und Lorsch, 1967, vgl. Stähle, 1999, S. 49) forschen nach Beziehungsmustern innerhalb und zwischen Subsystemen als auch zwischen der Organisation und der Umwelt. Das eigentliche Ziel besteht in der Formulierung normativer Aussagen, wie in bestimmten Situationen zu handeln ist, mit anderen Worten wie die Passung (fit) zwischen Kontext (Situation), Organisationsstruktur und Verhalten der Mitarbeiter gestaltet werden muss, um Effizienz zu erreichen. Methodisch herrschen strenge quantitative Verfahren mittels Fragebögen und strukturierten Interviews vor.
Derartige Ansätze werden der Komplexität von Unternehmen in keiner Weise gerecht und führen zwangsläufig zu Vorwürfen von Positivismus und situativem Determinismus (Stähle, 1999, S. 51). Der Einfluss der Umwelt muss als quasimechanistisch bezeichnet werden, da eine einseitige Kausalbeziehung von Umwelt auf Struktur und von Struktur auf Verhalten unterstellt wird. Die Ergebnisse bestehen häufig in situativen Hypothesen, die sich selten bewähren, als auch in niedrigen Korrelationen und inkonsistenten Ergebnissen.
Zur Erforschung eines sozialen Phänomens wie Unternehmenskultur müssen zusätzlich immer auch Methoden des interpretativen Paradigmas der Sozialwissenschaften Anwendung finden (Bungard, 2004, S. 135-39). Ebers (1991) weist auf die Öffnung in den Sozialwissenschaften Mitte der 70er Jahre für Hermeneutik, Phänomenologie und qualitative Methoden hin (S. 47). Die Enttäuschung über die Ergebnisse eines streng angewandten normativen Paradigmas wird die UnternehmenskulturForschung im weiteren maßgeblich prägen.
3.4 Zwischenfazit: Die Renaissance der Unternehmenskultur
Die Gründe für die Renaissance der Unternehmenskultur sind mannigfaltig und entspringen völlig verschiedenen Motivlagen und Rahmenbedingungen: Gewinnmaximierung, Wandel des ökonomischen und in Wechselwirkung damit des gesellschaftlichen Umfeldes und wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses.
Die Reaktion der Wissenschaft ließ einige Zeit auf sich warten, um die mannigfaltigen Eindrücke zu systematisieren und methodologisch einzuordnen. Linda Smircich veröffentlichte 1983 eine Literaturstudie, die bisherige Ansätze ordnete. Es war schließlich Edgar Schein, der mit seiner Monographie „Organizational Culture and Leadership" (1985) eine methodische Systematik entwickelte und auch definitorische Maßstäbe setzte. Bevor Scheins Definiton und Ansatz ausführlich erörtert werden, sollen die mittlerweile zahlreichen Ansätze systematisiert werden.
4 Theoretische Grundlagen
Aufgrund hoher Zahl und Heterogenität der Ansätze zur Unternehmenskultur wurden verschiedene Systematisierungen unternommen. In der einschlägigen Literatur hat sich die Unterscheidung in einen objektivistischen Variablenansatz, einen subjektivistischen Metaphern-Ansatz und eine integrative Kulturperspektive etabliert (vgl. zusammenfassend Mayrhofer & Meyer, 2004, Sp. 1025-1033).
Die systematischen Ausrichtungen werden nach folgenden wissenschaftstheoretischen Kriterien unterschieden: Ontologie, Epistemologie, Menschenbild und Methodologie.
4.1 Ontologie
Ontologie kreist im philosophischen Sinne um die Grundfrage: "Was existiert?"
Es ist ein zentraler Aspekt, ob man lediglich materielle Realitäten als existierend betrachtet oder auch geistige Realitäten wie Klassen, Relationen oder Ideen gleichermaßen als ontologische Realitäten gelten lässt. Die Klärung des ontologischen Status ist von höchster Bedeutung für die weitere Forschung, da hier geklärt wird, welcher Gegenstand überhaupt Objekt der wissenschaftlichen Prüfung sein kann. In diesem Zusammenhang ist der ontologische Status kognitiver Inhalte von Bedeutung. Man unterscheidet im wesentlichen die ontologischen Positionen des Realismus und des Nominalismus.
Der idealtypische Realismus billigt lediglich materiellen Phänomenen eine eigene ontologische Qualität zu, die dem Individuum quasi vorgelagert ist (Ochsenbauer & Klofat, 1997), S. 74). Hingegen betrachtet der Nominalismus Wirklichkeit als sozial konstruiert und nicht unabhängig vom Individuum. Kognitive Inhalte und Ideen erhalten einen vollgültigen ontologischen Status und werden somit Gegenstand von Forschung.
4.2 Epistemologie
Epistemologie oder Erkenntnistheorie befasst sich mit der grundsätzlichen Möglichkeit menschlicher rsp. wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Beantwortung dieser Frage hängt unmittelbar ab von der Zuschreibung ontologischer Qualitäten. Die erkenntnistheoretische Ausrichtung des Positivismus ist dem Realismus verpflichtet und betrachtet die materielle, beobachtbare Welt als einziges wissenschaftliches Forschungsobjekt. Der Forscher steht neutral außerhalb dieser objektiven Realität und versucht - dem naturwissenschaftlichen Ideal folgend - allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.
Die Gegenposition des „Antipositivismus" (Ochsenbauer & Klofat, 1997, S. 75) entspricht dem Nominalismus. Hier ist die Vorerfahrung des Forschers zentrale Voraussetzung zur Erkenntnisgewinnung (Seiffert, 1996, S. 57). Wissenschaftliche Erkenntnisse werden durch teilnehmende, interpretative Erschließung gewonnen. Eine herausragende Stellung innerhalb dieses interpretativen Paradigmas nimmt die soziologische Theorie des symbolischen Interaktionismus ein (Lamnek, 1995a ,S.46 ff).
4.3 Menschenbild
Die Gesamtheit der expliziten und impliziten Annahmen über den Menschen hinsichtlich Eigenschaften, Motiven, Einstellungen und ähnlichem verdichten sich zu einem Bild vom Menschen. Es finden sich zahlreiche dualistische Perspektiven und Typologien. Der prominenteste dualistische Ansatz ist das Gegensatzpaar von McGregor (s.o.). Die Typologie von Schein unterscheidet den rational-, social, self- actualizing- und den complex-man nach historischer Entwicklung. Ein Kernaspekt des Menschenbildes ist die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens. Prinzipiell lassen sich deterministische und voluntaristische Idealtypen unterscheiden (Ochsenbauer & Klofat, 1997, S. 75).
Der Determinismus sieht das Individuum in weitem Sinne von der Situation festgelegt. Menschliches Verhalten wird somit erklär- und prognostizierbar und durch die Kenntnis der mechanistischen Zusammenhänge schließlich steuerbar.
Der Voluntarismus hingegen geht von einem weitgehend freien Willen und mithin einem hohen Maß an Handlungsautonomie aus, der völlig verschiedene Reaktionen auf identische Stimuli zulässt. Wenngleich es sich um extreme Pole handelt, die verschiedene Forschungsrichtungen treffend kennzeichnen, so lassen sie doch vielfache gegenseitige Annäherungen zu.
4.4 Methodologie
Methodologisch unterscheidet man grundsätzlich eine nomothetische und eine ideographische Ausrichtung.
Das an den Naturwissenschaften orientierte nomothetische Erkenntnisziel ist stets das Auffinden von generalisierbaren, raumund zeitunabhängigen Gesetz- und Regelmäßigkeiten mit den klassischen Mitteln quantitativer Forschung zur Erklärung sozialer Phänomene (Diekmann, 1998, S. 93). Vor allem standardisierte Erhebung und intersubjektive Nachprüfbarkeit nach naturwissenschaftlichexperimentellem Muster sind hier charakteristisch.
Das ideographische Verfahren versucht in Anlehnung an Kultur- und Geisteswissenschaft die Beschreibung des Einzelfalles, des Individuellen und Besonderen mittels qualitativer, in der Regel nicht- oder teilstandardisierter Methoden. Es wird versucht soziale Phänomene in ihrem Kontext, ihrer Komplexität und Einmaligkeit zu beschreiben. Erkenntnisziel ist hier Fremdverstehen von Sinn im Einzelfall. Diese Sinnkomponente allerdings wird von der auf Neutralität ausgerichteten quantitativen Sozialforschung nicht akzeptiert (Lamnek, 1995a, S. 222). Die Forschungsergebnisse eignen sich zur Typisierung, nicht aber zur Generalisierung.
4.5 Zwischenfazit: Paradigmen der Sozialforschung
Die vier dargestellten wissenschaftstheoretischen Kategorien definieren in folgenden Kombinationen zwei unterschiedliche Paradigmen der Sozialforschung:
Ein objektivistisches quantitatives Paradigma wird ontologisch definiert durch den Realismus, ist erkenntnistheoretisch dem Positivismus verpflichtet, geht im wesentlichen von einem deterministischen Weltbild aus und folgt methodologisch einer nomothetischen Methodik.
Dem gegenüber steht ein subjektivistisches qualitatives Forschungsparadigma auf der Basis des Nominalismus, welches epistomologisch eine "interpretativ- hermeneutisch-phänomenologische Variante der Sozialwissenschaften" (Lamnek, 1995a, S. 255) darstellt und auf der Basis des Voluntarismus ideographisch vorgeht. Nicht zuletzt der Positivismusstreit in den 60er Jahren (Bortz, 1995, S. 280) brachte die Unvereinbarkeit beider Paradigmen einmal mehr auf den Punkt (Adorno, 1969). Die Vertreter der kritischen Theorie (Horkheimer, Adorno, Marcuse, und in der zweiten Generation Habermas) warfen den Positivisten vor, die Komplexität sozialer Realität zu verkennen, einem mechanistisch-deterministischen Weltbild anzuhängen, zudem Sinndeutung durch postulierte Neutralität zu vernachlässigen und somit gesellschaftliche Missstände zu ignorieren und zu zementieren. Sieht man von ideologisch geprägten Einseitigkeiten der Kritik der Frankfurter Schule ab, so ist doch einsichtig, dass komplexe soziale Phänomene kaum mittels quantitativer Methodik erforschbar sind (vgl. Rook et al., 2001). Mayring spricht von der "qualitativen Wende" (Lamnek, 1995a, S. 1).
In den 70er Jahren lässt sich eine "Renaissance der lange Zeit als ’unwissenschaftlich', 'feuilletonistisch' und 'unseriös' abgewerteteten qualitativen Forschungstraditionen in den Sozialwissenschaften beobachten" (v. Kardorff, 1995, S.3;
Hervorhebung v. Verf.). Das interpretativ-qualitative Paradigma geht auf die Komplexität ein und stellt die Sinndeutung in den Fokus.
Die Phänomenologie versucht Fremdverstehen mittels Reduktion, indem sie, ausgehend von der theoretischen Welt, über die Lebenswelt zum eigentlichen Wesen eines Phänomens vorzudringen trachtet.
Der symbolische Interaktionismus führt Sinnentstehung auf Interaktion zurück. Die soziale Welt und selbst die eigene Identität werden durch Interaktionen konstruiert (sozialer Konstruktivismus). Der Forscher beteiligt sich an symbolischen Interaktionen und wird somit selbst Teil des Konstruktionsprozesses. Hermeneutische Verfahren versuchen unter Beachtung des gesellschaftlich determinierten Vorverständnisses des Forschers die Differenz zwischen Forscher und Objekt schrittweise zu verringern. Von Kardorff merkt an: "Forschungsstrategisch lassen sich qualitative und quantitative Forschung auf einem Kontinuum abtragen" (v. Kardorff, 1995, S.4). Im weiteren fordert er, ohne die tatsächlichen Gegensätze der Paradigmen zu verwischen, eine jeweilige Ergänzung qualitativer und quantitativer Methoden, also von Erklären und Verstehen. Auch Lamnek postuliert ein multimethodisches Vorgehen mit der Hoffnung auf ein "breiteres und profunderes Erkenntnispotential" (1995a, S. 257). Von Kardorff regt an, quantitative Methoden in der Pilotphase eines Forschungsprojekts einzusetzen, um "Einstiege für die qualitative Hauptphase zu erkunden" (1995, S.8).
5 Zwei Paradigmen und ihre Integration
5.1 Objektivistischer Variablenansatz
Bei den objektivistischen Ansätzen wird Unternehmenskultur ontologisch als eine Variable unter anderen aufgefasst. Unternehmenskultur ist dem Individuum vorgelagert und stellt ein funktionales Subsystem des Unternehmens dar. Es handelt sich um einen integrierten Bestandteil im Kontingenzmodell. Ein Unternehmen hat Kultur.
Diese ontologische Sichtweise des Realismus bedingt erkenntnistheoretisch eine positivistische Perspektive, die dazu führt, dass Kultur von außen analysier- und steuerbar ist, da aufgrund des resultierenden deterministischen Menschenbildes das Verhalten des Einzelnen weitgehend von der Situation bestimmt wird.
Die methodologische Orientierung ist nomothetisch und quantitativ, dementsprechend intersubjektiv überprüfbar und entspricht mithin den klassischen Methoden der empirischen Sozialforschung.
Unabhängig von den Wahrnehmungen der Mitarbeiter erfasst der außenstehende Kulturanalytiker Manifestationen von Kultur. Man stellt durchaus fest, dass die manifesten Erscheinungsformen auf Werte und Normen zurückgehen, geht aber davon aus, dass sich diese an den Manifestationen ablesen lassen. Diagnostiziert werden leicht beobachtbare Merkmale wie Riten, Symbole, sichtbare Verhaltensweisen und geäußerte Werte. Entspricht diese Diagnose nicht einer angestrebten Soll-Kultur, d.h. erfüllt sie nicht ihre Funktion in Hinsicht auf
Unternehmensziele, wird die Kultur zielgerichtet geändert. Diese funktionalistisch- systemorientierte Sichtweise weist der Kultur wichtige Funktionen zu: Koordination, Integration und Motivation (Dill/Hügler, 1997, S.147).
Unter Koordination wird die Abstimmung verschiedener Subsysteme eines Ganzen im Hinblick auf ein übergeordnetes Ziel verstanden.
Durch Koordination wird einer Systemdifferenzierung und der damit verbundenen Gefahr zentrifugaler Tendenzen durch Ziel- und Interessenskonflikte entgegengewirkt (Sackmann , 1990, S.157).
Durch Integration werden Mitarbeiter untereinander und mit dem System verbunden. Durch Kultur als "sozialer Klebstoff" (Sackmann, 1990, S.157) soll ein "Wir- Gefühl" erzeugt werden. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl fördert die Motivation der Mitarbeiter dahingehend, dass ein Konsens über Normen und Werte einen Sinnzusammenhang erzeugt und mithin eine intrinsische Motivationslage entsteht, Dinge um ihrer selbst willen zu tun. Propagiert wird eine starke, einheitliche (homogene) Kultur. Führungskräften fällt bei dieser instrumentalistischen Betrachtungsweise eine besondere Rolle der Kulturschaffung, -gestaltung und - steuerung zu .
5.1.1 Kritik
Objektivistische Ansätze sind zu positivistisch und deterministisch ausgerichtet um das facettenreiche Phänomen Unternehmenskultur erfassen zu können. Dem naturwissenschaftlichen Paradigma verpflichtet, werden Oberflächenphänomene und Manifestationen quantitativ untersucht, ohne den tieferen Schichten von Kultur Beachtung zu schenken. Unternehmenskultur wird dementsprechend funktional als beliebig gestaltbare Variable aufgefasst.
Der "Macher-Typus" der Eigenschaftstheorie - der stark an ein Wiedererwachen der "great-man-theory" erinnert - implementiert top- down gesteuert Werte und Normen. Durch instrumentell- rationalistischen Umgang mit Symbolen, Riten, Mythen, etc. muss im Grunde von Manipulation gesprochen werden (Ulrich, 1990, S.277-299). Das rationalistisch-technokratische Paradigma sollte eigentlich überwunden werden (vgl. Peters & Waterman), durch die Ausdehnung auf kulturelle Ebenen wird es aber deutlich gesteigert.
Objektivistische Ansätze neigen dazu, starke einheitliche Kulturen zu propagieren, wobei allerdings übersehen wird, dass Innovationen und nötige Weiterentwicklungen eher durch Subkulturen vorangetrieben werden.
5.2 Subjektivistischer Metaphernansatz
Subjektivistisch interpretative Ansätze gehen in ontologischer Hinsicht davon aus, dass die Wirklichkeit in den Köpfen der Mitglieder entsteht und somit sozial konstruiert wird (sozialer Konstruktivismus, vgl. Osterloh, 1991, S. 175). Dieser Ansatz geht nicht von einer real existierenden Unternehmenskultur als abgrenzbarer, von außen beobachtbarer Variable aus, sondern betrachtet Kultur im nominalistischen Sinne als Ausdruck menschlichen Bewusstseins.
Die epistemologische Konsequenz besteht darin, dass ein positivistisch orientierter Forscher in seiner Außenbetrachtung keinen Zugang zu dieser Form von Realität hat; er muss zur Erkenntnisgewinnung sozusagen "antipositivistisch" als Teilnehmer in die soziale Welt verstehend eintauchen (Ochsenbauer & Klofat, 1997, S.75). Kultur als Ausgangspunkt von Prozessen und Strukturen ist somit nicht eine Variable unter anderen und wird zur "Basis-Metapher" (root metaphor) als Denkfigur und Modellvorstellung (Heinen, 1997, S. 17). Diese Kulturmetapher als Ablösung der systemtheoretischen Maschinenmetapher (vgl. Wollnik, 1991) dient als erkenntnisleitendes Medium, in dem prozessartig "organisatorische Wirklichkeit" (Marre, 1996, S.14) geschaffen wird. In diesem Sinne ist eine Unternehmung eine Kultur, an deren Entwicklung jedes Organisationsmitglied teilhat und somit zum Kulturgestalter wird.
Diese Betrachtung lässt kein deterministisches Menschenbild zu. Ist Mitgestaltung konstatiert, muss dem zugrundeliegenden Menschenbild eine gewisse Willensfreiheit und Handlungsautonomie implizit sein (Ochsenbauer & Klofat, 1997, S.76).
In methodologischer Hinsicht führt die aufgezeigte Ontologie zu einer ideographischen Position (Einzelfallstudien) auf der Basis qualitativer und interpretativer Methoden. Um das unternehmerische Sinnsystem als "ideelle Essenz" (Heinen, 1997, S.19) interpretativ zu entziffern, muss der Kulturforscher in Dialog mit den Organisationsmitgliedern treten. Hierzu dienen die Methoden der Phänomenologie, der Hermeneutik und des Symbolischen
Interaktionismus. Ziel des subjektivistischen Ansatzes ist nicht die Instrumentalisierung der Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor, sondern eine verstehende Beschreibung der Einzigartigkeit der jeweiligen Kultur.
5.2.1 Kritik
Hier liegt auch die Hauptkritik am subjektivistischen Ansatz begründet. Die Ergebnisse sind nicht generalisierbar - was durchaus nicht angestrebt war - und lassen zudem keine Ableitung von Gestaltungsmaßnahmen zu. Bei fehlender Verallgemeinerung der Ergebnisse fehlen logischerweise Referenzsysteme, so dass die Rolle des Forschers so herausragend wird, das die Gefahr besteht, dass seine eigene Subjektivität die Ergebnisse massiv beeinflusst. Schreyögg (1991) warnt davor, Unternehmenskulturen zu "Schutzzonen" (S.203) oder geschlossenen Systemen und den Inhalt kultureller Orientierung für "sakrosankt" (S.203) zu erklären. Die Kritik zielt zentral auf die "affirmative" (S.203) Handlungsorientierung, die die Kulturalisten -so nennt er die Vertreter dieses Ansatzes- jeder Kultur gegenüber einnehmen. Allein durch die teilnehmende Aktion des Forschers wird in den schutzbedürftigen authentischen Lebensraum eingegriffen; mit anderen Worten, bringt man ein Stück Welt vor dem Begriff auf den Begriff, hat man es bereits verändert, denn so Schreyögg: "Reflektierte Selbstverständlichkeit ist natürlich keine mehr" (S.203). Die Problematik besteht also in dem Postulat der Unversehrtheit einer Kultur als moralischem Prinzip, das auch die Veränderung von negativen oder dysfunktionalen Kulturen ausschließt.
5.3 Integrative Perspektive
Auf ontologischer Ebene versucht der integrative Ansatz sowohl die objektive als auch die sozial konstruierte Realität zugrunde zu legen. Sackmann (1990) präzisiert: "Unternehmen sind also Kulturen und haben zugleich kulturelle Aspekte"(S.160). Die Wirklichkeit eines Unternehmens besteht also aus materiell-objektiven und ideellen Aspekten, die in komplexer Wechselwirkung stehen.
Erkenntnistheoretisch bedeutet diese Integration, dass wissenschaftliche Erkenntnis sowohl aus objektiver Aussenbetrachtung als auch aus involvierter, Erfahrung voraussetzender, Perspektive möglich ist.
Der integrative Ansatz sieht den Menschen als weitgehend willensfrei und autonom. Dementsprechend wird methodologisch das ideographische Verfahren präferiert, aber quantitative Methoden werden nicht aus erkenntnistheoretischen Gründen zurückgewiesen. Um Unternehmenskultur verstehen zu können, werden qualitative Methoden favorisiert, gleichzeitig benötigt man quantitative Methoden zur Erfassung der materiellen Ebene. Es empfiehlt sich somit ein multimethodisches Verfahren (Gontard, 2002, S.23).
5.3.1 Kritik
In seiner Gesamtheit neigt sich der integrative Ansatz eher dem subjektivistischen Paradigma zu, will aber dennoch nicht die Vorstellung von Gestaltbarkeit aufgeben. Die Einflussnahme auf die Unternehmenskultur gestaltet sich aber deutlich kulturbewusster als bei funktionalistischen Ansätzen. Praktisches Einwirken bezieht sich hierbei auf gezielte Interpretationsmuster und offenen Austausch von verschiedenen Perspektiven von Wirklichkeit. Hierbei erwächst den Führungskräften eine besondere Rolle, aber nicht indem sie manipulativ materielle Aspekte der Unternehmenskultur verändern oder wie die "Helden" bei Deal & Kennedy eigensinnige Maßstäbe setzen, vielmehr eruieren sie, welche Unternehmenswirklichkeiten und Sinngebungen vorherrschen, um zu versuchen, diese durch gezielte Interpretationshilfen und symbolische Führung zu steuern.
5.4 Zwischenfazit: Fortschritt durch Integration
Betrachtet man die verschiedenen Forschungsansätze, so eignet sich die integrative Perspektive am ehesten, sich dem komplexen Phänomen Unternehmenskultur verstehend zu nähern und seine materiellen Manifestationen gleichermaßen empirisch zu erfassen. Die dargestellte "Beraterliteratur" eignet sich dazu offensichtlich nicht. Bevor nun die Modelle von Schein, Sackmann und Hatch dargestellt werden, soll eine Definition von Unternehmenskultur erörtert werden. Die Unterschiedlichkeit der idealtypisch dargestellten, paradigmatisch gegensätzlichen Ansätze lässt bereits vermuten, dass von einer einheitlichen Definition von Unternehmenskultur keine Rede seien kann. Somit kann es also nur Ziel eines Definitionsversuches sein, Gemeinsamkeiten herauszudestillieren.
6 Definitionsversuch von Unternehmenskultur
Analysiert man verschiedene Zitatensammlungen der wissenschaftlichen Forschungsliteratur (Neuberger/Kompa, 1987, S.17ff.; Neubauer, 2003, S.22; Marre, 1996, S.9; Gontard, 2002, S.7 ff.), so offenbart sich ein unübersichtliches und uneinheitliches Spektrum. Dennoch kristallisieren sich Begriffe wie Grundannahmen, Haltungen, Werte und Normen heraus. Berkel (1997) definiert Werte als "...Beurteilungsmaßstäbe, um bei mehreren Handlungsalternativen Entscheidungen treffen zu können" (S.13) und weiter "Werte sind demnach Steigerungsperspektiven oder Vorzugregeln, sie steuern und erklären menschliches Entscheiden und Handeln" (S.45; Hervorhebung v. Verf.).
Unter Normen versteht man Verhaltensregeln zur Umsetzung der Wertvorstellungen (Anweisungen, Gebote, Verbote). Die sachliche und zwischenmenschliche Ebene wird durch Normen verbindlich geregelt. Während Werte eher individuell-internalen Charakter aufweisen und keinen speziellen situativen Bezug haben, sind Normen external auf spezifische Situationen bezogen. Grundannahmen sind Werten und Normen logisch vorgeordnet. Diese grundlegenden Annahmen sind implizite Prämissen über das Wesen des Menschen, seiner Handlungen und Beziehungen. Sackmann (1983) hat ein Ordnungsschema vorgelegt (S.397), welches die zahlreichen Konzepte um einen „Kulturkern" gruppiert.
Neubauer (2003) hat auf der definitorischen Grundlage von Edgar Schein folgende Definition vorgelegt:
Organisationskultur ist die Gesamtheit gemeinsam geteilter Grundannahmen, Werthaltungen, Normen und Orientierungsmuster, die von den Menschen in einer Organisation zur Bewältigung der Probleme der äußeren Anpassung und der inneren Integration entwickelt wurden und die sich nach gemeinsamer Überzeugung so bewährt haben, dass sie an neue Mitglieder weiterzugeben sind, damit diese in der richtigen Weise wahrnehmen, denken, fühlen und handeln. (S.22)
Neubauer (2003) merkt selbstkritisch an, dass diese Definition einseitig der funktionalistischen Perspektive und somit dem Mainstream verpflichtet ist (S.21). Reduktionistisch werden Interpretationsmuster von Organisationsmitgliedern ausgeblendet, die nicht in der "richtigen Weise wahrnehmen, denken, fühlen und handeln". Die Betonung "gemeinsamer Überzeugung" lässt subkultureller Differenzierung kaum Spielraum.
[...]
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Heinz Giesen (Autor:in), 2006, Unternehmenskultur. Schillerndes Phänomen oder harte Variable?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177305
Kostenlos Autor werden

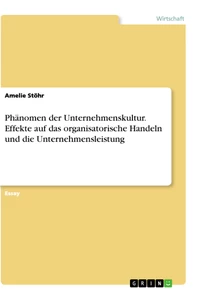







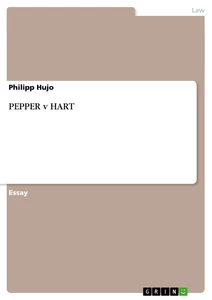






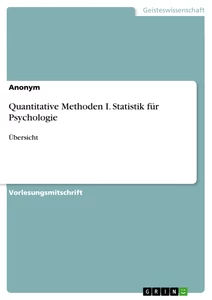



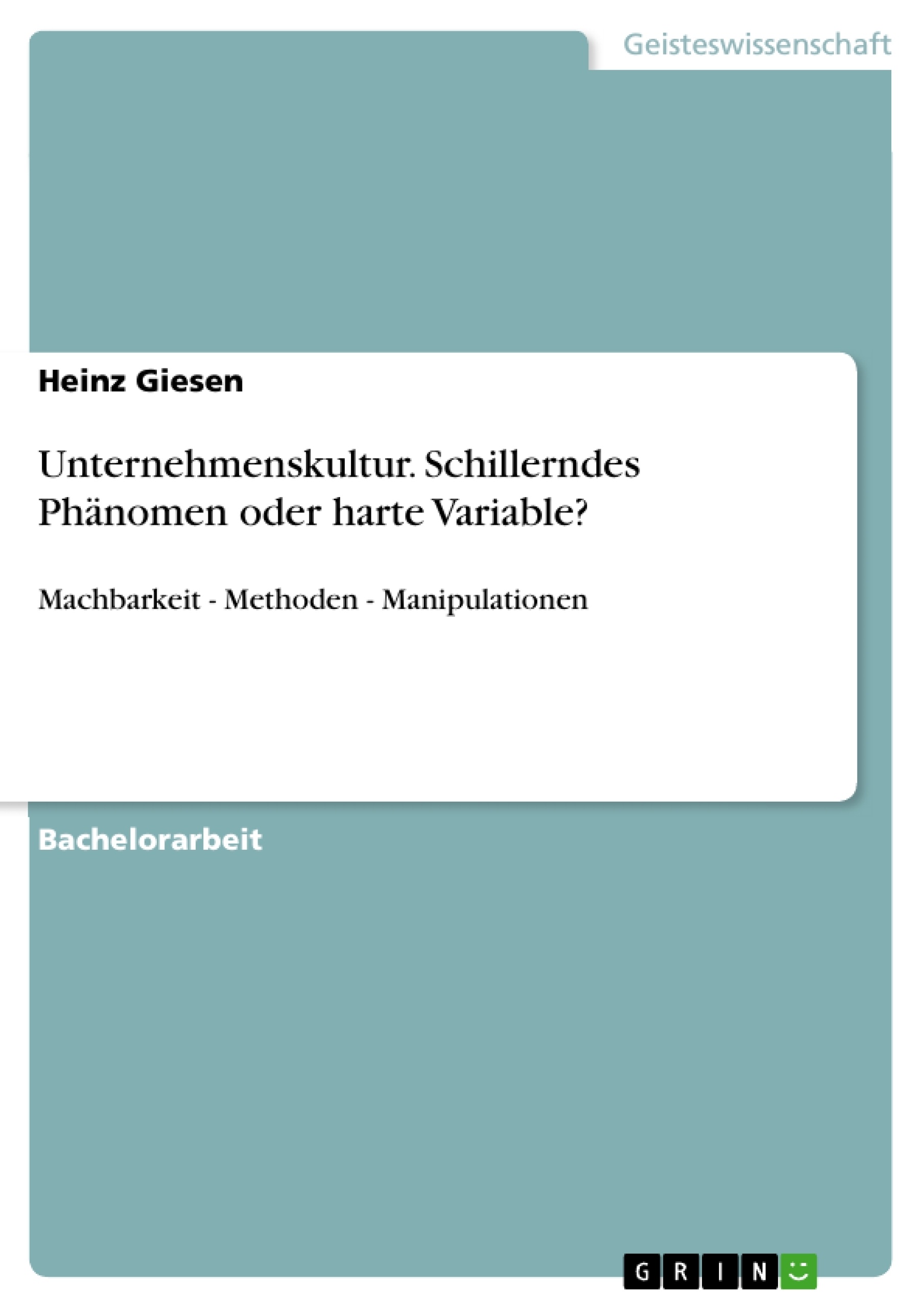

Kommentare