Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zur allgemeinen Bedeutung von Geruchswissen
1.2 Das Problem der Klassifikation von Gerüchen
1.3 Kognitionspsychologisches Interesse an der Struktur von Geruchswissen
1.4 Relevanz des Themas für die Medizin
1.5 Ziel der Arbeit
2. Bild und Benennung: Bildhaftes Assoziieren zu Gerüchen - ein explorativer Ansatz
2.1 Fragestellung
2.2 Methode
2.3. Ergebnisse
2.3.1 Assoziations- oder Antwortverhalten insgesamt
2.3.1.1 Überblick
2.3.1.2 Reihenfolge der Assoziationen
2.3.2 Bildhafte Assoziationen
2.3.2.1 Häufigkeit
2.3.2.2 Art der bildhaften Assoziationen
2.3.2.3 Alter und Lebhaftigkeit der bildhaften Assoziationen
2.3.2.4 Interindividuelle Übereinstimmung der Assoziationen zu den selben Gerüchen
2.3.2.5 Interindividuelle Übereinstimmung der Assoziationen zu ähnlichen Gerüchen
2.3.3 Benennungen
2.3.4 Individuelle und Geschlechtsunterschiede
2.4 Diskussion
3. Differenziertheit von Geruchsrepräsentationen - eine Untersuchung verbaler und non-verbaler Leistungen im Umgang mit semantisch verwandten Gerüchen
3.1 Methode
3.2 Ergebnisse
3.2.1 Vertrautheit und Hedonik
3.2.2 Die Leistung innerhalb der Aufgaben
3.2.2.1 Ungestützte Identifikation:
3.2.2.2 Zuordnung zum kategoriellen Oberbegriff
3.2.2.3 Zuordnung zum Objektbegriff
3.2.2.4 Diskrimination
3.2.3 Vergleich zwischen den Aufgaben
3.2.3.1 Zusammenhang mit Vertrautheit
3.2.3.2 Geschlechtsunterschiede
3.2.3.3 Schwierigkeit der Aufgaben
3.2.4 Fallanalyse über alle Aufgaben
3.3 Diskussion
4. Neuronale Lokalisation von Geruchsrepräsentationen
4.1 Hinweise auf funktionelle Hemisphärenasymmetrien bei der Verarbeitung von Geruchsreizen: Befunde aus Neuropsychologie und Gedächtnisforschung
4.2 Funktion des Geruchsgedächtnisses unter unilateraler Hemisphärenanästhesie
4.3 Methoden
4.4 Ergebnisse
4.4.1 Kontrollpersonen
4.4.2 Patienten
4.4.2.1 Linke Hemisphäre vs. rechte Hemisphäre
4.4.2.2 Leistung in Abhängigkeit von der Seite der Läsion
4.4.2.3 Lateralität von Sprachfunktionen
4.4.2.4 Sprachfunktionen und Leistung im Geruchsgedächtnistest:
4.4.2.5 Natürliche vs. künstliche Reize
4.4.2.6 Einfluß der Narkose und der Reihenfolge der Injektion
4.5 Diskussion
5. Gesamtdiskussion
6. Zusammenfassung
LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Wie reich ist die Verschiedenheit der Gerüche in der Natur und mit welcher Bestimmtheit sind wir im Stande, die zahlreichen Düfte und Gestänke voneinander zu unterscheiden!...Das Wasser aus der Leitung, die Kiesel in der Straße, die Luft unserer Gemächer, ob bewohnt oder unbewohnt, alles hat seinen spezifischen Geruch. Holzarten, Metalle, Kalk, Steine, das Linnen, das Papier, unsere Nahrungsstoffe und Getränke, beinahe nichts gibt es, was nicht riecht. So leben wir ebenso gut in einer Welt von Gerüchen wie in einer Welt von Licht und Schall.
(Zwaardemaker, 1895, S. 11-12)
1.1 Zur allgemeinen Bedeutung von Geruchswissen
Mit diesem Zitat gibt sich der holländische Geruchsforscher Zwaardemaker als Mensch zu erkennen, der Gerüchen mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt, als die meisten anderen Menschen unseres Kulturkreises. Auch wenn wir nicht wissen, ob diese Aufmerksamkeit erst aus seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Geruchssinn entstanden ist, oder ob umgekehrt ein besonders wacher Sinn für Düfte erst sein Interesse an der Olfaktorik geweckt hat, erscheint dies bemerkenswert. Denn obwohl die meisten Menschen auf ausgesprochene Wohlgerüche, die zum Beispiel von Nahrung oder Kosmetikprodukten ausgehen, positiv reagieren und unangenehme Gerüche entschieden zurückweisen, nehmen nur wenige Personen alltägliche Gerü-che, wie sie Zwaardemaker anspricht, bewußt wahr. Erst recht wäre kaum jemand in der Lage, diese zu beschreiben oder zu identifizieren, wenn er sich dabei allein auf die Nase verlassen müßte.
Weil im Unterschied zu vielen Tieren der Geruch neben anderen Wahrnehmungseindrücken für Menschen nur eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielt und eher geringe Bedeutung für die Orientierung in der Welt zu haben scheint, wurden Menschen immer wieder als Mikrosmatiker angesehen (vgl. Schaal & Porter, 1991). Dies stimmt jedoch nur zum Teil. Richtig ist zwar, daß Menschen wie die meisten Primaten ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf visuelle und akustische Informationen richten und ihr Verhalten selten allein nach Geruchsinformationen ausrichten. Dennoch scheinen Gerüche das Verhalten in allen Lebensbereichen, die bei ausgesprochenen "Nasentieren", überwiegend durch olfaktorische Reize bestimmt sind, auch bei Primaten und Menschen zumindest mitzubeeinflussen. Ebenso wie bei vielen Tieren lassen sich Geruchswirkungen auf das Verhalten in der Umwelt (Turk et al., 1974), bei der Nahrungssuche und -aufnahme (Mattes, 1995) sowie in sozialen Interaktionen (Schaal & Porter, 1991; Schleidt, 1980; Schleidt & Hold, 1982) auch beim Menschen nachweisen. Darüber hinaus spricht auch die wichtige kulturelle Bedeutung, die Menschen Geruchsreizen zu allen Zeiten zusprachen (Steele, 1992; Faure, 1993), für eine echte Relevanz olfaktorischer Informationen für unsere Spezies.
Trotzdem ist insgesamt nur wenig über die Struktur der menschlichen Geruchswelt bekannt. Da wir nur unzureichend in der Lage sind, über Geruchseindrücke zu sprechen, ist nicht einmal klar, ob der einzelne Mensch eher in einer sehr subjektiven Geruchswelt lebt, oder ob Menschen eines Kulturkreises Geruchserfahrungen weitgehend teilen und mit gleichen Gerüchen auch Vergleichbares verbinden. Diese sehr allgemeine Frage bildete den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit. Wie gehen verschiedene Menschen mit Alltagsgerüchen um? Können sie spezifisch auf Geruchseindrücke reagieren? Wie beschreiben sie die Gerüche, wie ist die alltägliche Geruchswelt in ihren Köpfen strukturiert?
In dieser Form wurde die Frage nach der mentalen Struktur des Geruchswissens bisher nicht gestellt. Die Bemühungen richteten sich eher auf die Beschreibung der Geruchswelt als solcher und auf Versuche, die Vielzahl der Geruchseindrücke zu ordnen und zu systematisieren. Zahlreiche Klassifikationssysteme zeugen von diesen Versuchen (historischer Überblick bei Harper et al., 1968; zu neueren Ansätzten vgl. Lawless, 1989).
1.2 Das Problem der Klassifikation von Gerüchen
Ein zentrales ursprüngliches Motiv für Klassifikationssysteme dürfte das praktische Bedürfnis von Fachleuten gewesen sein, über Gerüche zu kommunizieren. So sollen beispielsweise die ersten Versuche, die Vielzahl von Gerüchen in einer überschaubaren Anzahl von Kategorien zusammenzufassen, von Ärzten und Hygienikern des 18. Jahrhunderts stammen, die das Ziel hatten, mit diesen Kategorien "gesundheitsschädliche Miasmen" zu beschreiben (Corbin, 1992). Über die angenehmeren Seiten der Geruchswelt tauschten sich dagegen die Parfumeure aus. Stellvertretend für viele verschiedene Ansätze sei hier auf das System von Eugène Rimmel von 1868 verwiesen. Auch das erste System, das man mit Recht als systematisch bezeichnen kann, wurde vermutlich für den Austausch unter Experten entwickelt. Es stammt von dem Botaniker Linné (1756), der die Geruchsklassifikation als methodisches Instrument zur Ordnung der Pflanzenwelt benützte. Linné unterscheidet zu diesem Zweck sieben Klassen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs:
1) Odores aromatici, wie die der Nelkenblütler und Lorbeerblätter
2) Odores fragrantes, wie Lindenblüten, die Lilie, der Jasmin u.a.
3) Odores ambrosiaci, wie Ambra, Moschus
3) Odores alliacei, wie Zwiebel, Asa foetida
4) Odores hircini, wie der vom Bocke verbreitete Geruch
6) Odores tetri, wie der Geruch vieler Pflanzen aus der Familie der Nachtschatten
7) Odores nausei, wie die Blüten der Aaspflanze u.s.w.
(v. Linné nach Zwaardemaker, 1895, S. 209)
Andere versuchten Klassifikationen nach anderen Kriterien als den analogen Ähnlichkeiten zu bestimmten Geruchsträgern. Beispielsweise nahm Albrecht v. Haller (1763) eine Einteilung ausschließlich nach der hedonischen Qualität der Gerüche vor, Alexander Bain (1868) nach Begleiterscheinungen wie frisch, erstickend, ätherisch, appetitanregend, während Fröhlich (1851) reine Gerüche von solchen unterschied, die auch schleimhautreizend wirken (alle zitiert in Henning, 1916, S. 71ff).
Geruchsklassifikation als Suche nach den olfaktorischen Grundqualitäten
Ein wissenschaftliches Interesse an Geruchsklassen ergab sich aus der Hoffnung, mit Hilfe der Klassifikation von Düften etwas über die zugrundliegenden physiologischen, physikalischen und chemischen Mechanismen der Wahrnehmung in Erfahrung zu bringen. Diesem Gedanken lag die Vorstellung zu Grunde, daß zwischen Reizeigenschaften und Wahrnehmungseindrücken ein eindeutiger Zusammenhang bestehen muß. In Anlehnung an Erkenntnisse über das visuelle System, erhoffte man sich Hinweise auf "Primärgerüche", als eine Art olfaktorischer Grundbausteine, aus denen Gerüche zusammengesetzt sind wie Mischfarbtöne aus den Grundfarben, und auf die ihnen entsprechenden Rezeptoren. Wenn es gelänge, "auf physikalische Weise die einfachen Gerüche zu isolieren ... wird es möglich werden, Umschreibungen für die Gerüche mit derselben Präcision zu machen, wie wir es jetzt schon mit den Farben thun" , schreibt Zwaardemaker 1895 (S. 208f) in seiner "Physiologie des Geruchs".
Obwohl Zwaardemaker überzeugt war, daß eine Klassifikation von Gerüchen bei dieser Frage nur begrenzt weiterhelfen kann, erschien sie ihm dennoch sinnvoll, soweit sie sich "mehr oder weniger einem natürlichen System nähert ... den Forderungen der neueren Chemie" (1895, S. 215) entspricht und "soviel als möglich von subjectiven Wahrnehmungen" absieht (ibid. S. 238). Von ihm stammt deshalb eine Klassifikation von Gerüchen, mit der er versucht hat, verschiedenen Aspekten gerecht zu werden:
a) nach Beteiligung unterschiedlicher physiologischer Systeme
"1. olfactive Riechstoffe, welche ausschließlich auf den Geruchssinn einen Reiz ausüben,
2. scharfe Riechstoffe, die auch den N. Trigeminus = Gefühlsempfindungen erregen,
3. schmeckbare Riechstoffe" (S. 215, 216).
b) nach der Qualität
"Gerüche, die den Eindruck einer wechselseitigen Verwandtschaft machen, in Gruppen zu vereinigen und diese Gruppen dann nach der Eigenschaft zu benennen, welche in der Mehrzahl dieser untereinander verwandten Gerüche vorherrscht"
c) Berücksichtigung der "Forderungen der neuen Chemie" (S. 215), denn sowohl
Geruch wie Geschmack eines Stoffes "wurzeln in seiner chemischen Structur" (S. 238).
Er kommt auf diese Weise zu einer Einteilung, die auf den ersten Blick weitgehend der Linnés ähnelt, aber mit insgesamt 30 Subklassen viel komplexer ausfällt.
Klassifikationsschema nach Zwaardemaker
I. Odores aetherei (ätherische Gerüche)
a) Fruchtäther (Alkylester)
b) riechender Bestandteil des Bienenwachses - ein Ester
c) Äther, Aldehyde, Ketone (niedere Stufen der homologen Reihen)
II. Odores aromatici (aromatische Gerüche)
a) Kampfergerüche
b) Gewürzartige Gerüche
c) Anis-Lavendelgerüche
d) Citronen-Rosengerüche
e) Mandelgerüche
III. Odores fragrantes (balsamische Gerüche)
a) Blumengerüche
b) Lilienartige Gerüche
c) Vanillegerüche
IV. Odores ambrosiaci (Amber-Moschus-Gerüche)
a) Ambergerüche
b) Moschusgerüche
V. Odores alliacei (Allyl-Cacodyl-Gerüche)
a) Lauchartige Gerüche im engeren Sinne
b) Cacodyl-Fischgerüche
c) Bromgerüche
VI. Odores empyreumatici (brenzliche Gerüche)
a) Gebrannter Kaffee u.a. Beipiele
b) Amyalkohol und Homologe
VII. Odores hircini (Capryl-Gerüche)
a) Capronsäure und Homologe
b) Katzenharn u.a. Beipiele
VIII. Odores tetri (widerliche Gerüche)
a) Odor narcoticus
b) Odor cimis
IX. Odores nausei (Erbrechen erregende oder ekelhafte Gerüche)
a) Aas- und Leichengeruch
b) Dracontium, Fäces, Scatol (1895, S. 233ff)
Ethologisch interessant erscheint der Hinweis Zwaardemakers, daß sich die ersten vier seiner Geruchsklassen zu einer großen "Abteilung der Nahrungsgerüche" und die übrigen fünf zu einer Abteilung der "Zersetzungsgerüche" (S. 235) zusammenfassen lassen.
Der deutsche Psychologe Hans Henning (1916) kritisierte an Zwaardemakers komplexem Schema unter anderem, daß die Klassen "nicht charakteristisch gefaßt" und zu wenig an den Empfindungen orientiert seien (S. 77). Er selbst kam über empirische Beobachtungen zu dem Schluß, daß "es sechs Grundempfindungen des Geruches gäbe, von denen jede einzelne in jede andere kontinuierlich übergeht" (S. 80). Diese Grundempfindungen lassen sich seiner Meinung nach graphisch als Eckpunkte eines regelmäßigen Prismas darstellen, in dem alle einfachen Gerüche, die durch eine einzige Molekülgattung zustandekommen, auf den Kanten und Flächen liegen, während Mischgerüche, "Riechstoffe mit mehreren riechenden Molekülarten" (S. 110), den Innenraum füllen. Hennig meinte außerdem, das chemische Korrelat der Geruchswahrnehmung gefunden zu haben. "Ganz gleichgültig nun, wie die riechenden Substanzen chemisch sonst beschaffen sind (aus welchen Atomen sie bestehen, zu welcher Familie sie gehören usw.) haben alle Chemikalien derselben psychologischen Geruchsklasse eine gleiche Eigenart der innermolekularen Bindung" (S. 81).
Eine noch radikalere Reduktion der olfaktorischen Grundqualitäten auf nur vier Klassen schlugen Crocker & Henderson (1927) vor. Diese wurde zwar als zu restriktiv kritisiert, ist aber wegen des numerischen Systems interessant, das die Autoren einführten, um Gerüche auf der Basis der vier von ihnen postulierten Klassen zu beschreiben. Für jede der Grundqualitäten ("fragrant, acid, burnt, caprylic"; vgl. Harper et al., 1968) wurde nämlich ein Ratingwert von minimal 0 bis maximal 8 erhoben, der ausdrücken sollte, wie sehr die Grundqualität zum Gesamtgeruchseindruck beiträgt. Mit diesem System sollten geübte Personen in der Lage sein, jeden beliebigen Geruch in eine vierstellige Zahl umzusetzten und dadurch zu kategorisieren.
Obwohl sich keine der zuvor genannten Theorien durchsetzen konnte, gehen manche Olfaktoriker bis heute noch von einer überschaubaren Anzahl von Primärgerüchen aus: "There is a fairly general agreement nowadays that the sense of smell operates on the basis of a limited number of discrete 'primary odor' sensations, which can be combined to give a tremendous range of distinguishable odors. Smell would thus be analogous to taste, with its four classical primaries of sweet, salt, sour, and bitter, or to color, with its three primaries of red, yellow and blue", schreibt beispielsweise Amoore (1991, S. 657). Er leitete seine erste Geruchsklassifikation von 1952 aus einem Literaturüberblick über Geruchsbezeichnungen ab, die Chemiker bei der Beschreibung neuentdeckter oder synthetisierter Substanzen verwendeten. Sieben Begriffe schienen ihm dabei besonders häufig vorzukommen; sie betrachtete Amoore als Bezeichnungen für Primärgerüche, nämlich kampherartig, moschusartig, blumig, pfefferminzig, etherisch, stechend und stinkend. In seiner stereochemischen Theorie postulierte er darüber hinaus, daß diesen Primärgerüchen bestimmte Rezeptortypen entsprechen, an die jeweils nur Geruchsmoleküle einer bestimmten Größe und räumlichen Struktur oder eines bestimmten elektronischen Statuses ankoppeln (vgl. Amoore et al., 1964). Amoore untersuchte mehr als 600 Substanzen und fand, daß tatsächlich viele Gerüche, die sich einer der Kategorien zuordnen lassen, eine untereinander ähnliche molekulare Struktur aufweisen. Allerdings mußte er auch zahlreiche Ausnahmen zur Kenntnis nehmen - Fälle, in denen Moleküle trotz ähnlicher Struktur keine ähnlichen Gerüche erzeugen.
Neben diesen chemischen Ansätzen begann Amoore in den späten 60er Jahren spezifische Anosmien zu untersuchen. In Anlehnung an die Theorie von Guillot (1948) sah er in der sorgfältigen Untersuchung des Phänomens solcher substanzspezifischer Wahrnehmungsstörungen "the best evidence of primary odors" (1991, S. 657). In Analogie zur Farbenblindheit nahm er an, daß spezifische Anosmien auf Störungen der Sinneszellen oder der nervösen Verbindungen zurückzuführen seien, die normalerweise für die Wahrnehmung eines bestimmten Primärgeruches zuständig sind (vgl. Amoore, 1982). Nicht zuletzt die Entdeckung zahlreicher unterschiedlicher spezifischer Anosmien zwangen ihn dann allerdings, sein Konzept der sieben Primärgerüche zugunsten eines komplexeren Systems aufzugeben und festzustellen: "The sense of smell is thus very complex, with a far greater number of primary sensations than are found with color and taste." (1991, S. 661) Mittlerweile rechnet er mit mehr als 30 distinkten Klassen und nähert sich damit nicht nur wieder Zwaardemaker an, sondern findet sich auch in Übereinstimmung mit den neueren Ergebnissen der Geruchsforschung, die mit ganz anderen Methoden, wie z.B. der multidimensionale Skalierung, gewonnen wurden.
Multidimensionale Skalierung
Bei der multidimensionalen Skalierung (MDS) handelt es sich um ein mathematisches Verfahren, "which can systemize data in areas where organizing concepts and underlying dimensions are not well developed" (Schiffman, 1981, S. 1). Da sich genau so das zentrale Problem der Klassifikation von Gerüchen beschreiben läßt, und die MDS mit einigem Erfolg bereits bei anderen psychophysischen Fragestellungen, z.B. der Farbwahrnehmung, Anwendung fand, begannen sich auch die Geruchsforscher für das Verfahren zu interessieren. "...it was hoped that MDS and its historical antecedent, factor analysis, would produce a set of basic dimensions for odor quality space which would determine the fundamental attributes of odor quality. That is `primary odors´ ...might be discovered through an analysis of similarity judgements" beschreibt Lawless (1986, S. 100) die Erwartungen an die multivariate Statistik.
MDS läßt sich sowohl auf verbales wie auf numerisches Datenmaterial anwenden. Dravnieks (1982) unterscheidet entsprechend zwei Arten der Datenerhebung für die multidimensionalen Skalierungsverfahren - semantische und referentielle Methoden. Bei semantischen Verfahren werden Gerüche mit verbalen Deskriptoren beschrieben oder die Ausprägung einer bestimmten verbal gegebenen Qualität mit Hilfe von Ratingskalen erhoben. Bei Referenzmethoden wird die Ähnlichkeit eines Reizes zu einem Referenzreiz durch nonverbale Skalierung ermittelt.
Ziel der MDS ist in beiden Fällen, Ähnlichkeiten zwischen Reizen oder Objekten eines Sets in einem räumlichen Modell anschaulich darzustellen. Ähnliche Reize liegen in der graphischen Darstellung des Wahrnehmungsraumes nahe beieinander und unähnliche weit voneinander entfernt. Lawless schreibt dazu: "the proximities of the stimuli in the space may suggest certain natural groupings or categories that further help us to understand their perceptual structure" (1986, S. 88). Eine wichtige Studie dazu stammt von Chastrette et al. (1988): Sie untersuchten mit Hilfe einer Clusteranalyse die Ähnlichkeit von 74 verbalen Deskriptoren, die Parfumeure zur Beschreibung von 2467 Geruchssubstanzen verwendeten, und fanden nur wenig Überlappung zwischen diesen Bezeichnungen für unterschiedliche Duftqualitäten. Offenbar ist die Sprache der Parfümeure wenig redundant. "The existance of 14 isolated notes and of 27 groups containing two to four notes leads us to conclude that there cannot exist a small number of primary odors" (Chastrette et al, 1988, S. 301)
Mit dieser Schlußfolgerung stützen die Autoren indirekt auch andere gebräuchliche Listen von Geruchsbeschreibungen, die beispielsweise von Praktikern der sensorischen Analyse oder der angewandten Forschung entwickelt wurden, und die ebenfalls für eine hohe Komplexität der Geruchswelt sprechen. So hat etwa das sensorische Evaluationskommitee der American Society for Testing and Materials (ASTM) eine Liste von 830 in der Literatur gebräuchlichen Geruchsbeschreibungen zusammengetragen und Dravnieks et al. (1978) diese Liste auf 146 Deskriptoren reduziert.
Ein Problem bei der multidimensionalen Skalierung semantischer Daten bleibt die allgemein recht geringe Fähigkeit von Menschen, Gerüche verbal zu beschreiben. Selbst Experten sind sich untereinander oft nicht vollständig einig, welche Qualitäten mit welchen Wörtern zu bezeichnen sind. Diese Nachteile werden mit referentiellen Methoden der Datenerhebung, bei denen Reizpaare jeweils nur sensorisch zu vergleichen sind, vermieden. Dennoch haben die meisten Studien, die auf dieser Methode basieren, nur relativ grobe Hinweise auf Dimensionen der Geruchswahrnehmung ergeben. "Previous attempts to illuminate the nature of odor space by means of multivariate statistical analyses have met only with modest success" urteilt Lawless (1989, S. 349).
Fazit:
Die Olfaktorik hat die Geruchsklassifikation lange Zeit ganz in den Dienst der Suche nach Gesetzmäßigkeiten des Zusammenhangs zwischen Molekülstruktur und Geruchsempfindung gestellt. Sie ging dabei von der impliziten Annahme aus, daß gleiche oder ähnlich Reize bei Individuen der selben Art zu gleichen oder ähnlichen Empfindungen führen, und daß Gerüche aufgrund der Ähnlichkeit der ausgelösten Empfindungen klassifiziert werden. Dieser Versuch muß jedoch als gescheitert betrachtet werden. Es ließen sich bisher keine objektiven Klassifikationskriterien finden, die in der Frage nach den zugrundeliegenden Mechanismen der Geruchswahrnehmung weiterhelfen könnten. Es ließ sich im wesentlichen nur zeigen, daß eine Reduktion der Geruchseindrücke auf wenige Dimensionen nicht möglich ist und daß die Geruchswelt vermutlich wirklich sehr komplex strukturiert ist. Diese Ergebnisse decken sich mit den neuesten Befunden aus der Molekularbiologie, aus denen sich schließen läßt, daß tatsächlich etwa 800 bis 1000 unterschiedliche olfaktorische Rezeptortypen existieren müssen (vgl. Buck & Axel, 1991). Dazu kommen noch jeweils zahlreiche unterschiedliche Botenstoffe, deren Wirkungsweise noch nicht vollständig geklärt ist (Baker, 1995).
Bei dieser Betrachtungsweise wurde ein sehr wichtiger Aspekt vernachlässigt: Jede Klassifikation, die sich auf individuelle Empfindungen bezieht, spiegelt nämlich immer zu einem gewissen Grad auch subjektive mentale Strukturen wieder. Auf dieser Ebene stellen die sensorischen Stimuluseigenschaften nur eine mögliche Grundlage für Klassifikationen dar. Reize können ebensogut auch aufgrund anderer Attribute, beispielsweise nach ihrer Bedeutung für das Verhalten oder nach ihrer kontextuellen Zugehörigkeit mental strukturiert werden. Da dies vermutlich auch für olfaktorische Stimuli gilt, bleibt die Frage nach der Art und Weise, wie Menschen Gerüche klassifizieren und dadurch ihre Geruchswelt gliedern, für die vorliegende Arbeit auch im Folgenden noch wichtig.
1.3 Kognitionspsychologisches Interesse an der Struktur von Geruchswissen
Die Frage nach der mentalen Struktur der Geruchswelt ist, wenn man von ihrer zentralen Bedeutung für die Olfaktorik absieht, formal eigentlich eine ausgesprochen kognitionspsychologische Frage. In dieser Richtung der Psychologie wird nämlich versucht, Verhalten zu erklären, indem man untersucht, wie Wissen über die Welt erworben und intern abgebildet bzw. repräsentiert wird, und auf welche Weise diese mentalen Strukturen auf das Verhalten wirken.
Die Kognitionspsychologie betrachtet Lebewesen als informationsverarbeitende Systeme, die, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden und auf Reize adäquat reagieren zu können, Informationen aus dieser Umwelt aufnehmen und über bestimmte Zeiträume speichern müssen. Da für das Überleben des Organismus in seiner Welt aber nur bestimmte Aspekte wichtig sind, und es außerdem ein unlösbares informationstechnisches Problem darstellen würde, alle Aspekte der Umwelt intern abzubilden, selektiert jeder Organismus über seine Wahrnehmungskanäle für ihn relevante Informationen aus und speichert nur diese. Bei dem Aufbau von Repräsentationen handelt es sich daher um einen aktiven Konstruktionsprozeß, der interindividuell sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Ziel der Kognitionspsychologie ist daher etwas, das Mandl & Spada (1988) als "qualitative Prozeßdiagnostik" bezeichnen. Sie verstehen darunter, den "Wissensstand eines Individuums bezogen auf den interessierenden Gegenstandsbereich im Detail aufzudecken, gegebenenfalls auch in seinem zeitlichen Verlauf zu erfassen, um dadurch die gesamte Genese einer Wissenskomponente modellieren zu können" (Mandl & Spada, 1988, S. 4). Eine ähnliche Absicht verfolgt auch die vorliegende Arbeit im Bezug auf das Geruchswissen.
Für die kognitive Psychologie könnte dieser Versuch aus mehreren Gründen von besonderem Interesse sein, denn die olfaktorische Modalität erfüllt wesentliche Kriterien, die Mandl & Spada als wichtig für repräsentativen Erkenntnisgewinn über menschliches Gedächtnis und Informationsverarbeitung erachten:
- Es handelt sich bei Gerüchen um komplexe, bedeutungshaltige Reize, von denen stark anzunehmen ist, daß sie Zugang zu einem "vielfältig vernetzten bereichsspezifischen Wissen" (Mandl & Spada, 1988, S. 7) bieten.
- Der Umgang mit Gerüchen stellt ein "realitätsorientiertes Problem" (ibid. S. 7) dar, denn Gerüche kommen im Alltag in den verschiedensten Lebensbereichen vor und werden häufig nicht auf Anhieb richtig identifiziert.
- Geruchsreize sind besonders geeignet, um die Genese von Wissenskomponenten und Lernprozessen zu untersuchen: Geruchswissen ist zum einen vermutlich weniger fest verankert als Wissen über andere Reize. Zum andern lassen sich unter Gerüchen besonders leicht Reize finden, für die die Testpersonen über keine oder unterschiedlich starke Vorerfahrungen verfügen.
- Mit Geruchsreizen lassen sich Längsschnittstudien, die Mandl und Spada fordern "um tieferen Einblick in den konstruktiven Charakter menschlicher Informationsverarbeitung" zu bekommen (ibid., S. 8), in gleicher Weise wie mit anderen Reizen durchführen.
- Gerüche bieten sich besonders an, wenn es um die zusätzliche Erfassung von emotionalen und motivationalen Prozessen geht, denn die Verarbeitung von Gerüchen ist unmittelbar an das limbische System gekoppelt (Price, 1987; Shipley & Reyes, 1991). Es besteht ein starker wechselseitiger Einfluß zwischen Geruchswahrnehmungen, Stimmung und motivationaler Lage (Ehrlichman & Bastone, 1992).
Zusätzlich zu diesen von Mandl & Spada (1988) angesprochenen Punkten bietet die olfaktorische Modalität noch weitere neuroanatomische und neuropsychologische Besonderheiten, die sie als kognitonspsychologischen Untersuchungsgegenstand besonders interessant machen.
Neuroanatomisch ist festzustellen, daß in keinem anderen Wahrnehmungssystem periphere und zentrale Funktionen so eng miteinander verbunden sind wie beim Geruchssinn (Price, 1987; Shipley & Reyes, 1991, Hudson & Distel, im Druck). Der Riechkolben erhält zahlreiche Rückprojektionen aus verschiedenen Hirngebieten, was als anatomische Voraussetzung für die Modulation der Wahrnehmung durch Lernen und Erfahrung angesehen werden kann. Der Geruchssinn dürfte sich daher besonders zur Untersuchung der Frage eignen, wie sensorischer Input in ein mentales Format umgewandelt wird und welche Wechselwirkungen zwischen den sensorischen Bottom-up und (kognitiven) Top-down-Prozessen auftreten.
Darüber hinaus ist zu vermuten, daß Geruchsreize eher non-verbal verarbeitet werden. Diese Annahme ergibt sich zum einen aus der Beobachtung, daß selbst das Benennen von sehr vertrauten Gerüchen länger dauert und schlechter gelingt als das Benennen der zugehörigen Geruchsträger, wenn diese visuell dargeboten werden (Goodglas et al., 1968). Zum anderen können die Versuchspersonen beim verbalen Identifizieren von Gerüchen zwar Angaben über die allgemeine Kategorie machen, zu der der dargebotene Geruch gehört, können auf verwandte Gerüche verweisen oder Angaben zur Geruchsquelle machen (Henning, 1916; Engen 1987), im Unterschied zum Tip-of-the-tongue-Zustand (Brown & McNeill, 1966) aber nichts über lexikalische Eigenschaften des Geruchsnamens, wie Anfangsbuchstabe, Wortklang oder Worte mit ähnlicher Bedeutung sagen (Engen,1987). Die Verbindung zur Sprache scheint demnach eher schwach ausgeprägt zu sein. Dies könnte auch erklären, warum es Versuchspersonen in Paarassoziationsexperimenten schwerer fällt, Gerüche mit verbalen Bezeichnungen zu verknüpfen, als visuelle Reize oder Worte untereinander (Davis, 1975, 1977).
Non-verbale Informationsverarbeitungsprozesse waren bisher nur relativ selten Gegenstand kognitionspsychologischer Studien und wenn, dann fast ausschließlich im Zusammenhang mit der visuellen Modalität. Während verbale Begriffe auch als symbolische Repräsentationen bezeichnet werden, spricht man bei non-verbalen Konzepten von bildhaften oder analogen Repräsentationen (Kosslyn, 1980). Nach Steiner (1988) versteht man unter dieser Bezeichnung "Abbildungen, die die Eigenschaften (oder zumindest einige von ihnen) eines abzubildenden Objektes oder Umweltereignisses beibehalten, Abbildungen also, die in einer bestimmten Weise den äußeren Gegebenheiten ähnlich sind." (Steiner, 1988, S. 100).
Auf analoge Repräsentation eines Sachverhalts wird geschlossen, wenn ein Vorgang, der nur im Geist durchgespielt wird, ähnlichen Regeln folgt wie der entsprechende reale Prozeß. Hat man beispielsweise zu entscheiden, ob zwei unregelmäßige räumliche Figuren einander entprechen, so korreliert die Reaktionszeit mit dem Winkel, um den die Figuren vor dem geistigen Auge gedreht werden müssen, um optimal miteinander verglichen werden zu können (Metzler & Shepard, 1974). In ähnlicher Weise hängt auch die Reaktionszeit auf die Frage nach der Zahl der Fenster des Hauses, in dem man wohnt, von der tatsächlichen Zahl der Fenster ab. Da die meisten Menschen die Zahl der Fenster ihres Hauses nicht abstrakt oder symbolisch gespeichert haben, müssen sie sich erst ein Bild des Hauses in Erinnerung rufen und an diesem Bild konkret die Fenster zählen.
Obwohl analoge Repräsentationen bisher nur im visuellen Bereich genauer untersucht worden sind, nimmt man an, daß es sie auch in anderen sensorischen Bereichen gibt, z.B. bei Geräuschen und vermutlich auch bei Gerüchen. Auf die Existenz eines spezifischen, non-verbalen Systems für Geruchsvorstellungen deuten jedenfalls seit langem anekdotische Berichte hin. Beispielsweise berichtet Henning über den französischen Literaten Emile Zola, daß dieser nach Meinung von Zeitgenossen und Kennern seiner Werke angeblich dem "olfaktorischen Gedächtnistyp angehörte, denn der Dichter war eher imstande, Geruchserinnerungen zu reproduzieren, als andere. Jeder Gegenstand erschien ihm riechend, und dieser Geruch fiel ihm zuallererst ein, wenn er sich an einen Gegenstand erinnerte" (Henning, 1916, S. 183).
Experimentell wurden analoge Geruchsrepräsentationen erst in neuester Zeit mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen untersucht. Besonders naheliegend erscheint es, die Urteile zu realen Reizen mit Urteilen zu Vorstellungen dieser Reize zu vergleichen. Diesen Ansatz wählten Algom & Cain (1991) und Carrasco & Ridout (1993).
Algom & Cain (1991) verglichen die Intensitätsratings für fünf unterschiedliche Verdünnungsstufen von Isoamylacetat mit dem Gedächtnis für die entsprechenden Geruchsintensitäten. Dabei beurteilten Probanden, die nur einen vorher mit der entsprechenden Intensität assoziierten Farbcue als Erinnerungsstütze bekamen, die Stärke der erinnerten und damit nur mental gegebenen Gerüche auf einer numerischen Skala genauso wie Probanden, die die Gerüche real dargeboten bekamen. Entsprechendes ließ sich auch für Geruchsmischungen zeigen, und zwar sowohl, wenn diese in einer assoziativen Lernaufgabe vorher explizit gegeben waren, als auch, wenn die Probanden nur an den Komponenten gerochen hatten und sich das Mischungsergebnis vorstellen mußten. Die Autoren interpretieren diese Ergebnisse als Indiz für die Übereinstimmung zwischen Geruchsvorstellungen und chemophysikalischen Eigenschaften der Geruchswelt und damit als Hinweis auf die analoge Struktur olfaktorischer Repräsentationen: "Far from being detached, people´s olfactory world of make-belief obeys the rules used in constructing their physically bound perceptual world" (1991, S. 1117).
Carrasco & Ridout (1993) erhoben bei 16 verschiedenen Gerüchen Ratingurteile zu jeweils 12 verschiedenen Reizattributen und ließen ihre Versuchspersonen darüber hinaus die Ähnlichkeit von Geruchspaaren beurteilen, die entweder real dargeboten wurden oder die sich die Probanden vorstellen mußten. Dabei ergaben sich zwischen der Wahrnehmungs- und der Vorstellungsgruppe hohe Korrelationen, sowohl für die Beurteilung der meisten einzelnen Attribute als auch für die Beurteilung der Ähnlichkeiten der Reizpaare. Auch die multidimensionale Skalierung der Daten führte zu vergleichbaren Dimensionen der Wahrnehmungsräume. Dies werten die Autoren als Beleg für einen "Isomorphismus" zwischen den internen Repräsentationen und ihren externen Objekten und für die Existenz von Geruchsvorstellungen.
Gleichzeitig weisen Carrasco & Ridout jedoch auch darauf hin, daß zwischen internen Repräsentationen und real gebotenen Reizen keine vollständige Übereinstimmung besteht. Zum Beispiel stellte sich in ihrer Untersuchung heraus, daß sich die Dimension "Angenehmheit" bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Gerüchen nur bei real dargebotenen Gerüchen als wichtiges Vergleichskriterium erwies, nicht aber bei der Beurteilung vorgestellter Gerüche. Ähnliches fanden auch Breckler & Fried (1993). Sie untersuchten Präferenzurteile entweder zu tatsächlich dargebotenen Geruchsreizen oder nur zu den Geruchsnamen. Dabei zeigten sich Unterschiede in der Beurteilung der realen Gerüche und ihrer Namen. Breckler und Fried ziehen daraus den Schluß, daß sich symbolische (= Name) und perzeptuelle Repräsentationen (= Geruch) von olfaktorischen Reizen zum Teil grundlegend unterscheiden und nicht dieselbe Information enthalten. Diese Befunde bestätigen für die olfaktorische Modalität Erkenntnisse aus Untersuchungen mit visuellem Material. Sie machen deutlich, daß auch Geruchsrepräsentationen dem realen Reiz nicht im Sinne eidetischer Bilder analog sind und die komplette Information enthalten, sondern durchaus stilisiert, auf wesentliche Merkmale reduziert oder sogar verzerrt sein können. Mentale Repräsentationen müssen also nicht dem konkreten Wahrnehmungseindruck entsprechen.
Auf der Suche nach Hinweisen auf einen spezifischen Speicher für Geruchsvorstellungen nützten Lyman & MacDaniel (1990) die Tatsache, daß Gedächtnisleistungen von Priming mit Informationen in derselben Modalität profitieren. Sie forderten Versuchspersonen auf, sich zu einer Reihe von Namen bekannter Objekte entweder visuelle Vorstellungen zu bilden oder sich den Geruch der jeweiligen Objekte in Erinnerung zu rufen. Anschließend mußten die Probanden Gerüche oder Photographien der Namensreferenten wiedererkennen. Wie erwartet wirkten sich olfaktorische Vorstellungen nur auf das Erkennen von Geruchsreizen positiv aus, während visuelle Vorstellungen nur das Erkennen von Bildern erleicherten. Die Autoren schließen: "The interaction between modality of encoding and recognition plausibly suggests, however, that storage of olfactory information takes place in a modality specific imagery system" (1990, S. 663).
Fazit:
Aus Sicht der Kognitonspsychologie ist die Geruchsverarbeitung ein interessantes Thema, da sie auf allen Stufen Einblick in individuelle Prozesse des Aufbaus, der internen Organisation und des Abrufs von modalitätsspezifischem Wissen ermöglicht. Darüber hinaus erlaubt sie vermutlich eine Differenzierung von verbalen und non-verbalen Komponenten der Informationsverarbeitung und des Verhaltens und bietet einen ethologisch interessanten Zugang zu Fragen der Wissensrepräsentation.
1.4 Relevanz des Themas für die Medizin
Trotz eines allgemein wachsenden Interesses an grundlegenden Fragen der Geruchswahrnehmung wird olfaktorischen Defiziten in der Medizin im Vergleich zu Störungen der visuellen oder auditiven Modalität relativ geringe Bedeutung zugemessen. Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, daß Riechstörungen die Lebensqualität der betroffenen Patienten oft erheblich beeinträchtigen. Sie klagen in der Regel über den Verlust der Freude am Essen, denn der Geruchssinn vermittelt alle Geschmackseindrücke mit Ausnahme der vier gustatorischen Grundqualitäten. Alle Speisen erscheinen An- oder Hyposmikern gleichermaßen fade und pappig. Der Verlust des Geruchssinns beeinträchtigt das emotionale Erleben, nicht nur aufgrund der allgemeinen Verarmung der Wahrnehmungseindrücke, sondern auch weil plötzlich wichtige Informationen fehlen, die bisher beispielsweise die häusliche Umgebung als vertraut erscheinen ließen, oder die frühzeitig vor Gefahren warnten. Besonders unangenehm wirken sich Parosmien oder Kakosmien, also Verzerrungen der Geruchsempfindungen, die meist in negative Richtung gehen, auf das Erleben aus.
Geruchsstörungen können sehr unterschiedliche Ätiologien haben. Neben den häufigsten Ursachen wie mechanischen Verengungen der Nasen- oder Nebenhöhlen, infektiösen Erkrankungen der oberen Atemwege, Schädel-Hirn-Traumata oder toxischen Einflüssen, können olfaktorische Dysfunktionen unter anderem auch durch endokrine, neurologische oder psychiatrische Störungen bedingt sein (Überblick bei Smith & Seiden, 1991; Duncan & Smith, 1995). Obwohl sie medizinisch gesehen häufig sekundäre Symptome darstellen, ist die Beeinträchtigung des Geruchssinns für die betroffenen Patienten häufig eine Hauptbeschwerde und Grund, einen Arzt aufzusuchen. Auch wenn die Geruchsstörungen selbst aufgrund des recht eingeschränkten klinischen Wissens über diese Modalität oft schwer zu behandeln sind, sollte ihre Bedeutung für die Diagnostik deshalb nicht unterschätzt werden. Dies gilt vor allem für den Bereich der Neurologie und Neuropsychologie; also für Fälle, in denen periphere Ursachen für die Riechstörungen wie Atemwegsbehinderungen oder lokale pathologische Prozesse ausgeschlossen werden können.
Für die Neurologie und Neuropsychologie sind olfaktorische Defizite vor allem aufgrund der neuroanatomischen Besonderheiten des Geruchssinns interessant. Wie bereits erwähnt, hat das olfaktorische System im Vergleich zu anderen Modalitäten sehr direkte Verbindungen vom Rezeptor zu kortikalen und limbischen Strukturen (Price, 1987; Shipley & Reyes, 1991, Hudson & Distel, im Druck). Die Rezeptorzellen im Epithel sind im Unterschied zu den Rezeptoren der anderen Sinnessysteme echte Neuronen und senden ihre Axone durch die Lamina cribrosa direkt zum Bulbus olfactorius, wo sie in der Schicht der Glomeruli enden. Diese Gebilde sind die stark verzweigten Dendritenbäume der nachfolgenden Schicht der Mitralzellen. Ihre Funktion ist, die einlaufenden Information von den Fila olfactoria zusammenzufassen. So treffen in einem Glomerulum die Axone von circa 26 000 Rezeptorzellen auf die Dendriten von etwa 24 Mitralzellen. Nach dieser ersten und einzigen Verschaltung der Information laufen die Axone der Mitralzellen durch den Bulbus und über den lateralen olfaktorischen Trakt direkt zu einem Teil des limbischen Kortex, nämlich der piriformen Rinde. Von dort führen Projektionen zur Amygdala und über den dorsomedialen Thalamus zum medialen und lateralen orbitofrontalen und insulären Kortex, Area praeoptica und Hypothalamus. Die letzte Station des zentralen olfaktorischen Systems ist das basale Vorderhirn und dort insbesondere der Kern des Diagonalen Bandes.
Die unmittelbare Anbindung an bzw. weitgehende Identität olfaktorischer Strukturen mit dem limbischen System wird im allgemeinen als ursächlich für die meist spontanen emotionalen Reaktionen auf Gerüche angesehen. Tatsächlich werden Gerüche in der Regel noch bevor sie identifiziert werden oder eine Assoziation auslösen als angenehm oder unangenehm eingestuft. Klinisch könnte dies insofern relevant sein, als sich affektive Störungen bei der Bewertung von Gerüchen möglicherweise früher oder deutlicher zeigen als bei der Bewertung von Reizen aus den anderen Modalitäten. Es erscheint außerdem denkbar, daß die unmittelbare affektive Bewertung von Gerüchen weniger stark von kognitiven Prozessen abhängt als die Bewertung anderer Reize. Diese Fragen sind jedoch bisher kaum untersucht worden. Erste systematische Studien zu Störungen der affektiven Reaktionen auf Gerüche bei Patienten mit Frontalhirnschäden laufen zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch in Zürich und Berlin an (persönliche Mitteilung von Prof. Dr. M. Regard).
Relativ gut untersucht sind dagegen Geruchsstörungen, die bei einer Reihe neurodegenerativer Erkrankungen auftreten (Doty, 1991), insbesondere bei Morbus Alzheimer und verschiedenen Formen des Morbus Parkinson. Mehrere Faktoren sprechen hier für eine relativ spezifische Indikatorfunktion olfaktorischer Minderleistungen, die durchaus von (differential-) diagnostischer Bedeutung sein kann. So läßt sich beispielsweise idiopathischer von MPTP-induziertem Parkinson anhand der jeweils unterschiedlichen Ausprägung und des Verlaufs der olfaktorischen Dysfunktion unterscheiden (Doty, 1991). Darüberhinaus scheint das olfaktorische System bei einigen neurodegenerativen Erkrankungen besonders stark betroffen zu sein, denn Störungen des Geruchssinns lassen sich zumindest bei Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson, schon lange bevor andere Gehirnschäden erkennbar werden, nachweisen. Medizinisch könnte dies nicht nur diagnostisch, sondern auch bei der Ursachenforschung relevant sein, denn "evidence that olfactory neurons can serve as a portal of entry for viruses and a number of neurotoxic agents into the CNS, has led to the intriguing hypothesis that some neurogenerative disorders may be caused by the entry of viruses or toxins from the nasal cavity into the CNS via the olfactory nerves" (Doty, 1991, S. 747).
Nicht zuletzt werden olfaktorische Funktionen im Rahmen der Entwicklung neuropsychologischer Tests für diagnostische Zwecke, mit denen spezifische Hirnfunktionen gemessen werden können, untersucht (Abraham & Mathai, 1983). Das Interesse richtet sich dabei vor allem auf Patienten mit Temporallappenläsionen oder -epilepsien, da inzwischen mehrere Befunde für eine Beteiligung des Temporallappens an der Verarbeitung von Geruchsreizen sprechen. Dabei werden in der Regel normale Geruchsschwellen, aber Beeinträchtigungen bei der Diskrimination, der Identifikation und im Geruchsgedächtnis festgestellt. (Die entsprechende Literatur wird in Kapitel 4 genauer referiert). Da Gerüche vermutlich Zugang zu nicht sprachlich dominierten, eher nonverbalen kognitiven Verarbeitungsprozessen bieten, stellen Geruchstests eine sinnvolle Ergänzung zu Verfahren dar, die verbales Verhalten messen. Über eigene Anwendungen von Gerüchen als non-verbale Stimuli in der präoperativen Epilepsiediagnostik wird in Kapitel 4 berichtet.
Neurologische und neuropsychologische Testverfahren sind darauf ausgelegt, neben sensorischen Wahrnehmungsstörungen auch kognitive Defizite zu erfassen. Kognitive Prozesse sind jedoch in hohem Maße von der Vorerfahrung und der individuellen Struktur der mentalen Repräsentation abhängig. Damit Defizite diagnostizierbar werden, ist ein möglichst genaues Wissen über diese kognitiven Voraussetzungen und die Auswirkung individueller Faktoren bei gesunden Menschen notwendig. Da in der olfaktorischen Modalität dieses Vorwissen bisher jedoch noch recht unvollständig ist, versteht sich die vorliegende Arbeit als Referenz für die Entwicklung von klinischen Tests. Umgekehrt bietet die neuropsychologische Untersuchung von Patienten selbst einen äußerst wichtigen Ansatz für die medizinische und olfaktorische Grundlagenforschung und deren Ziel, zum Verständnis von Hirnfunktionen beizutragen.
1.5 Ziel der Arbeit
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die mentale Repräsentation von Geruchswissen mit kognitions- und neuropsychologischen Methoden zu untersuchen und auf diese Weise Fragestellungen der Geruchsforschung, der Kognitionspsychologie und der Neuropsychologie miteinander zu verbinden. Es sollte geklärt werden, wie differenziert die menschliche Geruchswelt im Gehirn verankert ist, und in welchem Maße individuelle Geruchswelten vergleichbar sind. Ferner sollte geprüft werden, inwieweit Gerüche non-verbal repräsentiert sind und ob es Hinweise auf eine Dominanz der rechten Hemisphäre für die Verarbeitung von Gerüchen gibt.
Bei der ersten Studie handelt es sich um einen explorativen Ansatz zur empirischen Beschreibung individueller Geruchswelten bei gesunden Probanden mit normalem Geruchssinn. Mit Hilfe der Methode der freien Assoziation soll erfaßt werden, wie Menschen auf ein breites Spektrum von Alltagsgerüchen reagieren, und mit welchen Erfahrungen sie diese Gerüche verbinden. Diese Studie soll klären, inwieweit Menschen aus dem selben soziokulturellen Umfeld Geruchserfahrungen teilen.
Die zweite Untersuchung dient einer systematischeren Erfassung unterschiedlicher olfaktorischer Leistungen, nämlich Identifikation, Diskrimination, Kategorisierung und Matching der Gerüche zum Geruchsträger bzw. dessen Namen, mit einem enger gefaßten Reizset. Es soll diskutiert werden, was sich aufgrund dieser unterschiedlichen Leistungen über die Qualität geruchlicher Repräsentationen aussagen läßt.
Die dritte Studie untersucht die Verarbeitung von Geruchsreizen bei hirngeschädigten Patienten unter unilateraler Hemisphärenanästhesie (Wadatest) im Rahmen der Epilepsiediagnostik. Sie soll nicht nur einen Beitrag zur grundsätzlichen Aufklärung von Besonderheiten der Informationsverarbeitung in der olfaktorischen Modalität liefern, sondern auch eine Aussage über den Wert dieser Modalität für die neuropsychologische Diagnostik ermöglichen. Von Seiten der Geruchsforschung steht die Frage im Vordergrund, ob sich Hinweise auf lateralisierte Verarbeitung bzw. Repräsentation von Geruchsreizen ergeben. Die Ausschaltung der sprachdominanten Hemisphäre im Wadatest bietet außerdem eine einzigartige Gelegenheit, den Zusammenhang zwischen Sprachfunktionen und Geruchsgedächtnis näher zu betrachten und die Frage zu untersuchen, inwieweit Gerüche non-verbal verarbeitet werden.
2. Bild und Benennung: Bildhaftes Assoziieren zu Gerüchen - ein explorativer
Ansatz
2.1 Fragestellung
"Whenever I smell new-mown grass, an experience from a faraway place nearly sixty years ago automatically comes to my mind, as though time had stood still. It was the first experience of a city boy on a farm in the haying season, walking through a field of clover behind a mowing machine pulled by a home made tractor."
(Engen, 1991, S. 5)
Erfahrungen dieser Art, daß die Wahrnehmung eines Geruchs plötzlich sehr deutliche Erinnerungen an lange zurückliegende Situationen auslösen kann, sind verbreitet. Der französische Schriftsteller Marcel Proust beschreibt ein entsprechendes Erlebnis sogar als Auslöser für die Geschichte eines ganzen Romans. In seinem Werk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" löst der Geruch und Geschmack von in Tee getauchtem Gebäck eine Kette von Erinnerungen an lange vergessene Gefühle und Ereignisse aus der Jugend des Ich-Erzählers aus. In der olfaktorischen Literatur wird daher vom Proust-Effekt gesprochen, wenn es um das Phänomen geruchsevozierter Erinnerungen geht.
Die Tatsache, daß einzelne Wahrnehmungseindrücke (gleichgültig aus welcher Modalität) spontan Gedächtnisinhalte aktivieren können, war bereits den griechischen Philosophen der Antike bekannt. Sie prägten dafür den Begriff der Assoziation und beschrieben damit die Vorstellung, daß Ideen und Gedanken in einer Weise miteinander verbunden sind, "daß das Erscheinen einer Vorstellung im Bewußtsein eine andere, die mit ihr assoziiert ist, nach sich zieht" (Hörmann, 1977, S. 72). Die Psychologie nützt diese Besonderheit des Bewußtseins spätestens seit Galton experimentell. Der englische Vererbungsforscher war überzeugt, daß Assoziationen "die Fundamente der Gedanken eines Menschen" bloßlegen und "seine geistige Anatomie mit mehr Deutlichkeit und Wahrheit [zeigen], als es ihm wahrscheinlich lieb ist" (Galton, 1880; zitiert nach Hörmann, 1977, S. 73). Assoziationsexperimente erschienen ihm daher geeignet zur Aufdeckung von versteckten, nicht unmittelbar faßbaren Verbindungen zwischen Begriffen. In diesem Sinne werden sie noch heute zum einen in der Sprach-, Lern- und Kognitionspsychologie und zum anderen in der Psychoanalyse eingesetzt.
Die meisten Untersuchungen zu Assoziationen wurden mit sprachlichen Reizen durchgeführt, viel seltener mit non-verbalem Material wie Bildern oder Musik. In der allgemeinen Psychologie ist das Ziel von Assoziationsstudien in der Regel die phänomenologische Beschreibung empirischer Normen (vgl Hörmann, 1977), also die Frage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Individuen oder Angehörigen bestimmter Gruppen und die Interpretation der vorgefundenen Gegebenheiten. Insofern Assoziationen die Struktur mentaler Repräsentationen widerspiegeln, sollten sie auch Zugang zur Organisation von Geruchswissen bieten. Doch bisher wurde die Methode der freien Assoziation bei Gerüchen kaum systematisch angewandt.
Ein erster Versuch, solche subjektiven Erfahrungen wissenschaftlich zu fassen, stammt von Laird (1935). Er sammelte retrospektive Berichte von 254 Versuchspersonen über geruchsevozierte Erinnerungen und fand, daß 80% der Männer und 90% der Frauen über entsprechende Erlebnisse aus eigener Erfahrung berichten konnten. Die Erinnerungen wurden meist als hoch emotional und lebhaft beschrieben (vgl. Herz & Cupchik, 1992).
Schleidt & Neumann (1986) wählten einen ähnlichen Ansatz wie Laird. Sie befragten 166 Probanden ohne Reizdarbietung nach ihren Erinnerungen an besonders angenehme oder unangenehme Gerüche, sowie nach den Situationen, in denen diese jeweils vorkamen und weiteren damit verbundenen Assoziationen. Mit dieser Untersuchung lieferten die Autoren einen eindrücklichen Nachweis der allgemeinen Bedeutung und fest verankerten Repräsentation von Geruchsreizen. Aufgrund von insgesamt mehr als 1500 erhaltenen Geruchsnennungen schließen sie: "Auch Großstadtbewohner sind in ihrem alltäglichen Leben offenbar überall und ständig von Gerüchen umgeben, die wichtig genug sind, um in den Langzeitspeicher des Gedächtnisses übernommen zu werden" (1986, S. 15). Sie fanden außerdem, daß die Geruchserinnerungen alle Lebensbereiche umfassen, das Verhältnis der positiven zu den negativen Geruchserinnerungen ausgewogen ist, frische, neuentstandene Gerüche aus den Bereichen "Natur" und "Nahrung" fast durchwegs positive Assoziationen auslösen; Fäkalien, Verrottetes oder Verfaultes dagegen durchgehend negative.
Zumindest auf dieser grundlegenden Bewertungsebene scheint es demnach eine gewisse interindividuelle Übereinstimmung in der internen Repräsentation von Geruchserfahrungen zu geben. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Schleidt, Neumann & Morishita (1988) auch bei einem interkulturellen Vergleich zwischen Deutschland und Japan.
Rubin et. al. (1984) und Herz & Cupchik (1992) untersuchten geruchsevozierte Erinnerungen direkt über die Darbietung von Reizen.
In der Studie von Rubin et. al. (1984) ging es dabei in erster Linie um einen Vergleich zwischen den Modalitäten. Sie interessierte, ob durch Gerüche andere Erinnerungen hervorgerufen werden, als durch entsprechende Namen oder Bilder und kommen zu dem Ergebnis: "Compared with memories evoked by photographs or names, memories by odors were reported to be thought of and talked about less often prior to the experiment and were more likely to be reported as never having been thought of or talked about prior to the experiment" (S. 493). Dies könnte andeuten, daß Gerüche tatsächlich mit anderen Gedächtnisinhalten enger assoziiert sind als Worte oder Bilder. Als Stimulusmaterial verwendeten Rubin und Mitarbeiter 20 unterschiedliche Alltagsgerüche.
Herz & Cupchik (1992) fanden bei ihrer Beschreibung von geruchsevozierten Erinnerungen zu 20 verschiedenen chemischen Substanzen und natürlichen Essenzen ebenfalls, daß Gerüche im Vergleich zu Bildern und Worten Erinnerungen auslösen, an die sonst selten gedacht wird, vor allem wenn die Düfte relativ unbekannt sind und nicht richtig benannt werden können. Die Autoren heben hervor "memories which are associated to odors do not require words ... to be elicited, supporting the view that the role of language is secondary in odor experience" (1992, S. 527). Verbale Aspekte scheinen demnach bei der Repräsentation von Gerüchen eine weniger wichtige Rolle zu spielen als affektive, denn Herz & Cupchik beschreiben die Erinnerungen in ihrer Studie als mehrheitlich stark emotional, ferner lebhaft, spezifisch und relativ alt.
Die angeführten Befunde legen nahe, daß Geruchswissen im Gedächtnis wenigstens zum Teil non-verbalverankert und eng mit emotionalen Aspekten verbunden ist. Mit Gerüchen assoziierte Erinnerungen scheinen überwiegend lebhaft zu sein und sich oft auf spezifische Situationen und konkrete, individuelle Erfahrungen zu beziehen, während die Anbindung an abstrakte sprachliche Konzepte eher schwach ausfällt.
Dieses Fazit erinnert an Befunde aus der Entwicklungspsychologie (Bruner et al., 1966, Piaget & Inhelder, 1971, 1978; Kosslyn, 1980, zitiert in Anderson, 1988, 382f), die darauf hindeuten, daß Kinder bei kognitiven Aufgaben eher bildhafte, wahrnehmungsmäßige Repräsentationen zu benutzen scheinen, Erwachsene dagegen eher auf abstrakt verbale, an der Bedeutung orientierte Konzepte zurückgreifen. Im Sinne dieser Hypothese erscheint es denkbar, daß in der phylogenetisch alten olfaktorischen Modalität generell bildhaft konkrete, "präverbale" Verarbeitungsstrategien bzw. non-verbale Formen der Repräsentation dominieren.
Die Methode der freien Assoziation könnte daher einen geeigneteren Zugang zu Geruchsrepräsentationen bieten als Benennensaufgaben, vor allem wenn sich bildhafte Assoziationen auch dann einstellen, wenn die verbale Identifikation eines Geruchsträgers nicht möglich ist. Da die bisherigen Studien Assoziationen zu Gerüchen nicht unter dem Aspekt der Repräsentation untersucht haben, war es das Ziel des ersten Experimentes dieser Arbeit, in explorativer Weise nach episodischen oder bildhaften Anteilen in der Struktur von Geruchswissen zu fragen und diese quantitativ und qualitativ zu beschreiben. Desweiteren sollte die Untersuchung klären, ob sich die Assoziationen zu Alltagsgerüchen interindividuell stark unterscheiden oder ob verschiedene Personen, die selben Düfte mit ähnlichen Erlebnissen verbinden.
2.2 Methode
Versuchspersonen
23 gesunde Versuchspersonen (11 Männer, 12 Frauen) im Alter von 25 bis 49 Jahren nahmen am Experiment teil. Bei den Probanden handelte es sich um Raucher und Nichtraucher mit nach eigener Einschätzung normaler Geruchswahrnehmung.
Reize
Da das Interesse dieser Studie dem gespeicherten Geruchswissen und nicht der Verarbeitung unbekannter Geruchsreize gilt, war das Vorkommen im Alltag das entscheidende Kriterium für die Reizauswahl. Um sicherzustellen, daß die Reize im Experiment in ihrer Qualität soweit wie möglich der tatsächlichen Erfahrung der Versuchspersonen entsprechen, wurde deshalb nicht mit künstlichen Aromen, sondern ausschließlich mit Originalsubstanzen gearbeitet. Es wurde ferner versucht, Reize aus einem möglichst breiten Spektrum verschiedener Lebensbereiche auszuwählen (vgl. Tab. 1).
Weitere Auswahlkriterien waren möglichst gute Haltbarkeit der Stoffe bzw. Ersetzbarkeit ohne qualitative Veränderung. Bewußt wurden auch einige sehr ähnliche Substanzen wie Kakaopraline und Schokolade, zwei verschiedene Sorten Leder oder Gummi sowie gemahlener und abgestandener Kaffee in das Stimulusset aufgenom-men, um auch die Unterscheidungsfähigkeit der Versuchspersonen und die Konsi-stenz der Aussagen zu prüfen.
Darbietungsform
Die Testsubstanzen wurden mit geruchlosem Zellstoff in schwarzen, undurchsichtigen Plastikfilmdöschen derart verpackt, daß weder optisch noch durch Schütteln der Dose Informationen über die Konsistenz des Inhaltes gewonnen werden konnten
Tab. 1: Liste der Geruchssubstanzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Versuchsablauf
Jede Versuchsperson bekam in vier Sitzungen, die über einen Zeitraum von maximal zwei Wochen verteilt waren, jeweils 10 andere Alltagsgerüche in unterschiedlicher, quasizufälliger Reihenfolge geboten. Die Versuchspersonen hatten während des Experimentes die Augen verbunden. Die Versuchsleiterin reichte ihnen die Geruchsdosen und wies sie an, den Deckel der Döschen selber an einer Seite zu lüften, um am Öffnungsspalt zu schnuppern. Sie forderte die Probanden auf, auf Erinnerungsbilder zu achten und diese zu beschreiben. Ausdrücklich wurde betont, daß es nicht darum ginge, die Gerüche zu erkennen. Zu jedem Geruchsstimulus notierte die Versuchsleiterin alle verbalen Äußerungen über ausgelöste Assoziationen und Erinnerungen.
Nach der Beschreibung dieser Erinnerungen sollten die Versuchspersonen die Lebhaftigkeit des Bildes auf einer fünfstufigen Skala von "kaum" (1) bis "sehr" (5) und eine Angabe zum Alter der Erinnerung machen - in der Größenordnung: Stunden (1), Tage (2) Wochen (3), Monate (4), Jahre (5), Jahrzehnte (6). Danach wurden ebenfalls auf fünfstufigen Skalen Ratingurteile zu Angenehmheit (Hedonik) von "sehr unangenehm" (1) bis "sehr angenehm" (5) und empfundener Intensität von "sehr schwach" (1) bis "sehr stark" (5) sowie auf einer Skala von "völlig unbekannt" (0) bis "sehr bekannt" (5) Ratingurteile zur Vertrautheit der Reize erhoben. Das Tempo der Präsentationsfolge bestimmten die Versuchspersonen selber und konnten jederzeit Pausen einlegen, sofern sie dies nötig fanden.
Auswertung
Die verbalen Äußerungen wurden nach folgendem Schema aufgeschlüsselt, kodiert und kategorisiert:
0 = keine Reaktion
Wort:
1 = Beschreibung mittels allgemeinem Adjektiv
z.B. süß, bitter, würzig, chemisch, medizinisch
2 = Beschreibung mittels Vergleich mit einer anderen Substanz oder mittels vergleichendem Adjektiv
z.B. teeartig, wie Harz, seifig, Gemisch aus x und y
3 = Oberbegriff bzw. Kategorie
z.B. (irgendein/e) Pflanze, Gewürz, eine Art...
4 = falsche oder nicht ganz zutreffende Bezeichnung für vermuteten
Geruchsträger (Benennungsversuch)
5 = korrekte Bezeichnung
Bild:
6 = objektbezogenes Bild
7 = kontextbezogenes Bild
8 = idiosynkratisches Bild
[...]
- Arbeit zitieren
- Ina Schicker (Autor:in), 1995, Gehirn und Geruch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176156
Kostenlos Autor werden




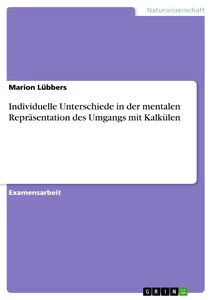




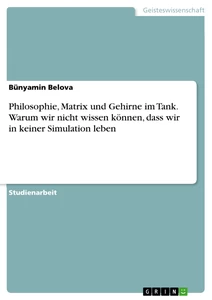

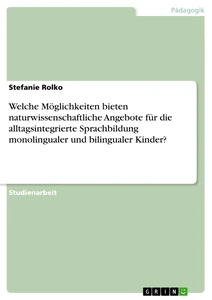







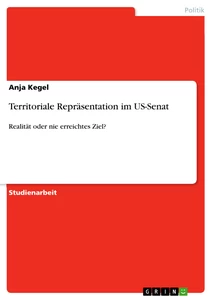


Kommentare