Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Theorieteil
1. Einführung in die Thematik
2. Die Koedukationsdebatte – vom 19. Jahrhundert bis heute
3. Ursache für Geschlechterdifferenzen: Erziehung oder Genetik?
4. Geschlechterdifferenzen
4.1 Das Sozialverhalten
4.2 Das Unterrichtsverhalten
4.3 Die Leistungsmotivation
4.4 Geschlechterdifferenzen im kognitiven Bereich
4.5 Geschlechterdifferenzen in den Bereichen Mathematik und
Naturwissenschaften
4.6 Geschlechterdifferenzen in schriftsprachlichen Leistungen
5. Die Geschlechtersozialisation in der Schule
5.1 Lehrerverhalten
5.2 Geschlechterrollen in Schulbüchern
5.3 Weiblich dominierte Erziehung
6. Eine geschlechtergerechte Pädagogik
7. Pädagogische Wege um beide Geschlechter zu fördern
7.1 Bildungspolitische Ansätze
7.2 Unterrichtspraktische Ansätze
II. Praxisteil – eine Werkstattarbeit im Sachunterricht
8. Einleitung in den Praxisteil
9. Lehrplananalyse
9.1 Aufgliederung in Lernbereiche
9.2 Einordnung in das Schuljahr
9.3 Fächerverbindende Bezüge
9.4 Fächerübergreifende Bezüge
10. Didaktische Analyse
11. Die Werkstatt „Jungen und Mädchen sind verschieden und doch gleich“
11.1 Ablauf und Organisation der Werkstattarbeit
11.2 Die gebundenen Phasen
11.3 Die Aufgaben der Werkstatt mit Lernvoraussetzungen, -zielen und methodischen Überlegungen
11.3.1 Der Werkstattplan
11.3.2 Aufgabe 1 – Alle Kinder sind verschieden
11.3.3 Aufgabe 2 – Forschungsauftrag
11.3.4 Aufgabe 3 – Mimikspiel: Der Gefühlswürfel
11.3.5 Aufgabe 4 – Rollenspiel
11.3.6 Aufgabe 5 – Körper der Mädchen und Jungen
11.3.7 Aufgabe 6 – So pflege ich meinen Körper
11.3.8 Aufgabe 7 – Große Erfinderinnen
11.3.9 Aufgabe 8 – Ja oder nein?
11.3.10 Aufgabe 9 – Jungen-/ Mädchenseite
11.3.11 Aufgabe 10 – Das bin ich – Mein Steckbrief
11.3.13 Aufgabe 12 – Fußballrätsel
11.3.14 Aufgabe 13 – Wann hast du dich so gefühlt?
11.3.15 Aufgabe 14 – Rück mir nicht auf die Pelle!
11.3.16 Aufgabe 15 – Wenn ich ein Junge/ ein Mädchen wäre
11.3.17 Aufgabe 16 – Küchenkräuter
12. Schlussbetrachtung
Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Quellenverzeichnis
Internetquellen
I. Theorieteil
1. Einführung in die Thematik
Bereits zum Schuleintritt haben Kinder zumeist eine feste Selbstkategorisierung als Junge oder Mädchen getroffen (vgl. Heinzel, Prengel, S. 149). Sie fühlen sich einem Geschlecht zugehörig, mit welchem die männliche oder die weibliche Geschlechterrolle verknüpft ist. Mädchen und Jungen wird dieses Geschlechterbild oft unbewusst durch geschlechtstypische Erwartungen der Erwachsenen sowie deren Rollenverhalten übermittelt, aber auch die Medien beeinflussen das Geschlechterrollenverständnis von Kindern (vgl. Nießen, Wieners, S. 8).
„Während der Grundschulzeit wird die Geschlechtsidentität dann weiter erprobt und ausdifferenziert“ (vgl. Heinzel, Prengel, S. 149). Dabei wird besonders in der Grundschule, aufgrund des sozialen Miteinanders einer großen Anzahl gleichaltriger Jungen und Mädchen, die Geschlechtsidentität der Kinder geprägt (vgl. Kaiser 2003, S. 22). Aber auch die Interaktionen mit den Lehrerinnen und Lehrern, die behandelten Unterrichtsthemen und die Beschäftigung mit den Unterrichtsmaterialien tragen zur Ausdifferenzierung der Geschlechteridentitäten bei (vgl. ebenda).
Der in unserer Verfassung festgelegt Grundsatz: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ erteilt auch den Grundschulen den Auftrag der Chancengleichheit für beide Geschlechter (vgl. ebenda, S. 148; Grundgesetz Artikel 3). Durch den Wandel zur Koedukation in der Geschichte, welcher in der vorliegenden Arbeit unter Gliederungspunkt 2 zusammengefasst wird, wird die Chancengleichheit äußerlich gewährleistet (vgl. Heinzel, Prengel, S. 148). Trotzdem kommt gerade in den letzten Jahren erneut die Diskussion darüber auf, ob Mädchen und Jungen in der Schule tatsächliche gleiche Möglichkeiten eröffnet werden. Dabei wurde der Vorwurf laut, die heutige koedukative Schulpraxis könne dem Anspruch einer geschlechtergerechten Pädagogik nicht genügen, da sie den stereotypen Geschlechterrollenbildern nicht oder nicht in ausreichendem Maße entgegenwirke (vgl. Kaiser 2003, S. 20).
Beispielhaft sei an dieser Stelle genannt, dass Schülerinnen in der Grundschule Bestärkung in ihrem weitgehend schulkonformen und angepassten Verhalten erfahren, wodurch Kompetenzen wie Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbehauptung wenig gefördert werden (vgl. Faulstich-Wieland 2004, S. 12). Damit steht in Zusammenhang, dass Mädchen später überdurchschnittlich häufig einen der weniger chancenreichen sozialen Berufe ergreifen, wogegen Jungen eher Berufswege mit besseren Karrierechancen in den Bereichen der neuen Technologien einschlagen (vgl. Kaiser 2003, S. 20).
Auf der anderen Seite werden aber auch die Jungen als nicht ausreichend in Bezug auf ihr Geschlecht gefördert betrachtet. Gründe dafür sind beispielsweise die Überzahl an weiblichen Lehrpersonen in Grundschulen und damit der Mangel an greifbaren männlichen Vorbildern sowie das häufigere Schulversagen der Jungen (vgl. Niemann, S. 7; Boldt, Schütte, S. 4). Die Präsenz gerade dieser Thematik zeigen Magazine wie Focus und Spiegel mit Titeln wie: „Das benachteiligte Geschlecht – Arme Jungs – Warum Mädchen besser dran sind“ oder „Schlaue Mädchen – dumme Jungen“ (vgl. Focus 32/2002; Spiegel 21/2004).
In der vorliegenden Arbeit sollen Wege aufgezeigt werden, wie die Geschlechterspezifika von Jungen und Mädchen im Grundschulunterricht berücksichtigt werden können. Ziel ist es dabei, beide Geschlechter zu fördern, damit Geschlechterstereotype zugunsten einer individuell vielfältigen Entwicklung von Jungen und Mädchen in den Hintergrund treten. Unter Geschlechterstereotyp bzw. Geschlechterrolle ist in diesem Zusammenhang die „schematische, auf bestimmte Normvorstellungen fixierte Zuschreibungen von Tätigkeiten und Eigenschaften an Frauen und Männer, durch die Verhaltensmöglichkeiten je nach Geschlechtszugehörigkeit abgesteckt und Alternativen ausgeblendet werden“ gemeint (Bundesamt für Gesundheit).
Dabei ist zu betonen, dass keinesfalls eine Gleichmacherei der Geschlechter bezweckt wird, sondern dass Mädchen und Jungen mehr Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden sollen (siehe Punkt 6 - Eine geschlechtergerechte Pädagogik).
Mit der Planung der fächerverbindenden Werkstattarbeit zum Thema „Mädchen und Jungen sind verschieden und doch gleich“ gibt diese wissenschaftliche Hausarbeit ein Praxisbeispiel dafür, wie einer Beschränkung auf die Geschlechterstereotype entgegengewirkt werden kann. Dabei finden Grundlagen zur Thematik Berücksichtigung, die im Theorieteil der Arbeit erörtert werden.
Der kurze geschichtliche Abriss über die Koedukationsdebatte zeigt, wie vom 19. Jahrhundert bis heute die gemeinsame Beschulung und die scheinbare Benachteiligung eines Geschlechts immer wieder Diskussionspunkte darstellen. Das Kapitel gibt weiterhin einen knappen Ausblick auf eine Möglichkeit, den koedukativen Unterricht heute geschlechtergerecht zu gestalten.
Der darauf folgende Gliederungspunkt behandelt die Ursprünge der Geschlechterdifferenzen. Danach wird auf einige Geschlechterunterschiede zwischen Grundschulkindern bezüglich ihres Verhaltens, ihren Interessen und ihren Leistungen eingegangen, wobei stets der Kontext zu Schule und Unterricht hergestellt wird. In allen dort angesprochenen Bereichen, insbesondere aber in den Gebieten Mathematik/ Naturwissenschaften und schriftsprachliche Leistungen, werden die jeweiligen Geschlechterunterschiede erläutert sowie Ursachen und Auswirkungen auf das Schulleben und die Schulleistungen gezeigt.
Der Abschnitt „Die Geschlechtersozialisation in der Schule“ (Punkt 5) befasst sich mit der Rolle der Schule und speziell der Grundschule bei der Ausprägung von Geschlechterstereotypen.
Daran schließt die Erläuterung von Möglichkeiten an, beide Geschlechter im Sinne einer geschlechtergerechten Pädagogik zu fördern.
2. Die Koedukationsdebatte – vom 19. Jahrhundert bis heute
Nicht erst durch die feministischen Schulforschungen ist die Koedukation zu einem Diskussionsthema geworden. Schon am Ende des 19. Jahrhunderts war sie Gegenstand von Auseinandersetzungen, wobei sich die Argumentation im Laufe der Zeit grundlegenden Änderungen unterzog (vgl. Richter, S. 15).
Im 19. Jahrhundert stand die Vermittlung von bürgerlich-weiblichen Tugenden, wie Sittsamkeit und Fleiß, im Vordergrund der Bildung an höheren Mädchenschulen. Eben jene Schulen trugen ihren Titel nicht wegen der Hochwertigkeit ihrer Ausbildung, sondern weil sie ausschließlich von Töchtern aus höheren gesellschaftlichen Schichten besucht wurden. Die Mädchenschulen hatte damals keine große Bedeutung für die Öffentlichkeit. Da „das preußisch-deutsche Schulwesen … von jeher in hohem Maße staatsfunktional organisiert war“, war das so genannte allgemeine Schulwesen stark auf Tätigkeiten im Staatsdienst ausgerichtet (Rendtorff, S. 39). Für Frauen war ein Ausüben solcher Tätigkeiten so unvorstellbar, wie der Besuch einer höheren ‚allgemeinen’ Schule. An den höheren Mädchenschulen konnten keine Abschlüsse oder Berechtigungen erworben werden, wodurch die „männliche Bildung und Definitionsmacht“ erhalten blieb (vgl. ebenda, S. 40). Im Entwurf des allgemeinen Schulverfassungsgesetzes wurde 1819 festgehalten, dass die höheren Töchterschulen nicht allgemein notwendig seien. Zwar erfolgte im Jahre 1908 eine Angliederung der höheren Mädchenschule an das Berechtigungs- und Verwaltungssystem des Preußischen Gymnasiums und 1921 folgte der Beschluss der Reichsschulkonferenz, Mädchen- und Knabenschulwesen nach den selben Grundsätzen zu regeln, doch ein koedukatives Bildungswesen war dadurch noch nicht geschaffen (vgl. Zinnecker, S. 93ff). Die Mädchenschulen blieben eine ‚Abweichung’ von dem als ‚allgemein’ bezeichneten Knabenschulwesen (vgl. Rendtorff, S. 40). Zu dieser Zeit gab es auch koedukative Schulen, deren Besuch allerdings kein Privileg war, sondern finanzielle Gründe hatte. Wenn es an Geld mangelte, besuchten Mädchen und Jungen dieselben Schulen. Für die Töchter betuchterer Familien wurden Mädchenschulen eingerichtet (vgl. ebenda, S. 42f).
Erstmals eingeführt wurde die Koedukation 1948 als Regelform in der DDR. Die Gründe dafür waren politische: Die Schule sollte zur Erziehung zur Gleichheit und der „Demokratisierung der deutschen Schule“ dienen (vgl. ebenda, S. 45f).
In Westdeutschland blieb vorerst das von den Nazionalsozialisten nach Geschlechtern getrennte Schulwesen bestehen. In den 1960er Jahren wurden durch die sich ausdehnende hochindustrialsierte Wirtschaft ein höheres Qualifikationsniveau und mehr gut ausgebildete Schul- und Studienabsolventen notwendig. Eine Weiterführung des getrennten Schulwesens wäre unwirtschaftlich gewesen, da die Mädchen „eine bis dahin wenig genutzte Bildungsreserve darstellten und das höhere Schulsystem der Jungen schon bereitstand, um sie aufzunehmen“ (ebenda, S. 46). Statt einer gesamten Neuordnung des Schulsystems fand durch das Hinzukommen der Mädchen lediglich eine Erweiterung des Knaben-Schulwesens statt. In den 1980er Jahren kam daraufhin im Zuge der Frauenbewegung und Frauenforschung der Vorwurf auf, die „koedukative Schule erziehe … Mädchen zur Anpassung und Jungen zu Dominanzdenken“. Infolgedessen wurden viele Untersuchungen zu Geschlechterdifferenzen in Schule und Berufwahl durchgeführt. Auch wenn viele dieser Studien einer methodischen Kritik nicht standhalten konnten, schufen sie doch insgesamt ein Bewusstsein dafür, „dass das Geschlechterverhältnis auch in der Schule subtil wirksam ist … und dass die Orientierung an reinem Leistungsvergleich zwischen Jungen und Mädchen erheblich zu kurz greift“ (ebenda, S. 47).
Verfolgt man die in der Geschichte hervorgebrachten Argumente gegen die Koedukation, lassen sich zwei grobe Abschnitte unterscheiden. Die erste Phase fand bis circa Anfang oder Mitte des 20. Jahrhunderts statt. Es herrschte die Meinung vor, die Mädchen sollten höhere allgemeine Schulen nicht besuchen, weil diese sie überfordern würden und mit Dingen belasten, die sie für ihren späteren Lebensweg ohnehin ohne Nutzen sein würden. Außerdem befürchtete man bei einer gemeinsamen Beschulung eine Vermännlichung der Mädchen sowie dass die Jungen verunsichert und in ihren Leistungen beeinträchtigt werden könnten (ebenda S. 50).
Seit den 1980er argumentierte man hauptsächlich mit der Benachteiligung von Mädchen gegen die Koedukation. Die Mädchen müssten davor bewahrt werden, von „männlichem Denkstil und Schulorganisation dominiert zu werden, … um ihr auf ihre Leistungsmöglichkeiten bezogenes Selbstvertrauen auszubauen und ihr geschlechtstypisch verengtes Interessenspektrum zu erweitern“ (ebenda).
Laut Barbara Rendtorff wurde inzwischen nachgewiesen, dass sich ein Unterricht, der nach Geschlechtern getrennt ist, zu Gunsten der Schulleistungen der Mädchen auswirkt. Dieser positive Effekt ist allerdings in Hinblick auf die späteren Karrierechancen nicht von Dauer. Rendtorff plädiert für einen koedukativen Unterricht, der zu einer „Erweiterung des Interessenspektrums“ der Schüler führt „und die bekannten geschlechtstypischen Begrenzungen mildern könnte“, indem er „geschlechtertypisierenden Impulsen widersteht oder gar entgegenarbeitet“ (ebenda, S. 52f).
3. Ursache für Geschlechterdifferenzen: Erziehung oder Genetik?
Im Zusammenhang mit der Koedukationsdebatte steht die Frage nach den Ursprüngen der Geschlechterdifferenzen. Wie oben beschrieben war Frauen im 19. Jahrhundert durch ihre gesellschaftliche Position das Erreichen eines höheren Bildungsabschlusses unmöglich. Auch heute unterscheiden sich Männer und Frauen zu einem großen Teil in ihren gesellschaftlichen Rollen. Selbst wenn Frauen heute berufstätig sind, sind hauptsächlich sie für die Kindererziehung und Familienbetreuung zuständig. Die Fixierung der Frau auf die Mutterrolle, die zweifellos auf die Frühzeit der Menschengeschichte zurückgeht, war damals durchaus sinnvoll. In einer Zeit mit hoher Kindersterblichkeit sicherte eine hohe Geburtenrate das Überleben der Menschheit. Die hohe Sterblichkeitsquote unter Kindern brachte es mit sich, dass die Frauen den Großteil ihrer Lebenszeit mit dem Gebären und Aufziehen der Kinder verbrachten. Aus der Arbeitsteilung resultierte die Ungleichverteilung der gesellschaftlichen Macht (vgl. Richter, S. 14f).
Heute, nach Beseitigung der hohen Kindersterblichkeit und auch durch die Mittel der Empfängnisverhütung, gestaltet sich der Prozess des Kinderkriegens und des Aufziehens wesentlich kürzer und lässt sich weitestgehend zeitlich steuern. „Frauen haben … alle äußeren Möglichkeiten, sich wie die Männer zu verwirklichen und damit althergebrachte Machtverteilungen zu verändern. Dennoch finden diese Veränderungen nur sehr bedingt statt.“ (Richter, S. 14). Damit gehen Geschlechterdifferenzen in Verhalten und Leistung von Jungen und Mädchen einher, welche in der vorliegenden Arbeit ab Punkt drei eingehend betrachtet werden.
„Die Frage wie »gleich« Frauen und Männer sein können bzw. wie »verschieden« sie immer bleiben werden“, führt zu Erklärungsansätzen der Geschlechtersozialisation (ebenda). In der Literatur wird auf zwei sich gegenüberstehende Theorien hingewiesen, die die Ursachen für die Geschlechterdifferenzen in Verhalten und Leistung sowie für die Rollenverteilung zu ergründen versuchen (Kaiser 2003, S. 23f).
Zum einen gibt es den evolutionspsychologischen Erklärungsansatz, der seine Argumente aus der Biologie der Fortpflanzung ableitet. Vertreter dieser Theorie begründen, dass Frauen von Natur aus für Geburt und Aufzucht der Kinder biologisch ausgerüstet sind. Des Weiteren seien sie auch für soziale und kommunikative Verhaltensweisen vorbestimmt. Der evolutionspsychologischen Theorie zu Folge fehlen Frauen hingegen die Anlagen für Fähigkeiten wie Aggressivität und Leistungsmotivation, mit welchen Männer von der Natur ausgestattet seien (vgl. Richter S. 14f zitiert nach Hansen). Als Ausgangspunkte dieser Theorie dienen lediglich Studien zu Geschlechterdifferenzen, die Männer und Frauen hinsichtlich Durchsetzungsvermögen und Aggressivität sowie sozialem Verhalten untersuchten. Andere biologische Grundlagen wurden dabei außer Acht gelassen, weshalb die Erklärung durch die Natur wissenschaftlich nicht haltbar ist (vgl. Kaiser 2003, S. 24 zitiert nach Fausto-Sterling). Auch Untersuchungen in verschiedenen Kulturkreisen widerlegen diesen Erklärungsansatz, denn in anderen Kulturen konnten trotz gleicher Hormone vollkommen andere Geschlechterverhältnisse beobachtet werden (vgl. Kaiser 2003, S. 24).
Die einseitige biologische Betrachtung der Entstehung von Geschlechterdifferenzen hielt sich bis etwa 1950 in der Wissenschaft. Infolge der feministischen Bewegung wurde danach die gegensätzliche Theorie verbreitet. Diese sagte aus, Männer und Frauen würden sich von Natur aus nur in Merkmalen und Funktionen unterscheiden, die mit der Fortpflanzung zusammenhängen. Jegliche anderen Geschlechterdifferenzen wurden als Einfluss der Gesellschaft auf dem Menschen dargestellt (vgl. Richter S. 112).
Heute wird davon ausgegangen, dass Männer und Frauen ebenso von der Kultur, wie von der Natur beeinflusst werden und der Mensch keiner rein passiven Einwirkung durch gesellschaftliche Reize unterliegt (vgl. Richter S. 113). Das Erklärungsmodell, auf welches Astrid Kaiser näher eingeht, ist sozialisationstheoretisch. Wie der Begriff Sozialisation schon angibt, geht man bei diesem Ansatz nicht von einer reinen Prägung durch äußere Reize aus. Es sind vor allem auch die Jungen und Mädchen selbst, die aktiv an der Übernahme von Geschlechtermustern mitwirken. Das sozialisationstheoretische Erklärungsmodell beinhaltet mehrere Teiltheorien, deren jeweilige Anteile an der Geschlechtersozialisation wissenschaftlich noch nicht erwiesen sind. Im Folgenden sollen die sieben Detailtheorien nach Kaiser kurz wiedergegeben werden (vgl. S. 24):
Teiltheorie 1 besagt, dass die Vorbilder für die Kinder entscheidend sind, da sie durch diese lernen, was männlich und was weiblich sein soll.
In Teiltheorie 2 wird der Einfluss der Übung hervorgehoben. „Wenn wir Jungen nur Technikspielzeug geben und Mädchen Puppen, dann lernen sie auch die entsprechenden Verhaltensweisen“ (ebenda).
Teiltheorie 3 hebt die Rolle der Mütter für die Geschlechtersozialisation hervor. Mädchen fühlen sich in ihre Mütter ein und identifizieren sich mit ihnen, wogegen die Söhne sich von ihren Müttern eher abgrenzen, da sie merken, dass sie dem andern Geschlecht angehören.
Teiltheorie 4 stützt sich auf die Erwartungshaltungen, die Kindern von ihrer Umwelt vermittelt werden. Dabei ist entscheidend, dass wir eigene Erwartungen haben, was weiblich und was männlich ist und dies unterbewusst an die Kinder weitergegeben wird.
In Teiltheorie 5 wird die Herausbildung der Persönlichkeiten von Jungen und Mädchen auf die Arbeitsteilung der Geschlechter in der Gesellschaft zurückgeführt.
Teiltheorie 6 besagt, dass Kinder ihr Selbstbild formen, indem sie darauf achten, was von ihnen verlangt wird.
Die letzte Teiltheorie des sozialisationstheoretischen Ansatzes hebt auf die bestimmten Rollen ab, welche die Gesellschaft für die Geschlechter vorsieht. Die Geschlechterstereotypen werden danach durch „heimliche und offene Vorschriften und negative Begrenzungen, wenn ein Kind sich nicht entsprechend seiner Rolle verhält, … herausgebildet“ (ebenda).
4. Geschlechterdifferenzen
Als Geschlechterunterschiede werden charakteristische Differenzen zwischen Mann und Frau bezeichnet, denen – wie im vorigen Kapitel beschrieben – „sowohl biologische bzw. genetische als auch psychologische und soziologische Faktoren zugrunde liegen“ (Brockhaus, S. 405).
In den folgenden Punkten soll näher auf Geschlechterunterschiede, vor allem von Grundschulkindern, in einzelnen Bereichen eingegangen werden, die mit deren Verhalten, Interessen und Leistungen in Verbindung stehen. Dabei werden nicht nur Geschlechterunterschiede, welche das Schulleben betreffen, behandelt, da der Übergang von schulischem zu außerschulischem Verhalten fließend ist und sich wechselseitig bedingt.
4.1 Das Sozialverhalten
In der Literatur ist häufig die Rede von „zwei verschiedenartigen sozialen Welten, die die Geschlechter trennen“ (Kaiser 2003, S. 14 zitiert nach Petillon, S. 174). Auf diese beiden „Welten“ bezogen grenzen Wiltrud Thies und Charlotte Röhner die typischen Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen im Grundschulalter ganz drastisch voneinander ab. So ordnen sie Jungen beispielsweise „sich messen, Durchsetzungsvermögen erproben durch Raufen, Kämpfen, … Anfechten der Rangordnung“ und das Austragen von Konflikten durch körperliche Aggressionen zu (Kaiser 2003, S. 15 zitiert nach Thies/Röhner 2000, S. 38). Die „soziale Welt“ der Mädchen dagegen ist gekennzeichnet vom Erproben sozialer Nähe, ein „dichtes Netz sozialer Beziehungen“ sowie Konflikten aufgrund von Rivalitäten um Freundschaften zwischen den Mädchen (ebenda). Diese Konflikte werden vornehmlich verbal oder mittels sozialen Ausschlusses ausgetragen (vgl. ebenda).
Die Theorie von Jungen- und Mädchenwelten wird von der Tatsache bestätigt, dass Grundschulkinder es trotz der Koedukation bevorzugen, mit ihren jeweiligen Geschlechtsgenossen Freundschaften zu schließen (vgl. Völkl-Maciejczyk, S. 117). Die inneren Strukturen von Mädchen- bzw. Jungengruppen unterscheiden sich. Aus Jungen bestehende Gruppen sind häufig durch eine hierarchische Ordnung gekennzeichnet. Deshalb akzeptieren Jungen eher einen Platz in der Gruppe, selbst wenn dieser rangniedrig ist und erkennen somit die Überlegenheit eines anderen Gruppenmitgliedes an (vgl. Rendtorff, S. 17).
„Mädchen in Gruppen wird in vielen Studien dagegen ein größeres Interesse an gegenseitiger Anerkennung und einvernehmlichem Aushandeln von Interessen zugeschrieben“ (ebenda). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine aggressiven Auseinandersetzungen gäbe. Die Formen der Aggressivität sind lediglich unterschwelliger und deshalb für Außenstehende schwieriger zu beobachten (vgl. ebenda).
Lothar Krappmann und Hans Oswald untersuchten in ihrer Arbeit „Alltag der Schulkinder“ die Interaktionen von gleichaltrigen Mädchen und Jungen in der Grundschule. Dabei stellen sie fest, dass eine Geflechtbildung mit gleichgeschlechtlichen Mitgliedern geschieht, aber dennoch Interaktionen über die Geschlechtergrenzen hinaus stattfinden. In ihrer Studie unterscheiden sie sechs verschiedene Typen anhand der Art der Interaktion, die zwischen Mädchen und Jungen stattfindet. Dabei beziehen sie sich auf Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren (vgl. Völkl-Maciejczyk zitiert nach Krappmann; Oswald 1995, S. 201).
Als Typ eins werden die so genannten „Abstinenten“ aufgeführt. Dies sind Kinder, welche kaum in Interaktion mit Kindern des anderen Geschlechts treten. Bis zum Alter von 12 war die Anzahl der ‚abstinenten’ Kinder steigend und umfasste schließlich etwa 50% der Jungen und Mädchen.
Die „Guten PartnerInnen“ stellen den zweiten Typen dar. Sie gehen sachlich mit dem anderen Geschlecht um, vermeiden es also mittels Ärgerns oder Flirt auf Kinder des anderen Geschlechts zuzugehen. Mit zunehmendem Alter nahm ihre Anzahl ab. Es fanden sich nur wenige Zwölfjährige, die dieser Gruppe zugeordnet werden konnten.
Typ drei bezeichnet Jungen, die Mädchen ärgerten. Krappmann/Oswald bezeichneten diesen Typ als die „Piesacker“. Unter den Zehnjährigen ließen sich einige Jungen ausmachen, die dieser Gruppe angehörten.
Mädchen, welche nur negative Erfahrungen mit Jungen machten, wurden zu dem Typ vier gezählt: den „Geärgerten“. Nur wenige der zehnjährigen Mädchen zählten zu diesem Typ und ihre Zahl schwand mit zunehmendem Alter.
Die „Kämpferinnen“, der vierte Typ, besteht aus Mädchen, welche kaum mit Jungen spielten. Ihr Kontakt mit den männlichen Mitschülern war trotzdem groß, da sie Streitigkeiten schlichteten „und Jungen generell in ihre Schranken wiesen, manchmal auch mit Hieben“ (ebenda). Der Typ der „Kämpferinnen“ konnte fast nur unter den Zehnjährigen ausgemacht werden.
Der letzte Typ bezeichnet die „NeckerInnen“. Diese Kinder versuchten durch eine „Mischung von hilfreichem Entgegenkommen, scherzhaftem Engagement und neckischer Tändelei“ mit dem jeweils anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Die Anzahl der „NeckerInnen“ nahm besonders unter den Zehn- bis Zwölfjährigen zu (vgl. ebenda).
Weiterhin wurde festgestellt, dass bei den Jungen der Zweck von provokantem Verhalten den Mädchen gegenüber darin besteht, neue Kontakte herzustellen. Es ärgerten vorwiegend die Jungen ihre Mitschülerinnen, die keine enge Freundschaft zu anderen Jungen hatten. Die Mädchen dagegen schienen ihre vorhandenen Kontakte durch Neckereien nicht gefährden zu wollen (vgl. Völkl-Maciejczyk, S. 117 zitiert nach Krappmann; Oswald 1988, S. 59)
Während der Grundschulzeit verändert sich das Verhalten von Mädchen und Jungen zueinander. In der 1. Klasse interagieren Kinder des gleichen Geschlechts in etwa genauso häufig wie Kinder verschiedener Geschlechter. Gegen Ende der Grundschulzeit treten Mädchen dagegen dreimal so oft untereinander in Kontakt. Die Jungen der 4. Klassen interagieren sogar viermal so häufig mit anderen Jungen (vgl. Völkl-Maciejczyk, S. 117 zitiert nach Krappmann; Oswald 1988, S. 55).
4.2 Das Unterrichtsverhalten
Besonders im Kontext von Schule und Unterricht sind geschlechterspezifische Unterschiede hinsichtlich des Verhaltens von Jungen und Mädchen auffällig (vgl. Kaiser 2003, S. 22). So unterscheiden sich Schüler und Schülerinnen in ihrer Arbeitshaltung. Jungen gelten als irritierbarer und auffälliger. Sie sind auch weniger bereit sich einzuordnen und sind mehr um Dominanz bemüht. Das Verhalten der Schülerinnen ist „schulangemessener als das Schülerverhalten“ (Faulstich-Wieland 2004, S. 11).
Margret Weschke-Meißner nennt die Haltung der Schülerinnen den „stillen Beitrag der Mädchen zur Schulkultur“. Sie beschreibt, dass die Schülerinnen Atmosphäre schaffen, auf Gerechtigkeit achten, Arbeitsfähigkeit in gemischten Lerngruppen herstellen, weniger Lärm machen und allgemein das soziale Klima positiv beeinflussen (vgl. Völkl-Maciejczyk, S. 109 zitiert nach Weschke-Meißner, S. 90ff). Damit „erleichtern (Mädchen, S.F.) auch den LehrerInnen das Unterrichten, in dem sie Anweisungen … Folge leisten, sich weniger auflehnen, Behinderungen ihres eigenen Lernens zulassen …, seltener sofortige Zuwendung bei Problemen einfordern … und einiges mehr“ (Völkl-Maciejczyk, S. 109). Auch Thies/Röhner heben die Rolle hervor, der zumeist Schülerinnen im Unterricht gerecht werden: Es sind „Mädchen …, die für die Aufrechterhaltung der Arbeitskultur und des sozialen Klimas sorgen“ (Kaiser 2003, S. 15 zitiert nach Thies/Röhner, S. 177).
Schüler stören dagegen vergleichsweise häufig den Unterricht. Auch an reformierten Schulen ist nachgewiesen worden, dass es größtenteils Jungen sind, welche durch Nebengespräche und ähnliches den Unterricht stören. Damit verbunden ist, dass ein großer Anteil der Interaktion von Lehrer/innen und Jungen von Ermahnungen bestimmt ist (vgl. Kaiser 2003, S. 15).
Eine Hamburger Studie zu Verhaltensauffälligkeiten in Grundschulklassen zeigte die Problematik des geschlechterspezifischen Verhaltens besonders deutlich auf. Die Untersuchung, welche an etwa 100 Grundschulen durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass ca. 82,5 % der beobachteten Verhaltensauffälligkeiten von Jungen und nur 17,5 % von Mädchen ausgingen. Die untersuchten Verhaltensbereiche waren unter anderem Hypermotorik, Ungehemmtheit, das Nichteinhalten von Regeln, Dominanzverhalten und Aggression sowie mangelnde Spielkompetenz. Besonders in den Bereichen Hypermotorik und Ungehemmtheit bzw. Erregbarkeit war der Anteil der Jungen mit ca. 88,5 % sehr hoch (Kaiser 2003, S. 16f nach Daten des Arbeitskreises Schulentwicklung Hamburg 1993).
4.3 Die Leistungsmotivation
In der Alltagstheorie wird häufig davon ausgegangen, dass sich die Geschlechter in Bezug auf die Leistungsmotivation unterscheiden. Anlass zu dieser These bietet die Tatsache, dass sich in den gesellschaftlichen Spitzenpositionen nur wenige Frauen befinden. Dass Mädchen jedoch über die gesamte Schulzeit hinweg bessere Schulleistungen als Jungen erbringen, spricht gegen eine generell niedrigere Leistungsmotivation von Frauen. In der Literatur wird das Phänomen von besseren Schulleistungen von weiblichen Individuen und ihrer gleichzeitigen Unterrepräsentation in beruflichen Führungspositionen oft auf so genannte „Erfolgsangst“ zurückgeführt (vgl. Horner). Diese „Angst vor Erfolg“ wirkt leistungsmindernd und steht in Zusammenhang mit der Angst von Frauen vor der sinkenden Attraktivität für Männer (vgl. Richter, S. 32f).
Selbst im Bereich der Grundschule wurde bewiesen, dass eine „Erfolgsangst“ von Mädchen, wenn auch noch unterbewusst, vorhanden ist. Im Rahmen einer Untersuchung Lüdemanns erzählte eine Viertklässlerin, dass sie gerne „Reporterin“ werden wolle. Auf die Frage, was ihr Berufswunsch sein würde, wenn sie ein Junge wäre, antwortete das Mädchen „Reisebüroleiterin“. Sie begründete diese Aussage damit, dass sie als Frau nicht Chef sein wolle (vgl. Richter, S. 34 zitiert nach Lüdemann). Richter geht davon aus, dass die „Erfolgsangst“ des Kindes durch soziale Erfahrungen in dessen Unterbewusstsein verankert ist. Vermutlich kommen der Wunsch, dem anderen Geschlecht zu gefallen, und das damit verbundene niedrigere Leistungsmotiv aber erst ab der Pubertät zum Ausdruck (vgl. ebenda).
Eindeutig unterschiedlich ist die Kausalattribution der Geschlechter. Die Kausalattribution befasst sich mit der Ursachenzuschreibung eines Handlungsergebnisses. Betrachtet die handelnde Person die Ursache als internal, so sieht sie sich selbst als Verursacher des Ergebnisses. Eine externale Begründung bezieht sich dagegen auf die Umwelt als Verursacher. Durch die zusätzliche Unterscheidung in stabile und variable Faktoren, die ein Ergebnis bedingen, entstehen vier Begründungsmöglichkeiten für Leistungsergebnisse: Erfolg bzw. Misserfolg können mit der eigenen Begabung, der eigenen Anstrengung, der Aufgabenschwierigkeit oder mit dem Zufall begründet werden (vgl. Krapp; Weidemann, S. 229). Frieze stellte fest, dass Mädchen ihre Misserfolge eher mit eigenem niedrigen Können attribuieren. Erfolge führen sie dagegen auf externale Faktoren, wie leichte Aufgaben zurück. Misserfolge werden von Jungen dagegen größtenteils mit dem Zufall oder der Aufgabenschwierigkeit begründet. Erfolge attribuieren sie mehrheitlich mit ihrer Begabung (Richter, S. 34f zitiert nach Frieze).
4.4 Geschlechterdifferenzen im kognitiven Bereich
Zu allererst ist festzuhalten, dass es bezüglich der Intelligenzhöhe der Geschlechter keine Differenzen gibt. Die Frage nach geschlechterspezifischen Unterschieden in der Intelligenz gehört zu den ältesten in der Geschlechterforschung. Deshalb liegt eine Reihe von Studien vor, deren Ergebnisse aber keine Differenzen zwischen Männern und Frauen aufzeigen konnten. Zwar ergaben manche Untersuchungen eine nicht signifikant höhere Intelligenz eines Geschlechtes, doch wurden diese Ergebnisse durch Studien, in denen das andere Geschlecht im Vorteil war, relativiert (vgl. Richter, S. 60ff).
Trotzdem von einer gleichen Intelligenzhöhe der Geschlechter ausgegangen werden kann, gibt es Vermutungen über Differenzen in spezifischen kognitiven Fähigkeiten. Im Allgemeinen werden die visuellen Wahrnehmungsleistungen, insbesondere die räumliche Wahrnehmung, von Männern als besser angesehen. Frauen hingegen werden bessere sprachliche Leistungen zugeschrieben (vgl. ebenda).
Die Annahme, dass weibliche Individuen bei sprachlichen Aufgaben im Vorteil sind, konnte wissenschaftlich widerlegt werden. Dazu beruft sich Richter auf Ergebnisse des Tests für Medizinische Studiengänge TMS, welcher als Auswahlverfahren bei der Studienplatzvergabe eingesetzt wird. Nach Unterscheidung der einzelnen Aufgaben in die Dimensionen sprachfrei und sprachlich konnte kein Geschlechtereffekt hinsichtlich der sprachlichen Fähigkeiten ausgemacht werden (vgl. ebenda).
Laut Untersuchungen von Gage und Berliner sind Mädchen in ihrer verbalen Leistung überlegen, da sie im Durchschnitt „etwas früher sprechen lernen und eine größere Vielfalt von Wörtern gebrauchen“ (vgl. ebenda zitiert nach Gage/ Berliner). Dies führt allerdings nicht zu einem höheren sprachlichen Niveau am Schulanfang (vgl. Richter, S. 69).
Die Annahme einer männlichen Überlegenheit bezüglich der räumlichen Wahrnehmung wurde in einer Reihe von Untersuchungen bestätigt (vlg. Richter, S. 63 zitiert u. a. nach Garai/ Scheinfeld). Meist konnte der Vorsprung der Jungen und Männer jedoch erst ab der Pubertät nachgewiesen werden, wodurch sich die Überlegenheit „als Trainingseffekt durch geschlechterspezifische Alltagserfahrungen interpretieren“ lässt (ebenda).
In Hinblick auf die Konzentrations- sowie die Merkfähigkeit wurde ein relativ eindeutiger Vorsprung weiblicher Personen im Rahmen des Tests für Medizinische Studiengänge TMS nachgewiesen (vgl. Richter, S. 68 zitiert nach Trost).
4.5 Geschlechterdifferenzen in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften
Alltagstheoretisch wird Männern und Jungen eine höhere Kompetenz und auch ein größeres Interesse an mathematisch-naturwissenschaftlichen Gebieten zugeschrieben (vgl. Richter, S. 76). Diese Vermutung scheint sich beispielsweise in Statistiken von mathematischen Schülerwettbewerben zu bestätigen. So gingen 2006 aus dem Bundeswettbewerb Mathematik 18 Schüler, aber nur zwei Schülerinnen als Bundessieger/innen hervor (vgl. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft). Im Folgenden soll erläutert werden, inwieweit tatsächlich eine Überlegenheit der Jungen hinsichtlich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen vorliegt und worin sich diese gegebenenfalls begründet.
Anhand der Schulnoten lassen sich keine höheren Fähigkeiten von Jungen feststellen. Verschiedene Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Jungen und Mädchen gleich gute bzw. schlechte Mathematikzensuren haben (vgl. Richter, S. 76 zitiert nach Ferdinand; Hannover/ Scholz/ Laabs). In anderen Studien zeigte sich, dass Mädchen im Vergleich zu ihren männlichen Mitschülern sowohl bessere Mathematiknoten in Klassenarbeiten als auch auf ihren Zeugnissen erreichten. Allerdings muss dabei in Betracht gezogen werden, dass Schülerinnen „in allen Fächern (auch in Mathematik) beinahe ausnahmslos bessere Noten als Jungen (erhalten, S.F.), besonders in der Grundschulzeit“ (Richter, S. 77).
Trotz insgesamt gleicher Schulleistungen unterscheiden sich Jungen und Mädchen deutlich hinsichtlich ihres Interesses für Mathematik und die Naturwissenschaften. Schon am Ende des 5. Schuljahres, also bevor die meisten Schüler überhaupt in Physik unterrichtet wurden, sind Mädchen deutlich weniger an den meisten Bereichen der Physik interessiert als Jungen. Mit dem 7. Schuljahr nimmt das Interesse an den meisten Gebieten des Physikunterrichts zwar allgemein ab, bei Mädchen ist der Interessenverlust jedoch drastischer. Neben Physik zählen Mädchen durchschnittlich auch Chemie, Geographie und Mathematik zu den am uninteressantesten Schulfächern (vgl. Hoffmann 1993, S. 114 zitiert nach Hoffmann/Lehrke 1986).
Unterschiede im Verhalten beim Lösen von Mathematikaufgaben wurden dahingehend festgestellt, dass Mädchen dazu neigen länger über Lösungswege von Sachaufgaben nachzudenken, während Jungen eher nach dem Prinzip ‚trial and error’ vorgehen. Da Sachaufgaben meistens Bezug auf jungentypische Alltagserfahrungen nehmen, sind diese eher in der Lage Aufgaben mit zeitlicher Begrenzung erfolgreich zu lösen. Es lässt sich also auf die schnelleren Lösungsversuche der Jungen zurückführen, dass sie den Mädchen in dem Bereich Lösungszeit überlegen sind. Darunter leidet nach Sterns Untersuchung jedoch die Lösungsgenauigkeit, bei welcher die Schülerinnen im Vorteil sind (vgl. Richter, S. 80 zitiert nach Stern). Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die Mathematikdidaktikerin Inge Schwank, welch Denkstrukturen erforschte, die sich auf die Problemlösestile auswirken. Laut ihrer Studien lösen Jungen und Männer mathematische Probleme häufiger nach der funktionellen Struktur. Dabei steht „das Denken in Wirkungsweisen und Handlungsfolgen im Vordergrund“ (Rendtorff, S. 190). Diese Vorgehensweise ist besonders bei physikalischen und technischen Aufgaben von Nutzen und zeigt sich zum Beispiel, wenn Lösungsversuche durch Ausprobieren unternommen werden und aus den resultierenden Fehlern gelernt wird. Die prädikative Denkstruktur dagegen, welche eher auf Beziehungsgeflechte und Ordnungsprinzipien ausgerichtet ist, lässt sich meistens bei Mädchen und Frauen finden (ebenda zitiert nach Schwank).
Vergleicht man die Selbstkonzepte beider Geschlechter in Bezug auf Mathematik, zeigt sich, dass die Mädchen ihr mathematisches Können trotz objektiv gleicher Leistungen weniger zuversichtlich einschätzen als die Jungen. Sie neigen dazu, „Mathematik häufiger als ein schweres Fach“ einzuschätzen, „führten Erfolg weniger auf gute Fähigkeiten und Misserfolg stärker auf die eigene Inkompetenz zurück“ (Rentdorff, S. 187). Im Vergleich zu den Jungen erklärten sie Misserfolg weniger durch Anstrengungsmangel (ebenda).
Dieses geringe Selbstkonzept von Schülerinnen hinsichtlich ihres mathematischen Könnens kann man einerseits als einen allgemeinen Sozialisations-Effekt verstehen. Das heißt, dass sich die Selbsteinschätzung der Mädchen auf das „allgemeine Bewußtsein“ bezieht, in welchem „mathematisches Interesse … nicht zum Rollenbild der Frau paßt" (Richter, S. 78).
Andererseits betonen laut Rendtorff neuere Untersuchungen den Einfluss der ‚perzipierten Fremdeinschätzung’ auf das Selbstkonzept. Hierbei wäre also das, was die Schülerin glaubt, wie der Lehrer/die Lehrerin ihre Leistungen einschätzt, ausschlaggebend für ihre Selbsteinschätzung (vgl. Rendtorff, S. 188 zitiert nach Dickhäuser/Stiensmeier-Pelster, S. 184). Ungünstig wirkt sich das dann auf die Mädchen aus, wenn LehrerInnen „aufgrund ihrer geschlechtstypischen Erwartungen Mädchen weniger zutrauen als Jungen und ihnen für gute Leistungen eher begabungs-irrelevante, für schlechte Leistungen jedoch begabungs-relevante Rückmeldungen geben“ (Rentdorff, S. 188f zitiert nach Rustmeyer, S. 189).
Weiterhin wird häufig bemängelt, dass Sachaufgaben im Mathematikunterricht größtenteils „einseitig männliche Erfahrungsbereiche zum Inhalt haben“ (Richter, S. 83 zitiert nach Bettge). Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Aufgaben, die geschlechterstereotyp für Mädchen zugeschnitten wären auch eine höhere Lösungshäufigkeit hervorrufen würden. Ein Inhalt, der einen positiven Bezug und eine Vertrautheit hervorruft, würde jedoch das Interesse der Schülerin stärken und auch zu einem schnelleren Lösungstempo führen. Außerdem „verstärkt eine einseitig am männlichen Interessenspektrum ausgerichtete inhaltliche Füllung der zu bearbeitenden Aufgabe die stereotype gesellschaftliche Sicht, daß Mathematik ‚nichts für Mädchen’ ist“ (Richter, S. 84). Es lässt sich vermuten, dass dies wiederum negative Auswirkungen auf das mathematische Selbstkonzept von Schülerinnen zur Folge hat (ebenda).
4.6 Geschlechterdifferenzen in schriftsprachlichen Leistungen
Wie sich in der PISA Studie 2000 bestätigte, gibt es nicht nur in Mathematik ein geschlechtstypisches Leistungsgefälle, sondern auch in dem Bereich Lesekompetenz – hier allerdings zu Ungunsten der Jungen. Die Untersuchung stellte fest, dass in der Gruppe der schwächsten Leser zwei Drittel Jungen sind (vgl. Rendtorff, S. 189 zitiert nach Deutschem PISA-Konsortium).
In vielen Studien wurde zu ergründen versucht, ab wann sich erste Geschlechterdifferenzen hinsichtlich des Schriftspracherwerbs abzeichnen und in welchen Teilbereichen des Lesen- und Schreibenlernens sich die Leistungen von Jungen und Mädchen unterscheiden. 1992 untersuchte Sigrun Richter die Schriftspracherfahrungen von Schulanfängern. Die teilnehmenden Kinder bearbeiteten vier Aufgabentypen, bei denen das Aufschreiben von schon bekannten Buchstaben bzw. Wörtern, das Wiedererkennen vorgegebener Worte aus einer Reihe von Schriftbildern und das Markieren von diktierten Buchstaben getestet wurde. Die Mädchen zeigten in allen Aufgaben bessere Leistungen, jedoch waren nur die Ergebnisse in dem Bereich ‚eigene Wörter’ signifikant höher als bei den Jungen. Hierbei konnte Richter feststellen, dass die Schulanfängerinnen „fast doppelt so viele orthographisch richtige Wörter aufschreiben wie die Jungen, während die Unterschiede bei den anderen Aufgaben als zufällig anzusehen sind“ (Richter 1996, S. 96).
Ebenfalls mit den Fähigkeiten von Schulanfängern im Gebiet des Schriftspracherwerbs setzte sich Wolfgang Schneider auseinander. Er fand heraus, dass zum Schulanfang circa ein Drittel mehr Mädchen als Jungen lesen können (vgl. Richter 1996, S. 98 zitiert nach Schneider). Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass die frühlesenden Jungen in allen untersuchten Teilgebieten, wie beispielsweise Anzahl der gelesenen Texte, Lesegeschwindigkeit, Sinnverständnis und Lesegenauigkeit, durchschnittlich bessere Leistungen aufwiesen als die Mädchen. Es wird vermutet, dass die Jungen durch größeres Leseinteresse zum zeitigen Schriftspracherwerb motiviert waren und dieses Interesse auch der Grund für ihr besseres Abschneiden in den einzelnen Teilbereichen ist. Nachträgliche Einschätzungen der Eltern und Lehrer haben ergeben, dass bei den Mädchen im Gegensatz dazu eher die Nachahmung der älteren Geschwister bzw. der Eltern zu der frühen Lesefähigkeit führte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass interessenmotiviertes Lesenlernen zu besseren Leistungen führt, als solches, das sich durch Imitation entwickelt (vgl. Richter 1996, S. 98 zitiert nach Neuhaus-Siemon).
Im Gegensatz zu den sich nur gering unterscheidenden schriftsprachlichen Leistungen von Jungen und Mädchen zur Schuleinführung, wurde in vier unabhängigen Studien die signifikante Überlegenheit der Mädchen von in etwa der 2. Klasse bis zur 9. Klasse belegt (vgl. Richter 1996, S.101; vlg. auch Richter/Brügelmann 1994). Wie abrupt der Bruch in der Entwicklung der Jungen ist, zeigte sich beispielsweise, als die Schülerinnen und Schüler nach sechsmonatigem Schulbesuch diktierte Wörter, die nicht zu ihrem Übungswortschatz gehörten, verschriftlichen sollten. So wurde zusätzlich zu der Rechtschreibentwicklung auch die Einsicht der Kinder in die Logik der Schriftsprache überprüft. Die Ergebnisse bewiesen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Am Ende der 1. Klasse jedoch waren die Mädchen den Jungen sowohl im Verschriftlichen unbekannter Worte sowie in einem Grundwortschatzdiktat deutlich voraus (vlg. Richter 1996, S. 103).
Richter bietet zwei Begründungen auf die Frage, weshalb die Entwicklung der Mädchen im schriftsprachlichen Bereich ab der 2. Klasse scheinbar schneller verläuft. „Entweder werden im Verlauf der 1. und evtl. auch der 2. Klasse komplexere schriftsprachliche Fähigkeiten notwendig, über die männliche Individuen in geringerem Umfang verfügen“ (ebenda, S.104). Die andere Begründung ist, dass sich der Schriftsprachunterricht ab Ende der 1. bzw. ab der 2. Klasse „zunehmend von den Interessen der Jungen entfernt, sie also nicht mehr in demselben Umfang wie die Mädchen erreicht“ (ebenda).
Untersuchungen, welche sich auf die Inhaltsbereiche von schriftsprachlichen Unterrichtsmaterialen beziehen, bekräftigen die zweite Begründung für geringere Leistungen der Jungen. Umfragen zufolge beschäftigen sich Frauen und Mädchen bevorzugt mit Texten, die zwischenmenschliche Beziehungen zum Inhalt haben. Von Jungen und Männern werden dagegen lieber Sach- und Gebrauchstexte gelesen (vgl. Richter 1996, S. 333). Zwar ist die Studie Richters zu den Unterrichtsmaterialien nicht umfangreich genug, um repräsentativ zu sein, spiegelt jedoch trotzdem die Tendenz wieder, dass die von Jungen bevorzugten Inhaltsbereiche nicht ausreichend berücksichtigt werden (vgl. ebenda, S. 330). Die Texte der schriftsprachlichen Grundschulbücher greifen deutlich häufiger Inhalte auf, die Mädchen ansprechen. So wurden in den Fibeln vornehmlich Texte über Naturereignissen, nicht-technische und nicht-sportliche Spiele, positive Werte und Tiergeschichten gefunden. Die Themen Sport, Technik, kindliche Aggressionen und Ängste, welche Richter als bevorzugte Jungenbereiche hervorhebt, finden dagegen kaum Beachtung (vgl. ebenda, S. 327).
Inwieweit die Interessen des Schülers oder der Schülerin für den Inhalt Einfluss auf die Rechtschreibleistung ausüben, zeigte zuerst eine Studie Peter Mays. Er verglich in der „Hamburger Schreibprobe“ die Rechtschreibleistungen von Jungen und Mädchen bezogen auf einzelne Worte. Dabei stellte er fest, dass nicht allein die allgemeine orthographische Schwierigkeit eines Wortes oder die Übungshäufigkeit in der Klasse die Rechtschreibkompetenzen der Kinder beeinflusst. Auch die individuelle Bedeutsamkeit der Wörter für die einzelnen Kinder spielt eine große Rolle. So wurde beispielsweise das Wort „Geburtstagsgeschenk“ häufiger von Mädchen korrekt geschrieben, wogegen die Jungen „Schiedsrichter“ deutlich häufiger richtig schrieben (vgl. Richter 1996, S. 248 zitiert nach May).
Richter griff diesen Untersuchungsbereich im Rahmen ihres „Schreibvergleich BRDDR“ noch einmal auf, um in 4. und 5. Klassen genauer zu untersuchen, ob Jungen und Mädchen bei herkömmlichen Diktaten unterschiedliche Wörter öfter falsch schreiben. Die Studie wies nach, dass ca. 20% der Jungen und Mädchen solche Wörter häufiger richtig schreiben, deren Bedeutsamkeit dem Geschlecht des Schreibers zugeordnet war. Vergleicht man die Wortlisten, so ist festzustellen, dass die „Jungenwörter“ hinsichtlich ihrer Buchstaben- und Silbenzahl die schwierigeren Wörter waren. Auch diese Wörter wurden von den Jungen eher korrekt geschrieben, als Worte aus dem „weiblichen“ Bedeutungsbereich, welche orthographisch die einfacheren waren (vgl. ebenda, S. 250 ff).
Zu einem noch deutlicheren Ergebnis gelangte Brügelmann, welcher die Rechtschreibleistung von Jungen und Mädchen ebenfalls an Diktaten mit geschlechterspezifischem Wortmaterial prüfte. Er schätzte als für Jungen relevante Wörter ein: „ Torwart, Lokomotive, Schiedsrichter, Computer, Fahrrad, Polizist “ (Richter 1996, S. 253 zitiert nach Brügelmann). Als „Mädchenwörter“ sah er „Familie, Geburtstag, Pferde, süß, Frühstück, singen, Strumpf“ an (ebenda). Besonders Brügelmanns Untersuchungsresultate aus Deutschschweizer Klassen zeigten, welche Bedeutung das Interesse für die Rechtschreibleistung von Jungen hat. Alle ausgewählten „Jungenwörter“ wurden von den Jungen mit einem Vorsprung von 3,2% richtig geschrieben. Eine Ausnahme bildete lediglich das Wort „Fahrrad“. „Während die Diepholzer Jungen das Wort Fahrrad fast genauso oft richtig schreiben wie die Mädchen …, gibt es in der Deutschschweizer Stichprobe einen schon fast dramatischen Unterschied von 66,4% (Jungen) zu 81,4% (Mädchen)“ (Richter 1996, S. 253 zitiert nach Brügelmann, S. 124). Hier zeigt sich erneut der Einfluss des Alltagsinteresses auf die Rechtschreibkompetenz. Da man in der Schweiz nicht Fahrrad sondern Velo sagt, kann sich bei diesem Wort das Interesse der Jungen nicht auf ihre Rechtschreibleistung auswirken.
5. Die Geschlechtersozialisation in der Schule
Im Folgenden soll die Rolle, die die Schule in der Ausprägung von Geschlechterstereotypen einnimmt betrachtet werden. Dabei muss betont werden, dass selbstverständlich nicht allein die Schule und die Lehrerpersonen Geschlechterrollen erzeugen. „Die Schule setzt den Sozialisationsprozeß aber fort und baut ihn aus, vor allem aber setzt sie kein Gegengewicht im Sinne ihres offiziellen Auftrags“. (Richter 1996, S. 170).
5.1 Lehrerverhalten
„Lehrerinnen und Lehrer tragen zu Grenzziehungen und damit dem Konstruieren von Mädchen und Jungen als gegensätzlich bei“ (Faulstich-Wieland 2004, S. 16). Diese Konstruktion einer Geschlechteropposition vollzieht sich in Schule und Unterricht beispielsweise durch Sitzordnungen, Separierung nach dem Geschlecht im Sportunterricht oder auch durch Einteilung in Mädchen- und Jungengruppen während unterrichtlicher Spiele. Bei einigen solcher Situationen, in denen das Geschlecht als Aufteilungskriterium herangezogen wird, geschieht dies tatsächlich lediglich aus der „Funktion der Unterscheidung“ heraus, „die nicht auf die Unterschiede abhebt“ (ebenda, S.17). „Zugleich allerdings ist es durch diese Unterscheidung auch möglich, Fremdheit zu konstruieren – und damit die oppositionelle Zweigeschlechtlichkeit zu erhalten“ (ebenda).
LehrerInnen behandeln Jungen und Mädchen in mancher Hinsicht unterschiedlich, was sich zu einem großen Teil auf das oben erläuterte geschlechtertypische Verhalten in Unterricht und Schule zurückführen lässt. So zeigen Jungen „mehr Aggression und Unachtsamkeit. Fast nur Jungen (…) stören“, woraufhin die Lehrperson mit stärkerer Aufmerksamkeit ihnen gegenüber reagiert (Völkl-Maciejczyk, S. 106). „Jungen erhielten viel mehr Zuwendung, positive wie negative.“ (ebenda). Die häufigeren Lehrer-Schüler-Interaktionen im Vergleich zu den Lehrer-Schülerinnen-Interaktionen nennt Kaiser einen „weiteren Beleg für den heimlichen Lehrplan der Geschlechtererziehung“ (Kaiser 2004, S. 380). Dabei beruft sie sich auf internationale Untersuchungen der Interaktionsforschung, welche zu dem übereinstimmenden Ergebnis gelangen, dass Jungen im Unterricht wesentlich häufiger zu Wort kommen (Kaiser 2003, S. 15 zitiert u.a. nach Spender, Thies/Röhner). Gemäß diesen Studien wird den Mädchen im Durchschnitt ein Drittel und den Jungen zwei Drittel der Aufmerksamkeit des Lehrers bzw. der Lehrerin zuteil. Diese Verteilung wird von LehrerInnen und der Klasse in der Regel als der Normalfall angesehen. Das zeigt sich daran, dass sobald die Lehrkraft die Schülerinnen häufiger aufruft oder lobt, dieses Verhalten von Jungen und Mädchen als Bevorzugung der Mädchen betrachtet wird (vgl. Richter 1996, S. 169 zitiert nach Enders-Dragässer/Fuchs).
Eine Studie über die Rückmeldungen von LehrerInnen auf Leistungen von Jungen und Mädchen zeigte, dass auch hier Geschlechterunterschiede herrschen. Jungen wurden ihre Erfolge häufiger als Ergebnis ihres Könnens rückgemeldet. Mädchen erhielten hingegen eher Rückmeldungen, die auf ihre ordentliche Arbeitsweise und ihre Anstrengung hinwiesen. Hier lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen dem unter Punkt 4.3 beschriebenen Attribuierungsverhalten der Geschlechter und den Lehrerrückmeldungen erkennen. Die Reaktion der Lehrer auf Leistungen der SchülerInnen könnte folglich einer der Verursacher von unterschiedlichen Fähigkeitskonzepten der beiden Geschlechter sein (vgl. Richter 1996, S. 169 zitiert nach Rustemeyer, S. 57).
Mädchen werden in der Schule für ihr „weitgehend unterrichtskonformes Schulverhalten (…) durch Zensuren, Zeugnisse und Gesamtbeurteilungen“ belohnt und so in ihrer
„sozialbewusst-angepassten Persönlichkeitsstruktur“ bestärkt (Faulstich-Wieland 2004, S. 12; Zinnecker, S. 131). Jungen dagegen geraten durch ihr selbstbewusst-exzentrisches Verhalten eher in einen negativen „Handlungs-, Einstellungs- und Wahrnehmungszirkel“, „entfremden“ sich der Schule in Folge dessen und werden „zunehmend Opfer schulischer Sanktionsmechanismen“ (Zinnecker, S. 131). Eine Bestärkung erfahren die Jungen durch ihre Mitschüler, die das weniger schulangepasste Verhalten als männlich und unabhängig anerkennen (ebenda, S. 161).
Jürgen Zinnecker gibt zu bedenken, dass „sich die scheinbar den Frauen günstige Schulsituation als versteckte Hilfeleistung für die Ausbildung des dominierenden männlichen Geschlechtscharakters“ erweist (ebenda, S. 232). Für das spätere Berufsleben förderliche Eigenschaften, wie Selbstbewusstsein, Durchsetzungsdrang und Kühnheit, werden durch die schulische Situation bei Jungen gefördert. Mädchen dagegen üben in der Schule häufiger Eigenschaften wie Autoritätsgläubigkeit, Angst vor Strafe und Schüchternheit ein (vgl. ebenda, S. 228).
Richter betont, dass die Mädchen aber keinesfalls die einzigen Leidtragenden dieser Sozialisation sind. Die Jungen erlernen zwar größeres Selbstvertrauen, was ihnen für ihre spätere berufliche Laufbahn zugunsten sein kann, doch sie lernen nicht, sich mit eigenen Beschränkungen auseinanderzusetzen, mit Ängsten offen umzugehen und ihre Persönlichkeit demzufolge umfassend zu entwickeln (vgl. Richter 1996, S. 170 zitiert nach Schnack/ Neutzling).
5.2 Geschlechterrollen in Schulbüchern
In den 70er und 80er Jahren wurden gründliche Untersuchungen dazu durchgeführt, welche Rollen Männern und Frauen in Schulbüchern zugeschrieben werden. In Fibeln und Lesebüchern wurden Männer übereinstimmend in der Rolle des »Familienoberhauptes« dargestellt, welches einen Beruf ausübt, nicht im Haus tätig ist, die Familie ernährt und alle wichtigen Entscheidungen trifft. Der Frau wurde die Rolle der »fleißigen Hausfrau« zugeschrieben. Eine ähnliche Darstellung betraf auch die Jungen und Mädchen. In den Lesebüchern und Fibel waren die Jungen die Handlungsträger, wogegen die Mädchen in den Texten Nebenrollen einnahmen. Diese Rollenverteilung wurde auch in Lehrbüchern der Fächer Mathematik, Englisch und Biologie nachgewiesen (vgl. Richter 1996, S. 170f).
Ulrike Fichera erörterte das Problem der stereotypen Geschlechterrollen in Schulbüchern in ihrer 1996 erschienenen Publikation. Darin prangert sie an, dass der Großteil der Verlage an dem in ihren Lehrwerken dargestellten Geschlechterverhältnissen nichts geändert hätte (vgl. Kaiser 2003, S. 20 zitiert nach Fichera).
Richter hält dagegen fest, dass die neuere Schulbuchforschung Erfolge gezeigt hätte, was den Abbau von Geschlechterrollenstereotypen betrifft. Sie beruft sich dabei auf Veröffentlichungen Wedigs und Backes’ von 1990 bzw. 1989. Den Einfluss, den Geschlechterklischees in Schulbüchern auf die Sichtweise der SchülerInnen haben, schätzt Richter als gering ein. Zwar können in Lehrwerken dargestellte Geschlechterrollen die Orientierung der SchülerInnen an den Stereotypen verstärken, jedoch sind sie nicht als Verursacher zu betrachten (vgl. Richter 1996, S. 171). Es wird vermutet, dass die Aufgabenkontexte und ob sie den jeweiligen Interessen von Jungen und Mädchen gerecht werden (wie unter 4.5 und 4.6 dargestellt), eine entscheidendere Rolle bei der Geschlechtersozialisation spielen.
5.3 Weiblich dominierte Erziehung
Ziel ist es, die Entwicklungsspektren von Jungen und Mädchen zu erweitern, um stereotypen Einengungen entgegen zu wirken (vgl. Kaiser 2003, S. 21). Im Erziehungs- und Bildungswesen selbst besteht aber die geschlechtertypische Ungleichverteilung von Männern und Frauen. In Kindergärten, in der gesamten öffentlichen und privaten frühkindlichen Erziehung und Versorgung sowie in den Grundschulen finden wir eine deutliche Mehrheit an Frauen (vgl. Rendtorff, S. 21ff).
So belegte das Statistische Landesamt 2002 einen Frauenanteil von 85% unter den vollbeschäftigten Lehrkräften in Grundschulen (vgl. Brinck/Gerbert, S.108). Aus noch aktuelleren Statistiken des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen für das Schuljahr 2006/2007 ist ersichtlich, dass in diesem Bundesland die Ungleichverteilung noch drastischer ist. Von insgesamt 9.336 im Freistaat beschäftigten Lehrpersonen, sind nur 435 (5%) männlich (siehe Statistik in Anlagen). In Sachsen sowie in der gesamten Bundesrepublik haben die Grundschulen den niedrigsten Männeranteil, gefolgt von den Sonderschulen, den Realschulen und den Hauptschulen. Mit 52% männlichen Lehrkräfte ist das Gymnasium, welches höhere gesellschaftliche Wertschätzung und bessere Verdienstmöglichkeiten bietet, die einzige Schulart, in der das Geschlechterverhältnis in etwa ausgeglichen ist (vgl. Brinck/Gerbert, S.108).
Eine Ursache für die Ungleichverteilung von Männern und Frauen ist die traditionelle gesellschaftliche Arbeitsteilung, in welcher die Frau für den privaten Bereich und die kleinen Kinder zuständig ist. Es ist zu vermuten, dass dadurch die Vorstellung, Frauen seien besser für die direkte Arbeit mit kleinen Kindern geeignet, gewachsen ist. Auch die Frauen selbst scheinen ein größeres Interesse für die praktische und beziehungsorientierte Arbeit in der Schule zu haben, als für Leitungsfunktionen – übernimmt doch oft der einzige männliche Kollege das Amt des Schulleiters (vgl. Rendtorff, S. 21ff).
[...]
- Arbeit zitieren
- Susann Ficker (Autor:in), 2008, Möglichkeiten der Berücksichtigung der Geschlechterspezifika im Grundschulunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175987
Kostenlos Autor werden










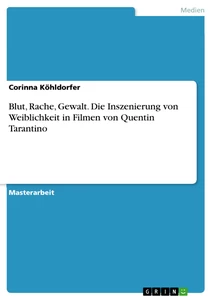






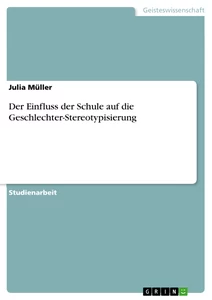


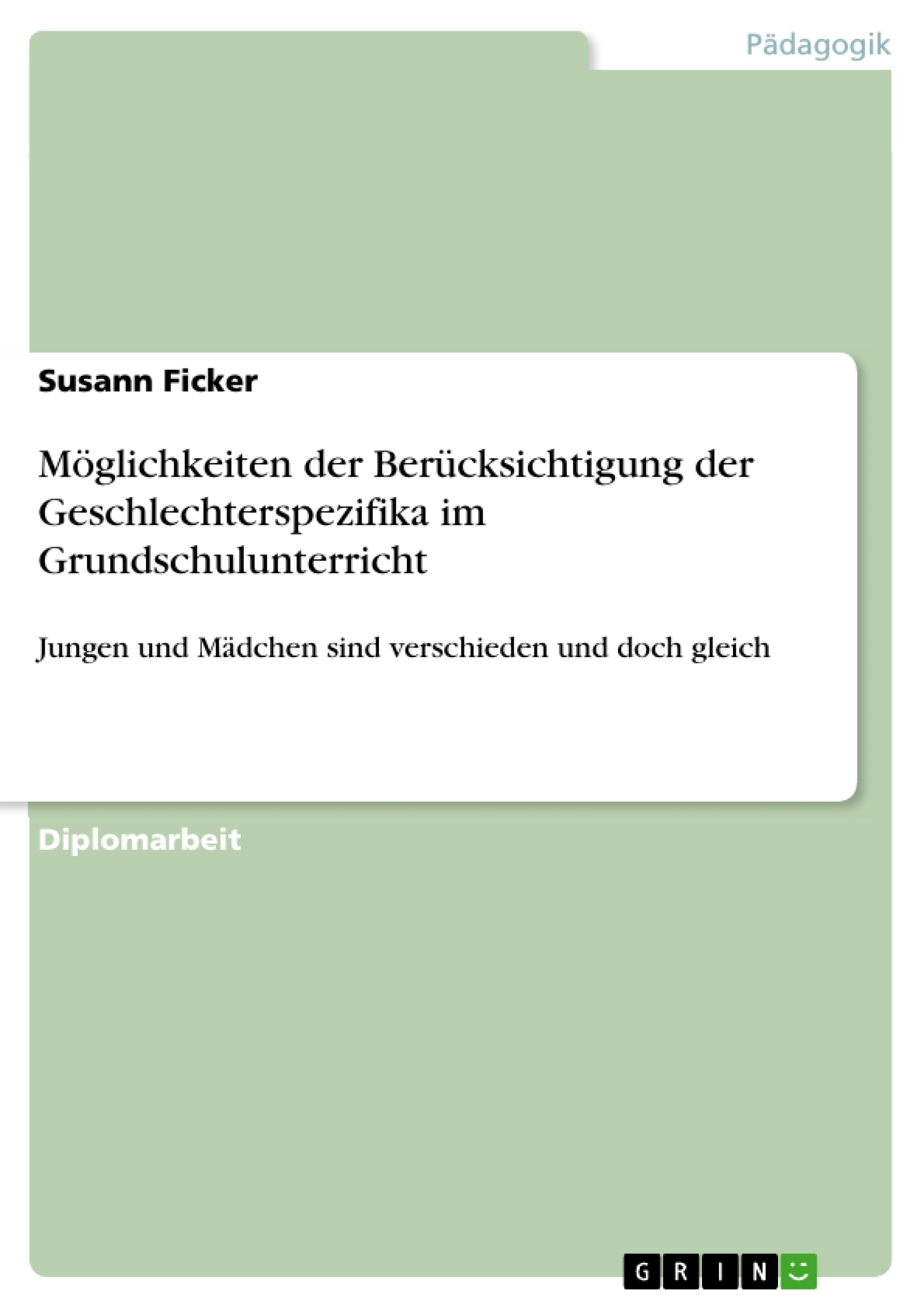

Kommentare