Leseprobe
Inhaltsangabe
Einleitung
Teil I: Theoretische Grundlagen
1. Diversität als Normalität - die Idee der Inklusion
1.1 Von der Integration zur Inklusion
1.2 Der Anspruch inklusiver Bildung
1.3 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
2. Spezifische Situation der schulischen Sprachheilpädagogik
2.1 Historischer Rückblick mit dem Fokus auf integrative Entwicklungen
2.2 Sprachheilpädagogisches Handeln im Unterricht
2.2.1 Konzepte sprachheilpädagogischen Unterrichts
2.2.2 Prinzipien sprachheilpädagogischen Unterrichts
Teil II: Diskurs
3. Stellungnahmen zur Inklusion aus der Sprachheilpädagogik
3.1 „Integration durch Rehabilitation“
3.2 Konzeption der Nichtaussonderung
3.3 Gestuftes System sprachheilpädagogischer Förderung
4. Risiken bei der Umsetzung inklusiver Bildung
4.1 Hindernisse durch bildungspolitische Strukturen
4.2 Verlust von Professionalität
4.3 Schwierigkeiten bei der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts
5. Chancen bei der Umsetzung inklusiver Bildung
5.1 Allgemeine Vorteile inklusiver Bildung
5.2 Chancen für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen
5.3 Möglichkeiten der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts
6. Grenzen in der Umsetzung inklusiver Bildung
6.1 Widersprüche und Einschränkungen
6.2 Voraussetzungen und Bedingungen
7. Fazit
7.1 Resümee
7.2 Stellungnahme und Ausblick
8. Quellenangaben
8.1 Literaturangaben
8.2 Zeitschriftenartikel
8.3 Internetquellen
9. Anhang
9.1 Schwerpunkte sprachheilpädagogischer Schulbildung in den Bundesländern
Einleitung
Aus der Perspektive einer angehenden Lehrerin nehme ich seit geraumer Zeit Veränderungen und Entwicklungen in der Schullandschaft und Bildungspolitik wahr. Debatten um den Begriff der Inklusion, seinen theoretischen Anspruch und seine Auswirkungen auf die Praxis sind in vielen Bereichen der Pädagogik zu vernehmen. Es bestehen vereinzelt Ansätze und Versuche, Schulen inklusiv zu gestalten. Diese Gestaltung stellt sich schnell als anspruchsvolle Aufgabe heraus; in der Praxis treten komplexe Schwierigkeiten auf und teilweise verläuft die Umsetzung aufgrund verschiedenster Faktoren in eine konträre Richtung. Hieraus entsteht vor allem auf Seiten der PraktikerInnen[1] Missmut und Frustration (vgl. Hinz 2002, S.357).
Die berufliche Zukunft der nachfolgenden LehrerInnengeneration ist durch die sich verändernden Strukturen der Schullandschaft ungewiss. SprachheilpädagogInnen stellen sich die Frage nach ihrem zukünftigen Einsatzort und Aufgabenfeld. Werden wir an einer Sprachheilschule[2] sprachtherapeutisch unterrichten, in einer Klasse in Kooperation mit RegelpädagogInnen im gemeinsamen Unterricht eingesetzt oder werden wir in mehreren Schulen beispielsweise als systemische BeraterInnen tätig sein? Diese Fragen bewegten mich dazu, die komplexe Idee[3] der Inklusion, mit all den Befürchtungen und Hoffnungen, die sie umgibt, zum Thema meiner Abschlussarbeit zu machen.
Der übergeordnete Anspruch der Inklusion ist die volle und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben (vgl. Albers 2010, S.52). Bei dem Versuch, das Konzept der Inklusion in die schulische Praxis zu übertragen, entstehen einerseits positive Reaktionen und kreative Ansätze zur Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts, andererseits vielschichtige Befürchtungen, Missverständnisse und Abwehrreaktionen.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen daher die Risiken, Chancen und Grenzen inklusiver Bildung aus der fachspezifischen Perspektive[4] der Sprachheilpädagogik. Hierbei geht es um die zentrale Ausgangsfrage, wie inklusive Bildung aus Sicht der Sprachheilpädagogik umgesetzt werden kann.
Zuerst werden im ersten Teil der Arbeit theoretische Grundlagen für den im zweiten Teil folgenden Diskurs erarbeitet. Im ersten Kapitel wird der Begriff der Inklusion in seinem Ursprung und seiner Entwicklung unter der Fokussierung seines theoretischen Anspruches erarbeitet. Kapitel zwei befasst sich mit der spezifischen Situation der Sprachheilpädagogik aus historischer und didaktischer Sicht.
Das darauf folgende Kapitel verschafft einen Überblick über aktuelle Positionen zur Inklusion aus der Sprachheilpädagogik. Anschließend werden sowohl Risiken (Kapitel vier) als auch Chancen (Kapitel fünf) inklusiver Bildung[5] aus der Perspektive der Sprachheilpädagogik[6] betrachtet. Grenzen, die durch Widersprüche zum Anspruch der Sprachheilpädagogik und fehlende Rahmenbedingungen entstehen, werden in Kapitel sechs erarbeitet. Schließlich soll der Diskurs im letzten Kapitel resümiert werden und ein Stellungnahme zur Thematik die Arbeit komplettieren.
Teil I: Theoretische Grundlagen
1. Diversität als Normalität – die Idee der Inklusion
1.1 Von der Integration zur Inklusion
Der Begriff der (schulischen) Integration ist mehrdeutig. Es existieren vielfältige Konzepte, die zum Teil sehr unterschiedlichen Ansätzen folgen oder verschiedene Schwerpunkte setzen. Bei Schöler beispielsweise steht die Nichtaussonderung und Normalisierung im Fokus, bei Feuser das „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“. Speck hingegen thematisiert die soziale Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen in alle Lebensbereiche (vgl. Braun 1999, S.217f.).[7]
Die Integrationsbewegung in Deutschland hat ihre Anfänge in den 70er Jahren. Das erste integrative Modellprojekt entstand 1975 an der Fläming-Grundschule in Berlin (vgl. Projektgruppe Integrationsversuch 1988, S.11). Die integrative Beschulung bildete zu diesem Zeitpunkt eine besondere Ausnahme. Denn die KMK[8] -Empfehlungen von 1972 sahen bei einer positiven Feststellung von „Sonderschulbedürftigkeit“ die jeweilige Sonderschule als einzigen Förderort vor (vgl. Albers 2010, S.60). Vor allem Eltern beeinträchtigter Kinder setzten sich immer wieder für Möglichkeiten einer integrativen Beschulung ein. Auch der Deutsche Bildungsrat verfasste 1973 Vorschläge zur gemeinsamen Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder. Ihre Forderung nach einem kooperativen Schulzentrum, das aus der Zusammenlegung von allgemeiner Schule und Sonderschule bestehen sollte, wurde zu jener Zeit nicht umgesetzt. Erst in den 90er Jahren nahmen integrative Bestrebungen auch außerhalb von Schulversuchen zu. Diese Entwicklung ist voranging auf die KMK-Empfehlung von 1994 zurückzuführen, die einen Paradigmenwechsel von der Feststellung der „Sonderschulbedürftigkeit“ zur Feststellung des „sonderpädagogischen Förderbedarfs“ vornahm. Bei der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ist die Förderung nicht mehr unmittelbar an die Institution Sonderschule gebunden, sondern kann auch an anderen Förderorten stattfinden (vgl. ebd., S.60ff.).
In den Bundesländern entwickelten sich verschiedene integrative Formen, beispielsweise das Konzept des gemeinsamen Unterrichts oder Kooperationen zwischen Grund- und Sonderschulen. Qualitätsprobleme der Integration wurden jedoch schnell deutlich. Die Integrationspraxis weicht häufig elementar vom theoretischen Anspruch der Integration ab, beispielsweise wird einseitig äußere Differenzierung als Methode genutzt, sodass eher neben- als miteinander gelernt wird (vgl. Hinz 2002, S.355, Sander 2001, S.4). „Der am häufigsten beschriebene Mangel in der Praxis der Integration besteht offensichtlich darin, dass sie als rein organisatorische, additive Maßnahme durchgeführt wird.“ (Sander 2001, S.4). Die Strukturen der Regelschule[9], der Unterricht und die Zuständigkeitsbereiche von Regel- und SonderpädagogInnen werden hierbei kaum verändert. Aufgrund der Kritik an der Integrationspraxis in Deutschland entsteht die Forderung nach einer erweiterten, verbesserten Integration. Diese Lücke füllt laut Sander das Konzept der Inklusion (vgl. Sander 2004, S.240).
Der Begriff Inklusion[10] ist ebenfalls in der Fachliteratur durch unterschiedliche und unpräzise Definitionen gekennzeichnet. Geprägt durch die Salamanca-Erklärung von 1994 und die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, in Deutschland seit März 2009 verbindlich, ist der angloamerikanische Begriff inclusion in Deutschland bekannt geworden. Beide Schriftstücke wurden jedoch in ihren deutschsprachigen Fassungen mit dem Begriff Integration übersetzt, was viele FachvertreterInnen bemängelten. Bis heute werden die Begriffe Inklusion und Integration häufig, auch in pädagogischen Fachkreisen, synonym verwendet (vgl. Sander 2004, S.240, Albers 2010, S.52). Sander kritisiert, „wer mit Inklusion nichts anderes sagen will als bisher mit Integration, der könnte eigentlich bei dem eingeführten Begriff bleiben und auf das neue Wort verzichten.“ (Sander 2004, S.240).
Laut Albers besteht die Unterscheidung von Integration und Inklusion darin, dass Integration die Eingliederung behinderter Menschen in ein bestehendes System anstrebt, Inklusion hingegen intendiert, nicht die Menschen sondern dass System durch Abbau von Barrieren anzupassen. Bei Integration sollen Menschen mit Beeinträchtigungen in die Gesellschaft integriert werden. Im Gegensatz dazu geht Inklusion davon aus, dass Menschen mit Beeinträchtigungen von Beginn an Teil der Gesellschaft sind (vgl. Albers 2010, S.53).[11]
Sander bezeichnet Inklusion als eine verbesserte Integration. Im Rahmen seines Konzepts inklusiver Pädagogik nimmt er eine systematische Einteilung vor, wie Zusammenhänge und Entwicklungslinien von der Integration zur Inklusion erläutert werden können.
Unter Inklusion I versteht er eine undifferenzierte Gleichsetzung mit Integration und folglich den synonymen Gebrauch der Fachbegriffe, wie er heute oft zu finden ist. Inklusion II ist bereits fortgeschrittener, Sander spricht von einer „von Fehlformen bereinigten Integration“ (vgl. Sander 2004, S.240ff.). Zu Fehlformen zählen Entwicklungen in der Praxis auf verschiedenen Ebenen, die der ursprünglichen Idee von Integration nicht mehr entsprechen. Es entsteht beispielsweise eine neue Art der Aussonderung, wenn häufig oder ausschließlich äußere Differenzierung als Methode genutzt wird. SonderpädagogInnen nehmen hierbei die Kinder mit Beeinträchtigungen aus dem Unterricht heraus und fördern additiv. Sowohl die SonderpädagogInnen als auch die RegelschullehrerInnen fühlen sich dadurch nicht für alle Kinder zuständig, der Unterricht bleibt frei von Veränderungen und die beeinträchtigten Kinder erfahren Stigmatisierung durch ihre gesonderte Gruppe. Zu Fehlformen können auch schulgesetzliche Ordnungen zählen, die Integration ausschließlich Kindern mit leichten Beeinträchtigungen zugänglich macht (vgl. ebd., S.241). Als Beispiel können hier die bayrischen Kooperationsklassen genannt werden, die als Voraussetzung für die Teilnahme an Integration die Umsetzung lernzielgleichen Unterrichts festlegen. Integrativer Unterricht ist somit nur für SchülerInnen zugänglich, die dem unveränderten Regelschulunterricht mit vereinzelten, temporären Unterstützungsmaßnahmen folgen können (vgl. Schneider 2004a, S.13). Ein weiteres Beispiel für „Verformungen des Integrationskonzepts“ sind zu erkennen, wenn kurzweilige Zusammenarbeit von Grund- und Sonderschule bereits als Integration gekennzeichnet wird (vgl. Sander 2004, S.241).
Unter Inklusion III versteht Sander eine verbesserte und umfassend erweiterte Integration. Der Unterricht und das gesamte Klassen- und Schulleben verändert sich schrittweise dahingehend, dass „die Unterschiedlichkeit der Kinder nicht mehr als Störfaktor betrachtet wird, sondern als Ausgangslage und auch als Zielvorstellungen der pädagogischen Arbeit.“ (Sander 2004, S.242). Die Heterogenität der SchülerInnen wird nicht nur wahrgenommen und akzeptiert sondern auch wertgeschätzt. Alle Kinder haben durch diese Leitidee das Recht, in ihren individuellen Bedürfnissen und Stärken gefördert zu werden. Sander konstatiert, „Inklusive Pädagogik kann sich nicht auf die Einbeziehung behinderter Kinder beschränken.“ (Sander 2004, S.242). Indem das Konzept der Inklusion eine erweiterte Zielgruppe (alle Kinder) und einen vergrößerten Aufgabenbereich annimmt, geht es über den Wirkungsbereich der Integrationspädagogik hinaus (vgl. ebd., S.242).
Historisch betrachtet kann das oben vorgestellte Konzept inklusiver Pädagogik als eine zukünftige Entwicklungsstufe interpretiert werden. In Anlehnung an Bürli, Wilhelm und Bintinger entwirft Sander ein Entwicklungsmodell der Beschulung behinderter Kinder mit fünf prägnanten Entwicklungsstufen (vgl. ebd.).
Die erste Entwicklungsstufe ist die Exklusion. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben keinen Zugang zur Schulbildung, sie werden vom Schulunterricht ausgeschlossen. Auf der Stufe der Separation werden behinderte Kindern in Sondereinrichtungen beschult. In der Entwicklungsphase der Integration besuchen SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf allgemeine Schulen mit Hilfe zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen. Inklusion bedeutet, dass alle Kinder in der allgemeinen Schule gemeinsam lernen. Vielfalt wird wertgeschätzt und bildet die Ausgangslage für die Unterrichtsplanung. Als letzte Stufe sieht Sander die Vielfalt als Normalität. Der Begriff der Inklusion wird überflüssig, da inklusives Denken selbstverständlich ist und nicht mehr ausdrücklich thematisiert werden muss (vgl. ebd., S.243).
Das deutsche Schulsystem befindet sich mehrheitlich noch auf der Entwicklungsstufe der Separation. Bevor deutsche Schulen die vierte Stufe der Inklusion erreichen, steht noch ein langer Entwicklungsprozess bevor (vgl. ebd.). Hinz macht darauf aufmerksam, dass sich die Prozesse der Integration und Inklusion in unterschiedlichen Phasen befinden (vgl. Hinz 2002, S.361). Integration befindet sich statistisch betrachtet noch am Anfang. Nicht einmal ein viertel aller Kinder mit Beeinträchtigungen werden integrativ beschult.[12] Die Gestaltung einer inklusiven Schule ist in Deutschland eine Zukunftsvorstellung. Lediglich vereinzelt, beispielsweise in Hamburg, können erste Versuche und Ansätze in Richtung inklusiver Bildung verzeichnet werden (vgl. ebd., S.357).
In der vorliegenden Arbeit soll der Begriff der Inklusion nach Sander bewusst benutzt werden. Aufgrund des vorherrschenden Integrationsbegriffs in der Literatur wird zum Teil versucht, integrative Konzepte zu modifizieren, damit eine Übertragung auf inklusive Konzepte möglich ist. Zeitgleich wird der Integrationsbegriff weiterhin dort genutzt, wo er mit Inklusion nicht vereinbar ist.
Im folgenden Abschnitt werden Grundbegriffe inklusiver Konzepte erläutert. Hierdurch soll der theoretische Anspruch der Inklusion verdeutlicht werden.
1.2 Der Anspruch inklusiver Bildung
Inklusion ist ein weitreichendes Konzept, welches sich nicht auf den Bereich Schulbildung beschränkt. Vielmehr geht es um die Entwicklung einer diskriminierungsfreien, nichthierarchischen und demokratischen Gesellschaft (vgl. Glück/Mußmann 2009, S. 212). „Inklusion setzt ein verändertes Verständnis von Normalität und Vielfalt in einer Gesellschaft voraus [...]“ (Albers 2010, S.52). Dieses Verständnis ist Gegenstand des „Diversity“-Ansatzes, der im Folgenden vorgestellt wird. Eine Konsequenz, die sich hieraus ergibt ist die Vermeidung von Etikettierungen durch systemisches Vorgehen.
„Diversity“-Ansatz
Die zentrale Grundlage der Inklusion ist der „Diversity“-Ansatz. Dieser geht von der Vielfalt der Menschen, von einer heterogenen Gesellschaftsstruktur aus. Heterogenität zeigt sich beispielsweise in den Bereichen Geschlecht, Alter, Sprache, Kultur, Ethnie, Nationalität, soziale Herkunft, kognitive Leistungsfähigkeit und körperliche Verfassung (vgl. Albers 2010, S.53, Glück/Mußmann 2009, S.212). Der Ansatz fordert auf, Diversität als Realität anzuerkennen und wertzuschätzen, denn „die Unterschiedlichkeit aller Menschen ist kein zu lösendes Problem, sondern eine Normalität – an diese Normalität wird das System angepasst und nicht umgekehrt“ (Albers 2010, S.53). Eine Übertragung dieses Leitsatzes auf das System Schule bedeutet, dass es die Schule ist, die sich an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder anpassen muss und nicht die Kinder, die sich an die Schule anpassen müssen.
Um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und gemeinsamen Lernen zu ermöglichen, ist ein umfassender Reformprozess notwendig. Das deutsche, mehrgliedrige Schulsystem ist für die Entwicklung einer inklusiven Schule kontraproduktiv (vgl. Albers 2010, S.53). Auch gegenwärtige Leistungsvergleiche wie PISA und TIMMS, die Schulqualität anhand von Schülerleistungen messen, stehen den Vorstellungen der Inklusion diametral entgegen. „Für die Schulen in Deutschland ist eine Qualitätsoffensive ausgerufen worden, die messbare Fachleistungen bevorzugt und menschliche Grundqualifikationen zu vernachlässigen droht.“ (Sander 2001, S.10). Durch die sehr eingeschränkte Auffassung von Schülerleistungen werden Bereiche wie soziale Kompetenzen, kooperative Fähigkeiten, interkulturelle Kompetenzen, aber auch individuelle Lern- und Leistungserfolge, die durch ein erfolgreiches gemeinsames Lernen gefördert werden, massiv vernachlässigt und damit auch aus dem Qualitätsprofil von Schulen ausgenommen (vgl. Sander 2001, S.10, Boban/Hinz 2003, S.20).
Die Annahme und Wertschätzung von Heterogenität bedingt auch ein methodisches Umdenken und ein verändertes Curriculum. Lehrkräfte müssen sich von der Illusion lösen, dass alle SchülerInnen das Gleiche in gleicher Zeit lernen und leisten können. Um binnendifferenziert und damit (zum Teil) auch lernzieldifferent arbeiten zu können, müssen Lehrpläne, Aufgabenformate und Unterrichtsformen verändert werden. Die überwiegende Orientierung an sozialen Bezugsnormen (z.B. Ziffernoten) widersprechen ebenfalls der Wertschätzung von Vielfalt. Das inklusive Konzept erfordert persönliche Rückmeldungen und individuelle Leistungsbewertungen (vgl. Sander 2004, S.243).
Um die Idee der Inklusion, dass jeder Mensch von Beginn an Teil der Gemeinschaft ist, umzusetzen, bedarf es einer starken Umorientierung der derzeitigen schulischen Integrationspraxis. Denn dort entscheidet in vielen Fällen Art und Grad der Behinderung darüber, ob ein Kind am gemeinsamen Unterricht teilnehmen kann oder nicht. „Es ist keine Qualifikation nötig für die Zugehörigkeit zum Gemeinsamen Unterricht, die über eine Diagnose von Mindestfähigkeiten erfolgen müsste [...]“ (Hinz 2002, S.356). Jedes Kind hat im Sinne der Inklusion ein Anrecht auf gemeinsames Lernen, es muss nicht erst beweisen, dass es integrationsfähig ist (vgl. Hinz 2002, S.356).
Aus dem „Diversity“-Ansatz ergeben sich die Vorgaben, Etikettierung zu vermeiden und systemisch zu arbeiten.
Vermeidung von Etikettierungen
Bereits seit den 70er Jahren wurden innerhalb der Integrationsdebatte behinderungsspezifische Terminologien von vielen FachvertreterInnen in Frage gestellt. Die angestrebte Überwindung des Behinderungsbegriffs gelang bis heute nicht. Da alle Begriffsdefinitionen der Sonderpädagogik vor dem Hintergrund von Normvorstellungen entstehen, wird durch die Begriffe immer eine Abweichung von der (Durchschnitts-) Norm gekennzeichnet. Diese defizitorientierte Sichtweise wirkt sich stigmatisierend aus. Die Abhängigkeit der Disziplin Sonderpädagogik vom Behinderungsbegriff ist darüber hinaus problematisch (vgl. Eberwein 2001,S.16ff.).
Nach dem inklusiven Grundgedanken der Diversität als Normalität verbietet es sich, stigmatisierende Etikettierungen an einzelnen Personen oder Gruppen vorzunehmen. Das (Sonder-)Schulwesen in Deutschland verfährt jedoch zur Zeit nach genau diesem Prinzip: Sonder- und Förderschule, Lernbehinderung, Lese-Rechtschreibschwäche und sonderpädagogischer Förderbedarf, um hier nur einige Etikettierungen zu nennen. Es spielt laut Hinz auch keine Rolle, ob die verwendeten Begriffe vermeintlich positiv gewählt werden, wie beispielsweise Integrationskind oder IntegrationslehrerInnen - es bleibt immer ein gewisses „Anderssein“ vorhanden und dieses wird implizit abgewertet (vgl. Hinz 2002, S.356f.). Administrativ muss ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt werden, um entsprechende Unterstützungsmaßnahmen zu erhalten. Da sich Etikettierungen immer stigmatisierend auswirken, auch wenn positiv gesehen dadurch einem Kind nach dem individuellen Bedarf Unterstützungsressourcen zugeordnet werden können, strebt die Vorstellung einer inklusive Schule ein System ohne Etikettierungen an. Ressourcen zur Unterstützung werden einer Klasse bzw. einer Schule pauschal zugeordnet. Das beinhaltet zugleich die Chance, dass jedes Kind die Möglichkeit hat Förderung zu erhalten, unabhängig davon, ob ein (vermeintlicher) Förderbedarf besteht oder nicht. Hierdurch könnten auch andere Gruppen, die Marginalisierungsgefahren ausgesetzt sind, beispielsweise mehrsprachige Kinder oder Kinder aus einem sprach- und schriftfernen Milieu, profitieren (vgl. Hinz 2002, S.356f., Hinz 2010, S.37).
Weitere Situationen der Etikettierung entstehen dann, wenn in der alltagstheoretischen „Zwei-Gruppen-Theorie“ Menschen in zwei Gruppierungen differenziert werden: behinderte Kinder - nicht behinderte Kinder, Kinder mit Deutsch als Muttersprache - Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, Kinder aus bildungsnahen - Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, Kinder mit – Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Bei diesen Einteilungen werden Hierarchien und gleichzeitig Abgrenzungen deutlich. Insbesondere in der Sonderpädagogik werden Gruppen auf gedanklicher Ebene in „der Norm entsprechend“ und „von der Norm abweichend“ geteilt (vgl. Hinz 2002, S. 357, Albers 2010, S.64). Das inklusive Konzept hingegen wehrt sich gegen dichotome Vorstellungen und geht von einer unteilbaren, heterogenen Lerngruppe aus. Innerhalb dieser Lerngruppe sind verschiedene Dimensionen von Heterogenität zu berücksichtigen wie beispielsweise Geschlecht, Sprache, Ethnie und sozialer Hintergrund (vgl. Hinz 2010, S.33). Kinder sollen stets in ihrer Ganzheitlichkeit gesehen werden und nicht auf einen Aspekt wie beispielsweise eine Lernbehinderung oder Deutsch als Zweitsprache reduziert werden (vgl. Boban/Hinz 2003, S.11).
Systemischer Ansatz
Das Konzept der Inklusion erfordert einen Wechsel der Blickrichtung. Von der einseitigen, (implizit) defizitorientierten Sicht auf das einzelne Kind hin zur ganzheitlichen Sicht auf das Kind und sein Umfeld. Von der Feststellungspraxis und personenbezogenen Zuteilung von Fördermaßnahmen für einzelne Kinder zur Nicht-Etikettierung und pauschalen Zuordnung von Unterstützungsressourcen für alle Kinder (vgl. Hinz 2002, S.357ff.).
Insbesondere der Begriff der Barrieren ist im Zusammenhang mit der Idee der Inklusion von zentraler Bedeutung. Der Fokus liegt nunmehr nicht auf der medizinisch diagnostizierten Störung des Kindes, sondern auf den Barrieren, die das Kind an einer vollen Teilhabe (be-)hindern. Barrieren können als ko-konstruierte Produkte eines gesellschaftlichen Interaktionskontextes angenommen werden, die beispielsweise in Beziehungen, Lerninhalten, Schul- und Unterrichtsstrukturen entstehen. Der „Index für Inklusion“ schlägt vor, statt den sonderpädagogischen Förderbedarf, Hindernisse für Lernen und Teilhabe als Ausgangspunkt anzunehmen (vgl. Glück/Mußmann 2009 S. 214, Boban/Hinz 2003, S.11f.).
Im Zentrum inklusiver Bestrebungen steht somit der Abbau von Barrieren, um gemeinsames Lernen und Teilhabe zu ermöglichen. Der systemische Ansatz verfolgt, im Gegensatz zum medizinischen Modell, nicht vorrangig „[…] die Veränderung von Menschen durch Therapie, Förderung und Ähnliches sondern hält das ganze Spektrum des Umfeldes für mindest ebenso bedeutsam.“ (Hinz 2010, S.42). Dieser Grundsatz birgt insbesondere für die Sprachheilpädagogik Schwierigkeiten, da diese sich zu großen Teilen auf Rehabilitation durch Sprachtherapie konzentriert (Verweis auf Kapitel 6.1).
Der systemische Ansatz bedingt auch eine Verschiebung der Zuständigkeiten. Im Rahmen einer inklusiven Schule sind alle PädagogInnen für alle Kinder verantwortlich. Die Forderungen, dass Inklusion im Zuständigkeitsbereich der allgemeinen Pädagogik liegt und dass die Sonderpädagogik ein verändertes Selbstverständnis entwickeln muss, schließen sich hieran an (vgl. Hinz 2010, S.39, Hinz 2002, S.359).
Der Anspruch Inklusion - Illusion oder Vision einer besseren Zukunft?
Die Grundlagen des inklusiven Konzeptes zeigen, dass der Anspruch, insbesondere hinsichtlich der Vision einer inklusiven Gesellschaft, die frei ist von Diskriminierung und Hierarchien, enorm hoch ist (vgl. Hinz 2010, S.34). Auf einer theoretischen, abstrakten Ebene denk- und vorstellbar, bei der Umsetzung in die Praxis jedoch mit komplexen, zum Teil unüberwindbaren Schwierigkeiten konfrontiert.
„Inklusion bedeutet Veränderung und einen nicht endenden Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller SchülerInnen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird.“ (Boban/Hinz 2003, S.10).
Es ergibt sich die Frage, ob hier purer Idealismus keine Chance gegen eine leistungs- und profitorientierte Gesellschaft hat, oder ob eine kraftvolle Idee, ein „positives Zukunftszenario“ geschaffen wird, das sich anzustreben lohnt (vgl. Sander 2001, S.10). Diese Frage wird im Anschluss des Diskurses, im Fazit erneut aufgegriffen.
1.3 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Die Menschenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13.12.2006 zur Ratifikation freigegeben. Eine Zustimmung zum Ratifikationsgesetz wurde zwei Jahre später durch Bundestag und Bundesrat vorgenommen. Der völkerrechtliche Vertrag ist seit dem 26.03.2009 in Deutschland gültig (vgl. Bielefeldt 2009, S.4).
In Artikel 24 werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Bereich Bildung konkretisiert. Das Recht auf Bildung wird hierin in vollem Ausmaß und mit allen daraus folgenden Konsequenzen für die Umgestaltung des Bildungssystems eingefordert.
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem[13] auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel […] Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. (Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen 2009, S.18)
Weitere Ziele sind u.a. die Entfaltung der Persönlichkeit, des Selbstwertgefühls, individueller Begabungen und Potenziale zu ermöglichen. Die Vertragsstaaten müssen gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht aus dem allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Es werden mehrere Bereiche benannt, in denen bestimmte Voraussetzung geschaffen werden müssen, damit die Rechte der Menschen mit Behinderungen verwirklicht werden können. Die Vertragsstaaten werden verpflichtet, die dafür notwendigen Maßnahmen und Vorkehrungen vorzunehmen (vgl. Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen 2009, S.18f.).
Die Kultusministerkonferenz reagierte Mitte 2010 in Form eines Diskussionspapiers auf die UN-Konvention. Für die Umsetzung der Rechte im schulischen Bereich sprechen sie die Zuständigkeit den Ländern und Kommunen zu. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass weitreichende Veränderungen nicht in kurzer Zeit erzielt werden können, zumal die Verwirklichung der Rechte in Konkurrenz zu anderen staatlichen Aufgaben steht. „Die Umsetzung des Übereinkommens ist damit als gesamtgesellschaftliches komplexes Vorhaben längerfristig und schrittweise angelegt.“ (KMK-Diskussionspapier 2010, S.2). Die KultusministerInnen erkennen die zentrale Rolle der Bildungspolitik bei der Umsetzung der Ziele der Konvention an. Sie weisen jedoch auch auf Grenzen schulischer Möglichkeiten hin. Als zentrale Aufgabe beschreiben sie die Gestaltung des Lernumfeldes der allgemeinen Schulen dahingehend, dass Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen Entfaltungsmöglichkeiten wahrnehmen können und ihnen eine vollständige Teilhabe ermöglicht wird. Hierbei sehen sie Veränderungs- und Entwicklungsbedarf u.a. in der Lehrerbildung, in der Schulorganisation und der Pädagogik. Neben dem allgemeinen Curriculum sollen auch individuelle Bildungs- und Entwicklungsbedürfnisse gefördert werden (vgl. KMK-Diskussionspapier 2010, S.2ff.). Für den Umgang mit diagnostischen Verfahren und Bewertung legen die KultusministerInnen fest: „Die Lernstands- und Leistungsmessungen sowie die Leistungsbewertung müssen auch in Bezug auf diese individuellen Ziele erfolgen“ (KMK-Diskussionspapier 2010, S.4).
Für die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die Zusammenarbeit von Sonderpädagogik und allgemeiner Pädagogik unbedingt geboten. In der Aus- und Fortbildung aller Lehrkräfte sollte der gemeinsame Unterricht zentraler Bestandteil sein, um Kompetenzen für den Umgang mit Vielfalt erwerben zu können. Nach dem Prinzip der Teilhabe, im Gegensatz zum Prinzip der Fürsorge, müssen Veränderungen von der vorschulischen Bildung bis hin zur Berufsausbildung stattfinden. Bei der Weiterentwicklung sonderpädagogischer Förderung und institutioneller Umgestaltung legen die KultusministerInnen keinen einseitigen Weg fest, sondern verweisen auf vielfältige Möglichkeiten. Beispielsweise können Förderschulen weiterhin als alternative oder ergänzende Lernorte genutzt werden, Kompetenz- und Förderzentren können zur stufenweisen Umgestaltung der allgemeinen Schule zur inklusiven Bildungseinrichtung verhelfen oder Förderschulen können sich für alle SchülerInnen eines Bezirks öffnen. Wichtig bei allen Formen ist, die Professionalität der SonderpädagogInnen sicher zu stellen und weiter zu entwickeln. Das Aufgabenfeld von Förderschulen, Kompetenz- und Förderzentren entwickelt sich weiter und erweitert sich beispielsweise in den Bereichen Kompetenztransfer, Qualitätssicherung sonderpädagogischer Förderung und Kooperation (vgl. ebd., S.5f.).
Bei der Entscheidung des Förderortes muss weiterhin der Wunsch von SchülerInnen und Eltern berücksichtigt werden. Des Weiteren ist bei der Wahl des bestmöglichen Lernortes für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Maßgabe des jeweiligen Bundeslandes entscheidend. Das Kindeswohl hat bei allen schulischen Entscheidungen stets Priorität. Die Basis sonderpädagogischer Förderung, unabhängig an welchem Förderort sie stattfindet, ist eine personen- und umfeldbezogene Diagnostik und der daraus entwickelte Förderplan (vgl. ebd., S.7).
„Die für Bildung Verantwortlichen nehmen die Herausforderung der Behindertenrechtskonvention an.“ (KMK-Diskussionspapier 2010, S.7). Durch dieses Statement bekräftigen die KultusministerInnen, dass sie die komplexen und vielfältigen Aufgaben, die bei einer langfristigen Gestaltung inklusiver Bildungseinrichtungen entstehen, wahrnehmen wollen. Der umfassende Veränderungsprozess erfordert beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit und zusätzliche personelle und materielle Ressourcen. Die KultusministerInnen fordern alle Beteiligte, beispielsweise private und kommunale Schulaufwandsträger sowie Organisationen von Menschen mit Behinderung, dazu auf, zusammen Rahmenbedingungen und Indikatoren für qualitativ hochwertigen gemeinsamen Unterricht unter Berücksichtigung aller Kinder zu erarbeiten (vgl. ebd., S.8ff.).[14]
2. Spezifische Situation der schulischen Sprachheilpädagogik
2.1 Historischer Rückblick mit dem Fokus auf integrative Entwicklungen
Die ersten Sprachheilschulen entwickelten sich vor ungefähr 100 Jahren mit der Intention, vorwiegend stotternden Kindern therapeutische Unterstützungen anzubieten, die sie in der Volksschule nicht erhielten. Ab 1928 konnten VolksschullehrerInnen Sprachheilpädagogik erstmals in Form eines Aufbaustudiums studieren. Nach der nationalsozialistischen Zeit, die das gesamte Sonderschulwesen zurückwarf, wurden Sprachheilschulen in den 60er Jahren wieder aufgebaut und schrittweise Professuren in der Sprachheilpädagogik besetzt (vgl. Motsch 2009, S.17).[15]
Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 1972, in denen das Feststellungsverfahren zur „Sonderschulbedürftigkeit“ eingeführt wurde, verstärkten die institutionelle Zuständigkeit der Sprachheilschulen für Kinder mit kommunikativen und sprachlichen Beeinträchtigungen. Hierdurch kam es zu einem erhöhten Ausbau des Sprachheilschulsystems. Bestrebungen einer gegenläufigen Bewegung, gemeinsamen Unterricht zu verwirklichen, waren aus der Sprachheilpädagogik kaum zu erkennen (vgl. Bielfeld 2006, S.13). Die Integrationsbewegung in Deutschland Mitte der 70er Jahre fand größtenteils ohne Mitwirkung der Sprachheilpädagogik statt. „Vertreter der Sprachbehindertenpädagogik verhielten sich gegenüber den Bemühungen um schulische Integration zunächst längere Zeit sehr zurückhaltend.“ (Sasse 2003, S.107). Anstatt Konzepte und Methoden zum gemeinsamen Unterricht zu entwickeln, legitimierte und verteidigte die Sprachheilpädagogik immer wieder die Sprachheilschule und ihren Erhalt (vgl. Sasse 2003, S.107). Gleichzeitig versuchte sie sich von anderen Disziplinen abzugrenzen, was ihr jedoch ohne eigenständige Didaktik bis heute schwerfällt. Bereits Mitte der 80er Jahre stellte Grohnfeldt die Frage nach zukünftigen Schwerpunkten der Sprachheilpädagogik. Diese könnten u.a. in der Weiterentwicklung der Sprachheilschule, in präventiver Förderung oder im integrativen Unterricht liegen (vgl. Motsch 2009, S.18f.).
Mit der KMK-Empfehlung von 1994 trat eine nachhaltige Veränderung in der Sonderpädagogik ein. Mit dem Paradigmenwechsel von der institutionellen hin zur personenorientierten Perspektive (Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs) ging ein Rückgang der Sprachheilschulen einher. Unterricht und Förderung im Förderschwerpunkt Sprache waren nun offiziell unabhängig vom Förderort, das heißt, die Institution Sprachheilschule stellte nicht mehr die einzige Möglichkeit zur kommunikativen und sprachlichen Förderung dar (vgl. Grohnfeldt 2004, S.17, Bielfeld 2006, S.13). Erst jetzt veränderte sich die Frage der Sprachheilpädagogik von einem kategorialen ob in ein methodisches wie Integration sprachbeeinträchtigter Kinder gelingen kann. Das an den Sprachheilschulen vorherrschende defizitorientierte Vorgehen - mit seinem Ursprung in der Medizin - und das damit einhergehende Therapieren der Symptome als zentrale sprachheilpädagogische Aufgabe, stand nun in der Kritik. Viele SprachheilpädagogInnen befürchteten, dass es im Zuge der Integration zu Enttherapeutisierung und Entprofessionalisierung der sprachheilpädagogischen Förderung kommen würde. Aufgrund dessen werden häufig nur diejenigen SchülerInnen für die Integration vorgeschlagen, die leichte sprachliche Auffälligkeiten zeigen, SchülerInnen mit komplexen sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen hingegen werden weiterhin an die Sprachheilschule verwiesen (vgl. Sasse 2003,S.107).
Der Strukturwandel der Sprachheilpädagogik zeigt sich in einer veränderten (Wahrnehmung der) Schülerschaft. Beim Ausbau der Sprachheilschulen vor 40 Jahren gingen die SprachheilpädagogInnen von einer homogenen Schülerschaft aus. Hierbei sollte es sich um Kinder handeln, die neben ihrer Sprachbeeinträchtigung eine normale Intelligenz aufweisen. Erst in den 80er und 90er Jahren fanden auch mehrfache und kognitive Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Sprachbeeinträchtigung in der Fachliteratur Beachtung (vgl. Sasse 2003, S.107f, Grohnfeldt 2008, S.216f.). Ein Wandel der Schülerschaft von einer (scheinbar) homogenen Gruppe stotternder SchülerInnen zu einer heterogenen Gruppe von SchülerInnen mit vielfältigen Störungsbildern, darunter häufig Spracherwerbsstörungen, vollzog sich in den vergangenen Jahrzehnten (vgl. Seiffert 2008, S.148f.). Heute finden sich oftmals Überschneidungen der Förderschwerpunkte Sprache mit den Förderschwerpunkten Lernen und/oder emotionale und soziale Entwicklung. Seit zehn Jahren ist auch ein Interesse der Sprachheilpädagogik an mehrsprachigen Kindern festzustellen (vgl. Sasse 2003, S.108, Grohnfeldt 2008, S.216f.). Darüber hinaus kann in den letzten zehn Jahren ein Bedeutungsgewinn der außerschulischen Sprachheilpädagogik beobachtet werden (vgl. Grohnfeldt 2004 S.18).
Aktuelle Formen sprachheilpädagogischer Integration
Da die Sprachheilschule von vielen ExpertInnen als Durchgangsschule klassifiziert wird, hat sie auch heute im Sinne der „Integration durch Rehabilitation“ weiterhin viele BefürworterInnen (Verweis auf Kapitel 3.1). Sprachheilpädagogische Einrichtungen sind in vielfältigen Formen und Modellen in den Bundesländern vertreten. Unterschiede finden sich auch in integrativen Organisationsformen wieder. Beispielsweise schaffte Bremen als einziges Bundesland 1998 alle Sprachheilschulen ohne vergleichbaren Ersatz ab. In Bayern wurden Sprachheilschulen abgebaut und der Mobile Sonderpädagogische Dienst (MSD) zur Unterstützung in Regelschulen eingesetzt, in Hessen hingegen kam es zu Neugründungen von Sprachheilschulen (vgl. Grohnfeldt 2004, S.18). Im Folgenden werden vier integrative Formen exemplarisch vorgestellt, wie sie im Bereich der schulischen Sprachheilpädagogik praktiziert werden (im Anhang befindet sich eine Übersicht zu den Schulformen der einzelnen Bundesländer).
Unter Einzelintegration ist die Förderung eines sprachauffälligen Kindes zu verstehen, das lernzielgleich in der Regelschule mit Unterstützung des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes (MSD) oder vergleichbaren Unterstützungssystemen unterrichtet wird. Hierbei kann die Förderung sowohl im Unterricht als auch additiv stattfinden. Die Aufgaben des MSD bestehen in der Diagnostik des sonderpädagogischen Förderbedarfs, Beratung von Eltern und LehrerInnen und Unterstützung der Schule durch angemessene Förderkonzepte (vgl. Schneider 2004 S.337).
Das Modell der Kombinationsklassen intendiert eine wohnortnahe Beschulung sprachauffälliger Kinder. Je 5-6 SchülerInnen mit sprachheilpädagogischen Förderbedarf werden in eine Klasse von 15-16 SchülerInnen ohne Förderbedarf integriert. Die Zuweisung von Ressourcen für die Förderung ist personenbezogen und liegt zwischen 1,6-2,58 Schulstunden pro Kind. Die SprachheilpädagogInnen werden in den Schulalltag mit einbezogen, ihre Stammschule bleibt meist die Sprachheilschule. Unterricht findet vorwiegend in Kooperation von Grundschul- und Sprachheilschullehrkraft statt (vgl. Schneider 2004b, S. 338, Zielke Bruhn 2002 S.56).
Kooperationsklassen sind eine Form von Integration, die in Bayern praktiziert wird. Sie ist mit dem Kombinationsklassen-Modell vergleichbar. Vorwiegend sind Kooperationsklassen für SchülerInnen mit sprachlichen Beeinträchtigungen geeignet, die nach dem Besuch einer Sprachheilschule in die Regelschule reintegriert werden sollen. Unterrichtet wird lernzielgleich in Form von Kooperation der Volks- und SonderschullehrerInnen. Zusätzlich können auch Kleingruppen-Settings genutzt werden (vgl. Schneider 2004b S.338).
Das Konzept der Integrativen Regelklassen stammt ursprünglich aus Hamburg. Es wird in Grundschulen von der ersten bis zur vierten Klasse für Kinder ohne und mit bestehenden Förderbedarf in Sprache, sozial-emotionale Entwicklung und Lernen angeboten. Die Klassenstärke ist auf 26 Kinder begrenzt. Die Zuordnung von sonderpädagogischen Ressourcen ist hier nicht personenbezogen, sondern erfolgt pauschal. Diese Verfahrensweise verhindert eine Etikettierung der SchülerInnen. Der Personalschlüssel liegt bei drei SonderpädagogInnen für acht Klassen zuzüglich der Vorschule (vgl. ebd., S.339).
Die derzeitigen Formen können den Anspruch einer inklusiven Beschulung nicht bzw. nur zu kleinen Teilen erfüllen. Lediglich die integrativen Regelschulklassen entsprechen beispielsweise dem Grundsatz einer Nicht-Etikettierung. Der oftmals lernzielgleiche Unterricht[16] und die Vorstellung, Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen müssen bestimmte Voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht mitbringen, widersprechen dem Konzept der Inklusion.
Im Folgenden wird der sprachheilpädagogische Unterricht als ein zentraler Aspekt sprachheilpädagogischer Professionalität herausgearbeitet. Das Kapitel soll als Grundlage für Überlegungen bezüglich eines inklusiven Unterrichts dienen.
2.2 Sprachheilpädagogisches Handeln im Unterricht
2.2.1 Konzepte sprachheilpädagogischen Unterrichts
Ein zentrales Thema sprachheilpädagogischen Unterrichts ist seit Jahrzehnten die Dualismusproblematik: In welchem Verhältnis stehen Therapie und Unterricht zueinander und wie können diese beiden zentralen Elemente, die gleichermaßen ihre Berechtigung haben, miteinander verbunden werden? (vgl. Grohnfeldt 2004, S.17).
Theoretische Konzepte und Modelle, die aus therapeutischen Kontexten stammen, lassen sich meist nur unzureichend auf den Unterricht übertragen. Hierbei müssen „Sprachheilpädagogen in der schulischen Praxis, […] klinisch-therapeutisches Wissen eigenverantwortlich an die Gegebenheiten im Schulalltag anpassen“ (Mayer 2009, S.108). Bisher kann nur das Konzept der Kontextoptimierung für Kinder mit grammatischen Beeinträchtigungen von Motsch hervorgehoben werden, das eine Verbindung von Therapie und Unterricht schafft und auch für eine größere Lerngruppe effektiv genutzt werden kann (vgl. Reber/Schönauer-Schneider 2009, S. 11). Es ergibt sich demnach auch die Frage nach dem Verhältnis von Therapie- und Unterrichtsgegenständen. Soll der Unterricht sich vorrangig am Lernziel oder am Therapieziel orientieren?
Beim sprachtherapeutischen Unterricht nach Braun ist das individuelle Therapieziel dem Lern- bzw. Bildungsziel des Unterrichts funktional untergeordnet. Das Arbeiten am sprachliche Therapieziel wird somit durch den Unterrichtskontext determiniert. Zum sprachtherapeutischen Unterricht zählt Braun „[...] jede organisierte Lehr- und Lernsituation, in der Bildungsinhalte – der allgemeinen Schule – vermittelt werden und zugleich auf die vorhandenen sprachlichen Beeinträchtigungen der Schüler eingegangen wird.“ (Braun 2004, S.42f.). Der sachliche Gegenstand, der vermittelt werden soll, muss hierbei so aufgearbeitet werden, dass SchülerInnen mit sprachlichen Beeinträchtigungen die erforderlichen sprachlichen Kompetenzen für die Bearbeitung mitbringen. Darüber hinaus muss es den SchülerInnen ermöglicht werden, am Unterrichtsgegenstand ihre sprachlichen Kompetenzen zu erweitern. Braun verortet den sprachtherapeutischen Unterricht in der allgemeinen Didaktik (vgl. Braun 2004, S.42ff.).
Der sprachassistierende Unterricht nach Seiffert intendiert dort anzusetzen, „[...] wo die sprachliche Selbstständigkeit des Schülers nicht gegeben ist.“ (Seiffert 2008, S.150). Ähnlich wie beim sprachtherapeutischen Unterricht liegt eine Orientierung am Unterrichtsgegenstand vor, therapeutische Ziele stehen in einer funktionalen Abhängigkeit zum Lernziel. Im Unterricht werden fehlende sprachliche Fähigkeiten kompensiert indem die Lehrkraft assistierend sprachliche oder sprachtherapeutische Unterstützung anbietet (vgl. Seiffert 2008, S.150f.).
Bei weiteren Konzepten liegt u.a. eine Orientierung am Therapieziel (Spezifische Sprachtherapie im Unterricht) oder an der Beziehungsgestaltung und Subjektzentrierung (Förderung des Sprachverhaltens und der Sprachemotion im Unterricht) vor (vgl. ebd., S.149ff.). Seit einigen Jahren ist laut Seiffert eine Entwicklung zum Begriff der Förderung zu beobachten, der sich innerhalb kontroverser Diskussionen schwer vom Therapiebegriff abgrenzen bzw. in Beziehung setzen lässt. Eine Unterscheidung kann in den ursprünglichen Zusammenhängen gesehen werden. Therapie ist stärker medizinisch geprägt, während Förderung eher pädagogisch zu verorten ist (vgl. ebd. S.147ff.).
Ein neuerer Ansatz, sprachheilpädagogischen Unterricht zu definieren, findet sich bei Reber/Schönauer-Schneider (2009). Der Begriff impliziert laut den Autorinnen sowohl pädagogische als auch heilpädagogische Anteile und schließt somit Förderung und Therapie mit ein (vgl. Reber/Schönauer-Schneider 2009, S.11). Sprachheilpädagogischer Unterricht wird von Reber und Schönauer-Schneider als Oberbegriff verstanden. Hierunter fallen einerseits Maßnahmen zur Sprachförderung, andererseits sprachtherapeutische Maßnahmen, die zur Unterstützung der Sprache des Kindes im schulischen Umfeld angeboten werden. Eine unverzichtbare, zu ergänzende Komponente des sprachheilpädagogischen Unterrichts ist die Individualtherapie (vgl. ebd. S.13).
Unter Sprachförderung verstehen die Autorinnen allgemeine, unspezifische Maßnahmen, die vorwiegend zur Prävention von Sprachstörungen eingesetzt werden. Diese können sowohl von SprachheilpädagogInnen als auch von ErzieherInnen und RegelschulpädagogInnen, die sich in diesem Bereich fortgebildet haben, für alle Kinder durchgeführt werden. Hierdurch können auch Kinder, die zur Risikogruppe im Bereich Sprache zählen, beispielsweise mehrsprachige Kinder oder Kinder aus einem sprach- und schriftfernen Milieu, von diesen Sprachfördermaßnahmen profitieren (vgl. ebd., S.13ff.). Maßnahmen der Sprachförderung reichen jedoch nicht aus, wenn Kinder bereits Beeinträchtigungen auf einer oder mehreren Sprachebenen ausgebildet haben. Hier greift der sprachtherapeutische Unterricht. Unter sprachtherapeutischem Unterricht verstehen Reber/Schönauer-Schneider (in Anlehnung an Dannenbauer) spezifisch geplante und wissenschaftlich begründete Interventionsmaßnahmen, die auf der Grundlage einer individuellen Förderdiagnostik von SprachheilpädagogInnen oder SprachtherapeutInnen durchgeführt werden (vgl. ebd. S.14). Das Konzept des sprachheilpädagogischen Unterrichts wird in der folgenden Abbildung noch einmal verdeutlicht.
[...]
[1] In der folgenden Arbeit kennzeichnet das Binnen-I, dass einer Personengruppe weibliche und männliche Geschlechter angehören.
[2] Zur besseren Lesbarkeit wird der Begriff „Sprachheilschule“ in der gesamten Arbeit als Synonym für alle derzeitigen Formen von Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ (Sprachbehindertenschule, Schule für Sprachauffällige etc.) verwendet. Ebenso wird der Begriff „Sprachheilpädagogik“ synonym zu anderen aus der Fachliteratur bekannten Termen wie bspw. Sprachbehindertenpädagogik benutzt.
[3] Der Begriff „Idee“ soll hier den theoretischen und abstrakten Aspekt hervorheben.
[4] An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Perspektive der Sprachheilpädagogik nur eine, z.T. spezifische Sicht auf das Thema Inklusion darstellt. Inklusion wird u.a. auch in der allgemeinen Pädagogik oder anderen sonderpädagogischen Fachrichtungen diskutiert.
[5] Die vorliegende Arbeit beschränkt sich hierbei, insbesondere bezüglich didaktischer Überlegungen, auf die Primarbildung (Elementar- und Sekundarbildung sowie Berufsausbildung können, aufgrund fehlender Literatur und Platzmangel, nur marginal mitgedacht werden). Aufgrund dessen wird im Folgenden als Bezugsgruppe oftmals Kinder genannt.
[6] Neben spezifisch-fachlichen Überlegungen, betreffen die Sprachheilpädagogik selbstverständlich auch allgemeine Überlegungen (u.a. in Kapitel 5.1) bezüglich der Umsetzung inklusiver Bildung.
[7] Aufgrund von Platzmangel kann hier nicht differenzierter auf den Integrationsbegriff eingegangen werden.
[8] Die Abkürzung KMK steht für Kultusministerkonferenz.
[9] Der Oberbegriff Regelschule umfasst allgemeinbildende Schulen wie Grund-, Gesamt-, Real- und Hauptschule sowie das Gymnasium. Ausgenommen sind alle Formen von Sonderschulen.
[10] In Kapitel 1.2 wird der Inklusionsbegriff differenzierter betrachtet.
[11] Die Definition von Integration, die innerhalb dieser Unterscheidung aufgezeichnet wird, weicht von dem Verständnis von Integration einiger IntegrationsvertreterInnen ab. Als Beispiel kann Feuser genannt werden (vgl. Hinz 2010, S. 41).
[12] Im Jahr 2008 besuchen lediglich 19% der Schüler und Schülerinnen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf „sonstige allgemeinbildende Schulen“ (vgl. Bildungsbericht 2010, S.70).
[13] Im englischen Original „inclusiv education system“ (vgl. Kritik an Übersetzung in Kapitel 1.1) (vgl. Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2010, S.34).
[14] Aufgrund von Platzmangel kann das Diskussionspapier an dieser Stelle nicht kritisch betrachtet werden.
[15] In Ermangelung inklusiver Modelle innerhalb der Sprachheilpädagogik wird an dieser Stelle die integrative Entwicklung aufgezeigt sowie derzeitige integrative Schulformen vorgestellt.
[16] Auch der Unterricht in der Sprachheilschule ist insofern lernzielgleich, dass nach dem Rahmenlehrplan unterrichtet wird. Jedoch bestehen in der Sprachheilschule aufgrund geringerer Klassenfrequenz und anderer Rahmenbedingungen mehr Möglichkeiten zur Individualisierung (Binnendifferenzierung).
[17] Aufgrund von Platzmangel wird auf einen systematischen Vergleich bzw. Bewertung der Konzepte verzichtet.
- Arbeit zitieren
- Anja Huballah (Autor:in), 2011, Inklusive Bildung in der Sprachheilpädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173180
Kostenlos Autor werden














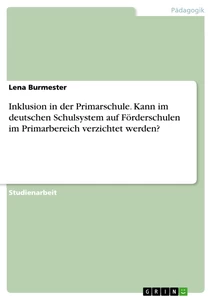


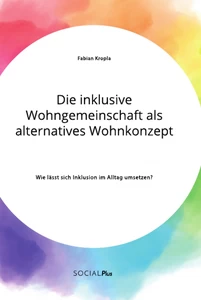




Kommentare