Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theorie
2.1 Werbung als Kommunikationsprozess
2.2 Werbung als Werbewirkungsprozess
2.2.1 Die behavioristischen S-R-Theorien
2.2.2 Die neobehavioristischen S-O-R-Theorien
2.3 Das klassische Konditionieren
2.3.1 Das klassische Experiment von Iwan P. Pawlow
2.3.2 Das klassische Experiment von John B. Watson
2.3.3 Zentrale Begriffe des klassischen Konditionierens
2.3.3.1 Der unkonditionierte Stimulus (UCS)
2.3.3.2 Die unkonditionierte Reaktion (UCR)
2.3.3.3 Der neutrale Stimulus (NS)
2.3.3.4 Der konditionierte Stimulus (CS)
2.3.3.5 Die konditionierte Reaktion (CR)
2.3.3.6 Extinktion (Löschung)
2.3.3.7 Konditionieren zweiter (höherer) Ordnung
2.3.3.8 Zeitliches Konditionieren
2.3.4 Die Stimulus-Substitutionstheorie
2.3.5 Die Theorie des Signallernens
2.3.5.1 Signallernen und evaluatives Konditionieren
2.3.5.2 Signallernen und zeitliches Konditionieren
2.3.6 Empirische Befunde aus dem Werbekontext
2.4 Zusammenfassung
2.5 Fragestellung und Hypothesen
3 Methoden
3.1 Versuchsplan
3.2 Experimentelles Stimulusmaterial
3.2.1 Auswahl und Gestaltung der Werbespots
3.2.2 Auswahl des Werbemediums Fernsehen
3.2.3 Festlegung der Darbietungshäufigkeit
3.2.4 Beeinflussung des Motivationsniveaus
3.2.5 Auswahl und Gestaltung des TV-Rahmenprogramms
3.2.6 Zusammensetzung und Anordnung der Werbeblöcke
3.3 Versuchsablauf
3.4 Operationalisierung der abhängigen Variablen
3.4.1 Einstellung zur beworbenen Marke
3.4.2 Relative Kaufabsicht
3.4.3 Erinnerung an die dargebotenen Werbespots
3.4.4 Einstellung zu den dargebotenen Fernsehwerbespots
3.5 Aufbau des Fragebogens
3.6 Stichprobe
4 Ergebnisse
4.1 Überprüfung der Markenbekanntheit
4.2 Markeneinstellung und relative Kaufabsicht
4.2.1 Deskriptive Darstellung der Ergebnisse
4.2.2 Überprüfung der Hypothesen
4.2.3 Einzelvergleiche (Kontraste)
4.3 Erinnerung an die gezeigten Werbespots
4.3.1 Deskriptive Darstellung der Ergebnisse
4.3.2 Überprüfung der Hypothesen
4.4 Einstellung zu den präsentierten Werbespots
5 Zusammenfassung und Diskussion
5.1 Zusammenfassung
5.1.1 Fragestellung und Hypothesen
5.1.2 Experimentelles Vorgehen
5.1.3 Ergebnisse
5.2 Diskussion
5.2.1 Interpretation der Ergebnisse
5.2.2 Kritik und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Informationsfluss in der fernsehmedialen Massenkommunikation
Abb. 2: Das behavioristische Modell der S-R-Theorien
Abb. 3: Das neobehavioristische Modell der S-O-R-Theorien
Abb. 4: Die vier Varianten des zeitlichen Konditionierens
Abb. 5: Die Phasen des klassischen Konditionierens
Abb. 6: Struktureller Aufbau der vier verwendeten Mystery Ads
Abb. 7: Struktureller Aufbau der vier erstellten Classical Ads
Abb. 8: Die einfache Präsentationssequenz
Abb. 9: Die fünffache Präsentationssequenz
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Versuchsplan
Tabelle 2: Anordnung der Werbespots bei fünfmaliger Darbietung
Tabelle 3: Markenbekanntheit vor der Untersuchung
Tabelle 4: Mittelwerte für die Marke „Hundeschule am Hammerberg“
Tabelle 5: Mittelwerte für die Marke „kondomshop.de“
Tabelle 6: Mittelwerte für die Marke „Osram“
Tabelle 7: Mittelwerte für die Marke „Siemens (mobile)“
Tabelle 8: Mittelwerte für die beiden unbekannten Marken
Tabelle 9: Mittelwerte für die beiden bekannten Marken
Tabelle 10: Übersicht der Kontrast-Koeffizienten
Tabelle 11: Kontraste für die Marke „Hundeschule am Hammerberg“
Tabelle 12: Kontraste für die Marke „kondomshop.de“
Tabelle 13: Erinnerung an den Spot „Hundeschule am Hammerberg“
Tabelle 14: Erinnerung an den Spot „kondomshop.de“
Tabelle 15: Erinnerung an den Spot „Osram“
Tabelle 16: Erinnerung an den Spot „Siemens (mobile)“
Tabelle 17: Mittelwerte AV „Einstellung gegenüber den Werbespots“
1 Einleitung
Stellen Sie sich die folgende Situation vor: Ein langer, harter Arbeitstag liegt hinter Ihnen als Sie spät abends endlich Ihre Wohnung betreten. Erschöpft lassen Sie Ihre Tasche mit einem geübten Handgriff in einer Ecke verschwinden. In der Küche bereiten Sie sich noch schnell ein kleines Abendmahl, bevor Sie sich schließlich mit einem schönen Glas Rotwein in Ihrem Lieblingssessel vor dem Fernseher niederlassen. Geistesabwesend schalten Sie das Gerät ein, um sich in den verbleibenden Minuten vor dem Schlafengehen noch ein wenig berieseln zu lassen. Während Sie in der Fernsehzeitung vergeblich nach einer Sendung suchen, die Sie ansprechen könnte, nehmen Sie eher beiläufig wahr, dass auf dem eingeschalten Sender einmal mehr Werbung gezeigt wird. Als Sie beim Studium des Programmheftchens nebenbei immer mal wieder zufällig auf den Bildschirm schauen, stellen Sie fest, dass schon wieder der Spot dieser Marke XYZ läuft, den Sie nun sicher zum hundertsten Mal sehen. Gelangweilt schauen Sie wieder in Ihre Zeitung, um vielleicht doch noch irgendwo eine interessante Sendung zu finden. Nach kurzer Suche werden Sie fündig und greifen zur Fernbedienung. Doch als Sie eigentlich schon umschalten wollen, stellen Sie erstaunt fest, dass Sie den gerade gezeigten Spot nicht kennen. In schönen Bildern wird Ihnen in dieser Werbung eine amüsante, gut inszenierte Geschichte erzählt, die im Hintergrund von einer verträumten Musik begleitet wird. Da Ihnen bisher weder eine Marke noch irgendwelche Produkte präsentiert wurden, ist Ihr Interesse geweckt und Sie fragen sich: „Was ist das?“ Gespannt schauen Sie weiter zu. Einige Sekunden später lösen die pfiffigen Werber das Rätsel auf, indem sie Ihnen gegen Ende des Spots das Logo der beworbenen Marke präsentieren. Lächelnd nehmen Sie zur Kenntnis, dass Werbung auch fesseln kann. Der nächste Werbespot beginnt. Anders als sein Vorgänger präsentiert Ihnen dieser Spots allerdings gleich zu Beginn die beworbene Marke. Plötzlich fällt Ihnen wieder ein, dass Sie doch eigentlich umschalten wollten. Sie schauen wieder in Ihre Zeitung. Ohne weiteres Interesse lassen Sie diesen Werbespot an sich vorüberziehen.
Diese Szene dürfte sich so oder so ähnlich allabendlich in vielen deutschen Wohnzimmern abspielen. Werbung ist in der heutigen Zeit zu einem omnipräsenten Begleiter unseres täglichen Lebens geworden. In machen Fällen widmen wir ihr unsere vollste Aufmerksamkeit, häufig nehmen wir sie eher beiläufig aus den Augenwinkeln wahr und in vielen Fällen beachten wir sie praktisch überhaupt nicht. Dennoch beeinflusst Werbung zu einem nicht unerheblichen Teil unser Denken und Handeln. Fazit: Werbung wirkt!
Fernsehwerbung kennt viele Facetten. Ohne im Detail auf die einzelnen Werbetechniken eingehen zu wollen, soll hier auf ein ganz besonderes Unterscheidungsmerkmal von Fernsehwerbespots hingewiesen werden, das den Ausgangspunkt für diese wissenschaftliche Arbeit darstellt und demzufolge einer näheren Betrachtung bedarf. Wie aus dem einleitend dargestellten Beispiel zu entnehmen ist, kann der Zeitpunkt, zu dem das Markenlogo zum ersten Mal dargeboten wird, von Spot zu Spot variieren. Aufgrund dieser Variation lassen sich im Wesentlichen zwei Gruppen von Fernsehwerbespots voneinander unterschieden. In der ersten Gruppe lassen sich all jene Werbespots zusammenfassen, die dem gewohnt klassischen Prinzip folgen, indem sie dem Zuschauer gleich zu Beginn des Spots die Marke bzw. das beworbene Produkt präsentieren. Der Zuschauer weiß in diesem Fall sofort, worum es geht. Erst im weiteren Verlauf des Spots wird ihm dann die eigentliche Werbebotschaft vermittelt. Die Spots, die diesem klassischen Design („erst Marke, dann Botschaft“) folgen, sollen im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Classical Ads bezeichnet werden. Die zweite Gruppe von Werbespots dreht dieses klassische Prinzip praktisch um. Hier wird zunächst die Werbebotschaft präsentiert, bevor gegen Ende des Werbespots das Markenlogo gezeigt wird. Da der Zuschauer aufgrund dieses konzeptionellen Vorgehens („erst Botschaft, dann Marke“) häufig bis kurz vor Ende des Spots darüber im Unklaren gelassen wird, um welche Marke es sich handelt, werden diese Spots im Folgenden als Mystery Ads bezeichnet.
Das Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, die Werbeeffizienz von Classical Ads und Mystery Ads im Rahmen einer empirischen Untersuchung unter kontrollierten Rahmenbedingungen einander gegenüberzustellen. Das experimentelle Vorgehen orientierte sich dabei möglichst nahe an der Realität und wurde deshalb wie folgt umgesetzt: Von vier bereits existierenden Fernsehwerbespots wurden jeweils zwei Versionen, ein Classical Ad und ein Mystery Ad, erstellt, die mit Ausnahme des Zeitpunktes der Logoeinblendung völlig identisch waren. Eingebettet in einen mit weiteren, irrelevanten Werbespots aufgefüllten Werbeblock wurden die jeweiligen Spot-Versionen den an der Untersuchung teilnehmenden Probanden dann als Unterbrecherwerbung im Rahmen einer vorher aufgezeichneten Sportsendung im sog. Splitscreen-Design präsentiert. Je nach Versuchsbedingung wurden dabei sowohl die Anzahl der Werbedarbietungen als auch das Motivationsniveau der Probanden, sich mit dem gezeigten Werbespot intensiv auseinanderzusetzen, gezielt variiert. Als Maße für die Werbeeffizienz wurden die Einstellung gegenüber den beworbenen Marken sowie die Erinnerung an die präsentierten Werbespots erhoben.
Zur Erklärung der Werbeeffizienz können die unterschiedlichsten psychologischen Modelle herangezogen werden, so auch das klassische Konditionieren. Jetzt mag bereits durch das Lesen des Wörtchens „konditionieren“ im Kopf des einen oder anderen Werbepraktikers das Erklingen eines imaginären Glöckchens ausgelöst werden, gefolgt von einem heftigen Protest gegen den Versuch, Konsumentenverhalten in der heutigen Zeit noch mit dieser als viel zu mechanistisch verschrienen S-R-Theorie erklären zu wollen. Mit diesem Verhalten ist zu rechnen. Die Ausführungen zu dem im zweiten Kapitel beschriebenen theoretischen und empirischen Hintergrund dieser Arbeit dürften jedoch deutlich werden lassen, dass das klassische Konditionieren noch lange nicht ausgedient hat und auch heute noch als geeignetes theoretisches Erklärungsmodell für bestimmte Bereiche des Konsumentenverhaltens herangezogen werden kann. In dem dritten Kapitel dieser Arbeit werden im Anschluss daran dann das methodische Vorgehen und das Versuchsdesign der experimentellen Untersuchung erörtert, bevor im vierten und fünften Kapitel die gefundenen Ergebnisse beschrieben, zusammengefasst und diskutiert werden.
2 Theorie
Im Marketing werden heute für gewöhnlich vier konkrete absatzpolitische Instrumente unterschieden, mit denen erwerbswirtschaftliche Unternehmen Einfluss auf das Geschehen am Markt nehmen können (vgl. z.B. Fritz & von der Oelsnitz, 1998). Es handelt sich hierbei um die Produkt-, Preis-, Distributions- und die Kommunikationspolitik, die in betriebwirtschaftlichen Kreisen häufig auch als „die 4 P des Marketing-Mix“ (Product, Price, Place, Promotion) bezeichnet werden (vgl. z.B. Kotler & Bliemel, 1995). Während die drei erstgenannten Instrumente hier nicht weiter beachtet werden sollen, wird zu Beginn dieses Kapitels zunächst kurz auf das „Sprachrohr des Marketing“ (Nieschlag, Dichtl und Hörschgen, 1997), die Kommunikationspolitik, eingegangen, zu deren Werkzeugen unter anderem die Werbung zählt.
Nach Ansicht von Fritz & von der Oelsnitz (1998, S. 172) sind kommunikationspolitische Maßnahmen für Unternehmen unerlässlich, da nichts verkauft werden kann, sei es auch noch so gut, was dem Konsumenten nicht bekannt ist. In den Bereich der Kommunikationspolitik fallen daher per definitionem sämtliche Maßnahmen, die Informationen über Dienstleitungen, Produkte oder das kommunizierende Unternehmen selbst vermitteln und mit denen der Versuch unternommen wird, Konsumenten in einer vordefinierten Art und Weise zu beeinflussen (Fritz & von der Oelsnitz, 1998; Kroeber-Riel, 1993). Dass die kommunikationspolitischen Maßnahmen dem Unternehmen oft nicht den gewünschten Erfolg bringen, mag einerseits an den Eigenarten der jeweiligen Kommunikationsmaßnahme liegen, andererseits wird aber auch häufig genug der in der Kommunikationssituation vorherrschende Kontext nicht beachtet.
Werbung wird im Allgemeinen zu den klassischen Instrumenten der Kommunikationspolitik gezählt (Fritz & von der Oelsnitz, 1998). Ihre wesentlichen Aufgaben bestehen aus Sicht des kommunizierenden Unternehmens darin, Konsumenten mithilfe geeigneter Werbemittel gezielt zu informieren und zu beeinflussen (Nieschlag et al., 1997; Rogge, 2000). Grundsätzlich kann dabei die Direktwerbung von der Mediawerbung unterschieden werden (Fritz & von der Oelsnitz, 1998). Während die Direktwerbung versucht, den Konsumenten beispielsweise durch namentlich adressierte Werbebriefe individuell anzusprechen und somit in einen direkten Dialog mit ihm zu treten, konzentriert sich die Mediawerbung auf die gängigen Massenmedien, wie z.B. Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen. Fernsehwerbung kann somit als eine Form der Massenkommunikation angesehen werden (Badura & Gloy, 1972; Frindte, 2001). Eine wesentliche Besonderheit der Massenkommunikation, auf die in Kapitel 2.1 noch einmal eingegangen wird, stellt der einseitige Informationsfluss dar.
Wie bereits angesprochen wurde, soll Werbung informieren und beeinflussen. Werbung ist demnach auf bestimmte Ziele ausgerichtet. Diese können sowohl ökonomischer als auch vor- oder außerökonomischer Natur sein (vgl. z.B. Fritz & von der Oelsnitz, 1998; Mayer, 1993). Zu den ökonomischen Zielen zählen z.B. die Steigerung des Umsatzes, das Gewinnwachstum sowie der Ausbau des Marktanteils. Als außerökonomische Ziele können beispielsweise die Steigerung des allgemeinen Bekanntheitsgrades oder die positive Veränderung der Einstellung gegenüber der beworbenen Marke verstanden werden. Ein weiteres wichtiges außerökonomisches Ziel stellt die Verbesserung der Erinnerungsleistung an die beworbenen Produkte dar, die am Point of Sale (POS) schließlich dazu führen kann, dass der Konsument das beworbene Produkt leichter erinnert bzw. wieder erkennt und dadurch eher geneigt ist, dieses Produkt zu kaufen. Dieser letzte Punkt macht deutlich, wie eng die beiden Zielkategorien miteinander verbunden sind. Da sich die außerökonomischen Ziele überwiegend auf Prozesse konzentrieren, die sich im Kopf – oder im Bauch – des Konsumenten abspielen, können diese auch als psychologische Ziele der Werbung bezeichnet werden (Mayer, 1993).
Um die angesprochenen Werbeziele, sein es nun ökonomische oder psychologische, erreichen zu können, müssen die von dem kommunizierenden Unternehmen in den Markt gesendeten Informationen zunächst einmal von den Konsumenten empfangen und entschlüsselt werden. Werbung kann daher als Kommunikationsprozess verstanden werden. Aus Sicht des Unternehmens dürfte es allerdings eher unbefriedigend sein, wenn die Konsumenten die Informationen zwar empfangen, sich daraus aber keine weiteren Konsequenzen ergeben. Zumal damit die oben bereits angesprochene zweite Aufgabe der Werbung, die gezielte Beeinflussung der Konsumenten, noch lange nicht erfüllt wäre. Werbung muss daher zusätzlich als Wirkungsprozess verstanden werden. Sowohl auf den Kommunikations- als auch auf den Werbewirkungsprozess soll in den nachfolgenden Kapiteln 2.1 und 2.2 kurz eingegangen werden.
2.1 Werbung als Kommunikationsprozess
Werbung ist Kommunikation. Ohne hier zu tief in die Kommunikationswissenschaften eintauchen zu wollen, lassen sich grundsätzlich vier Strukturelemente identifizieren, die an einem Kommunikationsprozess beteiligt sind: ein Sender, seine (Werbe-) Botschaft, ein Übertragungskanal oder ‑medium und ein oder mehrere Empfänger (vgl. dazu z.B. Haseloff, 1975; Lasswell, 1960; Mayer, 1993; Shannon & Weaver, 1949). Um das Beziehungsgeflecht, das zwischen diesen vier Elementen besteht, vereinfacht darstellen und erklären zu können, wurden in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen Kommunikationsmodelle entwickelt. Einen der wohl bekanntesten Ansätze stellt das klassische Kommunikationsmodell von Shannon & Weaver (1949)[1] dar, dessen wesentliche Grundannahmen im Folgenden kurz vorgestellt und anschließend auf den Kontext der fernsehmedialen Massenkommunikation angewendet werden sollen.
Shannon & Weaver (1949) gehen in ihrem ursprünglich für die Beantwortung technischer Forschungsfragen aus dem Bereich der Informations- und Nachrichtentechnik konzipierten Kommunikationsmodell davon aus, dass ein Sender seine auf eine bestimmte Art und Weise kodierte Botschaft über einen geeigneten Nachrichtenkanal an einen Empfänger schickt und dieser die empfangene Botschaft dann seinerseits zunächst richtig dekodieren muss, um sie zu verstehen. Diverse Störeinflüsse, die nach der Ansicht von Shannon & Weaver (1949) allerdings auf den Übertragungskanal beschränkt sind, können eine fehlerfreie Übermittlung der Botschaft behindern oder sogar gänzlich vereiteln.
Drei wichtige Bedingungen lassen sich aus diesem Modell für das erfolgreiche Zustandekommen eines Kommunikationsprozesses ableiten. Zunächst einmal müssen Sender und Empfänger für die Kodierung und Dekodierung der gesendeten Botschaft dasselbe Zeichensystem verwenden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Verständnisproblemen kommen. Zweitens muss der Sender einen geeigneten Kommunikationskanal für die Übertragung seiner Botschaft wählen, der von den Empfängern auch entsprechend genutzt wird. Dieser zweite Punkt ist insbesondere bei der Massenkommunikation von Bedeutung, da die Effizienz dieser Kommunikationsform zu einem großen Teil von der Anzahl der erreichten Empfänger abhängt. Drittens können gewisse Störeinflüsse die Übertragung und damit auch die vom Sender beabsichtigte Wirkung der Botschaft erheblich beeinträchtigen. An dieser Stelle sei allerdings angemerkt, dass in der heutigen Zeit, wo die Übertragungskanäle in der Regel über einen sehr hohen Qualitätsstandard verfügen, die besonderen Merkmale des Empfängers sowie der in der Kommunikationssituation vorherrschende Kontext weit größeren Einfluss auf die Effizienz, d.h. den Grad der Zielerreichung, der Kommunikation nehmen als die Störungen, die innerhalb des Übertragungskanals auftreten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wird dieses allgemeine Kommunikationsmodell nun auf den konkreten Kontext der Fernsehwerbung angewendet, ergibt sich daraus folgendes Bild (vgl. dazu Abbildung 1):
Abb. 1: (Einseitiger) Informationsfluss in der fernsehmedialen Massenkommunikation
Die am Markt agierenden erwerbswirtschaftlichen und gemeinnützigen Organisationen oder Institutionen (Sender) müssen – in Anlehnung an ihre vorher definierten Werbeziele – zunächst geeignete Werbemaßnahmen (Botschaften) produzieren, wie z.B. Fernsehwerbespots. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein für die Empfänger verständlicher Zeichencode verwendet wird. Werden diese Werbespots dann über einen oder mehrere der diversen privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsender (Übertragungskanäle) ausgestrahlt, treten die Konsumenten (Empfänger) schließlich mit den Werbebotschaften in Kontakt.
Der Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass es sich bei der fernsehmedialen Massenkommunikation um eine asymmetrische Kommunikationsform handelt, d.h. Informationen fließen hier in der Regel nur von dem Sender in Richtung des Empfängers. Wie der gestrichelte Pfeil in Abbildung 1 allerdings andeutet, können die Konsumenten bis zu einem gewissen Grad auch hier Einfluss auf die werbenden Unternehmen ausüben, indem sie sich z.B. trotz massiver Werbebemühungen seitens der Wirtschaft im Konsumverzicht üben. Dieses Verhalten der Konsumenten wird dann sehr wahrscheinlich gewisse Veränderungen im Kommunikationsverhalten der Unternehmen nach sich ziehen (wechselseitiger Kommunikationsprozess); der Kommunikationskreislauf wäre damit geschlossen.
Ob die angestrebten Werbeziele erreicht werden, hängt demnach nicht nur von der „fehlerfreien“ Informationsübertragung zwischen Sender und Empfänger ab. Viel entscheidender ist es, wie die Werbemaßnahmen auf das Erleben und Verhalten der Konsumenten einwirken. Werbeerfolg und Werbewirkung sind somit untrennbar miteinander verbunden. Oder um es mit den Worten von Barg (1981, S. 927) auszudrücken: „Werbewirkungen … (sind) … jene psychischen Vorgänge beim Umworbenen, die dem Werbeerfolg vorgelagert sind und diesen determinieren.“. Es liegt daher nahe, Werbung nicht nur als Kommunikationsprozess, sondern zusätzlich als Werbewirkungsprozess zu verstehen. Auf diesen soll im folgenden Kapitel eingegangen werden.
2.2 Werbung als Werbewirkungsprozess
Werbung entwickelt nur dann die gewünschte Wirkung, wenn sie das Erleben und Verhalten der Konsumenten gezielt beeinflusst (von Rosenstiel & Kirsch, 1996). Dazu müssen, das dürfte in dem vorangegangenen Kapitel deutlich geworden sein, zunächst einmal Werbebotschaften zwischen Werbendem (Unternehmen) und Beworbenem (Konsument) ausgetauscht werden. Dass dabei allerdings nicht jeder Konsument gleich auf die in den Markt gesendeten Werbeinformationen regiert, dürfte ebenso wenig verwundern, wie die Feststellung, dass ein Konsument zu verschiedenen Zeitpunkten ohne weiteres unterschiedlich auf ein und dieselbe Werbebotschaft reagieren kann (von Rosenstiel & Neumann, 1991). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass neben den Eigenschaften der jeweiligen Werbemaßnahme sowohl individuelle als auch situative Faktoren mit darüber entscheiden, wie der Konsument die bei ihm eintreffenden Informationen wahrnimmt und verarbeitet.
Zur Erklärung der menschlichen Informationsverarbeitung sind in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Werbewirkungsmodellen entwickelt worden. Die vier wesentlichen Funktionen dieser Modelle fasst Moser (1997) wie folgt zusammen: Erstens dienen Werbewirkungsmodelle dem Werbeforscher als Erklärungshilfe für die Entstehung einer bestimmten Werbewirkung. Zweitens lassen sich aus den theoretischen Modellannahmen und empirischen Befunden konkrete Gestaltungsempfehlungen für die Werbepraxis ableiten. Eine dritte Funktion stellt die Festlegung angemessener Testmethoden für die Messung der Werbewirkung dar. Die vierte Funktion liegt schließlich in der Begründung von Werbezielen, was mit anderen Worten bedeutet, dass Werbewirkungsmodelle konkrete Werbeziele, wie z.B. die positive Veränderung der Markeneinstellung oder die Verbesserung der Erinnerung an die beworbenen Produkte, zur Sicherstellung des angestrebten Werbeerfolges sichtbar machen.
Nach Felser (2001) lässt sich die große Anzahl der Werbewirkungsmodelle in drei Kategorien unterteilten: in die hierarchischen Modelle, die dualen Prozess-Modelle und die mechanistischen Ansätze. Die hierarchischen Modelle der Werbewirkung, die auch als Stufenmodelle bezeichnet werden, stellen die Werbewirkung nach Moser (1997, S. 270) als das „geordnete Durchlaufen verschiedener Wirkungsstufen und -ebenen“ dar. Eine tiefer gelegene Ebene kann nach dieser Auffassung erst dann durchlaufen werden, wenn die Werbewirkung auf den darüber liegenden Ebenen zu entsprechenden Prozessen geführt hat. Zu den bekanntesten Stufenmodellen zählen das AIDA-Modell (Attention, Interest, Desire, Action) und das PPPP-Modell (Picture, Promise, Prove, Push).
Bei der zweiten Kategorie von Werbewirkungsmodellen, den dualen Prozess-Modellen, stellt das Involvement[2] des Konsumenten die entscheidende Weiche für die Werbewirkung dar. Je nachdem, ob das Involvement hoch oder niedrig ausgeprägt ist, wird einer von zwei Wegen der Beeinflussung gewählt (Felser, 2001). Ist das Involvement hoch, d.h. wird der Werbung ein hohes Interesse entgegengebracht, hängt die Wirkung der Kommunikation im Wesentlichen von der Qualität der Argumente ab. Sind diese für den Konsumenten überzeugend, kann daraus in der Folge eine Einstellungs- oder Verhaltensänderung resultieren. Ist das Involvement hingegen niedrig, d.h. liegt bei dem Konsumenten nur geringes Interesse vor, sich mit der Werbung eingehender auseinanderzusetzen, wird der zweite Weg eingeschlagen. In diesem Fall spielt dann weniger die Qualität der Argumente eine Rolle, sondern vielmehr periphere Merkmale, wie z.B. die Emotionalität der Werbung oder die Anzahl der Wiederholungen (Moser, 1997). Auch über diesen Weg können Einstellungs- und Verhaltensänderungen erzielt werden, die dann allerdings auf einem anderen Wirkmechanismus beruhen als bei hohem Involvement. Eines der berühmtesten Zwei-Prozess-Modelle zur Einstellungsänderung ist das Elaboration-Likelihood-Modell (ELM) von Petty & Cacioppo (1986).
Die dritte Kategorie von Werbewirkungsmodellen bilden die mechanistischen Ansätze, zu denen neben den behavioristischen S-R-Theorien auch die neobehavioristischen S-O-R-Theorien gezählt werden (Felser, 2001). Da das klassische Konditionieren in der Regel diesen Modellen zugerechnet wird, soll dem Leser in den folgenden Kapiteln zunächst ein kurzer Einblick in die behavioristischen S-R-Theorien (Kapitel 2.2.1) und in die neobehavioristischen S-O-R-Theorien (Kapitel 2.2.2) gewährt werden. Daran anschließend werden dann in Kapitel 2.3 die theoretischen Grundlagen des klassischen Konditionierens sowie die bisherigen empirischen Befunde zum klassischen Konditionieren im Werbekontext ausführlich diskutiert.
2.2.1 Die behavioristischen S-R-Theorien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die behavioristischen S-R-Theorien stellten lange Zeit das in der Konsumentenpsychologie dominierende Denkmodell dar und wurden daher häufig zur Erklärung von Werbewirkungen herangezogen (Felser, 2001). Das S steht dabei für Stimulus (oder Reiz) und das R für Response (oder Reaktion)[3]. In strenger Anlehnung an die Wissenschaftsauffassung des zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommenen Behaviorismus[4] werden in den S-R-Theorien ausschließlich objektiv von außen beobachtbare Reize (S) sowie die von diesen Reizen ausgelösten Verhaltensreaktionen (R) betrachtet (Nieschlag et al., 1997). Nach streng behavioristischer Auffassung müssen neben den dargebotenen Reizen auch die durch diese Reize ausgelösten Reaktionen von außen beobachtbar sein (Watson, 1919). Psychische Phänomene wie Gefühle, Bewusstsein, Einstellungen, Gedanken usw., die sich im Inneren des Organismus abspielen und die als vermittelnde Variablen zwischen Input (Reizen) und Output (Reaktionen) fungieren könnten, werden in den S-R-Theorien komplett aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausgeblendet und in der berühmten Black Box verborgen (vgl. Abbildung 2). Die S-R-Theorien werden daher häufig auch als Black-Box-Ansätze bezeichnet (Nieschlag et al., 1997).
Abb. 2: Das behavioristische Modell der S-R-Theorien
Da den im Inneren des Organismus ablaufenden Prozessen in den S-R-Theorien keine weitere Beachtung geschenkt wird, kann das von dem Organismus gezeigte Verhalten als die Funktion derjenigen Reize verstanden werden, die auf ihn aktuell einwirken oder früher einmal eingewirkt haben (Nieschlag et al., 1997). Diese Annahme lässt Felser (2001) zu dem logischen Schluss kommen, dass ein bestimmter Reiz bei wiederholter Darbietung grundsätzlich zu vergleichbaren Verhaltensreaktionen führen müsste (vgl. dazu auch von Rosernstiel & Neumann, 1991). Bleibt die gewünschte Reaktion aus, ist die Begründung hierfür ausschließlich in der Beschaffenheit des dargebotenen Reizes zu sehen.
Übertragen auf den Werbekontext würde das bedeuten, dass eine bestimmte Werbemaßnahme (Stimulus) stets dasselbe Konsumentenverhalten (Reaktion) auslösen müsste (und das zu den verschiedensten Zeitpunkten und über viele Konsumenten hinweg). Für den Fall der fernsehmedialen Massenkommunikation hieße das beispielsweise, dass alle Konsumenten, die im Fernsehen den Werbespot der Marke XYZ gesehen hätten, Lemmingen gleich in den nächsten Supermarkt strömen und dort als willenlose Konsumäffchen hemmungslos ihrem durch die Massenmedien ausgelösten Kaufrausch frönen würden. Die Alltagserfahrung lehrt uns jedoch, dass diese Annahme von einer Omnipotenz der Medien so glücklicherweise nicht zutrifft (von Rosenstiel & Neumann, 1991).
Wie diese Ausführungen deutlich machen dürften, postuliert der streng behavioristisch orientierte Denkansatz ein sehr mechanistisches und deterministisches Menschenbild, in dem menschliches Verhalten als im Wesentlichen von außen (durch Reize) gesteuert und reaktiv angesehen wird (Edelmann, 2000). Dieser sehr mechanistischen Sichtweise verdanken die behavioristischen Ansätze den Umstand, dass die S-R-Theorien von den meisten Werbepraktikern in der heutigen Zeit nicht mehr zur Erklärung des menschlichen Konsumverhaltens herangezogen werden.
Die im nächsten Kapitel beschriebenen neobehavioristischen S-O-R-Theorien gehen aus diesem Grund einen Schritt weiter und rücken von der streng behavioristischen Sicht der S-R-Theorien ab. Dadurch, dass die neobehavioristischen Ansätze versuchen, ein wenig Licht in das Dunkel der Black Box zu bringen, stellen sie eine gewisse Erweiterung der S-R-Ansätze dar.
2.2.2 Die neobehavioristischen S-O-R-Theorien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als neobehavioristisch werden die S-O-R-Theorien bezeichnet, weil sie neben objektiv beobachtbaren Reizen und Reaktionen auch die im Inneren des Organismus ablaufenden psychischen Prozesse mit in die wissenschaftliche Betrachtung einbeziehen (Felser, 2001). Die Black Box der S-R-Theorien wird hier demnach durch einen prinzipiell erforschbaren Organismus (O) ersetzt, der zwischen eingehenden Reizen (S) und gezeigtem Verhalten (R) interveniert (vgl. dazu Abbildung 3). Nach Auffassung der S-O-R-Theorien wird menschliches Verhalten somit nicht mehr allein durch die Besonderheiten der eintreffenden Reize, sondern durch ein Zusammenwirken von Stimuluseigenschaften und psychischen Organismusvariablen determiniert (Nieschlag et al., 1997).
Abb. 3: Das neobehavioristische Modell der S-O-R-Theorien
Heutzutage haben die neobehavioristischen S-O-R-Theorien die behavioristischen S-R-Theorien in der Psychologie weitestgehend abgelöst, da die Komplexität des menschlichen Verhaltens mithilfe der S-O-R-Modelle sehr viel differenzierter untersucht werden kann (von Rosenstiel & Neumann, 1991). Allerdings sind auch die S-O-R-Theorien nicht ganz frei von Kritik. Ähnlich wie die S-R-Theorien gehen nämlich auch diese Theorien davon aus, dass der Organismus trotz der in seinem Inneren ablaufenden psychischen Prozesse überwiegend reaktiv und reizgesteuert ist (von Rosenstiel & Kirsch, 1996). Die äußere Umwelt bleibt damit auch in den neobehavioristischen Ansätzen die eigentliche Verhaltensdeterminante (Felser, 2001).
Wie lässt sich Werbewirkung nun aus Sicht der S-O-R-Theorien erklären? Zunächst einmal werden Werbemaßnahmen auch von diesen Theorien als Reize verstanden. Treffen diese Reize auf den Konsumenten, wird nach Auffassung der S-O-R-Theorien allerdings nicht automatisch eine unreflektierte, gleichförmige (Konsum-) Reaktion ausgelöst, sondern ein durch die im Inneren des Organismus ablaufenden psychischen Prozesse vermitteltes individuelles Verhalten, das von Situation zu Situation variieren kann. Mit dieser Vorhersage von Werbewirkung und Konsumentenverhalten dürften die S-O-R-Modelle den Gegebenheiten des täglichen Lebens sehr viel näher kommen als die streng behavioristischen S-R-Theorien.[5]
Der kritische Leser mag an dieser Stelle anmerken, dass die mechanistischen Ansätze aufgrund ihres deterministischen Menschenbildes nicht geeignet sind, Werbewirkung und Konsumentenverhalten dem heutigen Zeitgeist angemessen abzubilden. Dem kann jedoch folgendes entgegnet werden: Werbung stellt einen so hochkomplexen Themenbereich dar, dass es sehr schwer fallen dürfte, sämtliche ihrer Facetten mit einem einzigen, allumfassenden theoretischen Modell zu beschreiben. Dieser Umstand dürfte auch die Vielzahl der heute existierenden Werbewirkungsmodelle erklären (Felser, 2001). In diesem Sinne sind die mechanistischen Modelle lediglich als ein möglicher theoretischer Erklärungsansatz für einen ausgewählten Teilbereich der Werbung zu verstehen.
Ein besonders prominentes Beispiel für eine mechanistische S-R-Theorie stellt das klassische Konditionieren dar, auf das im folgenden Kapitel 2.3 ausführlich eingegangen werden soll. Dazu werden in den Kapiteln 2.3.1 und 2.3.2 zunächst zwei historische Experimente zum klassischen Konditionieren vorgestellt, um den Ablauf klassischer Konditionierungsexperimente beispielhaft darzustellen. Daran anschließend werden in Kapitel 2.3.3 die wichtigsten Fachtermini des klassischen Konditionierens erläutert, bevor in den Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5 theoretische Erklärungsmodelle für das Wirkprinzip des klassischen Konditionierens diskutiert werden. In Kapitel 2.3.6 werden dem Leser dann die bisherigen empirischen Befunde zum klassischen Konditionieren im Werbekontext vorgestellt. Nach einer kurzen Zusammenfassung in Kapitel 2.4 werden zum Abschluss des Theorieteils in Kapitel 2.5 die Fragestellung dieser Arbeit und die Forschungshypothesen abgeleitet.
2.3 Das klassische Konditionieren
Das klassische Konditionieren kann nicht nur als ein elementarer Lernprozess, sondern auch als eine Technik zur Einübung verschiedenster Verhaltensweisen verstanden werden (Tarpy, 1979). Die Wirksamkeit und Anwendbarkeit dieser Technik konnte seit seiner Entdeckung durch den russischen Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936) zu Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit in zahlreichen experimentellen Untersuchungen demonstriert und bei einer Vielzahl von Organismen nachgewiesen werden. Einige dieser Experimente zum klassischen Konditionieren zählen zu den bekanntesten psychologischen Untersuchungen überhaupt (Spada, 1990). Zwei der wohl berühmtesten Experimente dürften in diesem Zusammenhang von Iwan P. Pawlow selbst und von dem Begründer des Behaviorismus, John B. Watson (1878-1958), stammen. Anhand dieser beiden klassischen Experimente von Pawlow und Watson soll dem Leser nun zunächst ein kurzer Einblick in die Historie des klassischen Konditionierens gewährt und der grundsätzliche Aufbau klassischer Konditionierungsexperimente vorgestellt werden.
2.3.1 Das klassische Experiment von Iwan P. Pawlow
Pawlows Forschungsinteresse galt ursprüngliches der Physiologie des Verdauungssystems bei Hunden (vgl. Lefrancois, 1986; Spada, 1990; Tarpy, 1979). Mittels einer speziellen Apparatur versuchte er, die nach Verabreichung verschiedenster Substanzen produzierte Speichelmenge im Maul seiner Versuchstiere zu messen. Eher zufällig entdeckte er dabei die Technik des klassischen Konditionierens. Pawlow bemerkte im Verlauf seiner Untersuchungen, dass von einigen seiner Versuchshunde schon vor Beginn des eigentlichen Experiments, also noch vor der Verabreichung irgendwelcher Substanzen, vermehrt Speichel abgesondert wurde. Dieser Effekt zeigte sich erstaunlicherweise jedoch nur bei Tieren, die schon längere Zeit an seinen Versuchen teilnahmen. Gerade erst neu in das Forschungsprogramm aufgenommene Hunde zeigten solch eine Reaktion nicht (Mazur, 2004). Diese faszinierende Entdeckung veranlasste Pawlow, sich von seinem ursprünglichen Forschungsziel abzuwenden und stattdessen der experimentellen Untersuchung dieses unvorhergesehenen Lernphänomens nachzugehen. Das klassische Experiment zur Konditionierung der Speichelsekretion bei Hunden gestaltete sich in Anlehnung an Pawlow (1927) wie folgt:
Wird einem hungrigen Hund Fleischpulver – gleiches gilt selbstverständlich auch für richtiges Futter – vorgehalten bzw. verabreicht, reagiert dieser reflexartig mit gesteigerter Speichelsekretion. Dieser unbedingte Reflex[6], wie Pawlow diese Reaktion ursprünglich nannte, tritt praktisch bei jeder Darbietung des Fleischpulvers automatisch, d.h. ohne willentliche Kontrolle, auf. Wird dem Versuchstier das Fleischpulver nun wiederholt in Verbindung mit einem Glockenton dargeboten, so reagiert der Hund nach einigen Versuchsdurchgängen schon bei dem bloßem Klang der Glocke mit einer vermehrten Speichelproduktion, auch wenn ihm im Anschluss an das Läuten der Glocke kein Futterpulver mehr verabreicht wird. Diese Reaktion auf den ursprünglich für den Hund völlig bedeutungslosen Glockenton bezeichnete Pawlow als bedingten Reflex[7]. In einem weiteren Schritt wurde das Läuten der Glocke dann wiederholt an ein Lichtsignal gekoppelt, so dass auch dieses Lichtsignal bald in der Lage war, bei den Versuchstieren eine vermehrte Speichelproduktion auszulösen. Nach einigen Durchgängen ohne zusätzliche Darbietung des Fleischpulvers ließ sich allerdings feststellen, dass die Intensität der Speichelproduktion sowohl bei dem alleinigen Läuten der Glocke als auch bei alleiniger Darbietung des Lichtsignals langsam abnahm und schließlich sogar ganz ausblieb.
Das zweite klassische Experiment von Watson und Rayner (1920) soll im Folgenden die erfolgreiche, wenn auch ethisch mehr als fragwürdige Übertragung des klassischen Konditionierens auf den Humanbereich demonstrieren.
2.3.2 Das klassische Experiment von John B. Watson
Der Behaviorist John B. Watson griff die Gedankengänge Pawlows in Amerika bald auf und übertrug dessen Erkenntnisse aus den Versuchen mit Hunden auf den Humanbereich. In Anlehnung an Pawlows ursprüngliches Vorgehen gestaltete Watson sein berühmt-berüchtigtes Experiment mit dem kleinen Albert folgendermaßen (Watson & Rayner, 1920):
Der kleine Albert, der während der mehrere Monate andauernden Untersuchung zwischen 9 und 13 Monate alt war, wurde als Kind einer Krankenschwester für eine gewisse Zeit in einem Hospital aufgezogen, wo er an den Behavioristen Watson geriet. Da der Junge für sein Alter gut entwickelt und sowohl emotional als auch gesundheitlich sehr stabil war, wählte ihn Watson für sein Experiment als Testperson aus, dessen Ziel die Konditionierung einer negativen, emotionalen Reaktion war. Albert durchlief während der Untersuchung verschiedene Experimentalphasen (vgl. Spada, 1990). In der ersten Phase der Untersuchung, der sog. Kontrollphase, wurden Albert von Watson und Mitarbeitern neben diversen leblosen Gegenständen mit und ohne Fell auch einige Tiere präsentiert, zu denen unter anderem eine weiße Ratte und ein Kaninchen zählten. Albert zeigte in dieser ersten Phase des Experiments bei keinem der Gegenstände und Tiere irgendwelche Zeichen von Angst. Das laute Geräusch eines auf eine Eisenstange schlagenden Hammers hinter Alberts Kopf löste hingegen eine starke emotionale Angstreaktion bei dem Jungen aus: er zuckte heftig zusammen, fiel nach vorne über, verbarg sein Gesicht und fing an zu wimmern. In der zweiten Phase, der Konditionierungsphase, wurde jedes Mal, wenn Albert seine Hand nach der weißen Ratte ausstreckte und damit signalisierte, dass er mit dem Tier spielen wollte, kräftig mit dem Hammer auf die Eisenstange geschlagen.[8] Diese grausame Prozedur wurde mehrere Male wiederholt. In der dritten Phase des Experiments, der sog. Löschungsphase, wurde Albert die weiße Ratte schließlich wieder ohne das lärmende Geräusch des Hammerschlags präsentiert. Es zeigte sich, dass bereits der bloße Anblick der Ratte bei dem Jungen starkes Weinen und Schreien auslöste. Watson konnte zudem feststellen, dass plötzlich auch viele der ursprünglich nicht Angst auslösenden Gegenstände und Tiere in der Lage waren, eine ähnliche, wenn auch schwächere Angstreaktion bei Albert auszulösen. Die emotionale Reaktion fiel dabei umso intensiver aus, je ähnlicher die anderen Objekte der weißen Ratte waren. Im Gegensatz zu dem bedingten Reflex in Pawlows Experiment erwies sich Alberts konditionierte Angstreaktion über einen längeren Zeitraum als äußerst löschungsresistent. Watson hatte sich daher nach eigenen Angaben dazu entschlossen, die Angstkonditionierung in einer vierten Phase, der Phase der Gegenkonditionierung[9] , wieder rückgängig zu machen (vgl. Watson & Rayner, 1920).
2.3.3 Zentrale Begriffe des klassischen Konditionierens
In diesem Kapitel sollen die in der einschlägigen Literatur verwendeten Fachtermini des klassischen Konditionierens eingehend erläutert werden. Zum besseren Verständnis der einzelnen Begrifflichkeiten werden neben den allgemeinen Definitionen an entsprechender Stelle anschauliche Beispiele aus den beiden geschilderten klassischen Untersuchungen von Pawlow und Watson eingestreut.
Zusammengenommen können neben dem Fleischpulver, dem Glockenton und dem Lichtsignal in Pawlows Experiment auch der Schlag des Hammers auf die Eisenstange, die weiße Ratte sowie die anderen in Watsons Untersuchung verwendeten Objekte als Reize oder Stimuli bezeichnet werden. Treffen diese Reize auf die Sinnesorgane eines Organismus, können dadurch mehr oder weniger starke Reaktionen bei dem Organismus ausgelöst werden (Edelmann, 2000). Als eine solche durch Reize ausgelöste Reaktion kann sowohl die Speichelsekretion von Pawlows Hunden als auch das Weinen des kleinen Albert verstanden werden. Doch trotz dieser vermeintlichen Ähnlichkeit muss aus Sicht des klassischen Konditionierens strikt zwischen den von Pawlow und Watson verwendeten Reizen sowie zwischen den von diesen Reizen ausgelösten Reaktionen unterschieden werden. Im weiteren Verlauf der hier vorliegenden Arbeit soll daher in Anlehnung an Tarpy (1979) und Krech et al. (1992) zum besseren Verständnis der klassischen Konditionierungsprinzipien die nachfolgende Terminologie verwendet werden.
2.3.3.1 Der unkonditionierte Stimulus (UCS)
Ein unkonditionierter Reiz (engl. unconditioned stimulus = UCS) ist ein Reiz, der regelmäßig eine messbare, ungelernte Reaktion auslöst, über die das Individuum im Normalfall keine willentliche Kontrolle hat. In Pawlows Experiment stellt die Darbietung bzw. Verabreichung des Fleischpulvers solch einen unkonditionierten Reiz (UCS) dar, der unabhängig von der bisherigen Erfahrung des jeweiligen Versuchstiers wiederholt zu einer Erhöhung der Speichelsekretion führt. Analog dazu ist der Schlag des Hammers auf die Eisenstange in Watsons Untersuchung als UCS zu verstehen.
2.3.3.2 Die unkonditionierte Reaktion (UCR)
Jede messbare, durch einen unkonditionierten Stimulus (UCS) ausgelöste ungelernte Reaktion stellt eine unkonditionierte Reaktion (engl. unconditioned reaction = UCR[10] ) dar. Die Speichelsekretion, die durch die Darbietung des Fleischpulvers (UCS) reflexartig bei Pawlows Hunden ausgelöst wurde, kann als unkonditionierte Reaktion (UCR)[11] verstanden werden. Bei Watson stellt Alberts Zusammenzucken und Wimmern die unkonditionierte Reaktion (UCR) dar.
2.3.3.3 Der neutrale Stimulus (NS)
Als neutraler Reiz (NS) kann jeder Reiz verstanden werden, der bei dem Organismus in der Regel keine Reaktion auslöst, sieht man einmal von einer sog. Orientierungsreaktion (OR)[12] ab. In den beiden geschilderten Experimenten waren Glockenläuten und Lichtsignal (Pawlow) sowie Ratte und Kaninchen (Watson) zu Beginn der Untersuchungen neutrale Reize (NS).
2.3.3.4 Der konditionierte Stimulus (CS)
Der konditionierte Reiz (engl. conditioned stimulus = CS) ist ein ursprünglich für den Organismus völlig neutraler Reiz (NS). Erst durch die wiederholte Darbietung zusammen mit einem unkonditionierten Reiz (UCS) wird dieser zu einem konditionierten Reiz (CS). Nach erfolgreicher Konditionierung ist der CS dann seinerseits in der Lage, auch ohne weitere Paarungen mit dem UCS eine Reaktion bei dem Organismus auszulösen. Der CS löst demnach anders als der UCS nicht von Anfang an regelmäßig ein bestimmtes Verhalten bei dem Organismus aus. In Pawlows Untersuchung wurden aus den ursprünglich neutralen Reizen Glockenton und Lichtsignal konditionierte Stimuli (CS), die ihrerseits zu einem vermehrten Speichelfluss bei den Hunden führten. In Watsons Experiment mit dem kleinen Albert wurde neben der weißen Ratte unter anderem das Kaninchen zum konditionierten Reiz (CS).
2.3.3.5 Die konditionierte Reaktion (CR)
Als konditionierte Reaktion (engl. conditioned reaction = CR) wird jede Reaktion bezeichnet, die durch einen konditionierten Stimulus (CS) ausgelöst wird. In Pawlows Experimenten ist der durch das Glockenläuten und das Lichtsignal hervorgerufene Speichelfluss der Hunde als konditionierte Reaktion (CR)[13] anzusehen. Das Weinen Alberts und der Versuch des Wegkrabbelns stellen in Watsons Untersuchung die konditionierte Reaktion (CR) dar.[14]
2.3.3.6 Extinktion (Löschung)
Nach Krech et al. (1992) besteht bezüglich der Verwendung des Begriffes Extinktion im Rahmen der Theorie des klassischen Konditionierens eine gewisse Zweideutigkeit. Zum einen beschreibt Extinktion die Abnahme der Stärke der konditionierten Reaktion (CR), die sich – jedenfalls der Regel nach – aus der wiederholt alleinigen Darbietung des konditionierten Reizes (CS) ergibt. Zum anderen wird mit Extinktion die Phase des experimentellen Vorgehens umschrieben, in der der konditionierte Reiz (CS) ohne den unkonditionierten Reiz (UCS) dargeboten wird, ohne dabei jedoch explizit das Ergebnis, den Rückgang der CR-Stärke, zu berücksichtigen. Nach diesem zweiten Definitionsansatz würde selbst dann von Extinktion gesprochen, wenn sich die Stärke der konditionierten Reaktion (CR) trotz alleiniger Darbietung des CS nicht zurückbilden würde, wie im Fall des kleinen Albert geschehen (vgl. Kapitel 2.3.2).
2.3.3.7 Konditionieren zweiter (höherer) Ordnung
Die Technik des Konditionierens zweiter oder höherer Ordnung stellt eine Erweiterung des einfachen Konditionierungsprinzips dar. In diesem Fall wird zunächst, wie bereits kennen gelernt, ein unkonditionierter Reiz (UCS) wiederholt zusammen mit einem neutralen Reiz (NS) dargeboten, bis dieser NS ohne weitere Kopplungen an den UCS bei dem Organismus eine konditionierte Reaktion (CR) auslöst. Der ursprünglich neutrale Reiz (NS) ist damit zu einem konditionierten Reiz erster Ordnung (CS) geworden (vgl. Mazur, 2004). In einem nächsten Schritt wird nun dieser CS erster Ordnung wiederholt an einen weiteren neutralen Reiz (NS´) gekoppelt, bis aus diesem ein konditionierter Reiz zweiter Ordnung (CS´) geworden ist, der nun seinerseits eine konditionierte Reaktion zweiter Ordnung (CR´) auszulösen vermag, ohne dabei jedoch jemals zusammen mit dem ursprünglichen UCS dargeboten worden zu sein. In Pawlows Experiment stellt die Kopplung des Glockentons (CS erster Ordnung) an das Lichtsignal (CS zweiter Ordnung) einen Konditionierungsvorgang zweiter Ordnung dar (vgl. Kapitel 2.3.1).
2.3.3.8 Zeitliches Konditionieren
Beim klassischen Konditionieren können im Wesentlichen vier zeitliche Relationen zwischen konditioniertem Reiz (CS) und unkonditioniertem Reiz (UCS) unterschieden werden (vgl. z.B. Lefrancois, 1986; Krech et al., 1992; Tarpy, 1979).[15] Da die zeitliche Abfolge von CS und UCS, wie noch zu zeigen sein wird, einen wesentlichen Aspekt der im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Fragestellung darstellt, soll zum Abschluss dieses Kapitels kurz auf die vier in der nachfolgenden Abbildung 4 dargestellten Fälle des zeitlichen Konditionierens eingegangen werden.[16]
In den beiden ersten in Abbildung 4 dargestellten Fällen steht der CS dem UCS voran. In dem Fall a), dem verzögerten Konditionieren, setzt der CS irgendwann vor Darbietung des UCS ein und dauert zumindest während eines Teils des UCS – gelegentlich auch bis zu dessen Ende oder darüber hinaus – an. Im Gegensatz dazu beginnt die Darbietung des CS bei dem in Fall b) dargestellten Spurenkonditionieren nicht nur vor dem Einsetzen des UCS, sie endet auch vorher. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Fällen a) und b) besteht demnach darin, dass sich beim v erzögerten Konditionieren der CS und der UCS gegenseitig überlappen, beim Spurenkonditionieren hingegen nicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Varianten in der zeitlichen Abfolge von CS und UCS, geordnet nach ihrer „vermeintlichen“ Effektivität (nach Lefrancois, 1986): a) verzögerte Konditionierung, b) Spurenkonditionierung, c) simultane Konditionierung und d) rückwirkende Konditionierung
Bei dem in Fall c) dargestellten simultanen Konditionieren überlagern sich die beiden Reize komplett, was bedeutet, dass CS und UCS nicht nur zeitgleich einsetzen, sie enden auch zur selben Zeit. Der Fall d), das r ückwärtige Konditionieren, stellt schließlich eine dem in Fall b) beschriebenen Spurenkonditionieren unmittelbar konträre Vorgehensweise des klassischen Konditionierens dar. Beim rückwärtigen Konditionierens werden die Reize zwar auch seriell, d.h. nacheinander und nicht überlappend, dargeboten, anders als beim Spurenkonditionieren wird beim rückwärtigen Konditionieren jedoch zunächst der UCS und erst im Anschluss daran der CS präsentiert.
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass der CS in zeitlicher Relation zum UCS grundsätzlich drei verschiedene Positionen einnehmen kann: Er kann ihm voran stehen (CS à UCS), er kann gleichzeitig mit ihm dargeboten werden (CS + UCS) oder ihm nachfolgen (UCS à CS). Geht der CS dem UCS voran, wie in den beiden Fällen a) und b) in Abbildung 4 dargestellt, wird im Allgemeinen von Vorwärtskonditionierung (engl. forward conditioning) gesprochen. Der umgekehrte Fall, wenn also zunächst der UCS und erst im Anschluss daran der CS präsentiert wird, wird Rückwärtskonditionierung (engl. backward conditioning) genannt. An dieser Stelle sei bereits der kurze Hinweis erlaubt, dass es die Effizienz dieser beiden zeitlichen Konditionierungstechniken im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit zu überprüfen und auf den konkreten Kontext der Fernsehwerbung anzuwenden gilt. Bevor auf diesen Punkt jedoch näher eingegangen wird, sollen in den folgenden Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5 zunächst zwei theoretische Erklärungsmodelle zum klassischen Konditionieren besprochen werden.
2.3.4 Die Stimulus-Substitutionstheorie
Bis weit in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein wurde die Lernforschung von dem in Kapitel 2.2.1 bereits erwähnten Behaviorismus dominiert (Mazur, 2004). Ein Ziel der behavioristischen Wissenschaftsauffassung war es, auf Basis streng objektiv beobachtbarer Verhaltensmerkmale allgemeingültige Lerngesetzte aufstellen zu können (Spada, 1990). Den zentralen Forschungsgegenstand der wissenschaftlichen Psychologie siedelte der Behaviorismus daher auch ausschließlich im Verhalten und nicht im Bewusstsein des Menschen an (vgl. z.B. Edelmann, 2000; Fröhlich, 1997; Lefrancois, 1986; Schorr, 1994; Watson, 1919). Ein zentrales Postulat des Behaviorismus besagt in diesem Zusammenhang, dass jegliches Verhalten, selbst das komplexeste, in einzelne Reiz-Reaktions-Verbindungen zerlegt werden kann. Zwei Arten von Verbindungen werden dabei grundsätzlich voneinander unterschieden: die ungelernten oder angeborenen auf der einen sowie die erlernten Reiz-Reaktions-Verbindungen auf der anderen Seite. Das klassische Konditionieren stellt nun einen Ansatz dar, mit dem einerseits neue Reiz-Reaktions-Verbindungen erlernt[17] werden können, andererseits aber auch deren Zustandekommen theoretisch erklärt und abgebildet werden kann.
Bevor im Folgenden ein erster theoretischer Erklärungsansatz für das klassische Konditionieren vorgestellt wird, der auf den russischen Physiologen Pawlow zurückgeht und der heute im Allgemeinen als Stimulus-Substitutionstheorie bezeichnet wird (Mazur, 2004), sei an dieser Stelle eine kurze Anmerkung erlaubt. Nach heutiger Auffassung ist das klassische Konditionieren nicht mehr allein auf das Erlernen rein objektiv beobachtbarer Reiz-Reaktions-Verbindungen beschränkt, mittlerweile werden neben internen Reizen, wie z.B. Vorstellungen, auch von außen nicht unmittelbar beobachtbare Reaktionen, wie z.B. Erlebnisse, in die Betrachtung mit einbezogen. Damit hat der ursprünglich streng behavioristische Ansatz des klassischen Konditionierens eine wesentliche Erweiterung erfahren (Edelmann, 2000).
Die Stimulus-Substitutionstheorie soll hier – wie die nachfolgende Theorie im Übrigen auch – anhand eines Beispiels aus dem Kontext der Fernsehwerbung diskutiert werden. Dabei erscheint es sinnvoll, sich die einzelnen Phasen des klassischen Konditionierens, die im Rahmen der experimentellen Untersuchung von Watson & Rayner (1920) mit dem kleinen Albert in Kapitel 2.3.2 bereits kurz angesprochen wurden, noch einmal ins Gedächtnis zu rufen (vgl. dazu auch die nachfolgende Abbildung 5).
In der ersten in Abbildung 5 dargestellten Phase, der Kontrollphase, muss zunächst ein geeigneter bedeutungsneutraler Reiz (NS) gefunden werden, wie z.B. das Markenlogo eines neu in den Markt eintretenden Unternehmens. Logos etablierter Marken, die bereits einen hohen Bekanntheitsgrad haben, kommen hierfür im Allgemeinen nicht infrage, da in diesem Fall sowohl die Marken selbst als auch ihre Logos von den Konsumenten nicht mehr als neutrale, sondern als bedeutungsvolle Reize erlebt werden. Neben dem lediglich eine Orientierungsreaktion (OR) auslösenden Markenlogo (NS) muss in der Kontrollphase zusätzlich ein unkonditionierter Reiz (UCS) gefunden werden, der praktisch automatisch eine unkonditionierte Reaktion (UCR) nach sich zieht. UCS und UCR bilden somit eine ungelernte Reiz-Reaktions-Verbindung. In dem hier geschilderten Fall der Fernsehwerbung kann beispielsweise eine emotionsgeladene Werbeszene als UCS[18] verwendet werden, in der attraktive Menschen oder eine beschauliche Landschaft gezeigt werden. Die angenehme Stimmung, die durch die Darbietung der emotionalen Werbeszene bei den Zuschauern ausgelöst wird, stellt die UCR dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Die Phasen des klassischen Konditionierens
In der zweiten Phase, der Konditionierungsphase, werden CS (Markenlogo) und UCS (emotionale Werbeszene) nun wiederholte Male zusammen im Rahmen eines Fernsehwerbespots dargeboten, bis der CS schließlich in der dritten Phase, der Extinktions - oder Löschungsphase, dazu in der Lage ist, bei alleiniger Darbietung – d.h. ohne den UCS – verlässlich eine der UCR ähnliche konditionierte Reaktion (CR) in Form einer angenehmen Stimmung auszulösen. Die Bedeutung dieser neu erlernten Reiz-Reaktions-Verbindung für den Alltag besteht nun in der grundlegenden Annahme, dass der Konsument bei seinem Einkaufsgang das in der Fernsehwerbung beworbene Markenlogo auf den Produktverpackungen in den Regalen der Einkaufsstätte wieder erkennt und er durch die bei ihm praktisch automatisch entstehende angenehme Stimmung eher dazu geneigt ist, Produkte der beworbenen Marke zu kaufen.
Nach Auffassung der Stimulus-Substitutionstheorie lässt sich das Zustandekommen einer neuen, erlernten Reiz-Reaktions-Verbindung darauf zurückführen, dass der CS im Laufe der diversen Konditionierungsdurchgänge zu einem echten UCS-Ersatz wird (Mazur, 2004). Durch die wiederholt gemeinsame Darbietung zusammen mit dem UCS erlangt der CS schließlich die Fähigkeit, seinerseits eine der ursprünglichen UCR ähnliche Reaktion (CR) auszulösen. Das wichtigste Grundprinzip, das es dabei aus Sicht der Reizsubstitutionstheorie zu beachten gilt, ist das Gesetz der Kontiguität[19] (Tarpy, 1979). Ist die Kontiguität, d.h. die räumliche und zeitliche Nähe von CS und UCS, in den einzelnen Konditionierungsdurchgängen nicht gegeben, kann das erfolgreiche Erlernen einer neuen Reiz-Reaktions-Verbindung mittels klassischer Konditionierung verzögert oder sogar ganz verhindert werden. Grundsätzlich gilt dabei: je weiter CS und UCS räumlich oder zeitlich auseinander liegen, desto schwieriger wird das Konditionieren und desto mehr Durchgänge werden benötigt.
2.3.5 Die Theorie des Signallernens
Über die Jahre hinweg wurden eine Reihe theoretischer Überlegungen und empirischer Befunde zusammengetragen, die zum einen gegen die Gültigkeit der Stimulus-Substitutionstheorie sprechen, die zum anderen aber auch die Bedeutung der Kontiguität für das klassische Konditionieren relativieren, ohne dabei allerdings das klassische Konditionieren selbst infrage zu stellen (Steiner, 2001). Die wesentlichen Kritikpunkte sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.
Folgt man der zentralen Annahme der Stimulus-Substitutionstheorie, so dürfte die vom CS ausgelöste konditionierte Reaktion (CR) der vom UCS ausgelösten unkonditionierten Reaktion (UCR) im Falle einer echten Reizsubstitution nicht nur ähnlich sein. Beide Reaktionen müssten in diesem Fall identisch sein (Tarpy, 1979). Wie die in Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 beschriebenen historischen Experimente von Pawlow und Watson aber bereits beispielhaft gezeigt haben, stimmen CR und UCR keineswegs immer exakt überein. Zu einem ähnlichen Schluss kommt in diesem Zusammenhang auch Mazur (2004), der die konditionierte kompensatorische Reaktion, die als Ergebnis einer erfolgreichen Konditionierungsprozedur häufig das genaue Gegenteil der ursprünglichen UCR darstellt, als stärkstes Argument gegen die Gültigkeit der Reizsubstitutionstheorie ins Feld führt (Mazur, 2004, S. 101; vgl. auch Siegel, 1982).
Gegen die Annahme, die Kontiguität von CS und UCS stelle beim klassischen Konditionieren die alles entscheidende Bedingung dar, sollen an dieser Stelle zwei viel zitierte experimentelle Untersuchungen von Rescorla (1968) und Kamin (1969) angeführt werden. Rescorla (1968, 1988) versuchte im Rahmen seiner Untersuchungen die Frage zu beantworten, ob die Kontiguität zwischen zwei Umweltreizen, so wie es beispielsweise von Guthrie (1959) angenommen wurde, wirklich die hinreichende Bedingung für die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) darstellt oder ob nicht vielleicht eher der Informationsgehalt des CS entscheidend für das Erlernen einer Reiz-Reaktions-Verbindungen ist. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, präsentierte Rescorla (1968, 1988) zwei Gruppen von Ratten mehrere Male ein bestimmtes Tonsignal als CS, während ihnen gleichzeitig über das am Boden der Versuchsbox befindliche Metallgitter leichte Stromschläge als UCS verabreicht wurden. Eine der beiden Experimentalgruppen erhielt zusätzlich in den Intervallen zwischen den CS-Darbietungen weitere Stromschläge. Rescorla (1968, 1988) variierte dadurch zwar den Informationsgehalt des CS zwischen den beiden Gruppen (in der ersten Gruppe kündigte der CS den UCS verlässlich an, in der zweiten Gruppe mit den zusätzlichen Stromschlägen zwischen den CS-Darbietungen war das hingegen nicht der Fall), hielt aber gleichzeitig das Ausmaß der Kontiguität zwischen CS und UCS über beide Gruppen konstant. Als Ergebnis fand Rescorla (1968, 1988), dass nur die Ratten der ersten Gruppe eine konditionierte Reaktion (CR) ausgebildet hatten, bei denen der CS zuverlässig das Einsetzen des UCS ankündigte. Er schloss daraus, dass sich die Kontiguität zwischen zwei Umweltereignissen zwar günstig auf das klassische Konditionieren auswirken kann, die Kontingenz der beiden Reize, d.h. die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der UCS immer dann auftritt, wenn vorher der CS präsentiert wurde, aber das eigentliche Wirkprinzip hinter dem klassischen Konditionieren verkörpert und damit viel entscheidender für die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) ist (vgl. dazu auch Felser, 2001; Spada, 1990; Steiner, 2001).
In einer weiteren Untersuchung überprüfte Kamin (1969) die Bedeutung des CS-Informationswertes für die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR). Dazu präsentierte er seinen Versuchstieren, ebenfalls Ratten, sowohl einen einzelnen CS (Ton) als auch einen aus zwei Einzelreizen (Ton und Licht) zusammengesetzten CS-Verbund in unterschiedlichen Abfolgen, jeweils gefolgt von einem kurzen elektrischen Schlag als UCS. In der Löschungsphase überprüfte Kamin (1969), inwieweit der CS Licht, der während der Konditionierungsphase niemals allein, sondern nur innerhalb des CS-Verbunds dargeboten worden war, eine konditionierte Reaktion (CR) auszulösen vermochte. Es zeigte sich, dass die Stärke der konditionierten Reaktion (CR) von dem Informationsgehalt des CS Licht abhing. Je zuverlässiger das Licht den UCS ankündigte, desto stärker war die CR. Kamin zog daraus den Schluss, dass nicht die Anzahl der Konditionierungsdurchgänge das entscheidende Kriterium für die Ausbildung der CR darstellte, sondern der Informationsgehalt des jeweiligen CS. Wurde das bevorstehende Auftreten des UCS bereits von einem anderen Reiz angekündigt, wurde der weniger informative Reiz blockiert. In die Literatur ist dieses Phänomen als sog. blocking effect eingegangen (vgl. Spada, 1990).
Im Sinne der Theorie des Signallernens kann demnach festgehalten werden, dass nicht die Kontiguität von CS und UCS, d.h. deren räumliche und zeitliche Nähe, die entscheidende Variable beim klassischen Konditionieren darstellt, sondern vielmehr deren Kontingenz, die als ein Maß für die bedingte Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens der beiden Reize zu verstehen ist (Mazur, 2004). Oder um es anders auszudrücken: Sofern der CS einen zuverlässigen Prädiktor (im Sinne eines Signals) für das Auftreten des bevorstehenden UCS darstellt (Rescorla, 1968) und dieser CS dadurch im Vergleich zu anderen Reizen zusätzliche Informationen über den UCS liefert (Kamin, 1969), findet ein Lernprozess mittels klassischer Konditionierung statt.
Zusammenfassend lässt sich der Schluss ziehen, dass sich die Kontiguität von zwei Umweltereignissen zwar förderlich auf das klassische Konditionieren auswirken kann, das Ausmaß der Kontingenz dieser beiden Ereignisse nach Auffassung der Signaltheorie aber die eigentlich entscheidende Bedingung für die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) darstellt. Diese Interpretation des klassischen Konditionierens, nach der der Organismus nicht völlig unreflektiert und automatisch jegliche Art von Reiz-Reaktions-Verbindungen erlernt, sondern vielmehr aktiv die Bedeutung und Vorhersagequalität von Zeichen wahrnimmt und interpretiert, geht über die ursprünglich rein behavioristische Auffassung des Reflexlernens weit hinaus (vgl. dazu auch Janiszewski & Warlop, 1993).
2.3.5.1 Signallernen und evaluatives Konditionieren
Übertragen auf das aus dem Werbekontext entlehnte Beispiel, das bereits in Kapitel 2.3.4 benutzt wurde, um die Stimulus-Substitutionstheorie zu veranschaulichen, würde das bedeuten, dass die Konsumenten beim Erblicken des Markenlogos (CS) mit der emotionalen Werbeszene (UCS) rechnen würden, da ihnen das Markenlogo als Signal für die bevorstehende Darbietung der Werbeszene dient. Während diese Annahme für den Fernsehabend zuhause noch recht plausibel zu sein scheint, ist es umso unwahrscheinlicher, dass ein Konsument in einer Einkaufsstätte beim Erblicken des Markenlogos auf einer Produktverpackung mit dem Einsetzen eben dieser Werbeszene rechnet (vgl. Felser, 2001).
Nach neuerer Auffassung werden daher beim klassischen Konditionieren zwei Prozesse voneinander unterschieden: das im vorangegangenen Kapitel beschriebene Signallernen und das nach einem sehr viel mechanistischeren Prinzip ablaufende evaluative Konditionieren (vgl. Felser, 2001; Mazur, 2004). Walther (2002) postuliert in diesem Zusammenhang drei wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Formen des Konditionierens. Das evaluative Konditionieren ist ihrer Ansicht nach zum einen nicht wie das Signallernen auf höhere kognitive Prozesse angewiesen. Das Wissen über den Zusammenhang zwischen CS und UCS ist daher für die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) beim evaluativen Konditionieren nicht erforderlich. Zweitens wird die durch das evaluative Konditionieren erlernte konditionierte Reaktion (CR) nicht automatisch wieder gelöscht, sofern der CS einige Male ohne den UCS präsentiert wird. Der dritte Unterschied bezieht sich schließlich auf die beiden bereits kennen gelernten Prinzipien der Kontiguität und Kontingenz. Anders als das Signallernen ist das evaluative Konditionieren lediglich auf die Kontiguität von CS und UCS angewiesen. Demnach kommt es beim evaluativen Konditionieren allein durch die wiederholt gemeinsame Darbietung eines ursprünglich neutralen CS zusammen mit einem positiv oder negativ bewerteten UCS zu einer Art Bedeutungsverschiebung (engl. hedonic shift[20] ) vom UCS in Richtung CS.
Für den Organismus hat sowohl das Signallernen als auch das Lernen mittels evaluativer Konditionierung einen gewissen Wert. Während ihm das kognitiv anspruchsvollere Signallernen ermöglicht, brauchbare Repräsentationen seiner Umwelt im Sinne von „wenn, dann“-Erwartungen aufzubauen, erlaubt ihm das evaluative Konditionieren, automatische und unreflektierte Bewertung von Personen und Objekten vorzunehmen und dabei seine begrenzten kognitiven Ressourcen anderweitig zu verteilen. Dadurch, dass das evaluative Konditionieren weder Bewusstsein noch ein hohes Interesse voraussetzt, stellt es auch und gerade in der Werbung eine geeignete Technik zur Einstellungsbildung dar. Ob es sich beim Signallernen und evaluativen Konditionieren aber tatsächlich um zwei unterschiedliche Prozesse handelt oder ob eine der beiden Konditionierungsprozeduren als Spezialfall der anderen angesehen werden muss, konnte in der Forschung bisher nicht abschließend geklärt werden (vgl. z.B. Davey, 1994; Felser, 2001).
2.3.5.2 Signallernen und zeitliches Konditionieren
Wie sich aus den Anmerkungen zur Signaltheorie ableiten lässt, hängt die Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) und damit auch die Effizienz des klassischen Konditionierens im Wesentlichen von der Signalqualität des CS ab. Folgt man dieser Annahme, so ist davon auszugehen, dass das klassische Konditionieren umso effizienter ist, je zuverlässiger der CS das bevorstehende Auftreten des UCS signalisiert. Um als Signal für den UCS dienen zu können, muss der CS diesem verständlicherweise zeitlich vorausgehen (CS à UCS). Doch was geschieht in den anderen Fällen, wo der CS dem UCS nachfolgt oder vielleicht gleichzeitig mit ihm dargeboten wird? Rufen wir uns zur Beantwortung dieser interessanten Frage noch einmal die in Kapitel 2.3.3.8 bereits vorgestellten vier Fälle des zeitlichen Konditionierens ins Gedächtnis.
Wie aus Abbildung 4 in Kapitel 2.3.3.8 zu ersehen ist, steht der CS dem UCS nur in zwei der vier Fälle voran: bei dem a) verzögertes Konditionieren und dem b) Spurenkonditionieren. In den beiden anderen Fällen, dem c) simultanen Konditionieren, bei dem CS und UCS gleichzeitig präsentiert werden, und dem d) rückwärtigen Konditionieren, wo zunächst der UCS und erst dann der CS dargeboten wird, kann der CS seine Signalfunktion nicht ausüben. Lefrancois (1986) geht daher davon aus, dass die beiden Fälle a) und b), die wie in Kapitel 2.3.3.8 bereits erwähnt auch unter dem Begriff Vorwärtskonditionierung zusammengefasst werden können, bezüglich der Ausbildung einer konditionierten Reaktion (CR) sehr viel effizienter sind als die beiden anderen unter c) und d) dargestellten Fälle. In einer ganzen Reihe wissenschaftlicher Arbeiten findet diese Annahme ihre Zustimmung (vgl. z.B. Foppa, 1970; Janiszewski & Warlop, 1993; Jones, 1962; Krech et al, 1992; Mackintosh, 1974; Mazur, 2004; Ross & Ross, 1971; Spada, 1990; Stuart, Shimp & Engle, 1987; Tarpy, 1979; Wilson, 1969).
Zusammenfassend lässt sich demnach also festhalten, dass das Vorwärtskonditionieren dem simultanen und rückwärtigen Konditionieren in aller Regel überlegen zu sein scheint, was für gewöhnlich auf die bei den beiden letztgenannten Techniken fehlende Signalwirkung des CS zurückgeführt wird.
2.3.6 Empirische Befunde aus dem Werbekontext
Wie bereits in Kapitel 2.2.1 und 2.3.4 erwähnt wurde, waren die Behavioristen zuversichtlich, auf Basis objektiver Verhaltensbeobachtungen allgemeingültige Lerngesetze formulieren zu können (Spada, 1990). Aufgrund dieser Annahme beschränkten sich die behavioristischen Lerntheoretiker zunächst darauf, in ihren Laboratorien streng kontrollierte Tierexperimente durchzuführen. Als Ziel galt es dabei, aus den gewonnen experimentellen Befunden artübergreifende Gesetzmäßigkeiten des Lernens formulieren zu können. Wie aber die Studien von Rescorla (1968) und Kamin (1969) gezeigt haben dürften (vgl. dazu auch Kapitel 2.3.5), erwiesen sich bald selbst die einfachsten Reiz-Reaktions-Verbindungen als theoretisch so komplex, dass sogar Ratten die eine oder andere Kognition zugesprochen werden musste (Spada, 1990). Zudem zeigte sich, dass sowohl das klassische als auch das operante Konditionieren[21] an artspezifische, biologische Grenzen zu stoßen schien (vgl. z.B. Burdach, 1988; Garcia & Koelling, 1966; Seligman, 1970; Shettleworth, 1975; Thorndike, 1911; Wilcoxon, Dragoin & Kral, 1971). Daher erscheint es auch wenig verwunderlich, dass den Lerngesetzen des klassischen Konditionierens ihre von den Behavioristen unterstellte Allgemeingültigkeit heute in aller Regel abgesprochen wird (Spada, 1990). Die Einschränkungen, die die Lerngesetze des klassischen Konditionierens im Laufe der Jahrzehnte erfahren haben, sollten allerdings nur als eine Relativierung und nicht als deren generelle Widerlegung verstanden werden. Bevor zum Abschluss des Theoriekapitels das Gesagte zusammengefasst und die Fragestellung und Hypothesen dieser Arbeit besprochen werden, sollen dem Leser im Folgenden einige empirische Arbeiten zum klassischen Konditionieren im Werbekontext vorgestellt werden.
Ein viel zitiertes Experiment zur Bildung von Einstellungen mittels klassischen Konditionierens stammt von Staats & Staats (1958).[22] Als neutrale Reize benutzten die beiden Autoren unterschiedliche Nationalitätenbezeichnungen[23], als unkonditionierte Reize wurden Wörter mit angenehmer oder unangenehmer Bedeutung[24] verwendet. Ziel der Untersuchung war es, die einzelnen Nationalitätenbezeichnungen durch die wiederholt gemeinsame Darbietung mit den angenehmen oder unangenehmen Wörtern emotional aufzuladen. In insgesamt 18 Durchgängen wurden den Probanden zunächst die einzelnen Nationalitätenbezeichnungen per Dia-Projektion gezeigt. Nach etwa einer Sekunde Darbietungszeit wurden dann die entsprechenden angenehmen oder unangenehmen Wörter verlesen (verzögertes Konditionieren). Wie von Staats & Staats (1958) erwartet, erhielten diejenigen Nationalitäten, die zusammen mit angenehmen Wörtern präsentiert wurden, eine sehr viel positivere Bedeutung als die Nationalitäten, die mit unangenehmen Wörtern dargeboten wurden. Die beiden Autoren gehen nun davon aus, dass mit der Veränderung der emotionalen Bedeutung einer Nationalitätenbezeichnung zugleich eine Veränderung der Einstellung gegenüber der betreffenden Nation verbunden ist.
Angeregt durch die Arbeiten von Staats & Staats (1958) führte Kroeber-Riel ein weiteres Experiment zur Einstellungsbildung durch (Kroeber-Riel & Weinberg, 1999). Das Ziel dieser Untersuchung war es, zwei Fantasiemarken, HOBA-Seife und SEMO-Ordner, mittels klassischen Konditionierens emotional aufzuladen. Dazu wurden im Rahmen eines üblichen Kino-Werbeblocks Dia-Anzeigen für die beiden genannten Marken präsentiert. Ein Teil der Anzeigen zeigte die Markennamen zusammen mit reizstarken Bildern, der andere Teil wurde zusammen mit reizschwachen Bildern präsentiert (simultane Konditionierung).[25] Zusätzlich wurde ein Teil der Anzeigen mit sachlichen Produktinformationen versehen, der andere Teil hingegen nicht. An neun Tagen wurden den Probanden insgesamt 30 Dia-Anzeigen für die beiden oben genannten Marken sowie zahlreiche Ablenkungsanzeigen dargeboten. Als Ergebnis zeigte sich, dass die ursprünglich neutrale Marke HOBA-Seife aufgrund der wiederholt gemeinsamen Darbietung mit den reizstarken Bildern ein klares emotionales Erlebnisprofil erhalten hatte und das unabhängig davon, ob zusätzlich zu den Bildern sachliche Produktinformationen angeboten wurden oder nicht.
Einen Schritt weiter noch geht eine Studie von Gorn (1982). Ziel dieser Studie sollte nicht nur die Veränderung der emotionalen Einstellung gegenüber einem bestimmten Produkt mittels klassischer Konditionierung sein, sondern zusätzlich die gezielte Beeinflussung des Konsumentenwahlverhaltens. Gorn (1982) wählte dazu folgendes Vorgehen: Während seine Probanden je nach Versuchsbedingung entweder einen blauen oder einen beigen Füllfederhalter über einen Dia-Projektor zu sehen bekamen, wurde ihnen gleichzeitig angenehme oder unangenehme Hintergrundmusik vorgespielt (simultanes Konditionieren). Als Ergebnis fand sich, dass die Mehrzahl der Probanden als Belohnung für ihre Teilnahme denjenigen Füllfederhalter auswählte, dessen Farbe zusammen mit der angenehmen bzw. nicht zusammen mit der unangenehmen Musik präsentiert worden war. Aus Sicht des klassischen Konditionierens weist das Experiment von Gorn (1982) einige erwähnenswerte Besonderheiten auf. Erstens wurden CS (Füller) und UCS (Musik) nicht wiederholt, sondern nur ein einziges Mal zusammen präsentiert. Zweitens wurden die beiden Reize parallel und nicht zeitlich versetzt zueinander dargeboten. Dennoch zeigte sich der beschriebene Effekt. Ob dieser allerdings auf klassisches Konditionieren zurückzuführen ist, lässt sich u.a. aufgrund einer fehlenden Kontrollgruppe, mit der alternative Erklärungen hätten ausgeschlossen bzw. kontrolliert werden können, nicht mit letzter Sicherheit sagen. Die Kontroverse um die Anwendbarkeit des klassischen Konditionierens auf den Werbekontext wurde zusätzlich angeheizt durch einen in leicht abgewandelter Form durchgeführten Replizierungsversuch von Allen & Madden (1985), in dem Gorns (1982) Ergebnisse nicht repliziert werden konnten. Ein weiterer Replizierungsversuch von Bierley, McSweeney, & Vannieuwkerk (1985)[26], dessen gefundene Effekte zwar in die richtige Richtung wiesen, aber insgesamt gesehen zu schwach waren, konnte ebenso wenig wie die im Folgenden dargestellte Untersuchung von Gresham & Shimp (1985) zur endgültigen Klärung dieser Kontroverse beitragen.
Auch wenn die Studie von Gresham & Shimp (1985) nicht zu den erwartet starken Ergebnissen geführt hat, so ist sie dennoch einer kurzen Erwähnung wert. Die beiden Autoren widmeten sich in ihrer Untersuchung der Frage, in welchem Maße emotionale Werbespots die emotionale Einstellung gegenüber der beworbenen Marke beeinflussen können. Dazu präsentierten sie ihren Probanden bekannte Fernsehwerbespots für diverse Supermarktprodukte, die seit einigen Jahren nicht mehr gesendet wurden. Mithilfe einer Kontrollgruppe, die die Spots nicht zu sehen bekam, wurde kontrolliert, inwieweit die emotionalen Spots dazu in der Lage waren, die Emotionen bezüglich der beworbenen Marke zu beeinflussen, ohne dabei jedoch die rationale Bewertung der Marke zu verändern. Es zeigte sich, dass in nur einem einzigen Fall (von insgesamt 10 Fällen) der emotionale Werbespot in der Lage war, die Emotionen gegenüber der Marke zu verändern, ohne dabei gleichzeitig auch deren rationale Bewertung zu beeinflussen. Die Autoren führen dieses Ergebnis auf die Verwendung überwiegend bekannter, bereits etablierter Marken zurück, da in diesem Fall die Markeneinstellung häufig nicht durch eine einzelne Werbemaßnahme beeinflusst wird, sondern eher mit einer Abfärbung der allgemeinen, bereits vorhandenen Markeneinstellung auf die Werbemaßnahme zu rechnen ist.
Baker (1999) untersuchte in einer weiteren Studie zur Beeinflussung des Markenwahlverhaltens durch klassisches Konditionieren die Auswirkungen einzelner Kontextfaktoren auf die Effizienz des emotionalen Konditionierungsvorgangs. Dazu variierte er in zwei Experimenten systematisch die drei folgenden Faktoren: den Bekanntheitsgrad der verwendeten Marken, die wahrgenommene Produktqualität der einzelnen Marken sowie die Bereitschaft der Konsumenten, im Augenblick der Markenwahl intensiv nachzudenken. Im Gegensatz zu Gorn (1982) simulierte Baker (1999) das reale Markenwahlverhalten allerdings nur, indem er seine Probanden für die fünf präsentierten Marken (die konditionierte Marke und vier Wettbewerber) eine Präferenzreihenfolge bilden ließ. Es stellte sich dabei heraus, dass die emotional konditionierten Marken ihren Wettbewerbern dann überlegen waren, wenn kein Unterschied in dem Bekanntheitsgrad oder der Produktqualität der einzelnen Marken festzustellen war. Waren die Wettbewerbermarken bei gleicher Produktqualität hingegen bekannter, erwiesen sich die emotional konditionierten Marken als unterlegen. Gleiches galt auch für den Fall, dass die Markenbekanntheit zwar vergleichbar, dafür aber die Qualität der Produkte aufseiten der Wettbewerber besser war. In diesem Fall waren die Wettbewerber allerdings nur dann überlegen, wenn sich die Probanden auch intensiv mit der Situation auseinandersetzten. Baker (1999) schloss aus diesen Befunden, dass der Faktor Markenbekanntheit den Konditionierungserfolg am ehesten beeinträchtigen kann. Bezogen auf den konkreten Vorgang der Markenwahl schlussfolgerte er weiterhin, dass das klassische Konditionieren insbesondere in den Situationen, in denen vergleichbare Marken miteinander konkurrieren – und das scheint auf den heutigen Märkten ja vermehrt der Fall zu sein –, als sog. Zünglein an der Waage fungieren kann, durch das der betreffenden Marke ein emotionaler Mehrwert oder Zusatznutzen verschafft wird.
Einen echten Meilenstein in der Erforschung des klassischen Konditionierens im Werbekontext stellt die sehr umfangreiche Studie von Stuart, Shimp & Engle (1987) dar. In vier Experimenten, von denen hier allerdings nur zwei eingehender beschrieben werden sollen, operationalisierten die Autoren einige der von McSweeney & Bierley (1984) in ihrem sehr gelungenen Übersichtsartikel zusammengefassten Grundregeln des klassischen Konditionierens und wendeten diese auf den Werbekontext an. In einem ersten Experiment überprüften die Autoren, ob Produkteinstellungen mittels Werbung prinzipiell konditionierbar sind und inwieweit sich diese dann mithilfe einer vermehrten Anzahl von Konditionierungsdurchgängen (1, 3, 10 oder 20 Durchgänge) weiter verfestigen lassen. Im Rahmen einer Dia-Show präsentierten die Autoren ihren Probanden dabei zunächst für fünf Sekunden Dia-Bilder der fiktiven Marke „Brand L Toothpaste“ als CS, denen für ebenfalls fünf Sekunden emotionale Dia-Bilder diverser Naturszenen (z.B. eines Sonnenuntergangs oder Wasserfalls) als UCS folgten. Unmittelbar danach wurden CS und UCS für weitere fünf Sekunden zusammen dargeboten. Nach einer Schwarzblende von ca. zwei Sekunden folgte die nächste 15-Sekunden-Sequenz. Zur Ablenkung der Versuchspersonen wurden drei weitere fiktive Marken zusammen mit neutralen Dia-Bildern als Füllmaterial zwischen die eigentlichen CS-UCS-Sequenzen geschaltet. Als Ergebnis zeigten sich in diesem ersten Experiment sowohl zwischen den vier einzelnen Bedingungen (1, 3, 10 oder 20 Durchgänge) als auch gegenüber den jeweiligen Kontrollgruppen beachtliche Konditionierungsunterschiede.
In einem weiteren Experiment stellten Stuart et al. (1987) das Vorwärtskonditionieren (CS à UCS) und Rückwärtskonditionieren (UCS à CS) einander gegenüber. Der experimentelle Aufbau glich dabei mit zwei Ausnahmen dem des ersten Experiments. Zum einen wurden in beiden Bedingungen CS und UCS jeweils zehnmal zusammen dargeboten, zum anderen wurde beim Rückwärtskonditionieren auf das Dia-Bild, auf dem CS und UCS im ersten Versuch gemeinsam dargeboten worden waren, verzichtet.[27] Wie von den Autoren vorhergesagt, erwies sich das Vorwärtskonditionieren gegenüber dem Rückwärtskonditionieren als überlegen. Dennoch konnten auch mit der Technik des Rückwärtskonditionierens bessere Ergebnisse erzielt werden als in den beiden Kontrollgruppen mit zufälliger CS-UCS-Darbietung bzw. alleiniger CS-Darbietung. In einer weiteren, an das Design von Stuart et al. (1987) angelehnten Untersuchung konnten Grossman & Till (1998) in zwei Experimenten zeigen, dass die konditionierten Einstellungen auch nach drei Wochen noch existent waren.[28] Die beiden Studien von Stuart et al. (1987) sowie Grossman & Till (1998) belegen somit eindeutig, dass Einstellungen zu Marken oder Produkten mit der Technik des klassischen Konditionierens neu generiert bzw. verändert werden können und dass diese konditionierten Veränderungen bis zu einem gewissen Maße zeitstabil sind.
Eine ganze Reihe empirischer Arbeiten widmete sich der Frage, inwieweit das Bewusstsein der Probanden über die bestehende Kontingenz zwischen CS und UCS (engl. contingency awareness) einen Einfluss auf das klassische Konditionieren nehmen könnte. Man ging in diesem Zusammenhang davon aus, dass es aufgrund der wiederholt gemeinsamen Darbietung von CS und UCS praktisch unvermeidbar sei, dass die Probanden die Verbindung zwischen den beiden Reizen irgendwann bemerkten. Aus dieser Annahme ergaben sich gleich mehrere Probleme für die Konditionierungsforschung. Zum einen ließen sich die erzielten Effekte somit nicht nur auf eine erfolgreiche Konditionierungsprozedur zurückführen, die Effekte konnten nun ebenso durch das bewusst gesteuerte Antwortverhalten der Probanden zustande kommen, die Mutmaßungen über die vermeintliche Forschungshypothese anstellten (engl. hypothesis guessing) und demzufolge ihr Antwortverhalten in einer bestimmten Art und Weise zu lenken versuchten. In diesem Fall stellten die gefundenen Effekte dann nicht das Ergebnis einer erfolgreichen Konditionierungsprozedur dar, sondern müssten als Forschungsartefakt interpretiert werden (engl. demand artifact; vgl. dazu auch Brewer, 1974).
Als ein weiteres wesentliches Problem, das mit dem Kontingenzbewusstsein der Probanden zusammenhing, wurde die Konditionierungstheorie selbst angesehen. In ihrer ursprünglichen Fassung ging diese, wie in Kapitel 2.3.4 bereits besprochen, davon aus, dass das klassische Konditionieren einen reflexartigen, willentlich unkontrollierten Lernprozess darstellt, der keiner höheren kognitiven Prozesse bedarf. Wie die Ausführungen zum Signallernen aber gezeigt haben dürften, greift dieser behavioristische Erklärungsansatz aus heutiger Sicht in vielen Fällen zu kurz. Allen & Janiszewski (1989) gehen daher davon aus, dass das pawlowsche Konditionieren[29] ohne kognitive Beteiligung und das Konditionieren mit kognitiver Beteiligung zwei unterschiedliche Prozesse darstellen. Zu einem vergleichbaren Schluss kommen auch Baeyens, Eelen & van den Bergh (1990), die mit den Ergebnissen ihrer Studie die von Martin und Levey (1987) postulierte – und in Kapitel 2.3.5.1 bereits dargestellte – Unterscheidung von evaluativem Konditionieren und Signallernen bestätigen. Während Baeyens, Eelen & van den Bergh (1990) darauf hinweisen, dass für das evaluative Konditionieren von Einstellungen kein Bewusstsein der Probanden über die Kontingenz von CS und UCS vonnöten ist[30], weisen die Ergebnisse einer Untersuchung von Shimp, Stuart & Engle (1991) genau in die entgegengesetzte Richtung. Diese Autoren fanden, dass sich Markeneinstellungen effektiver konditionieren ließen, sofern die Probanden Einsicht in die bestehende Kontingenz von CS und UCS erlangt hatten. Dieser Befund spricht eher für die Annahmen der Signaltheorie und die Beteiligung höherer kognitiver Prozesse beim Konditionieren.
[...]
[1] Das Modell von Shannon & Weaver (1949) wird in seiner ursprünglichen Form heute zwar so nicht mehr vertreten, für den Zweck der schematischen Darstellung der grundlegenden Kommunikationsabläufe erscheint dieses Modell aufgrund seiner einfachen Struktur dennoch sehr geeignet zu sein, zumal nicht wenige der heute aktuellen Kommunikationsmodelle auf den damaligen Überlegungen von Shannon & Weaver (1949) aufbauen (vgl. z.B. Herrmann, 1994; mit Kritik und weiteren Literaturhinweisen auch Winterhoff-Spurk, 1999).
[2] Mit Involvement ist in diesem Zusammenhang das Ausmaß an innerer Beteiligung bzw. die Tiefe und Qualität der Informationsverarbeitung gemeint, die ein Konsument einer bestimmten Werbebotschaft entgegenbringt (vgl. dazu z.B. Felser, 2001; Kroeber-Riel & Weinberg, 1999; Krugman, 1966; Kuß & Tomczak, 2000).
[3] In der deutschsprachigen Literatur wird daher auch der Begriff Reiz-Reaktions-Theorien analog verwendet.
[4] Der Behaviorismus (engl. behavior = Verhalten) geht auf den amerikanischen Wissenschaftler John B. Watson (1913) zurück. Watson war der Auffassung, dass sich jegliche Art von Verhalten aus vielen einzelnen, von außen beobachtbaren Reaktionen zusammensetzt, die ihrerseits wiederum mit anderen beobachtbaren Vorgängen zusammenhängen (vgl. dazu auch Lefrancois, 1986). Den im Inneren des Organismus ablaufenden Bewusstseinsprozessen wurde dabei kein Interesse geschenkt. Der Behaviorismus wurde daher auch als objektive Psychologie bezeichnet und galt als Gegenpol zu der damals vorherrschenden Bewusstseinpsychologie (Edelmann, 2000). Ein wesentliches Ziel des Behaviorismus war es, auf Basis objektiv beobachtbarer Verhaltensmerkmale allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten zur Verhaltensbeeinflussung und -vorhersage aufzustellen (Spada, 1990).
[5] Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass auch die S-O-R-Theorien einige Schwierigkeiten damit haben dürften, das Phänomen des „freien Willens“ zu erklären. Beschließt ein Konsument beispielsweise, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, worauf er sich auf die intensive und gezielte Suche nach geeigneten Produktinformationen begibt, verhält er sich sehr viel aktiver und weniger reizgesteuert als von den S-O-R-Theorien angenommen (vgl. dazu auch von Rosenstiel & Kirsch, 1996).
[6] Als unbedingt bezeichnete Pawlow den Reflex ursprünglich, weil dieser außer an die Darbietung des auslösenden Reizes an keinerlei weitere Bedingungen geknüpft zu sein schien. Als Parallele im Humanbereich können in diesem Zusammenhang z.B. der Patellarsehnenreflex bei einem leichten Schlag auf die Kniescheibe oder der Lidschlussreflex bei einem Luftstoß auf das menschliche Auge angesehen werden (Foppa, 1970). Ganz abgesehen davon funktioniert selbstverständlich auch die Anregung der Speichelproduktion durch den Anblick schmackhafter Speisen bei einem hungrigen Menschen ganz hervorragend.
[7] Die erlernte Speichelabsonderung bezeichnete Pawlow zunächst als psychische Sekretion, später prägte er den Begriff bedingter Reflex. Der Ausdruck Bedingen wurde in der englischsprachigen Literatur schließlich mit Konditionieren (engl. conditioning) übersetzt (vgl. Spada, 1990; Krech, Crutchfield, Livson, Wilson jr. & Parducci, 1992)
[8] Im Grunde genommen handelt es sich bei dieser Art des Vorgehens im eigentlichen Sinn nicht um klassisches Konditionieren. Da dem klassischen Konditionieren, wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, das Prinzip der gemeinsamen Reiz-Darbietung zugrunde liegt, hätte der Schlag auf die Eisenstange bereits beim Anblick der Ratte erfolgen müssen und nicht erst nachdem der kleine Albert seine Hand bereits nach dem Tier ausgestreckt hatte. In diesem Fall könnte der Schlag des Hammers genauso gut als eine Art Bestrafung der bereits erfolgten Reaktion des Kindes verstanden werden, was dann streng genommen nicht mehr als klassisches Konditionieren interpretiert werden dürfte.
[9] Die sog. Gegen- oder Rekonditionierung unterscheidet sich im Grunde nicht von dem Normalfall des klassischen Konditionierens. Die Vorsilbe „Gegen“ bzw. „Re“ soll hierbei lediglich verdeutlichen, dass eine bereits erfolgte Konditionierung mithilfe derselben Technik wieder rückgängig gemacht werden soll. Unglücklicherweise wurde der kleine Albert in dem hier geschilderten Fall von seiner Mutter aus dem Hospital genommen, noch bevor Watson mit der Gegenkonditionierung beginnen konnte. Dass dieses Vorgehen prinzipiell funktioniert, belegt eine Untersuchung von Jones (1974), in der der kleine Peter mittels Gegenkonditionierung von seiner Furcht vor Hasen geheilt wurde.
[10] In der Literatur tauchen hin und wieder andere Abkürzungen für unkonditionierte Reize und Reaktion auf, so z.B. S und R oder US und UR. Zur besseren Differenzierung von den in dieser Arbeit für konditionierte Reize und Reaktionen verwendeten Abkürzungen CS und CR werden hier ausschließlich die Abkürzungen UCS und UCR verwendet.
[11] Pawlow bezeichnete dieses angeborene Reaktionsverhalten zunächst als unbedingten Reflex.
[12] Die Orientierungsreaktion (OR) äußert sich im Normalfall in einer allgemeinen Aufmerksamkeitssteigerung bzw. Hinwendung in Richtung Reizquelle. In den beiden dargestellten Experimenten können das Aufstellen der Ohren beim Läuten der Glocke (Pawlow) bzw. Alberts Drehen des Kopfes in Richtung der weißen Ratte (Watson) als Orientierungsreaktionen verstanden werden.
[13] Pawlow verwendete für diese Art von Reaktionen ursprünglich den Begriff bedingter Reflex.
[14] Der aufmerksame Leser mag bemerkt haben, dass sich die unkonditionierte Reaktion (UCR) und die konditionierte Reaktion (CR) in Pawlows Experimenten sehr stark ähneln: Beide äußern sich in einer Erhöhung des Speichelflusses der Hunde. Trotz dieser Übereinstimmung zwischen UCR und CR kann und darf nicht von identischen Reaktionen ausgegangen werden. Die durch den CS ausgelöste konditionierte Reaktion (CR) und die durch den UCS hervorgerufene unkonditionierte Reaktion (UCR) können zwar Gemeinsamkeiten aufweisen, sie müssen es aber nicht. Nach Tarpy (1979) kann die CR nicht nur schwächer ausfallen als die UCR, sie kann auch insgesamt langsamer auftreten oder nur einige der Komponenten der UCR enthalten. Deutlicher wird der Unterschied zwischen UCR und CR in der Untersuchung von Watson und Rayner (1920). Auf den Schlag des Hammers (UCS) reagiert Albert mit Zusammenzucken, Wimmern und dem Verlust des Gleichgewichts (UCR), die konditionierte Reaktion (CR) auf die weiße Ratte äußert sich hingegen in Schreien und Weinen und Alberts Bestreben wegzukrabbeln (vgl. Kapitel 2.3.2).
[15] Mazur (2004) kommt auf insgesamt fünf zeitliche Relationen, indem er die neben der simultanen, rückwärtigen und Spurenkonditionierung in Abbildung 4 unter a) aufgeführte verzögerte Konditionierung in zwei Fälle unterteilt: eine Konditionierung mit kurzem und eine mit langem Verzögerungsintervall. Auf diese Unterteilung soll hier verzichtet werden.
[16] Zur besseren Vergleichbarkeit der vier Varianten wurde der UCS in Abbildung 4 jeweils mittig auf der Zeitachse positioniert. Zudem wurde die Visualisierung der zeitlichen Dauer der CS-Darbietung über alle vier Relationen hinweg konstant gehalten.
[17] Lernen soll in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Bower & Hilgard (1981) als eine umfassende Veränderung des Verhaltens oder Verhaltenspotenzials eines Organismus hinsichtlich einer bestimmten Situation verstanden werden, die auf die wiederholte Erfahrung des Organismus mit dieser Situation zurückzuführen ist. Um Lernen handelt sich demnach nicht, sofern diese Veränderungen auf angeborenen Reaktionstendenzen, Reifevorgängen oder vorübergehenden Zuständen, wie z.B. Drogenkonsum oder Ermüdung, beruhen.
[18] An dieser Stelle sei auf den Stellenwert der klassischen Konditionierung zweiter bzw. höherer Ordnung für die Werbung hingewiesen (vgl. dazu Kapitel 2.3.3.7). Viele von den in der Werbung eingesetzten UCS, wie z.B. Musik oder ein berühmter Sportler, stellen im eigentlichen Sinne keine unkonditionierten Reize dar, da die Bedeutung dieser Reize von den Konsumenten im Laufe ihres Lebens erst gelernt werden musste (vgl. z.B. Felser, 2001).
[19] Die Kontiguität stellt eines von drei Assoziationsgesetzen dar, die auf Aristoteles zurückgehen und mit denen er die Verknüpfung zweier Gedächtnisinhalte zu erklären versuchte. Neben dem Gesetzt der Kontiguität postulierte Aristoteles das Gesetz der Ähnlichkeit und das Gesetz des Kontrasts (Edelmann, 2000).
[20] Vergleiche dazu beispielsweise die Arbeit von Baeyens, Eelen & van den Bergh (1990).
[21] Das operante oder auch instrumentelle Konditionieren stellt ein von Thorndike (1932) eingeführtes und von Skinner (1938) weiterentwickeltes Modell des Lernens durch Verstärkung dar. Ähnlich wie das klassische Konditionieren geht auch das operante Konditionieren grundsätzlich davon aus, dass sich das Verhalten eines Organismus an bestimmte Reize koppeln lässt. Im Gegensatz zum klassischen Konditionieren nimmt das Modell des operanten Konditionierens allerdings an, dass der Organismus dabei selbst aktiv wird, indem er ein bestimmtes Verhalten zeigt, um dadurch angenehme Reize zu empfangen bzw. unangenehme Reize zu beenden. Das Verhalten eines Individuums wird nach Auffassung des operanten Konditionierens also durch seine Konsequenzen bestimmt (Verstärkerprinzip).
[22] Mit zu den ersten Versuchen, Einstellungen durch die gemeinsame Darbietung eines neutralen Reizes mittels angenehmer bzw. unangenehmer Reizen zu verändern, dürften die Arbeiten von Razran (1938, 1940) zählen.
[23] Es ist davon auszugehen, dass Nationalitätenbezeichnungen grundsätzlich bereits ein gewisses Maß an emotionaler Aufladung besitzen. Staats und Staats (1958) achteten bei ihrer Auswahl deshalb darauf, dass die verwendeten Nationalitäten zu Beginn der Untersuchung keine allzu deutlichen positiven oder negativen Emotionen bei den Probanden hervorriefen.
[24] Als angenehme Wörter wurden z.B. „glücklich“ oder „Geschenk“ verwendet, als unangenehme Wörter z.B. „hässlich“ oder „bitter“.
[25] Printanzeigen stellen im Sinne des klassischen Konditionierens kein optimales Werbemedium dar. Da CS und UCS gleichzeitig (simultan) dargeboten werden, kann nicht sichergestellt werden, dass der CS auch wirklich vor dem UCS betrachtet wird. Ob der CS damit immer seine Signalfunktion erfüllen kann ist fraglich (vgl. dazu auch McSweeney & Bierley, 1984).
[26] Anstelle von farbigen Füllfederhaltern wurden hier rote, blaue und gelbe geometrische Figuren als CS verwendet, es wurden mehrere Konditionierungsdurchgänge durchgeführt und neben den beiden Experimentalgruppen wurden zusätzlich zwei Kontrollgruppen (mit alleiniger CS-Darbietung und zufälliger CS-UCS-Darbietung) untersucht. Wie in der Untersuchung von Gorn (1982) stellte Musik den UCS dar.
[27] So sollte gewährleistet werden, dass der UCS auch wirklich vor dem CS verarbeitet wird. Da die Darbietungsdauer dadurch aber fünf Sekunden kürzer gewesen wäre als in der Bedingung des Vorwärtskonditionierens, wurden beim Rückwärtskonditionieren sowohl das UCS-Dia als auch das CS-Dia für 7,5 Sekunden anstatt der ursprünglichen fünf Sekunden dargeboten.
[28] Zur Löschungsresistenz klassisch konditionierter Einstellungen vgl. auch die beiden Arbeiten von Baeyens, Crombez, van den Bergh & Eelen (1988) sowie Zellner, Rozin, Aron & Kulish (1983).
[29] In der englischsprachigen Fachliteratur wird das klassische Konditionieren häufig auch als Pavlovian Conditioning bezeichnet.
[30] Eine weitere empirische Bestätigung findet diese Annahme in den Befunden einer neueren Studie von Olson & Fazio (2001). Diese Autoren gehen davon aus, dass menschliche Einstellungen zu einem Großteil auf klassisches Konditionieren zurückzuführen sind.
- Arbeit zitieren
- Oliver H. Frenzel (Autor:in), 2004, Effizienz moderner Fernsehwerbung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172784
Kostenlos Autor werden



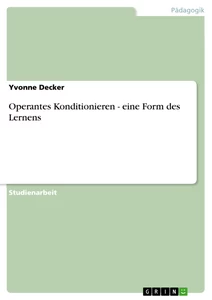













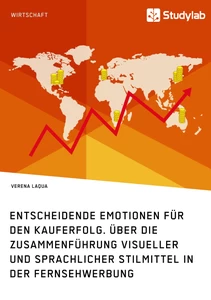




Kommentare