Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1. ZUR EINFÜHRUNG
2. IMMIGRATION UND ARBEITSMARKT IN DEUTSCHLAND UNTER SPRACHTHEORETISCHEN BEDINGUNGEN
2.1. Arbeitsmigration und „Gastarbeiterdeutsch“
2.2. Sprachtheoretische Grundlagen unter individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
3. STAND DER FORSCHUNG
4. FELDFORSCHUNG
4.1. Die interviewten MigrantInnen
4.2. Das narrativ fundierte Interview: theoretische Grundlagen und praktische Herausforderungen im Umgang mit MigrantInnen
4.3. Die dokumentarische Methode
5. ERFAHRUNGEN MIT DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF DEM ARBEITSMARKT
5.1. Der Einstieg in den Arbeitsmarkt - oder „Ich hatte mit dem Meister erst mit Handzeichen kommuniziert dan hat er langsam erzählt“
5.2. Rechtliche Exklusion bei der Nicht-Anerkennung des ausländischen Bildungstitels - oder „ohne wenn und aber mindestens Deutsch C2“
5.3. Der sprachliche Umgang in interkulturellen Arbeitsgesprächen - oder „Ich verstehe nicht, können Sie nochmal sagen?“
5.4. Klassifizierung und Diskriminierung - oder „Sie hat mich so richtig zur Schnecke gemacht“
5.5. Die Kompensation von sprachlichen Fähigkeiten durch fachliche Kompetenzen - oder „Manchmal ist es auch nicht nur das Verstehen“
5.6. Abschließende Betrachtung
6. FAZIT UND AUSBLICK
7. LITERATURVERZEICHNIS
8. ANHANG
9. SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG GEMÄß DER PRÜFUNGSORDNUNG
1. ZUR EINFÜHRUNG
Menschen mit Migrationshintergrund besitzen auf dem Arbeitsmarkt enorme immer öfter thematisierte Schwierigkeiten, wie die rückläufige Ausbildungsbeteiligung oder erhöhte Ar- beitslosenzahlen zeigen. Doch zeichnen sich solche Probleme nicht unbedingt nur vor dem Horizont einzelner Ursachen ab. Sie unterliegen vielseitigen Faktoren. Einer dieser ist die Sprache des Aufnahmelandes - in diesem Fall Deutschland. Wittgenstein formulierte dazu treffend, inwieweit die Sprache bestimmend für gesamtgesellschaftliche Prozesse wirkt:
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“1
Zweifelsohne ist eine Kompetenz in der Sprache des Aufnahmelandes wichtig und Grundvo- raussetzung für einen erfolgreichen Übergang in das berufliche Leben und die damit verbun- denen positiven Erfahrungen. Diese Sprachkompetenz eröffnet Möglichkeiten mit der Um- welt in Kontakt zu treten, um so nicht zuletzt Zugang zu Bereichen der Einheimischen zu be- kommen. Die Sprache als gemeinsames Medium bietet die Chance mit einheimischen Kolle- gen, Vorgesetzten und Klienten zu kommunizieren und zusammen zu arbeiten. In dieser Studie werde ich genau darauf eingehen. Ich werde dabei verschiedene Erfahrungshorizonte aufzeigen, die MigrantInnen während ihrer beruflichen Zeit wahrgenommen haben. Es geht mir also darum darzustellen, wie MigrantInnen sprachliche Erfahrungen wahrnehmen und ob und inwieweit Merkmale der Sprache für deren Rolle auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind. Ich werde weiterhin diese Erfahrungen - soweit dies möglich ist - in theoretische Grundla- gen und bestehende empirische Forschungen einordnen. Schließlich soll dann die Frage be- antwortet werden, inwieweit die deutsche Sprache als Zweitsprache von MigrantInnen den beruflichen Alltag bestimmt oder nur zweitrangig eine Rolle spielt, wobei ich auch auf dabei entstehende Effekte eingehen werde. Diese Arbeit hat dabei nicht die Absicht spezifische Typenbildungen vorzunehmen, welche die untersuchten MigrantInnen repräsentativ darstel- len, sondern einzig die Erfahrungen herauszukristallisieren und mit theoretischen Ansätzen und anderen empirischen Studien zu vergleichen.
Ich beginne zunächst mit einer allgemeinen Darstellung des Themas „Arbeitsmigration“ und beziehe dieses nach einem anfänglichen historischen Exkurs auf den sprachlichen Aspekt und dessen Zusammenwirken mit dem Arbeitsmarkt (2.). Um diese Studie verorten zu kön- nen, werde ich danach eine Skizzierung bestehender Forschungen und Studien vornehmen (3.). Im Anschluss daran stelle ich die hier vorliegende Studie vor und gehe dabei zunächst auf die Biografien der Interviewten ein, um dann das narrativ fundierte Interview und die do- kumentarische Methode zu erläutern (4.). Daran anknüpfend stelle ich die Ergebnisse der In- terviews anhand fünf markanter Punkte vor: der Einstieg in den Arbeitsmarkt (5.1.); die recht- liche Exklusion bei der Nicht-Anerkennung des ausländischen Bildungstitels (5.2.); der sprachliche Umgang in interkulturellen Arbeitsgesprächen (5.3.); Klassifizierung und Diskri- minierung (5.4.) und die Kompensation von sprachlichen Fähigkeiten durch fachliche Kom- petenzen (5.5.). In einer abschließenden Zusammenfassung möchte ich Vergleichshorizonte zu anderen Studien herstellen (5.6.) und schließlich in einem Fazit einen Ausblick auf die weitere Forschung geben (6.).
2. IMMIGRATION UND ARBEITSMARKT IN DEUTSCHLAND UNTER SPRACH- THEORETISCHEN BEDINGUNGEN
Im ersten Kapitel dieser Arbeit soll zunächst zum eigentlichen Thema hingeführt werden. Da eine Gesamtdarstellung des Themas „Migration“ bezogen auf Deutschland einen zu weiten Bogen spannen würde, werde ich dies direkt von Beginn auf eine Darstellung eines kurzen historischen Exkurses in die Arbeitsmigration in Deutschland beschränken. Ich werde dabei anhand kurzgeschilderter Fallbeispiele die Bedeutung der Sprache für die ArbeitsmigrantInnen und die einheimischen Unternehmen aufzeigen (2.1.). Danach werde ich den Begriff „Sprache“ thematisch einbinden und theoretisch fundiert klären (2.2.).
2.1. Arbeitsmigration und „Gastarbeiterdeutsch“
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist Deutschland hauptsächlich als Emigrationsland zu verstehen. Vor allem durch die massenhaften Auswanderungen auf den amerikanischen Kontinent oder die Arbeitswanderung nach Frankreich, Holland und in die Schweiz stieg Deutschland zu einem der wichtigsten Emigrationsländer der Welt auf.2
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist Deutschland durch den wirtschaftlichen Auf- schwung nun für viele Bewohner der Nachbarstaaten zunehmend attraktiver geworden. Der wirtschaftliche Aufschwung im Zuge der Reichsgründung 1871 und der damit verbundene Ausbau neuer Technologien, wie die Dampfmaschine und deren Nutzung vor allem in rhei- nisch-westfälischen Kohlebergwerken, sorgte dafür, dass erstmals in der Geschichte des Landes Arbeitskräfte - vor allem billige - benötigt wurden. Durch die zunehmend aufkom- mende Armut im Osten Europas gelangte Deutschland unter einer verstärkten Ost-West- Bewegung zu einem „der wichtigsten Immigrationsländer in Europa“3. Im Wesentlichen wur- den hierbei polnische Arbeiter aus dem durch Preußen besetzten polnischen Gebiet der Ma- suren angeworben. Viele der Angeworbenen kamen aber auch aus Gebieten, die von Russ- land oder Österreich-Ungarn besetzt waren. Ganz deutlich machen diese Anwerbung die Fakten der damaligen Jahre: während um 1890 gerade einmal - doch beachtliche - 30.290 ausländische Arbeitskräfte in Deutschland lebten, stieg die Zahl im Jahr 1907 auf 800.000 Arbeiter, die nun nicht mehr nur aus Polen, sondern weitestgehend aus Ost- und Südeuropa, Italien und Holland kamen. Drei Jahre später wurden einschließlich der Familienangehörigen 1.250.880 Ausländer in Deutschland gezählt und zum Beginn des ersten Weltkrieges sogar bereits zwei Millionen. Nach dem Krieg wurden zunächst die durch das Rückkehrverbot be- troffenen Polen und Kriegsgefangene zu Arbeiten eingesetzt. Mitte der zwanziger Jahre ging die Zahl der gesamtausländischen Arbeiter dann jedoch durch Aufhebung des Verbotes und Freilassung der Gefangenen auf 174.000 und Anfang der dreißiger Jahre auf 100.000 zu- rück. Im Zuge des zweiten Weltkrieges intensivierte sich der Einsatz von „Fremd-„ und „Zwangsarbeitern“4, um die deutsche Kriegswirtschaft zu ermöglichen und in Gang zu hal- ten.5
Die Nachkriegszeit stellt nach Paul Mecheril (2004) den Beginn des wissenschaftlichen Diskurses dar. Dabei unterscheidet er drei Typen der Migration, die für Deutschland in der Nachkriegszeit prägend sind: Zuwanderung von AussiedlerInnen, Flucht und Arbeitsmigration. Letztere soll an dieser Stelle ausschließlich betrachtet werden.
Arbeitsmigration ist dort anzutreffen, wo „Arbeitskräfte nachgefragt und angeboten werden“6 und wo einheimische Arbeitskräfte nicht eingesetzt werden sollen oder können. In solchen Fällen wird auf ArbeitsmigrantInnen zurückgegriffen. Um dieser Forderung nachzukommen schwenkte auch die Politik ein und schloss von 1955 bis 1968 Anwerbeverträge mit Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Portugal, Tunesien, Marokko und zuletzt mit Jugoslawien. Die Absicht dahinter war mit den ausländischen Arbeitskräften jene „konjunkturell und demo- graphisch bedingten Engpässe auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt“7 zu kompensieren, so- dass arbeitsmarktbezogene Probleme gelöst werden konnten. Die dies bezeichnende Rota- tionspolitik befristete die Arbeitsverhältnisse und zielte so darauf ab, einerseits die Behei- matung der MigrantInnen in Deutschland zu verhindern und andererseits „aufgebrauchte“ Arbeitskräfte durch neue ersetzen zu können. Es ging, so Mecheril (2004), schlicht und ein- fach um die Erledigung weitestgehend schlecht bezahlter und wenig attraktiver Arbeit, nicht aber um den Arbeiter und die Arbeiterin selbst. Es waren weder Bildungs- noch psychosozia- le Angebote vorgesehen, welche den „Gastarbeitern“8 bspw. durch einen Deutschkurs eine Eingliederung in die hiesige Gesellschaft hätte ermöglichen können.9 Gerade aber in Bezug zu Deutschkursen waren anfangs die Betriebe stark daran interessiert, dass die Arbeiter die deutsche Sprache konnten. So führten diese neben Sprachführern in der jeweiligen Landes- sprache auch spezielle Fachsprachführer für bestimmte Bereiche ein und veranstalteten so- gar in Zusammenarbeit mit Volkshochschulen deutsche Sprachkurse. Die Resonanz seitens der ArbeitsmigrantInnen war nicht wie gewünscht - wie sich auch weiter unten in einem an- deren Beispiel noch einmal dokumentieren wird - und so wurden Anreize „ideeller und mate- rieller Prämierungen“10 geschaffen, welche zu einer höheren Teilnahme an den Kursen füh- ren sollten.
Mit dem Ende der Anwerbepolitik 1973 sollte langfristig die nicht-deutsche Beschäftigung verhindert werden. Tatsächlich ergab sich aber durch den Nachzug von Familien bis zum Jahr 1995 eine Zahl von 7,2 Millionen in Deutschland lebenden Menschen, die keinen deutschen Pass besaßen.11
Seit den 1990’er Jahren orientiert sich das politische Lager zunehmend wieder an der Not- wendigkeit von Zuwanderung. Wiederum aus ökonomischen Gründen, aber mit einer ande- ren Zielgruppe, nämlich Hochqualifizierten. Mit ihnen soll die Wettbewerbsfähigkeit gesichert und die Wirtschaft innoviert und nicht zuletzt auch der alternden einheimischen Bevölkerung entgegengewirkt werden. Aus dieser Orientierung der Politik hat sich mittlerweile ein eigen- ständiger internationaler Wettbewerb gebildet, in dem die qualifizierte Arbeitskraft - neuer- dings bezeichnet als das Humankapital - die Ressource darstellt, welche für den notwendi- gen ökonomischen Erfolg steht.
Arbeitsmigration und Sprache
Man nehme zunächst ein geregeltes Leben in einem beliebigen Land daher. Nun reißt man dieses Leben aus diesem Land heraus und „verpflanzt“ es in ein anderes Land, weit vom Ur- sprungsland entfernt und unterlässt anfänglich jegliche Bemühung der sprachlichen Bildung dieses Lebens. Das Ergebnis ist neben völliger Orientierungslosigkeit das Fehlen von Mög- lichkeiten, Probleme, Bitten oder Fragen zu äußern. Die Arbeitsmigration sorgte dafür, dass die MigrantInnen in all ihren Lebensbereichen - Beruf, Freizeit, Familie, Nachbarschaft - ab- geschottet von Kommunikationsmöglichkeiten waren. Hinzu kommt, dass sprachliche Bil- dung nur marginal selbstständig gefördert werden konnte, da es in den Anfangszeiten durch die Nichtvermietung deutscher Vermieter an Ausländer zum Zwang kam, unter Landsleuten zu leben, wodurch die Muttersprache im Wesentlichen die Erstsprache abbildete. Der Auf- enthalt in einem Aufnahmeland ist also vor allem durch das Fehlen und den Verlust von Kommunikationsanlässen charakterisiert.
Die Entwicklung der deutschen Sprache bei der „Gastarbeitergeneration“ (d.h. die erste Einwanderergeneration) hat sich weitestgehend funktional und pragmatisch vollzogen. Zu fehlenden Deutschkursen seitens der staatlichen Obrigkeit kam noch erschwerend hinzu, dass sich die ArbeitsmigrantInnen die deutsche Sprache selbstständig, informell und damit jenseits von formaler Richtigkeit beibrachten. Ein Ausschnitt eines Interviews einer Sozialarbeiterin, welche als Arbeitsmigrantin nach Deutschland kam, die keine formale deutsche Sprachausbildung durchlief und sich daher durch fragen, hören und anhand eines Wörterbuches verständigt hatte, soll dazu kurz ihre Erfahrung schildern:
„(...) was ich damals gelernt habe, sitzt so tief drin, ich kann meine (3) also (2) Sprache nicht viel ändern (2). Das merke ich selber. Also das (4) wenn ich von Anfang an systematisch gelernt hätte, hätte ich vielleicht viel (2) viel besser sprechen, viel besser schreiben und so weiter (gelernt, d.V.). Beim Sprechen geht das, aber beim Schreiben habe ich noch Schwierigkeiten.“12
Maas (2005) führt dazu den Begriff „Pidgin“ an. Der Begriff „Pidgin“ bezeichnet eine rudimen- täre Sprechweise von sprachlich unterschiedlichen Personen - in diesem Fall Arbeitsmigran- tInnen unterschiedlicher Herkunftsnationen. Auf Basis des Deutschen als Grundsprache entwickelt sich aus Jargon, Mundart und Teilen der Heimatsprache jedes Einzelnen eine grammatikalisch stark vereinfachte und auf das Notwendigste reduzierte Sprachform, die nur wenigen Zwecken dient. Dennoch konnte die „Gastarbeitergeneration“ mit diesem Elemen- tardeutsch mehrere Jahrzehnte lang im Alltag und Beruf mit Deutschen und unter weiteren ArbeitsmigrantInnen kommunizieren. Die Bewertung dessen ist jedoch kritisch zu betrachten, denn gerade letzter Fakt - das Zurechtkommen mit dieser Sprachform - legte es den Ar- beitsmigrantInnen nicht unbedingt nahe, die deutschen Sprachkenntnisse zu erweitern. So kam es entlang eines „Fossilisierungsprozesses“ zur Verfestigung dieses Sprachniveaus, das sich deutlich mehr an „materialen Zwängen der Reproduktion im Alltag“13 als am Spracherwerb orientiert. Nicht zu Unrecht meint Maas (2005), denn perfekte Deutschkennt- nisse waren damals für die pragmatische Ausrichtung nicht erforderlich und entsprachen auch nicht den realistischen Einstellungen und Erwartungen. Zudem galt das Deutsche unter den ArbeitsmigrantInnen im informellen Bereich, wie dem intimen Familienleben oder der Öf- fentlichkeit, gerade einmal als Nebensprache, sozusagen als Mittel zum Zweck, wenn es da- rum ging, vielleicht doch einmal mit Einheimischen in Kontakt treten zu müssen. Dort also, wo kein entsprechender Horizont der Partizipation an sozialer Praxis vorhanden war, konn- ten und können entsprechende Sprachformen nicht erwartet werden.14
Die Entwicklung einer rudimentären Deutschkompetenz stellt zumindest in Ansätzen ein förderliches Verständnis am Arbeitsplatz dar. Wie sieht es aber in solchen Fällen aus, in denen so gut wie keine deutsche Sprache vorhanden ist. Anfang der achtziger Jahre schreibt Willi Thol (1983) dazu aus seinen fünfundzwanzigjährigen Erfahrungen während der Ausländerbetreuung in einem Industriebetrieb Folgendes:
„Wir boten (…) im unmittelbaren Anschluss an die Arbeitszeit und unmittelbar vor Arbeitsbeginn (…) preisgünstigen Deutschunterricht an, versprachen sogar volle Rückzahlung der Kursgebühren nach Teilnahme von 100 Unterrichtsstunden. Leider „verdiente“ sich keiner (…) diese Rückzahlung. Also mussten wir, um ein Mindestmaß an Verständigung bei der Arbeit, vor allem bei Arbeitseinweisungen und Hinweisen auf Unfallschutz, zu erreichen, unsere Meister veranlassen, ein paar (…) Worte [in der Herkunftssprache der ArbeitsmigrantInnen; MB] zu lernen. (…) Die Verständigung blieb anfangs recht und schlecht. Offensichtlich waren beide Seiten zuwenig motiviert, die ihnen jeweils fremde Sprache zu lernen.“15
Anhand dieser Schilderung zeigt sich der fehlende Drang nach einer neuen gemeinsamen Sprache sowohl bei den ausländischen als auch bei den deutschen Arbeitskollegen. Die Ar- beitsmigrantInnen scheuen sich die deutsche Sprache zu erlernen, scheinbar, weil es für sie einerseits ungeachtet der Rückzahlung finanziell zu teuer und anderseits zu unsinnig er- scheint eine Sprache zu lernen, die ihnen außer in der Arbeit sonst nirgendwo dient. Soziale und integrative Aspekte werden ausgeblendet, möglicherweise auch in Hinblick darauf, dass die befristeten Arbeitsverträge einen längeren Aufenthalt in Deutschland nicht möglich mach- ten. Auf der Seite der „Meister“ sieht man, dass möglicherweise die Abneigung gegenüber den fremdländischen Kollegen vorhanden ist. Die fremde Sprache wird ignoriert und damit auch die ArbeitsmigrantInnen selbst. Besonders in Bezug auf Unfallprävention, die durch das Erlernen der fremden Sprache seitens der „Meister“ erreicht werden sollte, kann dies schwerwiegende Folgen haben, wie das folgende Beispiel zeigt:
„Durch ein Mitgliedsunternehmen der StBG wurde im Mai 2002 eine Halle abgerissen. Ein dort beschäftigter Russe trat bei der Arbeit auf dem Hallendach durch zwei Platten und stürzte ab. Er schlug auf, bevor das Höhensicherungsgerät ansprach, weil er die Sicherungsleine nicht entsprechend nachgestellt hatte. Nach den Unterlagen des Unternehmens wurde zwar eine Unterweisung zur Anwendung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz durchgeführt; bei der Unfalluntersuchung stellte sich jedoch heraus, dass der Verunglückte praktisch kein Deutsch spricht - die Ehefrau musste übersetzen - und die Vorgesetzten sprachen kein Russisch.“16
Der Unfall in diesem Bericht zeigt, welche Auswirkungen eine fehlende (deutsche) Sprache haben kann. Der Verunglückte, der „praktisch kein Deutsch spricht“ und die Vorgesetzten, die seine Herkunftssprache nicht können, bilden die weiter oben angeführten Erfahrungen von Thol (1983) hervorragend ab. Aus welchen Gründen hier die Sprache nicht gekonnt wird, soll an dieser Stelle gleichgültig sein. Fakt ist aber, dass eine gemeinsame Sprache am Arbeitsplatz - je nach Art der Arbeit - auch über Leben und Tod entscheiden kann. Die offenkundige Sprachbarriere ist wohl das größte Problem, um solche Unfälle präventiv zu vermeiden. Unterweisungen, Schulungen oder Sicherheitsanweisungen verlieren ihre Bedeutung, wenn die Inhalte derer nicht verstanden werden können.
Dieses Beispiel stellt nur eines von vielen weiteren dar, in denen keine gemeinsame Sprache vorhanden ist und somit Missverständnisse entstehen. Besonders die erste Generation von MigrantInnen hatte und hat es schwer mit schlechten Sprachkenntnissen im Beruf Fuß zu fassen. Betrachtet man dagegen die zweite Generation, so stellt sich diese Situation gravie- rend anders dar:
„Unser Betrieb unterhielt damals (…) eine Kinderkrippe und zwei Kindergärten. Dort gelang die Ver- ständigung und das Eingewöhnen schnell und vortrefflich (…). (…) die ehemaligen Kindergarten- Kinder - die zweite Generation also - stehen heute ihren Mann, haben in jedem Fall Hauptschulab- schluss, teilweise sogar im A-Zug. Einige besuchten erfolgreich die Realschule. Diese Ausländer sind heute auch beruflich konkurrenzfähig. Wir finden sie nach abgeschlossener Ausbildung als Facharbei- ter bei uns, in Bankberufen, in Büros und Verkaufsstätten. Ein Teil hat sich sogar selbstständig ge- macht, kleine Gaststätten (Pizzerien) übernommen oder Handelsgeschäfte eröffnet.“17
Anhand dieses Beispiels soll die Situation der ArbeitsmigrantInnen erster Generation in Be- zug auf Sprache kontrastiert werden. Die zweite Generation, die bereits im Vorschulalter mit der deutschen Sprache in Berührung kommt, hat wesentlich bessere Chancen sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Sprache bildet hier die wesentliche Prämisse ab, um erstens erfolgreich eine schulische Laufbahn zu absolvieren und darauf aufbauend zweitens auf dem Arbeitsmarkt partizipieren zu können. Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass die Ar- beitsmigrantInnen erster Generation aufgrund fehlender Sprachkenntnisse in der neuen Landessprache auch eine geringere Bildung und damit weniger Chancen auf dem Arbeits- markt hatten. Besonders in der Zeit steigender Arbeitslosigkeit nach dem Wirtschaftswunder in Deutschland mussten viele MigrantInnen in ihr Herkunftsland zurückkehren, da sie durch ihre fehlenden deutschen Sprachkenntnisse keine Arbeit finden konnten.
Die genannten Fakten deuten bereits auf die wesentliche Rolle der Sprache für eine erfolg- reiche Teilhabe am Arbeitsmarkt hin. Es hat sich gezeigt, dass keine gemeinsame Sprache in Verbindung mit anderen Faktoren, wie den befristeten Verträgen oder Motivationsproble- men, von betrieblichen bis hin zu wirtschaftlichen Problemen oder sogar zu schwerwiegen- den physischen Schäden führen kann. Welchen Stellenwert der Sprache für den Arbeits- markt konkret zugesprochen werden kann, möchte ich nun im Folgenden noch weiter thema- tisieren.
2.2. Sprachtheoretische Grundlagen unter individuellen und gesellschaftli- chen Rahmenbedingungen
Diese Arbeit bezieht sich in ihrem Kern auf das Verhältnis von MigrantInnen, der deutschen Sprache als Sinnbild für Sprache allgemein und den jeweiligen Erfahrungen in der Arbeit. Daher halte ich es an dieser Stelle für angemessen, diese drei Punkte in Verbindung zu setzen, um die darin enthaltenen Verknüpfungen herauskristallisieren zu können. Zunächst wird es jedoch nötig sein, den Begriff „Sprache“, über den bereits im letzten Abschnitt gesprochen wurde, zu definieren und verschiedene Ausprägungen aufzuzeigen. Dabei möchte ich vor allem bereits Bezug zum Thema „Migration“ nehmen, da eine detaillierte Betrachtung der Sprache im Allgemeinen ausufernd wäre.
Der Begriff „Sprache“ ließe sich in vielerlei Verständnissen beschreiben und definieren. Im Zuge dieser Arbeit wird es aber vorrangig von Bedeutung sein, diesen Begriff aus gesellschaftlicher Sicht zu betrachten und seine Wirkung auf dem Arbeitsmarkt in den Blick zu nehmen. Dennoch halte ich es für unumgänglich zunächst einen kurzen Exkurs in die Linguistik einzuschlagen, um den Grundcharakter der Sprache zu verdeutlichen.
Sprache - ein linguistisches Verständnis
Aus linguistischer Sicht ließe sich „Sprache“ am besten wie folgt definieren: Die „Sprache“ ist ein Sammelsurium von interpersonalen Zeichen, welche jedes für sich eine Signifikation, d.h. einen Inhalt besitzt, welcher für viele Interpreten übereinstimmt, während für einen Einzelnen bestimmte Signifikationsunterschiede existieren können. Diese Zeichen müssen von den je- weiligen Interpreten herstellbar und in Sachen Signifikation für die Hersteller als auch für an- dere Interpreten identisch sein. Entscheidend ist dabei auch, dass die Signifikation für ver- schiedene Situationen relativ konstant sein muss, damit das einzelne Zeichen als Teil einer Zeichenfamilie auftreten kann. Um solche Zeichenfamilien bilden zu können ist es elementar, dass sich die Zeichen untereinander zu einem System wechselseitig verbundener Zeichen konstituieren können, welche allerdings in der Art und Weise der Kombinationen einge- schränkt sind. Nur so ist die Vielfalt komplexer Zeichenprozesse möglich.18 Mit anderen Wor- ten: Der Symbolcharakter der Sprache setzt voraus, dass die Inhalte der Zeichen den an der Kommunikation teilhabenden Personen bekannt und identisch sind. Eine Kommunikation ist demnach nur dann möglich, wenn ein Symbol für die Kommunikationsteilnehmer die gleiche Bedeutung hat. Nur wenn also unter einem Zeichen/ Symbol das Gleiche verstanden wird, kann auch die Zeichenfamilie und letztlich die Signifikation verstanden werden.
Sprache und Individuum
Betrachten wir nun folgend „Sprache“ in einem eher erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Verständnis, stellt diese zunächst einen beliebigen Lerngegenstand dar. Els Oksaar (2003) beschreibt „Sprache“ in diesem Sinne als ein „typisch psychosoziales Phänomen“19, das abhängig von einem biologischen und sozialen Rahmen existiert und sich entwickelt. Als Medium für kognitive und verhaltensrelevante Prozesse des Menschen, stellt sie somit „das wichtigste Ausdrucks- und Kommunikationsmittel“20 für die in der Gesellschaft lebenden Menschen dar. „Sprache“ kann demnach nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss auf das Individuum, seine Gruppe und die Gesellschaft, die es umgibt, bezogen werden, um die soziale Realität abbilden zu können.
Eine Sprache, wie sie in einem Land gesprochen wird, ist jedoch nicht immer identisch, son- dern unterliegt einer Dynamik. Oksaar (2003) schreibt dazu, dass sich solche Verände- rungsprozesse der Sprache und die damit einhergehenden unterschiedlichen Varianten nicht einfach auf das Individuum beziehen lassen, sondern in Zusammenwirken mit seinem „Idio- lekt“, d.h. „seinem gesamten sprachlichem Repertoire und seinen individuellen Realisie- rungsweisen des Sprachsystems“21, zu betrachten sind. Dieser Idiolekt wird durch den Er- werb weiterer Sprachen einerseits vergrößert, andererseits aber auch modifiziert und damit in seinem Verwendungsradius beeinflusst. Solche Veränderungen deuten sowohl auf die „spontane Tätigkeit des Individuums“22 als auch auf die Beeinflussung durch diejenigen hin, denen das Individuum ausgesetzt ist. In besonderem Maße spielt sich dies von Oksaar Be- schriebene bei MigrantInnen ab, die in Deutschland eine neue Sprache erlernen. Durch den Zuwachs der Kenntnisse über die deutsche Sprache vergrößert sich demnach der Idiolekt der MigrantInnen und wirkt sich somit auf die Erst- sowie auf die neu erlangte Zweitsprache aus.
Maas (2005) entwickelt dazu drei Dimensionen, in denen die Sprachpraxis variieren kann. Die Sprachnutzung ist demnach „abhängig von den beteiligten Sprechern (Hörern), (…) von der sprachlich zu bewältigenden Situation (…) [und; MB] von der Sprachstruktur im weiteren Sinne, mit der die Praxis artikuliert wird“23. Diese Dimensionen korrelieren mit situativen Fak- toren, welche Maas entlang zweier weiterer Dimensionen betrachtet: 1. öffentlich-intim; 2. in- formell-formell. Im Fall der informellen Sprachpraxis in der Öffentlichkeit, bspw. auf dem Markt oder der Straße, im Vergleich mit der informellen im Intimbereich, wie Familie oder Freunde, wird schnell klar, dass sich Variationen deutlicher in letzterem ausprägen. Die for- mell öffentliche Sprachpraxis erstreckt sich nach Maas auf gesellschaftliche Institutionen und hier insbesondere auf die Schriftsprache, die im Gegensatz zum informellen intimen Bereich die geringsten Variationen erfährt, da diese einer festen Norm unterworfen ist.24 Als Beispiele für Variationen nennt Oksaar (2003) zum einen gerade für MigrantInnen das Lernen aus Fachjargon, dem Einfluss von Anglizismen oder dem heruntergebrochenen Deutsch in einer Deutscher-Ausländer-Kommunikation („Du gehen da!“). Zum anderen fällt dies auch im An- redeverhalten, so Oksaar, auf. Die zunehmende Etablierung des „Du“ statt des „Sie“ in der Anrede hat neben Verhaltensänderungen auch Dynamisierungen sozialer Strukturen zur Folge. Ein „Du“ eines Deutschen gegenüber eines Ausländers muss nicht von letzterem er- widert werden, d.h. die durch das „Du“ aufgebaute Beziehungsstruktur muss „nicht automa- tisch reziprok“25 sein (Einen solchen Fall werde ich unter 5.3. bearbeiten.). Sowohl Oksaar (2003) als auch Maas (2005) zeigen mit diesen Ausführungen die Dynamik auf, welche die Sprache in bestimmten Situationen bzw. Sektoren besitzt und wie sie sich in diesen verän- dert.
Schreiben, Sprechen und Kommunikation
Die Sprache ist in der Lage Äußerungen auf zwei unterschiedlichen Ebenen Ausdruck zu verleihen. Um auf diese Ebenen Bezug zu nehmen, wende ich mich in aller Kürze Utz Maas (2005) zu. Maas differenziert bei Sprache zwischen gesprochener und geschriebener. Wäh- rend die geschriebene Sprache an ein visuelles Medium geknüpft ist und sich daher entwe- der an eine distanzierte Kommunikation oder an Praktiken bindet, die monologischen Cha- rakter besitzen, wie das Lesen oder das Aufschreiben von Notizen, beruht die gesprochene Sprache einerseits auf dem differenzierten „Umgang mit den leiblichen Ressourcen“26, d.h. den kognitiven und genetischen Voraussetzungen, die letztlich in der Sprachfähigkeit mün- den, andererseits wird sie in der direkten Interaktion mit einem Gesprächspartner situativ kontrolliert entwickelt. Die Gemeinsamkeit zwischen geschriebener und gesprochener Spra- che liegt einzig im Wissen über die Sprache und deren Umgang. Die Schriftsprache hebt sich zudem durch die Intention hervor, Neues von Bekanntem abzugrenzen und zugänglich zu machen.27 Der gesprochenen Sprache - also dem Sprechen - wird in dieser Arbeit mehr Bedeutung zukommen als der Schriftsprache. Daher halte ich es für richtig an dieser Stelle einen Moment zu verweilen und diese Ebene etwas genauer zu betrachten. Sprechen ist ei- ne Form des menschlichen und damit sozialen, also zwischenmenschlichen, Verhaltens, bei dem durch die Erzeugung von Phonemen eine Einzelsprache verwirklicht wird. Charakteri- siert ist das Sprechen dabei durch „Zielverfolgung und Befolgung sozialer Konventionen“28.
Das Sprechen stellt - abseits von Gebärdensprache - eine Grundvoraussetzung für den ge- genseitigen verbalen Gedankenaustausch dar. Ein solcher Austausch wird „Kommunikation“ genannt. Im Allgemeinen wird unter „Kommunikation“ der Bedeutungsaustausch verstanden, welcher jegliches Verhalten beinhaltet, das andere Menschen wahrnehmen und interpretie- ren. Eine Kommunikation muss dabei aus mindestens zwei Gesprächspartnern bestehen, die sich durch eine Sender-Empfänger-Beziehung auszeichnen und gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen, wobei die Rollen zu jeder Zeit gewechselt werden können. Semiotisch betrachtet, basiert eine Kommunikation auf dem Schema „A sendet und B empfängt“. Diese Ansicht übersieht aber die Kontrolle der Übereinstimmungen der jeweiligen Bedeutungen, die A „sendet“ und B „empfängt“ und interpretiert. Sie unterläuft diesen Aspekt und erzeugt damit Unwissenheit und Offenheit zwischen den Gesprächspartner, wodurch die Kommuni- kation letztlich nicht erfolgreich ist. Daher ist diese Annahme abzulehnen.29
Um ein Vielfaches effektiver ist die Perspektive von zirkulären Kommunikationen, bei denen eine Aussage nicht nur Wirkung, sondern zugleich Ursache für eine weitere ist. Grundvo- raussetzung für eine Kommunikation ist dabei die wahrnehmbare und in richtiger Weise in- terpretierbare Übermittlung einer Nachricht vom Sender zum Empfänger. Das ständige Wechselgefüge von Enkodieren und Dekodieren, d.h. das Verschlüsseln von Bedeutungen in Worte, Mimik, Gesten und Symbole und das Entschlüsseln dieser wiederum in Bedeutun- gen, ist mehrheitlich abhängig von der Kultur der Austauschpartner und lässt sich als der Prozess bezeichnen, welcher Kommunikationen zulässt. Solche Bedeutungen entstehen durch die individuelle und psychische Entwicklung beim Umgang mit der Umwelt und dem darin enthaltenen Interaktionspotential sowie der sprachlichen Reichhaltigkeit.30
Ein wichtiges Moment im Kommunikationsprozess ist das Verstehen von übertragenen Be- deutungen. Diese Bedeutungen basieren nicht auf vorhandenen determinierten Abfolgen, sondern werden individuell und intersubjektiv erzeugt. Das gegenseitige Verstehen dieser Bedeutungen führt einerseits dazu, dass während des Kommunikationsprozesses eine in- tersubjektive Wirklichkeit konstruiert werden kann, die über verbale und nonverbale Interakti- onen zum Ausdruck gebracht wird. Solche individuellen Bedeutungen können sich und damit auch die konstruierte und konzeptualisierte Wirklichkeit verändern. Andererseits setzt ein gegenseitiges Verstehen ein gemeinsames Hintergrundwissen voraus, welches Thema und Gegenstand sowie Verhaltensregeln, -erwartungen und -kontrollen ihrer Kommunikation de- finiert. Zudem spielt das Wissen eine spezielle Rolle, das von den Gesprächspartnern in die Kommunikation eingebracht wird. Dieses baut sich aus sozialen und kulturspezifischen Er- fahrungen auf, so Knapp und Knapp-Potthoff (1990), und legt fest, welche Erwartungen als normal, vernünftig und plausibel erscheinen. In diesem Sinne wäre ein Verstehen erfolgreich, wenn es die Akteure dazu veranlassen würde, eigene Äußerungen auf der Grundlage des jeweiligen verstandenen Kontextes zu planen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Dieses Verstehen im sozialen Sinne31 zielt demnach auf die Wahrnehmung der erwarteten An- schlusshandlung des Zuhörers durch den Sprecher ab, d.h. dass ein Verstehen dann erfolg- reich ist, wenn die Anschlusshandlung des Zuhörers dem entspricht, wie es der Sprecher erwartet hat. Dabei gilt es als völlig unerheblich, ob der Zuhörer tatsächlich versteht. Viel entscheidender ist, dass der Sprecher dem Zuhörer ein Verstehen der Bedeutungen zu- schreiben kann.32 Als problematisch ist auf das eben gesagte anzumerken, dass Kommunikationen oder Inter- aktionen nur schwer in Bezug auf die bestehenden jeweiligen Erwartungen zu deuten sind. Es findet dabei nämlich kein expliziter Bedeutungsaustausch statt. Dieser erfolgt fast immer ausschließlich durch verbale oder non-verbale Reize, die nachträglich oder präventiv den Handlungszusammenhang beeinflussen können. Die Unsichtbarkeit interaktionaler Erwar- tungen ist vor allem im Umgang mit (kulturell) Fremden schwierig. Um Unsicherheiten zu vermeiden und die Kontrolle über das Gespräch zu erlangen, schließt der Kommunikations- partner schnell auf Grundlage seiner eigenen Normalitätserwartungen auf das Verhalten und Handeln des Anderen. Das zusätzliche Nichtverstehen oder Missverstehen aufgrund kulturell verschiedener Schemata, durch die Handlungen und Beziehungen gedeutet werden, führt letztlich dazu, dass das kooperativ-kommunikative Verhältnis in Unsicherheit und Irritationen umschlagen kann, die schließlich der Person, deren Intention und deren individuellen Kogni- tionen zugeschrieben werden. Dies birgt neben erfolglosen Kommunikationen auch die Ge- fahr der Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen.33
Erst- und Zweitsprache
Will die menschliche Sprache in ihrer Entstehung beobachtet werden, so ist dies nicht ohne weiteres möglich. Sie entwickelt sich nur beim ersten Lernen einer Sprache im Kindesalter. Dieser Prozess ist der Wandel, die Transformation von einem biologisch-menschlichem We- sen zu einem sozial-menschlichem Wesen. Die Erstsprache wird kulturspezifisch erlernt, „um Kontakt mit anderen Menschen herzustellen und Gedanken und Gefühle auszudrücken“34, was zudem impliziert, dass ein Erlernen der Sprache ohne soziale Bindungen nicht möglich ist. Erstsprache kann auch durch das Synonym „Muttersprache“ verwendet werden, wobei Oksaar (2003) darauf hinweist, dass dabei wohl kaum identische gefühlsmäßige Nebenbe- deutungen auftreten. Weitere Synonyme dafür sind „Primärsprache“, „Grundsprache“, „natür- liche Sprache“ oder „Herkunftssprache“, wobei auch dabei unterschiedliche Konnotationen anhaften. Erstsprache kann sowohl als Anfang einer ganzen Sprachpallette verstanden wer- den, als auch als die Sprache, welche am besten gesprochen wird oder jene, die eine be- sondere und markante individuelle bzw. gesellschaftspolitische Bedeutung hat.35 In dieser Arbeit wird allerdings die Erstsprache als die zuerst gelernte Sprache betrachtet, wobei ich vorzugsweise den Begriff „Herkunftssprache“ verwenden werde, da dieser deutlich auf das zugrunde gelegte Verständnis hindeutet.
Ein Prozess, wie er oben aufgezeigt wurde, d.h. ein Erlernen der Sprache aufgrund des so- zialen Wandels eines Einzelnen, findet beim Zweitspracherwerb nicht statt, da hierbei nicht Sprache allgemein, sondern eine zweite Sprache zur ersten erworben wird. Es geht also nicht darum sprechen zu können, sondern eine fremde Sprachform zu erlernen, die zwar letztendlich auch zur Verständigung im sozialen Umfeld dient, aber nicht mit dem Erst- spracherwerb gleichgesetzt werden kann. Der Begriff „Zweitsprache“ ist mehrdeutig. Einer- seits geht er in die Richtung, dass damit die Sprache bezeichnet wird, welche nach der Erst- sprache als „Fremdsprache“ dazu gelernt und genutzt wird, andererseits werden damit zur Erstsprache alle weiteren Sprachen bezeichnet, egal ob zweite, dritte oder vierte.36 Als Zweitsprache dient in dieser Arbeit einzig die deutsche Sprache. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese als erste oder x-te Sprache erlernt wurde, weil davon auszugehen ist, dass die In- terviewten generell in ihrer schulischen Ausbildung bereits Kontakt mit ihrer ersten oder so- gar zweiten Fremdsprache hatten.
Funktionen der Sprache
Um die Bedeutung der Sprache zu fassen zu bekommen, ist eine Betrachtung ihres funktionalen Charakters unumgänglich. Ich beziehe mich dabei auf Hartmut Esser (2006)37.
Zunächst ist die Sprache eine Ressource, die es ermöglicht weitere Ressourcen zu erwer- ben. Sie ist ein Teil des kulturellen Kapitals und bedarf in vielen Fällen einer Investition, um sich weiterentwickeln zu können. In diesem Sinne regelt sie die wechselseitigen Abhängig- keiten unterschiedlicher Märkte und Branchen. Im Zeichen des lebenslangen Lernens spielt auch die Sprache eine Rolle, indem sie das Lernen also den Erwerb von Wissen in seiner Ef- fizienz beeinflusst, was nicht zuletzt auch für Fort- und Weiterbildungen essentieller Faktor im Berufsleben ist. Die Sprache ist für viele Tätigkeiten eine Ressource, durch die es auf- grund der unterschiedlichen sprachlichen Fertigkeiten zu einer erhöhten Varietät in Bezug auf die Wirksamkeit der Sprache in Zusammenhang mit anderen Kompetenzen kommt. Problematisch daran ist, dass das Erlernen einer neuen Sprache und den damit verbunde- nen kognitiven Veränderungen zu einer Nichtverwertung anderer Aspekte des Menschen kommen kann, wie bspw. die Bildung oder Erfahrungen.
Weiterhin besitzt die Sprache symbolische Funktion, d.h. sie kann „Dinge bezeichnen, innere Zustände ausdrücken, Aufforderungen transportieren und (darüber) Situationen ‚definieren‘“ . Neben der Schaffung von Definitionen kann sie Vorstellungen und Werte inspirieren und damit als Mittel zur kollektiven Identifikation dienen. Im Beruf können dadurch aber auch Ste- reotype aktiviert werden, woraus u.a. Diskriminierungen entstehen. Solche Stereotype fun- gieren auch ganz allgemein auf dem Arbeitsmarkt, wenn es bspw. aufgrund eines Akzentes oder einer für ein Land charakteristischen Sprechweise zu vorschnell geschlussfolgerten Ei- genschaften der MigrantInnen kommt und dadurch wiederum Benachteiligungen entstehen.
Zuletzt weist die Sprache eine Funktion „als Medium der Kommunikation und der darüber verlaufenden Transaktion“ auf und dient dabei vor allem einer gegenseitigen Verständigung zwischen Gesprächspartnern. Auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht sie damit die Einsparung von Transaktionskosten und die Erhöhung der Arbeitsleistung, was sowohl auf das Individuum als auch auf die Institution zurückwirkt. In diesem Zusammenhang lässt sich auch mit Maas (2005) argumentieren. „Sprachen sind als Medium der sozialen Praxis dieser in gewisser Weise vorgängig“. Maas (2005) formuliert damit die soziale Funktion der Sprache und ver- weist auf deren Voraussetzung für soziale Interaktion und zwischenmenschliche Kommuni- kation. Der Gebrauch der Sprache in Dialogen impliziert also bereits, dass überhaupt ein Medium zur Verständigung vorhanden sein muss.38
Deutsche Sprache als kulturelles Kapital
„@(.)@ ähm eine gute Frage aber sehr schwierig zu antworten ähm ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr auf Rumänisch denke ja ähm ich habe viel mit Englisch gearbeitet und als Lehrerin in Rumänien musste ich nur Englisch sprechen, so sind die Unterrichtsstunden dort. Ähm mit meinem Mann am An- fang habe ich nur Englisch gesprochen und alles war normal auf Englisch auch meine Gedanken, aber jetzt manchmal (1) ich weiß dass ich auf Deutsch denken muss und es ist eine ganz anderes Struktur der Sprache (1) Deutsch meine ich äh und ich habe meinen Kopf trainiert und es passiert, dass ich mehr auf Deutsch denke als auf Rumänisch.“ (Daiana, Lehrerin, Z.181-188)
Die Frage, die hier von einer für diese Studie interviewten Rumänin beantwortet wird, ist die nach dem subjektiven Grad der Verinnerlichung der deutschen Sprache. Dabei stellt sie zu- nächst fest, dass die Antwort schwierig ist, was möglicherweise mit dem Problem der Expli- zierung von Sprache im theoretischen Sinne im Allgemeinen zu tun hat. Ihre lange Zeit als Englischlehrerin in Rumänien hat bereits dazu geführt, dass ihr von Geburt an habitualisier- tes Denken in der rumänischen Sprache sukzessive verschwunden ist. An diese Stelle ist bis dahin die englische Sprache getreten. Auch in ihrer ersten Zeit in Deutschland war das Eng- lische die maßgebliche kognitive Sprache, was durch die alltäglichen Kommunikationen mit ihrem Mann in dieser Unterstützung fand. Mittlerweile - d.h. nach neun Monaten Aufenthalt in Deutschland und den ersten Sprachkursen - stellt sie fest, dass durch den Erwerb der deutschen Sprache auch ihre Gedankensprache modifiziert wird, sodass sie immer öfter auch deutsch denkt.
Anhand dieser Darstellung möchte ich den von Pierre Bourdieu (1992)39 dargelegten Begriff des inkorporierten kulturellen Kapitals aufzeigen, ohne dabei jedoch seine gesamte Theorie aufzuführen. Das inkorporierte Kulturkapital setzt durch seine Körpergebundenheit einen Verinnerlichungsprozess voraus, welcher vor allem Zeit kostet, die vom Individuum „persön- lich investiert werden“40 muss und nicht durch eine fremde Person vollzogen werden kann.
Neben der Zeit, so Bourdieu, muss zusätzlich ein Maß an individuellen Entbehrungen in Kauf genommen werden, um den Erwerb dieser Form von Bildung zu gewährleisten.
Die Sprache kann als ein solches inkorporiertes Kulturkapital verstanden werden. Sie wird in Form der Erstsprache erlernt und zeitlebens bei regelmäßiger Benutzung dieser auch behal- ten, wobei gerade hier deutlich wird, dass diese erste Aneignung das kulturelle Kapital nach- haltig prägt. Die Rumänin Daiana aus dem angeführten Interviewabschnitt durchlief diesen Prozess beim Erwerb der rumänischen Sprache als ihre Erstsprache. Ihre Aneignung der englischen Sprache als Zweitsprache und die lange und intensive Nutzung dieser stellt einen ähnlichen Prozess dar, obgleich, dieser wie gesagt durch die erste Aneignung geprägt wur- de. Der Erwerb der deutschen Sprache macht nun nicht nur den investierten hohen Zeitan- satz ihres Sprachkapitals allgemein deutlich, sondern bringt auch die angesprochenen Ent- behrungen mit sich, wie es ihr fehlender Arbeitsmarktzugang zeigt (näheres dazu unter 5.2.).
„Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der ‚Person‘, zum Habitus geworden ist“41. Der feste Bestandteil ist beim Erwerb der Sprache bspw. dann gegeben, wenn wie bei Daiana, die Denkprozesse bereits in der neuen Sprache erfolgen, wie sie es im extremen Fall mit dem Englischen erfuhr, da hierbei mittelfristig das Rumänisch, weil nicht mehr benötigt, abgelegt wurde. Ihre Erfahrungen zeigen, dass auch das Deutsche in ihre Denksprache Einzug hält.
Diese Habitualisierung impliziert, dass ein solches Kapital „nicht durch Schenkung, Verer- bung, Kauf oder Tausch kurzfristig weitergegeben werden“42 kann. Die Weitergabe wird be- einflusst durch die Verbundenheit von Kulturkapital und biologischer Einzigartigkeit und er- folgt „auf dem Weg der sozialen Vererbung (…), was freilich immer im Verborgenen ge- schieht und häufig ganz unsichtbar bleibt“43. Dabei spielt das familiale Umfeld eine Rolle, von dem das Repertoire des kulturellen Kapitals und die für den Erwerb benötigte Zeit abhängen. D.h. das vorhandene Kapital bestimmt einerseits die Reichhaltigkeit der Inhalte der Weiter- gabe und andererseits wirkt sich dieses auf die Zeitinvestition aus, wenn gleichzeitig zur So- zialisation auch die Aneignung stattfindet.
Im Fall der Sprache ist dies dann ausschlaggebend, wenn MigrantInnen bspw. nicht nur im Deutschkurs die neue Sprache sprechen, sondern gleichsam in ihrem familialen und weiter- führend sozialen Umfeld. Parallel zu den Gesprächen an sich (Sozialisation) kann dabei zeitgleich die deutsche Sprache erlernt werden (Aneignung). Allerdings ist der Erwerb von weiteren Faktoren abhängig, wie der Tatsache des Vorhandenseins unterschiedlicher Spra- chen in einer Familie. Eine solche Differenz „führt zunächst zu Unterschieden beim Zeitpunkt des Beginns des Übertragungs- und Akkumulationsprozesses, sodann zu Unterschieden in der Fähigkeit, den im eigentlichen Sinne kulturellen Anforderungen eines langandauernden Aneignungsprozesses gerecht zu werden“44. Ein Beispiel dafür liefert Emine, eine türkische
[...]
1 Wittgenstein 2003, S.86 (Hervorhebungen im Original)
2 vgl. Mecheril 2004, S.27
3 Mecheril 2004, S.27
4 Münz/ Seifert/ Ulrich 1999, S.42
5 vgl. Meinhardt 2005, S.31 ff.
6 Mecheril 2004, S.32
7 Münz/ Seifert/ Ulrich 1999, S.46
8 zur Diskrepanz und der Mehrdeutigkeit des Begriffes „Gastarbeiter“ vgl. Mecheril 2004, S.34 f.
9 vgl. Mecheril 2004, S.32 ff.
10 Herbst/ Weber 1961, S.44 f.
11 vgl. Mecheril 2004, S.35 ff.
12 Behrensen/ Westphal 2009, S.36 (Hervorhebungen im Original)
13 Maas 2005, S.105
14 vgl. Maas 2005, S.104 ff.; Oksaar 2003, S.117 ff.
15 Thol, 1983, S.8
16 Ehnes/ Schrandt 2007
17 Thol 1983, S.9
18 vgl. Morris 1981, S.113 f.
19 Oksaar 2003, S.16
20 Oksaar 2003, S.16
21 Oksaar 2003, S.21
22 Oksaar 2003, S.21
23 Maas 2005, S.102
24 vgl. Maas 2005, S.102 f.
25 Oksaar 2005, S.21
26 Maas 2005, S.112
27 vgl. Maas 2005, S.112
28 Battacchi/ Suslow/ Renna 1997, S.67
29 vgl. Hepp 2008, S.117
30 vgl. Kartari 1997, S.9 f.; Veil 1993, S.61
31 Im Vergleich hierzu steht das Verstehen im kognitionstheoretischen Sinne; vgl. Schmidt, S. J. (1996): Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt/ Main. S.122 ff.
32 vgl. Abeldt/ Kreher 1996, S.106; Geffert 2006, S.105; Knapp/ Knapp-Potthoff 1990, S.66
33 vgl. Knapp/ Knapp-Potthoff 1990, S.67
34 Oksaar 2003, S.13
35 vgl. Oksaar 2003, S.13
36 weiterführend dazu Oksaar 2003
37 vgl. Esser 2006, S.52-57
38 vgl. Esser 2006, S.52 ff.
39 vgl. Bourdieu 1992, S.53-63
40 Bourdieu 1992, S.55
41 Bourdieu 1992, S.56
42 Bourdieu 1992, S.56 (Hervorhebung im Original)
43 Bourdieu 1992, S.57
44 Bourdieu 1992, S.58 f.
- Arbeit zitieren
- B.A Bildungs- und Erziehungswissenschaftler Michel Beger (Autor:in), 2011, Sprache und Beruf - Eine dokumentarische Analyse der praktischen Erfahrungen mit der deutschen Sprache als Zweitsprache von Menschen mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171879
Kostenlos Autor werden













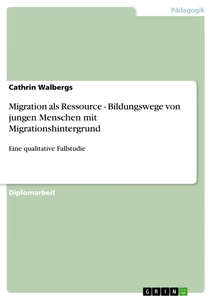
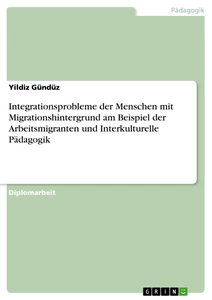



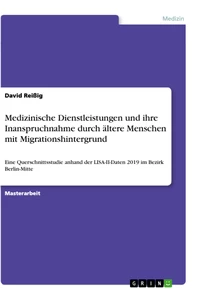



Kommentare