Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Aktualität des Themas
1.2. Der Blick nach außen
1.3. Aufbau der Untersuchung
2. Begriffsdefinition
2.1. Plebiszit
2.2. Volksinitiative
2.3. Volksbegehren
2.4. Volksentscheid und Referendum
2.5. Recall
2.6. Volksbefragung
3. Der Neuaufbau der Demokratie im Westen Von der „Stunde Null“ bis zur Ratifizierung des Grundgesetzes
3.1. Entwürfe einer gesamtdeutschen Verfassung
3.1.1. Die politischen Parteien
3.1.1.1. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der SPD
3.1.1.2. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der CDU/CSU
3.1.2. Die Verfassungsdiskussion im Büro für Friedensfragen
3.1.3. Die Verfassungsdiskussion im Zonenbeirat
3.2. Das "Volksbegehren für die Einheit Deutschlands“
3.3. Die Wirkung der SED-Politik im Westen
3.3.1. Positionsänderungen bei der CDU/CSU
3.3.2. Positionsänderungen bei der SPD
3.3.3. DPD und LDP (Liberale)
3.3.4. Die Deutsche Partei
3.3.5. Die Ministerpräsidenten und das Gründungsplebiszit
3.4. Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee
3.4.1. Gründungsplebiszit
3.4.2. Referendum
3.4.3. Volksgesetzgebung
3.4.4. Direktwahl des Staatsoberhauptes
3.5. Die Diskussionen im Parlamentarischen Rat
3.5.1. Gründungsplebiszit
3.5.2. Referendum
3.5.3. Volksgesetzgebung
3.5.4 Territorialplebiszite
3.6. Die Ratifizierung des Grundgesetzes durch die Landtage
3.7. Ergebnisse
4. Reformansätze für eine plebiszitäre Öffnung des Grundgesetzes bis zur Wiedervereinigung
4.1. Die fünfziger Jahre – Stillstand
4.2. Die sechziger Jahre - Bewegung
4.3. 1971 – Enquete-Kommission Verfassungsreform
4.3.1. Stärkung der politischen Mitwirkungsrechte der Bürger
4.3.1.1. Direktwahl des Bundespräsidenten
4.3.2. Das politische Ergebnis der Kommission
4.3.2. Exkurs: Weimarer Erfahrungen
4.4. Die achtziger Jahre
5. Die Verfassungsdiskussion im Zuge der Wiedervereinigung
5.1. Zwei Wege zur deutschen Einheit
5.2. Der Einigungsvertrag
5.3. Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder
5.4. Kommission Verfassungsreform
5.5. Die Gemeinsame Verfassungskommission
5.5.1. Gremienstruktur der GVK
5.5.2. Themenkatalog der Gemeinsamen Verfassungskommission
5.5.3. Entscheidungsprozess der Gemeinsamen Verfassungskommission
5.5.3.1. Position der SPD
5.5.3.2. Positionen der CDU/CSU
5.5.3.3. Bündnis 90/Die Grünen
5.5.3.4. FDP und PDS/LL
5.5.4. Die 6. Sitzung der GVK
5.5.5. Die Sachverständigenanhörung
5.5.5.1. Die Fragerunde
5.5.6. Die 17. Sitzung der GVK
5.5.7. Bewertung der Diskussion
6. Versuch einer Systematisierung und Analyse der Debatte
6.1. Kritik an der bisherigen Debatte
6.1.1. Exkurs: Die Kompatibilität direktdemokratischer Institution zum politischen System der Bundesrepublik.
6.1.1.1. Idealtypische Bestandteile politischer Systeme
6.1.1.2. Beschreibung des politischen Systems der Bundesrepublik
6.1.1.3. Verträglichkeit bestimmter plebiszitärer Elemente mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland
7. Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik
7.1. Trend zur Parteienoligarchie
7.2. Bevormundung des Bürgers
7.3. Gemeinwohlorientierung
7.3.1. Egoismen statt Gemeininteresse?
7.3.2. Berufspolitiker
7.3.3. Partikularinteressen
7.3.4. Selbstblockade des Systems
8. Mehr direkte Demokratie – ein Weg aus der Krise?
9. Exkurs: Umfragen – ein plebiszitäres Element?
Quellen und Literatur
A bkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Aktualität des Themas
„Der Ruf nach plebiszitären Verfassungsinstitutionen wird sich in politisch erträglichen Grenzen halten, solange die Wähler die Überzeugung besitzen, dass sie in ihren Parteien Gebilde besitzen, die ihre Wünsche und Ansichten ausreichend vertreten“[1]. Zwar geht in Deutschland niemand für mehr direkte Mitbestimmungsrechte auf die Straße, allerdings zeigen Umfragen immer wieder deutlich, dass die Mehrheit der Bundesbürger sich mehr Einflussmöglichkeiten auf politische Entscheidungen wünscht[2]. Würde eine große Mehrheit der Bundesbürger mit dem derzeitigen politischen System in völliger Übereinstimmung stehen, wäre eine Auseinandersetzung mit dem Thema Direkte Demokratie zwar vielleicht von theoretischem Interesse, für die politische Wirklichkeit aber irrelevant.
Am 1.1.2002 wurde wohl vielen Bundesbürgern erstmals bewusst, wie gering ihr direkter Einfluss auf politische Beschlüsse tatsächlich ist. An diesem Tag wurde der Euro offizielles Zahlungsmittel der Bundesrepublik Deutschland. Eine Entscheidung, von deren Reichweite es wenige gab in der jungen Geschichte Nachkriegsdeutschlands. Eine Entscheidung, die jeden betraf und die ökonomischen Grundlagen der Bundesrepublik nachhaltig und wahrscheinlich unwiderruflich verändern würde. Das Volk wurde nicht gefragt. Das Volk musste auch nicht gefragt werden! Im Grundgesetz ist nur für den Fall der Neugliederung des Bundesgebietes eine Volksabstimmung vorgesehen.[3] Von diesem Sonderfall abgesehen ist das politische System der Bundesrepublik rein repräsentativer Art.[4] Das Initiativrecht für Gesetzesvorhaben obliegt der Regierung, dem Bundestag oder der Ländervertretung. Gesetzesentwürfe werden dem Parlament zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt.[5] Im Gesetzgebungsprozess ist der Bürger nicht vorgesehen.
1.2. Der Blick nach außen
International ist Deutschland mit seinem zumindest auf Bundesebene strikt repräsentativen Regierungssystem eher eine Ausnahme. In den meisten Verfassungen westlicher Demokratien sind Instrumente Direkter Demokratie stärker verankert als in der Bundesrepublik[6]. Selbst in Großbritannien, wo die Idee der Parlamentssouveränität ihren Ursprung hat und zu einem scheinbar unverrückbaren Grundsatz im politischen System erstarrt zu sein scheint, sind Formen Direkter Demokratie stärker ausgeprägt als in der Bundesrepublik. Gerade seine umfassende Souveränität eröffnet dem Parlament dort die Möglichkeit, kraft eigener Autorität konsultative oder verbindliche Referenden abzuhalten. Historisch bedeutsam wurde dies Instrument, dem natürlich eine gewisse Selbstaushöhlung parlamentarischer Souveränität immanent ist, bisher einmal. 1975 ließ die damalige Labour-Regierung eine Volksabstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der EG abhalten, um der wachsenden Zahl der EG-Gegner in der Bevölkerung und im Parlament den Wind aus den Segeln zu nehmen und Großbritanniens Mitgliedschaft in der EG langfristig festzuschreiben.[7]
1.3. Aufbau der Untersuchung
Dass die Verfassung der Bundesrepublik nahezu frei von plebiszitären Elementen ist, ist natürlich kein Zufall. Hierfür gibt es historische und politische Gründe. Diese zu beleuchten, ist erstes Ziel dieser Arbeit. Zunächst soll hierbei der Fokus auf die Nachkriegszeit gelegt werden, und untersucht werden, welche politischen Überlegungen auf deutscher und alliierter Seite für den Prozess der Konstituierung ausschlaggebend waren. Meine Arbeit bezieht sich hierbei zum großen Teil auf die Untersuchungen von Otmar Jung, der als erster die „Plebiszitfeindlichkeit“ des Grundgesetzes unter dem Blinkwinkel des aufkommenden Kalten Krieges zu verstehen versuchte.
Im nächsten Abschnitt soll der Blick auf die bundespolitischen Entwicklungen bis zur Wiedervereinigung gerichtet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Arbeit der Enquete- Kommission Verfassungsreform, deren Ziel es war, das Grundgesetz „einer Bestandsaufnahme und Überprüfung zu unterwerfen“.[8] Auch eine Verstärkung der direkten Beteiligung der Bürger am politischen Prozess wurde hier zum Thema.
Im letzten Teil dieses Abschnitts soll auf die jüngste Geschichte der Bundesrepublik eingegangen werden, als die Wiedervereinigung erneut eine Befassung des Parlaments mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen des neuen, größeren Deutschland möglich und nötig machte.
Im zweiten Teil dieser Arbeit soll das zuvor untersuchte politische Für und Wider zum Thema Direkte Demokratie in einen größeren Rahmen gegossen werden. Gefragt werden soll, in wie weit sich die zuvor beschriebene Argumentation einordnen lässt und ausblickend untersucht werden, welche Auswirkungen die Einführung bestimmter plebiszitärer Elemente auf Staat und Gesellschaft haben würde. Wären sie tatsächlich in der Lage, „brachliegende Reserven an Mitwirkungsbereitschaft und Engagement zu mobilisieren und dem umsichgreifenden Ohnmachtgefühl der Bürgerinnen und Bürger entgegenzuwirken“?[9] Oder würde sie vielmehr eine Destabilisierung des politischen Systems der Bundesrepublik mit sich bringen?
2. Begriffsdefinition
Die bestimmenden Begriffe, die wahrscheinlich in jeder Arbeit vorkommen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Direkte Demokratie auseinandersetzt, sind: Plebiszit Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid, Volksbefragung. Und hier taucht auch schon ein erstes Problem auf. In der Literatur haben sowohl international als auch innerhalb eines Sprachraumes die einzelnen Begriffe einen unterschiedlichen Bedeutungsinhalt. Während im französischen beispielsweise Plebiszit und Referendum bedeutungsgleich benutzt werden, versteht man im deutschen Sprachgebrauch unter einem Plebiszit einen allgemeinen Oberbegriff für alle Spielarten Direkter Demokratie.[10] Auch innerhalb der deutschen Wissenschaftsgemeinde gibt es Unterschiede bei der Definition bestimmter Begriffe. Einige Autoren sehen beispielsweise in der Volksinitiative eine Vorstufe zum Volksbegehren, während andere die Begriffe synonym verwenden[11].
Einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem entsprechenden Thema ist daher ein Kapitel mit Begriffsdefinitionen voranzustellen. Um nicht im Ungefähren zu verweilen, ist es notwendig, vorab klarzustellen, was gemeint ist, wenn die Begriffe Plebiszit, Referendum, Volksinitiative oder Volksbegehren benutzt werden.
2.1. Plebiszit
Der lateinische Ursprung des Begriffes Plebiszit ist Plebi scitum, was wörtlich übersetzt Entscheidung des Volkes bedeutet[12]. In der deutschen wissenschaftlichen Diskussion wird der Begriff in der Regel breiter gefasst. Plebiszit wird hier als „Oberbegriff für sämtliche Erscheinungsformen verwendet, in denen das Volk unmittelbar an der staatlichen Willensbildung beteiligt ist“[13]. Plebiszitäre Elemente sind dementsprechend alle dem Bürger gesetzlich eingeräumten Rechte zur unmittelbaren Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess.
2.2. Volksinitiative
Eine Volkinitiative ermöglicht es einer Gruppe von Bürgern, ein bestimmtes politisches Anliegen direkt in das Parlament einzubringen. Sofern es gelingt, genügend Unterschriften für ihr Anliegen zusammenzutragen, muss das Parlament sich mit einem bestimmten Thema auseinander setzen. Die Vertreter der Initiative haben hierbei das Recht, angehört zu werden. Die Volksinitiative kann allgemein gefasst sein. Ihr muss kein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zu Grunde liegen.[14]
2.3. Volksbegehren
„Ein Volksbegehren ist eine Gesetzesinitiative.“[15] Anders als bei der Volksinitiative muss dem Volksbegehren ein ausformulierter Gesetzesentwurf zu Grunde liegen. Je nach Verfassungslage kann ein Volksbegehren den Erlass oder die Verwerfung eines Gesetzes, die Auflösung des Parlaments oder die Neugliederung des Staates zum Ziel haben.[16] Wie die Volksinitiative muss auch das Volksbegehren ein bestimmtes Quorum, d.h. eine bestimmte Anzahl von Unterstützern erreichen, um zustande zu kommen. Ist dieses Quorum erreicht und verstößt das Volksbegehren auch sonst gegen keine gültige Rechtsnorm, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich das Verfahren weiter entwickeln kann. Einmal kann das zuständige Parlament das Volksbegehren annehmen, womit die Initiatoren ihr Ziel erreicht hätten. Tut es dies nicht, so folgt dem Volksbegehren entweder „automatisch“ oder auf Antrag ein Volkentscheid.[17]
2.4. Volksentscheid und Referendum
Der Begriff Volksentscheid wird in der Literatur häufig synonym zum Wort Referendum verwendet. Das ist aber nicht ganz korrekt, denn nicht jeder Volksentscheid ist auch ein Referendum. „Anders als beim Volksbegehren mit anschließendem Volksentscheid geht dem Referendum stets eine parlamentarische Er- und Durcharbeitung voraus.“[18] Referendum kommt vom lateinischen ad referendum, was soviel meint wie etwas vortragen. Dem Volk wird etwas zur Entscheidung vorgelegt. Das Volk nimmt gewissermaßen die Position eines „Schiedsrichters“ (engl.referee) ein, ohne Einfluss darauf zu haben, worüber es richtet.[19]
Wenn einem Volksentscheid eine Volksinitiative und/oder ein Volksbegehren vorausging, kann man nicht von einem Referendum sprechen, da in diesem Fall das Volk selbst bestimmt, worüber es abstimmt. Ihm wird keine Entscheidung mehr zugetragen, es bestimmt selbst, was zur Entscheidung ansteht. In diesem Fall ist ein Volksentscheid Teil eines Volksgesetzgebungsverfahrens.[20]
Referenden lassen sich noch weiter in fakultative Referenden, obligatorische Referenden und Verfassungsreferenden unterteilen. Vom fakultativen Referendum spricht man, wenn ein Staatsoberhaupt, eine Regierung, eine Parlamentsmehrheit oder eine qualifizierte Minderheit nach eigenem Ermessen dem Volk eine bestimmte Sachfrage zur Entscheidung vorlegt. Wenn die Verfassung eines Landes verlangt, dass bei einem bestimmten Vorhaben, beispielsweise der Neugliederung des Staatsgebietes oder einer Verfassungsänderung, ein Volksentscheid durchgeführt wird, spricht man von einem obligatorischen Referendum. Anders als beim fakultativen Referendum liegt es hier nicht in der Hand eines Staatsorgans, ob ein Referendum durchgeführt wird.[21] Ein Verfassungsreferendum ist ein Referendum, das ein verfassungsänderndes Ziel verfolgt. Dieser Form des Referendums unterliegen in der Regel erhöhte Mehrheitserfordernisse.
Ein Sonderfall des Referendums ist ein zur Volksabstimmung gestellter Verfassungsentwurf. Ein solcher Volksentscheid ist kein fakultatives Referendum im eigentlichen Sinn. Zwar wird dem Volk hier auch etwas „von oben“, von einer Verfassunggebenden Versammlung oder einer Parlamentsmehrheit, zur Entscheidung vorgelegt, allerdings nicht ein einzelnes Gesetz oder Gesetzespaket, sondern das Regelwerk nach dem das zukünftige Zusammenleben im Staat organisiert werden soll. Ein derartiger Volksentscheid wird in dieser Arbeit als Gründungsplebiszit bezeichnet.
2.5. Recall
Außer bei Sachentscheidungen gibt es auch bei Personalentscheidungen Formen unmittelbarer Bürgerbeteiligung. Die in vielen Staaten vorgesehene Direktwahl des Staatsoberhauptes kann man durchaus als einen Volksentscheid betrachten. Für das Recht auf Wiederabberufung einer gewählten Person oder eines gewählten Parlaments durch einen Volksentscheid hat sich der dem US-Verfassungsrecht entstammende Begriff Recall etabliert. Auch in einigen deutschen Länderverfassungen[22] hat dieses Element direkter Demokratie seine Entsprechung gefunden.[23]
2.6. Volksbefragung
Eine Volksbefragung „wird vom Repräsentativorgan oder einer qualifizierten Parlamentsminderheit als eine offizielle informatorische Befragung des Volkes veranlasst“[24]. Eine Volksbefragung hat in der Regel keinen direkten verbindlichen Charakter für die Regierung. Sie ist rein informativer Natur, aber dennoch mehr als eine „staatlich organisierte Umfrage“. Eine Regierung kann sich, auch wenn dies rechtlich durchaus möglich wäre, nicht ohne weiteres über ein Mehrheitsvotum hinwegsetzen, ohne politisch Schaden zu nehmen.
illustration not visible in this excerpt
„Die Mission dieser Alliierten wurde erfüllt um 02.45 Ortszeit, am 7. Mai 1945.“[25] Mit diesem knappen Telegramm meldete Eisenhower die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit das Ende des bisher verheerendsten Krieges der Menschheitsgeschichte. Nach dem zwölf Jahre dauernden „1000 jährigen Reich“ standen die Deutschen vor dem Nichts. Nicht nur, dass der Krieg verloren war, die Menschen mussten erkennen, dass sie bis zuletzt einem verbrecherrischen Regime, auf dessen Tagesordnung millionenfacher Mord an Unschuldigen stand, die Treue gehalten hatten. Verständlich, dass man vergessen und verdrängen wollte. Vergangenheitsbewältigung war in den ersten Nachkriegsjahren kein großes Thema. Mit schlechtem Gewissen richtete man den Blick nach vorn. Der Wiederaufbau, darum ging es in den ersten Jahren nach dem Krieg. Nicht nur der physische Wiederaufbau der zerbombten Städte, Industrieanlagen und Verkehrswege ist damit gemeint, auch institutionell musste Deutschland wiederaufgebaut werden. Hierbei gab es kaum Traditionen, an die man hätte anknüpfen können. Nach dem Willen der Alliierten sollte das neue Deutschland demokratisch sein.[26] Das einzige demokratische System, was Deutschland aber bis dahin kennen gelernt hatte, war die Weimarer Republik. Und die war bekanntlich kläglich gescheitert. Man musste etwas Neues schaffen. An Weimar konnte und wollte man nicht anknüpfen.
3.1. Entwürfe einer gesamtdeutschen Verfassung
Bei dem demokratischen Neuaufbau Deutschlands waren drei politische Kräfte maßgeblich. Zuerst, was keine Überraschung sein dürfte, die Alliierten selbst, die „die höchste Regierungsgewalt in Deutschland“[27] ausübten. Außerdem die sich bereits kurz nach Kriegsende neu formierenden politischen Parteien und die aus den Wahlen von 1946/47 hervorgegangenen Landesregierungen. Die Rollen, die diese politischen Kräfte bei der Ausarbeitung der künftigen Verfassungsordnung innehatten (denn hierum geht es in erster Linie, wenn von „institutionellem Neuaufbau“ die Rede ist) sollen im Folgenden genauer untersucht werden. Natürlich gab es noch andere gesellschaftliche Kräfte von Rang in Deutschland. Ihr Einfluss auf die Ausgestaltung der Nachkriegsordnung war aber gering. Verfassungen werden nicht von Gewerkschaften oder Unternehmerverbänden beraten und ratifiziert. Sie können versuchen, Einfluss auf einzelne Abgeordnete oder Parteien auszuüben – mehr nicht!
3.1.1. Die politischen Parteien
Es war noch kein Jahr seit Kriegsende vergangen, da blühte das politische Leben in Deutschland in ungeahnter Vielfalt erneut auf. Als erstes gründete sich die Kommunistische Partei Deutschland (KPD) neu. Am 15. Juni 1945 verkündete Otto Grotewohl die Neugründung der SPD. Am 26. Juni 1945 riefen Ernst Lemmer und Jakob Kaiser die CDU ins Leben. Im Oktober 1945 konstituierte sich die CSU in Würzburg. Am 11. und 12. Dezember 1948 schlossen sich mehrere liberale Parteien in Heppenheim zur FDP zusammen und überwanden ihre schon fast traditionelle Zersplitterung. Die Liste ist nicht vollständig, soll aber genügen, da dies die wesentlichen politischen Kräfte bei den Parteien der Nachkriegszeit waren.
Die Alliierten standen den Parteigründungen offen gegenüber[28], war doch die Demokratisierung Deutschlands erklärtes Ziel. Zwar zeigten sich die Siegermächte, besonders in den Westzonen, bei der Lizenzierung der Parteien zunächst bedeckt. Dies hatte aber einen guten Grund. Die Parteien sollten nicht nur demokratische Ziele verfolgen, sondern auch in ihrem inneren Aufbau demokratisch sein. Man wollte keine neuen „Führerparteien“. Der Aufbau sollte sich „von unten nach oben“ vollziehen. Daher duldeten die Alliierten lokale Parteigruppen, lizenzierten die Parteien offiziell aber erst relativ spät im August/September bzw. Dezember 1945.[29]
Die Parteien in der direkten Nachkriegszeit waren in der historisch interessanten Situation, dass noch kein verfassungspolitischer Rahmen existierte, der das Regelwerk vorgab, nach dem sie handeln konnten und mussten. Diese Verfassung musste erst noch geschaffen werden, und sie selbst würden bei der Ausarbeitung der Verfassung eine herausragende Rolle einnehmen können. Doch welchen Vorstellungen, Ideen und Idealen folgten die Parteien bei ihren Entwürfen für den zukünftigen Aufbau des deutschen Staatswesens? Wie sah das Verhältnis von plebiszitären zu repräsentativ-demokratischen Verfassungselementen aus?
3.1.1.1. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der SPD
Am 25. September 1946 setzte der Parteivorstand der SPD einen Ausschuss für verfassungspolitische Fragen ein. Seine Aufgabe war es, Richtlinien für den Aufbau eines neuen Gesamtstaates zu erarbeiten. In der endgültigen Vorlage dieses Ausschusses, die am 13. und 14. März vom Parteivorstand gebilligt wurde, ist bereits eine klare Weichenstellung in Richtung repräsentative Demokratie zu erkennen. „Das Recht, Reichsgesetze vorzuschlagen, liegt ausschließlich bei dem Reichstag oder bei der Reichsregierung. Die Gesetze werden vom Reichstag beschlossen. Ein Volksentscheid ist nur für bestimmte in der Verfassung festzulegende Fälle unter Wahrung bestimmter Verfahrensvorschriften möglich“,[30] heißt es darin. Der Volksgesetzgebung wurde ebenso wie dem fakultativen Referendum mit dieser Vorlage bereits eine klare Absage erteilt. Lediglich dem obligatorischen Referendum stand man neutral gegenüber.
Acht Monate später, auf dem Nürnberger Parteitag, ging Walter Menzel, der formelle Verfasser der Richtlinie, auf jene Entscheidung ein und gab zwei Gründe für sie an. Er argumentierte, dass man bei einer guten parlamentarischen Repräsentation auf „das schwerfällige Instrument des Volksentscheides oder des unmittelbaren Volksbegehrens auf wesentliche in der Verfassung vorgesehene Fälle beschränken“ könne. Außerdem sah er die Gefahr, dass, „würde man die unmittelbare Volksbefragung in allen Fällen ohne weiteres zulassen", wäre es für die gewählten Volksvertreter zu leicht, sich in „schwierigen Fragen der Verantwortung (...) zu entziehen“[31].
Dieses Misstrauen seinen Parlamentskollegen gegenüber scheint tatsächlich ein wichtiger Grund bei Menzel gewesen zu sein, denn auch ein Notstandsrecht wurde mit derselben Begründung zurückgewiesen.[32] Die Erinnerung an den 23. März 1933, als der Reichstag mit 444 zu 94 Stimmen das verhängnisvolle „Ermächtigungsgesetz“ beschloss, war noch lebendig. Vermutlich wollte der Ausschuss ausschließen, dass etwas Vergleichbares über den Weg eines Notstandsrechts noch einmal geschehen könnte.
Worin allerdings Menzels Befürchtung wurzelte, dass ein Parlament sich durch häufigen Gebrauch fakultativer Referenden obsolet machen könnte, ist nicht einsichtig. „Historisch gesehen war diese Besorgnis abstrakt.“[33] Zur Zeit der Weimarer Republik ließ der Reichstag nicht ein einziges Referendum abhalten,[34] obwohl die Verfassung diese Möglichkeit vorsah.[35] Ebenso zwiespältig ist das Argument der „Schwerfälligkeit“. Genauso gut wie diese Begründung gegen plebiszitäre Elemente herhalten kann, kann es für vereinfachte Verfahrensregeln angeführt werden. Auf dem Nürnberger Parteitag, der eigentlich das Forum für derartige Diskussionen bieten sollte, kamen solche Argumente kaum zur Sprache. Jung vermutet, dass es einen „dunklen Konsens“ darüber gab, „dass man die reichen direktdemokratischen Möglichkeiten der Weimarer Verfassungslage radikal zurückschneiden wollte.“[36]
3.1.1.2. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der CDU/CSU
Im Februar 1947 bildete die CDU/CSU ihren ersten überregionalen Verfassungsausschuss. Als Tagungsort entschied man sich für Heppenheim. Schon bei den ersten Beratungen dieses Ausschusses zeichnet sich ab, dass die CDU/CSU zumindest in ihrer Anfangszeit direktdemokratischen Elementen offener gegenüber stand als die SPD, obwohl die Parteitraditionen[37] eigentlich Gegenteiliges erwarten ließen.
Ein erstes Thesenpapier des Heppenheimer Ausschusses enthält die Möglichkeit einer Parlamentsauflösung durch einen Volksentscheid. Ein breiter Konsens herrschte im Ausschuss darüber, dass die neue deutsche Verfassung nach Annahme in beiden Kammern auch „noch durch einen Volksentscheid zu billigen“[38] sei. Die Frage nach der Direktwahl des Staatsoberhauptes ließ der Ausschuss zunächst offen, ebenso die der Gesetzgebungskompetenzen. Entsprechend findet sich auch keine Zeile zur Volksgesetzgebung. Eine klare Absage wurde hingegen dem fakultativen Referendum erteilt. Auch ein Referendum für den Fall eines unüberbrückbaren Disputes zwischen Parlament und Länderkammer wurde in den Heppenheimer Entwurf nicht aufgenommen, obwohl in früheren Entwürfen dieses Element noch vorkam.[39] Durchgesetzt hat sich die Auffassung, dass gerade der Verzicht auf ein derartiges Instrument beide Kammern zu einem verantwortlichen Handeln zwingen würde.[40]
Vielleicht noch bedeutender für die Verfassungsdiskussion in der CDU/CSU als der offizielle Verfassungsausschuss war die Arbeit des informellen Ellwanger Freundeskreises, dessen selbstgestellte Aufgabe die Koordination der Unionsinteressen auf Länderebene war. Ein interessanter Punkt ist, dass ab Dezember 1947 dieser seine Beratungen über die künftige Verfassung Deutschlands auf zwei Ebenen führte. Einmal wurde für Gesamtdeutschland geplant und „Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung“ vorgelegt.[41] Gleichzeitig aber sah man, dass sich die Ostzone zunehmend von den drei Westzonen abkoppelte, so dass man es für erforderlich erachtete, „Vorschläge für eine Übergangsregelung“[42], mit zwei parallel existierenden deutschen Staaten zu erarbeiten.
Die „Grundsätze für die Deutsche Bundesverfassung“[43] sind für unsere Fragestellung nicht sehr ergiebig, da sie keine Aussagen über zukünftige Gesetzesvorhaben machen. Sie setzen sich hauptsächlich mit dem Verhältnis von Bundesstaat und Ländern auseinander. Entsprechend lässt sich aus diesem Papier auch weder eine Ablehnung noch eine Zustimmung zu plebiszitären Elementen herauslesen. Interessanter sind da schon die „Vorschläge für eine Übergangsregelung“, da hier entsprechende Vorschläge nachzulesen sind. Dieser Entwurf verfolgte einen extrem föderalistischen Ansatz. Das Bundesparlament sollte nicht direkt gewählt, sondern von Delegierten der Länderkammern gestellt werden. Gesetzentwürfe mussten von beiden Kammern angenommen werden. Lehnte der „Länderrat“ einen Gesetzentwurf ab, konnte der „Volksrat“ dieses Votum nur mit 2/3 Mehrheit überstimmen. Eine Volksgesetzgebung oder parlamentarische Referendumsoptionen finden sich in dem Entwurf nicht wieder. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, betrachtet man die Aufgabe, die der Bund nach diesen Vorschlägen während dieser Übergangszeit einnehmen sollte. Die bestand nämlich hauptsächlich darin, die „Wirtschaftseinheit (...) wieder herzustellen und die soziale Wohlfahrt seiner Bevölkerung zu fördern und zu sichern.“[44] Der Bund sollte also eine Koordinierungsstelle landeshoheitlicher Wirtschaftspolitik sein und entsprechende Kompetenzen erhalten. Befugnisse die hierüber hinaus gingen, sollten einem Bundesorgan – auch das Staatsvolk kann man als Bundesorgan betrachten – anscheinend nicht gegeben werden.
Eine Übereinstimmung zwischen den Papieren ist allerdings bemerkenswert. Beide fordern, dass die endgültige Bundesverfassung dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Die Grundsätze gehen hierbei sogar noch einen Schritt weiter und fordern in einer Homogenitätsklausel, dass auch die Verfassungen der Länder vom Volk angenommen werden müssen.[45]
3.1.2. Die Verfassungsdiskussion im „Büro für Friedensfragen“
Im Frühjahr 1947 sollte in Moskau eine Außenministerkonferenz stattfinden, die sich speziell mit Deutschland befassen sollte. Aus diesem Grund wollten die Ministerpräsidenten der Länder in der britischen und amerikanischen Zone Ende Januar 1947 eine gemeinsame Leitstelle einrichten. Deren Aufgabe sollte es sein, alle bisher unzusammenhängenden Arbeiten verschiedener Organisationen anlässlich der bevorstehenden Verhandlungen der Alliierten über das künftige Schicksal Deutschlands zu koordinieren und nach einheitlichen Gesichtspunkten Material für künftige Verhandlungen zu erarbeiten.[46]
Gegen eine zonenübergreifende Leitstelle legte die amerikanische Militärregierung aber ein Veto ein. Sie genehmigte lediglich eine regional begrenzte Koordinierungsstelle in ihrer Zone. Der deutschen Seite wäre eine zonenübergreifende Leitstelle natürlich lieber gewesen; sie nahm aber das Veto der Amerikaner hin. Im Frühjahr 1947 richteten sich die Länder der amerikanischen Zone eine zonale Leitstelle mit dem Namen „Büro für Friedensfragen“ in Ruit bei Stuttgart ein.[47]
Die Bearbeitung der Verfassungsfragen wurde Bayern und Hessen zugeteilt. Federführend auf bayerischer Seite waren Professor Nawiasky, der „Vater“ der bayerischen Verfassung und Ministerialdirigent Friedrich Glum, der maßgeblich an den Entwürfen des Ellwanger Freundeskreises beteiligt war. Diese erarbeitete für den bayrisch-hessischen Verfassungsausschuss einen Vorentwurf, der ausgesprochen reich an plebiszitären Elementen war. Er umfasste sowohl Möglichkeiten der Volksgesetzgebung nach Vorbild der bayerischen Landesverfassung als auch das Instrument des fakultativen Referendums und ein obligatorisches Referendum bei Verfassungsänderungen.[48]
Glum sah in den ausgeprägten plebiszitären Elementen der Weimarer Verfassung keine Gründe für das Scheitern der ersten deutschen Republik. Vielmehr hätten sich seiner Meinung nach das Verhältniswahlrecht und das parlamentarische Regierungssystem nicht bewährt, weshalb es für die Länder nicht mehr verbindlich vorgeschrieben werden sollte.[49]
Auf hessischer Seite war der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Hermann Brill, federführend. Im Ausschuss übernahm Brill, der ein herausragender Verfassungspolitiker war, schnell die Führung. Im Gegensatz zu Glum lehnte Brill plebiszitäre Elemente für die zukünftige Bundesverfassung ab. Zu den Gesetzgebungskompetenzen formulierte er: „Bundesgesetze werden durch inhaltlich übereinstimmende Beschlüsse des Staatsrates und des Volksrates erlassen. Die Institution des Volksbegehrens und Volksentscheides kommt in Wegfall.“[50]
Brill konnte sich durchsetzen. Während sich die zweite Fassung noch stark an Glums Entwurf orientierte, tauchten in der dritten und in der endgültigen vierten Fassung weder Volksgesetzgebung noch das fakultative Referendum wieder auf.[51] Brill war kein grundsätzlicher Gegner direkter Demokratie. Wie Glum machte auch er nicht die direktdemokratischen Elemente der WRV, sondern die Abhängigkeit des Staatschefs bei der Regierungsbildung vom Parlament für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich.[52] Den ostdeutschen Ländern machte er es in einem Artikel Ende Juni 1947 sogar zum Vorwurf, dass sie ihre Verfassungen rasch und einstimmig im Parlament verabschieden ließen, „ohne dass Volksabstimmungen darüber stattfanden“.[53] Dass Brill trotzdem gegen direktdemokratische Elemente opponierte, hat nach Meinung von Jung politische Gründe, die mit der von der SED geforderten Volksabstimmung über die Einheit Deutschlands zusammenhängen. Brill sah hinter dieser Volksabstimmung ein Instrument sowjetischer Reparationspolitik und befürchtete, dass das deutsche Volk auf die nationalistischen Parolen „nur zu leicht geneigt sei, hereinzufallen“[54].
3.1.3. Die Verfassungsdiskussion im Zonenbeirat
Vergleichbar dem Büro für Friedensfragen in der amerikanischen Zone etablierte sich in der britischen Zone der Zonenbeirat. Interessanterweise kamen Impulse für eine Verfassungsdiskussion in der britischen Zone von alliierter Seite. Mitte Juni 1947 forderte General Robertson ausdrücklich von den Parteien Rat in der Frage der zukünftigen politischen Struktur Deutschlands an. Im Plenum beschloss daraufhin der Zonenbeirat, dass jede Fraktion binnen sechs Wochen Vorschläge für die künftige deutsche Reichsverfassung ausarbeiten soll.
Am schnellsten arbeitete die konservative DP, die bereits am 5. August ihre „Richtlinien“ vorlegte. Dies ziemlich allgemein gehaltene Papier ist nicht sehr aussagekräftig. Über die zukünftige Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen heißt es lediglich, dass das Volk seinen Willen durch „die Wahl seiner Vertreter im Parlament und Volksentscheide Ausdruck“[55] verleihen solle. Aus späteren Dokumenten lässt sich ein zwiespältiges Verhältnis der DP zur direkten Demokratie erschließen. So stand sie plebiszitären Formen, die „von oben“ ausgehen, also Referenden und Volksbefragungen aller Art, als Konfliktlösungsmöglichkeiten durchaus positiv gegenüber, während sie der eigentlichen Volksgesetzgebung eine klare Absage erteilte.[56]
Die CDU legte am 25. August ihre „Richtlinien“[57] vor, die ausdrücklich als persönlicher Entwurf von Robert Lehr gekennzeichnet waren. Obwohl Lehr für Nordrhein-Westfalen noch einen referendumsfreundlichen Entwurf vorgelegt hatte, kamen in diesem Entwurf plebiszitäre Elemente nicht mehr vor. Lehrs Meinungsumschwung erfolgte laut Jung bei den Diskussionen im Zonenbeirat, wo er sich der Meinung seines SPD-Kollegen Menzel anschloss, dass den Fraktionen nicht ohne weiteres die Möglichkeit gegeben werden solle, sich vor der Verantwortung zu drücken.[58]
Die SPD brachte die bereits auf dem Nürnberger Parteitag beschlossenen „Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik“ ein, an deren Text sie nur die Einleitungsworte ein wenig abgeändert hatte.[59] Die FDP schwieg sich in ihrem Entwurf zum Thema direkte Demokratie aus[60] und die KPD brachte gar nicht erst eigene Richtlinien ein, da sie die Zuständigkeit des Zonenbeirates für die Vorbereitung einer gesamtdeutschen Verfassung bestritt[61].
3.2. Das "Volksbegehren für die Einheit Deutschlands“
Am 18. März 1948 beschloss die SED auf ihrem zweiten Volkskongress, ein Volksbegehren für einen Volksentscheid über die Einheit Deutschlands anzustoßen. Im Wortlaut einigte man sich auf folgenden Gesetzentwurf:
§1. Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik, in der den Ländern ähnliche Rechte zustehen, wie sie die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 enthielt. §2. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.[62]
Einige Delegierte des Volkskongresses wollten auch noch die sozialistische Umgestaltung der Wirtschaft mit in den Volksentscheid aufnehmen. Diese Linie konnte sich aber nicht durchsetzen. Vermutlich gelang man zu der Überzeugung, dass derartige Klauseln besonders in den Westzonen Stimmen kosten würden.[63] In der SBZ gelang es der SED mit Hilfe ihrer Massenorganisationen und der von ihr kontrollierten Medien eine Unterstützungsquote von 96,9% aller Wahlberechtigten zu erreichen. In den Westzonen, in denen die SED natürlich keinen „sozialen Druck“ ausüben konnte und sich nicht der gesamte Staatsapparat für ihre Zwecke missbrauchen ließ, belief sich die Unterstützung auf magere 7%. Für Gesamtdeutschland erreichte das Volksbegehren eine Unterstützung von über 10%. Nach Weimarer Recht war damit die Voraussetzung für einen Volksentscheid geschaffen. Genau auf dieser Rechtsgrundlage verlangten die drei Vorsitzenden des Volkskongresses in einem Brief an den Alliierten Kontrollrat, entweder das Gesetz zur Einheit Deutschlands zu erlassen oder einen Volksentscheid darüber herbeizuführen. Der Kontrollrat hielt es nicht für nötig, zu antworten und rechtlich bewegte sich die SED mit ihrem Anliegen auch auf äußerst dünnem Eis. Deutschland stand unter Besatzungsrecht, die Weimarer Reichsverfassung war für die Alliierten nicht bindend. Bezeichnenderweise schwankte die SED selbst bei der Frage, auf welchen Füßen das Begehren eigentlich stand, von naturrechtlichen Überlegungen bis zur Zugrundelegung von Landesverfassungen, die das Instrument der Volksgesetzgebung kannten.[64]
3.3. Die Wirkung der SED-Politik im Westen
Die SED spielte mit dem Volksbegehren für die Einheit Deutschlands nicht zum ersten Mal die plebiszitäre Karte. Am 30. Juni 1946 hielt sie in Sachsen ein Plebiszit über die Enteignung von aktiven Nationalsozialisten und Kriegsverbrechern ab. Gestützt auf diesen Volksentscheid, der mit 77,6% der Stimmberechtigten angenommen wurde, erließen auch die übrigen Länder der SBZ Enteignungsgesetze.[65] Um so öfter aber die „SED auf die plebiszitäre Karte setzte und je sensiblere Bereiche sie damit beeinflussen wollte (...), um so mehr tendierten die nichtkommunistischen Parteien im Westen zu Rückzug und Abschottung.“[66]
3.3.1. Positionsänderungen bei der CDU/CSU
Auf Parteiebene zeichnete sich im Frühjahr 1948 eine Abkehr von direktdemokratischen Verfassungselementen ab. Die „Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung“ wurden von Strauß auf der Basis von Diskussionen des Ellwanger Kreises revidiert. In der geänderten Fassung ist eine Verabschiedung der Verfassung durch einen Volksentscheid nicht mehr vorgesehen.[67] Als Begründung wurde darauf verwiesen, dass ein so kompliziertes Gesetzgebungsrecht, wie es eine Verfassung darstelle, nicht für eine Volksabstimmung geeignet sei. Entsprechend kam auch die Homogenitätsklausel, die für die Landesverfassungen Gründungsplebiszite vorsah, in der am 13. April 1948 in Bad Brückenau verabschiedeten Fassung der Grundsätze nicht mehr vor.[68]
Bei der Bewertung des Komplexitätsargumentes muss man sagen, dass es äußerst fadenscheinig ist. In acht[69] von fünfzehn Ländern wurde die Landesverfassung durch Volksentscheid angenommen, ohne dass ähnliche Bedenken vorgebracht worden wären. Der Schlüssel für die Reduktion direktdemokratischer Elemente in den „Grundsätzen“ liegt nach Meinung Jungs vielmehr darin, dass sich die Partei allmählich von der Hoffnung auf eine baldige staatliche Einheit verabschiedete. Daher passte man die „Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung“ für den zu erwartenden Weststaat an und unterstellte sie dem „Provisoriums- (bzw. Angst-) Verdikt.“[70]
3.3.2. Positionsänderungen bei der SPD
Nach der Verabschiedung der „Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik“ auf dem Nürnberger Parteitag am 1. Juli 1947 ließ man die verfassungsprogrammatische Arbeit erst einmal für gut ein Jahr liegen. Am 21. Juli 1948 stellte der Verfassungsexperte Menzel dann aber doch einen neuen Entwurf zur Diskussion, der zwar auf den Nürnberger „Richtlinien“ basierte, aber ausdrücklich nur für Westdeutschland galt und verglichen mit dem alten Entwurf gut ausgearbeitet war. Zwar lehnt auch dieser Entwurf ein Gründungsplebiszit ab, interessanterweise umfasst er aber die Möglichkeit der Volksgesetzgebung. Zur Erinnerung: Nach den Nürnberger „Richtlinien“ sollte es Volksbegehren und Volksentscheide nur für bestimmte in der Verfassung festgelegte Fälle geben.[71]
Warum Menzel für die Übergangszeit Verfahren vorsah, denen er für ein vereinigtes Deutschland skeptisch gegenüberstand, ist auch für Jung nicht erklärlich. Jung hat recht, wenn er schreibt, dass, sofern sich direktdemokratische Elemente in der Übergangsfrist bewähren, sie natürlich auch in die endgültige Verfassung einer Deutschen Republik eingehen müssten.[72] Anfangs sperrte sich die Parteiführung gegen Menzels Entwurf, machte ihn dann aber mit kleinen Änderungen[73] doch zur Grundlage für zukünftige Verfassungsberatungen.[74]
3.3.3. DPD und LDP (Liberale)
Im Juni 1948 arbeitete der Vorsitzende der Demokratischen Partei Deutschlands, Theodor Heuss, zusammen mit dem Vorstandsmitglied Mayer Vorschläge für eine deutsche Verfassung aus. Der Volksgesetzgebung erteilten sie in ihrem Rundschreiben eine klare Absage „da die gesetzgeberische Aktion nicht durch das Agitationsbedürfnis einzelner Volksgruppen belastet werden darf. Die Erfahrungen der Weimarer Republik waren eindeutig.“[75] Dem Instrument des Referendums stand man hingegen positiv gegenüber. Dies sollte entweder auf Initiative einer qualifizierten Mehrheit in beiden Kammern oder, bei unüberbrückbaren Differenzen zwischen beiden Häusern, auf Betreiben des Bundespräsidenten zustande kommen.[76]
Die LDP vertrat ähnliche Vorstellungen wie die DPD. Auch sie lehnte die Volksgesetzgebung ab, beschränkte aber das Referendum auf den Fall eines unüberbrückbaren Konfliktes zwischen Parlament und Länderkammer.[77]
3.3.4. Die Deutsche Partei
An der skeptischen Haltung der DP über die Volksgesetzgebung hat sich seit der Vorlage ihrer „Richtlinien“ im Zonenbeirat wenig geändert. Das Volksbegehren „für die Einheit Deutschlands“ scheint die Partei lediglich in ihrer Haltung noch gestärkt zu haben. „Wer den Mechanismus des modernen Massenstaates mit seiner Propagandamöglichkeit und die im Zustand der Vermassung so auffällige Unselbständigkeit des Denkens hierbei in Rechnung stellt, wird die problematische Natur dieser modernen demokratischen Einrichtung richtig zu werten wissen. Solche Plebiszite werden stets das Echo derjenigen sein, die über die Propagandamöglichkeiten und die Terrormittel des modernen Staates verfügen“[78], lässt ein Positionspapier aus jener Zeit verlauten.
3.3.5. Die Ministerpräsidenten und das Gründungsplebiszit
Die eindrucksvollsten Belege für Jungs These des „Angst-Verdikts“ finden sich, wenn man sich die Diskussionen der Ministerpräsidenten in Koblenz und Niederwald ansieht. Doch der Reihe nach: Am 1. Juli 1948 wurden die Ministerpräsidenten von den drei Westalliierten ermächtigt, „eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen“[79]. Inhaltlich machten die Alliierten nur geringe Vorgaben.[80] Was aber die Ratifikation der Verfassung angeht, hatten die Siegermächte durchaus konkrete Vorstellungen. Die von einer gewählten Versammlung ausgearbeitete Verfassung sollte durch eine Volksabstimmung in jedem Land der drei Westzonen ratifiziert werden, wobei sich eine 2/3 Mehrheit der Länder für eine Annahme der Verfassung aussprechen musste.[81] Sieben Tage später trafen sich die Ministerpräsidenten zu einer Konferenz auf dem Rittersturz bei Koblenz, um über die Vorgaben der Alliierten zu beraten. Hierbei standen die Ministerpräsidenten allerdings vor dem Dilemma, dass die Gründung eines Weststaates die faktische Teilung Deutschlands bedeuten würde. Zwar könnte man eine Weststaatsgründung als Zwischenschritt zur deutschen Einheit darstellen und mit Vorläufigkeitsvokabeln überfrachten[82], jedoch würden SED und KPD nicht eine Sekunde zögern, gegen diese Weststaatspläne mit allen Mitteln der Propaganda zu opponieren.
Diese Angst vor kommunistischer Agitation und Propaganda scheint der wahre Grund dafür zu sein, dass es nach dem Willen der meisten Ministerpräsidenten[83] weder eine direkte Wahl zu einer Verfassunggebenden Versammlung noch ein Gründungsplebiszit geben sollte. So gab der badische Staatspräsident Wohleb in einer Antwort auf den Bremer Landeschef Kaisen zu bedenken, dass von einer Wahl abzusehen sei, zumal man sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten befände.[84] Ein weiteres Indiz findet sich in den Memoiren des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Maier, der dort schrieb, dass vor allem bei den nordwestdeutschen Landesregierungen die Befürchtung vorlag, dass es bei einer Volkswahl „zu viele kommunistische Stimmen“[85] geben würde.
Von einem Gründungsplebiszit nahmen die Landesregierungen aus dem simplen Grund Abstand, dass man befürchtete, es könnte in Folge kommunistischer und rechtsextremer Propaganda negativ ausfallen. In einem ersten Erklärungsentwurf einer Kommission die eine Antwort auf die Forderung der Westalliierten nach einem Gründungsplebiszit und Wahlen zu einer Verfassungebenden Versammlung formulieren sollte, heißt es:
Für ihren Vorschlag, von einem Volksentscheid Abstand zu nehmen, war maßgebend die Erkenntnis, daß heute weite Teile des deutschen Volkes ihre Stimme nicht aus sachlichen Gründen abgeben würden, sondern, um ihrem Bedürfnis nach einem sichtbaren Protest gegen die Zeitverhältnisse und die von ihnen dafür verantwortlich gemachten Militärregierungen (sc. Ausdruck) zu verleihen, schlechthin gegen die von den verantwortlichen politischen Parteien vorgeschlagenen Lösungen stimmen könnten.[86]
In der späteren endgültigen Antwort war so viel Offenheit nicht mehr gefragt. Statt dessen wurde nun mit dem „Konstrukt der Überlegitimation“[87] argumentiert. „Ein Volksentscheid würde dem Grundgesetz ein Gewicht verleihen, das nur einer endgültigen Verfassung zukommen sollte“,[88] hieß es jetzt.
[...]
[1] Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, Frankfurt am Main 1991, S.150
[2] Vgl. Berthold Huber, Formen direktdemokratischer Staatswillensbildung- eine Herausforderung an das parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland?, in: ZRP, 1984, Heft 9, S.246
[3] Art. 29 GG
[4] Vgl. Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, Frankfurt am Main 1991, S.201
[5] Art. 76 Abs. 1 GG sowie Art. 77 Abs.1 GG
[6] Vgl. Silvano Möckli, Direkte Demokratie im Vergleich, in: APuZG, 1991, B23, S.23
[7] Vgl. Wolfgang Luthert, Direkte Demokratie, Ein Vergleich in Westeuropa, Baden Baden 1994, S. 91-92
[8] Gebhard Rittger, Der Streit um die Direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, S.40
[9] Hans-Jochen-Vogel in einem Geleitwort für: Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.15
[10] Vgl. Wolfgang Luthert, Direkte Demokratie, Ein Vergleich in Westeuropa, Baden Baden 1994,
S. 35
[11] Vgl. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band 2, München 1980 S.13 sowie Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.23-24
[12] Thomas Fleiner-Gerster, Staatslexikon, Recht · Wirtschaft · Gesellschaft, Freiburg im Breisgau 1988, S.424
[13] Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.23
[14] Ebd.
[15] Josef Isensee, Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1987, Seite 347
[16] Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.24
[17] Vgl. Gebhard Rittger, Der Streit um die direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, Seite 11
[18] Stefan Przygode, Die deutsche Rechtsprechung zur unmittelbaren Demokratie, Ein Beitrag zur Praxis der Sachentscheide in Deutschland, Baden-Baden 1995, S. 39
[19] Vgl. Wolfgang Luthert, Direkte Demokratie, Ein Vergleich in Westeuropa, Baden Baden 1994,
S. 34
[20] Ebd.25
[21] Vgl. Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.26-27
[22] Eine Parlamentsauflösung durch Volksentscheid ist nach den Landesverfassungen von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz möglich.
[23] Vgl. Uwe Berlitt, Soll das Volk abstimmen? Zur Debatte über direktdemokratische Elemente im Grundgesetz, KritV 1993, Heft Nr. 3,76, S. 332-333
[24] Tatiana Paterna, Volksgesetzgebung, Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Frankfurt am Main 1995, S.26
[25] Telegramm von Eisenhower an Marshall zit. nach: Wolfgang Krieger, General Lucius D. Clay und die amerikanische Deutschlandpolitik 1945-1949, Stuttgart 1987, S. 68
[26] „Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wieder aufzubauen“, Verlautbarung über die Potsdamer Konferenz, in: Rolf Steininger, Deutsche Geschichte 1945-1962, Darstellung und Dokumente in zwei Bänden, Frankfurt 1983, S. 75
[27] Amtliche Verlautbarung über die Potsdamer Konferenz vom 2.8. 1945, in: Rolf Steininger, Deutsche Geschichte 1945-1962, Darstellung und Dokumente in zwei Bänden, Frankfurt 1983, S. 75
[28] Amtliche Verlautbarung über die Potsdamer Konferenz Punkt 9 (II): „In ganz Deutschland sind alle demokratischen politischen Parteien zu erlauben und zu fördern mit der Einräumung des Rechtes, Versammlungen einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzuführen.“ Zit. nach: Ebd.
[29] Vgl. Rolf Steininger, Deutsche Geschichte 1945-1962, Darstellung und Dokumente in zwei Bänden, Frankfurt 1983, S. 106
[30] Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik in: Frank R. Pfetsch, Verfassungspolitik der Nachkriegszeit Theorie und Praxis des bundesdeutschen Konstitutionalismus, Darmstadt 1985, S.111
[31] Walter Menzel, Der Aufbau der deutschen Republik, hrsg. V.d. SPD, Bez. Ost-Westfalen und Lippe, Minden 1947, S. 26
[32] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 159
[33] Ebd.
[34] Vgl. Gebhard Rittger, Der Streit um die direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991,
Seite 25
[35] Art. 73 Abs.2 WRV
[36] Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 159
[37] Vgl. für die CDU: Frank R. Pfetsch, Verfassungspolitik der Nachkriegszeit Theorie und Praxis des bundesdeutschen Konstitutionalismus, Darmstadt 1985, S.94-98, für die SPD: Michael G.M. Antonio, Sozialdemokratie und Grundgesetz, Verfassungspolitische Vorstellungen der SPD von den Anfängen bis zur Konstituierung des Parlamentarischen Rates 1948, Berlin 1991, S.41-43
[38] Richard Ley, Föderalismusdiskussion innerhalb der CDU/CSU von der Parteigründung bis zur Verabschiedung des Grundgesetzes, Mainz 1978 (Beiträge zu Wissenschaft und Politik Bd. 17) S. 47
[39] Vgl. Walter Strauß’ Entwurf für den hessischen Ministerpräsidenten Geiler in: Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen“, Zur Geschichte des Grundgesetzes, Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S.217
[40] Vgl. Heinrich v. Brentano, Deutschland, Europa und die Welt, Reden zur deutschen Außenpolitik, hrsg. v. Franz von Böhm, Bonn 1962, S.49-50
[41] Grundsätze für die Deutsche Bundesverfassung, abgedruckt bei: Frank R. Pfetsch, Verfassungspolitik der Nachkriegszeit, Theorie und Praxis des bundesdeutschen Konstitutionalismus, Darmstadt 1985, S.98
[42] IfZ NL W.Strauß/138, Bl. 145-146
[43] Grundsätze für die Deutsche Bundesverfassung, abgedruckt bei: Frank R Pfetsch, Verfassungspolitik der Nachkriegszeit, Theorie und Praxis des bundesdeutschen Konstitutionalismus, Darmstadt 1985, S.98
[44] IfZ NL W.Strauß/138, Bl. 145
[45] Vgl. Grundsätze für die Deutsche Bundesverfassung, abgedruckt bei: Frank R. Pfetsch, Verfassungspolitik der Nachkriegszeit, Theorie und Praxis des bundesdeutschen Konstitutionalismus, Darmstadt 1985, S.98
[46] Vgl. http://www.lpb.bwue.de/publikat/swgrund5.htm, v.a. 5.5.2003
[47] Ebd.
[48] Vgl. Friedrich Glum, Der künftige deutsche Bundesstaat, München 1946 S.28-46
[49] Ebd.23
[50] Vorschläge für eine Verfassungspolitik des Länderrates abgedruckt in: Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1949, Bd. 2, bearb. von Wolfram Werner, Wien 1979, S. 298 ff.
[51] Vorschläge für eine Bundesverfassung abgedruckt in: Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1949, Bd. 3, bearb. von Günter Plum, Wien 1982, S. 298 ff.S. 991-994
[52] Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1949, Bd. 2, bearb. von Wolfram Werner, Wien 1979, S. 294-298
[53] Hermann Brill, Streit um die Verfassung, in: Das sozialistische Jahrhundert 1(1946/47), S. 2.231, zit. nach: Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 166
[54] Hermann Brill, Streit um die Verfassung, in: Das sozialistische Jahrhundert 1(1946/47), S.232, zit. nach: Ebd.
[55] Vgl. Acht Thesen der Rettung (1947) in Ossip K. Flechtheim, Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, 2. Band: Die Programmatik der deutschen Parteien, Erster Teil, Berlin 1963, S. 377-383
[56] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 168
[57] Abgedruckt bei: Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen“, Zur Geschichte des Grundgesetzes, Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S.328-332
[58] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 168-169
[59] Vgl. Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen“, Zur Geschichte des Grundgesetzes, Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S. 358
[60] Ebd. 358
[61] Vgl. Landwehr, ParlA DBT, ZB 1/231, handschriftliches Protokoll vom 30.9.1947
[62] Gesetz über die Einheit Deutschlands in: Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 173
[63] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 173
[64] Ebd. 189-192
[65] Dietrich Staritz, Sozialismus in einem halben Lande, Zur Programmatik und Politik der KPD/SED in der Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in der DDR, Berlin 1976, S.100
[66] Otmar Jung, Kein Volksentscheid im Kalten Krieg! Zum Konzept einer plebiszitären Quarantäne für die junge Bundesrepublik 1948/1949, APuZG Bd.45, 1992, S.16
[67] Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung bei: Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen“, Zur Geschichte des Grundgesetzes, Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S. 333-347
[68] Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung bei: Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen“, Zur Geschichte des Grundgesetzes, Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S. 333-347
[69] Baden, Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern, und Württemberg-Baden vgl. Frank R. Pfetsch, Ursprünge der zweiten Republik, Prozesse der Verfassungsgebung in den Westzonen und in der Bundesrepublik, Darmstadt 1990, S.56
[70] Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994,
S. 225
[71] Vgl. Michael G.M. Antoni, Sozialdemokratie und Grundgesetz, Verfassungspolitische Vorstellungen der SPD von den Anfängen bis zur Konstituierung des Parlamentarischen Rates 1948, Berlin 1991, S.220-225
[72] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 228-229
[73] so wurde die Frist in der sich das Parlament über den Umgang mit einem Volksbegehren klar werden musste, von 3 Monaten auf 3 Wochen verkürzt.
[74] Vgl. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 229
[75] Rundscheiben Nr. 3 der DPD v. 20.6.1948 in: Ingrid Wurtzbacher-Rundholz, Verfassungsgeschichte und Kulturpolitik bei Dr. Theodor Heuss bis zur Gründung der Bundesrepublik durch den Parlamentarischen Rat 1948/49 – mit Dokumentenanhang, Frankfurt a. M. 1981, S. 207
[76] Ebd.
[77] BAK NL Heuss/407
[78] ACDP I-148-089/02
[79] Frankfurter Dokument Nr. 1 in: Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Bd. 1: Vorgeschichte, bearb. von Volker Wagner, 1975, S. 30
[80] Die Alliierten verlangten eine demokratische Verfassung, einen föderalen Aufbau und die Garantie individueller Rechte und Freiheiten. Vgl. Frankfurter Dokument Nr. 1 in: Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Bd. 1: Vorgeschichte, bearb. von Volker Wagner, 1975, S. 31
[81] Ebd. 32
[82] Carlo Schmidt schlug als Synonym für die künftige deutsche Verfassung die Begriffe Verwaltungsstatut, Organisationsstatut und vorläufiges Staatsrundgesetz vor. Vgl. Gerhard Hirscher, Carlo Schmid und die Gründung der Bundesrepublik, Eine politische Biographie, Bochum 1986, S.141
[83] Eine Ausnahme bildeten Kaisen (Bremen) und Brauer (Hamburg
[84] Protokoll Ministerrat Sitzung v. 8.-10.7.1948, in: Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Bd. 1: Vorgeschichte, bearb. von Volker Wagner, 1975, S. 69
[85] Rheinhold Maier, Erinnerungen 1948-1953, Tübingen 1966, S.65
[86] „Entwurf 1“ v. 9.7.48, BayHStA NL Pfeiffer/34
[87] Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie, Lengerich 1994, S. 211
[88] Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Bd. 1: Vorgeschichte, bearb. von Volker Wagner, 1975,
S. 144
- Arbeit zitieren
- Stephan Büsching (Autor:in), 2003, Die Diskussion um die Einführung plebiszitaerer Elemente in das Grundgesetz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17091
Kostenlos Autor werden






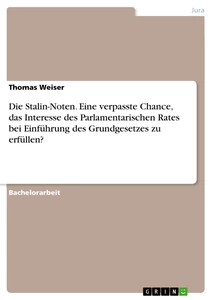


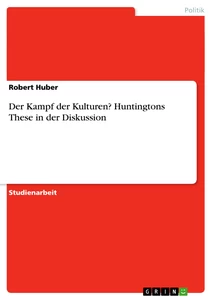




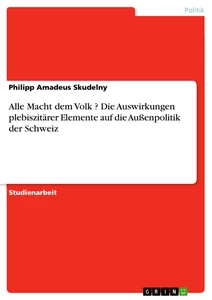

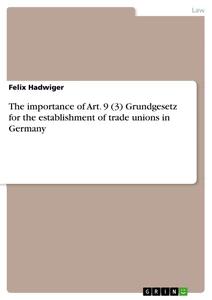





Kommentare