Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Glossar
Vorwort .
1 Einleitung
1.1 Ziel der Arbeit
1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit
2 Nierenfunktionseinschränkung und ihre Ursachen
2.1 Stadien und Symptome der Niereninsuffizienz
2.2 Nierenerkrankungen.
2.2.1 Diabetische Nephropathie
2.2.2 Glomerulonephritis
2.2.3 Interstitielle Nierenerkrankungen
2.2.4 Hypertone vaskuläre Nephropathie
2.2.5 Erblich/angeborene Nierenerkrankungen
2.2.5.1 Erbliche Zystennieren
2.2.5.2 Allport-Syndrom.
2.2.6 Akutes Nierenversagen...
2.3 Möglichkeiten der Nierenersatzherapie ...
2.3.1 Formen der Dialyse
2.3.1.1 Hämodialyse.
2.3.1.2 Peritonealdialyse.
2.3.2 Nierentransplantation
2.4 Wissen der Bevölkerung zu Nierenerkrankungen
2.4.1 Ergebnisse der Befragung
3 Gesundheit und Krankheit - die gesellschaftliche Perspektive
3.1 Gesundheitskonsum
3.1.1 Konsequenzen des Gesundheitskonsums
3.1.2 Gesundheitskonsum aus der Perspektive der Konsumenten eine Onlinebefragung
3.1.2.1 Ergebnisse der Befragung
3.2 Gesundheitskompetenz als wichtige Ressource
4 Perspektive der Professionellen
4.1 Professionelle als Experten.
4.2 Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Professionelle.
4.3 Arzt-Patienten-Beziehung
4.3.1 Paternalistisches Modell
4.3.2 Partizipative Beziehungsgestaltung
5 Perspektive des Patienten
5.1 Gesundheit und Krankheit aus der Sicht des Patienten.
5.2 Patientensouveränität
5.3 Selbstwirksamkeitserwartungen.
5.4 Eigenverantwortung
5.4.1 Übernahme von Eigenverantwortung Möglichkeiten und Grenzen.
5.5 Entscheidungsverhalten und entscheidende Faktoren
5.5.1 Handlungsleitende Motive des Menschen und ihre Einfluss auf Entscheidungen in der Arzt-Patientenbeziehung
5.6 Zwischenfazit
6 Die Untersuchung
6.1 Die Forschungsfragen.
6.2 Das Forschungsdesign und die Methoden
6.2.1 Qualitative Interviews (T 1)
6.2.2 Picture - Story - Exercise
6.2.3 Zweites Interview (T 2) 6 Monate nach Eintritt in die Studie
6.3 Auswahl der Untersuchungsgruppe
6.4 Durchführung der Untersuchung.
6.5 Auswertungsmethoden
6.5.1 Auswertung der Leitfadeninterviews
6.5.2 Auswertung des Materials der Picture Story Exercise
6.5.3 Auswertung der Zweiten Interviews
7 Ergebnisse
7.1 Die Untersuchungsgruppe und die Erfahrungen mit der Rekrutierung.
7.2 Quantitative Ergebnisse der transkribierten Leitfadeninterviews.
7.3 Ergebnisse der Analyse der qualitativen Interviews
7.3.1 Charakterisierung der Situation - Gruppe I - langfristige Entscheidungsfindung
7.3.2 Charakterisierung der Situation - Gruppe II - kurzfristige Entscheidungsfindung
7.3.3 Bedürfnisse der Patienten in beiden Untersuchungsgruppen
7.3.4 Erwartungen an die Professionellen in beiden Untersuchungs gruppen
7.3.5 Beeinflussende Faktoren im Rahmen der Entscheidungs findung
7.4 Ergebnisse der Analyse der Picture Story Exercise
7.4.1 Bindungs-/Harmoniemotiv
7.4.2 Leistungsmotiv
7.4.3 Powermotiv
7.5 Ergebnisse der zweiten Befragung nach ca. sechs Monaten
7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse auf der Basis der Teilgruppe der Befragten, von denen Ergebnisse zu drei Studienteilen vorliegen (N=10) .
7.6.1 Fallbeispiele
8 Nephroguide
9 Diskussion
9.1 Methodik
9.2 Leitfadeninterview
9.2.1 Qualitative Analyse
9.3 Picture Story Exercise
9.4 Zweites Interview
9.5 Beantwortung der Forschungsfragen
9.6 Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit des Nephroguides
10 Ausblick
11 Zusammenfassung
12 Literatur
13 Anhänge
13.1 Fragebogen Gesundheitskonsum Onlinebefragung
13.2 Nephroguide
Über die Schriftenreihe
Die Schriftenreihe der Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule Hannover wird herausgegeben von Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks und Dr. rer. biol. hum. Gabriele Seidel vom Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover.
Ziel der Schriftenreihe ist es Forschungsergebnisse zur Patientenorientierung und Gesundheitskompetenz einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
In der Schriftenreihe werden Doktorarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten sowie Arbeitsberichte von Forschungsberichten aufgenommen und veröffentlicht.
Über die Autorin
Dr. rer. biol. hum. Martina Oldhafer, MBA, geb. 1959 in Bonn, studierte Soziologie und Soziale Verhaltenswissenschaften an der FernUniversität Hagen (Abschluss Bachelor of Arts(B.A.) und Gesundheits- und Sozialmanagement an der Universität Hamburg (Berufsbegleitender Studiengang), Abschluss MBA. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist sie als Verwaltungsleiterin im KfH-Nierenzentrum an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig.
Über das Buch
Die vorliegende Arbeit ist eine Dissertation zum Dr. rer. biol. hum von Martina Oldhafer, verfasst am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover unter der Betreuung von Prof. Dr. Marie-Luise Dierks. Die Dissertation wurde am 22. Februar 2011 vom Senat der Medizinischen Hochschule Hannover angenommen.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb.1 43 Verteilung des Wissens bezüglich Schmerzmitteleinnahme und Nierenschädigung Abb. 2 44 Verteilung des Wissen über den Zusammenhang zwischen Hypertonie und Nierenerkrankungen
Abb. 3. 47 Gesellschaftlich geprägte Einflussfaktoren auf die gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung des Einzelnen
Abb. 4… 62 Entscheidungsfindung des Patienten aus Sicht der Professionellen Abb. 5 71 Ressourcen der Entscheidungsfindung des Patienten
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 41 Altersverteilung der Teilnehmer in der Passantenbefragung
Tab. 2… 42 Übersicht über Anteil der Antworten mit Ja über alle Fragen
Tab. 3 57 Übersicht über die Ergebnisse der Onlinebefragung zum Gesundheitskonsum
Tab. 4 90 Keywords als Indikatoren für Grundbedürfnisse
Tab. 5…..96 Vorgehen der qualitativen Analyse
Tab. 6.100 Darstellung aller Patienten in der Studie zum Zeitpunkt T1
Tab. 7 101 Quantitative Analyse der Leitfadeninterviews
Tab. 8 108 Übersicht Patienten, die am 1. Interview und der Picture Story Exercise teilgenommen haben
Tab. 9….. ..113 Basale Motive der Befragten
Tab. 10… ..114 Übersicht Teilnehmer an T1 - Picture Story Exercise - T2
Tab. 11…..116 Übersicht der Ergebnisse Teilnehmer Leitfadeninterview (T1 Kategorien) und Picture Story Exercise (Motivlage)
Tab. 12 ….121 Fallbeispiele im Vergleich
Glossar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Die Motivation, einen Leitfaden für Ärzte und andere Professionelle im Gesundheitswesen zu entwickeln, entstand aus meiner über zehnjährigen Beschäftigung mit nierenkranken Kindern und Jugendlichen, die nach einem eigenen Konzept in der Phase der Adoleszenz betreut werden, sowie aus meinen Erfahrungen in den Nierenzentren des KfH Kuratoriums für Dialyse und Nierentransplantation e.V. , die ich als Verwaltungsleiterin begleiten durfte. Im engen Kontakt zu Patienten und allen an der Behandlung Beteiligten ist die Idee der Leitfadenentwicklung entstanden und unterstützt worden.
Mein besonderer Dank gilt den Patientinnen und Patienten, die mir durch ihre Offenheit einen Einblick in ihre besondere Situation gewährt haben. Durch Sie wurde es erst möglich antizipierend auf die Besonderheiten der Entscheidungsfindung einzugehen und neue Erkenntnisse daraus abzuleiten.
Er gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Nephrologie (Medizinische Hochschule Hannover) unter Leitung von Prof. Dr. Hermann Haller, die mir bei der Rekrutierung der Patienten behilflich waren. Frau Prof. Dr. Marion Haubitz danke ich ganz herzlich für ihre konstruktive Kritik und die zahlreichen Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Frau Prof. Dr. Gisela Offner sei Dank für Ihre kritischen Anmerkungen und ihre positive Unterstützung und Motivation in den letzten Jahren der Zusammenarbeit im Bereich der pädiatrischen Betreuung und der Entwicklung des Transferprogramms endlich erwachsen.
Besonders möchte ich Frau Prof. Dr. Marie-Luise Dierks für die konstruktiven Diskussionen und Hinweise sowie die wundervolle Betreuung danken, die mich nie etwas hat vermissen lassen, mich fortwährend motivierte und sehr unterstützte. Sie initiierte den notwendigen Perspektivenwechsel, der neue Ideen eröffnete. Dank ihrer Erfahrung im Bereich Versorgungsforschung und der qualitativen Sozialforschung, sowie ihrer Offenheit konnten wir konstruktive Themen jederzeit diskutieren. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Sie hat mich immer wieder auf die Forschungsfrage und das Ziel zurückgeführt. Ihre Begleitung ermöglichte es mir, verbindende Elemente zwischen Geistes- und Naturwissenschaft zu finden.
Meiner Familie danke ich für ihr unermüdliches Verständnis und ihre Toleranz während der Zeit des Formulierens und Schreibens. Besonders möchte ich meinem lieben Ehemann danken, der, trotz eigener hoher Belastung, mir immer jede Unterstützung zu Teil hat werden lassen, die notwendig war, um meine Ziele in den vergangenen sechsundzwanzig Jahren zu erreichen.
Hamburg, im Juli 2010
1 Einleitung
Gesundheit ist ein zentrales Thema für den Menschen, und damit keineswegs ein neues Thema. Aus soziologischer Sicht ist die Beschäftigung mit Gesundheitsthemen als ein wichtiges Merkmal von modernen Gesellschaften zu verstehen (12), schließlich ist eine Gesellschaft dann funktionsfähig, wenn die Bevölkerung so gesund ist, dass die Erfüllung der sozialen Rollen gegeben ist (143). Die Aufgabe des Gesundheitssystems in modernen Gesellschaften besteht demnach unter anderem darin, Kranke schnellstmöglich wieder zu heilen, damit diese ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Verpflichtungen wahrnehmen können (142). Im Krankheitsfall hat der Betroffene1, so Parsons, die Verpflichtung, schnellstmöglich gesund zu werden und dazu einen Arzt zu besuchen, sowie das Gesundheitssystem nicht unnütz in Anspruch zu nehmen (70), gleichzeitig wird der Patient vorübergehend von seinen gesellschaftlichen Rollen befreit und, so diese Theorie, nicht für seine Krankheit moralisch verantwortlich gemacht.
Neuere Gesundheitskonzepte, wie sie auch in der Definition der Weltgesundheitsorganisation zu finden sind, betrachten Gesundheit und Krankheit in einem weiteren Kontext. So wurde mit der Ottawa Charta ein erstes gesundheitspolitisches Dokument verabschiedet, in dem ein aktives Gesundheitsverständnis formuliert wurde (77). Gleichzeitig gilt Gesundheit heute als Ausdruck moderner Lebensqualität mit diversen Elementen, u. a. Fitness, Ernährung, Lifestyle und Sport (77).
Gesundheit hat aber auch etwas mit Zugehörigkeit, Status und Konsum im engeren und weiteren Sinn zu tun (ebd.). Entsprechende Aktivitäten einzuleiten oder Angebote zu nutzen, bedeuten tägliche, aktive Entscheidungen der Menschen, auch wenn dies nicht immer reflektiert wird. Es beginnt mit der Ernährung, der Körperpflege und Mundhygiene, dem Bewegungsverhalten, dem Umgang mit Stress und endet noch nicht bei der Wahrnehmung von Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen.
Weil diese Entscheidungen wesendlich gesellschaftlich geprägt sind, und durchaus von ökonomischen Vorstellungen beeinflusst werden, wird deutlich, dass Gesundheit und Entscheidungen zum Gesunderhalt, sowie zur Gesundung, keine ausschließlich persönlichen bzw. privaten Entscheidungen mehr sind, sondern gesellschaftlich relevante Aspekte beinhalten. Dazu gehören Entwicklungen, die die Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen und damit zusammenhängende Fragen der Rationierung, Rationalisierung und Priorisierung von Behandlungen und möglichen Mitteleinsatz betreffen (159). Die letztgenannten sozioökonomischen Fragen haben zu einer Diskussion um eine Anpassung der Finanzierung des Gesundheitssystems geführt, dass in den letzten Jahren durch hohe Innovativität auf der einen und Finanzierungsprobleme auf der anderen Seite gekennzeichnet ist. Rationierung kann in diesem Zusammenhang bedeuten, dass Entscheidungen über anzuwendende Verfahren nach definierten Kriterien, und eben auch nach ökonomischen Kriterien, gefällt werden.
Rationalisierungsmaßnahmen dagegen zielen auf Effizienz- und Produktivitäts- steigerungen im Rahmen der Leistungserstellung. Priorisierung folgt nach vollständiger Ausschöpfung von Rationierung und Rationalisierung und meint, dass das ärztliche Handeln im Rahmen der zur Verfügung stehenden Leistungsmöglichkeiten einer Auswahl unterliegt, welche Therapiemöglichkeiten für welche Patienten in Zukunft zur Verfügung stehen und worauf unter Umständen verzichtet werden muss.
Es ist offensichtlich, dass in einer solchen Situation ein immenses Informationsbedürfnis in der Bevölkerung entsteht und nicht nur unter Gerechtigkeitskriterien völlige Transparenz notwendig ist, um Entscheidungen nachvollziehbar zu machen (159). Eine entscheidende Rolle spielt hier die Gesundheitskompetenz des Einzelnen und die methodisch-didaktischen Fähigkeiten des Behandelnden.
In diesem Zusammenhang hat der Begriff der Eigenverantwortung der Erkrankten an Bedeutung gewonnen (119). Er wird in der Regel verbunden mit positiven Assoziationen wie Freiheit und Selbstbestimmung, im Gegensatz zu dem Begriff Verantwortung, mit dem eher ableitbare Rechte und Pflichten verbunden werden (77). In der gesundheitspolitischen Diskussion wird die Eigenverantwortung der Bürger nicht zuletzt dann gern beschworen, wenn es darum geht, durch Neuverteilung von Eigenbeteiligung die Bürger mehr in die Pflicht zu nehmen und den Staat oder die Sozialversicherungssysteme von Kosten zu entlasten. Die Übernahme von Eigenverantwortung ist so gesehen nicht nur eine Frage des Wollens auf Seiten des Bürgers, sondern auch eine Zuschreibung, die im Sinne der Kostenreduktion bzw. Ressourcenreduktion erfolgt und auf die der Einzelne keinen direkten Einfluss nehmen kann.
Im Falle von Erkrankungen hat die Eigenverantwortung zudem eine besondere Tragweite. Gerade in dieser besonderen Situation wird von Patienten erwartet, dass die Entscheidung der Vernunft entspricht und diese Entscheidung in eigener Verantwortung der Betroffenen gefällt wird (77). Wer soll und will die Verantwortung übernehmen, wie wichtig ist die Haltung des Betroffenen in diesem Entscheidungsprozess, wie viel Verantwortung kann und will er übernehmen und was benötigt er, um diese Verantwortung zu übernehmen und die Konsequenzen zu tragen?
Hier kommt den Professionellen eine besondere Rolle zu. Diese ergibt sich aus der fehlenden oder eingeschränkten Möglichkeit der Erkrankten, zwischen notwendigen und nicht notwendigen Leistungen zu unterscheiden, da eine solche Differenzierung die individuellen Kompetenzen zur Beurteilung in den meisten Fällen überschreitet. Neben Informations- und Kompetenzasymmetrien spielen Machtasymmetrien zwischen Angehörigen der Gesundheitsberufe (Professionelle) und Patienten eine entscheidende Rolle. Beeinflusst wird dieses Verhältnis zusätzlich von einem Leidensgefälle zwischen den Beteiligten.
Akutes oder chronisches Leiden erzeugt beim Patienten einen unmittelbaren Bedarf nach Hilfe und fördert die Bereitschaft, jedes angebotene Vertrauensgut zumindest auszuprobieren, um Beschwerden möglicherweise lindern zu können (58). Bei vielen Angehörigen der „helfenden Berufe“ erzeugt es auf der anderen Seite das unmittelbare Bedürfnis die Hilfe zu geben, um daraus positive Bestätigung und Wertschätzung zu erzielen. Trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen gehören Bestätigung und Wertschätzung nach wie vor zu den Grundbedürfnissen des Menschen per se.
Dass diese Situation nicht unkritisch ist, beschreibt Rosenbrock treffend mit der Tatsache, dass der Betroffene sich ausnahmslos in einer vulnerablen Phase befindet und dadurch in einer sachlich und wirtschaftlich leicht ausnutzbaren Situation steckt (115). Unter Bedingungen von Unwissenheit, Schmerzen und Unwohlsein sind Patienten schlechte Verhandlungspartner und aus seiner Sicht unfrei in ihrer Entscheidungsfähigkeit.
In sozialpsychologischen Studien zum Thema „Subjektive
Gesundheitsvorstellungen“ sind Hinweise darüber zu finden, dass Verantwortung abgewehrt wird, wenn subjektiv keine ausreichende Handlungs- und Kontrollmöglichkeit gesehen, wenn das eigene Handeln als fremdbestimmt erlebt wird, und die Konsequenzen des Handelns als unkontrollierbar wahrgenommen werden. Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum alle primär „erzieherischen“ Gesundheitsförderungskonzepte bzw. Aktivitäten nicht auf die gewünschte hohe Akzeptanz und Nachhaltigkeit stoßen (54).
1.1 Ziel der Arbeit und Methoden
Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, was Patienten mit chronischen Erkrankungen, hier konzentriert auf Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, in der Phase der Entscheidungsfindung zur Nierenersatztherapie, an Unterstützung wünschen. Dabei soll hinterfragt werden, ob die in Gesprächen verbalisierten Bedürfnisse auch den basalen Bedürfnissen des Einzelnen entsprechen. Zur Eruierung der individuellen Bedürfnisse der Betroffenen werden teilstandardisierte, qualitative Leitfadeninterview eingesetzt, ergänzt um das Verfahren der Picture Story Exercise, sowie einer zweiten Befragung ca. sechs Monaten nach Therapiebeginn um den Zeitfaktor (Verlauf) zu berücksichtigen.
Auf der Basis der Untersuchung soll ein Betreuungsinstrument entstehen, das den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht wird und das als Arbeitshilfe für Professionelle zur Unterstützung der Patienten eingesetzt werden kann. Es soll angewendet werden mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung so zu begleiten, dass der Patient die Nierenersatztherapie für sich wählt, die seiner Bedürfnisstruktur und der medizinischen Notwendigkeit entspricht.
1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit medizinischen und epidemiologischen Grundlagen von Nierenerkrankungen und dem Wissen der Bevölkerung über diese Erkrankungen, letzterer auf der Basis einer eigenen Passantenbefragung aus dem Jahr 2009. Darauf folgt eine Betrachtung der gesellschaftlichen Relevanz von Gesundheit und Krankheit, zudem wird der Aspekt des Gesundheitskonsums beleuchtet, dies ebenfalls unter Berücksichtigung einer eigenen Onlinebefragung, die im Jahr 2009 durchgeführt wurde. Die besondere Perspektive der Professionellen (Ärzte, Pflegekräfte, etc.) des Gesundheitswesens, ihr Verständnis von Gesundheit und die spezifischen Ausprägungen der Arzt-Patienten-Beziehung, die maßgeblich sind für die Interaktion zwischen den beiden Interaktionspartnern, werden in diesem Kontext diskutiert.
Im folgenden Teil der Arbeit steht der Patient im Mittelpunkt der Betrachtung. Von Bedeutung sind das Gesundheitsverständnis, das Entscheidungsverhalten, die Patientensouveränität und die individuelle Gesundheitskompetenz. Berücksichtigt werden dabei die Grundbedürfnisse von Menschen aus sozialpsychologischer und motivationspsychologischer Perspektive sowie deren Einfluss auf Entscheidungen.
Es folgt die Darstellung der Untersuchung sowie die Präsentation der Ergebnisse der Interviews und des Picture Story Exercise-Experiments. Die Aufarbeitung der Erkenntnisse mündet in den Nephroguide, die entsprechenden Grundlagen, die Konzeption und Überlegungen zur Relevanz werden in Kapitel 8 vorgestellt, eine kritische Reflektion der eigenen Untersuchung wird in Kapitel 9 vorgenommen.
Der Nephroguide soll einen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung, der Kooperation zwischen Professionellen und einer guten der Arzt-Patienten- Beziehung beitragen.
2 Nierenfunktionseinschränkungen und ihre Ursachen
Unter chronischer Niereninsuffizienz oder chronischem Nierenversagen versteht man eine irreversible Einschränkung der Nierenfunktion. Die Ausscheidung von Toxinen und die Flüssigkeitsregulation durch die Nieren sind dann nur noch eingeschränkt möglich. Einer von 10 000 Westeuropäern leidet unter chronischer Niereninsuffizienz, in den USA betrifft diese Erkrankung sogar sechs von 10 000 Einwohnern. Die häufigste Ursache eines chronischen Nierenversagens ist Diabetes mellitus, gefolgt von entzündlichen Veränderungen in der Niere, der Hypertonie und der chronischer Analgetikaeinnahme (22).
2.1 Stadien und Symptome der Niereninsuffizienz
Die Niereninsuffizienz wird in fünf Stadien eingeteilt. Je höher das Stadium, umso fortgeschrittener ist die Erkrankung. Das formale Hauptkriterium für diese Einteilung ist die so genannte glomeruläre Filtrationsrate (GFR). Über die Bestimmung der GFR im Urin lässt sich eine Funktionseinschränkung der Niere am frühesten erkennen. Der Normalwert der GFR für Kreatinin (Creatinin-Clearance) liegt bei 95 bis 110ml pro Minute. Neben der GFR gibt es noch weitere Parameter, die eine Aussage über die Funktionsfähigkeit der Niere geben.
Stadium 1: GFR größer 90 ml/min
In diesem Stadium besteht noch eine normale Nierenfunktion. Die Blutwerte der harnpflichtigen Substanzen sind zu diesem Zeitpunkt im Normbereich. Ein Indiz für eine Nierenschädigung im Frühstadium, ist eine möglicherweise bereits nachweisbare Eiweißausscheidung im Urin. Da die Patienten keinerlei Symptome aufweisen, wird die Diagnose Niereninsuffizienz meist zufällig gestellt, z. B. durch eine Routine-Urinkontrolle, möglicherweise auch im Rahmen der Abklärung eines Hypertonus oder bei einer Vorsorgeuntersuchung.
Stadium 2: GFR zwischen 60 und 89 ml/min
Auch im Stadium 2 sind die Blutwerte der harnpflichtigen Substanzen weiterhin im Normbereich. In dieser Phase ist die engmaschige Betreuung des Patienten besonders wichtig, um einer Progression vorzubeugen. Besonders wenn Hypertonus und Diabetes die Nieren zusätzlich belasten.
Oberstes Ziel ist es, die chronische Niereninsuffizienz solange wie möglich in diesem Stadium zu halten, was bei konsequenter Therapie auch über Jahre möglich ist.
Stadium 3: GFR zwischen 30 und 59 ml/min
Die Nierenschädigung ist nun so weit fortgeschritten, dass auch im Blut erhöhte Kreatinin- und Harnstoffwerte nachzuweisen sind. Spätestens jetzt stellen sich bei den Betroffenen Beschwerden ein. Dies sind z.B. Kopfschmerzen, Hypertonie, Leistungsminderungen und rasche Ermüdung. Die Patienten können diese Symptome oft nur schwer zuordnen, denn sie lassen zunächst keinen Rückschluss auf das Organ Niere zu. In Stadium 3 steigt auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich an. Medikamente (z.B. Schmerzmittel), die normalerweise über die Nieren wieder ausgeschieden werden, müssen jetzt in ihrer Dosis reduziert werden, damit sie keine Nebenwirkungen verursachen und die Nieren zusätzlich belasten oder schädigen.
Stadium 4: GFR zwischen 15 und 29 ml/min
In diesem Stadium nehmen die Beschwerden deutlich zu - dazu zählen unter anderem Appetitlosigkeit, Erbrechen, Übelkeit, Neuralgien, Juckreiz und Ödeme. Die mangelhafte Ausscheidung von Toxinen zieht jetzt den gesamten Körper in Mitleidenschaft. In diesem Stadium sind alle Funktionen der Niere betroffen, neben der Ausscheidung der Toxin und der Regulation des Flüssigkeitshaushaltes, sind Vitamin-D-Regulation, Hormonbildung und Blutdruckregulation betroffen. In diesem Stadium ist die nephrologische Betreuung unabdingbar, um das Fortschreiten der Nierenschädigung zu verlangsam. Entscheidend in dieser Phase ist besonders das Mitwirken des Patienten, der neben der konsequenten Medikamenteneinnahme diätetische Regeln beachten muss, zu unterstützen und zu fördern. Eine gezielte, umfassende und an den Kompetenzen des Betroffen orientierte Aufklärung ist hier unerlässlich.
Stadium 5: GFR unter 15 ml/min
Das Stadium 5 beschreibt den Zustand des völligen Funktionsverlusts der Niere, man spricht deshalb auch von einer terminalen Niereninsuffizienz.
Spätestens jetzt muss mit den einleitenden Maßnahmen für eine geeignete
Nierenersatztherapie (Dialyse/Transplantation) begonnen werden. Trotz Dialyse bleiben die Blutwerte der harnpflichtigen Substanzen erhöht und auch alle anderen Funktionen der Niere müssen medikamentös unterstützt werden (81).
2.2 Nierenerkrankungen
In den folgenden Abschnitten werden mögliche Ursachen beschrieben, die einer chronischen Niereninsuffizienz zugrunde liegen können. Dieser Abschnitt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern orientiert sich an den Erkrankungen, die am häufigsten auftreten. Es wurde berücksichtigt, dass für alle Altersgruppen (Kinder, junge Erwachsene, Erwachsene, betagte Menschen) mindestens eine Erkrankung Erwähnung findet.
2.2.1 Diabetische Nephropathie
In Deutschland sind fast 80 000 Patienten dialysepflichtig. Über 30 % davon haben einen Diabetes (rund 70 % Typ 1, 30 % Typ 2). Typ-1-Diabetiker sowie Typ-2- Diabetiker, deren Erkrankung sich schon im mittleren Erwachsenenalter manifestiert hat, haben ein Risiko von ca. 30 %, terminal niereninsuffizient zu werden, hinzukommen die betagten und hochbetagten Patienten mit Diabetes mellitus (160).
Die diabetische Nephropathie ist kein klar definiertes Krankheitsbild, sondern die Summe unterschiedlichster Veränderungen, die als Folge der diabetischen Stoffwechsellage in den Nieren entstehen können. Sowohl eine mangelnde Durchblutung der Nieren, als auch Veränderungen des Nephrons bedingen eine diabetische Nephropathie. Die Basalmembran wird dicker, die Glomeruli hyalinisieren (das heißt, deren Gewebe wird so umgewandelt, dass die Eiweißkörper glasartig durchscheinen) und werden durchlässig für Eiweißmoleküle. Zunächst kommt es nur zu einer sehr geringen Albuminausscheidung (Mikroalbuminurie), im Verlauf kann sich diese aber zu einer Makroproteinurie steigern. In einem ausgeprägten Stadium findet sich häufig das Vollbild eines Kimmelstiel-Wilson-Syndroms mit Hypoproteinämie (häufig nephrotisches Syndrom), Ödemen, Hypertonie und diabetischer Retinopathie (57).
Nicht alle Diabetiker sind gleich empfänglich für die Entwicklung einer diabetischen Nephropathie. Eine genetische Veranlagung fördert die Entwicklung offenbar entscheidend. Dafür wird eine Veränderung auf Chromosom 18 mit einer dominanten Merkmalsübertragung verantwortlich gemacht. Das Fortschreiten einer diabetischen Nephropathie kann nur verzögert, aber nicht vollständig aufgehalten werden. Beim Nachweis einer Mikroalbuminurie sind therapeutische Konsequenzen, wie Blutzucker- und Blutdruckoptimierung, Nikotinverzicht und ausreichende Bewegung (Sport) zwingend erforderlich. Im Mittelpunkt steht das Erreichen eines optimalen Blutdruckwertes (< 130/85 mmHg). Dazu muss u. U. ein Antihypertensivum verordnet werden, das den systemischen und intraglomerulären Blutdruck beeinflusst, wie z. B. ein ACE-Hemmer oder Sartane. Sonografisch ist die diabetische Nephropathie meist durch große Nieren gekennzeichnet. Viele andere Nierenerkrankungen führen dagegen zu Schrumpfnieren.
2.2.2 Glomerulonephritis
Die Glomerulonephritis ist eine entzündliche Nierenerkrankung, die diffus oder herdförmig an den Nierenkörperchen (Glomeruli) abläuft. Sie führt dort zu einer Schädigung der Filtermembran, so dass Proteine und Erythrozyten die glomeruläre Gefäßmembran passieren können und somit im Urin nachweisbar sind. Eine Glomerulonephritis kann kurz und heftig (akute Glomerulonephritis), rasch fortschreitend (rapid progressive Glomerulonephritis) oder langsam bzw. schleichend (chronische Glomerulonephritis) verlaufen und ist, nach der Pyelonephritis, die zweithäufigste Ursache der chronischen Niereninsuffizienz. Die Vorgänge im Einzelnen sind bei den meisten Glomerulonephritiden nicht geklärt, bekannt sind jedoch verschiedene zugrunde liegende Mechanismen, bei denen stets das Immunsystem beteiligt ist.
Im Folgenden die wichtigsten Ursachen für eine Glomerulonephritis:
1. Durch Immunkomplexe, die sich im Nierengewebe anlagern, kann eine Glomerulonephritis entstehen. Hierbei werden an den Glomeruli entzündliche Gewebeveränderungen hervorgerufen. Ein Beispiel für eine durch Immunkomplexe ausgelöste Glomerulonephritis ist die Poststreptokokkenglomerulonephritis, die einige Zeit nach einem
Streptokokkeninfekt zu einer Nierenentzündung mit nephritischem Syndrom führen kann.
2. Glomerulonephritiden werden häufig bei Systemerkrankungen wie dem systemischen Lupus Erythematodes oder Vaskulitiden wie Morbus Wegener nachgewiesen. Diese Erkrankungen sind allgemein durch eine Überaktivität und Fehlsteuerung des Immunsystems gekennzeichnet. Diese Form der Autoimmunerkrankung manifestiert sich an zahlreichen Organen, typisch ist der Befall von Gelenken und der Haut. Eine Nierenbeteiligung in Form einer Glomerulonephritis führt nicht selten zum terminalen Nierenversagen. 3. Seltener (ca. 5 %) wird eine Glomerulonephritis durch Autoantikörper verursacht, die der Körper speziell gegen die Basalmembran des Glomerulus produziert. Zu diesen Erkrankungen gehört die Anti- Basalmembran-Antikörper-Nephritis. Bei der Mehrzahl dieser Patienten besteht gleichzeitig eine Miterkrankung der Lungen. Diese „pulmorenale Erkrankung“ wird als Goodpasture Syndrom bezeichnet.
4. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl seltener Glomerulonephritiden, die sich im Einzelnen hinsichtlich des Verlaufs, der mikroskopisch sichtbaren Veränderungen, der Therapie und der Prognose unterscheiden.
Glomerulonephritiden machen häufig zu Beginn keine subjektiven Beschwerden. Auftreten können Proteinurie, Hämaturie, Ausscheidung von Harnzylindern, Oligurie, Hypertonie, Ödeme, Nierenschmerzen und evtl. ein nephrotisches Syndrom.
Die Diagnose einer Glomerulonephritis erfolgt primär auf der Basis der Labordiagnostik von Blut und Urin. Eine gesicherte Diagnose ist jedoch nur mittels einer Nierenbiopsie möglich. Die Therapie ist abhängig vom Typ der Glomerulonephritis. Im Vordergrund steht die Behandlung der Grunderkrankung, daneben werden je nach Bedarf Antihypertensiva, Kortikoide oder Immunsuppressiva verordnet (86).
2.2.3 Interstitielle Nierenerkrankungen
Nierenerkrankungen können im Anfangsstadium sowohl das Bindegewebe (Interstitium) zwischen den Glomeruli und den Tubuli, als auch hauptsächlich die Glomeruli betreffen. Diese Einteilung erfolgt mit Hilfe einer Nierenbiopsie. In einem fortgeschrittenen Stadium ist erkennbar, dass sämtliche Strukturen pathologisch verändert sind. Interstitielle Nierenerkrankung (interstitielle Nephritiden) können akut auftreten und zu einer raschen Nierenfunktionsverschlechterung führen, aber auch einen chronischen Verlauf nehmen. Die akute interstitielle Nephritis führt zu einer plötzlichen Entzündung des Bindegewebes in der Niere und meist auch zu einer akuten Nierenfunktionseinschränkung. Diese Verlaufsform ist entweder medikamentös-toxisch (durch Antibiotika, Diuretika), infektiös (durch systemische Infektionen, Pyelonephritis) oder immunologisch (durch systemischen Lupus erythematodes) bedingt. Insbesondere die beiden ersten Gruppen sind klinisch bedeutsam. Die akute interstitielle Nephritis kann von Hautausschlägen, Fieber und Gelenkbeschwerden begleitet sein. Das klinische Spektrum reicht von leichten Funktionseinschränkungen der Niere bis hin zu einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz. Therapeutisch steht die Vermeidung und Behandlung der auslösenden Ursache im Vordergrund.
Unter dem Begriff chronische interstitielle Nephritis werden chronische Entzündungen des Interstitiums der Niere unterschiedlichster Ursache zusammengefasst. Eine wichtige Rolle unter den chronisch interstitiellen Nierenerkrankungen spielt die Analgetikanephropathie, die in der Vergangenheit meist durch die schmerzreduzierende Substanz Phenacetin hervorgerufen wurde. Phenacetin war früher Bestandteil zahlreicher Mischanalgetika, inzwischen ist die Substanz nicht mehr erhältlich. Doch auch die noch zugelassenen Analgetika und nicht steroidalen Entzündungshemmer (Antiphlogistika), wie das sehr gebräuchliche Diclofenac, besitzen ebenfalls ein nierentoxisches Potenzial. Sie sollten mit Vorsicht eingenommen werden, vor allem wenn die Nieren bereits durch andere Erkrankungen vorgeschädigt sind. Man vermutet, dass die Abbauprodukte der Analgetika sich im Nierenmark anreichern und dort zu lokalen Minderdurchblutungen, Sauerstoff-unterversorgung und sukzessive zum Absterben des Gewebes führen (81).
Eine Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung) kann ebenfalls zu einer chronisch interstitiellen Nephritis führen. Sie tritt bei beiden Geschlechtern und in jeder Altersklasse auf, häufiger aber bei Mädchen und Frauen. Im höheren Alter wiederum sind vermehrt Männer betroffen - Ursache ist dann meist eine vergrößerte Prostata, die den Harnabfluss behindert. Die Pyelonephritis nimmt entweder einen akuten oder chronischen Verlauf. Die akute Pyelonephritis tritt meist einseitig auf. Sie entwickelt sich üblicherweise aus einer aufsteigenden Harnwegsinfektion. In 80% der Fälle sind E.-coli-Bakterien die Erreger, normalerweise harmlose Bewohner des menschlichen Darms. Symptome sind schmerzhaftes und häufiges Wasserlassen, hohes Fieber (bis 40 °C), Schüttelfrost, Abgeschlagenheit sowie Rücken- und Flankenschmerzen. Eine chronische Pyelonephritis kann dagegen lange Zeit symptomlos bleiben. Somit besteht die Gefahr, dass sie nicht früh genug erkannt und behandelt wird. Nicht rechtzeitig behandelte Nierenbeckenentzündungen schädigen die Nieren unter Umständen so weit, dass es zu einem vollständigen Nierenversagen (terminale Niereninsuffizienz) kommt und eine Nierenersatztherapie notwendig wird (74).
Sowohl die akute als auch die chronische Pyelonephritis wird mit Antibiotika behandelt. Jede Nierenbeckenentzündung muss sehr sorgfältig austherapiert und kontrolliert werden, um Rezidive zu vermeiden. Sind Engstellen der ableitenden Harnwege zusätzlich vorhanden, sollten diese beseitigt werden. Die direkte Nachbarschaft des Nierenbindegewebes zum Tubulussystem führt bei interstitiellen Nierenerkrankungen, neben der akuten oder chronischen Nierenfunktionsverschlechterung, auch zu Störungen der Transporteigenschaften der Tubuli. Diese Störungen werden unter dem Begriff tubuläre Syndrome zusammengefasst.
Tubuläre Syndrome äußern sich in einer gestörten Rückresorption von Elektrolyten, Puffersubstanzen, Aminosäuren und Glukose. Bedeutende tubuläre Syndrome sind der nephrogene Diabetes insipidus und die renale tubuläre Azidose. Der nephrogene Diabetes insipidus ist eine Erkrankung des distalen Tubulus, bei der das antidiuretische Hormon die Wasserrückresorption aus dem Primärharn nicht mehr steuern kann. Dies führt zu einer enormen Produktion eines gering konzentrierten Urins (Polyurie) und dem daraus resultierenden Wasserverlust.
Bei der renalen tubulären Azidose unterscheidet man eine distale und eine proximale Form. Die distale Form zeichnet sich durch eine Störung der aktiven Säuresekretion in das Tubulussystem aus. Bei der proximalen Form entsteht die Azidose durch eine ungenügende tubuläre Rückresorption von Bikarbonat. Dies wiederum ist häufig ein Symptom des Fanconi-Syndroms, bei dem neben der Übersäuerung (Azidose) weitere tubuläre Transportprozesse gestört sind. Dabei kommt es zu einer erhöhten Ausscheidung von Aminosäuren, Glukose und Phosphat. Das Fanconi-Syndrom ist häufig ein Indikator für eine Nierenschädigung durch Schwermetalle, z. B. bei starker Bleibelastung.
2.2.4 Hypertone vaskuläre Nephropathie
Eine Nierenschädigung kann auch die Folge einer Hypertonie (arterieller Hypertonie) sein. Eine arterielle Hypertonie liegt dann vor, wenn bei mindestens zwei Gelegenheitsblutdruckmessungen an zwei unterschiedlichen Tagen Blutdruckwerte von 140 mmHg systolisch und/oder 90 mmHg diastolisch erhoben werden. Diese Definition bezieht sich auf manuelle Messungen im klinischen Umfeld, die durch einen Arzt oder geschultes medizinisches Personal durchgeführt werden. Eine langjährig bestehende und unzureichend behandelte arterielle Hypertonie führt häufig, durch eine arteriosklerotische Schädigung der kleinen (glomerulären) Gefäße, zu einem chronischen Nierenversagen. Ein schlecht eingestellter Bluthochdruck erhöht zudem das Risiko einer vorzeitigen Arteriosklerose der großen Gefäße. Es kommt unter anderem zu arteriosklerotischen Verengungen der Nierenarterien, so genannten Nierenarterienstenosen. Wenn diese Verengungen beidseits auftreten, kann letztendlich eine chronische Niereninsuffizienz die Folge sein. Eine einseitige Nierenarterienstenose aktiviert das Renin-Angiotensin-System und unterstützt somit einen schon bestehenden Hypertonus. Zeichen der Nieren-schädigung durch Bluthochdruck ist nicht nur die Funktionsverschlechterung der Niere mit Abfall der glomerulären Filtrationsrate, sondern vor allem die Mikroalbuminurie, die einer Nierenfunktionseinschränkung lange vorausgehen kann. Die Mikroalbuminurie wird heute als Marker einer hypertensiv bedingten Gefäßschädigung an allen Endorganen gesehen (87).
2.2.5 Erbliche (angeborene) Nierenerkrankungen
Bei einer erblichen, angeborenen Niereninsuffizienz begegnet man dem Phänomen des chronisch kranken Kindes, welches mit der Niereninsuffizienz und der Nierenersatztherapie sozialisiert wurde (40). Häufig liegt hier ein komplexes Syndrom vor, einhergehend mit Mehrfachbehinderung und einer mehr oder weniger ausgeprägter Retardierung im Jugend- und jungen Erwachsenalter.
2.2.5.1 Erbliche Zystennieren
In Mitteleuropa sind Zystennieren die Bedeutendsten unter den erblichen Nieren- erkrankungen, die zum chronischen Nierenversagen führen. Sie sind klar zu unter- scheiden von einzelnen oder mehreren Nierenzysten, die ein- oder beidseitig auftreten, meist harmlos sind, keine Beschwerden machen und oft nur zufällig im Ultraschall entdeckt werden. Bei den erblichen Zystennieren werden verschiedene Formen unterschieden. Am häufigsten ist die autosomal dominant vererbte polyzystische Nephropathie, die durch eine Mutation auf dem Chromosom 16 verursacht wird. Die Wahrscheinlichkeit der Weitervererbung liegt bei 50 %.
Normalerweise bilden sich die Zysten zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Sie durchsetzen beide Nieren und verdrängen das funktionsfähige Nierengewebe. Die Bowman-Kapsel und die tubulären Strukturen weiten sich allmählich und werden zu Zysten, die mit einer urinähnlichen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Betroffenen leiden schon frühzeitig unter einer schweren Hypertonie. Entwickeln sich sehr große Zysten, füllen die Nieren einen großen Teil des Bauchraums aus und sind von außen gut zu tasten.
Durch aufsteigende Harnwegsinfekte können sich Zysten infizieren. Ferner sind sie durch stumpfe Verletzungen von außen rupturgefährdet. Häufig treten Zysten auch in der Leber und der Bauchspeicheldrüse auf, darüber hinaus findet man häufiger pathologische Aufweitungen von arteriellen Gefäßen (Aneurysmen). Das Voranschreiten einer polyzystischen Nierenerkrankung lässt sich therapeutisch nicht beeinflussen. Im Fokus der Therapie stehen die Vermeidung von Harnwegsinfekten und eine möglichst Senkung des Bluthochdrucks. Eine polyzystische Nephropathie ist bei ca. 10 % aller dialysepflichtigen Patienten in Europa die Ursache des Nierenversagens. Bei 50 % der Betroffenen führt sie vor dem 60. Lebensjahr zur terminalen Niereninsuffizienz und damit zur Dialysepflicht. Ist eine Transplantation geplant, muss bei großen, raumfordernden Zysten häufig eine Niere entfernt werden.
2.2.5.2 Alport-Syndrom
Das Alport-Syndrom ist eine erbliche Nierenerkrankung, bei der eine qualitative Störung der Kollagensynthese vorliegt. Die x-chromosomal vererbte Erkrankung beeinträchtigt nicht nur die Nieren, sondern auch Ohren und Augen. An den Nieren kommt es, auf Grund einer Schädigung der glomerulären Basalmembran, zu einer mikroskopischen Hämaturie sowie einer Proteinurie. Darüber hinaus leiden viele Patienten an einer Innenohrschwerhörigkeit. Die Augen sind seltener betroffen.
Der Verlauf ist bei Männern in der Regel schwerer als bei Frauen, die terminale Niereninsuffizienz tritt um das 25. Lebensjahr ein. Eine kausale Therapie steht bisher nicht zur Verfügung. Viel versprechende Studienergebnisse deuten darauf hin, dass eine vorbeugende Therapie mit ACE-Hemmern den Verlauf der Nierenerkrankung um mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte hinauszögern kann (87).
2.2.6 Akutes Nierenversagen
Das akute Nierenversagen (ANV) ist eine Form der Niereninsuffizienz, die durch eine schnelle Abnahme der Nierenfunktion gekennzeichnet ist und sich wieder zurückbilden kann. Die Dauer eines akuten Nierenversagens schwankt zwischen einigen Stunden und mehreren Wochen. Klinisch unterteilt man das akute Nierenversagen in ein oligurisches akutes Nierenversagen (Harnmenge < 400 ml/d) und in ein nicht-oligurisches akutes Nierenversagen (Harnmenge normal). Die Prognose ist für die nicht-oligurische Form wesentlich besser. Pathophysiologisch unterscheidet man im Fall des akuten Nierenversagens prärenale (70 %), renale (20 %) und postrenale Formen (10 %). Alle Formen des prärenal ausgelösten akuten Nierenversagens beruhen auf einer Verminderung des Blutvolumens. Dadurch kommt es zu ischämisch bedingte Schädigungen von Nephronen. Die wichtigsten Ursachen der prärenalen Form sind: massive Blutverluste, z. B. im Rahmen von schweren Verletzungen oder Operationen, Verbrennungen (Verlust von Plasmaproteinen und Flüssigkeit), Flüssigkeitsverluste, z. B. durch Diarrhö, Perforationen von Hohlorganen mit Flüssigkeits-und/oder Blutverlust in Körperhöhlen, Hypoproteinämie (Eiweißmangel), Herzinsuffizienz, Sepsis oder septischer Schock, Hepatorenales Syndrom.
Der Organismus versucht im Rahmen der Minderdurchblutung der Niere, durch Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, Katecholamin-Aus- schüttung und erhöhte ADH-Ausschüttung, einem Funktionsverlust gegenzusteuern. Dies wiederum führt zu einer verminderten Ausscheidung von Wasser und Natrium. Intrarenal ausgelöste Formen des akuten Nierenversagens zeichnen sich durch eine direkte Schädigung von Nephronen aus. Im Rahmen dieser Schädigung kommt es häufig zu ausgedehnten Tubulusnekrosen, die zur Ablagerung von Zelltrümmern im Tubulussystem führen.
Die Ursachen für die intrarenale Form können sowohl toxisch, entzündlich als auch infektiös sein. Hervorgerufen wird sie häufig durch Medikamente (Zytostatika, Antibiotika), Kontrastmittel, Pflanzengifte, Tiergifte und Chemikalien, Drogen (im Sinne von Rauschmitteln), Hämolyse, Rhabdomyolyse (akute Degeneration quergestreifter Muskeln), Bence-Jones-Proteinen und Hyperkalzämie im Rahmen eines Plasmozytoms, Glomerulonephritis, z. B. im Rahmen eines GoodpastureSyndroms und Infektion mit dem Hantavirus.
Postrenale Formen des Nierenversagens entstehen durch Obstruktionen in den ableitenden Harnwegen, aufgrund derer es zur Anurie und zur Druckerhöhung oberhalb des Abflusshindernisses kommt. Die Durchblutung der Niere wird gedrosselt. Mögliche Ursachen für Obstruktionen in den ableitenden Harnwegen sind Urolithiasis (Nierensteine), Prostatahypertrophie, Tumoren der Harn- und Geschlechtsorgane und des Retroperitonealraums, Stenosen des Ureters und der Urethra, sowie andere mechanische Hindernisse.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es unterschiedliche Ursachen für eine Niereninsuffizienz gibt, unterschiedliche Verlaufsformen (akut und chronisch) und die Erkrankungen angeboren oder erworben sein können. Eine chronische Niereninsuffizienz ist irreversible und führt unweigerlich früher oder später zu einer Nierenersatztherapie. Diese Patienten gehören mit ihren Grunderkrankung zur großen Gruppe der chronisch Kranken, die besondere psychische, soziale und emotionale Besonderheiten und Belastungen aufweisen. Sie sind durch die Kombination bestimmter Faktoren in einer außergewöhnlichen Situation, wodurch sie in der Gruppe der chronisch Kranken zusätzlich eine Sonderrolle einnehmen.
Wie bei kaum einer anderen Krankheit erlebt der Patient mit terminaler Niereninsuffizienz kurz vor und bei Beginn der Dialyse eine Reihe von Abhängigkeiten, die in viele Bereiche seines Lebens massiv eingreifen. Entscheidend ist, wie bereits mehrfach erwähnt, dass der Patient durch wenige Symptome eine zunehmende Funktionseinschränkung der Niere nicht bewusst wahrnimmt und somit den Verlust der Nierenfunktion als plötzlich und überraschend erlebt. Das Wissen über Zusammenhänge und Symptome bei einer eingeschränkten Nierenfunktion ist zu Wenigen bekannt. Diesem Thema wird in Kapitel 2.4.1 (S. 39 ff) Beachtung geschenkt.
In der Phase der Entscheidungsfindung über eine Form der Nierenersatztherapie erscheint es deshalb besonders wichtig die Bedürfnisse der Patienten zu hinterfragen und in die Entscheidungsfindung zu integrieren. Welche Bedürfnis hier im Vordergrund stehen und wie diese in ein Begleitkonzept integriert werden können, solle im Verlauf der Arbeit hinterfragt und geklärt werden.
2.3 Möglichkeiten der Nierenersatztherapie
Die Anzahl der Patienten mit Nierenersatztherapie wächst stetig, ebenso steigen die Multimorbidität und das Alter dieser Patienten an. Im Jahre 1987 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 27.000 Patienten dialysiert, 5.000 Patienten erhielten eine Nierentransplantation. Die Anzahl der Dialysepatienten hat sich bis heute fast verdreifacht und liegt bei über 85.000 Patienten pro Jahr, bei gleich bleibender Anzahl der Nierentransplantationen. Man erwartet in der Bundesrepublik eine Zunahme der Dialysepatienten um jährlich 10.000 Betroffene, die Tendenz ist steigend. Zusätzlich nehmen Patienten mit einem Diabetes mellitus zu, die dann im höheren Alter mit hoher Prävalenz an der diabetischen Nephropathie erkranken (57).
Eine genaue Bezifferung der betroffenen Patienten kann nicht erfolgen, da das Register „Quasi-Niere“ seit Ende 2007 nicht mehr gepflegt wird. An Hand des letzten Berichtes dieses Registers orientieren sich die Erhebungen der aktuellen Patientenzahlen.
2.3.1 Formen der Dialyse
Als Nierenersatztherapie stehen die Hämodialyse, die Heimhämodialyse, die Peritonealdialye und die Transplantation zur Verfügung (22). Gemäß gesetzlichen Vorgaben ist der behandelnde Arzt zu einer umfänglichen Aufklärung über alle Ersatzverfahren verpflichtet. Persönliche Präferenzen dürfen hier keine Rolle spielen, ebenso muss der niedergelassene Nephrologe alle Ersatzverfahren anbieten und eine Transplantationsnachsorge ermöglichen. Trotz dieser Vorgaben kann beobachtet werden, dass Heimverfahren seltener angewandt werden als die Behandlung durch eine Hämodialyse im Dialysezentrum. Im Kinder- und Jugendalter ist die Peritonealdialyse sehr viel mehr verbreitet als im Erwachsenenalter, hiermit soll neben einer möglichst optimalen und schonenden Befreiung des Körpers von den harnpflichtigen Substanzen, eine altersgerechte und familienorientierte Sozialisation ermöglicht werden, um Spätfolgen zu vermeiden (40).
2.3.1.1 Hämodialyse
Die Hämodialyse ist ein effektives Nierenersatzverfahren, wobei die Urämietoxine über Diffusion aus dem Blut entfernt werden. Die Behandlung dauert ca. 4,5 Stunden und muss mindestens dreimal wöchentlich erfolgen. Es ist möglich, die Dialysezeit zu verlängern, z.B. in Form einer „Langen Nacht-Dialyse“ (8 Stunden) oder einer täglichen Heimhämodialyse. Es wird davon ausgegangen, dass eine lange wöchentliche Dialysezeit die Gesamtlebenszeit verlängert und die begleitende Medikation (insbesondere Antihypertensiva und Phosphatbinder) reduziert werden kann. Das allgemeine Wohlbefinden dieser Patienten verbessert sich in der Regel gravierend, ebenso ihre Leistungsfähigkeit. Hohe Qualitätsstandards sichern die Dialyseeffektivität. Neben der Dialysezeit und Dialysefrequenz ist der Hb-Wert des Patienten zu beachten, sowie die Harnstoffkinetik (Kt/V-Wert) als Parameter für die Dialysequalität. Die Reinigung des Blutes erfolgt in der Regel über einen Unterarmshunt. Andere Gefäßzugänge sind ZVK (zentrale Venenkatheter), permanente zentralvenöse Katheter (Demerskatheter) und Portsysteme (22).
Die Hämodialyse ist das am weitesten verbreitete künstliche Blutreinigungsverfahren, welches bei Niereninsuffizienz zum Ersatz der Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktion eingesetzt wird. Um diese Ziele zu erreichen, lässt man das Blut auf der einen und die Dialysierlösung auf der anderen Seite an einer semipermeablen Membran entlang fließen. Der primär wirksame Transportmechanismus bei der Hämodialyse ist die selektive Diffusion. Die Porengröße der semipermeablen Membran entscheidet darüber (selektiert), welche Moleküle aus dem Blut in die Dialysierlösung und umgekehrt diffundieren können. Die Membran ist für Wasser, kleinere und mittlere Moleküle durchlässig. Blutzellen und größere Moleküle, z.B. Proteine, können die Membran nicht passieren. Die Transportrate einer Substanz hängt bei der Hämodialyse unter anderem vom Konzentrationsgefälle (Konzentrationsgradienten) zwischen Blut und Dialysierlösung und von der Größe der Moleküle ab.
Die Hämodialyse kann als Zentrumsdialyse erfolgen oder auch als Heimverfahren durchgeführt werden. Hierzu wird der Patient in einem Dialysezentrum trainiert, um anschließend seine Behandlung selber oder mit Hilfe des Partners zu Hause durchzuführen. Heimverfahren haben generell den Vorteil der höheren Selbstbestimmung, aber auch den Anspruch an die Zuverlässigkeit der Patienten. Eine Überwachung kann online erfolgen, das umgehende Eingreifen bei Komplikationen ist damit jedoch nicht gewährleistet. Dieses Verfahren bietet sich für jüngere und stabile Patienten an. Vorkenntnisse oder medizinische Kenntnisse sind nicht Voraussetzung, können aber erleichternd sein.
2.3.1.2 Peritonealdialyse
Bei der Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse) werden über einen dauerhaft in den Bauchraum implantierten Katheter 1,5-2,5 Liter einer sterilen Flüssigkeit (Dialyselösung) der Schwerkraft folgend in die Bauchhöhle eingebracht. Die Dialyselösung enthält Elektrolyte, eine Puffersubstanz (Bikarbonat, Laktat oder ein Bikarbonat-Laktat-Gemisch) zur Korrektur der metabolischen Azidose (Übersäuerung) und eine osmotisch wirksame Substanz (Glukose, 35 Glukosepolymere, Aminosäuren) zum Wasserentzug. Durch den Austausch von gelösten Stoffen zwischen dem Blut in den kleinen Blutgefäßen des Bauchfells (Kapillargefäße) und der Dialyselösung erfolgt eine ausreichende Entfernung der harnpflichtigen Substanzen. Dieser Austausch findet nach dem Prinzip der Diffusion statt. Die gelösten Substanzen bewegen sich durch die semipermeable Membran (Kapillarwand) vom Ort der höheren Konzentration (Blutkapillaren des Peritoneums) zum Ort der niedrigeren Konzentration (Dialyselösung) bis zum Konzentrationsausgleich. Zur Entfernung des überschüssigen Körperwassers wird das Prinzip der Osmose genutzt. Abhängig von der Glukosekonzentration in der Dialyselösung entsteht ein Druckgradient, der das Wasser aus den Kapillaren des Peritoneums über das Interstitium und das Mesothel in die Bauchhöhle „saugt“.
Die Dialyselösung verbleibt mehrere Stunden (Verweilzeit) in der Bauchhöhle und wird 3- bis 5-mal täglich ausgewechselt. Die Verweilzeit der Dialyselösung und die Frequenz der täglichen Wechsel (Einlauf/Auslauf) muss patientenindividuell, je nach Transporteigenschaften des Peritoneums und der Restnierenfunktion der Niere, festgelegt werden. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der manuellen Peritonealdialyse (CAPD), die der Patient ausschließlich selbst oder mit Hilfe von Angehörigen durchführt und den apparativ unterstützenden Verfahren (APD).
Nachfolgend alle gängigen Möglichkeiten:
1. CAPD (engl. continuous ambulant peritoneal dialysis, kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse): Der Patient wechselt die Dialyselösung täglich 4- bis 5-mal manuell, mit einem längeren Intervall in der Nacht. Unter absoluter Einhaltung hygienischer Richtlinien wird morgens nach dem Aufstehen und dann i. d. R. alle 3-6 Stunden drei weitere Male ein Beutelwechsel vorgenommen. Dazu wird zunächst das alte Dialysat aus der Bauchhöhle in einen leeren Beutel zum Auslauf gebracht, anschließend wird der Beutel mit frischer, angewärmter Dialyselösung in die Bauchhöhle eingebracht. Der Beutel mit der verbrauchten Dialyselösung wird gewogen. Die Differenz zwischen Ein- und Auslauf ist die dem Körper entzogene Flüssigkeit, diese wird protokolliert. Sowohl der Auslauf als auch der Einlauf erfolgen mit Hilfe der Schwerkraft, d. h., beim Auslauf wird der Beutel abgesenkt, beim Einlauf angehoben. Der Beutelwechsel dauert ca.
30 Minuten. Davon entfallen 10-15 Minuten auf den Auslauf und 10 Minuten auf den Einlauf. Der Rest der Zeit wird für die Vor- und Nachbereitung benötigt. Im Prinzip kann der Beutelwechsel überall, wo die hygienischen Verhältnisse es erlauben, durchgeführt werden, zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs im Hotel oder an anderen Orten.
2. APD (engl. automatic peritoneal dialysis, automatische Peritonealdialyse): Der Wechsel der Dialyselösung erfolgt maschinell mittels eines Dialysegeräts (Cycler).
3. CCPD (engl. continuous cycling peritoneal dialysis, kontinuierliche cyclervermittelte Peritonealdialyse): Die CCPD ist eine Form der APD: Die Behandlung wird vom Patienten jede Nacht selbstständig mit einem Cycler durchgeführt. Die Dauer der Behandlung beträgt ca. 6-12 Stunden (bei Bedarf auch mehr) mit z. B. 4-5 Füllungen. Am Tag wird eine Beutelfüllung im Bauchraum belassen. Eventuell kann noch ein zusätzlicher Beutelwechsel über Tag durchgeführt werden.
4. TPD (engl. tidal peritoneal dialysis, Tidal-Verfahren; Tiden=Gezeiten). Bei diesem Verfahren wird die Dialyselösung mittels Cycler nicht völlig, sondern nur teilweise (max. 85 %) aus dem Bauchraum entfernt und wieder ersetzt. Das hat den Vorteil, dass die Wechselhäufigkeit der Dialyselösung gesteigert werden kann. In Abhängigkeit, u. a. von der peritonealen Transportrate, wird dadurch die Effektivität der Dialyse erhöht. Bei Patienten mit Flussproblemen, insbesondere gegen Ende des Dialysatauslaufs, wird die TPD bevorzugt eingesetzt.
5. IPD (engl. intermittent peritoneal dialysis, intermittierende Peritonealdialyse): Der Dialysatwechsel erfolgt durch einen Cycler. Die Behandlung wird ambulant im Dialysezentrum oder stationär 3-4 mal pro Woche für 8-12 Stunden durchgeführt.
6. NIPD (engl. nocturnal intermittent peritoneal dialysis, nächtliche intermittierende Peritonealdialyse). Durchführung einer IPD, nur über Nacht.
In Deutschland wurden im Jahre 2006 lediglich ca. 5 % aller dialysepflichtigen Patienten mit der Peritonealdialyse behandelt und das, obwohl mehrere Untersuchungen darauf hinweisen, dass die Peritoneladialyse und die Heimhämodialyse weitgehend als gleichwertige Behandlungsverfahren gesehen werden. In einigen europäischen Nachbarstaaten, wie den Niederlanden (ca. 30 %) oder England (40 %), liegt der Anteil der Peritonealdialyse-Patienten wesentlich höher. Die Peritonealdialyse bietet gegenüber der Hämodialyse entscheidende Vorteile. Die Patienten haben die Möglichkeit einer flexibleren Tagesgestaltung, die Einschränkungen bezüglich der Ernährung sind weniger restriktiv. Des Weiteren bleibt die Nierenrestfunktion zumeist länger erhalten. Darüber hinaus können Patienten im erwerbsfähigen Alter ihrer Berufstätigkeit uneingeschränkt nachgehen (22).
2.3.2 Nierentransplantation
In Deutschland warten nach Angaben der Experten derzeit etwa 9000 bis 9500 Menschen auf eine Spenderniere. Die Wartezeit auf ein Organ beträgt durchschnittlich fünf bis sieben Jahre. Pro Jahr werden bis zu 2500 Nieren transplantiert (Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO): Organspende und Transplantation in Deutschland Jahresbericht 2008)2. Mit speziellen Programmen, wie z. Bsp. „ young for young “ für junge Patienten, sowie eines Kinderbonusses und die Etablierung eines so genanntes „europäischen Seniorenprogramm“ (ESP) für die ältere Generation, wird die Verteilung der Transplantate beeinflusst. Das europäische Seniorenprogramm wird auch „ old for old “ Programm genannt, hier werden Nierenspenden, die 65 Jahre und älter sind, gezielt der gleichen Altersgruppe angeboten. Ziel ist es, vor allem angesichts des Organmangels, auch Organe von älteren Organspendern noch in hilfreicher Weise zu nutzen. Durch beide Programme konnten die Wartezeiten für beide Altersgruppen reduziert werden.
Bei der Nierentransplantation kann zwischen der Kadaverspende und der Lebendspende unterschieden werden (89). Der Vorteil der Lebendspende bei engen Verwandten ist u.a. die hohe Übereinstimmung der Gewebemerkmale, dafür kann auf der anderen Seite eine hohe emotionale Belastung für Spender und Empfänger entstehen, insbesondere durch empfundene Abhängigkeit, Ängste und Dankbarkeit. Ein weiterer Vorteil der Lebendspende ist die Planbarkeit des Eingriffes, der dann unter optimalen medizinischen und sozialen Bedingungen erfolgen kann. Während für kleine Kinder die Entscheidung einer Lebendspende noch nicht von besonderer Bedeutung sein muss, kann sie für Jugendliche und junge Erwachsene elementar sein und bis zur bewussten, unbewussten bzw. unterbewussten Ablehnung des Organs führen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass jede Therapieform Vor- und Nachteile birgt und eine umfängliche Aufklärung und Begleitung in der Phase der Entscheidungsfindung rechtfertigt. Wie entscheidend diese Aufklärung ist, zeigen Umfragen in den USA und Europa bei Nephrologen. Diese Studien belegen, dass die Patientenentscheidung bzw. der Patientenwille das entscheidende Kriterium für die Auswahl des Dialyseverfahrens ist (74).
Allerdings ist zu beobachten, dass in der Realität dem dialysepflichtigen Patienten die Therapieoptionen Hämodialyse, Peritonealdialyse oder Lebendspende nicht oder nicht mit der gleichen Intensität angeboten werden. Aufgrund einer Auswertung des USRDS (US Renal Data System) verweist Mendelssohn darauf, dass nur 25 % der Hämodialyse-Patienten vor ihrer Entscheidung die Peritonealdialyse als Behandlungsoption kennen gelernt haben (102).
Werden Patienten rechtzeitig durch standardisierte Aufklärungsprogramme auf alle Therapieoptionen hingewiesen, entscheiden sich bis zu 40 % der Patienten für die Peritonealdialyse als Heimverfahren (73). In der Tat ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Beratung von Patienten durch den behandelnden Nephrologen zu einer Form der Nierenersatztherapie von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Hier zu nennen sind zum Beispiel unterschiedliche persönliche Akzeptanz und Erfahrungen mit den einzelnen Therapieverfahren bei den Ärzten, aber auch vorhandene oder nicht vorhandene Ressourcen, wie zum Beispiel eine Trainingsschwester, die Möglichkeit einer 24-Std.-Rufbereitschaft bei akuten Notfällen oder eine Anbindung an eine stationäre nephrologische Abteilung. Diese Erkenntnisse waren zusätzliche Motivation, den Nephroguide zu entwickeln und einzuführen.
2.4 Wissen in der Bevölkerung zu Nierenerkrankungen
Über das Wissen in der deutschen Bevölkerung bezüglich Erkrankungen und speziell Nierenerkrankungen gibt es wenige Untersuchungen. Eine Repräsentativbefragung von rund 1.550 Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren zu diesem Thema erfolgte 2008 von der Bertelsmannstiftung (15) mit der Frage, ob Wissensdefizite mit höherer Morbidität verbunden sind, ob sich die Nutzung unterschiedlicher Informationsmedien auch auf den Wissensstand auswirkt und ob in der Bevölkerung die Notwendigkeit gesehen wird, Gesundheitswissen stärker im Bildungswesen zu verankern. Ein direkter Einfluss des Gesundheitswissens auf die Morbidität ließ sich dabei nicht nachweisen. Dennoch sind Wissensdefizite weit verbreitet, unter anderem die irrige Vorstellung, dass Antibiotika bei Erkältungskrankheiten die Krankheitsdauer abkürzt. Auch zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Gesundheitswissen und Bildungsniveau - aber auch Befragte mit Abitur weisen keinesfalls durchweg einen fundierten Wissensstand zu Krankheit und Gesundheit auf. Die intensive Informationssuche in populären Massenmedien (Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften) zu gesundheitlichen und medizinischen Fragen führt eher zu einer Ansammlung von Irrtümern und Fehleinschätzungen, als zu einem fundierten Gesundheitswissen. Offensichtlich ist das gesundheitliche „Bildungsangebot“ dieser Medien defizitär und nicht hinreichend geeignet, Verbraucher und Patienten bei ihren Entscheidungen im Alltag zu unterstützen (15).
Im Rahmen einer eigenen Passantenbefragung im Umfeld des Welthypertonietages (2009) im Hautbahnhof Hannover sollte mit folgenden Fragen das Wissen über Nierenerkrankungen und das Interesse an Informationen darüber erhoben werden.
Wissen Sie, wie Sie ihre Nieren schützen können?
Wissen Sie, dass die Zuckerkrankheit die Niere schädigt?
Wissen Sie, dass der Bluthochdruck etwas mit der Niere zu tun hat? Wissen Sie, dass Schmerzmittel die Niere schädigt?
Wären Sie interessiert, an einer kostenlosen Schulung zur Vorbeugung von Nierenerkrankungen teilzunehmen?
Die Fragen sollten lediglich mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. Zusätzlich wurden das Alter und das Geschlecht der Befragten dokumentiert.
2.4.1 Ergebnisse der Befragung
Insgesamt nahmen an der Befragung 395 Passanten teil, davon waren 210 männlich und 185 weiblich. Die Teilnehmer wurden in Altersgruppen zwischen 15 und über 70 eingeteilt (Tabelle 1). Die Passanten wurden ohne Vorselektion am Bahnsteig angesprochen und um ihre Teilnahme an einem Kurzinterview erbeten. Einführend wurde ihnen erklärt, dass diese Befragung im Rahmen des Welthypertonietages erfolgt und mit Unterstützung der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt wird. Zusätzlich wurde auf einen Informationsstand im Bahnhofsbereich hingewiesen, an dem die Möglichkeit bestand, sich umfangreich zu informieren, den Blutdruck messen zu lassen und einen Arzt um Rat zu fragen. Ein Teil der Passanten nutzte dieses Angebot. Das angebotene Informationsmaterial, bestand aus einer Broschüre zum Thema Nierenerkrankung und Hochdruck, einem Blutdruckpass sowie einem Urinstick zum Nierenfunktionstest zu Hause.
Tab. 1: Altersverteilung der Teilnehmer in der Passantenbefragung (N=395)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Übersicht über die zentralen Antworten aus der Passantenbefragung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Altersgruppen, zeigt Tabelle 2.
Tab. 2: Übersicht über Anteil der Antworten mit Ja über alle Fragen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
63 % der Befragten gaben an zu wissen, wie sie ihre Nieren schützen können. Im Geschlechtervergleich sind Frauen (74%) besser informiert als Männer (53%). Als möglichen Schutz gaben die Passanten häufig „viel Trinken“ und „Wärme“ an. Einen Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus und Nierenkrankung vermuteten 63% der Passanten, auch hier eine deutliche Verteilung zwischen den Geschlechtern, 71% der Frauen; 56% der Männer. Dass es einen Zusammenhang zwischen der Hypertonie und Nierenerkrankungen gibt, wussten nur 42,0 % der Befragten, auch hier waren die Männer mit 40% etwas unwissender als die Frauen mit 45%.
Eher hoch war das Wissen über den Zusammenhang zwischen Schmerzmitteln
und Nierenschädigung - 77% der Befragten waren der Meinung, dass Schmerzmittel die Nieren schädigen. Hier zeigten sich ebenso geschlechtsspezifischen Unterschiede (Abb. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Verteilung des Wissens bezüglich Schmerzmitteleinnahme und Nierenschädigung
Das Interesse an einer kostenlosen Schulung zum Thema „Wie schütze ich meine Nieren“ war in dem Kollektiv unterschiedlich ausgeprägt. Bei den Frauen äußerten die besonders jungen und besonders alten Befragten hohes Interesse, in allen anderen Altersphasen hatten die Befragten das Gefühl, ausreichend Wissen zu besitzen, sodass sie kein Bedürfnis an einer Schulungsmaßnahme verbalisierten.
Bei den männlichen Patienten sah es ähnlich aus, nur die Verteilung des „vermeintlichen Wissens“ war unterschiedlich verteilt. Man könnte vermuten, dass „Mann“ sich aus dem Thema Gesundheit in einzelnen Lebensphasen heraus schleicht. Zwischen dem 40 und 50 Lebensjahr scheinen andere Dinge im Vordergrund zu stehen, Leistungsfähigkeit und beruflicher Erfolg verdrängen den Gedanken an Krankheit und Vorsorge. Ebenso das gesellschaftlich geprägte Bild der Ehefrau als „Gesundheitsmanagerin“ der Familie. Veränderungen erfolgen jenseits des 50. Lebensjahres, jetzt gerät die Gesundheit wieder verstärkt in den Fokus. Übergewicht und Hochdruck und das bekannte erhöhte Infarktrisiko in dieser Altersphase lässt die Männer scheinbar sensibler für ihre Gesundheit werden. Sicherlich spielt auch die zur Verfügung stehende freie Zeit eine Rolle, die in dieser Lebensphase wieder mehr vorhanden ist als zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr.
Bei der Altersverteilung wird ersichtlich, dass das Wissen über den Zusammenhang zwischen Hypertonie und Nierenerkrankung in der Altersphase 40-55 Jahre, in der eine Sekundärprävention noch erfolgreich wäre und den Beginn der Dialysepflicht hinauszögern könnte, bei den männlichen Passanten eher gering ausgeprägt ist (Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Verteilung des Wissens über den Zusammenhang Hypertonie und Nierenerkrankung
Die wichtigsten Ergebnisse aus der Passantenbefragung zusammengefasst:
3 M
3 W
1. Es besteht in der befragten Passantengruppe kein verbreitetes Wissen über die Zusammenhänge zwischen Hypertonie und Nierenerkrankung, ebenso über die Zusammenhänge zwischen Diabetes und Nierenerkrankung. Wobei der Zusammenhang zwischen Hochdruck und Nierenerkrankung weniger bekannt zu sein schein als der Zusammenhang zwischen Diabetes Mellitus und Nierenerkrankung.
2. Das Wissen bezüglich der Schädigung der Nieren durch Schmerzmittel ist einem großen Teil der befragten Passantengruppe bekannt.
3. Die Wissensverteilung differiert nach Alter und Geschlecht. Bei den befragten Frauen konnte ein höheres Wissen über Krankheiten und ihre Zusammenhänge als bei Männern erkannt werden. Dies könnte auch auf eine höhere Gesundheitskompetenz der Frauen hindeuten.
4. Interesse an Schulungsmaßnahmen zum Nierenschutz besteht besonders bei Frauen und bei der Altersgruppe der über 60 Jährigen.
Die aus dieser Befragung gewonnenen Erkenntnisse können - bei aller gebotenen Zurückhaltung bei der Interpretation der Daten aufgrund der Selektion der Befragten und der nicht-repräsentativen Zufallsstichprobe - als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Patienten in der Tat von einer Diagnose überrascht sein können, da der Bevölkerung die Verbindung zwischen den Krankheiten und Risikofaktoren, die einen schädigenden Einfluss auf die Nieren haben können, nicht in ausreichendem Maß bekannt zu sein scheint.
Auch lassen sich erste Parallelen zu neueren Studien zum Thema „healthy living“ von Teichert erkennen, der sieben Typen (health styles) von Menschen beschreibt, die einen speziellen Umgang mit Gesundheitsthemen präferieren (136).
Teichert definiert hier die so genannten „Blockierten“, die zwar erkennen, dass Gesundheit wichtig ist, aber keine Zeit finden, sich darum zu kümmern. Der typische Vertreter dieses Typus ist männlich, 50-59 Jahre, verheiratet mit durchschnittlichem Bildungsniveau, in Vollzeitbeschäftigung und hohem Einkommen. Der „Unbekümmerte“ ist ein weiterer Typus, der Gesundheit eher beiläufig wahrnimmt „Gesundheit ja - aber erst morgen“. Der typische Vertreter hier ist ebenso männlich, 20-29 Jahre, ledig, Abitur und relativ geringes Einkommen, da noch in der Ausbildung, Studium oder Berufsanfänger.
Daneben wird eine Gruppe der „Desinteressierten“ beschrieben, in der beide Ge- schlechter vertreten sind, dabei wird diesem Typus kein spezifisches Alter, aber geringe Bildung und geringes Einkommen zugeschrieben.
Typisch weibliche Vertreterinnen sind die "Individualistinnen", im Alter zwischen 30 und 39 Jahren, ledig, hohes Bildungsniveau, Vollzeitbeschäftigt mit durchschnittlichem bis hohem Einkommen und die "Konsumentinnen" zwischen 30 und 39 Jahren mit geringem Bildungsniveau, unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen und eher niedrigem Einkommen. Ebenfalls eher bei den Frauen zu findende Typen sind die "Instinktiven" und die "Vorreiterinnen".
Auch diese kurze umrissene Studie gibt Hinweise darauf, dass das Thema Gesundheit ein „weibliches“ Thema ist und eine höhere Gesundheitsorientierung bei Frauen zu beobachten ist. Die Typisierung diente dazu, einen Beitrag zum Thema Gesundheitsmarkt aus dem Blickwinkel des Marketings zu leisten, dennoch lassen sich Parallelen zum Gesundheitsverhalten insgesamt ziehen.
Bevor im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit der Patient im Vordergrund der Betrachtung stehen soll, werden die gesellschaftliche Perspektive und die Perspektive der Professionellen eingehend analysiert, da davon ausgegangen wird, dass Patienten und Professionelle sich in einem gemeinsamen gesellschaftlichen Rahmen bewegen, der Werte und Normen setzt. Insoweit sind individuelle Entscheidungen immer auch abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
3 Gesundheit und Krankheit - die gesellschaftliche Perspektive
Was versteht „die Gesellschaft“ unter Gesundheit und Krankheit? Welche Normen und Werte sind daran gebunden und welche Hinweise gibt es über den Wandel, den die Begriffe erfahren haben? Wie lassen sich Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und Situationen einordnen?
Im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Fragen wird im Folgenden vor allem auf den relativ neuen Aspekt des „Gesundheitskonsums“, als eine Grundlage von Entscheidungen zur Inanspruchnahme von Angeboten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen, eingegangen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Gesellschaftlich geprägte Einflussfaktoren auf die gesundheitsbezogene Entscheidungs- findung des Einzelnen
In einer ersten Annäherung an den Begriff „Gesundheit“ im gesellschaftlichen Kontext werden einige ausgewählte Zitate präsentiert, um die Entwicklung bzw. Veränderung nachzuvollziehen.
Gesundheit ist zwar nicht alles - aber ohne Gesundheit ist alles nichts. (Arthur Schopenhauer 1788-1860)
Stabiles Selbstwertgef ü hl, positives Verh ä ltnis zum eigenen K ö rper,
Freundschaft und soziale Beziehungen, eine intakte Umwelt, Sinnvolle Arbeit und gesunde Arbeitsbedingungen, Gesundheitswissen und Zugang zur Gesundheitsversorgung, lebenswerte Gegenwart und die begr ü ndete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft sind die Grundbedingungen f ü r die Gesundheit. (Die Weltgesundheitsorganisation, 1963)
Die Summe von Arbeitsinhalt, Pers ö nlichkeitseigenschaften und
Arbeitsumfeld ist verantwortlich f ü r Motivation und Gesundheit der
Mitarbeiter. (Dr. Johannes Kr ä mer, September 2001 vor dem Forum Arbeit und Gesundheit)
Gesundheit ist der Megamarkt der Zukunft. Alle Bereiche der Wirtschaft
werden mit diesem Thema noch enger verbunden sein. Damit r ü ckt erstmals der Mensch in das Zentrum des Wirtschaftsgeschehens. (Leo A. Nefiodow, September 2001 vor dem Forum Arbeit und Gesundheit)
Eine historisch bedeutsame und auch aktuell viel zitierte Definition von Gesundheit ist die Formulierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 22. Juli 1946. Sie lautet: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen.“ („Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity“.)
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1997 (BMFT) definiert Gesundheit: … als mehrdimensionales Ph ä nomen …“ , das über den Zustand der Abwesenheit von Krankheit“ hinaus reicht. Forscher aus dem Bereich der Pflegewissenschaften sehen in Krankheit und Gesundheit
„ dynamische Prozesse “ , die f ü r die Pflege als F ä higkeiten und Defizite erkennbar sind und betrachten Gesundheit als … .eine zufrieden stellende Entfaltung von Selbstst ä ndigkeit und Wohlbefinden in den Aktivit ä ten des Lebens (90).
Nach dem Meikirch-Modell wird Gesundheit als … ein dynamischer Zustand von
Wohlbefinden bestehend aus einem biopsychosozialen Potential, welches gen ü gt, um die alters- und kulturspezifischen Anspr ü che des Lebens in Eigenverantwortung zu befriedigen, beschrieben (16) . Und Kickbusch formuliert, dass Gesundheit zum ethischen Prinzip, zum Argument, Verh ä ltnisse oder Verhalten zu loben oder zu tadeln und auf entsprechend Ver ä nderungen zu dr ä ngen, geh ö rt (77) . Gesundheit wird zum sozialregulativen Wert womit gemeint ist, dass Gesundheit ein weiterer Parameter ist, der soziale Unterschiede hervorhebt und dokumentiert.
Gesundheit wird von Wissenschaftlern auch als eine Art persönliche Ressource verstanden, die verbraucht oder gebraucht wird. Dazu gehört, was der Einzelne besitzt und ihn vor Krankheit schützt, also die Fähigkeit, anstürmende Krankheitserreger und pathogene Bedingungen ohne Erkrankung zu überstehen (68). Faltermeier und Kühnlein erweitern dieses Konzept um eine Differenzierung der Ressource in drei Varianten: Ein „Batteriemodel“ als eine Ressource, die sich im Laufe des Lebens verbraucht, ein „Akkumodell“ als eine Ressource, die regenerierbar ist und ein „Generatormodell“ als eine Ressource, die erweiterbar bzw. steigerungsfähig ist, zum Beispiel durch gesunde Ernährung, Vermeidung von belastenden Noxen wie z. B. Rauchen und Alkohol etc. (49).
Unübersehbar hat Gesundheit viele Facetten. Waren die historisch frühen Definitionen noch dadurch geprägt, dass fehlende Gesundheit mit Aussichtslosigkeit, großem Leiden und schnellem Lebensende assoziiert wurde, integrieren spätere Versionen, die weit über das persönliche Betroffensein hinausgehen, auch gesellschaftliche Aspekte. Gesundheit wird in der aktuellen Diskussion auch zum selbstverantwortlich Machbaren erklärt und Krankheit unter dieser Diktion als Resultat individuellen Fehlverhaltens interpretiert3.
Neu in der Diskussion über Gesundheit und ihren Stellenwert ist die von Nefiodow aufgeworfene Marktdefinition „ Gesundheit ist der Megamarkt der Zukunft “. Dies thematisiert den Aspekt des Gesundheitskonsums, also alles das, was der Einzelne konsumiert, verbraucht, gebraucht, um einen optimalen oder besseren
Gesundheitszustand zu erzielen bzw. seinen Gesundheitszustand zu erhalten und zu verbessern und um Krankheiten vorzubeugen. Unklar bleibt bei diesen Überlegungen, was zu einem besseren Gesundheitszustand führt und ob es ein Maximum gibt oder ob Gesundheit nur als anzustrebender Zustand im Gegensatz zu Krankheit steht. Daraus ergibt sich die Frage, wer die Definitionshoheit über Gesundheit und Krankheit hat, die Medizin, die Wissenschaft, die Ökonomie oder das Individuum? Somit wird es Ziel führend, sich mit dem Begriff des Konsums detaillierter zu beschäftigen.
3.1 Gesundheitskonsum
Auf den ersten Blick erzeugt der Begriff Gesundheitskonsum einen inneren Konflikt. Konsum wird umgangssprachlich mit dem Verbrauch von Gütern verknüpft, der über die erforderliche Notwendigkeit hinausgeht. Im Sprachgebrauch schlägt sich das im „sich etwas leisten“ nieder, somit werden Konsumgüter auch schnell mit Luxusgütern gleichgesetzt. Durch das eingesetzte Geld als Gegenleistung erfährt der Konsum eine Form der Entmoralisierung und Legitimierung. Dem gegenüber steht Gesundheit als einer der letzten unumstrittenen Werte unserer Gesellschaft, verbunden mit dem Recht auf gesunde Lebensverhältnisse und medizinische Versorgung zur gesellschaftlichen Teilhabe gemäß Sozialgesetzbuch V mit hohen ethischen Anteilen und nach wie vor impliziten altruistischen Aspekten.
Aus marktwirtschaftlicher Perspektive bedeutet Konsumieren selbstgesteuertes, willentliches und verantwortetes Handeln. Im Zusammenhang mit Gesundheit gibt es hier die ersten Dissonanzen. Lag doch die Gesundheit lange im Verantwortungsbereich der Gesundheitsberufe und wurde von Kranken maximal als verantwortliches Handeln im Rahmen der Einhaltung von Verhaltensweisen eingefordert, so ist in diese Sichtweise Bewegung gekommen, denn mit der Zuordnung von Gesundheit zum Konsumverhalten wird dem Individuum auch Verantwortung für die eigene Gesundheit zugeschrieben, die zugleich eine soziale Verantwortung nach sich zieht.
In der Ökonomie steht der Begriff Konsum kurz für Konsumgüter, d. h. Güter des privaten Ge- oder Verbrauchs. Dabei dient Konsum nicht nur den lebenswichtigen Gütern, sondern auch der Intensivierung des individuellen Lebensgefühls (29) und der Abgrenzung von anderen, oft statusniedrigen Gruppen (138). Der Konsum von Gütern und Dienstleistungen eröffnet dem Konsumenten die Möglichkeit der Identifikation, Zugehörigkeit und Distinktion. So stellt Bosshart fest: „ Heute definieren wir unsere menschlichen Bed ü rfnisse und W ü nsche weitgehend ü ber den Konsum und benutzen ihn als Mittel zur Selbstdarstellung und Differenzierung, Konsum erzeugt Gl ü cksgef ü hle! “, denn die Bedürfnisse des täglichen Lebens sind längst befriedigt. Entscheidend ist, dass steigender Konsum nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch gewollt ist, jedenfalls so lange es dem Wirtschaftswachstum zu Gute kommt (21).
Auch im Gesundheitswesen findet Konsum statt - durch Kauf von Gütern oder Dienstleistungen (Medikamente, Medizinische Hilfsmittel und Dienstleistungen wie Massage, Physiotherapie, Pflege). Auch haben sich Marketingkonzepte aus gesundheitsfernen oder gesundheitsfremden Wirtschaftszweigen bereits im Gesundheitswesen erfolgreich durchgesetzt (z.B. Kettenbildung wie „Doc Morris), und Patienten schließlich werden als Selbstzahler und damit als interessante Kunden geschätzt.
Konsum dient, wie oben ausgeführt, in der westlichen Gesellschaft unter anderem der Kompensation von fehlenden sozialen Beziehungen, fehlender Arbeitsfreude oder mangelnder Sinnerfüllung4. Daraus ergeben sich für die "Vermarktung" von Gesundheit weit reichende Konsequenzen. Die Darbietung und Werbung verspricht den Adressaten, genau wie bei anderen Konsumgütern, neben dem Hauptnutzen der Gesunderhaltung auch emotionalen oder sozialen Nutzen (101) und will damit "Kaufentscheidungen“ beeinflussen. Auf diese Weise schafft der Konsum von Gesundheitsgütern Identität und ein Zugehörigkeitsgefühl zu sozialen Subgruppen. Man gehört dazu, wenn man sich die gesundheitsspezifischen Produkte und Aktivitäten leistet bzw. leisten kann. Die Strategien der Bedürfnisweckung auch im Bereich der Gesundheitsgüter werden immer ausgefeilter und der Konsum dient mehr denn je der gesellschaftlichen Selbstdefinition.
Letztlich müssen Menschen auch nicht zwingend krank sein, um Gesundheitsgüter zu konsumieren. Die Beschäftigung mit Gesundheit verspricht, so die Zuschreibung, Wohlbefinden, Zufriedenheit, Erfolg und soziale Kontakte und zahlt sich langfristig im wahrsten Sinne des Wortes aus.
Somit ist Gesundheit in den letzten 30 Jahren zu einem Konsumgut geworden und ein zweiter Gesundheitsmarkt hat sich neben dem traditionellen Krankheitswesen etabliert (Studie der Bosten Consulting Group 2006). Im Jahr 2005 wurden in Deutschland 240 Milliarden Euro für die Gesundheit ausgegeben, das entspricht einem Anteil von 11% des Bruttoinlandsproduktes. Über die Hälfte wurde von den Krankenkassen bezahlt und der Rest von den Privathaushalten. Der Trendforscher Matthias Horx bezifferte die aktuellen Pro-Kopf-Ausgaben der Deutschen für Gesundheit auf jährlich ca. 3000 Euro. So betrug die Gesamtsumme selbstfinanzierter Gesundheitsausgaben im Jahr 2007 schätzungsweise 60 Mrd. Euro mit der Tendenz - weiter ansteigend. (Quelle: Roland Berger Studie, „Der Zweite Gesundheitsmarkt“) (136). Und genau dieser neue Gesundheitsmarkt unterliegt nicht allein den traditionellen, impliziten altruistischen Regeln der Medizin, sondern orientiert sich nicht unerheblich an ökonomisch orientierten Regeln und Verhaltensweisen.
3.1.1 Konsequenzen des Gesundheitskonsums
Eine der wesentlichen Konsequenz des Gesundheitskonsums ist, dass nicht die Gesundheit des Einzelnen im Vordergrund steht, sondern die Vermarktung von Produkten rund um die Gesundheit. Es geht um Umsätze, um Marktführerschaften, um Arbeitsplätze und um Geld, welches mit einem Produkt auf einem definierten Markt verdient werden kann. Und das ist nicht wenig. Viele Anbieter nutzen dementsprechend den Gesundheitsboom. Fitnessstudios und Wellnessfarmen verbuchen hohe Nutzerzahlen und auch die Tourismusbranche bietet mit großem Erfolg Präventionsreisen an, selbst ein Lebensmitteldiscounter wie Aldi hat in sein Repertoire „Gesundheitsreisen“ aufgenommen (77). Marketing-Fachleute sprechen von einem Nachfragemarkt, der vor Supermärkten und Online-Shops (Internetapotheke) nicht Halt gemacht hat. Schon heute gibt es „Praxen“ in Einkaufszentren, Tür an Tür mit der Ladenfläche, oder wie bei einer amerikanischen Supermarktkette bereits in diese integriert (101), die Werbung für Gesundheitsprodukte und frei verkäufliche Dienstleistungen boomt.
Produzenten von Gesundheitsgütern haben aus ökonomischer Sicht ein Interesse an der Vermarktung ihrer Produkte und betreiben deshalb umfangreiche Werbung, beispielsweise für nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Problematisch wird diese Werbung dann, wenn sie suggeriert, dass jede Befindlichkeitsstörung ein Medikament erfordert, und umgekehrt nur Arzneimittel imstande sind, den reibungslosen Fortgang des Alltags zu gewährleisten. Das Motto „Nur durch Pillen, Tropfen oder Tabletten kann man jung schön, schlank und dynamisch bleiben oder werden“ trägt gewiss nicht zu einem verantwortungsbewussten und sinnvollen Umgang mit Arzneimitteln bei (33).
Betrachtet man den Bereich der Pharmawerbung und der daraus resultierenden Selbstmedikation genauer, zeigt sich die ökonomische Dimension dieses Marktsegmentes. Im Jahr 1997 entfielen über 680 Millionen Packungseinheiten im Wert von 9 Milliarden Mark auf Medikamente, die von Patienten in Apotheken und Drogerien gekauft wurden (2). Diese Selbstmedikation hat unterschiedliche Hintergründe: Den Wegfall der Kostenübernahme von Medikamenten bei so genannten Bagatellerkrankungen, aber auch der Versuch der Patienten, Beschwerden ohne ärztliche Hilfe zu lindern. Dies birgt allerdings die Gefahr, dass Selbstmedikation Folgeerkrankungen mit verursacht (Nierenfunktionsstörung durch hohen Schmerzmittelgebrauch) oder Symptome bei Überdosierung falsch interpretiert werden (z.B. Hypervitaminosen, deren Symptome einem akuten Abdo- men ähneln).
Bei weitem nicht jeder medikamentösen Selbstbehandlung geht im Übrigen ein Besuch in der Apotheke voraus. Sehr häufig wird auf den Fundus in der Hausapotheke zurückgegriffen, in der sich Reste von früher verschriebenen und gekauften Präparaten befinden. Verfallsdaten, Wechselwirkungen oder Wirkungsverlust bei unsachgemäßer Lagerung sind vom Laien kaum einschätzbar oder überprüfbar (25) und können gesundheitliche Schäden nach sich ziehen.
Durch das Internet hat sich dieses Konsumverhalten nochmals verändert.
Dienstleistungen und Waren aus aller Welt sind schneller und leichter verfügbar als noch vor wenigen Jahren. Auch Arzneimittel werden über das Internet angeboten, dieser Beschaffungsweg wird zunehmend mehr genutzt. Beratung und Information spielen bei diesem Bezugsweg kaum eine Rolle, was besonders bei verschreibungspflichtigen Medikamenten Gefahren birgt.
Was das Thema "Gesundheitskonsum" für die Menschen selbst bedeutet, wie sie die Vielfalt der unterschiedlichen Produkte und deren Zugänglichkeit beurteilen und wie sie selbst mit den Gesundheitsprodukten umgehen, war Gegenstand einer von der Verfasserin konzipierten Onlinebefragung, die als Pretest für eine noch in Planung befindliche größere Studie angelegt war. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel dargestellt und diskutiert.
3.1.2 Gesundheitskonsum aus der Perspektive der Konsumenten - eine Onlinebefragung
Die Onlinebefragung (Pretest für eine noch durchzuführende größere Untersuchung) wurde im Jahr 2009 durchgeführt. Dabei wurden folgende Bereiche erfragt:
1. Entwicklung des Warenangebotes von Gesundheitsprodukten aus Sicht der (potentiellen) Konsumenten (Produktvielfalt)
2. Ermittlung des persönlichen Stellenwertes einzelner Konsumgüter
3. Auswahlkriterien für Gesundheitsprodukte
4. Rolle von Online-Shopping bei Gesundheitsprodukten
5. Rolle von Internetinformationen bezüglich Gesundheit
6. Gründe für gesundheitsbewusstes Verhalten (Konsum von gesunden Nahrungsmittel, Nutzung von Fitnessangeboten, Verzicht auf Alkohol und Nikotin)
7. Wissen über Krankheitsentstehung und Beeinflussung
8. Soziodemographische Daten Angeschrieben (via Email) wurden 70 Personen aus dem beruflichen und privaten Umfeld der Verfasserin (35 weibliche und 35 männliche Patienten), der Rücklauf lag bei 61%; 16 Männer, 27 Frauen. Das Durchschnittsalter betrug 44 Jahre, der jüngste Responder war 19, der älteste 64 Jahre alt.
3.1.2.1 Ergebnisse der Befragung
Im Hinblick auf die Entwicklung des Warenangebotes von Gesundheitsprodukten (Produktvielfalt), womit alle Angebote im Gesundheitsmarkt, wie Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, med. Hilfsmittel gemeint waren, empfanden mehr als 50% der Befragten das Angebot als zu groß. Im Mittel standen die Befragten neuen Produkten skeptisch gegenüber, fühlten sich aber durch die Produktvielfalt nicht belastet. Eindeutig sprachen sie sich gegen eine noch größere Auswahl aus.
Gesundheitsprodukte werden nach Auskunft der Befragten gezielt eingekauft, wobei dieser gezielte Einkauf nicht unabdingbar an eine vorherige ausführliche Information gebunden sein muss. Die Meinung der sozialen Bezugsgruppe spielt bei der Entscheidung des Einkaufes von Gesundheitsprodukten keine große Rolle. Bezüglich des Stellenwertes, der bestimmten Konsumbereichen zugemessen wird, zeigten sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei den männlichen Patienten hatten Unterhaltungselektronik und Gesundheitsprodukte den gleichen Stellenwert, bei den weiblichen Patienten hatten Bekleidung und Gesundheitsprodukte den gleichen Stellenwert und wurden lediglich von Produkten zur Ernährung in der Präferenz übertroffen.
Bei der Frage, was sich für den Einzelnen hinter dem Begriff "Gesundheit" verbirgt wurden „großes Wohlbefinden zu haben“, „sich selber zu gefallen“, „Krankheiten vorzubeugen“ und „auf den Körper zu achten“ als die Hauptassoziationen mit dem Begriff Gesundheit genannt. Hier zeigten sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Die erwartete oder erfahrene Qualität (Wirkung / Nebenwirkung) beeinflusst maßgeblich den Einkauf von Gesundheitsprodukten. An zweiter Stelle wurde die Funktionsweise bzw. der Wirkmechanismus genannt. Dies spiegelt sich wieder in einer Präferenz für Marken und Produkte im Gesundheitsbereich, die für bestimmte Eigenschaften stehen (Verträglichkeit, geringe Nebenwirkungen). So ist verständlich, dass eher auf Produkte zurückgegriffen wird, die der Konsument lange aus eigenem Gebrauch oder der Werbung kennt (Aspirin, Ass-Ratiopharm, etc.).
Der Online-Kauf von Medikamenten ist bei 35% der weiblichen Patienten etabliert, während nur 12,5% der männlichen Befragten Medikamente im Internet kaufen. Besonders auffallend war der Unterschied bei Nahrungsergänzungsmitteln. Hier gaben immerhin 17,8 % der Frauen und nur 6,25% der Männer an, diese online zu beziehen. Es ist davon auszugehen, dass Männer generell weniger Nahrungsergänzungsmittel nehmen als Frauen. Dies wird häufig behauptet, konnte aber bis jetzt in keiner Studie belegt werden. Des Weiteren wird das Internet für Informationen umfangreich genutzt, Frauen nutzen diese Medium intensiver als Männer und fühlen sich von der Informationsflut nicht überfordert.
Gesundheitsbewusstes Verhalten ist für die Befragten im hohen Maß mit Ernähung, Fitness und Leistungsfähigkeit assoziiert. Ebenso wurde positiv bestätigt, dass Krankheit durch eine gesunde Lebensführung positiv beeinflusst wird. So erklären sich unter anderem auch die jährlichen Ausgaben für Gesundheitsprodukte. Bis 100€ geben 50% der männlichen Patienten und 57% der weiblichen Patienten für Gesundheitsartikel jeglicher Art monatlich aus. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die zentralen Ergebnisse der Befragung, dabei werden die Angaben von Männern und Frauen getrennt dargestellt.
Tab.3: Übersicht über die Ergebnisse der Onlinebefragung zum
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beeinflussbarkeit Frauen sind eher der Meinung, dass Krankheit durch gesunde von Krankheit Lebensführung beeinflusst werden kann. Männer und Frauen meinen beide, dass Krankheit nicht vom Einkommen abhängig ist.
Frauen verbinden mit Krankheit eher Angst als Männer.
Monatliche
Ausgaben für Zwischen 100€ und 150€
Gesundheit
Auch wenn diese Befragung aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und der nicht kontrollierbaren Selektionseffekte bei den Befragten nur ein Schlaglicht auf das Thema werfen kann, zeigen sich doch interessante Ergebnisse. Dazu zählt die Einschätzung, dass das Warenangebot im Gesundheitssektor als zu groß eingeschätzt wird und die Gesundheitsartikel nach wahrgenommener Wirkung und Qualität präferiert werden. Bevorzugt werden bekannte Produkte, wobei ja die Bekanntheit der Produkte neben eigener Erfahrung auch durch gezielte Werbung der Hersteller und Anbieter forciert wird.
Der kurze Abriss des Gesundheitskonsums und seiner Folgen für die Rolle der Bürger, aber vor allem der Patienten im Gesundheitswesen hat deutlich gemacht, dass Entscheidungen zur Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und - gütern von bewussten, aber auch unbewussten Aspekten abhängig sind und auch vor dem Hintergrund von Konsumtheorien aus anderen Markbereichen erklärt werden können. Deutlich wurde allerdings auch, dass gerade der Gesundheits- und Krankheitsbereich für die Menschen zu einem hoch geschätzten Bereich gehört, für den sie bereit sind, finanzielle Ressourcen in nicht unbeträchtlicher Höhe einzusetzen (vgl. S. 49).
Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Ökonomisierung der Gesundheit auch die Gefahr birgt, dass eine Abkoppelung von ethischen und sozialen Aspekten im Umgang mit Betroffenen erfolgt.
3.2 Gesundheitskompetenz als wichtige Ressource
Die bisherigen Ausführungen lassen auch erkennen, dass das Verhalten der Betroffenen in einem „Markt Gesundheitswesen“ bestimmte Kompetenzen erfordert, u. a. die Fähigkeit, sich in dem Markt souverän zu bewegen, eigene Rechte zu kennen, Angebote kritisch zu überprüfen und den Nutzen zu erfassen, mit Anbietern zu kommunizieren und sich nach Maßgabe der eigenen Bedürfnisse für ein bestimmtes Angebot zu entscheiden. Diese Kompetenzen sind bekanntermaßen abhängig von Selbstkonzepten, Erfahrungen, Bildung, Einkommen und gesellschaftlicher Stellung. Sie sind aber auch abhängig von der gesundheitlichen Lage und der situativen Möglichkeit von Patienten, diese Kompetenzen einzubringen (111).
Kompetenzen sind „ die bei Individuen verf ü gbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven F ä higkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu l ö sen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen [Anm.: gewollten] und sozialen Bereitschaften und F ä higkeiten, um die Probleml ö sungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu k ö nnen “ (135). Neben rein kognitiven Fähigkeiten werden in dieser Definition auch die affektiven Bereitschaften einbezogen. Kennzeichnend für individuelle Kompetenz ist somit a) das netzartige Zusammenwirken von „ Wissen, F ä higkeit, Verstehen, K ö nnen, Handeln, Erfahrung und Motivation “ sowie b) die Ergebnisbezogenheit, d.h. die Bewältigung von konkreten Anforderungssituationen bzw. die tatsächliche erbrachte Leistung (s. auch Kap.3.3). Auch Hutter betont die Ergebnisbezogenheit von Kompetenzen
(72). So definiert er Kompetenz als „ Eigenschaft eines Menschen, die ihn in die Lage versetzt, in gegebenen Situationen ein Handlungsziel aufgrund von Erfahrung, K ö nnen und Wissen zu erreichen. Kompetent sein hei ß t, Situationen angemessen zu meistern. “ Diese Definition verweist darüber hinaus auf die Wertgebundenheit von Kompetenzen bzw. bezieht diese bewusst mit ein. Kompetenz kann keinen objektiven Sachverhalt darstellen, sondern bleibt immer abhängig von der Zuschreibung der Handelnden. Was in einer Situation als kompetentes Verhalten verstanden wird, ist abhängig von gesellschaftlichen Zuschreibungen und muss somit auch situationsspezifisch operationalisiert werden. Was das für das Gesundheitswesen und gesundheitsbezogenen Entscheidungen bedeutet, verbirgt sich hinter dem Begriff „Health Literacy“.
Das Konzept der Gesundheitskompetenz (health literacy) als besondere Kompetenz, gewinnt seit einigen Jahren zunehmend an Bedeutung. Thematisiert wird diese Form der individuellen Kompetenz im Zusammenhang mit Verantwortungsübernahme für Gesundheitsentscheidungen bzw. gesundheits- förderlichem Verhalten. Nachdem der Begriff über lange Zeit fast ausschließlich im engen Rahmen von Grundfertigkeiten wie Lesen, Verarbeiten und Verstehen von gesundheitlichen Informationen (z.B. Beipackzettel, Ernährungstabellen, etc.) betrachtet wurde, ist spätestens seit der Definition des Begriffs durch die WHO eine Erweiterung für die Betrachtung des Begriffs gegeben worden. Der dadurch eröffnete Raum ermöglicht eine umfassendere Betrachtung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jeder Einzelne braucht, um Entscheidungen für sich und seine Umwelt treffen zu können, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. "Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health" (WHO 1998).
Nach Kickbusch besteht Gesundheitskompetenz aus mehren Teilkompetenzen: einer persönlichen Komponente, einer systembedingten Komponente, einer Konsumkomponente, einer berufsbedingten Komponente und einer gesellschaftlichen Komponente (78). Diese Komponenten können durch eine psychologische Komponente zusätzlich erweitert werden. Kompetenzentwicklung im Gesundheitsbereich bedeutet, die über die Wissensvermittlung hinausgehende, bewusste Ausprägung von Handlungskompetenz. Der Begriff
Gesundheitskompetenz ist stets subjektbezogen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die Selbstorganisationsfähigkeit des Einzelnen beinhaltet bzw. einbezieht.
Gesundheitskompetenz kann als eine Form von Handlungskompetenzen gesehen werden, welche den Einzelnen befähigt, unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen (Normen und Werten), Wissen einzusetzen, Können und Verhalten anzuwenden und umzusetzen5.
Bisher gibt es wenige Studien zu der Frage, welche Kompetenzen vorrangig oder nachgeordnet erscheinen bzw. welche sich untereinander beeinflussen. Es existieren Aussagen über das Leseverständnis von medizinischen Texten wie z.B.
Tabellen, Formularen oder Beipackzetteln. Bekannt ist, dass Gesundheitskompetenz oder Health Literacy vom Bildungsniveau abhängig ist. Dieses Problem wird immer wieder dann bewusst, wenn Patienten mit einem niedrigen Bildungsniveau dem Arzt-Patienten-Gespräch nicht folgen können oder schriftliche Informationen nicht verstehen können. Erschwerend wird es, wenn niedrige Gesundheitskompetenz mit schlechtem Gesundheitszustand korreliert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kompetenzentwicklung im Gesundheitsbereich eine über die Wissensvermittlung hinausgehende, bewusste Ausprägung von Handlungskompetenz und nicht lediglich die Reduktion des Wissens über Krankheitsrisiken bedeutet. Menschen brauchen heute Wissen, Handlungskompetenzen und die Überzeugung, dass sie in der Lage sind, gesundheitliche Themen allein oder zusammen mit anderen zu bewältigen (Selbstwirksamkeitserwartungen), woraus sich wiederum Forderungen an professionelles Handeln im Gesundheitswesen ableiten lassen.
Wie die Professionellen in diesem Zusammenhang ihre Rolle definieren und wie sie die Interaktion mit Patienten und Angehörigen gestalten, ist Gegenstand des folgenden Kapitels. Hier spielen das Expertentum der Professionellen und die unterschiedlichen Modelle zur Arzt-Patienten-Kommunikation eine wichtige Rolle.
4 Perspektive der Professionellen
Als Professionelle werden alle Angehörigen der medizinischen Berufe definiert, die Einfluss auf Patientenverhalten und Patientenentscheidungen nehmen, wobei der Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen auf den Ärztinnen und Ärzten liegt. Sie tragen, neben Pflegekräften, Psychologen und Angehörigen anderer Heil- und Hilfsberufe, durch ihre Kommunikation und durch ihr Verhalten dazu bei, dass Patienten sich mehr oder weniger unterstützt, verstanden und wertgeschätzt fühlen. Als Experten nehmen gerade Mediziner eine besondere Position ein, da sie nicht nur beraten, sondern vor allem auch behandeln und verordnen und somit eine Form der Abhängigkeit zwischen Professionellen und Patienten besteht, die den Entscheidungsprozess beider Seiten beeinflusst.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Entscheidungsfindung bei Erkrankungen aus der Sicht der Professionelle
4.1 Professionelle als Experten
Experten zeichnen sich durch ein hohes Spezialwissen in einem Fachbereich aus. In diesem Sinne ist ein Experte, wer einen Gegenstand im Vergleich mit anderen Personen überdurchschnittlich gut beherrscht, und wer über sein Fachgebiet außerordentlich viel weiß. Die Expertise desjenigen bezeichnet die bereichs- und aufgabenspezifische Problemlösefähigkeit einer Person. Expertenwissen stellt letztendlich etwas Positives und Nutzbringendes da - und trotzdem ist die Glaubwürdigkeit von Experten in eine Krise geraten6. Mediziner als besondere Experten bilden hier bedingt eine Ausnahme. Die wachsende Skepsis der Laien gegenüber den Experten ist zum Teil auch das Resultat der Enttäuschung der Gesellschaft über eine ausbleibende Einlösung aller Heilversprechen nicht nur im Gesundheitswesen (107).
Bezüglich der Sozialisation der einzelnen Berufsgruppen gab es im Laufe der letzten vierzig Jahre, bedingt durch die Veränderungen im Bildungswesen (Bildungsreform), Zugangsveränderungen für Spezialisten. Wurden vor 100 Jahren Mediziner noch in Medizinerhaushalten sozialisiert, so spielt dieses heute nur noch eine nachgeordnete Rolle. Das bezieht die geschlechtsspezifische Berufswahl mit ein, denn Medizinerinnen waren früher - im Gegensatz zu heute - eher eine Seltenheit. Zum Mediziner wird heute auch derjenige bzw. diejenige, der/die nach dem Leistungsprinzip der Besten den Numerus Clausus erreicht hat, manchmal unabhängig von Eignung und Neigung zu diesem Beruf. Medizin wird manchmal auch studiert aus der Verlegenheit durch die gute Abitursnote und Bestenregelung (mehr Frauen als Männer), aus dem klaren Bedürfnis vom, nach wie vor, hohen Sozialprestige des Arztes (bei Männern höher als bei Frauen) und der Vorstellung, von dem vermeintlich erhofftem hohen Einkommen zu profitieren. So hat auch heute wahrscheinlich noch die Aussage von Frau Noelle - Neumann aus dem Allensbacher Institut für Umfragen anlässlich des Internisten - Kongress 1999
Gültigkeit: "Trotz eines dramatischen Normenwandels in allen gesellschaftlichen
Bereichen, ist das Ansehen des Arztes unbeirrt wie eine Insel in den St ü rmen des Ozeans ü ber die Jahre unver ä ndert geblieben, er genie ß t immer noch das h ö chste Sozialprestige aller Berufe. Leider f ü hrt das konstante Vertrauen in die Ä rzteschaft auch dazu, dass die Mediziner immun gegen massive Kritik und unflexibel f ü r Ver ä nderungen sind" (107).
Ein weiteres wesentliches Merkmal ist die Abgrenzung der Expertenwelt gegenüber anderen Gruppen. Diese Abgrenzung erfolgt in der Regel durch eine eigene Sprache und dadurch entstehende Sprachhindernisse. Zusätzlich sind Autonomiestreben und Eliteempfindung auch heute noch bei Medizinern weit verbreitet. Die berufliche Sozialisation von Medizinern/In als Experten/In ist geprägt durch ein individuelles Entwickeln und Bearbeiten von Theorien, Hypothese und Forschungsergebnissen. Der Austausch erfolgt im Kreise Gleicher und lässt generalistische Ansätze eher nicht zu. Genauso wie in anderen Disziplinen ist die wissenschaftliche Arbeit von der Interaktion mit Fachkollegen/In geprägt und abhängig von guter fachlicher Kommunikation, etwa im Zuge von Diskussionen auf Kongressen und Expertengremien. Ein weiteres tragendes Element der modernen Wissenschaft und der Medizin ist das Peer-Review-System, welches bedeutet, dass Kollegen/In (peers) anonym Projektanträge und Publikationsentwürfe begutachten und mit ihrem Urteil entscheidend mitbestimmen, ob ein Projekt finanziert oder ein Manuskript angenommen wird oder nicht. So soll ein hohes Niveau internationaler Forschung aufrechterhalten werden. Gute Journale lehnen 50-90% der eingereichten Manuskripte ab und versuchen, auf diese Weise Qualitätsstandards zu setzen. Auch hier wird über Knappheit motiviert, was den Einzelnen in seinem individuellen Elitestreben unterstützt. So ist gut nachvollziehbar, wenn Steffani Engler in ihrer Habilitationsschrift untermauert, dass wissenschaftliche Persönlichkeiten durch Zuschreibung und Anerkennung im sozialen Umfeld entstehen und nicht von Anfang an mit besonderen Gaben ausgestattet sind, die sie nur zur Wissenschaft prädestinieren. Aus ihrer Sicht ist die Persönlichkeit keine psychologische Größe, sondern eine soziale, die geprägt ist durch die Rollenzuschreibung und Lösung von Rollenkonflikten (107).
4.2 Gesundheit und Krankheit aus der Sicht der Professionellen
Neben den eingangs zitierten Definitionen von Gesundheit (s. Kap. 3) gibt es aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen weitere Festschreibungen, u.a. biomedizinische, systemische, handlungsorientierte, soziologische, psychosoziale, psychologische oder sozioökonomische. Nach wie vor spielt das naturwissenschaftlich orientierte, biomedizinische Modell der Experten in westlichen Gesundheitswesen eine wichtige Rolle (44). Dieses ist geprägt von der Vorstellung, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit sei, und dass jeder Krankheit eine pathologische Veränderung des Organismus zugrunde liegt. In der Regel wird Krankheit dementsprechend organbezogen gesehen, eine Sichtweise, die sich in der zunehmenden Spezialisierung und Separierung der Medizin niederschlägt. Engel initiierte schon frühzeitig die Erweiterung dieser Denkrichtung durch Einführung des biopsychosozialen Modells (44). Danach werden Krankheiten durch Wechselwirkung zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren verursacht. Besonders bei chronischen Erkrankungen hat die sozial- wissenschaftliche Forschung den großen Einfluss von Lebensstil, Risikoverhalten und Umweltbedingungen nachgewiesen. Mittlerweile herrscht Einigkeit darüber, dass Gesundheit einen Prozesscharakter besitzt. Dieser spiegelt sich auch in der immer wieder aktualisierten Gesundheitsdefinitionen der WHO wieder:
„ Gesundheit ist ein positiver funktionaler Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen biopsychologischen Gleichgewichtszustandes, der erhalten bzw. immer wieder hergestellt werden muss “ (WHO 1986) (109).
Die Frage nach der Definition von Gesundheit und Krankheit ist nicht nur eine wissenschaftstheoretische, sondern eine ganz praktische. Je nachdem, welches Entstehungsmodell von Krankheit beispielsweise ein Professioneller hat, wird die Intervention anders aussehen, und die subjektive Theorie der Patienten selbst spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Häufig scheint eine nicht geglückte Kommunikation die Hauptursache für ein problematisches Miteinander zwischen Laie und Experte zu sein. „D ie mangelnde Wirksamkeit einer medizinischen Praxis und von Programmen der Gesundheitserziehung … d ü rfen sehr oft damit zusammenh ä ngen, dass die subjektiven Vorstellungen der Zielpersonen und - gruppen nicht ausreichend ber ü cksichtigt wurden (48) . Gerade die jeweils andere Vorstellung von der Entstehung und Behandlung einer Krankheit machen die Kommunikation zwischen Patient und Behandelnden häufig schwer und sind „ … f ü r die so genannte Non-Compliance... “ verantwortlich (13).
Des Weiteren muss in diese Überlegungen einbezogen werden, dass die Professionellen in diesem System nicht nur diejenigen sind, die die Diagnostik und Therapie durchführen. Sie haben gleichzeitig auch eine zentrale Kontroll- und Definitionshoheit. Der betroffene Patient hat sich den bestehenden Werten und Normen zu unterwerfen und Rechts- und Versorgungsstrukturen sind daran ausgerichtet. Diese wiederum sind politischen und wirtschaftlichen Interessen unterworfen. Ein Beispiel ist hier die Ausstellung der Arbeitsunfähigkeits- bescheinigung durch den Arzt.
Vor diesem Hintergrund verdient die Arzt-Patienten-Beziehung eine besondere Betrachtung, es geht nicht nur um Kommunikation, sondern auch um Verhaltensmuster, die die Interaktion zwischen Patienten und Professionellen beeinflussen und im Prozess der Entscheidungsfindung maßgeblich dazu beitragen, ob der Patient diese Entscheidung mehr oder weniger souverän treffen kann.
4.3 Die Arzt-Patienten-Beziehung
Bei der Analyse von unterschiedlichen Modellen der Arzt-Patienten-Beziehungen geht es nicht nur um unterschiedliche Kommunikationsstile, sondern auch um die damit einhergehenden, unterschiedlichen Interaktionsstile, die sich unter anderem in Kommunikationsstrukturen bemerkbar machen. Als unidirektional kann das paternalistische Beziehungsmodell beschrieben werden, bidirektional sind die Modelle, die die Verteilung der Kommunikation bilateral und partnerschaftlich verteilt sehen.
4.3.1 Paternalistisches Modell
Das traditionelle paternalistische Modell ist charakterisiert durch die Autorität und alleinige Entscheidungssouveränität des Arztes (31,44). Diesem Modell liegt die Annahme zugrunde, dass der Arzt aufgrund seines Expertentums medizinische Entscheidungen alleine treffen soll. Der Patient schildert dem Arzt seine Beschwerden, der Arzt interpretiert diese als Krankheitssymptome und legt das diagnostische und therapeutische Vorgehen fest. Damit entscheidet er über die für den Patienten aus seiner Sicht beste Therapie. Dabei enthält er dem Patienten nicht notwendig Informationen vor, sondern der Patient erhält die Informationen, die für seine Zustimmung erforderlich sind und erteilt sein Einverständnis. Ob alle Inhalte der Information wirklich verstanden und in ihrer Tragweite erfasst wurden, bleibt manch einem Behandelnden verborgen. Mit dem ausgesprochenen Einverständnis setzt der Arzt voraus, dass der Patient alles verstanden hat und seine Entscheidung darauf beruht. Da der Kommunikationsprozess unidirektional geprägt ist, bedeutet dieses Verhalten: der Arzt fragt und der Patienten antwortet. Häufig wird diese Kommunikationsform so vom Patienten im Rahmen der Visite empfunden, wenn Intimität und Vertrautheit im Mehrbettzimmer nicht hergestellt werden können.
Es kann durch aus möglich sein, dass den Patienten Informationen vorenthalten werden, vermeintlich zu ihrem Besten, um keine Skepsis oder Entscheidungskonflikte aufkommen zu lassen oder um nicht Bedürfnisse zu wecken, die der persönlichen Präferenz des Arztes entgegenlaufen.
Dies ist unter anderem bei der Aufklärung bezüglich der unterschiedlichen Formen der Nierenersatztherapie, insbesondere der Peritonealdialyse im Erwachsenen- alter, nicht selten der Fall. Es kann immer wieder beobachtet werden, dass im Rahmen der Aufklärung über unterschiedliche Nierenersatztherapieverfahren von den beteiligten Ärzten die Methoden vorrangig empfohlen werden, die den Patienten enger an ein Dialysezentrum binden, Heimverfahren werden dagegen eher skeptisch betrachtet. Diese Skepsis kann unbewusst, aber auch bewusst vorhanden sein und wirkt in jedem Fall entscheidungsbeeinflussend.
Bis in die 60er Jahre war die paternalistische Umgehensweise mit Patienten vorherrschend. Auch heute ist sie nach wie vor anzutreffen und wird von einem Teil der Patienten akzeptiert und präferiert. Besonders ältere Patienten, für die viele Informationsquellen nicht erschließbar sind und die auf Grund ihrer Sozialisationserfahrungen den Arzt als besondere Autorität akzeptieren, wird dieser Kommunikationsstil bevorzugt, viele Patienten erleben dadurch eine Entlastung und Sicherheit. Aus ihrer Sicht ist der Arzt der Experte und wird als solcher mit Vertrauen bedacht. Ein partizipatives Entscheidungsverhalten empfinden sie als unangemessen und überfordernd. Welche Charakteristika eine partizipative Beziehungsgestaltung zwischen Patienten und Arzt kennzeichnet, wird im folgenden Kapitel dargestellt.
4.3.2 Partizipative Beziehungsgestaltung
Patienten wollen als Menschen und als Gesprächspartner in Entscheidungsprozessen anerkannt werden, auch wenn nicht alle Betroffenen in allen Situationen dieses Bedürfnis äußern bzw. insistieren, wenn Professionelle diesem Bedürfnis nicht nachkommen.
Vielfältige Einflussfaktoren wirken auf die Interaktion zwischen Arzt und Patient ein, der Wunsch von Patienten, als gleichberechtigter Partner an Entscheidungen beteiligt zu sein, ist abhängig von einer Vielzahl von Aspekten, die sich zudem im Verlauf einer Erkrankung verändern können. So sollten sich Professionelle auf die Interaktion mit den Patienten in der Weise einlassen, dass sie aufmerksam für die offenen, aber auch die versteckten Aussagen der Patienten sind und auf die individuellen Bedürfnisse eingehen (36).
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Patienten eher an eine Therapie halten, wenn die Behandlung den Weg einer gemeinsamen Entscheidung von Arzt und Patient genommen hat (31, 32, 99). Diese Patienten zeigen eine bessere Akzeptanz gegenüber ihrer Erkrankung, leiden weniger unter den Symptomen ihrer Erkrankung und sind weniger depressiven Verstimmungen ausgesetzt.
Die damit verbundene Art der Kommunikation wird international unter dem Stichwort „Shared Decision-Making“ - den Entscheidungsprozess teilen -, diskutiert (9, 46, 130). Inzwischen handelt es sich um das am weitesten entwickelte und operationalisierte Konzepte der Patientenbeteiligung in der Arzt-Patient- Kommunikation (44). Auch in Deutschland etablierte sich dieses Konzept zunehmend. Seit 2001 wurden durch das Bundesministerium für Gesundheit mehrere Forschungs- und Praxisprojekte gefördert, die Ergebnisse sind ermutigend. Die Studien zeigen eine höhere Zufriedenheit der Patienten mit der Arzt-Patienten-Beziehung, eine höhere Sicherheit mit der getroffenen Entscheidung, aber auch positive Effekte auf den gesundheitlichen Outcome.
Entscheidend ist, dass es sich um ein Beteiligungskonzept handelt und nicht mit Verantwortungsübernahme gleichzusetzen ist. Insgesamt stößt das Konzept auf breite Zustimmung, dennoch gibt es Barrieren bei der flächendeckenden Etablierung. Auf der einen Seite sind es die zeitlichen Restriktionen des Gesundheitswesens, auf der anderen die fehlenden kommunikativen Fertigkeiten der Ärzte. Beachtet werden muss, dass ältere Patienten, wahrscheinlich aufgrund ihrer Biographie, den Paternalismus als die bessere Interaktionsform weiterhin bevorzugen, ebenso Patienten, die bedingt durch kognitive Einschränkungen den Erklärungen des Arztes nicht folgen können. Dies bestätigen auch die Daten des Gesundheitsmonitors (17) und die persönlichen Erfahrungen der Autorin aus der Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsen des Transferprogramms endlich erwachsen.
Im konkreten Behandlungsprozess sind nach Dierks (37) folgende Schritte zur Förderung der Autonomie und zur Durchführung einer partnerschaftlichen Entscheidungsfindung notwendig:
1. Ein Gesprächsrahmen, in dem die Sichtweise der Patienten als wichtig und relevant akzeptiert wird.
2. Förderliche Kommunikation drückt sich auch über nonverbale Signale aus (Augenkontakt, im Gespräch eine sitzende statt einer stehenden Position einnehmen).
3. Erschließen der Präferenzen der Patienten, so dass Behandlungsoptionen diskutiert werden können.
4. Dazu gehören Gesprächsführungstechniken wie offene Fragen, aktives Zuhören.
5. Weitergabe der technischen Informationen in einer klaren, verständlichen Sprache, so dass der Patient (so weit wie möglich) alle Optionen, Risiken und den möglichen Nutzen verstehen kann.
6. Hilfe bei der Abwägung zwischen Nutzen und Risiken
7. Sicherstellen, dass die Entscheidung der Patienten auf einem klaren Verständnis der Situation und nicht auf einer Fehlinterpretation der Informationen beruht.
Dazu müssen, so Dierks (37) weiter, die Professionellen im Gesundheitswesen die Patientensouveränität nicht nur theoretisch anerkennen, sondern sie auch praktisch forcieren und die legitimen Erwartungen der Patienten nicht als Störung der Routine begreifen. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen der Versorgung entsprechend zu gestalten. Neben einem breiten Zugang zu Informationen, der Nutzung neuer Medien, die wiederum personelle Ressourcen einsparen könnten, müssen bei der Organisation von Abläufen die Informationsweitergabe und die Kommunikationsstrukturen besonders berücksichtigt werden. Es ist wenig hilfreich, wenn die Abläufe derart organisiert sind, dass die notwendige Zeit für Gespräche und der dadurch entstehende Raumbedarf unbeachtet bleiben.
Hinzu kommt, dass Gesprächskompetenzen im Rahmen von Aus- Fort- und Weiterbildung konsequent einen breiten Raum einnehmen sollten. Kommunikation muss gelernt, geübt und reflektiert werden, denn nur so können alle, Betroffene (Patienten und Angehörige), Professionelle (Ärzte, Pflegekräfte, etc.) und das Gesundheitswesen, als System davon profitieren.
Schließlich wäre es hilfreich, eine "Typologie" des autonomen Nutzers des Gesundheitswesens zu generieren, die den Professionellen hilft, die Gratwanderung zwischen Über- und Unterforderung ihres Gegenüber besser zu gestalten (36). Damit ist nicht gemeint Menschen in „Schubladen“ zu stecken, sondern mit Hilfe dieser Typologien könnte versucht werden, Reaktionen und Verhaltensweisen von Betroffenen besser zu identifizieren und antizipieren, um so Behandlungsbeziehungen positiv zu begleiten.
5 Die Perspektive der Patienten
Nach der umfassenden Darstellung der gesellschaftlichen Perspektive als Handlungsrahmen und der Perspektive der Professionellen als Experten wird im folgenden Kapitel der Patient in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Seine Sichtweise, Einstellungen und Verhaltensweisen sind maßgeblich für die Phase der Entscheidungsfindung bei gesundheits- und krankheitsbezogen Fragen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Ressourcen zur Entscheidungsfindung des Patienten
Dabei müssen besonders die vorhandenen Ressourcen von Patienten zur Entscheidungsfindung berücksichtigt und in die Überlegungen zur Etablierung von unterstützenden Beratungsinstrumenten integriert werden.
5.1 Gesundheit und Krankheit aus der Sicht des Patienten
Gesundheit und Krankheit werden subjektiv erlebt, ihre Bedeutung und Ausprägung, ihre Definition und der Umgang sind geprägt durch Sozialisationserfahrungen. So muss Krankheit nicht als unabdingbar, als Destruktion und Niederlage empfunden werden, sie kann auch als Herausforderung, Aufgabe oder Entlastung erlebt werden. Demzufolge gibt es keine einheitliche Vorgehensweise, Gesundheits- bzw. Krankheitsbewusstsein zu schulen oder zu unterstützen. Notwendig ist eine Stärkung der Fähigkeit von Betroffenen, aus dem individuellen Wissen Handlungsoptionen entwickeln zu können, die zu einer inneren Überzeugung führen und langfristig Veränderungen und Therapietreue zulassen (49).
Verschiedene Studien über subjektive Gesundheitskonzepte dokumentieren, dass Laien ein ausgeprägtes Verständnis von Gesundheit und Krankheit haben (48). Sie beschreiben Gesundheit als einen überwiegend positiven Begriff mit körperlichen, psychischen und sozialen Merkmalen (49). Dass diese Beschreibung sowohl schicht-, geschlechts- und bildungsabhängig ist, ist unumstritten (66, 48, 14, 53). Frauen und Männer sind beispielsweise anders krank, handeln im Alltag unterschiedlich, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht, nehmen medizinische Versorgung anders in Anspruch, haben unterschiedliche Wahrnehmungs- und Deutungsmuster im Umgang mit Gesundheit und Krankheit entwickelt, unterscheiden sich im Wissen über Gesundheit und setzen jeweils andere Schwerpunkte im Umgang mit Gesunderhaltung und Krankheit. Auch lässt sich eine Altersabhängigkeit beobachten. Ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt des Umgangs mit Gesundheit und Krankheit ist das Ausmaß der empfundenen Souveränität des Individuums bezüglich dieses Themas (49).
5.2 Patientensouveränität
Souveränität wird als ein Zustand von Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit, im Gegensatz zur Fremdbestimmtheit, bezeichnet. Der souveräne Patient geht mit seiner Situation als Erkrankter eigenständig um, darunter kann verstanden werden, dass er ausreichend informiert ist und die relevanten Möglichkeiten zur Behandlung seines Leidens kennt und einschätzen kann. Er weiß, wem er sich anvertrauen kann und ist in der Lage, den Ratschlägen der medizinischen Experten Folge zu leisten bzw. gegebenenfalls weitere Meinungen einzuholen. Dabei empfindet er kein Gefühl der Fremdbestimmtheit und Ohnmacht. Partnerschaftlich werden Entscheidungen zur Gesunderhaltung und im Falle der Krankheit getroffen.
Nach dieser Umschreibung wird der kritische Leser sich unweigerlich fragen, ob es überhaupt „den souveränen Patienten“ gibt. Vermutlich sind es eher Situationen, in denen Patienten oder ihre Angehörigen mehr oder weniger souverän handeln können (77). Schließlich ist die skizzierte Souveränität von der Situation, der Bedrohlichkeit der Erkrankung und von zusätzlichen Determinanten wie z.B. Krankheitsbewältigung, Lebensqualität und Belastungserleben abhängig (7).
Wesentliche Voraussetzung für Souveränität ist die Selbstwirksamkeitserwartung, womit die Erwartung des Einzelnen bezüglich der Ergebnisse seines Denkens und Handelns gemeint ist (11).
5.3 Selbstwirksamkeitserwartungen
Selbstwirksamkeit ("self-efficacy") ist "die individuell unterschiedlich ausgeprägte Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation die angemessene Leistung erbringen kann. Dieses Gefühl einer Person bezüglich ihrer Fähigkeit beeinflusst ihre Wahrnehmung, ihre Motivation und ihre Leistung auf vielerlei Weise (149). Ausgehend von den Überlegungen Banduras, dass menschliches Verhalten nicht allein durch Reiz-Reaktions-Zusammenhänge zu erklären sei und dass zwischen Reiz und Reaktion höhere Prozesse ablaufen, hat sich das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung entwickelt. Das Entscheidende an Banduras Theorie ist, dass zwischen dem Reiz und der Reaktion eine Informationsverarbeitung erfolgt. Diesen Verarbeitungsprozess unterteilt er in zwei Phasen, denen je zwei Teilprozesse zugeordnet werden. Die erste, so genannte Aneignungsphase, besteht aus Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen. Die zweite Phase nennt Bandura Ausführungsphase und sie beinhaltet motorische Reproduktionsprozesse und Motivationsprozesse (11).
In der so genannten Aneignungsphase sind Aufmerksamkeitsprozesse relevant, die zur Entscheidungsfindung beitragen. Diese Aufmerksamkeitsprozesse spielen eine besondere Rolle z.B. bei Präventionsangeboten und Früherkennungskonzepten, die trotz positiver Darbietung nur von einem Teil der Bevölkerung „wahrgenommen“ und akzeptiert werden. Hintergrund ist, dass erst durch interne Normen und Standards Menschen Umweltereignisse und Hinweisreize selektieren und differenzieren, bevor sie sich ihnen intensiver zuwenden. Das Problem dabei ist, dass viele beobachtete Verhaltensformen nicht sofort, sondern zeitlich erst viel später reproduziert werden und sie so im Gedächtnis des Beobachters gespeichert werden müssen.
Die zweite von Bandura beschriebene Phase ist die Erwerbsphase, sie ist im Gegensatz zur Ausführungsphase von Verstärkungsbedingungen abhängig. Bandura differenziert hier drei Verstärkungsmechanismen. Aus seiner Sicht informieren Verstärkungen den Beobachter über den Wert oder die Angemessenheit bestimmter Verhaltensweisen. Die Verstärkung ist ein Mechanismus, der die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Verhaltensweise erhöhen kann. Er geht davon aus, dass bei externer Verstärkung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Verhaltens durch Konsequenzen von außen verändert wird. Bei stellvertretender Verstärkung nimmt der Beobachter wahr, dass eine Verhaltensweise verstärkt wird und diese daraufhin von ihm nachgeahmt wird. Verhalten, dass zu Anfang mit nur geringer Spontaneität auftritt, wird nun abhängig von den Folgen, die das Modell für dieses Verhalten erhält, häufiger oder seltener nachgeahmt. Die Folgen für die Verhaltensweisen, die beobachtet werden, wirken also so, als hätte sie der Beobachter selbst erfahren
(11). Verhalten und Übernahme von Verantwortung bezüglich dieses Verhaltens kann nicht zwingend vorausgesetzt werden. Eigenverantwortung bei gesundheitsbezogenen Fragestellungen ist ein weiterer Aspekt der im anschließenden Kapitel berücksichtigt werden soll.
5.4 Eigenverantwortung
Als Eigenverantwortung wird die Fähigkeit und die Bereitschaft, für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen, definiert. Das bedeutet, dass Menschen für ihr Tun einstehen und die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Entscheidend ist der antizipatorische Anteil dieser Fähigkeit, nämlich die Folgen des Handelns abschätzen zu können und daraus Konsequenzen im Entscheidungsprozess zu ziehen (44).
Umgangssprachlich und gesellschaftlich wird Eigenverantwortung mit ganz unterschiedlichen Aspekten assoziiert: u.a. mit
Eigenverantwortung - meint die Verwirklichung von Lebenschancen?
Eigenverantwortung - meint das Leben in die eigenen H ä nde nehmen?
Eigenverantwortung - meint unter vermeintlichen Perspektiven und Alternativen zu w ä hlen?
Eigenverantwortung - meint Freiheit, Selbstbestimmung, B ü rokratieabbau, Enthierarchisierung
Eigenverantwortung - meint Abschied vom Wohlfahrtsstaat?
Eigenverantwortung - meint Entlastung und Belastung zugleich?
Was bedeutet Verantwortung bzw. Verantwortungsbewusstsein? Verantwortungs- Bewusstsein ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich auf nichtintendierte Handlungsfolgen richtet, mögliche Risiken und Unsicherheiten in die Planungen einbezieht und antizipatorisch ausgerichtet ist. Dies würde bedeuten, dass vorausschauend gesundheitsbewusst gehandelt und rückblickend die Verantwortung für gesundheitsrelevantes Verhalten übernommen wird. Es beinhaltet sowohl Vermeidungsverhalten, als auch Suchtverhalten (Konsumverhalten bis Abusus). Wer Verantwortung übernimmt, handelt freiwillig, sorgfältig und umsichtig mit hoher Motivation. Es ist eine erweitere Form der Verpflichtung, die durch Moralität, Voraussicht und Urteilskompetenz gekennzeichnet ist. Verantwortung kann nie unabhängig gesehen werden, sondern steht im engen Zusammenhang zu gesellschaftlichen Systemen und Dynamiken.
Das Wort Eigenverantwortung könnte somit als eine personalisierte Form des Verantwortungsbegriffes gelten und muss dementsprechend im gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden. Für den Philosophen Kierkegaard beruhte Eigenverantwortung eines Individuums auf der Fähigkeit, die kontingenten und zufälligen Faktoren seines Handelns in das aktuelle Handeln zu integrieren. Der Mensch ist dann ein verantwortlicher Akteur seines Lebens, wenn er auch diejenigen Entscheidungsfolgen auf sich nimmt, die er im Moment der Wahl nicht absehen konnte, die aber zu den Umständen gehören, unter denen er seine Entscheidung trifft. Für ihn wird das eigenverantwortliche Handeln zu einer Qual, wenn diese nicht der persönlichen Überzeugung des Individuums entspringt, sondern aus allgemeinen Geboten hervorgeht, die mit der besonderen Lage und Einsicht des Handelnden nichts zu tun haben (65). In welchem Rahmen kann eine Übernahme von Eigenverantwortung denn dann erfolgen? Welche Möglichkeiten aber auch welche Grenzen müssen hier berücksichtigt werden?
5.4.1 Übernahme von Eigenverantwortung - Möglichkeiten und Grenzen
Inwieweit der einzelne Bürger Eigenverantwortung übernehmen kann, hängt nicht nur von seinen Informationen, seinem Wissen und seinen Fähigkeiten ab, sondern darüber hinaus bestimmen die vorhandenen Infrastrukturen und Ressourcen, sowie die herrschenden sozialen Werte und Normen maßgeblich, in welchem Ausmaß Eigenverantwortung überhaupt möglich ist (123).
Für gesundheitsbezogene Entscheidungen bedeutet eigenverantwortliches Handeln, dass das Individuum über ausreichende Informationen verfügt, diese auch versteht und Handlungsalternativen, Handlungskonsequenzen etc. einschätzen und bewerten, sowie beurteilen kann (48).
Nach Schmidt ist Eigenverantwortung begrifflich eng gekoppelt an Kunden- mündigkeit und Patientensouveränität, aber auch an Gesundheitsverhalten und Compliance / Adhärenz (120). Eigenverantwortung meint aus ihrer Sicht eine Verpflichtung des Einzelnen bezüglich erwünschter Handlungen, um das umgebende System aufrecht zu halten (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft). Konsequenterweise müsste jeder Patient über das gleiche Ausmaß an Informationen verfügen und diese in seinen Entscheidungsprozeß einfließen lassen können. Ärzte müssten Diagnose- und Behandlungskonzepte, unabhängig von monetären Folgen der Leistungserbringung verfolgen und individuellen Defiziten im Verständnis bei dem Patienten durch ein maximales Maß an Aufklärung und Begleitung entgegenwirken. Alle an der Behandlung Beteiligten müssten über geeignetes Kommunikationsverhalten verfügen, um Missverständnisse nicht aufkommen zu lassen oder aufzuklären. Dies beschreibt einen kaum erreichbarer idealisierten Zustand, zumal Verantwortung übernehmen wollen auch Verantwortung übernehmen können voraus setzt.
Besonders hervorzuheben ist der Prozess der Verantwortungsübernahme und Entscheidungsfähigkeit von Patienten während eines stationären Aufenthaltes. In dieser Zeit unterliegen Menschen häufig einer besonderen Form der Depersonalisierung, eine Entscheidungsfindung muss unter besonderen Bedingungen erfolgen, da mit dem Eintritt in die stationäre Einrichtung die Patienten
- aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld herausgelöst werden und im Krankenhaus eine sowohl physische als auch soziale Isolation erfahren;
- durch die Reduktion auf die Patientenrolle unweigerlich einen Rollen- und Statusverlust erleiden;
- durch die Unterwerfung unter personenfremde und die Autonomie verleugnende Regeln und Routinen symbolisch infantilisiert werden;
- in die Abhängigkeit von Handlungsbereitschaft anderer geraten;
- unter vollständiger Beobachtung ihres Verhaltens und damit vor einer Auflösung ihrer Privatheit stehen (Entkleidung, Zugänglichkeit des Zimmers, Fragen nach Stuhlgang etc.)
- sich teilweise unverstandenen bzw. undurchsichtigen Prozeduren und Kontrollen ausgeliefert sehen, die sie selber kaum beeinflussen können, bei denen jedoch ihre Kooperativität erwartet und vorausgesetzt wird.
Dass Entscheidungsverhalten von diesen und weiteren Faktoren beeinflusst wird, wird keiner bezweifeln. Interessant ist, welche zusätzlichen Faktoren eine Rolle spielen. Die Psychologie hat diesbezüglich interessante Erkenntnisse, die zur Klärung beitragen können.
5.5 Entscheidungsverhalten und beeinflussende Faktoren
Bei der Frage, wie Entscheidungen getroffen werden und welche innerpsychischen Vorgänge dabei relevant sind, haben die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (50), die Kontrasttheorie, die Assimilations-Kontrast-Theorie und die Risikotheorie besondere Verbreitung gefunden. Basis dieser Theorien sind folgende Grundannahmen:
Der Mensch sucht in vielfältiger Form nach Gleichgewicht, nach Harmonie zwischen: früher und heute, sich und anderen, Wünschen und Wirklichkeit, Verstand und Gefühl, Wollen und Können und vielem anderen mehr. Dieses Gleichgewicht ist jedoch ein schwer greifbarer und definierbarer Zustand. Er wird potentiell immer bedroht, aus den Widersprüchen in der Person selbst und aus der Umwelt. Auf derartige Bedrohungen reagiert das „Ich“ mit Stress oder Frustration. Beides sind psychische Reaktionsmuster. Sie entstehen also nicht aktiv aus dem Individuum heraus, sondern sind immer Reaktionen auf Bedingungen in der Person selbst oder in der Umwelt der Person. Solche Reaktionen sind individuell, in Art und in Intensität sehr unterschiedlich (50, 21).
Die Dissonanztheorie geht nun davon aus, dass, wenn ein Individuum eine Entscheidung getroffen und umgesetzt hat, es immer ein Unsicherheitsgefühlt empfindet, da nicht verhindert werden kann, dass weitere Informationen zur Entscheidungssituation hinzukommen, die zu der ursprünglich getroffenen Entscheidung im Widerspruch stehen können. Zum Ausdruck kommt dies bei der immer wieder aufkommenden Frage: … ob die Entscheidung richtig ist … oder was w ä re wenn … gewesen. Hieraus kann sich ein mehr oder weniger ausgeprägter Selbstzweifel entwickeln, eine Dissonanz, die als mehr oder weniger belastend empfunden wird, sodass der Mensch danach strebt, die Dissonanz zu verringern.
Zum Beispiel erfahren Patienten eine kognitive Dissonanz bei Bluthochdruckkrisen oder Blutdruckmessungen bei Kontrolluntersuchungen, wenn sie um die gesundheitlichen Gefahren durch die nicht regelmäßige Einnahme ihrer Hochdruckmedikamente wissen und sie trotzdem nicht immer befolgen. Für sie gibt es folgende Möglichkeiten, darauf zu reagieren, um eine Reduktion der Dissonanz herbeizuführen: Sie können ihr Verhalten ändern und eine kontinuierliche Einnahme des Medikamentes realisieren, sie können aber auch versuchen, Umfeldfaktoren zu ändern, z. B. durch die Suche nach alternativen Möglichkeiten der Bluthochdruckregulation. Des Weiteren bestünde die Möglichkeit, mit dem Behandelnden nach einem alternativen Medikament Ausschau zu halten, welches vielleicht eine höhere Verträglichkeit verspricht, wenn das ein Grund für die unregelmäßige Einnahme sein könnte.
Zu der gleichen Gruppe der Theorien gehört die Kontrasttheorie, diese besagt, dass der Mensch seine Wahrnehmung nachträglich korrigiert, sofern sie nicht mit seinen Erwartungen übereinstimmt. Abweichungen werden dabei emotional übertrieben, dies gilt für positive Abweichungen des Erlebnisses von der Erwartung ebenso wie für negative (50). Daraus folgt dann Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit. Insofern führen bereits kleine Diskrepanzen zu einer Gefährdung der Behandlungsbeziehung. Im Fall des Patienten mit Bluthochdruck könnte die Folge sein, dass ein häufiger, nicht thematisierter Behandlerwechsel und Medikamentenwechsel das Einstellen des Hochdruckes fast unmöglich macht und der Patient das Vertrauen vollständig verliert und zur Selbstmedikation greift. Aus der Sicht der Agierenden im Gesundheitswesen ist dieser Patient dann non- compliant oder nicht adhärent, womit gemeint ist, dass er sich nicht an ärztliche Ratschläge hält bzw. keine Therapietreue zeigt. Auf der anderen Seite fühlt sich der Patient unverstanden und nicht gut begleitet. Beide Seiten sind unzufrieden.
Erweitert wird die Kontrasttheorie durch die Assimilations-Kontrasttheorie, sie korrigiert die Annahme insofern, als sie behauptet, dass Menschen dazu tendieren, bei nur geringfügigen Abweichungen den Abstand subjektiv zu untertreiben und emotional eine Angleichung herbeizuführen (Assimilation). Bei Überschreiten eines Schwellenwerts werden die Abweichungen, wie bei der Kontrasttheorie, übertrieben. Kleine Diskrepanzen führen meist nicht zur Unzufriedenheit. Problematisch ist jedoch die Bestimmung, welcher Grad von Abweichung zu einem Umkippen von Assimilation zu Kontrast führt. Im Fall des Bluthochdruckpatienten wäre das zum Beispiel gegeben, wenn der Patient nach sporadischer Selbstkontrolle seiner Blutdruckwerte und aufgrund der eigenen Bewertung der
Ergebnisse die Medikamenteneinnahme selbst steuert oder Ernährungsempfehlungen und sportliche Aktivitäten zur Gewichtsreduktion anpasst. Auch das selbsttätige Anpassen der Insulinmenge bei Diabetikern z.B. bei nicht eingehaltenen Diätvorschriften würde hierunter fallen. Bei Unkenntnis der skizzierten Verarbeitungsmuster ist es schwer, Patientenverhalten realistisch einzuschätzen und Patienten adäquat zu begleiten.
Vor dem Hintergrund der kurz dargestellten Entscheidungsmodelle wird die Relevanz gerade weit reichender Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit deutlich. Unstrittig ist, dass Entscheidungen einen retrospektiven und einen prospektiven Anteil aufweisen. Im Gesundheitsbereich ist der retrospektive Anteil nicht selten mit „Schuld“ assoziiert, der prospektive Anteil häufig mit „Angst“. Beides, sowohl Schuld als auch Angst resultieren in der Regel aus Unwissenheit oder Nichtherleitbarkeit kausaler Zusammenhänge (115). Auch wenn Patienten kognitiv verstehen, dass sich individuelle Gesundheit nicht allein durch persönliche Anstrengung erzeugen lässt, weil Gesundheit und Krankheit von einem komplexen Gefüge aus Lebensbindungen, milieubedingter Lebensweise, individuellem Lebensstil und genetischen Bedingungen bestimmt werden, wird der Einzelne in schwierigen Entscheidungssituation nicht selten von Schuldgefühlen geplagt. In der konkreten Behandlungs- und Entscheidungssituation gilt es, hinreichend Zeit für die Reflektion zur Verfügung zu stellen, mögliche Konsequenzen zu berücksichtigen und auch auf die innerpsychische Verarbeitung des Entscheidungsgeschehens einzugehen.
Entscheidungen finden darüber hinaus immer in einem sozialen Kontext statt, häufig ja in der Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Hier hat die Sozialpsychologie interessante Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung beschrieben, deren Kenntnis für die Arzt-Patienten-Kommunikation relevant sein könnte und die auch praxisrelevante Hinweise für die Konzeption von unterstützenden Aktivitäten in einer Entscheidungssituation liefern können. Einige Phänomene scheinen besonders wichtig und werden aus diesem Grund genauer beleuchtet: Reziprozitätsverhalten, Commitment und Konsistenz, soziale Bewährtheit, Sympathiefaktor und Autorität (143).
Mit Reziprozitätsverhalten wird der Umstand beschrieben, dass Menschen versuchen, sich für das, was sie erhalten haben, zu revanchieren. Im Konsumbereich wird dieses Phänomen zum Beispiel genutzt, indem Proben / Werbegeschenke verteilt werden, die den Konsumenten bei zukünftigen Kaufentscheidungen daran erinnert, etwas erhalten zu haben, worauf er dann reziprok mit der Auswahl der Marke reagiert. Im Gesundheitswesen ist das „Erhaltene“ primär nicht im materiellen Bereich zu suchen. Menschen erhalten neben einer medizinischen Intervention Informationen, Zuwendung, Zeit, Empathie und positive Wertschätzung. Daraus resultiert, dass sie als Patienten einem Behandelnden treu bleiben und dann auch Entscheidungen präferieren, von denen sie glauben, dass der Beratende diese getroffen haben möchte. Wenn in einem partnerschaftlichen Behandlungsmodell das Reziprozitätsverhalten bedacht wird, sollten möglicherweise mehrere behandelnde Personen in die Informationsvermittlung und die Gespräche zur Entscheidungsfindung eingebunden sein.
Auch das Phänomen Commitment und Konsistenz beeinflusst das Entscheidungsverhalten des Patienten. Damit wird das Bedürfnis der Menschen umschrieben, bezüglich ihres Verhaltens konsistent zu sein, d. h. beispielsweise dass es ihnen schwer fällt, einmal getroffene und verbalisierte Entscheidungen zu revidieren. Konsistenz hat einen hohen gesellschaftlichen Wert der Verlässlichkeit, sie ist alltagstauglich und erleichtert die Entscheidungsfindung bei komplexen Entscheidungen (z.B. welche Nierenersatztherapie), daraus leitet sich auch das Commitment gegenüber dem Behandelnden ab. Für die Gespräche mit Betroffenen bedeutet dies, dass Patienten, die sich bereits für eine Behandlungsform entschieden haben, ihre Entscheidung vielleicht nicht revidieren werden, auch wenn sie noch so umfangreich medizinisch begründet sind.
Menschen tun das, was sie glauben, dass es andere Menschen in dieser Situation auch tun würden oder getan hätten. Dieses Verhalten wird umschrieben mit dem Prinzip der sozialen Bewährtheit. Besonders auffällig ist dieses Phänomen in Situationen mit großer Unsicherheit. Menschen wünschen sich dann Austausch, um ihre Entscheidung abzusichern, dies muss kein fachlicher Austausch sein, sondern auch ein Austausch im sozialen Umfeld, mit Familie, Freunden oder anderen Betroffenen. Diese Bedürfnisse müssen bei der Entwicklung von Behandlungs- und Informationskonzepten, durch z.B. die Organisation von Kontakten zu anderen Betroffenen berücksichtigt werden.
Der Sympathieeffekt spielt bei allen Formen der Beratung eine maßgebliche Rolle und sollte nicht unterschätzt werden. Menschen entscheiden sich durchaus irrational und nicht nachvollziehbar, weil ihnen der Beratende sympathisch oder unsympathisch ist. Hinzu kommt der bekannte Halo - Effekt (ist nett, wird es gut mit mir meinen, wird mich richtig beraten) und die Vertrautheit durch mehrfache wiederholte Kontakte (niedergelassener Arzt) sowie positive Bestätigung durch Lob und Anerkennung bezüglich der Einhaltung von Medikamenten- und Diätvorschriften. Um den Sympathieeffekt positiv zu nutzen ist es wichtig, dass den Beratenden ihr Tun Spaß macht und sie es schaffen, Vertrauen aufzubauen. Dies ist ein weiteres Hinweis darauf, dass es lohnend sein kann, in der Beratung von Patienten mit Nierenerkrankungen unterschiedliche Berater einzusetzen, um die Wahrscheinlichkeit einer hohen Übereinstimmung in Sachen Sympathie zu erreichen.
Auch der Autoritätseffekt hat besonders bei Entscheidungen im Gesundheitswesen einen hohen Einfluss. Autoritätshörigkeit ist gesellschaftlich geprägt (Titel, Kleidung, Status, Expertentum) und Entscheidungen erfolgen auf Grund des Vertrauens in das hohe Expertentum des Beratenden. Umso wichtiger ist, dass die medizinische Autorität die Entscheidungsfindung passagere begleitet und letztendlich positiv bestätigt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Betroffene in der Phase der gesundheitsbezogenen Entscheidungsfindung eine situative Souveränität, Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeitserwartungen sowie ein gewisses Ausmaß an Gesundheitskompetenz benötigen, um die für ihre Person und ihre Situation am besten geeignete Entscheidung zu treffen. Das Dilemma liegt darin, dass Patienten den Eindruck haben können, sie wären dieser Entscheidungsfindung gewachsen und den Professionellen die deutlichen Signale fehlen, ob dieses Gewachsensein ausreicht, um die Tragweite der Entscheidung zu antizipieren und eine wirklich durchdachte Entscheidung zu treffen. Zusätzlich beeinflusst eine große Zahl von psychologischen und sozialpsychologischen Phänomenen jegliches Entscheidungsverhalten des Einzelnen. Diese Phänomene bleiben häufig dem Behandelnden verborgen bzw. werden nicht erkannt. Diese unbewussten Motive werden im Folgenden kurz erläutert.
5.5.1 Handlungsleitende Motive des Menschen und ihr Einfluss auf Entscheidungen in der Arzt-Patienten-Beziehung
Aus motivationspsychologischer Perspektive lassen sich Motive in drei Grundkategorien differenzieren: Leistung, Bindung und Macht/Power (125). Schultheiss nennt diese drei Motive "basale" Motive, die bei jedem Menschen vorhanden sind, allerdings in ihrer Ausprägung individuell unterschiedlich sind. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, welche Auswirkungen die Ausprägung der primären Grundbedürfnisse auf das Verhalten von Menschen hat, wenn diese in die Rolle des Patienten wechseln.
Die Leistungsmotivation, das Bedürfnis, sich mit einem internen oder externen Gütemaßstab zu messen, findet ihren Ausdruck, so Schultheiss (ebd.) zum Beispiel in hohem Stolz auf das eigene Geleistete, Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg. Personen mit hoher Leistungsmotivation streben nach Perfektion. Sie setzen sich anspruchsvolle, aber dennoch erreichbare Leistungsziele und orientieren sich an Gütestandards. Sie haben Ehrgeiz und wollen vorwärts kommen. Nach Schultheiss zeigen Patienten mit hoher Leistungsmotivation eine eher niedrige Bereitschaft, sich gemäß Therapieempfehlungen zu verhalten, wenn sie nicht vollständig von der Behandlung und den Maßnahmen überzeugt und ausreichend informiert sind (125). Patienten mit hoher Leistungsmotivation möchten Klarheit und wollen mit entscheiden, sie sind ungeduldig und erkundigen sich umfassend. Die Wahrung ihres Autonomiebedürfnisses könnte der Umsetzung von ärztlichen Ratschlägen bei gesundheitlichen Problemen entgegenstehen.
Die Bindungstheorie beschreibt in der Psychologie das Bedürfnis des Menschen, eine enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehung zu Mitmenschen aufzubauen. Bindungsmotivierte streben nach Nähe und Zusammenhalt. Ein hohes Bindungsmotiv ist daher sehr wichtig für eine gute Serviceorientierung. Bindung führt oft zur Vermeidung von Konflikten und Wettbewerbssituationen. Daraus könnte bei einer Übertragung der Theorien von Schultheiss auf die Arzt- Patienten-Beziehung geschlossen werden, dass der Bindungstyp als Patient eher angepasst reagiert, wenn er dafür Anerkennung bekommt, er leidet bei Ablehnung. Er könnte sein, dass er deshalb seltener als andere seine eigene Meinung oder Standpunkt kundtun und eher verdeckt agiert. Patienten mit hoher Bindungsmotivation zeigen vermutlich eher ein gutes kooperatives Verhalten und Therapietreue, um eine gute Beziehung zu ihren Ärzten zu erhalten. Nach Schultheiss neigen Menschen mit hoher Bindungsmotivation auch dazu, Meinungen und Ziele von anderen zu übernehmen.
Das Motiv "Macht" bzw. "Power" weist auf den Wunsch nach Beeinflussung hin. Machtmotivierte Personen haben besonders viel „Power“. Sie wollen etwas bewirken, Umstände verändern, Menschen beeinflussen, entwickeln, begeistern. Dafür sind sie bereit, hart zu arbeiten und viel zu leisten. Die Leistung ist aber eher Mittel zum Zweck, Einfluss auszuüben. Machmotivierte wollen vorrangig unabhängig sein und über sich und andere bestimmen. Patienten mit einer hohen Machtmotivation wollen mitreden und mitentscheiden. Sie suchen das Gespräch mit den Therapeuten und nehmen jede Information dankbar an. Diese Patienten haben oft eine Abneigung gegen „machtorientierte“ Therapeuten. Patienten mit hoher Machtmotivation zeigen eine eher niedrige Therapietreue, weil sie auf die Wahrung ihrer Autonomie bedacht sind, in dieser Hinsicht unterscheiden sich Menschen mit einer starken Machtorientierung nicht von denen mit einer hohen Leistungsorientierung.
5.6 Zwischenfazit
Es konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche Aspekte die Entscheidungsfindung des Einzelnen maßgeblich beeinflusst. Es sind nicht nur kognitive Aspekte, die die Patientensouveränität und die Gesundheitskompetenz des Einzelnen unterstützen sondern hinzukommen Aspekte der Motivationslage, die Eigenverantwortung fördert und Selbstwirksamkeit unterstützt. Ebenso sozialpsychologische Phänomene wie sie in Kapitel 5.5 (s. S. 76. ff) beschrieben wurden, verdeutlichen, dass Entscheidungen nie in völliger gesellschaftlicher Unabhängigkeit erfolgen und Einflussfaktoren dort ebenso zu suchen und zu finden sind. Also ein Zusammenspiel aus Kognition, Bedürfnislage und gesellschaftlichen Phänomen machen die Entscheidungsfindung bei gesundheits- bezogenen Fragestellungen nicht einfach und erst recht nicht, wenn es Entscheidungen betrifft, die das Leben vollständig und nachhaltig ändern. In der folgenden Untersuchung wird versucht diesen Aspekten vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen, um im Anschluss ein Unterstützungstool „ Nephroguide “ zu entwickeln, der einem Teil der Bedürfnisse der Betroffen Rechnung trägt und Behandelnde sowie Betroffene begleitet und entlastet.
6 Die Untersuchung
Nach den Ausführungen über die wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Diskussion zur Situation von Patienten im deutschen Gesundheitswesen, die Perspektiven der Professionellen und die gesellschaftlich und individuell geprägten Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung von Patienten sollen im Folgenden Patienten in einer speziellen Entscheidungssituation genauer betrachtet werden. Bewusst wurden Patienten gewählt, deren Entscheidungssituation einen ultimativen Charakter besitzt.
6.1 Die Forschungsfragen
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Menschen mit einer Nierenerkrankung, die sich vor dem Hintergrund unterschiedlicher therapeutischer Optionen für eine Behandlung entscheiden müssen. Folgende Aspekte werden dabei untersucht:
Welche speziellen Bedürfnisse haben Patienten in der Situation der Entscheidungsfindung?
Was wollen die Betroffenen?
Was erwarten sie von den Professionellen?
Stimmt das, was sie verbal ä u ß ern, mit den basalen Motiven ü berein?
Wie erleben die Erkrankten die Entscheidungssituation?
Wie erleben sie die Entscheidungssituation im Zeitverlauf?
Aus den Ergebnissen soll entwickelt werden, wie eine Unterstützung für die Betroffenen aussehen könnte und welche erweiterten Möglichkeiten Professionelle haben, um Patienten bei Entscheidungen beratend zur Seite zu stehen.
6.2 Das Forschungsdesign und die Methoden
Um die Erfahrungen und Bedürfnisse der Patienten aus deren Perspektive detailliert zu erfassen, wurden Menschen in einer Entscheidungssituation vor einer Nierenersatztherapie in die Studie einbezogen, diese wurden im Rahmen eines stationären Aufenthaltes rekrutiert und hier erstmalig befragt, eine abschließende Befragung sechs Monate nach dem stationären Aufenthalt schloss sich an (s. Punkt 6.2.3).
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Im qualitativen Forschungszusammenhang geht es um einen vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugang, über den ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte ermöglicht wird.
Die in einem qualitativen Forschungsdesign eingesetzten Methoden unterscheiden sich vor allem durch die offene Vorgehensweise und die Prinzipien der Kommunikation und Interpretativität von quantitativen Verfahren (Lamnek 1989). Ziel der qualitativen Vorgehensweise ist es, die Wirklichkeit anhand der subjektiven Sicht der relevanten Gesprächspersonen abzubilden und so mögliche Ursachen für deren Verhalten nachzuvollziehen und zu verstehen.
Für die Erfassung der subjektiven Perspektive von Betroffenen sind unterschiedliche Verfahren geeignet. In der vorliegenden Untersuchung wurden zwei miteinander korrespondierende Zugänge gewählt: qualitative Interviews, die auch als "Königsweg" der qualitativen Forschung bezeichnet werden (Lamnek 1989) und das Verfahren des Picture Story Exercise, entwickelt von Schultheiss (124), als psychologisches Erhebungsinstrument, um eine zusätzliche Quelle des Informationsgewinns zu nutzen.
6.2.1 Qualitative Interviews (T1)
Im qualitativen Forschungszusammenhang sind diverse Interviewformen entstanden, die in den Dimensionen Offenheit und Strukturiertheit differieren. Der Bogen lässt sich hier von narrativen Interviews - durch eine Eingangsfrage angeregte Stegreiferzählung der Befragten (vgl. Schütze 1983, Hermanns 1991) ohne weitere thematische Strukturierung - über fokussierte Interviews bis hin zu teilstrukturierten Leitfadeninterviews spannen (vgl. Lamnek 1989).
In der vorliegenden Untersuchung kamen leitfadengestützte Interviews zum Einsatz. Auf der Basis der theoretischen Vorüberlegungen und der eigenen praktischen Erfahrungen im Umgang mit Patienten mit Nierenerkrankungen wurde ein Leitfaden entwickelt (s. 81). Dieser diente als Gliederungshilfe und Orientierungsrahmen während der Interviews. Reihenfolge und Gestaltung der Fragen waren dabei flexibel. Die Interviewpartner sollten mithilfe der offenen Leitfragen angeregt werden, ihre Bedürfnisse in unterschiedlichen Phasen der Erkrankung (zurückblickend, aktuell und vorausschauend, im Hinblick auf die folgende Therapie) zu verbalisieren. Die offenen Fragen dienten zur Stimulierung des Erzählflusses.
Interviewleitfaden
Fragen zum Gesundheitszustand und zum stationären Aufenthalt
Wegen welcher Beschwerden liegen Sie hier in der MHH? Wie fühlen Sie sich heute?
Können Sie mir etwas über Ihren Aufenthalt an der MHH im Allgemeinen erzählen? Waren Sie mit Ihrer Behandlung (in der MHH) bis jetzt zufrieden?
Fragen zur Entscheidungsfindung
Haben die Ärzte schon mit Ihnen darüber gesprochen, wie es weitergehen soll? Wissen Sie selbst schon, was gemacht wird?
Ist Ihnen Ihre Krankheit erklärt worden?
Wo haben Sie sich bisher über Ihre Krankheit informiert?
Wenn es um die weiteren Entscheidungen geht, wer sollte die Ihrer Meinung nach treffen?
Informationsstand und Gefühle beim Gedanken an die weiteren Schritte
Fühlen Sie sich zurzeit ausreichend über die nächsten Schritte informiert? Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die nächsten Schritte denken?
Wenn Sie noch einmal an die nächsten Schritte denken, was ist Ihnen besonders wichtig? Was wünschen Sie sich jetzt?
Wie können Sie selbst die Behandlung positiv unterstützen? Fühlen Sie sich in der Lage, die Behandlung zu unterstützen?
Der Blick in die Zukunft
Wenn Sie jetzt einmal an die Zeit nach dem Aufenthalt in der MHH denken, was glauben Sie:
Wie werden Sie mit Ihrer Situation zu Recht kommen? Welche Unterstützung brauchen Sie zuhause?
Was denken Sie, könnten Sie in gesundheitlicher Hinsicht für sich tun?
6.2.2 Picture Story Exercise
Bei der Picture Story Exercise handelt es sich um ein psychologisches Testverfahren, mit dem unbewusste Bedürfnisse unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.5.1 (S. 72 ff.) genannten Grundbedürfnisse Leistung, Bindung und Macht dargestellt werden können. Sie wurde von Schultheiss an der Universität of Michigan in Ann Arbot etabliert und getestet (124). Die Menschen werden gebeten, eine Kurzgeschichte zu den von Forschern ausgewählten Bildern zu schreiben, die Geschichten werden anschließend einer Itemanalyse unterzogen. Dabei stehen ausgewählte Items, sogenannte "Keywords" als Indikatoren für ein Grundbedürfnis, Häufigkeit und Kombination der jeweiligen Items werden bei der Analyse berücksichtigt.
Tab. 4: Keywords als Indikatoren für Grundbedürfnisse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Keywords
gut, besser, der Beste, schnell, effektiv, besonders, groß, größer, sowie alle Steigerungsformen und Superlativen
Keywords
Freund, Freundschaft, vertrauen, unzertrennlich, zusammenhalten, einsam, verlassen, Liebe, Sehnsucht, Trennung, Nähe
Keywords
etwas bewirken wollen, jemanden beeindrucken, Rat geben, helfen, berühmt, stark, überzeugend, sowie alle Steigerungsformen
Mit diesem Verfahren können Phantasien, Bedürfnisse, Gefühle etc. erkannt werden - vergleichbar mit einer Tagebucheintragung. Getestetes Bildmaterial als Grundlage für die Geschichten liegt aus verschiedenen Untersuchungen vor (124,125), z.B. Landschaftsbilder oder Alltagssituationen.
Für die eigene Untersuchung wurden zwei unterschiedliche Bilder eingesetzt - zum einen ein von Schultheiss getestetes Bild einer Gesprächssituation zwischen zwei Menschen in einem alltäglichen Zusammenhang (Bild 1)
Bild 1 (Quelle: Schultheiss 124,125)
Ergänzend dazu kam ein neues, speziell für die Forschungsfrage ausgewähltes Bild zur Arzt-Patienten-Kommunikation zum Einsatz mit dem Ziel, basale Motivstrukturen in dieser speziellen Situation zu erfassen. Dieses Bild wurde sowohl Frauen als auch Männern angeboten. Des Weiteren wurde keine Rücksicht darauf genommen, ob die Patienten aktuell von einer Ärztin oder einem Arzt hausärztlich oder fachärztlich betreut werden.
Bild 2 (Quelle: KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.)
Folgende schriftliche Instruktionen erhielten die Patienten, bevor sie mit der Bildgeschichte begannen:
Im Folgenden werden Sie an einer Bildgeschichten ü bung arbeiten. Dabei geht es im Wesentlichen einfach darum, eine vollst ä ndige Geschichte ü ber jedes Bild zu schreiben - eine fantasievolle Geschichte mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Bitte versuchen Sie zu beschreiben, wer die in jedem Bild dargestellten Personen sind, was sie f ü hlen, denken, und wollen. Bitte beschreiben
Sie auch, was zu der dargestellten Situation gef ü hrt hat und wie die Geschichte am
Ende ausgeht. Oben links auf der Seite finden Sie einige Leitfragen:
Was geschieht gerade? Wer sind die dargestellten Personen? Was geschah zuvor? Wie begann die Geschichte? Was denken, f ü hlen, oder wollen die dargestellten Personen? Was geschieht als n ä chstes? Wie geht die Geschichte zu Ende?
Diese sollten aber wirklich nur als Anhaltspunkte f ü r das Ausdenken einer vollst ä ndigen Geschichte verwendet werden. Sie brauchen sie nicht einzeln zu beantworten. Bitte sehen Sie sich jedes Bild erst f ü r einen Moment an. Bl ä ttern Sie dann das Bild um und schreiben Sie auf der nachfolgenden Seite einfach diejenige Geschichte auf, die Ihnen beim Ansehen des Bildes als erstes in den Kopf kommt. Wenn Sie mehr Platz zum Schreiben brauchen, setzen Sie die Geschichte bitte auf der R ü ckseite der Schreibseite fort. Auf korrekte Grammatik, Rechtschreibung oder Interpunktion kommt es hier ü brigens nicht an. F ü r jede Bildgeschichte haben Sie etwa 5 Minuten Zeit. Ich werde Ihnen sagen, wenn es Zeit ist, eine Geschichte abzuschlie ß en und mit der n ä chsten weiterzumachen.
6.2.3 Zweites Interviews (T2) sechs Monate nach Eintritt in die Studie
Das zweite Interview nach erfolgter Entscheidungsfindung diente dazu, die Entscheidungsfindung zu hinterfragen und zu ermitteln, was den Betroffen gefehlt hat bzw. wo sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätten. Es wurde ca. sechs Monate nach dem Erstkontakt in Form eines freien Interviews nach folgenden Leitfragen geführt.
1. Welche Unterstützung hätten Sie im Rahmen der Entscheidungsfindung und der Betreuung noch gewünscht bzw. was hat Ihnen gefehlt?
2. Was wünschen Sie sich für die Zukunft. Alle Patienten befanden sich zu dieser Zeit in einer Nierenersatztherapie. Die ersten Eindrücke von den Veränderungen bei Aufnahme der Nierenersatztherapie waren zwar noch präsent, aber nicht mehr so dominant.
6.3 Auswahl der Untersuchungsgruppe
Im qualitativen Forschungszusammenhang geht es nicht darum, für eine bestimmte Patientengruppe repräsentative Aussagen zu erarbeiten, sondern darum, die mögliche Bandbreite der bei Patienten vorherrschenden Bedürfnisse, Motive und Entscheidungspräferenzen zu erfassen und dabei Frauen und Männer sowie unterschiedliche Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der Erkrankungssituation der Betroffenen zu berücksichtigen. Die Auswahl der Studienteilnehmer orientierte sich deshalb an einem theoretical sampling, wobei zwei Patientengruppen einbezogen werden sollten - Patienten die sich schon langfristig mit dieser anstehenden Entscheidung auseinandergesetzt haben (Gruppe I) und Patienten, die sich in einer akuten Entscheidungssituation (Gruppe II) befanden.
In Gruppe I sollten 15 Patientinnen und Patienten, die sich ca. 4-6 Monate vor der Entscheidungsfindung bezüglich der folgenden Nierenersatztherapie befanden, interviewt werden. Berücksichtigt werden sollten Frauen und Männer aus unterschiedlichen Altersgruppen (35-45 Jahre, 46-55 Jahre, 56-65 Jahre).
In der Gruppe II sollten 15 Patientinnen und Patienten, die sich in der akuten Konfrontation mit einer Entscheidungsfindung bezüglich der folgenden Nierenersatztherapie befanden, angesprochen werden. Auch hier sollten Frauen und Männer aus den drei oben genannten Altersgruppen integriert werden.
Für beide Gruppen sollten zusätzlich, soweit möglich, zwei Patienten aus einem nichtdeutschen Kulturkreis befragt werden, um kulturspezifische Unterschiede bezüglich ihrer Bedürfnislagen und ihrer Bedürfnisartikulation zu erfassen.
6.4 Durchführung der Untersuchung
Die Rekrutierung der Patienten erfolgte in zwei unterschiedlichen Bereichen der gesundheitlichen Versorgung (stationär und ambulant). Stationäre Patienten konnten im Zentrum Innere Medizin der Medizinischen Hochschule Hannover gewonnen werden. Im Nierenzentrum des KfH Kuratorium für Dialyse und
Nierentransplantation e.V. und im kooperierenden Medizinischen Versorgungszentrum des KfH am Stadtfelddamm 65 konnten ambulant versorgte Patienten rekrutiert werden.
Patienten, die stationär oder wie im KfH, ambulant in der Urämikersprechstunde betreut und behandelt werden, wurden nach den oben genannten Kriterien von den Ärzten angesprochen, über die Studie umfassend informiert und um die Teilnahme gebeten. Eine Einverständniserklärung wurde eingeholt, Ansprech- partner war die Autorin der Dissertation (Projektleiterin). Die Ärzte wurden gebeten, die Anzahl der angesprochenen Patienten zu erfassen und so zu dokumentieren, dass darauf Rückschlüsse über das Ausmaß der Bereitschaft von Patienten zu ermitteln, die an einer derartigen Studie bereit sind teilzunehmen.
Die Patienten wurden persönlich in einem separatem Raum zu zwei unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten (Zeitpunkt T1 - akute Entscheidungs- situation in der Klinik, Zeitpunkt T2 - 6 Monate nach dem Klinikaufenthalt) befragt, ergänzend zu den Angaben in der persönlichen Befragung kam die Picture-Story - Exercise Methode zum Einsatz, um die verbalen geäußerten Bedürfnisse mit eventuell dahinter stehenden, nicht ausgesprochenen Motiven zu vergleichen. Die Befragung zum Zeitpunkt T2 diente dazu, Bedürfnisse retrospektiv zu erfassen und zu beurteilen.
Im Vorfeld wurde das Votum der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover (November 2008) eingeholt. Es bestanden keine Einwände gegen das geplante Vorgehen.
6.5 Auswertungsmethoden
Für die unterschiedlichen Studienteile kamen methodenspezifische Analyseverfahren zum Einsatz.
6.5.1 Auswertung der Leitfadeninterviews
Die Leitfadeninterviews wurden von der Autorin der Dissertation durchgeführt und selbst zeitnah nach dem Gespräch transkribiert. Damit sollte gewährleistet werden, dass durch die noch frische Erinnerung an das Interview alle kontextuellen, gestischen, teils auch inhaltlichen Informationen mit in den Datenbestand aufgenommen werden konnten.
Zuerst erfolgte eine quantitative Analyse der Transkripte. Hier wurde die Anzahl der Worte erfasst, um eine übergreifende Aussage bezüglich des Umfangs der Antworten, zunächst ganz ohne inhaltlichen Bezug, zu treffen.
Im nächsten Schritt wurde das Material mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring erschlossen (96b):
Erster Schritt der Analyse
Im ersten Schritt wurden alle Texte durchgelesen, um einen umfassenden Überblick über das gesamte Material zu erhalten. Im Anschluss wurden die für die Forschungsfragen relevanten Textpassagen ausgewählt und markiert. Bei diesem Analyseschritt erfolgte noch keine Verdichtung der Inhalte der Aussagen.
Zweiter Schritt der Analyse
Im Folgenden zweiten Schritt wurden die vor dem Hintergrund der Forschungsfragen relevanten Textpassagen mit einander verglichen und möglichst nah am Gesprochenen zusammengefasst, was zu einer ersten Verdichtung des Materials führte. Dieser Schritt ist notwendig, um zu einer Kategorienbildung zu gelangen. Es galt die Kategorienbildung zu folgenden drei Bereichen zu erarbeiten: Kategorien, die die Bedürfnisse der Betroffen widerspiegeln, Kategorien, die die Erwartungen an die Professionellen kennzeichnen und Kategorien, die die Situation bei der Entscheidungsfindung darstellen.
Dritter Schritt der Analyse
Das gesamte Textmaterial wurde nochmals gesichtet und zu einem Kategoriengerüst verdichtet. Im Folgenden werden die Schritte am Beispiel der Empfindungen bei der Entscheidungsfindung dargestellt, um das Vorgehen der Kategorienbildung zu verdeutlichen:
Tab. 5: Vorgehen der qualitativen Analyse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Entscheidung will und muss ich … Entscheidung Eigenständigkeit
alleine treffen, da kann mir keiner will und muss ich
helfen, nat ü rlich bespreche ich das alleine treffen Eigene
mit meiner Frau aber entscheiden Entscheidung
muss ich dass … wissen Sie ich bin … nat ü rlich Rolle des Partner
eher ein rationaler Mensch, aber bespreche ich
wenn es um Entscheidungen geht das mit meiner
ist mir wichtig, dass dann auch eine Frau, aber Eigenständigkeit
Entscheidung gef ä llt wird und entscheiden
manchmal sehe ich das ganz muss ich dass Übernahme von
anders, aber lebe dann mit der Verantwortung für
Entscheidung, auch wenn es nicht Aber lebe dann Entscheidungen
mein Wille ist (Hinweis Interview) mit der
Entscheidung
Das machen die hier schon … da … Das machen Abgabe der
brauche ich mir keine Gedanken zu die hier schon Entscheidung Entscheidung
machen … kann ich ja so wie so durch den Arzt
nicht ä ndern … ich hoffe nur, dass … kann ich ja so Hoffnungslosigkeit
es mal wieder besser geht, damit wie so nicht
ich in meinen Garten kann. ä ndern …
Verdrängung einer
Entscheidungen … jetzt muss ich ja … aber sonst Entscheidung
nichts entscheiden … au ß er so f ü r muss das mein Entscheidung
die Untersuchungen … das ich Arzt Abgabe der durch den Arzt
damit einverstanden bin … aber entscheiden und Entscheidung und die
sonst muss das mein Arzt Ehefrau
entscheiden und meine Frau … die meine Frau … Entscheidung mit
muss da auch mitentscheiden … die muss da der Ehefrau
sie muss ja wissen was sie kochen auch
muss und was ich jetzt nicht mehr mitentscheiden
darf (schunzelt) …
6.5.2 Auswertung des Materials der Picture Story Exercise
Bei der Analyse der Bildgeschichten orientierte sich die Verfasserin an den Vorgaben von O. Schultheiss (125). Die Bildgeschichten wurden in der Regel handschriftlich verfasst oder in Einzelfällen durch Mitschrift der Verfasserin festgehalten. Unabhängig von einander wählten alle Patienten eine eigene Reihenfolge bei der Bearbeitung. Sie schrieben ausnahmslos als erstes eine Geschichte zu Bild 2 (Ärztin/Patientin), dann zum Bild 1 (Spaziergänger auf der Bank). Alle Texte wurden aus der handschriftlichen Version in eine Word-Version im Textverarbeitungsprogramm übernommen und anonymisiert. In einem ersten Analysevorgang wurden die Worte gezählt, um einen Überblick über das quantitative Ausmaß der Geschichten zu erhalten. Der zweite Schritt der Analyse befasste sich mit der Identifizierung der Keywords, die sich an den von Schultheiss vorgegeben Keywords orientierte. Diese wurden dann hervorgehoben und über ihre Auftretenshäufigkeit bewertet. Im Folgenden wird dieses Vorgehen dargestellt, die fett gedruckten Wörter stellen Keywords dar.
Zeigt zwei Personen auf einer Bank. Sie wirken entspannt und genie ß en die Sonne. Es scheint sich um zwei junge Leute zu handeln, die mit Rucksack am Tage unterwegs waren. Vielleicht machen sie Urlaub, vielleicht entspannen sie sich von der Uni oder der Arbeit. Sie verstehen sich jedenfalls recht gut und sind sich nicht fremd . Das Bild strahlt etwas befriedigendes, vertrautes zwischen den beiden aus, ohne dass es den Anschein hat, als kennen sie sich schon l ä nger . Die Beiden werden sich wohl ü ber die Ereignisse des Tages unterhalten und dabei die Stille am Fluss genie ß en . Sie f ü hlen sich wohl und denken vielleicht ü ber ihr weiteres Leben nach. Ü ber ihre Ziele und W ü nsche (Karriere, Kinder etc.). Nachdem sie sich ausgeruht haben, werden sie nach Hause gehen oder anderen Besch ä ftigungen nachgehen. Wie die Geschichte zu Ende geht kann ich nicht sagen. Aber f ü r mich geht es so aus, dass sie einer guten Zukunft entgegen gehen.
Die hier beispielhaft dargestellten Keywords sprechen gemäß den Interpretationsvorgaben von Schultheiss für das Vorherrschen einer Harmoniemotivation bei der betreffenden Person.
6.5.3 Auswertung Zweites Interview (T 2)
Die Auswertung der zweiten Interviews diente dazu, Anhaltspunkte und/oder Parallelen für die unterschiedlichen Motivlagen zu identifiziert. Die Auswertung der kurzen Interviews erfolgte nach dem oben beschriebenen Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (s. 6.5.1). Die Interviews wurden aufgenommen, zeitnah transkribiert und in Anlehnung an Mayring analysiert. Ebenso erfolgte die abschließende Kategorienbildung.
7 Ergebnisse
Im Erhebungszeitraum zwischen Oktober 2008 bis März 2009 wurden über 80 Patienten, die die zuvor festgelegten Einschlusskriterien erfüllten, von den Ärzten in den einbezogenen Versorgungseinrichtungen angesprochen, 23 davon konnten für die Studie gewonnen werden.
7.1 Die Untersuchungsgruppen und die Erfahrungen mit der Rekrutierung
Da die Studie in den klinischen Alltag eingebettet war, ergaben sich bei der ursprünglich vorgesehenen Dokumentation aller angesprochenen potentiellen Studienteilnehmer organisatorische Hindernisse, z.B. durch die Fluktuation der betreuenden Ärzte auf den Stationen. Aussagen über die genaue Zahl der Angesprochenen und deren Merkmale sind deshalb nicht möglich.
Gründe für die Nicht-Teilnahme von Patienten sind dennoch identifizierbar und basieren auf Gesprächen mit den Ärzten und Pflegekräften, sowie auf eigenen Erfahrungen der Verfasserin der Doktorarbeit. Als hinderlich für die Rekrutierung erwiesen sich folgende Aspekte:
Organisatorische Gründe
1. Unvorhergesehene Entlassung oder Verlegung des Betroffenen, die eine zeitliche Koordinierung des Interviews unmöglich machten; Gründe auf Seiten der Betroffenen
2. Patienten waren in fester nephrologischer Betreuung außerhalb der Einrichtung und hatten klare Vorstellungen bezüglich der Therapie, dadurch hatten sie kein weiteres Interesse an einem ausführlichen Interview und langfristiger Begleitung;
3. Patienten artikulierten Abneigung gegen Befragungen per se;
4. Patienten verbalisierten nach der Vorinformation eine Abneigung gegenüber der Picture Story Exercise;
5. Es lag keine Bereitschaft zu einer längerfristigen Begleitung, mit Verpflichtung eines zweiten Interviews, auf Seiten des Patienten vor, da daraus kein vermeintlicher Nutzen erkannt werden konnte; Medizinische Gründe
6. Eine plötzliche Veränderung des Gesundheitszustandes machte eine geplante Befragung unmöglich.
Aufgrund von Sprach- und Akzeptanzproblemen ist auch nicht gelungen, mehrere Patienten mit Migrationshintergrund in die Studie aufzunehmen.
Insgesamt waren 23 Patienten bereit, an der Untersuchung teilzunehmen (12 Frauen, 11 Männer). Der Anteil der Teilnehmer reduzierte sich im Laufe der Untersuchung. Hier waren medizinische Gründe, aber auch persönliche und räumliche Gründe (z.B. es erfolgte eine Versorgung außerhalb von Hannover) ausschlaggebend.
Die jüngste Patientin war 21 Jahre, der älteste Teilnehmer an der Studie 84 Jahre alt. Das mittlere Alter betrug 59 Jahre. Zwölf Befragte gaben als höchsten Schulabschluss den Hauptschulabschluss an, sieben die Mittlere Reife und vier hatten das Abitur abgelegt. Von den 23 Befragten waren noch zwölf berufstätig, sechs bezogen eine Rente und vier waren im Haushalt tätig. Nur ein Patient ging keiner Beschäftigung nach. Knapp die Hälfte der Teilnehmer war verheiratet oder lebte in fester Partnerschaft.
In der folgenden Übersicht sind alle in die Studie integrierten Personen aufgeführt.
Tab. 6: Darstellung aller Patienten in der Studie zum Zeitpunkt T1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7.2 Quantitative Ergebnisse der transkribierten Leitfadeninterviews
Die quantitative Analyse erfolgte, um einen Überblick über die Ausdehnung der Interviews zu erhalten. Es wurden die Worte der Aussagen gezählt in den beiden Untersuchungsgruppen gezählt, differenziert wurde zudem nach Männern und Frauen.
Tab. 7: Quantitative Analyse der Leitenfadeninterviews (durchschnittliche Wortanzahl der Texte)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es fällt auf, dass die Gesprächsanteile der Personen aus der Gruppe II insgesamt etwas höher ausfielen, in beiden Gruppen sprechen die Männer mehr als die Frauen.
7.3 Ergebnisse der Analyse der qualitativen Interviews
Die Analyse der Interviews nach den im Methodenteil dargestellten Reduktionsprozessen mündet vor dem Hintergrund der drei großen Forschungsfragen in die folgenden übergeordneten Kategorien.
A Bedürfnisse der Betroffenen
Kümmern - gemeint ist, dass sich Behandelnde und Familie/Freunde sich um die Menschen kümmern sollen, ihnen Zuwendung und Hilfe geben Zeit - hinreichend Zeit für Gespräche und Neuorientierung Organisation - im Sinne von reibungslosen Abläufen, keine unnötige Wartezeiten, kein Hinauszögern Zuverlässigkeit und Sicherheit - Ansprechpartner sind vorhanden, Hilfe ist schnell möglich
Informationen - vollständige und verständliche Informationen
Hilfe - Umgang mit Schmerzen, Hilfe bei der Bewältigung der Krankheit
Ruhe - Ruhe finden, in Ruhe mit der Krankheit auseinandersetzen, Rückzugsmöglichkeiten haben
B Erwartungen an die Professionellen
Kompetenz, Verantwortung übernehmen, Engagement, Kontinuität, Gespräche, Informationen, Vertrauen
C Situation der Entscheidungsfindung
Wer die Entscheidung treffen soll, kann in folgende Gruppen der Entscheidungsfindung aufgeteilt werden:
Eigenständigkeit bzw. eigene Entscheidung Entscheidung mit Partner oder Familie Entscheidung mit Hausarzt
Entscheidung alleine durch den Arzt.
Zusätzlich wurden folgende Kategorien identifiziert, die im Rahmen der Entscheidungsfindung wichtig sind. Perspektiven, Selbständigkeit, Unsicherheit.
7.3.1 Charakterisierung der Situation - Gruppe I - langfristige
Entscheidungsfindung
In der Gruppe I wurden 13 Patienten und Patientinnen rekrutiert (6 Frauen und 7 Männer). Das Durchschnittsalter dieser Gruppe lag bei 57,4 Jahre. Unter ihnen befanden sich vier Betroffene im Rentenstatus.
Die Befragten in dieser Gruppe unterschieden sich von den Patienten der Gruppe II (kurzfristige Entscheidungsfindung). Ihnen war in der Regel schon mehrere Jahre bekannt, dass eine Nierenersatztherapie auf sie zukommt. Sie wurden im Rahmen der kontinuierlichen Behandlung ihrer Erkrankung immer wieder darauf hingewiesen, dabei wurde ihnen auch die Relevanz von Therapietreue erklärt. Die Befragten fühlten sich in der Regel umfassend informiert, der Klinikaufenthalt und die Abläufe zur Überprüfung der Nierenfunktion waren recht gut vertraut. Im Vergleich zu den Patienten in der akuten Entscheidungssituation fühlten sie sich weniger bedroht oder belastet. Auffällig ist, dass fast alle der befragten Männer und Frauen dazu neigten, ihre fortschreitende Niereninsuffizienz zu verharmlosen. So bewerteten sie beispielsweise verbesserte Funktionswerte (Laborwerte) als Zeichen einer Besserung der Erkrankung, nicht zuletzt aus dem Wunsch heraus, sich mit der auf sie zukommenden Entscheidung nicht auseinander setzen zu müssen.
„ Ja, aber im Augenblick habe ich ja noch Zeit … mein Wert ist wieder besser geworden … . Aber noch habe ich ja Zeit." (L.,K. W 58 L)
Besonders wichtig ist allen Befragten, dass der Krankenhausaufenthalt nur eine vorübergehende, hoffentlich kurze Episode sein soll. Das "normale Leben" nach dieser Zeit wird sehnsüchtig erwartet.
„ Jetzt gehe ich als n ä chstes in die Rehabilitation … nach Bad M ü nder, ich denke so drei Wochen und von da aus gehe ich nach Hause und dann mache ich wieder meinen Sport mit den Jugendlichen, die Zeit wird es schon tun. “ (B.,W., M 68 L)
In diesem Zusammen werden besonders bei den Berufstätigen Ängste formuliert, die sich auf die Arbeitsplatzsituation bezogen.
„ Ich hoffe, dass das hier bald vorbei ist … muss wieder zur ü ck … sonst
verliere ich meinen Job, wissen Sie, dass kann ich mir nicht leisten und
wenn die hier nicht wissen was ich habe … dann k ö nnen die mich doch auch gehen lassen." (V.,K. M 51 L)
7.3.2 Charakterisierung der Situation - Gruppe II - kurzfristige Entscheidungsfindung
In der Gruppe II befanden sich 10 Patienten und Patientinnen (6 Frauen und 4 Männer). Das Durchschnittsalter der Mitglieder dieser Gruppe war niedriger als in der Gruppe I und lag bei 54,6 Jahren. Unter ihnen waren sich zwei Betroffene im Rentenstatus.
Patienten dieser Gruppe befanden sich in der Phase der akuten Entscheidungsfindung zu einer Form der Nierenersatztherapie. Die Patienten und Patientinnen in dieser Gruppe waren ausnahmslos in der Situation, dass sie akut, ohne für sie erkenntliche Anzeichen, einen Funktionsverlust der Nieren akzeptieren mussten und aus diesem Grund eine Entscheidung notwendig und unumgänglich war. Sie befanden sich in der Regel in einem schlechteren körperlichen und gesundheitlichen Allgemeinzustand und wiesen multiple Symptome der ausgeprägten Niereninsuffizienz auf. Für sie war der stationäre Aufenthalt alles Andere als Routine. Sie wirkten emotional stark belastet und zeigten Zeichen der Erschöpfung und Ratlosigkeit.
„ Wir haben da ganz oft dr ü ber gesprochen … aber diesmal ist es anders … jetzt wird es irgendwie ernst … wissen Sie ich habe Angst vor dem Ding im Hals … Katheter oder so .. wissen sie was ich meine … kennen Sie das? Und dann Dialyse … da gibt es ja mehrere M ö glichkeiten … sch ö n sind die alle nicht … aber ich muss ja wohl … . “
(S.,G. W 43 K)
„ Viele Gedanken … ich kann es nicht ä ndern … ich will noch leben und werde immer schw ä cher … das ist nicht sch ö n … wenn man keine Kraft mehr hat zum Aufstehen oder Flasche aufmachen." (M.,E. 62 W K )
7.3.3 Bedürfnisse der Patienten in beiden Untersuchungsgruppen
Die Bedürfnisse der Patienten in beiden Gruppen sind nicht deutlich unterschieden, wobei für die Patienten in Gruppe II insgesamt der Aspekt der Verarbeitung von Ängsten eine wichtige Rolle spielt, der allerdings latent auch bei den Befragten der ersten Gruppe auftaucht. Auffälliger sind hier Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wobei die Frauen häufiger den Aspekt der Zuwendung und Unterstützung, auch durch die Familie, ansprechen
„ Ich habe Hilfe zu Hause und Essen bekommen ich auch … mein Sohn hat das alles f ü r mich geregelt … " (P., E. 75 W L) bei den Männern standen der Wunsch und das aktive Suchen nach Informationen im Vordergrund „ … ich habe jetzt alle Informationen, die ich brauche und ich glaube, wenn ich mich von den anderen Ä rzten beraten lasse, dann f ä llt es mir nicht schwer, eine Entscheidung zu treffen." (O.,T. 35 M L)
7.3.4 Erwartungen an die Professionellen in beiden Untersuchungsgruppen
Hier bestand bei den Frauen besonders häufig der Wunsch nach Verantwortungsübernahme und intensiver Hilfestellung durch die Ärzte und dem Wunsch, auf dieser Basis Vertrauen zu den Ärzten haben zu können.
„ Denke schon … muss mir nur jemand sagen … was ich machen soll und was ich so darf … das kann ja nicht so schwer sein. “ (M.,K. W 56 L) „… ob ich nach Hause gehe oder nicht … . Das sagen die Ä rzte mir hier. “ (P.,E. W 75 L). die Männer wünschten sich vor allem Informationen.
„ Informationen brauche ich, ja … habe mich auch schon im Internet
informiert … man muss ja erstmal die ganzen Sachen verstehen … diese vielen Fremdworte und meine Freundin hat mir auch viel erkl ä rt. Geht schon … " (J.,R. M 44 L)
Die meisten Befragten gaben zwar an, ausreichend informiert worden zu sein, aber häufig wurden diese Informationen nicht richtig verstanden oder nur unvollständig erinnert.
„ Ja, sie haben mir erkl ä rt, dass das irgendwie mit meiner Niere zusammenh ä ngt …“ (C.,N. M 65 K)
„ Sie haben mir alles erkl ä rt … habe ich zwar nicht alles verstanden nun, dass meine Nieren nicht mehr gut arbeiten und ich an die Dialyse muss … davon habe ich keine Vorstellung … aber ist wohl nicht zu vermeiden. “ (W.,G.W 59 K)
Häufig gaben die Befragten an, nicht die behandelnden Ärzte im stationären Bereich um weitere Informationen bitten zu wollen, sondern mit dem betreuenden Hausarzt oder mit Familienangehörigen offene Fragen zu klären. Dies traf besonders bei älteren Patientinnen zu.
„ Ja er hat mir das erkl ä rt … aber wirklich verstanden habe ich das nicht … da muss ich noch mal meine Haus ä rztin fragen … die kann mir das sicher erkl ä ren … wir kennen uns ja schon so lange “ (M.,K. W 56 L)
Auffällig ist, dass neben der aktiven Informationssuche und dem Wunsch, alles genau zu verstehen, auch das Bedürfnis nach "Nichtwissen" genannt wird.
„ Ich will gar nicht so viel wissen … das macht mir nur Angst, erkl ä ren tun dir mir aber alles gut … also informieren tun die mich schon. “ (H.,P. W 51 K)
Oder
"Aber ich geh ö re zu den Menschen, die gerne verdr ä ngen. mehr muss ich jetzt nicht wissen “ . (W.,H. 49 M K)
Deutlich wird bei den meisten Interviewten der Wunsch nach kontinuierlicher Betreuung und Behandlung.
„… was mich nur st ö rt, dass da immer andere Ä rzte sind … ich hatte schon
4 verschiedene, jeder macht es anders und immer wieder muss man alles erz ä hlen, darauf habe ich am Ende keine Lust mehr gehabt … das hat mich genervt." ( E.,S. 21 W L )
„ Die Schwestern sind lieb … . aber irgendwie wei ß die eine nicht was die andere tut, die sprechen sich nicht gut ab." (T.,M. 53 W K)
„ die sind immer gestresst, … . und sie geben sich ja auch M ü he." (S.G., 43 W K)
7.3.5 Beeinflussende Faktoren im Rahmen der Entscheidungsfindung
Bei der Frage, welche Entscheidungspräferenzen die Befragten haben, zeigen sich ganz unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensweisen. Während einige Befragte auf einer sehr unabhängigen Entscheidung bestehen und dabei auch durchblicken lassen, dass sie diese Entscheidungsfindung als schwere Aufgabe und als Last, die sie selbst bewältigen müssen, betrachten.
„ Da muss ich jetzt alleine durch." (S.G., 43 W K)
„ Die Entscheidung muss ich treffen … ganz alleine … ich will unabh ä ngig sein frei und so … Ich glaube die Bauchdialyse ist das … . Vielleicht auch nachts hierher kommen … ich wei ß noch nicht". (J.,R. M 44 L)
„ Die Entscheidung muss ich ja treffen … die kann mir keiner abnehmen und ich glaube, dass ist ja richtig so … wie bei der Berufswahl … ich muss ja damit zufrieden sein und es muss zu meinem Leben passen. Damals als ich mich f ü r den Lehrerberuf entschieden habe, war das auch nicht ganz einfach … jeder redete rein und hatte bessere Ideen … da kann ich mich auf mich verlassen … ich finde schon den richtigen Weg “ . (N.,K. W 35 K)
formulieren andere deutlich den Wunsch nach einer gemeinsamen Entscheidung mit Ärzten, häufig mit den Hausärzten
"Na, wer soll das denn entscheiden, ich … mach ich mit meiner Ä rztin … die wei ß schon, was gut für mich ist". (M.,K. 56 W L)
Eine wichtige Rolle spielen auch die Angehörigen
„ So etwas haben sie angesprochen … muss das aber noch mal mit meiner Tochter besprechen … vielleicht kann die ja noch mal mit dem Arzt sprechen … " (P., K. 73, W L)
„ Die Entscheidung will und muss ich alleine treffen, da kann mir keiner
helfen, nat ü rlich bespreche ich das mit meiner Frau, aber entscheiden muss ich dass …“ (W., H. M 49 K)
„ Ich und … . ne das mache ich ganz alleine, na ja meine Frau wird mir schon helfen. “ (C.,N. M 65 K)
Nur drei Patienten äußerten gezielte Wünsche nach Gesprächen mit anderen Betroffenen und erwähnten eine Ernährungsberatung.
7.4 Ergebnisse der Analyse der Picture Story Exercise
11 der 23 Befragten (6 Frauen, 5 Männer) waren nach dem Interview bereit, an dem Experiment der Picture Exercise Story teilzunehmen. Tabelle 9 zeigt diese Befragten im Vergleich zu allen Befragten zum Zeitpunkt T1 (s. S. 92). Auch wenn mehr als die Hälfte der genuinen Untersuchungsgruppe nicht in diese Teilerhebung eingebunden war, entspricht die Zusammensetzung weitgehend der Gesamtgruppe
Tab. 8: Übersicht Patienten, die am ersten Interview und der Picture Story Exercise teilnahmen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die kurzen Bildbeschreibungen wurden nach dem oben geschilderten Procedere (Kapitel 6.2.2) ausgewertet. Dabei konnten für alle drei bei Schultheiss beschriebenen Motivlagen Beispiele mit unterschiedlichen Ausprägungen gefunden werden.
Im Folgenden werden typische Bespiele für jede Motivlage dargestellt. Zum besseren Verständnis wird den Beispielen nochmals eine kurze Charakterisierung der Motivlage vorangestellt.
7.4.1 Bindungs- / Harmoniemotiv
Patienten mit einem hohen Bindungs-/ Harmoniemotiv verhalten sich eher angepasst, wenn sie dafür Anerkennung bekommen, sie leiden bei Ablehnung, sie werden selten eigene Meinung oder Standpunkt kundtun und agieren eher verdeckt. Sie zeigen häufig ein kooperatives Verhalten und Therapietreue, um eine gute Beziehung zu ihrem Arzt zu erhalten. Des Weiteren neigen Menschen mit hoher Bindungsmotivation eher dazu, Meinungen/Ziele von anderen zu übernehmen. Sie akzeptieren und wünschen sich eher eine paternalistische Arzt- Patientenbeziehung. Die folgenden Bildgeschichten stammen von einer 53- jährigen Patientin, im Prozess der akuten Entscheidungsfindung (P3).
Bild 1
Auf Bild 1 erkenne ich eine Patientin, die mit ihrer behandelnden Ä rztin ein
Gespr ä ch ü ber Krankheit spricht. Man erkennt, dass es sich von Seiten der Ä rztin um Erkl ä rung oder Beratung handelt. Wahrscheinlich hat die Patientin Beschwerden oder Schmerzen gehabt und nach einigen Untersuchungen durch den Hausarzt oder den Facharzt kommt es jetzt zur oben genannten Beratung wie die weitere Behandlung verlaufen kann oder muss.
Man erkennt, dass sich die Ä rztin das weitere Vorgehen durchdacht hat und den von ihr entworfenen Behandlungsplan mitf ü hlend mit der Patientin bespricht. Die Patientin h ö rt aufmerksam zu und scheint viel Vertrauen in die Ä rztin zu legen. Die Patientin will bestimmt wissen, ob sie unter der Behandlung Schmerzen (OP, etc.) zu erwarten hat und vertraut auf das, was die Ä rztin erkl ä rt. Als n ä chstes wird die Patientin einen f ü r sich aufgestellten Behandlungsplan bekommen, damit sie wei ß , wie es mit ihr weitergeht. Die Patientin wird auf Dauer lernen k ö nnen, sich mit ihrer Krankheit zu arrangieren , sich an die Vorgaben zu halten , und so, ein vielleicht eingeschr ä nktes, aber lebenswertes Leben zu f ü hren.
Interpretation: Bindungs- / Harmoniemotiv
Bild 2
Zeigt zwei Personen auf einer Bank. Sie wirken entspannt und genie ß en die Sonne. Es scheint sich um zwei junge Leute zu handeln, die mit Rucksack am Tage unterwegs waren. Vielleicht machen sie Urlaub, vielleicht entspannen sie sich von der UNI oder der Arbeit. Sie verstehen sich jedenfalls recht gut und sind sich nicht fremd. Das Bild strahlt etwas befriedigendes, vertrautes zwischen den beiden aus, ohne dass es den Anschein hat, als kennen sie sich schon l ä nger. Die Beiden werden sich wohl ü ber die Ereignisse des Tages unterhalten und dabei die Stille am Fluss genie ß en . Sie f ü hlen sich wohl und denken vielleicht ü ber ihr weiteres Leben nach. Ü ber ihre Ziele und W ü nsche (Karriere, Kinder etc.). Nachdem sie sich ausgeruht haben, werden sie nach Hause gehen oder anderen Besch ä ftigungen nachgehen. Wie die Geschichte zu Ende geht kann ich nicht sagen. Aber f ü r mich geht es so aus, dass sie einer guten Zukunft entgegen gehen.
Interpretation: Bindungs- / Harmoniemotiv
7.4.2 Leistungsmotiv
Patienten mit einer hohen Leistungsmotivation möchten Klarheit und Mitentscheiden, sie sind eher ungeduldig und erkundigen sich umfassend. In der Arzt-Patienten-Beziehung verhalten sie sich fordernd und möchten einen genauen Plan der Behandlung, sowie Informationen darüber, was sie selber zur Behandlung beitragen können. Die folgenden Geschichten wurden von einer 21 jährigen Patienten (P1) verfasst, die sich bereits seit über fünf Jahren wegen der eingeschränkten Nierenfunktion in ärztlicher Betreuung befand.
Bild 1
Eine Frau sitzt bei ihrer Ä rztin im Besprechungszimmer. Die Frau ist ganz unsicher , weil sie nicht wei ß , wie sie auf die schlechten Nachrichten reagieren soll. Sie hat i mmer so auf sich geachtet und jetzt ist sie doch schwer krank geworden. Sie denkt dar ü ber nach wie es weitergehen soll und kann sich gar nicht auf das Gespr ä ch konzentrieren . Sie macht sich gro ß e Sorgen und denkt immer dar ü ber nach. Jetzt wird alles noch viel schwerer und sie weiss nicht was sie machen soll. Sie muss doch weiter f ü r sich sorgen und hat soviel zu erledigen. Die Ä rztin hat ein Rezept ausgeschrieben.
Interpretation: Leistungsmotivation
Bild 2
Auf der Bank am Fluss sitzen zwei Leute, die sich viel zu erz ä hlen haben. Der eine hat gerade eine schlechte Nachricht bekommen und ü berlegt, wie er es dem anderen sagen kann. Ihm f ä llt nichts ein und deswegen schweigt er. Die andere merkt, dass ihn etwas bedr ü ckt und versucht ihn auszufragen. Das gelingt ihr aber nicht und deshalb steht er bald auf und geht nach Hause. Der andere bleibt auf der Bank sitzen und schaut in den Fluss. Sie kann nicht schwimmen und denkt was passieren w ü rde, wenn sie ins Wasser falle oder von der Br ü cke falle. Das muss doch alles gehen, denkt sie und geht dann auch ihren Weg .
Interpretation: Leistungsmotivation
7.4.3 Powermotiv
Schultheiss (125) übersetzt bewusst dieses Motiv nicht im Sinne von Macht, sondern im Sinne von Power (Kraft). Patienten, bei denen diese Motivlage überwiegt, haben eine Abneigung gegen „machtorientierten“ Therapeuten und suchen häufig nach einer Zweit- oder Drittmeinung. Wobei die Therapeuten oftmals über ihre CO-Existenz nicht informiert sind. Diese Patienten bevorzugen eine partizipative Entscheidungsfindung bzw. ärztliche Begleitung. Die folgenden Geschichten stammen von einem 35-jährigen Patienten (P15), der sich bereits länger mit der Tatsache der eingeschränkten Nierenfunktion auseinandergesetzt hat.
Bild 1
Auf dem Bild sitzt eine Frau bei ihrer Ä rztin, die beiden kennen sich schon sehr lange und sie vertraut ihrer Ä rztin alle ihre Sorgen an. Es ist nicht besorgniserregend , sondern sachlich und konzentriert. Beide sind auf Augenh ö he und es gibt wenig Abstand. Die Ä rztin versteht die Ä ngste und versucht ihr zu helfen . Sie macht ihr Mut und sagt ihr, dass sie sich darum k ü mmern wird. Die Frau ist schon sehr lange krank und kennt das alles schon, aber diesmal ist es irgendwie schlimmer und sie braucht mehr Hilfe . Interpretation: Harmoniemotiv und Powermotiv
Bild 2
Auf dem Bild sitzen zwei junge Leute am Fluss. Sie haben eine lange Wanderung gemacht und machen jetzt eine Pause und unterhalten sich. Sie sind in einer sch ö nen Stadt und machen gerade Urlaub. Sie haben beide noch viele Ideen f ü r ihr Leben und denken nach. Der eine will noch mal ganz von vorne anfangen und erz ä hlt seine Ideen, die andere h ö rt gut zu und findet das spannend und interessant . Er redet, sie h ö rt zu, sie kann ihre Gef ü hle nicht erkl ä ren. Nach kurzer Zeit stehen beide auf und wandern weiter ü ber die Br ü cke. Er gibt ihr immer irgendwelche Ratschl ä ge und so diskutieren sie den ganzen langen Weg . Er will etwas machen und nach vorne schauen , das motiviert sie und er kann kein Ende finden .
Interpretation: Powermotiv
Bei der Analyse der Geschichten findet sich eine Häufungen von Items (Keywords), die eindeutig auf eine Motivlage hinweisen. Dennoch sind nicht alle Wörter direkt zuzuordnen, in der Gesamtschau kommen Mischformen vor. Auffallend sind gute Übereinstimmungen der gefundenen Motivindikatoren zwischen den beiden Geschichten der Patienten zu ganz unterschiedlichem Bildmaterial.
Über die 10 Studienteilnehmer in diesem Teil der Untersuchung zeigte sich
folgende Verteilung der basalen Motive (Tab. 9).
Tab. 9 Basale Motive der Befragten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7.5 Ergebnisse des zweiten Interviews nach ca. sechs Monaten
Für das zweite Interview 6 Monaten nach dem Erstgespräch waren noch 10 Personen erreichbar.
Tab. 10: Übersicht Teilnehmer an T1 - Picture Story Exercise - T2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das zweite Gespräch erfolgte in Form eines freien Interviews nach den Leitfragen:
1. Welche Unterstützung hätten Sie sich noch gewünscht bzw. was hat Ihnen gefehlt?
2. Was wünschen Sie sich für die Zukunft.
Zu einem zweiten Gespräch (T2) waren mehr Frauen als Männer bereit. Bezüglich Alter, Bildungsgrad und Lebenssituation entsprachen sie der genuinen Gesamtgruppe. Sie wurden in der Regel im Rahmen einer Kontrolluntersuchung oder im Rahmen der Dialysebehandlung im Nierenzentrum kontaktiert und befragt. Sechs Patienten befanden sich zum Zeitpunkt der ersten Befragung (T1) in der Gruppe I (Patienten war schon länger bekannt, dass eine Entscheidung für eine Nierenersatztherapie erfolgen muss; sie befanden sich in der Regel bereits mehrere Jahre in nephrologischer Betreuung). Vier Patienten gehörten der Gruppe
II an (Patienten waren akut mit der Entscheidung für eine Nierenersatztherapie konfrontiert).
Aus den Folgeinterviews und den Patientenakten konnte festgestellt werden, dass die Verarbeitung des Dialysebeginns sehr unterschiedlich erfolgte und unter anderem vom Betreuungsumfang vor der Dialyse abhängig war.
Einige Patienten erlebten die erste Phase der Dialyse durchaus positiv, die körperliche Leistungsfähigkeit verbesserte sich, insbesondere bei den Heimverfahren wurde das aktive eigene Handeln als positiv bewertet. Eine wiederkehrende Lebensfreude und Hoffnung, dass das Leben auch mit Dialyse zu bewältigen sei, trat ein. Hier konnte kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (langfristige vs. kurzfristige Entscheidungsfindung) erkannt werden.
Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass Patienten, die in einem Dialysezentrum dialysiert wurden, die Lebensveränderungen eher als Konflikt und Belastung wahrnahmen. Dies betraf Patienten beider Gruppen gleichermaßen. Sie bemerkten, dass die Dialyse nicht problemlos in den Alltag integrierbar war, und Resignation machte sich bemerkbar. Es traten Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit auf, je nach Persönlichkeitsstruktur auch Depression, Trotz oder Aggression. In dieser Phase wurde der Patient beispielsweise von den Behandelnden häufig als der „schwierige Patient“ bezeichnet. Dies war besonders bei jüngeren Patienten, Patienten die noch im Berufleben (Familienversorgung /Kinderbetreuung eingeschlossen) standen sowie bei Patienten mit hoher Leistungsmotivation zu beobachten. Wahrscheinlich äußerte sich so der innerpersonelle Konflikt zwischen Abhängigkeit (vom Dialyseregime) und Autonomiestreben des Betroffenen.
7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse auf der Basis der Teilgruppe der Befragten, von denen Ergebnisse zu drei Studienteilen vorliegen (N=10)
Mit zehn Patienten wurde das teilstrukturierte, qualitative Interview durchgeführt, zudem waren sie bereit an der Picture Story Exercise teilzunehmen und haben an einem zweiten offenen Gespräch teilgenommen. Eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse zeigt Tab. 11.
Tab.11: Übersicht der Ergebnisse Teilnehmer Leitfadeninterviews (T 1 Kategorien) und Picture Story Exercise (Motivlage)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gemäß der Kategorisierung wird deutlich, dass sich die überwiegende Zahl der Betroffenen vor allem ein "Kümmern" und damit das Eingehen auf ihre Bedürfnisse wünscht, Zeit und Organisation des Behandlungsverlaufes sind dabei ebenso wichtig wie verständliche und ausreichende Informationen. Von den Professionellen erwarten sie Kompetenz und Verantwortungsübernahme sowie Engagement und Vertrauen.
Die Kategorisierung der Patientenbedürfnisse und der Erwartungen an die Professionellen wurden im Anschluss mit den Aussagen aus der Picture Story Exercise verglichen. Zu untersuchen war, ob sich aus diesen Aussagen zusätzliche Bedürfnisse, die Patienten aus unterschiedlichsten Gründen nicht verbalisierten, erkennen ließen. In dem untersuchten Kollektiv gab es drei von zehn Patienten, bei denen ein Unterschied bezüglich verbalisierter Motivlage und verschriftlichter Motivlage vorlag. Dies kann ein Anlass dafür sein, neben einer Befragung ein weiteres eher psychologisches Test - bzw. Analyseverfahren anzuwenden.
Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass diese Patienten im Vergleich zu den Patienten mit übereinstimmender Motivlage zu den verbalisierten Bedürfnissen größere Schwierigkeiten zu haben scheinen, sich in die Behandlung einzufinden. Sie reagierten zum Teil mit Überforderung, teils mit vermehrten unerklärlichen Komplikationen und empfanden den Beginn der Dialyse besonders belastend.
Um darzustellen, wie die Äußerungen der Patienten auf den unterschiedlichen Ebenen (Interview und Picture Story Exercise) eingeordnet wurden, wie sie selbst die Entscheidungsfindung beschreiben und welche Konsequenzen dieses für die Nierenersatztherapie haben kann, sind im folgenden vier Fallbeispiele abgebildet, an Hand derer der Verlauf und die Entscheidungsfindung nochmals diskutiert werden kann.
Bewusst wurden Patienten gewählt, die alle unterschiedliche Nierenersatz- therapieverfahren gewählt haben. Wichtig ist zu erkennen, was Patienten verbalisieren, aus welcher Motivlage heraus sie agieren und wie Professionelle darauf adäquat reagieren können, um eine möglichst hohe Therapietreue zu gewährleisten.
7.6.1 Fallbeispiele
Es handelte sich um eine 71-jährige Patientin, die verwitwet war und als Rentnerin alleine lebte. Sie versorgte noch einen eigenen Garten und traf sich regelmäßig mit ihren Freundinnen zum Kaffee. Sie wurde von der Tatsache ernsthaft erkrankt zu sein vollständig überrascht und gab an, seit 50 Jahren nicht mehr im Krankenhaus bzw. richtig krank gewesen zu sein. Der Verlauf der Entscheidungsfindung bei dieser Patientin verlief diskontinuierlich, obwohl Motive und Kommunikation einheitlich waren und auch dementsprechend von ihr kommuniziert wurden. Einerseits wirkte sie zeitweise sehr kooperativ und aufgeschlossen, selbständig und eigeninitativ. Auf der anderen Seite signalisierte sie im Gespräch häufig den Bedarf nach Ruhe und Zeit. In der Picture Story Exercise zeigte sie ein ausgeprägtes Harmoniemotiv. Ihre Entscheidung für das Heimverfahren Peritonealdialyse wurde von allen an der Behandlung Beteiligten unterstützt und gefördert. Im fortschreitenden Trainingsverlauf zeigte sich jedoch, dass sie mit dieser Therapieform überfordert war und so wurde bei ihr auf das Verfahren der IPD (Intermetierende Peritonealdialyse im Nierenzentrum) umgestiegen. Sie fühlte sich entlastet und nahm diese Alternative im Nierenzentrum an. In der Folgebefragung konnte sie keine Angaben darüber machen, was ihr gefehlt habe. Die Erwartungen an die Professionellen, dass sie die Entscheidung treffen sollten, konnte so im Sinne der Patientin genutzt werden, um eine optimale Nierenersatztherapie zu finden.
Bei der Patientin handelte es sich um eine 53-jährige Pflegekraft, die bis zu ihren akuten Symptomen voll berufstätig war. Sie fiel im Prozess der Entscheidungsfindung durch hohe Verantwortungsübernahme, spezifisches Wissen und Eigeninitiative auf. Die Kommunikation zwischen ihr und den Professionellen wurde auf beiden Seiten auf Augenhöhe empfunden. Ein Heimverfahren schien hier für alle auf den ersten Blick optimal zu sein, sowohl medizinisch wie auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Patientin. Gehäuft auftretende Komplikationen bereits während des stationären Aufenthaltes belasteten die Patientin sehr, sie waren aber kein Signal, von einem Heimverfahren Abstand zu nehmen. Retrospektiv betrachtet litt die Patientin unter ihrer hohen Leistungsmotivation, gepaart mit einem hohen Harmoniemotiv. Die immer wieder auftretenden Komplikationen führten dazu, dass sie im hohen Maß unzufrieden wurde und einer intensiven psychologischen Betreuung bedurfte, um ihre Überbelastung zu verarbeiten. Diese lehnte sie jedoch, bis auf ein kurzes Coaching, ab. Wahrscheinlich hätte eine streng reglementierte und kontrollierte Hämodialyse im Nierenzentrum für sie entlastend gewirkt und hätte ihr mehr Sicherheit vermittelt, als das gewählte Heimverfahren.
Bei diesem Patienten handelt es sich um einen 35-jährigen Patienten, der vollständig im Berufsleben stand und bereits über 10 Jahre in einer ambulanten nephrologischen Betreuung war. Die Tatsache, dass seine Nierenfunktion sich von Jahr zu Jahr verschlechterte, beunruhigte ihn zwar, aber durch seinen hohen Grad der Eigeninitiative und Optimismus konnte er gut mit der Entwicklung umgehen (Motivlage Power/Harmonie). Er fühlte sich gut informiert, nahm weitere Informationen positiv auf und verarbeitete sie. Eine optimale Nierenersatztherapie hat er über Umwege gefunden. Durch das erst gewählte Heimverfahren der Peritonealdialyse konnte er seine Selbständigkeit erhalten, lernte aber auch die Abhängigkeiten, die durch die Nierenersatztherapie unweigerlich eintraten, kennen. Die Lebendnierenspende kam dann seinen Bedürfnissen absolut entgegen und bestätigt diesen positiven Verlauf. Wäre dieser Patienten mit der Hämodialyse in einem Nierenzentrum versorgt worden, hätte das unter Umständen entscheidende psychosoziale Konsequenzen (z.B. Arbeitsplatzverlust) nach sich ziehen können. So konnte er seinen Arbeitsplatz erhalten und erfuhr nur passagere Einschränkungen bezüglich seiner Lebensführung über knapp acht Monate.
Es handelte sich um einen 44 jährigen Patienten, der Berufstätigkeit in Vollzeit nachging. Die Tatsache, dass er an einer Nierenfunktionsstörung litt, war ihm bereits mehre Jahre bekannt. Die plötzlichen Symptome der starken Kopfschmerzen konnte er nicht zuordnen und war überrascht über den Zusammenhang zu seiner Nierenerkrankung. Er fiel im Rahmen der Begleitung dadurch auf, dass er ein hohes Maß an Bedürfnis nach Informationen und Gesprächen signalisierte. Gleichzeitig betonte er, dass sowohl seine Mutter als auch seine Freundin in medizinischen Berufen tätig waren und er sich auf deren Hilfe verlasse. In der Picture Story Exercise zeigte er eine deutliche Harmoniemotivation. Er wirkte in den Gesprächen stets zurückhaltend und wenig eigeninitativ. Die gewählte Therapieform der Hämodialyse in einem Nierenzentrum war dann auch seine persönliche Entscheidung, obwohl auch ein Heimverfahren aus medizinischen Gründen vorteilhaft gewesen wäre. Mit der gewählten Therapieform kam dieser Patient ausgezeichnet zurecht, sein Gesundheits- und Allgemeinzustand verbesserte sich zunehmend, seine psychosoziale Situation stabilisierte sich.
Tab.12: Fallbeispiele im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8 Nephroguide
Die von den Betroffenen verbalisierten und verschriftlichten Bedürfnisse und Motivlagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. bei der Diagnoseübermittlung sind die akut betroffen Patienten eher überfordert und können ihre Wünsche nicht dezidiert artikulieren,
2. fehlendes Hinterfragen wird von den Professionellen häufig als „alles verstanden“ fehl interpretiert;
3. Patienten wünschen sich primär eigene Zeit, um sich mit der Situation und den bevorstehenden Veränderungen auseinanderzusetzen;
4. Patienten, die langfristig betreut werden, verdrängen die Niereninsuffizienz häufig durch fehlende Wahrnehmung und Zuordnung der Symptome;
5. wichtig für die Patienten ist, dass die Entscheidung mit dem Lebenspartner getroffen sowie ein Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht wird.
6. Professionelle sollten Spielräume für partnerschaftliche bzw. eigenverantwortliche Entscheidungen bei den Patienten fördern, aber auch in Fällen, in denen Patienten von der Situation überfordert sind, hilfreiche Unterstützung anbieten. Dazu gehört, dass verbal und nonverbal Räume für ausführliche Gespräche zur Verfügung gestellt werden und Professionelle lernen, auf explizite und implizite Signale der Patienten zu hören.
7. In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, neben der Sachaussage auch auf die Wortwahl und häufig wiederkehrende Begriffe bzw. Argumente zu hören und auf diese besonders einzugehen.
Diese Erkenntnisse wurden bei der Entwicklung eines Manuals für Professionelle - Nephroguide - für einen förderlichen Umgang mit Patienten mit Nierenerkrankungen berücksichtigt (s. Anlage).
Der Nephroguide berücksichtigt drei unterschiedliche Akteure, die Patienten, die Professionellen und die behandelnde Institution.
Patienten
Aus Patientenperspektive wird davon ausgegangen, dass eine Intervention im Sinne einer umfangreichen multidisziplinären Begleitung, besonders in der frühen Phase der Erkrankung, von Vorteil sein kann. Da in vielen Fällen offensichtliche und einschränkende Symptome fehlen, sollen die Patienten bereits in dieser Phase sensibilisiert werden, um die Progression der Erkrankung positiv zu beeinflussen. Sie sollen auch durch umfassende Aufklärung und Begleitung in die Lage versetzt werden, die Entscheidung bezüglich der Nierenersatztherapie auf ihre Lebensumstände abzustimmen und auszuwählen. So könnte eine höhere Identifikation mit der Therapieentscheidung erzielt und damit eine nachhaltige Therapietreue ermöglicht werden. Der Leitfaden Nephroguide verfolgt nicht nur das Ziel, durch umfangreiche Aufklärung und Begleitung die Entscheidungsfindung positiv zu beeinflussen, sondern will auch zur besseren Krankheitsverarbeitung beitragen. So könnte neben einer nachhaltigen Therapietreue eine weniger eingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ein längerer Verbleib im Arbeitsprozess und schließlich die Verhinderung von frühzeitiger Berentung durch Berufsunfähigkeit ermöglicht werden.
Professionelle
Für die Professionellen entsteht ein Nutzen durch die Anwendung des Leitfadens, da sie beim Einsatz dieses Instrumentes die Gewissheit haben, dass der Patient umfangreich aufgeklärt und beraten wurde. Es kann so gewährleistet werden, dass keine Abhängigkeiten zwischen Therapeuten und Patienten entstehen, die die Wahl der Nierenersatztherapie beeinflusst und zu einem späteren Zeitpunkt eventuell zu einem Verfahrenswechsel führen könnte. Auch können die Professionellen darauf bauen, dass der Patient durch umfangreiche Aufklärung und die unterschiedlichen Darstellungen seine Kompetenz erweitert und dadurch die Arzt-Patienten-Kommunikation verbessert wird. Eine Entlastung erfahren die Professionellen dadurch, dass sie darauf vertrauen können, dass alle Beratungsmöglichkeiten angeboten werden und nichts in Vergessenheit gerät, was für die Entscheidungsfindung der Patienten notwendig gewesen wäre. Das Instrument hat somit eine entlastende Wirkung für die Professionellen und trägt zu einer verbesserten Arzt-Patienten-Kommunikation bei.
Institution
Schließlich handelt es sich bei dem Leitfaden auch um ein Instrument zur Erhöhung der Patientenbindung an eine Institution oder Einrichtung. Durch verbesserte Kommunikation und Beratung erhöht sich die Zufriedenheit der Patienten mit daraus resultierender Bindung an die behandelnde Einrichtung. Der Aufbau von Vertrauen führt zu verbessertem Verständnis auf beiden Seiten und wirkt unterstützend auf die Behandlungsbegleitung.
Der Nephroguide gliedert sich in fünf Phasen.
In der ersten Phase, meist während des stationären Aufenthaltes oder in der Ambulanz/Sprechstunde, sollen eine ausführliche ärztliche Beratung und eine ergänzende Beratung durch eine Dialysefachkraft (Gesundheits- und Krankenpfleger/in) bezüglich der einzelnen Nierenersatztherapieverfahren erfolgen. Entscheidend ist, dass die Verfahren von verschiedenen Personen, unabhängig von einander, geschildert und mit den Patienten besprochen werden. Ebenso ist die Wahl unterschiedlicher Medien (Printmedien und Film) ratsam, um den diversen Bedürfnisse der Informationsaufnahme und -verarbeitung gerecht zu werden. Alle begleitenden Aspekte, wie Ernährungsberatung und Sozialberatung, sollten hier bereits zusätzlich integriert werden. Danach sollte die Entlassung in das häusliche Umfeld erfolgen, beziehungsweise mindestens eine längere Pause bis zum nächsten Termin in der Ambulanz/Sprechstunde eingeräumt werden. In dieser Zeit (Phase 2) sollen Patienten durch Kontakt zu Selbsthilfegruppe, Informationsmaterial und die Möglichkeit, jederzeit Kontakt mit den behandelnden Ärzten im Zentrum aufzunehmen, begleitet werden.
Die dann folgende dritte Phase, die mit der Entscheidung bzw. der Wahl der Nierenersatztherapie eingeleitet wird, ist geprägt durch das Legen des Dialysezugangs. Jetzt sollte nochmals eine gezielte Betreuung durch Ernährungsberatung, Sozialdienst und Psychologen - soweit gewünscht - erfolgen. In der vierten Phase wird der Patient in das jeweilige Dialyseverfahren aufgenommen und mit dem Dialyseablauf vertraut gemacht oder für das Heimverfahren (Heimhämodialyse oder Peritonealdialyse) vorbereitet bzw. trainiert. Programme wie „Fit für Dialyse“ des KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation können hier begleitend angeboten werden.
In der Phase 4 sollte das Patientencoaching beginnen, um die Patienten gezielt zu begleiten. Durch den weitergeführten oder neu aufgenommenen Kontakt zur Selbsthilfegruppe kann zusätzliche Unterstützung angeboten werden. In der anschließenden fünften Phase wird die Teilnahme an einer rehabilitativen Maßnahme zur Vertiefung des Wissens und zum Erhalten von neuem Verhalten empfohlen, um Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre neu erworbene Gesundheitskompetenz zu stabilisieren und zu erweitern.
Die Länge der Phasen variiert von Patient zu Patient. Sie kann binnen sechs Monaten durchlaufen werden, kann aber unter Umständen auch sehr viel länger dauern. Hier muss das behandelnde Team miteinander kooperieren und sich abstimmen. Entscheidend ist, dass ein Austausch mit Professionellen aus allen an der Behandlung Beteiligten erfolgt.
9 Diskussion
Zum Nephroguide als Ergebnis dieser Arbeit haben unterschiedliche Informationsquellen geführt. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Aspekten der Patientensouveränität, der Eigenverantwortung, der Selbstwirksamkeit und der Gesundheitskompetenz sowie der Entscheidungsfindung und ihrer Beeinflussung bildete den Hintergrund.
Eine eigene, nicht-repräsentative Befragung zum Thema „Wissen in der Bevölkerung zu Nierenerkrankungen (Kap. 2.4) hat gezeigt, dass das Wissen über Nierenerkrankungen in der Bevölkerung unterschiedlich verteilt ist. Bedingt durch die Tatsache, dass viele Symptome nicht direkt mit einer Nierenerkrankung in Verbindung gebracht werden, ist das Phänomen des „Überraschtseins“ und der nach wie vor bestehende Wunsch nach Informationen bei Patienten aus der Gruppe I (Langfristige Entscheidungsfindung) nachvollziehbar.
Ein Ergebnis aus der Onlinebefragung zum Gesundheitskonsum war, dass Frauen mit Krankheit eher Angst verbinden als Männer. Dies konnte in den qualitativen Interviews ebenso bestätigt werden. Männer signalisierten und thematisierten Angst in beiden Gruppen eher indirekt über Arbeitsplatzverlust oder erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, womit „Angst vor Unsicherheit“ gemeint sein kann.
Häufig wurde in den Gesprächen die Rolle der Ärzte als „Ratgeber“ thematisiert. Sie wurden als diejenigen beschrieben, die die Verantwortung für Entscheidungen und deren Richtigkeit übernehmen sollten. Damit wird die Rolle des Experten als
Autorität einerseits und als Sympathieträger andererseits in Entscheidungsprozessen unterstrichen.
Für die Studie in einem qualitativen Design konnten 23 Patienten aus einer Gruppe von 80 potentiell infrage kommenden Personen rekrutiert werden. Die Rekrutierung der Studienteilnehmer erfolgte eher schleppend und zog sich deshalb auch über einen relativ langen Zeitraum hin. Wichtigster Grund war, dass Ärzte die möglichen Patientinnen und Patienten nicht ansprachen, zweitwichtigster Grund war, dass Patienten nicht wollten, drittwichtigster Grund wurde darin gesehnen, dass Patienten zwar bereit zur Teilnahme waren, aber unvorhergesehen verlegt wurden und als viertwichtigster Grund kann die Picture Story Exercise gesehen werden, die als Erhebungsverfahren zu geringe Akzeptanz erfahren hat. Im Folgenden wird nochmals auf die jeweiligen Aspekte im Detail eingegangen.
9. 1 Methodik
Die im Hauptteil durchgeführten qualitativen Leitfadeninterviews waren gut geeignet, um die Bedürfnisse der Patienten zu eruieren und diese in die Entwicklung des Nephroguide zu integrieren. Die Kodierung und erste Analyse erfolgte durch die Forscherin, ergänzt um erweiterte Analysen durch die Betreuerin.
Die Picture Story Exercise wurde als ein psychologisches Testverfahren gewählt. Sie galt dazu, verbalisierte Bedürfnisse nochmals zu hinterfragen und trug zum Erkenntnisgewinn bei. Hier ist kritisch anzumerken, dass die Methode bisher nicht ausreichend im medizinischen Umfeld evaluiert wurde. Des Weiteren waren die Texte, die die Patienten lieferten, in der Regel sehr kurz, zwar wurden ausreichend Items (Keywords) zur Analyse gefunden, jedoch ist anzunehmen, dass längere Ausführungen mehr Sicherheit in die Beurteilung der Motivlage gebracht hätten.
Des Weiteren muss die Picture Story Exercise als Methode insgesamt bezüglich ihrer Umsetzbarkeit in Frage gestellt werden, da der überwiegende Teil der Patienten dieser Methode skeptisch gegenüberstand. Häufig fehlte die Bereitschaft, sich ausführlich schriftlich zu äußern. Dies könnte einerseits daran liegen, dass Patienten diese Form der Interaktion fremd geworden ist und Vorbehalte zu schriftlichen Äußerungen vorliegen. Bedingt durch Skepsis oder die Angst, etwas „Falsches“ zu schreiben und anhand der Verschriftlichung beurteilt oder bewertet zu werden, erinnert diese Vorgehensweise eventuell an negative Erfahrungen aus der Schule oder dem beruflichen Umfeld.
Hinzu kommt, dass es Betroffenen oft schwer fällt, sich handschriftlich zu äußern, dies könnte an der immer weiter rückläufigen Verbreitung des Briefeschreibens liegen, da andere Kommunikationswege mehr genutzt werden. Eine Möglichkeit, diesem Phänomen in Zukunft zu begegnen, wäre es, Geschichten, die die unterschiedlichen Motivlagen widerspiegeln, dem Patienten zum Lesen anzubieten und ihn zu bitten, eine Geschichte auszusuchen, die seiner Geschichte, die er geschrieben haben könnte bzw. seiner Sichtweise am ehesten entspricht, auszusuchen. Beachtet werden muss jedoch, dass typische Sozialisationseffekte hierbei nicht ausgeschlossen werden können. Auch das Phänomen der Auswahl gemäß angenommener „Erwünschtheit“ können so nicht umgangen werden.
9.2 Leitfadeninterviews
Die Analyse der Leitfadeninterviews war in mehrfacher Hinsicht überraschend und sie deckte sich nicht immer mit den im Vorfeld vermuteten Erwartungen. Bei der quantitativen Analyse ist hervorzuheben, dass die männlichen Teilnehmer durchschnittlich umfangreichere Aussagen zu den Fragen fanden und mehr artikulierten als die weiblichen Teilnehmer. In der Regel wird davon ausgegangen, dass weibliches Kommunikationsverhalten ausschweifender ist als männliches Kommunikationsverhalten. In dieser Erhebung zeigte sich deutlich, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede eher umgekehrt erschienen und sich nicht mit den Erwartungen deckten. Eventuell lag es daran, dass die weiblichen Patienten sich dem hierarchisch orientierten medizinischen System eines Krankenhauses eher unterordneten und ihr Kommunikationsverhalten anpassten. Auch wäre es möglich, dass das Antwortverhalten durch die Interviewerin beeinflusst wurde.
Hinweise darauf, dass das Sprachverhalten Abhängigkeiten (u. a. Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand etc.) gibt die linguistische Genderforschung. Gemäß dem Doing-Gender-Ansatz ist Geschlecht keine fundamentale, in der Biologie der Individuen verankerte Eigenschaft mehr, sondern in erster Linie das Ergebnis interaktiver sozialer Handlungen. Dabei wird die Kategorie Geschlecht niemals „pur“ inszeniert, sondern immer in Interaktion mit anderen Kategorien - dem sozioökonomischen Hintergrund, dem professionellen Status, der ethnischen Zugehörigkeit, dem Alter, der individuellen Biographie und, entscheidend, in dem situativen und kulturellen Kontext. Sowohl Konstellationen, in denen sich geschlechtstypisches Sprachverhalten zeigt als auch solche, in denen sich keinerlei sprachliche Geschlechtsspezifik ausmachen lässt, sind mit dem Doing- Gender-Ansatz zu vereinbaren und zu erklären (62b).
9.2.1 Qualitative Analyse
Mit Hilfe der qualitativen Analyse konnten eindeutige Hinweise bezüglich der Bedürfnisse der Betroffenen identifiziert werden. Die Kategorien, die die Bedürfnisse der Betroffen widerspiegeln sind Kümmern, Zeit und Organisation, Zuverlässigkeit und Sicherheit, sowie Informationen, Hilfe und Ruhe. Auch wenn die letztgenannten Kategorien nicht auffällig repräsentiert waren, sollen sie im Rahmen der Entwicklung des Nephroguides berücksichtigt werden. Die Kategorien, die die Erwartungen an die Professionellen thematisieren wurden sind Kompetenz, Verantwortung übernehmen, Engagement, Kontinuität, Gespräche und Informationen. Die Kategorien, die die Empfindungen oder wichtige Aspekte bei der Entscheidungsfindung beschreiben, sind Eigenständigkeit bzw. eigene Entscheidung, Entscheidung mit Partner oder. Familie, Entscheidung mit Hausarzt, Entscheidung allein durch den Arzt.
Damit wird auch deutlich, dass die Phase der Entscheidungsfindung geprägt ist durch eine mehr oder minder große Unsicherheit, der mit Hilfe von Informationen z.B. durch Gespräche mit Betroffen und anderen Professionellen und anderen Hilfsangeboten begegnet werden kann. Wichtig ist es den Patienten in dieser Phase, dass auf der einen Seite ihre Eigenständigkeit beachtet wird, die Professionellen jedoch auf der anderen Seite Verantwortung im Sinne ihres Expertentums übernehmen. Es ist also eine Gratwanderung auf beiden Seiten, die Bedürfnisse der Patienten und ihre Erwartungshaltung, die medizinischen Indikationen und das Verhalten der Professionellen in Übereinstimmung zu bringen.
Unterschiede in der Situationswahrnehmung und Bedürfnisartikulation konnten sowohl zwischen den beiden Patientenkollektiven (Patienten mit langfristiger Entscheidungsfindung und Patienten mit akuter Entscheidungsfindung) beobachtet werden, ebenso zeigten sich in Teilbereichen geschlechtsspezifische Unterschiede. Zusätzlich wurde deutlich, dass Patienten, die langfristig vor dem Dialysebeginn nephrologisch betreut und begleitet wurden, kurz vor Beginn der Nierenersatztherapie eine geringe Ausprägung von Hilflosigkeit und Überforderung zeigten, auch war der Bedarf nach Informationen entweder nicht besonders groß oder sehr viel konkreter und zielgerichteter. Hier kann davon ausgegangen werden, dass diese Patienten sich bereits für ihre Bedürfnisse ausreichend informiert haben und nun realisieren, dass das Unausweichliche Realität geworden ist.
Dem gegenüber zeigen Patienten mit akutem Verlust der Nierenfunktion erhebliche Anzeichen der Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit. Dies war bei den weiblichen Patienten ausgeprägter als bei den männlichen Patienten. Das Ausbleiben von gezielten Fragen nach Informationen könnte hier ursächlich sein. Es entstand der Eindruck, dass die Betroffenen derart mit der Verarbeitung der Diagnose und den antizipierten Folgen beschäftigt waren, dass ein gezieltes Hinterfragen nicht in Betracht gezogen wurde bzw. einfach ausblieb. Einerseits wirken die Patienten dann sehr angepasst, verstehen scheinbar alle Zusammenhänge und haben kaum weiterführende Fragen, anderseits wünschen sie sich Zeit und haben hohen Gesprächsbedarf, der dann auf Unverständnis oder Erstaunen bei den Professionellen stößt, da sie diese Patienten anders erlebt und wahrgenommen hatten.
Informationen spielen in dieser Situation eine wichtige Rolle. „Mit Informiertheit der Patienten wachsen die Zufriedenheit mit der Therapie und das Vertrauen in die Behandlung. Information vergrößert die Wirksamkeit therapeutischer Maßnahmen vor allem durch „Entängstigung“ (51). Information schafft, so Fiedler, bessere Voraussetzungen zur aktiven und eigenverantwortlichen Beteiligung der Patienten an therapeutischen Maßnahmen. Dies dokumentierten Patienten, die im Gespräch angaben, dass sie ausreichend und umfangreich informiert wurden und diese Informationen auch verstanden hatten. Ebenso konnte in dieser Phase eine intensive Patienten-Arzt und Patienten-Pflegekraft-Beziehung aufgebaut werden, die für die spätere Behandlung als Vorteil gesehen werden kann.
Der Zeitfaktor spielte bei beiden Gruppen eine unterschiedliche Rolle. Die Betroffen, die sich langfristig entscheiden mussten, bewerteten den noch vorhanden Zeitraum der Entscheidungsfindung eher zu hoch. In ihrer Wahrnehmung hatten sie noch viel Zeit und die bis dahin erfolgreich angewandten Verdrängungsmechanismen griffen weiter. Akut Betroffene verbalisierten das Fehlen von Zeit und drängten, eventuell auch aus diesem Grund, auf schnellstmögliche Entlassung, um Zeit zu gewinnen, bevor die Entscheidung dann Endgültigkeit besitzen würde.
Des Weiteren konnte im Rahmen der Entscheidungsfindung in den Interviews bei den männlichen Patienten beobachtet werden, dass es ihnen wichtig war, die Partnerinnen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, während die weiblichen Patienten dies eher am Rande oder gar nicht erwähnten. Bei ihnen spielte die Beratung mit dem betreuenden Hausarzt/Hausärztin eher eine Rolle. Hier kann eine Parallele zur Onlinebefragung aufgezeigt werden, in der männliche Teilnehmer auch vermehrt angaben, Informationen zum Thema Gesundheit und Krankheit mit ihrer Partnerin zu besprechen (s. Tab. 3 S. 54).
9.3 Picture Story Exercise
Die von Schuldheiss differenzierten drei basalen Motivlagen konnten mit spezifischem Patientenverhalten in Verbindung gebracht werden (125). Generell kann davon ausgegangen werden, dass jede Persönlichkeit alle drei Motivlagen in sich trägt, die jeweilige Ausprägung jedoch unterschiedlich ist.
Patienten mit überwiegend leistungsorientierter Bedürfnis-/ Motivlage empfanden die Krankheit als Defizit, sie überforderten sich eher und achteten weniger auf ihre körperlichen Signale und Grenzen. Kleine Schritte im Fall der Gesundung oder Rehabilitation können nur schwer positiv bewertet werden. Sowohl positive als auch negative selbsterfüllende Prophezeiungen haben besondere Auswirkungen. Sie sind als Patienten schwer führbar, leicht frustriert und häufig unzufrieden, da sich der persönliche Leistungsanspruch nicht mit dem aktuellen Leistungsvermögen deckt. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn die Betroffenen von der Diagnose „überrascht“ werden und sich herausstellt, dass die bereits bekannten, meist als banal empfundenen und nicht zuzuordnenden Symptome, ursächlich hierfür sind.
Patienten mit einer hoher Bindungs-/ Harmoniemotivlage werden dominiert von Ängsten u.a. vor krankheitsbedingter sozialen Isolation. Es konnte beobachtet werden, dass sie sich häufig dem Phänomen des sekundären Krankheitsgewinns bedienten. Sie suchten Kontakt und fielen durch hohe Anpassung und signalisierter Hilfsbedürftigkeit auf. Sie treffen damit in der Regel den „Helfer“ im Professionellen, der sich über Kurz oder lang „ausgesaugt“ fühlt und sich distanzieren will, was mit erhöhtem Bindungsanspruch seitens des Patienten beantwortet wird. Dieses überaus angepasste Verhalten darf jedoch nicht mit hoher Kooperation und Therapietreue gleichgesetzt werden.
Patienten mit hoher Macht-/Powermotivlage empfinden den Beginn der Nierenersatztherapie als drohenden Autonomieverlust. Dieses belastet die Arzt- Patienten-Beziehung dadurch, dass der Patient sich schwer tut einem Therapieweg treu zu bleiben. Er scheint ständig auf der Suche nach Alternativen zu sein, holt sich zweite und dritte Meinungen ein und entscheidet sich dann für die Behandlungsoption, die seinem Autonomiestreben am wenigsten entgegensteht. Diese Patienten wirken nach außen recht souverän und sie empfinden die Beziehung und Kommunikation zu den Professionellen stets auf Augenhöhe. Hieraus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass sie alle Empfehlungen verstehen und abwägen können, um eine für sich angemessene Entscheidung zu treffen. Häufig wird bei diesen Patienten unbewusst oder unterbewusst eine hohe Gesundheitskompetenz vermutet.
9.4 Zweites Interview
Im zweiten Gespräch nach Aufnahme der Nierenersatztherapie waren die Patienten oftmals eher bereit, ihre Wünsche zu thematisieren und konnten verbalisieren, was sie an Unterstützung benötigt hätten bzw. aktuell benötigen würden. Wenn mit Hilfe der Interpretation der Bedürfnislage diese Wünsche bereits vor Aufnahme der Nierenersatztherapie antizipiert würden, wäre aus meiner Sicht eine noch effektivere Begleitung für den Einzelnen möglich.
Des Weiteren konnte aus den Folgeinterviews, den Patientenkontakten und den Gesprächen mit Professionellen festgestellt werden, dass die Verarbeitung des Dialysebeginns sehr unterschiedlich erfolgte und unter anderem vom Betreuungsumfang vor der Dialyse abhängig zu sein scheint. Einige Patienten erlebten die erste Phase der Dialyse durchaus positiv, die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert sich und insbesondere bei den Heimverfahren wurde das aktive eigene Handeln als positiv bewertet. Eine wiederkehrende Lebensfreude und Hoffnung, dass das Leben auch mit Dialyse zu bewältigen sei, trat ein.
Auch konnte beobachtet werden, dass Patienten, die in einem Dialysezentrum dialysiert wurden, die Lebensveränderungen häufiger als Konflikt und Belastung wahrnahmen. Sie bemerken, dass die Dialyse nicht problemlos in den Alltag integrierbar war und Resignation machte sich bemerkbar. Es traten Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit auf, je nach Persönlichkeitsstruktur auch Depression, Trotz oder Aggression. In dieser Phase wurde der Patient häufig als der „schwierige Patient“ bezeichnet. Dies war besonders bei jüngeren Patienten, Patienten die noch im Berufleben (Familienversorgung / Kinderbetreuung eingeschlossen) standen, sowie bei Patienten mit hoher Leistungs- und Bindungsmotiv zu beobachten.
9.5 Beantwortung der Forschungsfragen
Die Eingangs gestellten Forschungsfragen konnten mit der gewählten Methodik wie folgt beantwortet werden. Auf die Frage, welche Bedürfnisse Patienten in der Situation der Entscheidungsfindung haben, konnte mit Hilfe der Kategorisierung eine Antwort gefunden werden. Sie wünschen sich, dass man sich um sie kümmert, Zeit für sie hat und die Behandlung organisiert wird. Ebenso wichtig sind umfassende Aufklärung und Verständnis für ihre besondere Situation.
Wie gut Patienten in der Lage sind, diese Bedürfnisse zu artikulieren und welche Unterstützung das Gesundheitssystem an dieser Stelle bietet, kann wie folgt beantwortet werden: Patienten sind unterschiedlich befähigt, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, sie sind beeinflusst durch das empfundene Ausmaß von Bedrohung, spezifische oder unspezifische Ängste, Hoffnungslosigkeit / Hilflosigkeit, Überforderung und Verdrängung. Das derzeitige System bietet für diese Patienten wenig Unterstützungskonzepte an. Primär sind Printmedien vorhanden, die im Rahmen einer individuellen ärztlichen Beratung ausgehändigt und mehr oder weniger ausführlich besprochen werden. Unsere Erfahrungen sind, dass sich viele Patienten mit dieser Form der Beratung letztendlich alleingelassen fühlen.
Ob die verbalisierten Bedürfnisse auch den basalen Bedürfnissen (Motiven) des Einzelnen entsprechen, kann nicht mit Eindeutigkeit bejaht werden. Bei einer Mehrzahl der Patienten war eine Übereinstimmung vorhanden, aber es befanden sich auch Patienten im Kollektiv, deren geäußerte Bedürfnisse und basale Bedürfnisse nicht deckungsgleich waren. Hier wäre mit weiterführenden Untersuchungen, die sich zusätzlich auf Beobachtungen der Patienten in konkreten Situationen stützten könnten, abzuklären, welche Bedürfnisse tatsächlich vorhanden sind und wie es gelingt, ein vertieftes Verständnis für die Patienten herzustellen.
9.6 Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines Nephroguides
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines Unterstützungsinstrumente für Professionelle zur besseren Integration von Patientenbedürfnissen in die medizinische Versorgung soll nicht zuletzt vor dem Hintergrund finanzieller und personeller Ressourcenfragen im Gesundheitswesen geführt werden. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass Patienten in der Situation einer schwerwiegenden Entscheidungsfindung Hilfe und Unterstützung brauchen, auch wenn sie selbst über hinreichend Gesundheitskompetenz verfügen und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen wollen. Hier spielt die Arzt-Patienten- Kommunikation eine entscheidende Rolle, wenn es um die Wahrnehmung und Begleitung der Therapieentscheidung geht. Zu beachten ist dabei, dass die verbalisierten Bedürfnisse seitens der Betroffenen nicht unbedingt ihren basalen Bedürfnissen entsprechen.
Vorteile des Leitfadens sind, dass hier die Begleitung bei der Entscheidungsfindung durch unterschiedliche Behandler und Betreuer vorgeschlagen wird, die natürlich eng miteinander kooperieren müssen, um nicht den ohnehin vorhandenen Eindruck einer wenig abgestimmten Therapie noch zu verstärken. Zudem wird angeregt, unterschiedliche Medien und Methoden der Vermittlung einzusetzen, da sich die Patienten aus den unterschiedlich dargebrachten Informationen (Bildmaterial, Schriftliches Material, Modelle, Filme) diejenige Erklärung herausfiltern kann, die seinem Verstehen am nächsten kommt. Da alle Wahrnehmungsbereiche integriert werden, wird der primär visuell orientierte Betroffene genauso angesprochen wie der auditiv oder kinästhetisch orientierte Betroffene. Durch die mehrmalige Wiederholung der Erklärung bzw. der Informationsvermittlung durch unterschiedliche Personen sind auch Sympathieund Antipathieeffekte, die sich hinderlich auf die Entscheidungsfindung auswirken könnten, nivelliert.
Insgesamt ist die Begleitung der Patienten mit Hilfe des Leitfadens zwar aufwendiger und zeitintensiver als die bisher herrschende Routineversorgung, kann aber mittel- und langfristig zur Verbesserung der Kooperation und Therapietreue sowie nachhaltig zur Patientenbindung beitragen. Ob dadurch die Patientenzufriedenheit und Lebensqualität der Betroffenen verbessert wird, ist anzunehmen und sollte in weiterführenden Studien untersucht werden. Ebenso könnte eine Analyse der medizinischen Outcomes, wie Komplikationsraten weiterführende Erkenntnisse zur Effektivität eines Nephroguides liefern.
10 Ausblick
Das Instrument Nephroguide soll zukünftig im stationären Bereich in der Abteilung Nephrologie der Medizinischen Hochschule getestet werden und auch in den ambulanten Einrichtungen des KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. zur Unterstützung der Patienten während der Entscheidungsfindung und -umsetzung zum Einsatz kommen.
Um die mittel- und langfristige Wirksamkeit des Instrumentes, den Nutzen für den Patienten sowie die ökonomischen Vorteile beurteilen zu können, müsste der Einsatz kontrolliert erfolgen. Begleitende Befragungen der Patienten, die Erfassung der Lebensqualität sowie eine Kostenanalyse bezüglich der Komplikationen, stationärer Aufenthalte und eventuell die Transplantatverlustrate sollten dazu durchgeführt werden.
Auch sollte die Akzeptanz des Nephroguide bei Ärzten und Pflegepersonal überprüft und die Handhabung sowie die Inhalte gemeinsam mit den Akteuren und den Patienten kontinuierlich weiter entwickelt werden.
11 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Bedürfnissen von Menschen, die mit einer gesundheitsbezogenen Entscheidungssituation konfrontiert sind, die ihr Leben maßgeblich beeinflusst. Am Beispiel von Personen mit einer chronischen Nierenerkrankung wird unter Einsatz qualitativer Forschungsmethoden untersucht, ob und wie Betroffene ihre Bedürfnisse verbalisieren, welche möglicherweise nicht ausgesprochenen Wünsche und Ängste bzw. Motivstrukturen sie haben und welche Erwartungen sie insbesondere im Zusammenhang mit Entscheidungssituationen an Professionelle im Gesundheitswesen haben.
Der theoretische Teil der Arbeit thematisiert das Dreiecksdiagramm der Entscheidungsfindung. Hier werden unterschiedliche Perspektiven auf Gesundheit, Krankheit und damit verbundene Entscheidungen aufgegriffen und aus der Perspektive der Gesellschaft, der Professionellen und der Patienten erörtert. Auf der Basis dieser theoretischen Vorüberlegungen, ergänzt um unterschiedliche psychologische und soziologische Perspektiven auf Entscheidungen, erfolgt die eigene, qualitative Untersuchung.
In der Studie wurden 23 Leitfadeninterviews mit Patienten mit Nierenerkrankungen in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung durchgeführt (12 Frauen, 11 Männer). Ergänzend wurden die Befragten gebeten, speziell entwickeltes Bildmaterial zu beschreiben (Picture Story Exercise), um über diesen Zugang und die damit intendierte andere Kommunikationsebene einen Eindruck vom Erleben ihrer Situation in einer Entscheidungsphase zu ermöglichen. Von 11 Patienten konnten solche Daten gewonnen werden. Eine zweite Befragung sechs Monate nach dem ersten Interview wurde genutzt, um mit den Befragten (10 Personen) retrospektiv die Situation zu Beginn der Studie zu reflektieren.
Die Analysen zeigten: Bei der Diagnoseübermittlung sind die akut betroffen Patienten eher überfordert und können ihre Wünsche nicht dezidiert artikulieren. Patienten, die vor diesem Hinterrund eher wenige Fragen stellen, werden von den Professionellen häufig so eingestuft, als hätten sie alles verstanden. Patienten, die langfristig betreut werden, verdrängen oft die Niereninsuffizienz und die auf sie zukommenden Entscheidungen, sie verleugnen Symptome oder deuten sie falsch und setzen Therapieempfehlungen bzw. Verhaltensänderungen nicht adäquat um.
Die Bedürfnisse, die die Betroffenen formulieren, spiegeln ihre basalen Motive nach Harmonie, Leistung oder Power wider, allerdings lassen sich diese Übereinstimmungen nicht in allen Fällen belegen. Idealtypisch gesehen empfinden Patienten mit überwiegend leistungsorientierter Bedürfnis-/ Motivlage die Krankheit als Defizit, sie überforderten sich eher und achteten weniger auf ihre körperlichen Signale und Grenzen. Patienten mit einer hoher Bindungs-/ Harmoniemotivlage werden dominiert von Ängsten, unter anderem vor krankheitsbedingter sozialer Isolation. Patienten mit hoher Macht-/Powermotivlage empfinden den Beginn der Nierenersatztherapie als drohenden Autonomieverlust.
Alle Patienten wünschen sich primär eigene Zeit, um sich mit der Situation und den bevorstehenden Veränderungen auseinanderzusetzen. Die Entscheidung selbst wollen die meisten Befragten allein treffen, weil sie zu Recht formulieren, dass sie mit der Entscheidung leben müssen. Bei genauer Analyse wird dann jedoch auch deutlich, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Erkrankung angemessene Unterstützung durch Professionelle, aber auch durch Angehörige und andere Betroffenen erforderlich ist. Wichtig ist es den Patienten in dieser Phase, dass auf der einen Seite ihre Eigenständigkeit beachtet wird, die Professionellen jedoch auf der anderen Seite Verantwortung im Sinne ihres Expertentums übernehmen. Adäquate Informationen zum richtigen Zeitpunkt sind dafür zentrale Grundlagen, ebenso relevant ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Behandelndem und Patienten. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Hausärzte, die häufig als "Interpretatoren" von Informationen, die die Menschen in der stationären Behandlung zwar bekommen, aber nicht verstanden haben, gewünscht werden.
Für den Umgang Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen ergeben sich aus der Arbeit folgende Hinweise: Professionelle sollten Spielräume für partnerschaftliche bzw. eigenverantwortliche Entscheidungen bei den Patienten fördern, aber auch in Fällen, in denen Patienten von der Situation überfordert sind, hilfreiche Unterstützung anbieten. Dazu gehört, dass verbal und nonverbal Räume für ausführliche Gespräche zur Verfügung gestellt werden und Professionelle lernen, auf explizite und implizite Signale der Patienten zu hören. In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, neben der Sachaussage auch auf die Wortwahl und häufig wiederkehrende Begriffe bzw. Argumente zu hören, in denen ein besonders Harmonie, Leistungs- oder Machtmotiv anklingt, um auf dieser Ebene die eigenen Argumente bzw. Verhaltensweisen anzugleichen.
Die Ergebnisse der Untersuchung münden in einen Leitfaden für Professionelle, der sich an den ermittelten Bedürfnissen der Betroffenen orientiert und sich jetzt in der Erprobung befindet. Er soll zur Verbesserung der Patientenversorgung, der Kooperation aller an der Behandlung beteiligten und der Arzt-Patienten-Beziehung beitragen.
12 Literatur
1. Abel, A. (2006): Dialyse und Depression - Ergebnisse einer Patientenumfrage, Kiel, 2006
2. Ahrens, D. (2004): Gesundheitsökonomie und Gesundheitsförderung. Eigen- verantwortung für Gesundheit? In: Das Gesundheitswesen, Jg. 66, H. 4, S. 213- 221, 2004
3. Albers, T. (2004): Arzt im Fitness-Studio, Physician in the fitness studio, Zeitschrift Sportmedizin 0502 S. 142, 2004
4. Albs, B. (1997): Verantwortung übernehmen für Handlungen und deren Folgen, Verlag D. Kovac, Hamburg, 1997
5. Arnold, N. (2006): Gesundheitskompetenz ausbauen. Grundsatzpapier zur strategischen Weiterentwicklung der Gesundheitsforschung. Konrad-Adenauer- Stiftung (Hg.). Sankt Augustin, 2006
6. Atteslander, P. (2000): Eigenverantwortung - Prävention. In: Das Gesundheitswesen, Jg. 62, H. 1, S. 35-39, 2000
7. Auhagen, A. E. (1999): Die Realität der Verantwortung, Hogrefe Verlag für Psychologie, Göttingen, 1999
8. Bahr, D. (2007): Eine Reform mit Langzeitwirkung. Plädoyer für das Prinzip Eigenverantwortung im Gesundheitswesen /. In: Auf der Suche nach der besseren Lösung, S. 41-49, 2007
9. Balint, M. (2001): Der Arzt, sein Patient und die Krankheit, Klett-Cotta, 10., veränd. Auflage, Stuttgart, 2001
10. Bamberger, J. (2000): Eigenverantwortung und Prävention im Spannungsfeld der Gesundheitssysteme. In: Das Gesundheitswesen, Jg. 62, H. 1, S. 42-43, 2000
11. Bandura, B. (2005): Versicherten- und Patientenorientierung - ein Gebot der Humanität und der sozialwirtschaftlichen Vernunft, Psychomed, 17(1) 4-6, 2005
12. Bauch, J., Hörnemann, G. (Hrsg.) (1996): Gesundheit im Sozialstaat. Konstanzer Schriften zur Sozialwissenschaft. Hartung Gorre Verlag. Konstanz, 1996
13. Becker, H. (1984): Die Bedeutung der subjektiven Krankheitstheorie des Patienten für die Arzt-Patienten-Beziehung. In: Psychotherapie, Psychosomatik, Med. Psychologie 34, 313-321, 1984
14. Bengel, J., Belz-Merk, M. (1997): Subjektive Gesundheitsvorstellungen. In Schwarzer, R. (Hrsg): Gesundheitspsychologie. Lehrbuch, Hogrefe, S. 23-41, Göttingen, 1997
15. Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) (2004): Eigenverantwortung. Ein gesundheitspolitisches Experiment. Gütersloh, 2004
16. Bircher, J., Wehkamp, K.-J. (2006): Das ungenutzte Potential der Medizin, Analyse von Gesundheit und Krankheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts, rüffer & rub Sachbuchverlag, Zürich, 2006
17. Böcken, J. (2004): Jan Böcken, Bernard Braun, Melanie Schnee (Hrsg.) (2004): Gesundheitsmonitor 2004 ambulante Versorgung aus Sicht von Bevölkerung und Ärzten, S. 88-100, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2004
18. Böker, W. (2003): Der fragmentierte Patient. Dtsch. Ärzteblatt 2003; 100: A 24-27 Heft 1-2, 2003
19. Bölts, J. (2004): Lernziel Gesundheitskompetenz. Der Beitrag des Qigong zur zukunftsfähigen Gesundheitsbildung in der Schule. Nachdruck., (Theorie & Praxis des Qigong) Oldenburg, 2004
20. Borgetto, B., Kälbe, K. (2007): Medizinsoziologie, Sozialer Wandel, Krankheit, Gesundheit und das Gesundheitssystem, Juventa Verlag, Weinheim, 2007
21. Bosshart, D. (1998): Die Zukunft des Konsums - Wie leben wir morgen, Econ Verlag, Zürich, 1998
22. Breuch, G. (2008): Fachpflege Nephrologie und Dialyse, Urban & Fischer Verlag, München, 2008
23. Brieskorn-Zinke, M. (1992): Zur Aneignung von Gesundheitskompetenz. Genuss und Risiko.; Ein Seminarbeispiel zur Gesundheitsförderung. In: Sozialmagazin, Jg. 17, H. 7/8, S. 43-49, 1992
24. Brown, J.B. Stewart., M., Ryan, B.L. (2001): Assessing communication between patients and physicians (2001): The measure of patient-centered communication, London: Centre for Studies in Family Medicine, (Working Paper Series 95-2, 2nd edition), 2001
25. Büchi, M. (2000): Alle Macht den Patienten? Vom ärztlichen Paternalismus zum Shared Decision Making, Schweizerische Ärztezeitung, 49, 2776-2780, Zürich, 2001
26. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2001: Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklung in Ost und West. Schriftenreihe des BMFSFJ, Bd.209, Kohlhammer, Berlin, 2001
27. Burkhardt, R. (2005): Neuorientierung des Gesundheitswesens., in VAS, Verl. für Akad. Schriften, Frankfurt am Main, 2005
28. Burrmann, U. (Hrsg.) (2005): Sport im Kontext von Freizeitengagements Jugendlicher. Köln Sport und Buch Strauß, Köln, 2005
29. Buyx, A. M. (2005): Eigenverantwortung als Verteilungskriterium im Gesundheits-wesen. Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung, 2005
30. Campbell, C. (1987): The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Oxford, 1987
31. Charles, C., Gafni, A., Whelan, T. (1999): Decision-making in the physicianpatient encounter: revisiting the shared treatment decision-making model. Soc Sci Med 1999; 49: 651-661, 1999
32. Coulter, A., Entwistle, V, Gilbert, D. (1999): Sharing decisions with patients: is the information good enough? BMJ 1999; 318: 318-322, 1999
33. Cross, G. (2004): Interview in „Die Zeit“ Konsum statt Freundschaft, geführt von Thomas Fischmann, Die Zeit 30.09.2004 Nr. 41, 2004
34. Czypionka, T. (2007): Konsumentenschutz im Gesundheitswesen - eine internationale Perspektive, Health System Watch, Beilage zur Fachzeitschrift Soziale Sicherheit, Institut für höhere Studien IHS HealthEcon, Wien, 2007
35. Dahlbert, C. (1980): Verantwortlichkeit und Handeln, Universität Trier, Fachbereich I - Psychologie, Bereicht aus der Arbeitsgruppe, Trier, 1980
36. Dierks, M.-L. (1995): Frauen und Krebsfrüherkennung - subjektive Theorien von Frauen im Krebsfrüherkennungsprogramm. Hannover: Dissertation an der Medizinischen Hochschule Hannover; 1995
37. Dierks, M.-L. (2001): Patientensouveränität. Der autonome Patient im Mittelpunkt /. Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in BadenWürttemberg (Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in BadenWürttemberg, 195), 2001
38. Dierks, M.-L., Seidel, G., Lingner, H., Schneider, N., Schwartz, F.W. (2007): Die Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule Hannover, Zeitschrift Managed Care. 7/8, S.34-40, 2007
39. Dietz, B. (2006): Patientenmündigkeit. Messung, Determinanten, Auswirkungen und Typologie mündiger Patienten /. 1. Aufl. Wiesbaden: Dt. Univ.- Verl. (Gabler Edition Wissenschaftl. Schriftenreihe des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung, Universität Mannheim), Mannheim,. 2006
40. Dötsch, J. (2007): Niereninsuffizienz in Reinhardt, D. (Hrsg): Therapie der Krankheit im Kindes- und Jugendalter, Springer Verlag, Berlin und Heidelberg, 2007
41. Donges, J.- B. (2002): Mehr Eigenverantwortung und Wettbewerb im Gesundheitswesen. Stiftung Marktwirtschaft (Schriftenreihe, 39), Berlin, 2002
42. Dreßler, W. (2002): Angebot und Nutzerstrukturen bei kommerziellen Fitnessstudios - eine soziologisch- empirische Untersuchung in Fitnessstudios und Sportvereinen in der Stadt Viersen. Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, 2002
43. Eigenverantwortung, Wettbewerb und Solidarität. Analyse und Reform der finanziellen Anreize im Gesundheitswesen (2007). Bern: SGGP-Verl. (Schriftenreihe der SGGP), Bern, 2007
44. Eigenverantwortung. Ein gesundheitspolitisches Experiment (2004). Verlag Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh, 2004
45. Elwyn, G., Edwards, A., Gwyn, R., Grol, R. (1999): Towards a feasible model for shared decision-making: perceptions and reactions of registrars in general practice. BMJ 1999; 319: 753-7, 1999
46. Emanuel, E.J., Emanuel, L.L. (1992): Four models of the physician-patient relationship. JAMA 1992; 267: 2221-2226, 1992
47. Engel, G.L. (1977): The need for a new medical model: A challange for biomedicin Science, 196 S. 129-136, 1977
48. Faltermaier, T. (1998): Subjektive Konzepte von Theorien von Gesundheit: Stand und Praxisrelevanz eines gesundheitswissenschaftlichen Forschungsfeldes. In: U. Flick (Hrsg.): Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellung von Gesundheit und Krankheit, Juventa, S. 70-86, Weinheim/München ,1998
49. Faltermaier, T., Kühnlein, I. (2002): Subjektive Gesundheitskonzepte im Kontext: Dynamische Konstruktionen von Gesundheit in einer qualitativen Untersuchung von Berufstätigen. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie 2002; 8, 137-154, 2002
50. Faltermaier, T. (2005): Subjektive Konzepte und Theorien von Gesundheit und Krankheit, in Schwarzer, R. (Hrsg): Gesundheitspsychologie, Enzyklopädie der Psychologie, Hogrefe, S. 31-53, Göttingen, 2005
51. Fiedler, P. (2000): Integrative Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen, , Hogrefe, S.82, Göttingen, 2000
52. Fischer, B., Fischer, U., Lehrl, S. (1981): Zeitgemäße Lebensweise (Gesundheit) in Eigenverantwortung. In: Das öffentliche Gesundheitswesen, Jg. 43, H. 4, S. 177-184, 1981
53. Fischer, C.S. (1977): Perspectives on Community and Personal Relations. In: Fischer, C.S., Jackson, R.M.; Stueve, C.A., Gerson,K., Jones,L.M., Badassarge,M.: Networks and Places, Social Realtions in the Urban Setting, S. 1- 16, New York,1977
54. Frank, U., Belz-Merk, M. et al (1998): Subjektive Gesundheitsvorstellungen gesunder Erwachsener. In Flick, U. (Hrsg:): Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit, Juventa, S. 57-69 Weinheim,1998
55. Franke, A. (2006): Modelle von Gesundheit und Krankheit, Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern, 2006
56. Franke, R. (1994): Ärztliche Berufsfreiheit und Patientenrechte - Eine Untersuchung zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen des ärztlichen Berufsrechtes und des Patientenschutzes, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1994
57. Frei, U., Schober-Halstenberg, (2008): Nierenersatztherapie in Deutschland, bericht über Dialysebehandlung und Nierentransplantation in Deutschland 2006/2007, QuaSie-Niere, Bundesverband Niere e.V., Mainz, 2008
58. Fritschka, E., Mahlmeister, J. (2002): Gesundheitstrainingsprogramm für chronische Nierenkranke. Pabst Science Publishers, Verlag, S. 1-152 Lengerich, Berlin, Bremen, Riga, Rom, Viernheim Wien, Zagreb, 2002
59. Fritschka, E., Mahlmeister, J., Liebscher-Steinecke, R., Schätzlein, S., Enderlein-Frank, E. (2000): Rehabilitation bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, Dialysepatienten und nach Nierentransplantation. Nieren- und Hochdruckkrankheiten 29(11), S. 555-565, 2000
60. Fritschka, E., Mahlmeister, J., Enderlein-Frank, E., Liebscher-Steinecke, R. (2000): Eine prospektive Studie zum Langzeiteffekt eines neuen multidisziplinären Gesundheitstrainings für nierenkranke Patienten mit Bluthochdruck im Rahmen der stationären Rehabilitation. Nieren- und Hochdruckkrankheiten 29(12), S. 635-627, 2000
61. Fritzen, F. (2006): Gesünder leben, Die Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2006
62. Geisler, L.S. (2003): Der mündige Patient ist ein Phantom. In: AOK-Forum "Gesundheit und Gesellschaft", Jg. 6. Jahrgang, Ausgabe 9/2003, S. 3, 2003 62b. Gottburgsen, A. (2000): Stereotype Muster des sprachlichen Doing Gender. Eine empirische Untersuchung, Westdeutscher Verlag, Opladen, 2000
63. Heath, A. (1976): Rational Choice & Social Exchange: A Critique of Exchange Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 1976
64. Haisch, J. (2002): Der mündige Patient und sein Arzt. Wie der Arzt die Eigenverantwortung des Patienten fördern kann; Ein Trainingsprogramm, Heidelberg 2002
65. Hallauer, J. F. (2000): Eigenverantwortung - Prävention. In: Das Gesundheitswesen, Jg. 62, H. 1, S. 40-41, 2000
66. Heidbrink, L. (2007): Handeln in der Ungewissheit - Paradoxien der Verantwortung, Kulturverlag Kadmos, Berlin, 2007
67. Helfferich, C. (1993): Das unterschiedliche „Schweigen der Organe“ bei
Frauen und Männern - subjektive Gesundheitskonzepte und „objektive
Gesundheitsdefinitionen“. In Franke, A, Broda, M. (Hrsg.): Psychosomatische Gesundheit. Versuch und Abkehr vom Pathogenese-Konzept, Tübingen, dgvtVerlag 1993, S. 35-65, 1993
68. Herzlich, C. (1973): Health and illness. A social psychological analysis, London, 1973
69. Hodel, B. (1991): Gesundheitspolitik zwischen Freiheit und Paternalismus. E. ordnungstheoretische Analyse der Möglichkeiten und Grenzen liberaler Ordnungskonzepte für den Gesundheitsbereich unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse, Zürich, 1991
70. Hurrelmann, K. (2000): Gesundheitssoziologie, Juventa (5. Auflage) Weinheim, 2000
71. Hurrelmann, K., Lösel, F. (1990) Health Hazards in Adolescence. De Gruyter Berlin/New York, 1990
72. Hutter, J. (2004): Kompetenzfeststellung. Verfahren zur Kompetenzfeststellung junger Menschen, Expertise, Bonn, 2004
73. Jager, K.J. (2004): Am J Kidney Dis 43 (5): 891; Gomez, CF. et al. (1999) PDI 19:471, 2004
74. Keller, C.K. (2007): Praxis der Nephrologie, Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, 2007
75. Jung, B. (1999): PDI 19:263; Jassal, SV. (2008) NDT 12:474, 1999
76. Kessels, J. (1983): Das kirchliche Krankenhaus zwischen Eigenverantwortung und Fremdbestimmung. Überlegungen zur Sicherung d. kirchlichen Krankenhauses in der gegenwärtigen Krankenhaussituation, Kath. Krankenhausverb. Deutschlands, Freiburg i.Br., 1983
77. Kickbusch, I. (2006): Die Gesundheitsgesellschaft, Verlag für Gesundheitsförderung, Zürich, 2006
78. Kickbusch, I.; Marstedt, G. (2008): Gesundheitskompetenz. eine unterbelichtete Dimension sozialer Ungleichheit. In: Gesundheitsmonitor, S. 12-28, 2008
79. Klingenberg, A., Bahrs, O., Szecsenyi, J. (1999): Wie beurteilen Patienten Hausärzte und ihre Praxen? Deutsche Ergebnisse der europäischen Studie zur Bewertung hausärztlicher Versorgung durch Patienten (EUROPEP). Z. ärztl. Fortbild. Qualitätssicherung; 93: S. 437-445, 1999
80. Klingenberg, A., Bahrs, O., Szecsenyi, J. (1996): Was wünschen Patienten vom Hausarzt? Erste Ergebnisse einer europäischen Gemeinschaftsstudie. Z Allg Med 1996; 72: 180-186, 1996
81. Koch, K.-M. (1999): Klinische Nephrologie, Urban & Fischer Verlag, München, 1999
82. Kolip, P. (Hrsg.) (1994): Lebenslust und Wohlbefinden - Beiträge zur geschlechtsspezifischen Jugendgesundheitsförderung, Juventa, Weinheim und München, 1994
83. Kramer, A., Siegrist, J. (1973): Soziale Schicht und Krankheitsverhalten - Eine Kontrollstudie. In: Enke H, Pohlmeier H (Hrsg.): Psychosoziale Rehabilitation, Hippokrates Verlag, S.119-131, Stuttgart, 1973
84. Kroeber-Riel, W. (1998): Kommunikative Beeinflussung in der GesellschaftKontrollierte und unbewusste Anwendung von Sozialtechniken, Gabler Verlag Deutscher Universitäts- Verlag, Wiesbaden, 1998
85. Krpi´c-Mocilar, T. (2003): Mitverantwortung für die eigene Gesundheit. Hamburg: Kovac (Schriftenreihe Studien zur Rechtswissenschaft, 122)
86. Kühn, H. (1997): Managed Car, Medizin zwischen kommerzieller Bürokratie und integrierter Versorgung. Am Beispiel USA (Veröffentlichungsreihe der Arbeitsgruppe Public Health, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, S. 97-2202,WZB, Berlin , 1997
87. Kuhlmann, U. (2008): Nephrologie, Pathophysiologie-Klinik- Nierenersatztherapie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2008
88. Kummer, K. R. (1998): Der mündige Patient. Freiheit im Gesundheitswesen - eine Utopie? Bad Liebenzell: Verein für Anthroposophisches Heilwesen (Aktuelle Themen), 1998
89. Land, W. ( 2004): Evaluations-Manual Nierentransplantation, Thieme-Verlag, Stuttgart, 2004
90. Lay, R. (2004): „Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung.“ Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 2004
91. Leydon, G.M., Boulton, M., Jones, A., Mossman, J., McPherson, K. (2000): Faith, hope, and charity: an in-depth interview study of cancer patients’ information needs and information-seeking behavior. WJM; 173: S.26-31, 2000
92. Little, P., Everitt, H., Williamson, I., Warner, G., Moore, M., Gould, C. et al. (2001): Preferences of patients for patient centred approach to consultation in primary care: observational study. BMJ; 322: S.468-72, 2001
93. Lundy, A. (1988): Instructional set and Thematic Apperception Test validity. Journal of Personality Assessment, 52, S. 309-320. (neutral condition instructions), 1998
94. Maguire, P., Pitceathly, C. (2002): Key communication skills and how to acquire them. BMJ; 325: S. 697-700, 2002
95. Mahlmeister, J. (2003): Evaluation der Schulung von nierenkranken Patienten im Rahmen der stationären Rehabilitation - Ein neues Gesundheitstrainingsprogramm für chronische Nierenkranke, Charite Berlin) Diss. Berlin, 2003
96. Marfan Stiftung Schweiz; Hagmann, A. (Hrsg.) (2008): Herzsache. Gesundheitskompetenz und Empowerment bei chronischen körperlichen Beeinträchtigungen am Beispiel des Marfan-Syndroms: inforce - Gesundheits- und Umweltinformation, Zürich, 2008 96b. Mayring, P. (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (7. Auflage, erste Auflage 1983). Weinheim: Deutscher Studien Verlag 2000
97. McAlister, F.A., O’Connor, A.M., Wells, G., Grover, S.A., Laupacis, A. (2000): When should hypertension be treated? The different perspectives of Canadian family physicians and patients. CMAJ; 163: S.403-408, 2000
98. McClelland, D. C. (1975): The inner experience, Irvington Publishers. (couple in nightclub) New York, 1975
99. McClelland, D. C., Steele, R. S. (1972): Motivational workshops, General Learning Press. (boxer), New York, 1972
100. McKinstry, B. (2000): Do patients wish to be involved in decision making in the consultation? A cross sectional survey with video vignettes. BMJ; 321: S. 867- 871, 2000
101. Mehr Eigenverantwortung und Wettbewerb im Gesundheitswesen (2002).: Stiftung Marktwirtschaft (Schriftenreihe / Stiftung Marktwirtschaft), Berlin, 2002
102. Mendelsohn, D.C. (2004): A sceptical view of assisted home peritoneal dialysis, Am J Kidney Dis 43 (2004)
103. Mullen, P.D. (1997): Compliance becomes concordance. BMJ; 314: S. 691- 692, The Health Center, Linton, Cambridge1997
104. Neubauer, B. (1998): Eigenverantwortung - Positionen und Perspektiven, Licet Verlag, Waake, 1988
105. Noeske, U. (2002): Die Diskussion um die Eigenverantwortung des Patienten im deutschen Gesundheitswesen vor dem Hintergrund der Rationierungsdebatte, Diss., Hannover, 2002
106. Nutbeam, D. (2000): Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21 st century. Health Promotion International 15(3), S. 259-267
107. Oldhafer, M. (2007): Expertenwissen im Gesundheitswesen Chancen und Barrieren, Masterarbeit, HWP, Hamburg, 2007
108. Pang, J. S., Schultheiss, O. (2005): Assessing implicit motives in U. S. college students: Effects of picture type and position, gender and ethnicity, and cross-cultural comparisons. Journal of Personality Assessment, 85(3), S. 280-294, Chicago, 2005
109. Patientensouveränität: Der autonome Patient im Mittelpunkt. Akad. für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg (Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg), Stuttgart, 2001
110. Quass, W. (1994): Arbeitswissenschaftlich orientierte Gesundheitsförderung in der Arbeit - konzeptionelle Aspekte und empirische Grundlagen. In B. Bergmann & P. Richter (Hrsg.) Die Handlungsregulationstheorie. Von der Praxis einer Theorie, Hogrefe, S. 175-197, Göttingen, 1994
111. Reibnitz, Ch. v, Schnabel, P., E.; Hurrelmann, K. (Hrsg.) (2001): Der mündige Patient. Konzepte zur Patientenberatung und Konsumentensouveränität im Gesundheitswesen. Rosenbrock, R.: Verbraucher, Versicherte und Patienten als handelnde Subjekte Juventa, S. 25-35, Weinheim, 2001.
112. Robert-Koch-Institut (2004): Schlussbericht: Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme des deutschen Gesundheitswesens und mögliche Steuerungsmechanismen, Berlin, 2004
113. Rohr, M. (2000): Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Gesund- heitswesen. Ergebnisse des Workshops zu Forschungsbedarf im Bereich Medizin und Gesundheit, Akad. für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg (Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg), Stuttgart, 2000
114. Rosen, P., Anell, A., Hjortsberg, C. (2001): Patient views on choice and participation in primary health care. Health Policy 2001; 55: S. 121-128, 2001
115. Rosenbrock, R. (2001): Verbraucher, Versicherte und Patienten als handelnde Subjekte Rosenbrock, R.: Verbraucher, Versicherte und Patienten als handelnde Subjekte. In: Reibnitz, C. v./Schnabel, P.-E./Hurrelmann, K. (Hg.): Der mündige Patient. Konzepte zur Patientenberatung und Konsumentensouveränität im Gesundheitswesen., Juventa, S. 25-34, Weinheim, München, 2001
116. Rütten, A., Ziemainz, H., Röger, U. (2005): Qualitätsgesichertes System der Talentsuche, -auswahl und -förderung. Theoretischer Ansatz, Methode, erste Ergebnisse. In E. Emrich, A. Güllich & M.-P. Büch, Beitr ä ge zum Nachwuchsleistungssport, Hofmann S. 45-74, Schorndorf, 2005
117. Scheibler, F. (2004): Shared Decision - Marking, von der Compliance zur partnerschaftlichen Entscheidungsfindung, Huber Verlag, Bern, 2004
118. Scheibler, F., Pfaff, H. (2004): Shared Decision-Marking. Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess, Juventa, Weinheim, 2004
119. Schmeinck, W. (2007): Mehr Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Leerformel oder echte Chance? 2007
120. Schmidt, B. (2008): Eigenverantwortung haben immer die Anderen. Der Verantwortungsdiskurs im Gesundheitswesen. 1. Auflage Huber, Bern, 2008
121. Schmidt, B.; Kolip, P. (2007): Gesundheitsförderung im aktivierenden Sozialstaat. Präventionskonzepte zwischen Public Health, Eigenverantwortung und sozialer Arbeit, Grundlagentexte Gesundheitswissenschaften, Juventa, Weinheim, 2007
122. Schnabel, P-E. (2007): Gesundheit fördern und Krankheit prävenieren. Besonderheiten, Leistungen und Potentiale aktuelle Konzepte vorbeugenden Versorgungshandelns, , Juventa, S. 35-36, Weinheim u. München, 2007
123. Schönbach, P., Bergmann, D. (1994): Was heißt Verantwortung? Begriffs- bestimmung unter dem Einfluss von Geschlechtszugehörigkeit und Kontrollüberzeugung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 25(3) S. 192-207, 1994
124. Schultheiss, O. C., Brunstein, J. C. (2001): Assessing implicit motives with a research version of the TAT: Picture profiles, gender differences, and relations to other personality measures. Journal of Personality Assessment, 77(1), S. 71-86, Chicago, 2001
125. Schultheiss, O. C., Pang, J. S. (2004): Measuring implicit motives. In R. W. Robins, R. C. Fraley & R. Krueger (Eds.), Handbook of Research Methods in Personality Psychology. New York, 2004
126. Schweizerische Eidgenossenschaft (2007): Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB), Bundesamt für Sport BASPO, Magglingen, 2007
127. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Ergebnisse des Workshops zu Forschungsbedarf im Bereich Medizin und Gesundheit (2000).: Universität Stuttgart / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg Senatsverwatung für Arbeit, Soziales und Frauen,: Gesundheitsberichtserstattung Berlin, Basisbericht 2001, Hrsg: Referat, Quantitative Methoden, Gesundheitsberichtserstattung, Epidemiologie, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme, ISSN 1617-9242, Berlin, 2001
128. Sichrovsky, P. (1984): Krankheit auf Rezept- Die Praktiken der Praxisärzte, Kiepenhauer&Wisch, Köln, 1984
129. Smith, C. P. (1992): Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. Cambridge University Press, New York, 1992
130. Solidarität braucht Eigenverantwortung. Orientierungen für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem; Mai 2003 (2003): Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Die deutschen Bischöfe : 2, Erklärungen der Kommissionen), Bonn, 2003
131. Steel, N. (2000): Thresholds for taking antihypertensive drugs in different professional and lay groups: questionnaire survey. BMJ; 320: S.1446-1447, 2000
132. Stewart, M.A., Brown, J.B., Donner A., McWhinney, I.R., Oates, J., Weston, W.W., Jordan, J. (2000): The impact of patient-centered care on outcomes. Journal of Family Practice, 49; S. 796-807, 2000
133. Stillfried, D. von (1996): Gesundheitssysteme im Wandel. Das Dilemma zwischen Bedarfskonzept und Eigenverantwortung: medizinische Grundsicherung als Reformperspektive? Eine evolutorische Analyse. Verlag P.C.O. (Schriften zur Gesundheitsökonomie, 16), Bayreuth, 1996
134. Stark, W. (2003): Empowerment. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung, Fachverlag Peter Sabo, S. 28-31, Schwabenheim a.d. Selz, 2003
135. Streich, W., Klemperer, D., Butzlaff, M. (2002): Partnerschaftliche Beteiligung an Therapieentscheidungen. In: Böcken J, Braun B, Schnee M (Hrsg.): Gesundheitsmonitor 2002,Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2002
136. Teichert, T. (2008): „Health Styles“ Die Trendstudie von health living. Ergebnisbericht der Studie zum deutschen Gesundheitsmarkt. Hamburg, 2008
137. Thielmann, L. (2002): Szenarien für mehr Selbstverantwortung und Wahlfreiheit im Gesundheitswesen, Akad. für Technikfolgenabschätzung in Baden- Württemberg (Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden- Württemberg), Stuttgart, 2002
138. Veblen, Th. (1997): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen, Frankfurt/ Main, 1997
139. Wenzel, E. (2006): Gesundheit 2010 - Health 2010, Gesundheitstrend heraus-gegeben: Zukunftsinstitut GmbH, Kelkheim, 2006
140. Weinert, F. E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Weinert, F.E. (Hrsg.) Leistungsmessung in Schulen 2001, Juventa, S. 17-32, Weinheim, 2001
141. Widmer, W., Beck, K., Boos, L., Steinmann, L., Zehnder, R. (2007): Eigenverantwortung, Wettbewerb und Solidarität. Analyse und Reform der finanziellen Anreize im Gesundheitswesen, SGGP (Schriftenreihe der SGGP, 91) Zürich, 2007
142. Winter, D. G. (1992): Power motivation revisited. In C. P. Smith (Ed.), Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis, Cambridge University Press, S. 301-310, New York, 1992
143. Wendt, C., Wolf, C. (Hrsg.) (2006): „Soziologie der Gesundheit“, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderhefte Bd. 46, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006
144. Zimbardo, P. G., Gerring, R. J. (1999): Psychologie. 7.Auflage. Berlin: Springer-Verlag.
Vorträge
145. Offner, G., Oldhafer, M., Breuch, K. (2007): „endlich erwachsen“ - ein Problem nicht nur für Patienten, sondern auch für Eltern und Ärzte, 1. Kieler Kinder Transplantationstag, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, 2007
146. Offner, G., Ehrich, J.H.H., Breuch, K., John, U., Oldhafer, M. (2008):
„ endlich erwachsen“ - transfer coaching for adolescents with end-stage renal disease (ESRD), 39th Annual Meeting of the European Working Group on Psychosocial Aspects of Children with Chronic Renal Failure (EWOPA), Guy’s Hospital, London, 2008
147. Offner, G., Oldhafer, M., Breuch, K., John, U. (2008): „endlich erwachsen“
- ein Schulungsprogramm für niereninsuffiziente Jugendliche vor dem Verlassen der Kinderklinik, 11. Arbeitstagung Psychosomatik in der Transplantationsmedizin, Medizinische Hochschule, Hannover, 2008:.
148. John, U., Oldhafer, M., Breuch, K., Offner, G., (2009): Transfer coaching project for adolescents with end-stage renal disease (ESRD) effect on allograft loss. Pediatr Nephrol 24: 908 (P075) APN, Amsterdam, 2009
149. John, U., Oldhafer, M., Breuch, K., Offner, G. (2009): Transfer Coaching Projecct for Adolsecents with endstage renal disease (ESRD), Effection Allograft Loss. 5th Congress of the International Pediatric Transplant Association Istanbul, April 18-21, 2009, Pediatric transplantation 13, Suppl 1: 52 (V31)
150. Oldhafer, M. (2005): 54. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin: Psychosoziale Begleitung nierenkranker Jugendlicher, Celle, 2005
151. Oldhafer, M. (2005): 14. Symposium zur psychosozialen Betreuung chron. Nierenkranker Kinder und Jugendlicher: Das Projekt „endlich erwachsen“, Essen, 2005
152. Oldhafer, M. (2005): Leberkrankes Kind - Integration in Kindergarten, Schule und Beruf, damit leberkranke Kinder von heute, unabhängige Erwachsene von morgen werden, Fulda, 2005
153. Oldhafer, M. (2006): Das Projekt endlich erwachsen, Ergebnisse nach den ersten drei Jahren, Freiburg, 2006
154. Ruder, H., Melter, M., Offner, G., Oldhafer, M., Pape, L., Pfister, E., Schmidt-Schaller, S., Ehrich, J.H.H. (2007): Modulares Rehabilitationskonzept für Kinder und Jugendliche vor und nach Leber- und Nierentransplantation, Nürnberg, 2007
155. Oldhafer, M. (2008): Endlich erwachsen, Dreiländer-Kongress Nephrologische Pflege, Konstanz, 2008
156. Oldhafer, M. (2009): Transferprogramm Endlich erwachsen - 5-Jahres- Ergebnisse, 1. Pflegefachtagung Kindernephrologie Universitätskinderspital, Zürich, 2009 Veröffentlichungen
157. Kugler, C., Oldhafer, M., Freier, C. (2009): Impact of computer-based patient education on illness-related knowledge and functional outcomes in adolescents after renal transplantation (PEDTRANS-09-O-0165) has been submitted by Dr. Christiane Kugler to Pediatric Transplantation (angenommen)
158. John, U., Offner, G., Oldhafer, M. (2009): Konzept zur Verbesserung der Adhärenz bei jungendlichen Erwachsenen nach Nierentransplantation: Vision oder Realität?, Urologe 2009, 48: S.1468-1472, Springer Medizin Verlag
159. Brunkhorst, R., Oldhafer, M. (2010): Der Soziokulturelle Wandel und sein Einfluss auf die Nephrologie, Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Nr. 39,1/1010, S.17-20
160. Oldhafer, M. (2010): Diversity Management - Einfluss auf das zukünftige Personalmanagement und die Patientenbetreuung in der Nephrologie, Die Schwester - Der Pfleger 04/2010
13 Anhänge
13.1 Fragebogen Gesundheitskonsum Onlinebefragung
13.2 Nephroguide
Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen meiner Promotion beschäftige ich mich mit dem Thema Gesundheitskonsum. Sicher fragen Sie sich was ist denn unter dem Begriff Gesundheitskonsum zu verstehen ist und welches Interesse genau besteht. Dies will ich Ihnen im Folgenden erläutern:
Unter Gesundheitskonsum wird alles verstanden, was der Mensch zum Erhalt oder zur Verbesserung seines Gesundheitszustandes aktiv tut oder verbraucht (konsumiert). Es soll damit die Gesundheitszufriedenheit, also die Zufriedenheit mit dem eigenen Gesundheitszustand, erhalten oder verbessert werden. Im Einzelnen sind damit gemeint:
1. Nahrungsergänzungsmittel, die Sie aus der Apotheke oder der Drogerie oder im Internet beziehen wie zum Beispiel Mineralien, Vitamine, Spurenelemente. Also Substanzen von denen Sie annehmen, dass sie nicht ausreichend über die tägliche Nahrung aufgenommen werden und die Sie so ergänzen oder hinzufügen.
2. Heil- und Hilfsmittel, die Sie entweder von Ihrem Hausarzt verschrieben bekommen oder die Sie mit eigenen Mittel finanzieren, weil Sie der Meinung sind, dass sie Ihnen helfen und Ihre Gesundheitszufriedenheit steigern. Dazu gehören: Massagen, Physiotherapie, Psychosoziale Beratung und Coaching, Teilnahme an Fitness-Kursen, Mitgliedschaft in Fitnesszentern, Bandagen, Blutdruckmessgeräte etc.
3. Rezeptfreie Medikamente und Homöopathische Substanzen, die Sie eigenverantwortlich erwerben oder nach Beratung in der Apotheke erwerben.
4. Arztbesuche Mit den Erkenntnissen des Fragebogens soll dann der Fragestellung nachgegangen werden, in wieweit Informationen und Wissen in diesem Bereich die Entscheidung des Einzelnen beeinflusst und was zur Sicherheit durch Unwissenheit für den Verbraucher getan werden muss.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mein Anliegen, durch die Bearbeitung des Fragebogens unterstützen könnten.
Mit freundlichem Gruß
Martina Oldhafer MBA
Gesundheits- und Sozialmanagement
155
Fragebogen „Konsum im Gesundheitswesen“
Geschlecht: männlich weiblich
Datum der Befragung (Tag / Monat / Jahr) :
Dieser Fragebogen beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheitskonsum. Dazu befragen wir anonym Personen zwischen 18 und 70 Jahren und die Studierenden an der Patienten-Uni Hannover.
Alter: ___________ Jahre
I. Entwicklung des Warenangebots
Die Entwicklung des Angebots im Gesundheitsmarkt wird in den letzten Jahren ja sehr unterschiedlich beurteilt, auch hinsichtlich der Produktvielfalt. Mich würde interessieren, was Sie darüber denken. Im Folgenden werde ich Ihnen ein paar Fragen zu diesem Thema stellen. Bitte bewerten Sie auf einer Skala 1 bis 5, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen können. 1 bedeutet dabei „stimme voll zu“, 5 bedeutet „stimme gar nicht zu“. Mit den Zahlen 2, 3 und vier können Sie Ihr Urteil abstufen.
1. Ich habe den Eindruck, dass sich die Auswahl an Produkten in den letzten Jahren stark vergrößert hat.
(gemeint sind alle Angebote im Gesundheitsmarkt wie z.B. Medikamente, Nahrungserg ä nzungsmittel, Vitamine, med. Hilfsmittel)
stimme stimme
voll zu gar
nicht zu
1 2 3 4 5
2. Die derzeitige Auswahl an Produkten im Gesundheitswesen (Apotheke, Reformhaus, Sanitätshaus, Drogeriemarkt) empfinde ich als:
zu groß
gerade passend zu gering
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen auf einer Skala 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zu? Bitte jede Frage beantworten.
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
3.1. Meine Bedürfnisse werden durch das aktuelle Produktangebot sehr gut befriedigt
3.2. Ich empfinde eine große Auswahl als Bereicherung
3.3. Ich bin der Meinung, dass es noch eine größere Auswahl geben sollte
3.4. Normalerweise fällt es mir leicht, das passende Produkt für
156
mich zu finden
3.5 Neuen Produkten gegenüber bin ich eher skeptisch eingestellt
3.6. Ich fühle mich oft überfordert, wenn ich mich zwischen vielen Produkten entscheiden muss
3.7. Ich halte die große Auswahl an Produkten für überflüssig
3.8. Das derzeitige Produktangebot ist für mich eher belastend
4. Bewerten Sie bitte folgende Aussagen auf einer Skala 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu). Jede Frage bitte beantworten.
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
4.1 Meine Bedürfnisse würden auch mit einer geringeren Produktauswahl befriedigt werden
4.2 Viele Gesundheits-Produkte ähneln sich zu sehr
4.3 Wenn ich mich beim Einkaufen nicht entscheiden kann, kaufe ich mehr als ich wollte.
4.4 Vor dem Einkauf informiere ich mich meist ausführlich über die Gesundheits-Produkte, die ich kaufen möchte.
4.5 Die Meinung von Freunden ist mir bei der Entscheidung für ein Gesundheits-Produkte sehr wichtig.
4.6 Wenn ich mit einem Produkt zufrieden bin, dann kaufe ich es wieder, ohne viel darüber nachzudenken
4.7. Ich gehe meist mit einer konkreten Kaufabsicht in ein Geschäft
II. Stellenwert Konsum
Im Folgenden geht es um den Stellenwert, den Sie persönlich bestimmten Konsumbereichen zumessen.
5. Welchen Stellenwert haben für Sie persönlich Einkäufe in folgenden Produktbereichen:
hoher
Stellenwert
5.1 Ernährung
5.2 Bekleidung
5.3 Inneneinrichtung
5.4 Telekommunikation + Foto
5.5 Unterhaltungselektronik
5.6 Freizeit + Urlaub
sehr geringer sehr
Stellenwert
1 2 3 4 5
5.7 Auto und Verkehr
5.8 Gesundheit
6. Gesundsein heißt für mich:
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
6.1 sportlich und leistungsfähig zu sein
6.2 fit zu sein und eine Figur zu besitzen
6.3 großes Wohlbefinden (seelisch, geistig, körperlich) zu haben
6.4 Krankenkassengeld einzusparen
6.5 dem eigenen Partner zu gefallen
6.6 sich selber zu gefallen
6.7 eine schöne Haut zu haben
6.8 Krankheiten vorzubeugen
6.9 auf den Körper zu achten
7. Manchmal wünscht man sich etwas, kann es sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht leisten. Wie würden Sie sich in dieser Situation verhalten, wenn es um Ihre Gesundheit ginge? Antworten Sie bitte jede Aussage mit ja oder nein.
ja nein
7.1. Ich würde darauf verzichten
7.2. Ich würde Sparen
7.3. Ich würde das Konto überziehen
7.4. Ich würde in Raten zahlen
7.5. Ich würde mir Geld von Freunden/Verwandten leihen
7.6. Ich würde einen Kredit aufnehmen
III. Im Folgenden finden Sie Gründe für den Einkauf von Gesundheitsprodukten.
Bitte beurteilen Sie auch hier wieder, inwieweit Sie diesen Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zustimmen können. Bitte jede Aussage bewerten.
8. Beim Einkauf von Gesundheitsartikel (Medikamente,
Nahrungserg ä nzungsmittel, Vitamine, med. Hilfsmittel achte ich besonders auf:
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
8.1 auf den Preis
8.2 auf die Qualität (Wirkung/Nebenwirkung)
8.3 auf das Design/ Aussehen der Verpackung
158
8.4 auf die Neuartigkeit der Produkte
8.5 auf die Funktionsweise (z.B. bei einem Blutdruckmessgerät)
8.6 auf die Testergebnisse (z.B. bei Stiftung Wahrentest)
8.7 auf Markenprodukte (Nivea, Aspirin)
9. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen auf einer Skala 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zu? Bitte jede Aussagen bewerten.
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
9.1 Bei dem Kauf von Markenprodukten im Gesundheitsbereich fühle ich mich wohler und sicherer
9.2 Ich kaufe bestimmte Marken und Produkte im Gesundheitsbereich, die für bestimmte Eigenschaften stehen
(wie Verträglichkeit, geringe Nebenwirkungen)
9.3 Bestimmte Marken kaufe ich nicht, weil sie meiner Einstellung widersprechen (z.B. Homöopathische Medikamente)
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
9.4 Ich kaufe gerne Gesundheitsprodukte, die von meinen Freunden genutzt werden
9.5 Um „in“ zu sein, gebe ich schon mal mehr aus (z.B. im Wellness-Bereich)
9.6 Ich kaufe Gesundheitsprodukte, um meinen persönlichen Stil (Individualität) z.B Brillen, zu betonen
9.7 Manche Dinge kaufe ich besonders günstig (z.B. Schmerztabletten) ein, bei anderen bin ich dagegen verschwenderisch
z.B. Kosmetik
9.8 Für den Kauf von Gesundheitsartikeln ist mein / meine Partnerin zuständig.
9.9 Ich kaufe nur das, was mit meinem Hausarzt abgestimmt ist
9.10 Ich lasse mich grundsätzlich in der Apotheke beraten bevor ich Medikamente einkaufe
9.11 Ich informiere mich im Vorfeld, wenn ich Gesundheitsartikel kaufe
9.12 Ich kaufe meistens die Produkte, die ich schon lange kenne
9.13 Ich probiere häufig etwas Neues aus
159
IV. Online-Shopping
Beim Einkaufen spielt das Internet für manche Konsumenten eine immer größere Rolle. Im Folgenden möchte ich Ihnen daher ein paar Fragen zum Thema OnlineShopping stellen. Antworten Sie bitte mit ja oder nein bei jeder Aussage.
ja nein
10. Ich kaufe im Internet:
10.1 Medikamente
10.2 Kosmetika
10.3 Nahrungsergänzungsmittel
10.4 Drogerieartikel
10.5 Bücher
10.6 Kleidung
VI. Online - Informationen
Im Internet sind viele Informationen über Medikamente, Krankheiten und Behandlungen zu finden. Ich informiere mich hier regelmäßig. Bitte beurteilen Sie auch hier wieder, inwieweit Sie diesen Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zustimmen können. Bitte jede Aussagen bewerten.
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
11.1 Ich informiere mich umfassen über Erkrankungen, die mich oder meine Familie betreffen
11.2 Ich informiere mich nicht sondern vertraue meinem Hausarzt
11.3 Ich informiere mich, verstehe aber nicht alle Informationen
11.4 Ich informiere mich und bespreche anschließend diese Informationen mit meinem Partner
11.5 Ich informiere mich und bespreche anschließend diese Informationen mit meinem Hausarzt
11.6 Mich verunsichert die Vielzahl der Informationen im Internet.
VII. Bei den folgenden Fragen interessieren mich die Gründe für den Konsum von gesunden Nahrungsmittel, Fitnessangeboten, Nikotin, Alkohol. Bei der Frage der gesunden Ernährung wird darunter verstanden, dass die Ernährung ausreichend Obst und Gemüse enthält und wenig Fast Food zu sich genommen wird. Ebenso versteht man darunter eine angemessen Konsum von Süßigkeiten und gesüßten Getränken (Cola etc). Bitte beurteilen Sie auch hier wieder, inwieweit Sie diesen Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zustimmen können. Auch bei dieser Frage bitte jede Aussage bewerten.
160
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
12. 1 Gesundheit und Gesunde Ernährung gehören zusammen
12.2 Gesunde Ernährung und Fitness steigern die Leistungsfähigkeit
12.3 Gesunde Ernährung bedeutet längeres Leben
12.4 Gesunde Ernährung und Fitness ist wichtig für das Alter
12.5 Für mich sind Alkohol und Nikotin tabu
12.6 Ich konsumiere regelmäßig Alkohol und Nikotin
12.7 Gesunde Ernährung und Fitness interessieren mich nicht
12.8 Ich kann mir gesunde Ernährung und Fitness nicht leisten
13. Für mich spielen diese Themen
13.1 keine Rolle
13.2 eine nachgeordnete Rolle
13.3 eine große Rolle
VIII. Gesundheitskonsum steht im Zusammenhang über die Vorstellung und das Wissen wie Krankheiten entstehen. Bitte beurteilen Sie auch hier wieder, inwieweit Sie diesen Aussagen auf einer Skala von 1 (stimme voll zu) bis 5 (stimme gar nicht zu) zustimmen können. Bitte auch hier wieder jede Aussage beurteilen.
stimme stimme
voll zu gar nicht zu
1 2 3 4 5
14.1 Krankheit ist für mich nicht beeinflussbar.
14.2 Krankheit kann durch eine gesunde Lebensführung beeinflusst werden
14.3 Krankheit ist abhängig vom Einkommen
14.4 Krankheit ist eine Strafe
14.5 Mit Krankheit verbinde ich Angst
14.6 Krankheit ist mit Vereinsamung verbunden
161
VII. Soziodemographische Daten
Zum Abschluss der Befragung möchte ich Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person und Ihren Lebensumständen stellen.
15. Welchen Familienstand haben Sie?
verheiratet
verwitwet geschieden ledig
16. Leben Sie mit einem/einer Partner/in zusammen in einem gemeinsamen Haushalt?
ja
nein
17. Haben Sie eine feste Partnerschaft mit getrennten Haushalten?
ja
nein
18. Wie viele leibliche Kinder haben Sie?
_________ Kinder
19. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie eingeschlossen? ____________ Personen
21. Wie viele Personen davon sind unter 18 Jahre? ____________ Personen
22. Wie alt ist das älteste und das jüngste Kind/ Jugendlicher? (nur die im Haushalt lebenden Kinder erfassen!)
1. (ältestes Kind)_______
2. (jüngstes Kind)_______
23. Wie viele Personen in Ihrem Haushalt haben ein regelmäßiges Einkommen (400 Euro und mehr)?
_________ Personen
24. Was ist die Haupteinkommensquelle Ihres Haushalts? Bitte jede Aussage mit Ja oder Nein beantworten.
Ja nein
Lohn oder Gehalt
Einkünfte aus selbstständiger oder freiberuflicher Tätigkeit
Einkünfte aus Vermögen oder Besitz (z.B. Zinsen, Wertpapiere, Vermietung, etc)
Rente oder Pensionszahlungen
Soziale Transferleistungen oder Unterhaltszahlungen (z.B. Erziehungsgeld, Sozialhilfe)
Sonstiges
25. Mein persönliche monatliche Ausgaben für Gesundheitsartikel (z.B.
Medikamente, Ernährungsergänzungsmittel, Sport etc.) beträgt ungefähr (nur eine Nennung):
bis 100 €
100 - 150 €
150 - 200 €
200 - 250 €
250 - 300 €
300 - 350 €
über 400 €
über 500 €
26. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich auch mehr für Gesundheitsartikel ausgeben.
Ja
Nein
27. Ich habe nicht genügend Geld für Gesundheitsartikel
Ja
Nein
28. Was ist Ihr höchster Schulabschluss?
Haupt-/Volksschule
Abschluss der allgemein bildenden polytechnischen Oberschule der ehemaligen DDR
Realschule/Mittlere Reife bzw. gleichwertige Ausbildung Abitur/Fachabitur
kein Abschluss
noch in Ausbildung (Sch ü ler/ Student))
29. Wie hoch ist Ihr höchster Ausbildungsabschluss?
abgeschlossene Berufsausbildung
höherer Berufsabschluss (Meister, Fachwirt, Techniker) abgeschlossener Fachhochschulabschluss abgeschlossener Hochschulabschluss kein Abschluss
30. Ihr derzeitiges Beschäftigungsverhältnis ist:
hauptberufliche Erwerbsarbeit, ganztags (35+ Stunden pro Woche) Teilzeitbeschäftigung (18 - 34 Stunden pro Woche) geringfügige Beschäftigung (weniger als 18 Stunden pro Woche) nicht erwerbstätig
31. Ist Ihr Beschäftigungsverhältnis befristet?
ja, es läuft noch bis ___________________ nein
32. Ist eine Verlängerung wahrscheinlich?
ja nein
33. Was ist Ihre derzeitige berufliche Position/Situation? Bitte jede Aussage mit Ja oder Nein beantworten.
Ja nein
Beamter/Beamtin im höheren oder gehobenen Dienst Beamter/Beamtin im mittleren oder einfachen Dienst Angestellte/r in leitender Position
Angestellte/r in einfacher oder mittlerer Position Arbeiter/in
Minijobber auf 400 Euro-Basis Schüler/in
Azubi
Landwirt/in
derzeit keine (arbeitssuchend) Hausfrau/Hausmann
sonstiges
Student/in
Rentner/Pensionär selbstständig
34. Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?
deutsch
andere EU-Nationalität andere Staaten
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nephroguide
Name des Patienten:
Diagnose:
Für Patienten mit akuter/chronischer Niereninsuffizienz und
der Notwendigkeit zur dauerhaften Nierenersatztherapie Datum
1. Ärztliches aufklärendes Gespräch mit dem Patienten über Möglichkeiten der Nierenersatztherapie
2. Ärztliches aufklärendes Gespräch mit dem Patienten und seinen Angehörigen über die Möglichkeiten der Nierenersatztherapie (optional)
3. Informationsgespräch mit der Dialysefachschwester
4. Übergabe von Informationsmaterial Broschüren Film Hämodialyse Peritonealdialyse Transplantation
5. Besichtigung eines Dialysezentrums
6. Gespräch mit der Ernährungsberatung, Übergabe von Informationsmaterial
7. Gespräch mit dem Sozialdienst/Psychologischen Dienst Übergabe von Informationsmaterial Entlassung in das häusliche Umfeld für mindestens 3 - 5 Tage
8. Auf Wunsch Herstellung von Kontakten zu Betroffenen aus der Selbsthilfegruppe/Ambulanz
9. Übergabe von Kontaktadressen und Informationsmaterial Stationäre Neuaufnahme nach der Entscheidung für eine Nierenersatztherapie
10. Operativer Eingriff und Legen des Zugangs für die Dialysebehandlung
11. Beratungsgespräch mit dem psychosozialen Team
12. Gespräch mit der Ernährungsberatung
13. Gespräch mit dem Sozialdienst
14. Vorbereitung auf die erste Dialyse Einführung in die Dialyse
15. Informationen zum Dialyseablauf
16. Patientencoaching
17. Kontakt zur Selbsthilfegruppe herstellen
18. Vorbereitung zur Transplantation Rehabilitation
19. Beratung bezüglich einer stationären nephrologischen Rehabilitation mit integriertem Schulungsprogramm (Wissensvermittlung/Verhaltensempfehlungen)
Datum
[...]
1 Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit Funktionen und persönliche Bezeichnungen nicht generell in der männlichen und weiblichen Form verwendet. Wenn diese Bezeichnungen in der männlichen Form formuliert sind, ist selbstverständlich das weibliche Geschlecht eingeschlossen.
3 Dies hat zur Folge, dass die Solidarität mit den Kranken abnimmt.
4 So könnte man das so genannte "Wartezimmer-Syndrom“, als eine Suche nach sozialen Kontakten über die Inanspruchnahme ärztlicher Kommunikation definieren (70,80,112,120)
5 Bekannt ist, dass Gesundheitsverhalten in der Regel nicht an fehlendem Wissen über Gefahren und gesundheitlichen Belastungen scheitert, sondern am tatsächlichen Verhalten. Genau hier könnte z.B. Patientencoaching ansetzen, in dem es hilft und unterstützt notwendige Handlungskompetenz zu erwerben. Dazu gehört zum Beispiel sich um Befreiungsanträge und Behindertenausweis zu kümmern, oder rehabilitative Maßnahmen zu beantragen, sowie sich im „Ämterwesen“ sicher zu bewegen. Es müsste eine Form der Hilfe zur Selbsthilfe beim Patienten etabliert werden, nach dem Motto: „ so viel wie n ö tig, jedoch so wenig wie m ö glich “ ! Insgesamt könnte der Patient hierdurch eine Entlastung durch Befähigung erfahren, die Lebensqualität könnte erhöht werden und der zusätzliche Leidensdruck reduziert werden.
6 Ursächlich für diese Glaubwürdigkeitskrise ist nach Carl Friedrich Gehrmann eine zunehmende wissenschaftliche Inkompetenz unserer Gesellschaft. Er meint damit die Unfähigkeit der Gesellschaft, wissenschaftliches Wissen - Expertenwissen - prozessbezogen nachzuvollziehen. Des Weiteren bescheinigt er der Gesellschaft eine weitergehende Entsymbolisierung der Wissenschaft, die keine emanzipatorischen Fortschritte, wohl aber einen erheblichen Verlust an standesethischem Bewusstsein bewirkt hat (107) Wettbewerbsdruck und zunehmende Ökonomisierung sind die ergänzenden Faktoren, die die Glaubwürdigkeitskrise von Wissenschaft und Experten vollends besiegeln. Beigetragen hat dazu sicherlich auch die zunehmende Schließung der Kluft zwischen Experten und Laien im Zuge der Bildungsreform.
- Arbeit zitieren
- Dr. rer. biol. hum. Martina Oldhafer (Autor:in)Marie-Luise Dierks (Reihenherausgeber:in)Gabriele Seidel (Reihenherausgeber:in), 2010, Nephroguide - Ein Leitfaden für Professionelle zur Begleitung von Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung während der Entscheidungsfindung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169493
Kostenlos Autor werden









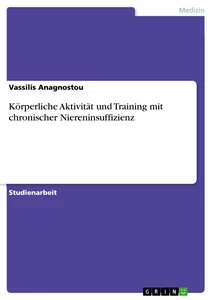



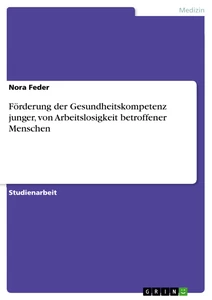








Kommentare