Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 DAS RÄTSEL DES BEWUSSTSEINS
2.1 Das Problem der Qualia
2.1.1 Qualia sind subjektiv und privat
2.1.2 Qualia sind an eine Perspektive gebunden
2.1.3 Qualia sind nicht räumlich
2.1.4 Qualia - eine Herausforderung
3 BEWUSSTSEIN UND PHILOSOPHIE
3.1 Die aristotelisch-naturalistische Position
3.1.1 Aristoteles: Seele und Körper sind eins
3.1.2 Thomas von Aquin: die Vervollständigung der Seele
3.2 Die dualistische Position
3.2.1 Platon: Die Seele ist unsterblich
3.2.2 René Descartes: Ich denke, also bin ich
3.3 Der Funktionalismus
3.4 Daniel Dennett: Bewusstsein als virtuelle Maschine
3.4.1 „Quining Qualia“
3.4.2 Dennett und das „Cartesianische Theater“
3.4.3 Das „Multiple Drafts“-Modell
3.5 Paul Churchland: Der eliminative Materialismus
4 PSYCHOLOGIE UND NEUROWISSENSCHAFTEN
4.1 Historischer Exkurs in die Psychologie
4.2 Die Entwicklung der Neurowissenschaften
4.3 Die Neuropsychologie
5 BEWUSSTSEIN UND NEUROWISSENSCHAFTEN
5.1 Methoden der Hirnforschung
5.2 Die Architektur des Gehirns
5.2.1 Überblick über Strukturen und Funktionen des Gehirns
5.2.2 Informationsverarbeitung durch Neuronen
5.2.3 Systeme der Wahrnehmung
5.3 Die Suche nach den neuronalen Korrelaten
5.3.1 Christof Koch: spezifische Neuronengruppen
5.3.2 Susan A. Greenfield: Bewusstsein - Ausdruck holistischer Funktionen
5.4 Bewusstsein und Gedächtnis
5.4.1 Der „Sitz“ des Gedächtnisses
5.4.2 Die Formen der Gedächtnisspeicherung
5.4.2.1 Das Kurzzeitgedächtnis
5.4.2.2 Das Langzeitgedächtnis
5.5 Bewusstsein und Emotion
5.5.1 Antonio Damasio: Ich fühle, also bin ich
5.5.1.1 Somatische Marker
5.5.1.2 Die zwei Arten des Bewusstseins nach Damasio
5.6 Bewusstsein und Gene
5.6.1 Das flexible Gehirn
5.6.2 Das Genom - ein komprimiertes Informationspaket
6 SCHLUSSBEMERKUNGEN
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Anhang 4
Anhang 5
GLOSSAR
PERSONENVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
1 Einleitung
Im Jahre 2009 bewunderten rund 8,5 Millionen Besucher die Kunstschätze im Louvre, dem meistbesuchten Museum der Welt. Die Besucherzahl hat sich in den letzten Jahren um zwei Drittel erhöht.1 Der „Sinn für Schönes“ lässt die Kassen klingeln. Dem Mus é e de l ‘ Orangerie war das Geschäft mit den schönen Künsten 29 Millionen Euro Investition wert: In den Jahren 2000 - 2006 erweiterte es seine Ausstellungsfläche um fast das Doppelte.2 Tag für Tag strömen Menschen aus allen Teilen der Welt in die Ausstellungshallen, um einen Blick auf Monets riesige „Seerosen“ zu werfen. Nicht wenige gönnen sich einen Moment Ruhe und tauchen mit all ihren Sinnen und Gedanken in diese gewaltige Bilderwelt ein. Während Wirtschaftswissenschaftler diese menschliche Eigenart kühl in Zahlen umsetzen und damit Umsatzkurven berechnen, ist der Blick, den Natur- und Geisteswissenschaftler darauf werfen, eher von Neugierde geprägt. Was genau macht den „Sinn für Schönes“ denn eigentlich aus? Woher „wissen“ wir, dass etwas schön ist? Was ist dieser geistige Zustand überhaupt, den wir Bewusstsein nennen und der uns befähigt, solche Empfindungen und Gedanken zu haben? Diese Fragestellung bildet die Grundlage der vorliegenden Bachelor-Arbeit. Sie hat zum Ziel, das Phänomen „Bewusstsein“ in folgenden drei Forschungsrichtungen zu untersuchen: der Philosophie, der Psychologie und den Neurowissenschaften. Dabei soll zunächst gezeigt werden, dass die Philosophie, die sich als erste wissenschaftliche Disziplin mit Bewusstsein auseinander gesetzt hat, die theoretische Grundlage bildet für die weiteren Entwicklungen in der modernen Bewusstseinsforschung. Daher widmet sich die erste Hälfte der vorliegenden Arbeit den geisteswissenschaftlichen Aspekten dieser Thematik. Es wird ein Überblick darüber gegeben, welche hauptsächlichen Bewusstseinsmodelle die sogenannte „Philosophie des Geistes“ vertritt, wobei in Kapitel 2 zunächst auf die Problematik eingegangen wird, die traditionell als das „Rätsel des Bewusstseins“ bekannt ist. In Kapitel 3 kommen dann Philosophen der Antike und des Mittelalters mit ihren Vorstellungen über die Seele zu Wort. Die anschließenden Kapitel widmen sich den kontroversen Standpunkten zweier moderner Philosophen: Daniel Dennett und Paul M. Churchland. Es wird deutlich, dass ihre unterschiedlichen Positionen über das Bewusstsein einen starken Einfluss auf die heutige Diskussion der Bewusstseinsforschung ausüben. Kapitel 4 schlägt die Brücke von der Philosophie zur Psychologie, die sich später von der Philosophie emanzipieren sollte. Ihre eigenständige Entwicklung führte zu Ansichten über das Bewusstsein, die inhaltlich von der Sichtweise der Philosophie differieren. Als einer ihrer prominentesten Vertreter wird Sigmund Freud genannt, dessen These über das Ich und seiner Aufspaltung in das Bewusste und das Unbewusste eine ganze Generation bewegte und die Wissenschaft revolutionierte. Die Entwicklung der Neurowissenschaften wird in dem Kapitel 4.2 erläutert. Dieser Abschnitt soll auch als Überleitung zu dem zweiten Teil der vorliegenden Arbeit dienen, der den Fokus auf die neurowissenschaftliche Forschung legt. Da die Neurowissenschaften sich besonders auf die Erforschung des Gehirns konzentrieren, werden in Kapitel 5 zunächst ihre Methoden erläutert. Dann folgt der anatomische Aufbau des Gehirns mit seinen neuronalen Netzwerken, bevor in Kapitel 5.3 auf zwei unterschiedliche Bewusstseinsmodelle eingegangen wird, die von den Neurowissenschaftlern Christof Koch und Susan A. Greenfield entwickelt wurden. Kapitel 5.4 wendet sich dann dem Gedächtnis zu und untersucht die Rolle, die es bei der Bewusstseinsentwicklung spielt. Dabei werden die verschiedenen Gedächtnissysteme beschrieben und es wird anhand von Fallbeispielen gezeigt, wie ein Ausfall dieser Systeme Einfluss nimmt auf die Identität eines Menschen. In Kapitel 5.5 wird auf die Funktion der Emotionen aufmerksam gemacht. Antonio Damasios‘ Theorie der somatischen Marker sowie seine zwei Bewusstseinsmodelle werden beschrieben. Inwieweit unser Bewusstsein durch Gene beeinflusst ist, wird schließlich in Kapitel 5.6 besprochen. Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenspiel von Genen und Umwelteinflüssen. Die Schlussbemerkungen in Kapitel 6 weisen schließlich auf die Grenzen der Hirnforschung hin und geben einen Ausblick auf die Forschungslandschaft der nahen Zukunft.
Da die Thematik sehr umfangreich ist und sich in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen bewegt, wurde zum besseren Verständnis ein Anhang mit alphabetisch geordnetem Glossar und Personenverzeichnis angefügt. Soweit nicht anders vermerkt finden Begriffe, die ich kursivfett markiert habe, Eingang in das Glossar, während die Namen der wichtigsten Persönlichkeiten, die von mir fett markiert wurden, sich im Personenverzeichnis wieder- finden. Bezüglich der Zitierweise referiere ich auf die Regeln des MLA (Modern Language Association of America).3 Außerdem zitiere ich aus Webseiten, deren Erscheinungsdatum oder Verfasser entweder unbekannt ist oder die keine Seitenzahl angeben, wie beispielsweise Daniel Dennetts verfasster Artikel „Quining Qualia“. Auf Internetquellen wird daher einheitlich in einer Fußnote verwiesen, die den Autor bzw. den Träger der Webseite und den Namen des Artikels erwähnt.4 Original Hervorhebungen kennzeichne ich mit „Hv. i. O.“, Hervorhebungen von mir werden mit „Hv. v. MS“ angezeigt. Einfügungen im Originaltext sind mit […, MS] markiert, Auslassungen mit (…). Um das Verständnis des vorliegenden Textes zu erleichtern, schreibe ich manche Wörter zu Betonungs- oder Unterscheidungs- zwecken in kursiv.
Die Thematik „Gehirn und Bewusstsein“ bietet Stoff für Forschungen, die auch in den kommenden Jahrzehnten die Wissenschaft in Atem halten wird. Die vorliegende Arbeit kann daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie verfolgt jedoch das Ziel, einen Einblick in die faszinierende Welt unseres Gehirns zu gewähren. Vielleicht wird dadurch bei dem einen oder anderen Leser die Neugierde geweckt und er wird dazu angeregt, weitere Nachforschungen zu betreiben. Denn auch das ist ein Merkmal unseres Bewusstseins: die Neugierde, die uns dazu antreibt, unser Wissen zu erweitern.
2 Das Rätsel des Bewusstseins
Seit der Mensch über sich selbst nachdenkt, beschäftigen ihn vor allem drei elementare Rätsel, die um seine eigene Existenz kreisen: Wie konnte das Universum aus dem Nichts entstehen? Wie konnte aus toter und anorganischer Materie Leben entstehen? Und schließlich: Wie konnten Lebewesen plötzlich über sich selbst nachdenken und bewusst etwas fühlen? Die Suche nach Antworten bewegte Philosophen wie Naturwissenschaftler über die Jahrhunderte hinweg. (vgl. Koch 2007: 35) Mangels methodischer und technischer Möglichkeiten hatten es die Naturwissenschaften anfangs jedoch schwer, empirisch fundierte Antworten auf diese Fragen zu liefern. So legte die Philosophie mit ihren theoretischen Erklärungsmodellen die Grundlage für die heutige Bewusstseinsforschung. Eine Problematik, die sich dabei sehr schnell herauskristallisierte, betrifft den subjektiven Raum, in dem sich die Forschungen bewegen. Theorien, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen, Ideen über geistige Prozesse entstehen im Bewusstsein selbst. Die Tatsache, dass über das Mentale oder phänomenologisch zu Erfassende reflektiert wird, ohne dabei den subjektiven Raum verlassen zu können, macht es nach Ansicht der Geisteswissenschaftler schwer, aus der nötigen Distanz heraus einen objektiven Blick auf das Bewusstsein zu werfen. Der Philosoph Hans Goller schreibt dazu:
„Die Erforschung des Bewusstseins unterscheidet sich von der Erforschung aller anderen Gegenstände dadurch, dass der Wissenschaftler selbst aus den Bewusstseinszuständen besteht, die er mit Hilfe eben dieser Zustände untersucht und erklärt. Bewusstseinsforschung ist ohne Bewusstsein nicht möglich.“ (Goller 2003: 141)
Diese Erste-Person-Perspektive führt zu einer weiteren Problematik, die bis heute nicht gelöst worden ist und welche dadurch immer noch zur Rätselhaftigkeit des Bewusstseins beiträgt: dem Problem der Qualia.
2.1 Das Problem der Qualia
„ Qualia sind die Sorgenkinder der Bewusstseinsphilosophen. “ (Goller 2003: 18)
In der Philosophie wird für geistige und psychische Phänomene allgemein der Ausdruck „das Mentale“ verwendet. Dazu gehören u. a. Sinnes- und Körperempfindungen, Meinungen und Gedanken, Wünsche und Gefühle. Für die qualitativen Empfindungen, die entstehen, wenn man z. B. das Fell eines Hundes streichelt, den Geruch von gerösteten Mandeln wahrnimmt oder eine heiße Herdplatte berührt, wird traditionell der Begriff „Qualia“ verwendet oder, synonym dazu, „Erlebnisqualitäten“. Um zu verstehen, warum sich an den Qualia so viele Debatten entzünden, ist es notwendig, ihre Merkmale zu kennen. (vgl. Goller 2003: 18)
2.1.1 Qualia sind subjektiv und privat
Es war Thomas Nagel, der in seinem berühmt gewordenen Artikel „What is it like to be a bat?“ (1974) die Subjektivität der Qualia in den Mittelpunkt stellte. Er forderte darin seine Leser auf, sich vorzustellen, eine Fledermaus zu sein. Doch selbst wenn sie sich vorstellten, Flughäute zwischen den Beinen zu haben, nachts von der Decke zu hängen und sich mittels Echolotortung und Radar in der Umgebung zurecht zu finden, könnten sie sich nicht vorstellen, wie es für die Fledermaus selbst ist, eine Fledermaus zu sein. (vgl. Ravenscroft 2008: 323) Dieses Beispiel zeigt, dass Erlebnisqualitäten subjektiv sind. Wir können uns zwar in das Erleben von anderen Menschen oder Tieren hinein fühlen, doch wir vergessen dabei nicht, dass wir dabei nur so tun als ob. Zudem sind Qualia sprachlich schwer fassbar. Man kann einem Blinden nicht erklären, was Rot bedeutet. Deswegen wird das momentane Erleben oft nichtsprachlich zum Ausdruck gebracht. Die Körperhaltung oder Reaktionen wie Schwitzen, Blässe, Röte etc. helfen uns bis zu einem gewissen Grad, uns vorzustellen, was der Andere wohl gerade empfindet. Der direkte Zugang in sein Inneres, das wie, fehlt uns jedoch. Nur er weiß, wie er gerade fühlt und denkt. Seine Erlebniswelt ist somit auch privat. (vgl. Goller 2003: 19-22)
2.1.2 Qualia sind an eine Perspektive gebunden
Es gibt zwei verschiedene Wege, um Wissen über Erleben und Bewusstsein zu erlangen: Man kann sich der Introspektion bedienen, also der Sicht nach Innen, oder man tritt von außen an die Sache heran und begibt sich in die Beobachterperspektive. Letztere ist die Methode, die die Wissenschaft anwendet. Ihr Ziel ist es, von subjektiven Standpunkten zu abstrahieren und ein möglichst objektives Bild zu geben. Diese Herangehensweise ist jedoch paradox: Da Qualia subjektiv sind, sind sie auch an die Erste-Person-Perspektive gebunden. Der objektive Standpunkt, die wissenschaftliche Dritte-Person-Perspektive, lässt sich hier gar nicht einnehmen. (vgl. Goller 2003: 23-25)
2.1.3 Qualia sind nicht räumlich
Wir leben in einer dreidimensionalen Welt mit einer zeitlichen Struktur. Wohin wir auch gehen, was wir auch sehen - unsere Augen oder unser Tastsinn messen unaufhörlich unsere Umgebung ab und helfen uns dadurch, uns zu orientieren. Ganz anders jedoch verhält es sich mit unseren Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen. Es ist schlichtweg unsinnig, sie auf ihr Länge, ihre Höhe oder Breite auszumessen. Sie haben bestenfalls eine zeitliche Dimension. Unser Erleben ist also nicht räumlich. Es stellt sich nun die Frage, wie unser räumlich organisiertes Gehirn so etwas Nichträumliches wie das Bewusstsein hervorbringen konnte. Der britische Philosoph Colin McGinn gibt uns als Antwort einen Denkanstoß. McGinn stellt die These auf, dass das, was wir unter „Raum“ verstehen, möglicherweise nicht die ganze Wahrheit ist. Vielleicht besitzt der Raum noch weitere Eigenschaften, die wir gar nicht kennen, und Bewusstsein ist in Wirklichkeit räumlich. Nur erkennen wir das nicht, weil unsere gegenwärtige physikalische Weltsicht zu begrenzt ist: „Unser Geist steht einer korrekten Theorie des Raumes so ähnlich gegenüber wie der Geist eines Adlers der Relativitätstheorie“ (McGinn 2001: 155, zit. n. Goller 2003: 29).
2.1.4 Qualia - eine Herausforderung
Angesichts dieser Merkmale der Qualia ist es für die Wissenschaft eine große Herausforderung, empirische Forschungen über das Bewusstsein durchzuführen. Bis jetzt ist immer eine Erklärungslücke übrig geblieben: Selbst wenn Neurowissenschaftler und Philosophen größtenteils darin übereinstimmen, dass unser bewusstes Erleben aus Gehirnprozessen hervorgeht - wir haben keine endgültige Erklärung dafür, warum und wie das geschieht. Selbst wenn uns Gehirnforscher sagen könnten, „welche spezifischen neuronalen Aktivitätsmuster mit dem Erleben von Freude einhergehen, wüssten wir ohne eigene Freudeerlebnisse trotzdem nicht, wie es ist, sich zu freuen“ (Goller 2003: 23 ff.). Lässt sich das „Rätsel des Bewusstseins“ dann überhaupt lösen? Viele Philosophen beantworten diese Frage mit „Nein“.5 Naturwissenschaftler jedoch neigen zu einer anderen Antwort. Der Biologe Henning Engeln gibt zwar zu: „Niemand hat bislang den Sitz des Bewusstseins im Gehirn orten können - oder gar zu durchschauen vermocht, wie es zustande kommt“ (Engeln 2008: 80). Doch wird es nicht für unmöglich gehalten. Moderne bildgebende Verfahren6 machen das Gehirn immer durchschaubarer und entzaubern es dadurch Schritt für Schritt. Ob wir Gesichter erkennen, Vokabeln lernen oder Gedichte interpretieren - die Wissenschaft kann uns heute sagen, wo oder in welcher Hirnregion dies stattfindet. Christof Koch hält es daher für möglich, das „Rätsel des Bewusstseins“ doch noch zu lösen:
„Das Bewusstsein steht im Mittelpunkt des Leib-Seele-Problems. Es erscheint den Wissenschaftlern des 21. Jahrhunderts ebenso rätselhaft wie vor einigen Jahrtausenden, als sich Menschen erstmals deshalb Fragen zu stellen begannen. Dennoch sind die Wissenschaftler heute besser als je zuvor gerüstet, die physische Basis des Problems zu erforschen.“ (Koch 2007: 54)
Koch bezeichnet hier die Jahrhunderte alte Debatte über das Leib-Seele-Problem als die Grundlage für die heutige Bewusstseinsforschung. Tatsächlich existiert kein unter den Neurowissenschaftlern einheitlich anerkanntes Modell des Bewusstseins. Die unterschied- lichen Auffassungen haben ihren Ursprung in den theoretischen Bewusstseinsmodellen, die die Philosophie im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Um die verschiedenen Positionen der Neurowissenschaften zu verstehen, ist es deshalb notwendig, ihre philosophische Grundlage zu kennen.
3 Bewusstsein und Philosophie
“ One of the values of philosophy is that throughout its history it has prefigured science. ”
(Antonio Damasio 2004: 15)
Der sprachliche Begriff „Bewusstsein“ hat im Abendland eine lange Geschichte, die eng mit dem Gewissensbegriff zusammenhängt. In vielen Sprachen lässt sich dies etymologisch nachvollziehen. So besitzt z. B. das englische Wort „consciousness“ (Bewusstsein) den gleichen Wortstamm wie „conscious“ (Gewissen). Der Begriff des Gewissens wurde von Notker Teutonicus (950-1022), einem führenden Mönch in St. Gallen, in die deutsche Sprache eingeführt.7 Das deutsche Wort „Gewissen“ ist eine Lehnübersetzung des lat.
Begriffs „conscientia“, der Bewusstsein und Gewissen bedeutet. Nach der Orthodoxie in der Philosophiegeschichte war es der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes (1596-1650), der schließlich den modernen Bewusstseinsbegriff neu konstituierte und das semantische Element des Gewissens davon ablöste. (vgl. Metzinger_VL1:20 ff.) Diese enger gefasste semantische Eingrenzung von „conscientia“ bedeutete jedoch keine endgültige Definition des Begriffs. Vielmehr lenkte sie den Fokus auf ein Phänomen, das in der Philosophie Gegenstand verschiedenster Erklärungsmodelle wurde, und sich noch heute in der gegenwärtigen Diskussion wiederfindet. Um die - wie es zunächst scheint - oft nicht zu vereinbarenden Positionen der modernen Bewusstseinsforschung zu verstehen, ist es daher notwendig, ihre philosophischen Vorläufer zu kennen.
Die folgenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden jedoch die wichtigsten philosophischen Strömungen, die das Leib-Seele-Problem als Erklärungsgegenstand haben, erläutert. Ziel dieser Ausführungen ist es, zu veranschaulichen, dass die Weltsicht, die sich in den verschiedenen philosophischen Theorien widerspiegelt, auch gegenwärtig noch Einfluss nimmt auf die Herangehensweise in der modernen Bewusstseinsforschung. Sie bestimmt dadurch nicht nur die Forschungsrichtung, sondern färbt subjektiv auch die Interpretation der Forschungsergebnisse ein. Im nächsten Kapitel wird zunächst auf die aristotelisch-naturalistische Position von Aristoteles und Thomas von Aquin eingegangen, die davon ausgeht, dass Körper und Seele eins sind. Erst dann wird die dualistische Sichtweise von Platon untersucht. Dies entspricht nicht ganz der geschichtlichen Chronologie, schließt sich aber inhaltlich homogen an die These von René Descartes an, der als „die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte des K ö rper-Geist-Problems [gilt, MS]. (…) [Seine dualistische, MS] Deutung des Körper-Geist-Verhältnisses führte dazu, dass die Frage der kausalen Wechselwirkung von Körper und Geist die Leib-Seele-Debatte dominierte.“ (Goller 2003: 84) Descartes Theorien werden heute noch stark debattiert, und in den Kapiteln 3.1.6 und 3.1.7 kommen schließlich noch zwei moderne Philosophen zu Wort, die zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen.
3.1 Die aristotelisch-naturalistische Position
3.1.1 Aristoteles: Seele und Körper sind eins
Aristoteles (384-322 v. Chr.) gehört zusammen mit Platon und Sokrates zu den bedeutendsten Philosophen der Antike. Sein Einfluss lässt sich in den verschiedensten Disziplinen erkennen, u. a. in der Wissenschaftstheorie, Dichtungstheorie, Logik, Physik sowie in der Staatslehre. Das Hauptaugenmerk seiner Philosophie liegt jedoch in der Biologie, was vermutlich der Tatsache zuzuschreiben ist, dass sein Vater Arzt war.8 Für Aristoteles ist der Mensch eine nicht trennbare, einheitliche Substanz aus Körper und Seele, wobei die Seele dem Organismus die Form gibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass er mit dem Wort „Seele“ nur die äußere Gestalt eines Lebewesens bezeichnet. Für ihn ist die Seele ein Lebensprinzip, der Grund für das Lebendig sein schlechthin. Aristoteles erklärt mit der Seele auch bestimmte Arten der Bewegung. Nach der physikalischen Bewegungslehre werden Bewegungen von physikalischen Objekten durch äußere Ursachen erklärt. Ein Ball bewegt sich, weil er angestoßen wird oder ein Wind weht, etc. Doch warum bewegt sich der Mensch? Er benötigt kausal keine äußeren Umstände, um sich zu bewegen. Dies bedeutet, dass „Lebewesen (…) die Ursache ihrer Bewegung in sich tragen“ (Goller 2003: 77). Nach Aristoteles ist dies die Seele, das Sich-Selbst-Bewegende, der Ursprung der Körperbewegung. Jedoch übt auch die Umgebung Einfluss auf unseren Bewegungsdrang aus. Diese Gesamtheit aller biologischen und kognitiven Prozesse nennt Aristoteles „Seele“. Das eine existiert nicht ohne das andere, erst durch die Seele wird der Körper zum Menschen. Anhand eines Beispiels wird dieses untrennbare Geflecht veranschaulicht:
„Wenn nämlich das Auge ein Lebewesen wäre, so wäre seine Seele die Sehkraft; denn sie ist das Wesen des Auges dem Begriff nach. Das Auge aber ist die Materie der Sehkraft. (…) Wie aber die Pupille und die Sehkraft das Auge bilden, so bilden dort die Seele und der Körper das Lebewesen.“ (De Anima: 412-413, zit. n. Goller 2003: 78)
Aristoteles geht in seiner Definition der Seele jedoch noch weiter. Er unterscheidet zwischen dem „vegetativen Seelenvermögen“, das er schon den Pflanzen zuordnet und welches sich hauptsächlich auf biologische Prozesse wie Nahrungsaufnahme, Wachstum und Fortpflanzung beschränkt, dem „sensitiven Seelenvermögen“, das die Grundlage für Sinneswahrnehmungen darstellt, einschließlich Schmerz und das Gefühl für Angenehmes und Unangenehmes, und schließlich dem „rationalen Seelenvermögen“, welches nur der Mensch besitzt. Dies macht den Menschen zum „animal rationale“, ausgestattet mit Vernunft und Denkkraft, welche ihn über das Tier stellen. Interessanterweise ist dieser Teil der Seele, den er auch als „tätige Vernunft“ bezeichnet, trennbar vom Körper. Während beim Tod die niederen Seelenteile und damit auch die fühlbaren Bewusstseinsinhalte zu existieren aufhören, ist die geistige Energie unvergänglich. Doch wie kann von einer Einheit von Seele und Körper ausgegangen werden, wenn ein Teil der Seele weiter existiert? Dieser Widerspruch wird von Aristoteles nicht aufgeklärt, und so wurde seine Seelenlehre Grundlage für viele unterschiedliche Erklärungsversuche darüber, was die Seele überhaupt ist. (vgl. ebd.: 80)
Ein berühmter Vertreter, der die naturalistische Sicht von Aristoteles annahm und weiter verbreitete, war der heilig gesprochene Dominikaner Thomas von Aquin. Er ging jedoch über Aristoteles‘ These hinaus und suchte nach einer Seelendeutung, die sowohl die christliche Lehre der Unsterblichkeit der Seele erlaubte als auch die Annahme, dass Seele und Körper eine Einheit bilden.
3.1.2 Thomas von Aquin: die Vervollständigung der Seele
Thomas von Aquin (1225-1274) war einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen des Mittelalters. Er hinterließ eine gewaltige Menge an Schriften, und seinem Hauptsekretär zufolge beschäftigte er 3 oder 4 Sekretäre gleichzeitig. Geboren als jüngster Sohn eines Landadligen trat er 1244 gegen den Willen seiner Familie in den Dominikanerorden ein. Im Laufe seines Lebens machte er Karriere als Doktor und Studienpräfekt der scholastischen Philosophie. Er lehrte in Paris, Rom, Viterbo und Orvieto. 1248 wurde er Schüler von Albertus Magnus in Köln, Begründer der christlichen Aristotelik.9 Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum Thomas von Aquin in seiner Deutung des Körper-Geist-Verhältnisses auf Aristoteles‘ Seelenlehre zurückgreift. Auch für ihn ist der Mensch ein „animal rationale“, das sich von allen übrigen Lebewesen durch seinen Intellekt unterscheidet. Zudem betont er - wie Aristoteles die Einheit von Körper und Seele und weist darauf hin, dass die Seele dem Körper die Form gibt. Gäbe es keinen Körper, könnten wir den Menschen nicht als Individuum erkennen. Er wäre nur ein unpersönliches denkendes Etwas. Nur die Einheit von Seele und Körper macht den Menschen aus. Thomas von Aquin verteidigte jedoch auch die Auffassung von der Unsterblichkeit der Seele. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schrieb er der menschlichen Seele gegenüber der Tier- und Pflanzenseele eine Sonderstellung zu. Dabei geht er davon aus, dass die „tätige Vernunft“ nicht auf den Körper angewiesen ist und folglich auch ohne den Körper existieren kann. Diese Vernunft wird durch die menschliche Seele realisiert. Zwar sind für Erkenntnis gewisse Sinneseindrücke nötig, aber am Erkenntnisakt selbst sind diese nicht beteiligt. Thomas von Aquin spricht daher von der „Nichtsinnlichkeit des Denkens“ (von Aquin, zit. n. Goller 2003: 82), das die Seele unabhängig macht von dem materiellen Zeitbegriff. Für ihn hat die Seele eine subsistierende und eine nichtsubsistierende Form, also etwas, das selbständig getrennt von Materie existieren kann und doch den Körper benötigt, um sich zu vervollständigen:
„Die Subsistenz und die Nichtsubsistenz der Seele werden also nicht unter derselben Hinsicht ausgesagt: Subsistenz hat sie bezüglich ihres Seins, insofern dies die Bedingung der Möglichkeit der unabhängigen Denktätigkeit ist; Nichtsubsistenz hat sie bezüglich ihrer Wesensvervollkommnung, da sie ohne das von den Sinnesdaten bereitgestellte Material diese unabhängige Denktätigkeit, die ihr Wesen ausmacht, nicht ausüben kann.“10 [Hv.v.MS]
Obwohl Thomas von Aquin sich gegen die dualistische Auffassung Platons (siehe Kapitel 3.1.3) stellte und sich für die Einheit Körper-Geist ausspricht, besitzt seine Theorie dualistische Ansätze. Für ihn sind „physische Zustände notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für mentale Zustände“ (ebd.: 15). Kläden schlägt in seinem Aufsatz den Bogen von der thomanischen Konzeption zur modernen Hirnforschung. Er weist darauf hin, dass diese „sinnlich-intellektuelle Einheit“ (ebd.: 7), nämlich dass es ein und dasselbe Subjekt (der Mensch) ist, der wahrnimmt und erkennt, auch in den Ergebnissen der Hirnforschung zu sehen ist. Beide Zustände, Wahrnehmen und Erkennen, setzen ein funktionierendes Nervensystem voraus. Dies erklärt auch, warum in der Hirnforschung vornehmlich der aristotelisch-naturalistische Standpunkt vertreten wird. Jedoch gibt es auch naturwissenschaftliche Forschungsrichtungen, die eine dualistische Sichtweise voraussetzen. Grundlage für eine solche Weltordnung bildete die dualistische Philosophie Platons, dessen Definition der Seele nun veranschaulicht werden soll.
3.2 Die dualistische Position
3.2.1 Platon: Die Seele ist unsterblich
Platon (428-348/347 v. Chr.) war Aristoteles‘ Lehrer. Im Gegensatz zu seinem Schüler vertrat er nicht die Ansicht, dass die Seele und der Körper eins seien. Für ihn waren dies „zwei ontologisch eigenständige Wirklichkeiten“ (Goller 2003: 73) mit unterschiedlichen Schick- salen: Während der Körper dem Tod entgegen strebt, ist die Seele unsterblich. Wenn der Körper stirbt, verlässt die Seele den Körper. Die Seele existierte schon vor ihrer Verbindung mit dem Körper und wird auch nach dem Tod weiter existieren. Platon begründete dies u. a. durch die Tatsache, dass der Mensch vieles weiß, obwohl er gar keine Erfahrung darüber sammeln konnte. Er kann sagen, dass zwei Dinge „gleich“ sind, oder dass etwas „schön“ ist oder „gerecht“:
„Dieses Wissen, das nicht aus der Erfahrung stammt, haben wir vor unserem Leben erworben. Folglich muss unsere Seele bereits vor der Geburt existiert haben. Platon spricht von der Präexistenz der Seele. Präexistenz meint, dass die Seele vor der Entstehung des Körpers existierte und im Reich der Ideen zum Beispiel die Idee des Gleichen, des Guten, des Schönen und des Gerechten schaute.“ (ebd.: 73)
Für Platon waren unsere Erfahrungen nur Abbilder von Ideen. Die Ideen waren in seinem Weltverständnis aber realer als ihre Abbilder. Die Seele selbst war für Platon Lebensprinzip oder Träger des Lebens: „So wie das Feuer allem, dem es innewohnt, Wärme gibt, so gibt die Seele allem, wovon sie Besitz ergreift, Leben“ (ebd.: 74 ff.). Ihre Präexistenz und ihre Unsterblichkeit stellen sie hierarchisch über den Körper, der sogar als „Gefängnis“ bezeichnet wird. Was für einen Sinn hat es dann überhaupt für die Seele, eine Zeit lang mit dem Körper verbunden zu sein? Während dieser Zeit kann sie selbst Erfahrungen machen wie Lust und Schmerz, und sie kann ihre Erkenntnis und Denkfähigkei t sowie ihre charakterliche Stärke ausbilden. Das erfolgreiche Streben nach einem guten Leben bestimmt letztendlich, ob die Seele wiedergeboren wird in einem „niederen“ Lebewesen oder einem „höheren“.
Platons Denken beeinflusste selbst das Christentum. Über die Jahrhunderte war die Abwertung des Körpers gegenüber der Seele omnipräsent. Sich den Begierden des Körpers zu entziehen und ein geistiges Leben anzustreben, galt als Idealbild. (vgl. ebd.: 76) Diese dualistische Sichtweise grub tiefe Wurzeln in das Weltbild der Menschen. Im späten Mittelalter wurde sie schließlich durch den wichtigsten Vertreter in der Geschichte des Körper-Geist-Problems aufgegriffen und verfeinert: René Descartes.
3.2.2 René Descartes: Ich denke, also bin ich
René Descartes (1596-1650), ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler, gilt als Begründer des modernen, frühneuzeitlichen Rationalismus, seine Lehre wird auch als Cartesianismus bezeichnet. Nach Descartes lässt sich alles anzweifeln, selbst die Existenz des eigenen Körpers. Jedoch lässt sich nicht anzweifeln, dass ich es bin, der gerade denkt und zweifelt, was zu seinem berühmten Ausspruch führte „ cogito, ergo sum “: Ich denke, also bin ich. Unter „Denken“ verstand Descartes das gesamte Erleben eines Menschen: „Ich bin ein denkendes Etwas, das zweifelt, empfindet und fühlt“ (Descartes, zit. n. Goller 2003: 84). Er unterscheidet zwischen Geist und Körper, zwischen Innenwelt und Außenwelt, wobei diese Welten eigenständige Substanzen oder Realitäten darstellen, die unabhängig voneinander existieren können. Der Körper ist wie eine Uhr, die geistlose Bewegungen ausführt. Deswegen kann die Wissenschaft ihn auch untersuchen, als sei er eine Maschine. Die Seele dagegen, mit all ihren Gedanken, Wahrnehmungen und Emotionen, lässt sich keinem bestimmten Körperteil zuordnen; sie ist mit allen Körperorganen verbunden und bestimmt deren Aktionen. Auffällig ist jedoch, dass Descartes der Seele einen physischen Ort zuweist, durch den sie ihre Funktionen ausüben soll: der Zirbeldrüse, die sich im Zwischenhirn befindet. Warum gerade diese Drüse? Descartes beantwortet diese Frage wie folgt:
„Der Grund (…) liegt darin, dass alle anderen Teile unseres Gehirns doppelt vorhanden sind, so wie wir auch zwei Augen, zwei Hände, zwei Ohren haben, und überhaupt alle unsere äußeren Sinnesorgane doppelt vorhanden sind. Damit wir also nur einen einzigen und einfachen Gedanken (…) haben, ist es notwendig, dass es eine Stelle gibt, wo die zwei Bilder (…) sich zu einem verbinden können, bevor sie zur Seele gelangen, damit sie dieser nicht zwei anstatt einem Bild darbieten.“ (Descartes, zit. n. Goller 2003: 85-86)
Descartes‘ Unterscheidung des Menschen in ein denkendes Wesen einerseits und einen mechanischen Körper andererseits ließ die Einheit von Körper und Geist, wie sie von Aristoteles und Thomas von Aquin vertreten wurde, zerfallen. Seine Theorie gab auch neuen Fragen Raum, denen zunächst philosophisch, aber mehr und mehr auch naturwissenschaftlich begegnet wurde: Wie können Bewusstseinszustände Körperzustände verursachen bzw. umgekehrt? Gibt es eine kausale Wechselwirkung? Wenn ja, wo findet diese statt? Die Debatte über das Leib-Seele-Problem wurde durch Descartes engere semantische Eingrenzung des Begriffs ‚Bewusstsein‘ und durch seine substanzdualistische Theorie in eine neue Richtung gelenkt. Eine Erklärungslücke hatte sich aufgetan, und mit ihr eine fast unendliche Anzahl von möglichen Antworten. Eine der vielen philosophischen Strömungen, die aus dieser Fragestellung hervorgingen, war der Funktionalismus, der zurzeit die wohl populärste Deutung in der modernen Leib-Seele-Debatte darstellt, weswegen er im nächsten Kapitel näher erläutert wird.
3.3 Der Funktionalismus
Es war der Popularitätsverlust der sog. Identitätstheorie, die dem Funktionalismus zu seinem Aufstieg verhalf. Die Identitätstheorie, die von den Philosophen Ullin T. Place (1924-2000) und John J. C. Smart (* 1920) formuliert wurde, behauptete, dass mentale Zustände mit neuronalen Zuständen identisch seien. Diese Theorie stellte in den 1950er-Jahren die wichtigste Position in der analytischen Philosophie dar, wurde in den 1960er-Jahren jedoch weitestgehend wieder verworfen. Ein gewichtiges Argument gegen diese Position war der Einwand der „multiplen Realisierung“: Die Identitätstheorie postuliert, dass nur Geschöpfe mit der gleichen anatomischen Konstruktion mentale Zustände hervorbringen könnten. Jedoch sind auch Tiere dazu in der Lage, z. B. Schmerz zu empfinden, obwohl sie ganz andere Gehirne haben und somit auch andere neuronale Zustände. Der amerikanische Philosoph Hilary Putnam (* 1926) formulierte 1960 daher mit seiner funktionalen These einen Ausweg aus dieser Sackgasse. Nach Putnam sind mentale Zustände nichts anderes als funktionelle Zustände, die unabhängig von ihrer konkreten Realisierung sind. (vgl. Ravenscroft 2008: 106- 109) Als Erklärungsbeispiel für dieses Modell dient die Zeitangabe, nach Putnam ebenfalls ein funktioneller Zustand. Zeitangaben können mit unterschiedlichen technischen Geräten gemacht werden, egal ob Sonnenuhr, Sanduhr etc. Aber alle arbeiten sie nach dem gleichen technischen Programm. Ebenso könnten mentale Zustände in unterschiedlichen Nervensystemen realisiert werden. Der Geist verhält sich zum Körper also so wie eine Software zur Hardware. Der Funktionalismus wurde dadurch „zum führenden Paradigma der Künstlichen-Intelligenz-Szene“ (Goller 2003: 125-126).
Allerdings scheiterte die sog. „Starke Künstliche Intelligenz“ bisher an ihrer philosophischen Fragestellung. Im Gegensatz zur „Schwachen Künstlichen Intelligenz“, die zum Ziel hat, Intelligenz zu simulieren, um Anwendungsprobleme durch Computerleistung zu lösen, will die Starke Künstliche Intelligenz Computer mit Bewusstsein und Emotionen schaffen. Die Erklärungslücke wäre dann geschlossen, aber bis jetzt wurden auf diesem Gebiet kaum Fortschritte erzielt:
„Bisher kennen wir nur Maschinen, die das psychologisch erklärte menschliche Verhalten, wenn überhaupt, dann durch interne Mechanismen zustande bringen. Diese internen Mechanismen ähneln psychischen Zuständen sehr wenig oder gar nicht.“ (ebd.: 126)
Der Funktionalismus reduziert Mentales also auf seine kausale Rolle, die dann physisch umgesetzt wird. Am Beispiel des Schmerzes würde dies bedeuten, dass Schmerz einfach nur die kausale Rolle übernimmt für das folgende Schmerz verhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Die Schmerz funktion erklärt jedoch nicht das Schmerz erleben. Dieser Gedanke führt zu einer Problematik, die unmittelbar mit der Erklärungslücke zu tun hat: Wenn das subjektive Erleben (Qualia) eines phänomenalen Zustandes nicht notwendig ist für das funktionelle Verhalten - warum existiert es dann überhaupt? Sowohl in der Philosophie als auch in den Neurowissenschaften wurde diese Frage oft debattiert. Im Folgenden wird auf die Sichtweise von Daniel Dennett und Paul Churchland eingegangen, die jeweils zu unterschiedlichen Lösungsansätzen gelangt sind.
3.4 Daniel Dennett: Bewusstsein als virtuelle Maschine
Daniel Dennett (* 1942) ist gegenwärtig Professor für Philosophie und Direktor des Zentrums für Kognitionswissenschaften an der TUFTS University in Massachusetts/Boston. Seine Werke beschäftigen sich u. a. mit dem freien Willen des Menschen, seinem Bewusstsein, und seiner Religiosität. Dabei offenbaren sie einen naturalistischen Blickwinkel auf den Menschen. Sein Buch „Consciousness explained“ (1991) sorgte in philosophischen wie auch in neurowissenschaftlichen Kreisen für viel Bewegung. Metzinger bezeichnet es sogar als „Initialzündung“ (Metzinger_VL8:08 ff.) für deren Interdisziplinarität der letzten Jahre. Um sich in Dennetts sehr umfangreicher Arbeit nicht zu verlieren, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf drei Aspekte: Seine Sichtweise über Qualia, seine Kritik am sogenannten „Cartesian Theatre“, und schließlich seine Vorstellung darüber, wie Bewusstsein funktioniert, dem „Multiple-Drafts-Model“.
3.4.1 „Quining Qualia“
Schon mit der Überschrift seines berühmten Aufsatzes deutet Dennett die Richtung seiner Argumentation an: „to quine“ ist ein Kunstwort, nach Dennetts Lehrer in Harvard, W. V. O. Quine (1908-2000), benannt. Es bedeutet so viel wie „To deny resolutely the existence or importance of something real or significant“11 12 leich in seiner Einleitung erkennt Dennett an, dass es ein Erleben gibt, dass sich dem radikalen Zweifel entzieht. Selbst wenn dieses Erleben an sich eine Fehlrepräsentation ist, wird nicht bezweifelt, dass sie sich auf eine bestimmte Weise anfühlt: „Descartes claimed to doubt everything that could be doubted, but he never doubted that his conscious experiences had qualia, the properties by which he knew or apprehended them” (Dennett: Qualia). Allerdings möchte Dennett eine bestimmte Vorstellung von Qualia auslöschen. Welche ist das? Da sich Qualia vor allem durch ihren subjektiven Charakter auszeichnen, ist eine endgültige Definition nicht gegeben. Doch wie bereits in Kapitel 2 dargelegt, wird über Qualia traditionell gesagt, dass sie unsagbar („ineffable“), intrinsisch, privat und direkt dem Bewusstsein zugänglich sind.13 Die Faszination, die diese Definition in Menschen erweckt, ist für Dennett unverständlich:
“Qualia are supposed to be special properties, in some hard-to-define way. My claim - which can only come into focus as we proceed - is that conscious experience has no properties that are special in any of the ways qualia have been supposed to be special.” (Dennett: Qualia, Hv. i. O.)
Für ihn sind diese Eigenschaften einfach irrelevant, nicht wichtig genug, um darüber zu reden oder gar ein philosophisches Rätsel daraus zu machen. In der angelsächsischen Philosophie wird stark auf die Relevanz einer Diskussion geachtet: „Differences that make a difference“ (Metzinger VL8_37 ff.). Wenn irgendjemand begriffliche Unterscheidungen einführt, und man kann nicht beobachten, dass sie irgendeinen kausalen Unterschied in der Welt ausmachen, dann ist diese Diskussion nur leere Rhetorik. Dennett kommt daher zu der Schlussfolgerung:
“There is a strong temptation, I have found, to respond to my claims in this paper more or less as follows: ‘But after all is said and done, there is still something I know in a special way: I know how it is with me right now.’ But if absolutely nothing follows from this presumed knowledge (…) what is the point of asserting that one has it? Perhaps people just want to reaffirm their sense of proprietorship over their own conscious states.” (Dennett: Qualia, Hv. i. O.)
Anstatt sich also darin zu verzetteln, irgendwelchen Phantasmen („hallucinatory experiences“ nachzujagen, macht er den Vorschlag, die Berichte über Qualia aus der Erste-Person- Perspektive zwar in die Forschungen mit einfließen zu lassen, aber eben nur als Datensätze, denen noch keine besondere Bedeutung zukommt. Bewusstseinsforschung sollte nur aus der Dritte-Person-Perspektive geleistet werden. Nur aus dieser Perspektive heraus könnte man objektiv erkennen, wie die Dinge wirklich sind, unter Berücksichtigung aller Faktoren und äußeren Einflüssen, und muss sich nicht darauf verlassen, wie sie einer einzelnen Person erscheinen. Dennett prägte für diese Herangehensweise den Begriff „Heterophenomenology“, der sich von der traditionellen „Cartesian Phenomenology“ abgrenzt. Eine zentrale Idee in der zuletzt erwähnten Weltordnung ist das „Cartesianische Theater“ im Gehirn, das Dennett als „der am weitesten verbreitete Denkfehler in der aktuellen Bewusstseinsforschung“ (Metzinger_VL8:58 ff.) bezeichnet.
3.4.2 Dennett und das „Cartesianische Theater“
Ein glücklicher oder unglücklicher Moment im Leben eines Menschen, der erste Kuss, ein Spaziergang am Strand, ein schrecklicher Autounfall, der Tod eines geliebten Menschen - Momente wie diese werden im Augenblick des Erlebens als Szenen mit all seinen Geräuschen, Gerüchen und Gefühlen in unserem Gedächtnis abgespeichert und bei Bedarf auch wieder hervorgeholt. Schon allein die Wortwahl dieses Phänomens zeigt, wie der Mensch im Allgemeinen seine Weltordnung sieht: Die äußere erlebte Welt wird projiziert in eine innere Welt, eine innere Leinwand, „a central (…) theatre where ‚it all comes together“ (Dennett 1991: 107). An diesem zentralen Ort gibt es außerdem einen Zeitpunkt, an dem Bewusstsein in Erscheinung tritt, und auch ein Selbst (Homunculus), das die Szenen betrachtet. Dieses dreidimensionale Gefüge wird von Dennett als “Cartesian Materialism” bezeichnet, den er folgendermaßen definiert:
“Cartesian Materialism is the view that there is a crucial finish line or boundary somewhere in the brain, marking a place where the order of arrival equals the order of "presentation" in experience because what happens there is what you are conscious of.” (Dennett, zit. n. Schneider 2007: 2, Hv. i. O.)
Die Idee einer geistigen zentralen Schaltstelle wurde schon von Descartes vertreten, der - wie in Kapitel 3.1.4 erwähnt - glaubte, dass „die Seele ihren Hauptsitz in der kleinen Drüse in der Mitte des Hirns hat“ (Descartes 1996: 57). Dennett beklagt sich, dass diese Grundidee, die er selbst vehement ablehnt, immer noch bei vielen Forschern der modernen Wissenschaft vorherrscht:
“Many theorists would insist that they have explicitly rejected such an obviously bad idea. But (...) the persuasive imagery of the Cartesian Theatre keeps coming back to haunt us - laypeople and scientists alike - even after its ghostly dualism has been denounced and exorcized.” (Dennett 1991:107)
Tatsächlich beinhaltet die Zielrichtung der Neurowissenschaften die Lokalisation von Bewusstsein, also wie, wo und wann Bewusstsein im Gehirn auftritt. Die „innere Bühne“ wäre dann die letzte Stufe der Informationsverarbeitung im Gehirn, an der die Gesamtheit aller Bewusstseinsinhalte explizit repräsentiert wird. Spätestens hier wird deutlich, wie philosophische Weltanschauungen die Wissenschaft prägen. Wissenschaftler, die sich zum Beispiel der Suche nach dem neuronalen Korrelat der Repräsentationen verschrieben haben (siehe Kap. 5.3), setzen stillschweigend voraus, dass Bewusstsein zeitlich und physisch lokalisierbar gemacht werden kann.
[...]
1 Vgl. online: Schubert, Christian: Der Abstauber des Louvre.
2 Vgl. online: Art-Port: Paris blüht auf: Monets Seerosen.
3 Jedoch befindet sich in meinem Literaturverzeichnis eine Quelle, die eine gesonderte Zitierweise erfordert. Dabei handelt es sich um die universitäre Vorlesung „Philosophie des Geistes“ von Prof. Dr. Thomas Metzinger, die als DVD erhältlich ist. Zitate daraus wurden von mir persönlich transkribiert. Um die Zitate auf der DVD zu finden, habe ich sie beispielsweise wie folgt zitiert: Metzinger_VL8:24 ff. „VL8“ steht hierbei für die Vorlesung Nr. 8, die Ziffern dahinter geben die Minutenanzahl an.
4 Vgl. online: Dennett, Daniel C.: Quining Qualia.
5 Die Neurophilosophie vertritt eine davon abweichende Ansicht. Siehe dazu Kapitel 3.1.7.
6 Siehe Kap. 5.1
7 Vgl. online: Biller, Karlheinz: Der Begriff der Verantwortung und des Gewissens. S. 6.
8 Vgl. online: O’Connor J. J./Robertson, E. F.: Aristotle.
9 Vgl. online: Art Directory: Thomas von Aquin.
10 Online: Kläden, Tobias: Anima Forma Corporis. S. 7 .
11 Online: Dennett, Daniel C.: Quining Qualia. Direkte Zitate daraus werden im Folgenden mit (Dennett: Qualia) gekennzeichnet.
12 Vgl. online: Dennett, Daniel C.: The Philosophical Lexicon.
13 Vgl. online: The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Qualia.
- Arbeit zitieren
- Mirjam Schmid (Autor:in), 2011, Bewusstseinsmodelle im Lichte der Philosophie, der Psychologie und den Neurowissenschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167012
Kostenlos Autor werden

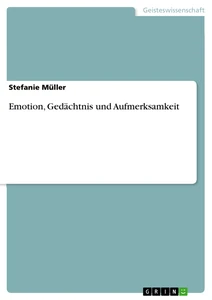














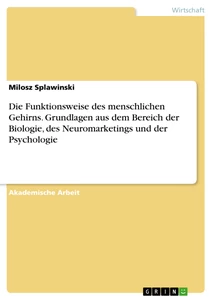

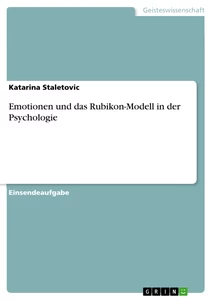



Kommentare