Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sozialisation: Eine Interaktionserfahrung und ein konstruktiver Lernprozess
2.1 Berufliche Sozialisation
2.1.1 Sozialisation von Pflegekräften
2.1.2 Sozialisation von Ärzten
2.2 Die Rolle und ihre Funktion in Organisationen
2.2.1 Die Rolle der Pflegekraft
2.2.2 Die Rolle des Arztes
3. Identität
4. Das Selbstbild: Ein Konstrukt aus Eigen- und Fremdwahrnehmung
4.1 Wie wird ein Selbstbild konstruiert?
4.1.1 Soziale Interaktion und ihre Auswirkung auf den Konstruktionsprozess
4.1.2 Kulturabhängigkeit
4.1.3 Personen- und Gruppenabhängigkeit: Soziales Umfeld
4.2 Funktion des Selbstbildes über die Lebensspanne
4.3 Bewertung des Selbstbildes
5. Pflege im Wandel der Zeit
5.1 Historische Entwicklung des Pflegeberufs
5.2 Pflegewissenschaft: Die Pflege auf dem Weg zur Professionalisierung
6. Soziale Wahrnehmung
6.1 Wahrnehmung der Pflegekräfte durch die Gesellschaft
6.1.1 Wahrnehmung des Berufsbilds Krankenpflege
6.2 Wahrnehmung aus dem Blickwinkel des Patienten
6.3 Wahrnehmung der Pflege aus Sicht der Ärzte
6.4 Berufliches Selbstbild der Pflegenden: „Mädchen für Alles“
7. Arbeit im Krankenhaus
7.1 Probleme des modernen Pflegeberufs
8. Interaktion
8.1 Die Interaktion als System der Gesellschaft
8.2 Symbolischer Interaktionismus
8.3 Soziale Interaktion und Kommunikation
8.4 Interaktion zwischen Pflegekraft und Arzt
8.5 Möglichkeiten der Interaktion innerhalb der Organisation Krankenhaus
9. Fazit
10. Anhang
I Berufsbild Gesundheits- und Krankenpfleger/- in von der Bundesagentur für Arbeit
II Genfer Ärztegelöbnis
11. Literaturangabe
1. Einleitung
Die Interaktion zwischen Pflegkräften und Ärzten im Krankenhaus wird gerade von Pflegekräften als schwierig und problematisch empfunden.1 So ergab sich die Frage, woraus diese Schwierigkeiten resultieren, und wie sie sich auf das berufliche Selbstbild der Pflegenden auswirken.
Innerhalb dieser Arbeit sollen Faktoren dargestellt werden, die auf die Entwicklung und Ausbildung des Selbstbildes Einfluss nehmen können und wie sie sich in der Interaktion auswirken.
Die Arbeit ist so strukturiert, daß in den ersten Kapiteln die theoretischen Grundlagen des Themas geschaffen werden. Es folgt ein Überblick über die historische Entwicklung des Pflegeberufs und endet mit der Darstellung der Interaktion von Pflegekräften und Ärzten, welche als ein zentraler Faktor für die Ausbildung des beruflichen Selbstbilds der Pflegenden angesehen wird. Dabei kann die Interaktion als soziale Interaktion und als Interaktionssystem verstanden werden.
Als zentrales grundlegendes Moment für die Ausbildung von Identität und Individualität wird von vielen Autoren, wie zum Beispiel Krappmann, Geulen, Mummendey, Greve, Filipp, die Interaktion benannt. Sie ist somit als zentrale Struktur anzusehen, die Subjektivität produziert und hervorbringt. Die Interaktion stellt sich daher als Dreh- und Angelpunkt für Entwicklungsprozesse des Individuums und den daraus resultierenden Möglichkeiten und Determinierungen dar.
2. Sozialisation: Eine Interaktionserfahrung und ein konstruktiver Lernprozess
Der Begriff „Sozialisation“ ist ein weitgefasster Begriff, der einen Entwicklungsprozess des Menschen darstellt, in dem es zu einer inneren Verarbeitung, der in Tätigkeiten mit der Umwelt gemachten Erfahrungen kommt2 und die sich im Handeln des Menschen zeigt. Die Umwelt gibt dafür die gesellschaftlichen (und kulturellen) Regeln, Normen und Werte vor. Diese kollektiven Werteorientierungen werden internalisiert, dienen der Ausbildung von Identitäten und spielen eine entscheidende Rolle für die Sozialisation. Der lebenslange Lernprozess nimmt somit Einfluss auf die Persönlichkeit des Menschen und macht ihn gesellschaftlich handlungsfähig.3 Damit wird zukünftiges Verhalten und Handeln determiniert und erhält im gesellschaftlichen Kontext seine Bedeutung. „Sozialisation ist (damit) der gesellschaftlich vermittelte Lernprozess, durch den Menschen sich individuell und kollektiv in einem bestimmten sozialen System orientieren und tätig werden.“4
Es scheint eine Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner inneren Realität und der Umwelt als äußerere Realität zu bestehen. Der Mensch kann so auch als Mit- Produzent seiner eigenen Entwicklung angesehen werden. Das Individuum verarbeitet und interpretiert seine Umwelt und beteiligt sich an der Konstruktion seiner sozialen Lebenswelt. Damit kommt es zu einer wechselseitigen Beeinflussung von Individuum und Umwelt.
Bei der Lebenswelt- ein Begriff der ursprünglich aus der Bewusstseins- philosophie E. Husserls stammt- handelt es sich um „einen intersubjektiv geteilten Wissensvorrat, der in Sozialisationsprozessen erworben werden muss und die Subjekte dazu befähigt den Dingen ihrer Umwelt Bedeutung zu verleihen. Über diese Bedeutung erfolgt eine Verständigung mit anderen.“5 „Der Mensch kann nach dieser Vorstellung seine Welt und seine eigenen Handlungen in ihr mit Bedeutungen versehen […] er entwickelt auf diesem Wege Selbstbild und Bewusstsein.“6 Es entfalten sich die subjektiven Handlungsbedingungen wie Wert- und Zielvorstelllungen, Motive und Handlungsdispositionen.
Die Sozialisation als „[…] ein wesentlicher Teil unserer Identitätsentwicklung“7 hat dadurch auch Auswirkungen auf alle Aspekte des Individuums: die Persönlichkeit, die Identität, das Selbstbild. Sozialisation stellt den Menschen als Subjekt ins Zentrum und ist für seine Konstitution notwendige Voraussetzung. Die Konstitution des Subjekts erfordert die Reflexion und Interpretation von Situationen und Ereignissen, um gesellschaftlich handeln zu können. So zeigt sich Sozialisation in beobachtbarem Verhalten und ist damit das „Ergebnis reflektierter Erfahrungen.“8 Somit ist die Sozialisation ein komplexes kausales Geschehen, in dem das Subjekt als solches, und zwar unter eigener aktiver Beteiligung, konstituiert wird.9
Das Ziel der Sozialisation soll ein gesellschaftlich handlungsfähiges Subjekt sein, welches im Laufe dieses Prozesses mit divergierenden Interessen konfrontiert wird und diese ausbalancieren kann. Es besteht ein dauerhaftes Spannungsverhältnis zwischen innerer und äußerer Realität. Die Herstellung einer Balance zwischen diesen Realitäten führt im Ergebnis zu einer eigenen stabilen Identität, die jedoch über die Lebensspanne auch veränderbar also flexibel ist.
Der Vorstellung von Bourdieu zu Folge wird durch Sozialisation ein Habitus aufgebaut, der als ein System relativ dauerhafter Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsmuster verstanden werden kann. Diese Muster sind das Resultat der sozialen Struktur, die durch Sozialisation erreicht wurde.10 Allerdings ist auch der Habitus eine dynamische Instanz, die in einem ständigen Wandel begriffen ist. Er bestimmt das Handeln und wird zudem als vermittelnde Instanz zwischen subjektiven und objektiven Dimensionen der sozialen Existenz angesehen. Diese Vorstellung lässt das Bild einer autonomen selbstbestimmten Persönlichkeit jedoch nicht zu.11 Die Existenz des Individuums wird durch die gesellschaftlichen Bedingungen entscheidend beeinflusst und determiniert.
Insgesamt sind sich alle Vertreter verschiedener wissenschaftlicher Ausrichtung darin einig, dass der Sozialisationsprozess dazu führt ein Individuum erfolgreich an Interaktionsprozessen teilnehmen zu lassen und diese Fähigkeit in einem lebenslang andauernden Prozess erlernt wird. Innerhalb des Sozialisationsprozesses bildet sich die persönliche Identität aus und daraus folgend sind unterschiedliche Handlungspotentiale für das Individuum vorhanden. Innerhalb dieser Prozesse können auch typische „Tugenden“ oder Verhaltensweisen für Männer und Frauen erlernt werden. Die Prozesse sind in Abhängigkeit von den kognitiven Strukturen des Individuums zu sehen. So kann eine Reflexion der bisherigen Sozialisation auch Richtungsänderungen (beruflich wie privat) mit sich bringen, wobei die Reflexionsmöglichkeit ebenfalls als Ergebnis der bisherigen Sozialisation zu betrachten ist.12
2.1 Berufliche Sozialisation
Die berufliche Sozialisation ist als ein Teil der Sozialisation zu sehen.
Dieser Prozess dient dazu das Individuum in einen beruflichen Kontext zu integrieren und ihn im Beruf handlungsfähig zu machen. Die berufliche Sozialisation wird nicht mit dem Ende einer Ausbildung oder eines Studiums abgeschlossen, sondern zieht sich durch das gesamte Erwerbsleben.
Der Beruf ist ein wesentliches Element der Identität einer Person. „Die Erfahrung der beruflichen Tätigkeit […] stellt einen zentralen Kern der Orientierung im eigenen Leben dar […].“13
Das Individuum sucht aktiv und autonom bestimmte Sozialisations-kontexte (z.B. Wahl der Ausbildung, berufliche Tätigkeit) auf, wobei dieser Prozess von seiner bisherigen Biographie und damit seiner Sozialisation bestimmt wird, der häufig noch geschlechtsspezifisch geprägt ist.
Beispielsweise geben 53% der nach ihrer Berufsmotivation befragten Auszubildenden im Pflegeberuf an den Beruf gewählt zu haben, weil sie Menschen helfen wollen,14 ein als typisch weiblich eingestuftes Motiv.
Gerade die Ausbildung hat einen entscheidenden Einfluss auf das spätere Berufsleben. Hier werden Grundlagen und Kompetenzen für die berufliche Zukunft geschaffen und es kommt zum Erlernen einer Rolle, die es dann zukünftig zu spielen oder zu reformulieren gilt. Hier wird auch der Grundstein für eine zukünftige berufliche Identität gelegt. Wie eine „Schweizer Lehrlingsstudie“ (Längsschnittstudie) zeigte wirkt sich die Ausbildung auf die individuellen Persönlichkeitsstrukturen aus, indem es zu einer Konkretisierung der eigenen Stellung in der Gesellschaft, dem eigenen Verhältnis zum Beruf, eines tragfähigen Selbstkonzepts und Geschlechtsrollenvorstellungen kommt.15 Die Persönlichkeitsstrukturen werden in interaktiven Prozessen ausgebildet.
Über die Berufswahl erfolgt eine Weichenstellung im Hinblick auf die zukünftigen beruflichen Möglichkeiten bzw. Entscheidungen. Es werden somit auch Einschränkungen vorgenommen, die künftig nicht mehr rückgängig zu machen, sondern nur noch zu korrigieren sind, wobei der dazu nötige Eigenbeitrag des Individuums und seine subjektive Realitätsverarbeitungsfähigkeit16 berücksichtigt werden müssen.
2.1.1 Sozialisation von Pflegekräften
Die Sozialisation von Krankenpflegekräften beginnt in der Regel mit der Ausbildung. Diese geschieht bis heute weder nach dem Berufsbildungsgesetz als >>Lehre<< mit einer festen Verankerung im allgemeinen Berufsschulwesen, noch ist sie bis dato durchgängig in wissenschaftlichen Ausbildungsgängen organisiert.17 Zu einer Veränderung hinsichtlich dieser Voraussetzungen wird es durch das Angebot eines dualen Studiengangs ab Herbst 2010 kommen. Dann besteht die Möglichkeit im Studium- neben der Pflegeausbildung- ein breites Wissen und Können im Pflegehandeln zu erwerben.18 Die Umgestaltung der Pflegeausbildung wird zukünftig Auswirkungen auf die berufliche Sozialisation haben und damit zu einem Wandel im Berufsbild der Krankenpflege führen können.
Aktuell überwiegt jedoch noch der praktische Anteil innerhalb der 3 jährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger/-in. Diese wird nach wie vor an Krankenpflegeschulen absolviert, die einem Krankenhaus angegliedert sind, welches damit auch der Träger ist. Durch mangelnde gesetzliche Vorgaben ist jede Schule relativ „frei“ die Unterrichtseinheiten inhaltlich zu besetzen. Diese Freiheit schafft darüber hinaus auch Platz für eine autonome Gestaltung der Unterrichtsinhalte und Ziele. Dennoch sollte die Pflegeausbildung nicht weiter außerhalb des öffentlichen Schul- und Hochschulwesens oder ohne klare Anbindung daran fortgeführt werden.19
Die praktische Ausbildung erfolgt im Krankenhaus mit Einsätzen auf verschiedenen Stationen. Die Schüler/-innen erfahren innerhalb dieser Einsätze, daß sie sich in einer immer noch hierarchisch strukturierten und in der Regel geschlechtsregierten, d.h. männerdominierten, Institution befinden, die zudem stark auf die Medizin und Wissenschaft ausgerichtet ist, was sich besonders in universitären Einrichtungen zeigt.
Die zunehmende Technisierung im Krankenhaus führt dazu, dass Tätigkeiten, die originär der Pflege zugeordnet sind, heute einen geringeren Stellenwert als früher einnehmen. Als Beispiel sei hier erwähnt die Krankenbeobachtung, die durch den Einsatz von Monitoren und anderen technischen Hilfsmitteln nicht mehr so erlernt wird wie dies bis anhin der Fall war. Es wird ein zunehmend höheres Vertrauen in die vorhandene Technik gesetzt als in die eigenen Fähigkeiten.
Die Schüler eigenen sich während der Ausbildung theoretisches und praktisches Wissen an und lernen schnell, daß es einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt und die Umsetzung des in der Schule Erlernten im klinischen Alltag kaum oder nur eingeschränkt möglich ist.
In der Ausbildung werden somit die Grundlagen für das berufliche Selbstverständnis gelegt. „Die Weichen für die berufliche Identität in der Krankenpflege werden in der Ausbildung gestellt.“20
In der weiteren beruflichen Sozialisation im Anschluss an die Ausbildung, machen Pflegekräfte bedingt durch die Umstrukturierung des Gesundheitswesens21 die Erfahrung, daß ihr Arbeitsbereich Veränderungen erfährt, die häufig dazu führen, daß ihre pflegerische Tätigkeit nicht mehr offensichtlich ist, eine Folge der zunehmenden Arbeitsteilung. Zusätzlich gibt es Bestrebungen den Pflegekräften die Übernahme bestimmter ärztlicher Tätigkeiten zu ermöglichen.22 Dies führt dazu, daß die Trennschärfe von pflegerischen und ärztlichen Tätigkeiten immer weiter abnimmt, und für die Patienten und somit auch für die Gesellschaft immer weniger sichtbar ist was Pflege beinhaltet und wo sie sich von der Medizin abgrenzt. Es fehlt das sichtbare Selbstverständnis eigener Professionalität der Berufsgruppe der Pflegenden, um Abgrenzung und in der Folge Kooperation zu ermöglichen.
2.1.2 Sozialisation von Ärzten
Der Beruf des Arztes wird schon lange Zeit als Profession angesehen, d.h. es gibt einen gesellschaftlichen Auftrag für die Tätigkeit, sie beinhaltet Autonomie, öffentliche Anerkennung, Prestige, Macht und Autorität.23 Der Beruf ist bis anhin noch eine Domäne der Männer und somit dienen diese auch als Vorbilder für die ärztliche Sozialisation, die geschlechtsspezifische Normen wie Separation und Unabhängigkeit transportiert.24
Die Medizin ist eine „zweckrational- wissenschaftlich orientierte Profession“25, dies hat zur Folge, daß die Wirkungen zwischenmenschlicher Interaktionen nicht ausreichend berücksichtigt werden, was sich in der Auswirkung vor allem für somatische Stationen zeigt. Auf Stationen, die Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen behandeln, sind die interaktiven Kompetenzen gerade der Ärzte deutlich stärker ausgeprägt, was mit der Art der zu behandelnden Erkrankungen in Zusammenhang zu bringen ist26 und der erforderlichen zusätzlichen sozialwissenschaftlichen Ausrichtung der Ärzte.
Die Ausbildung der Mediziner erfolgt an Universitäten, die den Studenten die theoretischen Grundlagen vermitteln, welche dann im beruflichen Umfeld des Krankenhauses Anwendung finden. In der universitären Ausbildung werden die zukünftigen Mediziner anscheinend nicht angemessen auf ihre beruflichen Herausforderungen vorbereitet. Die Aneignung von Basiswissen ist nicht ausreichend, um angemessen auf die beruflichen Herausforderungen (Umgang mit Tod und Sterben, Gespräche mit Patienten und Angehörigen, Kommunikation mit
verschiedenen Berufsgruppen) vorzubereiten.27 Gerade
Interaktionskompetenzen werden erst in der beruflichen Praxis erlernt. Es fehlt der direkte Praxisbezug während des Studiums. Da in der Regel erst nach Abschluss des Studiums die Einsätze im Krankenhaus erfolgen.
Im Lauf des Studiums kommt es zur Verinnerlichung der ärztlichen Rollennormen, zu denen laut Talcott Parsons:
- Affektive Neutralität: Übernahme einer Expertenrolle ohne eigene Bewertungen
- Funktionale Spezifität: soll der Erhaltung des professionellen Expertenstatus dienen
- Kollektivitätsorientierung und Universalität: die eigenen Interessen werden zurückgestellt28
gehören. Auch im Genfer Ärztegelöbnis,29 welches seit 1950 die Präambel der deutschen Ärztekammer bildet und den Hippokratischen Eid abgelöst hat, zeigen sich diese Rollennormen und Vorstellungen von ärztlichem Tun. Hinzu kommt der hohe bestehende Anspruch an die Ärzte möglichst keine Fehler in der Patientenbehandlung zu machen.
Aus den genannten Rollenerwartungen entsteht eine große Kluft zum tatsächlichen Handeln des Arztes im Krankenhaus. Erst im praktischen Einsatz im Krankenhaus werden die notwendigen Fähigkeiten zur Interaktion und Verarbeitung von belastenden Situationen erlernt. Trotzdem gibt es laut Siegrist heute nur wenige Berufsgruppen, die in so umfangreichem Maße wie die Ärzteschaft in der Lage sind, berufliche Autonomie auszuüben.30
So ist „ […] die Sozialisation zum Arzt ein bisher in Theorie und Praxis gleicherweise unterschätztes Thema geblieben.“31
Um den genannten Problemen im Medizinstudium besser begegnen zu können hat beispielsweise die Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Köln ein Studierendenhaus gebaut. Hier können unter realistischen Bedingungen technische Fähigkeiten ebenso wie die Gesprächsführung erlernt werden.32 Allerdings besteht weiterhin der Fokus auf dem Erlernen von praktischen Fähigkeiten und nicht den interaktiven Kompetenzen. Die zunehmende Technisierung bringt ein zusätzliches Dilemma zwischen instrumentellem (Einsatz von Geräten zur Diagnose und Therapie) und kommunikativem Handeln mit sich und führt häufig zur Fokussierung auf das instrumentelle Handeln zu Lasten der Kommunikation mit den Patienten und ihren Angehörigen.
2.2 Die Rolle und ihre Funktion in Organisationen
Die Rollentheorie wurde durch Talcott Parsons begründet. Laut Parsons impliziert die Rolle als normative Erwartung das Abgeben von Individualität des Individuums zugunsten eines funktionierenden Systems. Die Erwartung basiert auf Normen und Werten. Parsons prägte den Begriff des Rollenhandelns. Wird die Rolle nicht in der erwarteten Form ausgefüllt kommt es zu sozialen Sanktionen, die laut Parsons von Menschen vermieden werden wollen. Diese Vorstellung schränkt den Freiheitsgrad des Handelns eines jeden Einzelnen ein und es kommt zu einem individuellen Autonomieverlust, womit das Handeln ein von außen gesteuertes Handeln wird. So nehmen Kultur und Gesellschaft eine zentrale Rolle in dieser Theorie ein. Die Übernahme einer Rolle erfolgt im Sozialisationsprozess, der als Prozess des Erlernens einer Rolle verstanden wird, und dazu dient die Stabilität der Gesellschaft zu erhalten. Es soll eine „störungs- und konfliktfreie Zusammenarbeit“33 gewährleistet werden. Dabei wird die Rollenkompetenz im Laufe des Lebens ständig erweitert. Die Rolle wird so als ein soziales Muster unabhängig vom Individuum verstanden34 und dient der Abgrenzung.
Der Vorstellung von Parson widersprechen verschiedene Wissenschaftler wie zum Beispiel Habermas und Goffman. Sie gehen davon aus, daß es nicht notwendig ist die „Rolle vollständig zu internalisieren, um erfolgreich handeln zu können“35, sondern daß durchaus Spiel- und Handlungsräume innerhalb der Rolle vorhanden sind, die der Individualität des Individuums Rechnung tragen. Hier wird der Begriff des sozialen Handelns eingeführt, welcher mit der Auffassung einhergeht, daß Handeln und damit Interaktion innerhalb eines gemeinsamen Symbolsystems und unter Verwendung der verbalen Sprache stattfinden.36
Rollen sind jeweils mit einer bestimmten Vorstellung verknüpft, wobei das Individuum nicht nur eine Rolle innehat, z.B. man kann gleichzeitig Mutter und Kind sein. Die Übernahme einer Rolle ist dennoch mit einer Einschränkung der persönlichen Autonomie verbunden, da bestimmte Verhaltensweisen und Erwartungen in den Rolleninhaber geknüpft sind. Der jeweils Handelnde ist nur mit einem Teil seines „Selbst“ beteiligt. Die Vorgaben bzw. Vorstellungen über die Rolle können zudem von jedem Individuum eine eigene Interpretation erhalten. Diese „Differenz zwischen Norm und Verhalten bestimmt den Grad der Rollenkonformität.“37 Die bestehenden Normen dienen dazu Erwartungen in sozialen Systemen aufzubauen und diese zu stabilisieren. Dabei sind die Normensysteme selektiv, werden innerhalb des Systems hierarchisiert und haben bestimmte Adressaten, für die sie maßgeblich sind.38 So können Normen auch als positive Voraussetzung für das Handeln des Subjekts angesehen werden und nicht als repressive Einschränkung von Handlungsimpulsen.39
Innerhalb einer Organisation dient die Übernahme einer Rolle dazu die Handlungen des jeweiligen Individuums zu determinieren. Diese Determinierung erfolgt durch bestehende Verhaltensweisen und Erwartungen, die an die Rolle gebunden sind. Damit dient eine Rolle als Inklusionsfaktor und ordnende Struktur40 in einer Organisation, wie z.B. dem Krankenhaus. Sie bietet einen Rahmen für Handlungen und ist Voraussetzung für Mitgliedschaft in verschiedenen Systemen, die jeweils bestimmte Ausschnitte des Handelns verlangen. Dies gilt vor allem für Institutionen, deren Mitglieder sich an vorgegebenen Verhaltensweisen zu orientieren haben und so Verhalten vorhersehbar wird. Allerdings sind Rollenerwartungen häufig widersprüchlich, so daß es unmöglich ist allen Erwartungen zu entsprechen. „Erwartungen an Rollen können sehr unterschiedlich sein und das Individuum muss mit den zum Teil widersprüchlichen Erwartungen fertig werden.“41
Damit bietet die Rolle aber auch Interpretations- und Toleranzspielräume und gibt Möglichkeiten für Handlungsspielräume vor. Hier kann sich das Individuum selbst repräsentieren und gegebenenfalls aus der Rolle heraustreten. Diese Handlungsspielräume bieten Raum für die Selbstdarstellung des Einzelnen und seiner Individualität. „Individuen gehen (so) nicht bruchlos in sozialen Rollen auf, sondern sie erleben soziale Realität als ein ihnen gegenüberstehendes Objektives, dem sie eine eigene Identität entgegensetzen […].“42
Für das Gesundheitssystem impliziert die Rollenübernahme, daß die Angehörigen der verschiedenen Berufsgruppen (hier bezogen auf Ärzte und Pflegekräfte) sich in unterschiedlichen sozialen Positionen befinden, die aus der jeweiligen sozialen Rolle heraus resultieren. Beispielsweise führt die zugewiesene Rolle innerhalb des Systems Krankenhaus zu einem unterschiedlich hohen sozialen Ansehen in der Gesellschaft.
Die Rigidität des jeweiligen Rollensystems ist dabei abhängig vom jeweils gewährten institutionellen Spielraum, welcher auch zur Stabilisierung von Machtbeziehungen führen kann. So besteht die Herausforderung an die Rolle in der „[…] Fähigkeit, Rollenambiguitäten bewusst zu ertragen, eine angemessene Repräsentation des Selbst zu finden und verinnerlichte Normen auf neue Lagen flexibel anzuwenden.“43
Hinzu kommt im Rollengefüge des Krankenhauses, daß die verschiedenen Rolleninhaber (Pflege und Medizin) über unterschiedliche Werte und Normen verfügen, was häufig zu Konflikten führt und so kommt es zum Teil dazu, daß sich die Rolleninhaber entgegen ihrer Überzeugungen, Werte und Dispositionen verhalten.“44 Beispielsweise erfolgt die Durchführung ärztlicher Anordnungen zum Teil entgegen der Vorstellungen und Werte der Pflegekräfte. So besteht ein Wertekonsens jeweils in den Berufsgruppen aber nicht Berufsgruppen übergreifend.
Das Aushalten verschiedenartiger und teilweise sogar widersprüchlicher Erwartungen und Ansprüche wird als Ambiguitätstoleranz beschrieben und führt zum Ausbalancieren der Rollenerwartungen. Zur Realisierung ist es nötig, nicht nur die eignen Interessen zu entfalten, sondern dies auch dem Interaktionspartner zuzugestehen.45
2.2.1 Die Rolle der Pflegekraft
Die Rolle der Pflegekräfte wird häufig verknüpft mit der Vorstellung, daß sie die Arbeit unter dem Aspekt der Selbstlosigkeit und damit unter Rückstellung ihrer eigenen Interessen ganz im Sinne des Patienten und seiner Erkrankung ausführen. Die Aufgabe der Pflege wird als Kompensation gesundheitsbedingter Einschränkungen, zur Vorbeugung von Kompetenzverlusten und Hilfe zum Erlernen eines selbständigen Umgangs mit einer Erkrankung angesehen.46
Auch wird die Pflegekraft meist mit einer weiblichen Person assoziiert, deren „schönste Pflicht das Dienen“ ist.47 Daher wird angenommen, daß diese Tätigkeit auch ohne eine hochqualifizierte Ausbildung auszuführen ist. „Diese Ideale und Normen, die größtenteils zur Zeit ihrer Entstehung (in eine bestimmte Richtung) geprägt wurden […], (sind) zu allgemeinen Berufsnormen geworden.“48
Die Pflegekraft ist dem Arzt hierarchisch untergeordnet und ihre Tätigkeit steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arzt und seinen Anordnungen.
Die zunehmende Arbeitsteilung und Neuorientierung im Krankenhaus hat dazu geführt, daß das Tätigkeitsgebiet der Krankenpflege nicht mehr klar von anderen Tätigkeiten und Berufsgruppen (wie Reinigungspersonal, und Servicekräfte) abzugrenzen und damit die Rolle der Pflege „unschärfer“ geworden ist. „Verzichten die Pflegenden auf Abgrenzung, unterlassen es die eigene Rolle zu definieren, dann […] ist die Kooperation mit den Ärzten nicht mehr positiv und chancenreich.“49 Diese mangelnde oder klare Trennung hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Umwelt. Die Pflegekraft wird als „Mädchen für alles“ gesehen und nicht als eine qualifizierte Fachkraft, die für die Pflege des Patienten zuständig ist.
Die Pflegekraft ist unterschiedlichen und zum Teil divergierenden Erwartungen ausgesetzt, die es zu erfüllen gilt. Hier besteht auf der einen Seite der Anspruch den Patienten und seine Angehörigen kompetent zu betreuen und zu beraten, auf der anderen Seite den Arzt bei der Diagnose und Therapie zu unterstützen. Hinzu kommen die organisationalen Erwartungen seitens des Krankenhauses, wie zum Beispiel ressourcenoptimiertes Arbeiten.
Die Rolle der Pflegekraft erhält scheinbar dann eine Veränderung, wenn das jeweilige Individuum über eine hohe Fachkompetenz verfügt. Dies scheint mit ein Grund zu sein, warum Pflegekräfte beispielsweise auf Intensivstationen eine höhere Anerkennung zu Teil wird als denen auf einer Allgemeinstation. Hinzu kommt sicherlich, daß gerade auf Intensivstationen der Kontakt zu Ärzten wesentlich häufiger ist als dies auf anderen Stationen der Fall ist und die Pflege hier die intensive und umfassende Versorgung des Patienten übernimmt.
Die eigene Interpretation der Rolle gibt der Pflegekraft die Möglichkeit das eigene Handeln zu bestimmen und damit neue Handlungsoptionen für sich zu schaffen. Die Re-Definition der Rolle birgt Konflikte in sich und erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexivität. Man muss die eigene Rolle neu definieren.
2.2.2 Die Rolle des Arztes
Innerhalb des Krankenhauses und in der Gesellschaft zeichnet sich die Rolle des Arztes durch die Vorstellung aus, daß dieser einen großen Anteil am Heilungs- und Genesungsprozess des Patienten hat. Damit einhergehen hohe gesellschaftliche Erwartungen an das Können des Arztes. Die „ärztliche Macht erhält sich bis heute nicht aufgrund von Wissen, sondern aufgrund ihrer strukturellen Verankerung“50 in der Organisation Krankenhaus. Diese Überlegenheit wird aufgrund des höheren Bildungsabschlusses und der hochqualifizierten universitären Ausbildung des Mediziners akzeptiert. Die Dominanz des Arztes und seiner Rolle wird von manchen weiblichen Pflegekräften nach wie vor anerkannt und damit auch zementiert, was zum Teil als Resultat des individuellen Sozialisationsprozesses angesehen werden kann.
Die Erwartungen an den Arzt erfordern wie schon erwähnt Kompetenz, Neutralität, Unvoreingenommenheit und Uneigennützigkeit.
Die Rolle impliziert einen hohen Grad an Entscheidungskompetenz und Handlungsautonomie einhergehend mit einer prominenten Stellung in der Krankenhaushierarchie, die auch als zum Teil notwendiges Ordnungsprinzip angesehen werden kann, um Entscheidungen zu beschleunigen (z.B. in Notfallsituationen). Der Arzt ist verantwortlich für die Erhebung der Diagnose und die Durchführung der jeweiligen Therapie. Er entscheidet über die Handlung, die bei der Feststellung von Krankheit zu erfolgen hat (binäre Codierung nach Luhmann gesund/krank51 ). Damit obliegt dem Arzt die Kontrolle über den medizinischen Arbeitsprozess und er beansprucht darüberhinaus auch die Kontrolle über das arbeitsteilige Geschehen. Diese Kontrollfunktion wird jedoch zunehmend an andere Berufsgruppen übertragen, um der Qualitäts- und Kostenoptimierung im Krankenhaus Rechnung zu tragen, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement, Controlling, Finanzwesen, Bettenbelegung.
3. Identität
„Der Identitätsbegriff bezieht sich auf komplexe subjektive Sachverhalte, daher wird er oft ungenau und mehrdeutig verwendet und lässt sich kaum präzise definieren, geschweige denn operationalisieren.“52 Die Identitätsentwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der von einer heterogenen Anzahl von Faktoren beeinflusst wird. Es handelt sich bei der Identität um ein theoretisches Konstrukt, welches die subjektive Verarbeitung von objektiven Ereignissen in Interaktionsprozessen darstellt. Damit ist „in die Konzeptualisierung von Identität das soziale Gegenüber mit einbezogen.“53
Die Identität kann als das Resultat eines selbstreflexiven Prozesses angesehen werden.54 Sie wirkt als organisierende und koordinierende Instanz der Persönlichkeit. Damit ist die Identität keine von Geburt an bestehende Eigenschaft, sondern das Produkt von Interaktions- und Sozialisationsprozessen des Menschen. Sie wird verstanden als das relativ stabile Wertgefüge einer Person, welches eine Berechenbarkeit des Menschen zur Folge hat und die Planung und Steuerung des Verhaltens ermöglicht.55 Sie ist in Abhängigkeit von selbstbezogenen und aussenweltbezogenen Erfahrungen zu sehen, somit nicht statisch und daher eher als aktive „Systembildung“ zu verstehen.
[...]
1 Vgl. Lorenz, Alfred L. (2000): Abgrenzen oder zusammen arbeiten. Krankenpflege und die ärztliche Profession. Frankfurt am Main: Mabuse-Verl., S. 194.
2 Vgl. Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie. Sozialisation als Epigenese des Subjekts in Interaktion mit der gesellschaftlichen Umwelt. Weinheim: Juventa-Verl., S. 76.
3 Vgl. Rothgangel, Simone; Schüler, Julia; Müller, Bringfried (2010): Kurzlehrbuch Medizinische Psychologie und Soziologie. 2., überarb. Aufl. Stuttgart: Thieme, S. 109.
4 Rieländer, Maximilian (1990): Die Subjektivität und Einheit der Person aus der Sicht psychologischer Begriffe. Referat, S. 9.
5 Vgl. Hoffman, Peter (2005): Eine Kritik kulturalistischer Verkürzungen. Zum Verhältnis von
Interaktion und Gesellschaft bei Habermas und Luhmann. Hausarbeit zum Hauptseminar Kulturund Wissenssoziologie: Asymmetrie- Problem und Lösung. Dozenten: Armin Nassehi, Irmhild Saake. Ludwig-Maximilians- Universität München, Institut für Soziologie, S. 10.
6 Abels, Heinz (2007): Einführung in die Soziologie. Band 2: Die Individuen in ihrer Gesellschaft. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, S.98.
7 Hurrelmann, Klaus (2008): Handbuch Sozialisationsforschung. 7., vollst. überarb. Aufl. Weinheim und Basel: Beltz, S. 402.
8 Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 109.
9 Vgl. Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 168.
10 Vgl. Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 79.
11 Vgl. Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation. Erläuterungen- Texte- Arbeitsaufgaben. 4., durchgesehene Aufl., Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 202.
12 Vgl. Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 267.
13 Frey, Hans- Peter; Haußer, Karl (1987): Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart: Enke Verlag, S. 71.
14 Vgl. Höpfner-Kröger, Margot Louise (1993): "Historische Aspekte zur Pflege-Berufskunde". 1. Auflage. Oldenburg: Pflege-Publiziert-Verl., S.100.
15 Vgl. Lempert, Wolfgang (2007): Theorien der beruflichen Sozialisation. Kausalmodell, Entwicklungstrends und Datenbasis, Definitionen, Konstellationen und Hypothesen, Desiderate und perspektiven. IN: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 103. Band, Heft 1, S. 12- 40, S. 23.
16 Vgl. Lempert, Wolfgang (2007): Theorien der beruflichen Sozialisation, S. 33.
17 Vgl. Lorenz, Alfred L. (2000): Abgrenzen oder zusammen arbeiten, S. 180.
18 Vgl. Bibliomed- News vom 07.05.2010.
19 Vgl. Robert Bosch Stiftung (2000): Pflege neu denken. Zur Zukunft der Pflegeausbildung. Stuttgart, New York: Schattauer, S. 19.
20 Taubert, Johanna (1992): Pflege auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis. Berufliche Entwicklung zwischen Diakonie und Patientenorientierung. Frankfurt am Main: Mabuse- Verlag, S. 32.
21 Vgl. Kreutzer, Susanne (Hg.) (2010): Transformationen pflegerischen Handelns. Institutionelle Kontexte und soziale Praxis vom 19. Bis 21. Jahrhundert. Osnabrück: V&R unipress,S. 30- 31.
22 Großkopf, Volker (2007): Die Delegationsverantwortung. Neuverteilung der Aufgaben im
Gesundheitswesen. Vorlesung an der Kath. Hochschule NW, Köln; Vorlesungsunterlagen, S. 1-15.
23 Vgl. Lorenz, Alfred L. (2000): Abgrenzen oder zusammen arbeiten, S. 27.
24 Vgl. Cilligan, Carol IN: Tewes, Renate (2002): Pflegerische Verantwortung. Eine empirische Studie über pflegerische Verantwortung und ihre Zusammenhänge zur Pflegekultur und zum beruflichen Selbstkonzept. 1. Aufl. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, S.124.
25 Siegrist, Johannes (1995): Medizinische Soziologie. 5., neu bearb. Aufl. München, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg, S. 239.
26 Vgl. Lorenz, Alfred L. (2000): Abgrenzen oder zusammen arbeiten, S. 23.
27 Vgl. Siegrist, Johannes (1995): Medizinische Soziologie. S. 240.
28 Vgl. Siegrist, Johannes (1995): Medizinische Soziologie, S. 239.
29 Befindet sich im Anhang.
30 Vgl. Borgetto, Bernhard; Kälble, Karl; Babitsch, Birgit (2007): Medizinsoziologie. Sozialer Wandel, Krankheit, Gesundheit und das Gesundheitssystem. Weinheim: Juventa-Verl., S. 133.
31 Siegrist, Johannes (1995): Medizinische Soziologie, S. 241.
32 Vgl. Presse- Information vom 17.06.2010 der Universität zu Köln und der Uniklinik Köln.
33 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 82-83.
34 Vgl. Abels, Heinz (2007): Einführung in die Soziologie, S.106.
35 Abels, Heinz (2007): Einführung in die Soziologie, S. 131.
36 Vgl. Höpfner-Kröger, Margot Louise (1993): "Historische Aspekte zur Pflege-Berufskunde", S. 95.
37 Habermas, Jürgen (1973): Kultur und Kritik: verstreute Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 119.
38 Siegrist, Johannes (1995): Medizinische Soziologie, S. 96.
39 Vgl. Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 228.
40 Vgl. Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 91.
41 Abels, Heinz (2007): Einführung in die Soziologie, S. 68.
42 Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 92.
43 Habermas, Jürgen (1973): Kultur und Kritik: verstreute Aufsätze, S. 131.
44 Zimbardo, Philip G.; Gerrig, Richard J.; Graf, Ralf (2007): Psychologie. 16. aktual. Aufl. München: Pearson- Studium, S. 793.
45 Vgl. Taubert, Johanna (1992): Pflege auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis, S. 46 und Krappmann, Lothar (2005): Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. 10. Aufl.: Klett-Cotta, S. 150- 167.
46 Vgl. Borgetto, Bernhard; Kälble, Karl; Babitsch, Birgit (2007): Medizinsoziologie, S. 108.
47 Vgl. Rohde, Johann Jürgen (1962): Soziologie des Krankenhauses. Eine Einführung in die Soziologie des Krankenhauses. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, S. 287.
48 Taubert, Johanna (1992): Pflege auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis, S. 112.
49 Lorenz, Alfred L. (2000): Abgrenzen oder zusammen arbeiten, S.63.
50 Höhmann, Ulrike, Krampe, Eva- Maria, Kohan, Dinah (2004): Von der „weiblichen“ Pflege zur „männlichen“ Wissenschaft?, S.7.
51 Luhmann, Niklas (2009): Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S. 176- 188.
52 Geulen, Dieter (2005): Subjektorientierte Sozialisationstheorie, S. 81.
53 Voß, Gerd- Günter (1991): Lebensführung als Arbeit. Über die Autonomie der Person im Alltag der Gesellschaft. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, S. 185.
54 Vgl. Frey, Hans- Peter; Haußer, Karl (1987): Identität, S. 4.
55 Vgl. Hurrelmann, Klaus (2008): Handbuch Sozialisationsforschung, S. 404.
- Arbeit zitieren
- Andréa Kaib (Autor:in), 2010, Die Interaktion zwischen Pflegekraft und Arzt in ihrer Auswirkung auf das Selbstbild der Pflegenden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165355
Kostenlos Autor werden








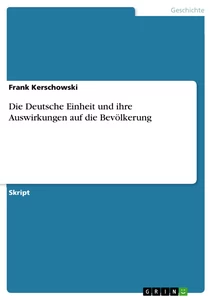


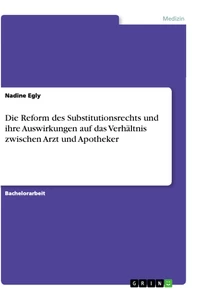





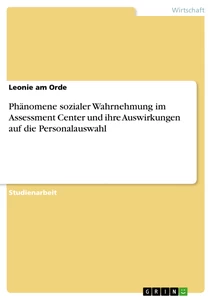


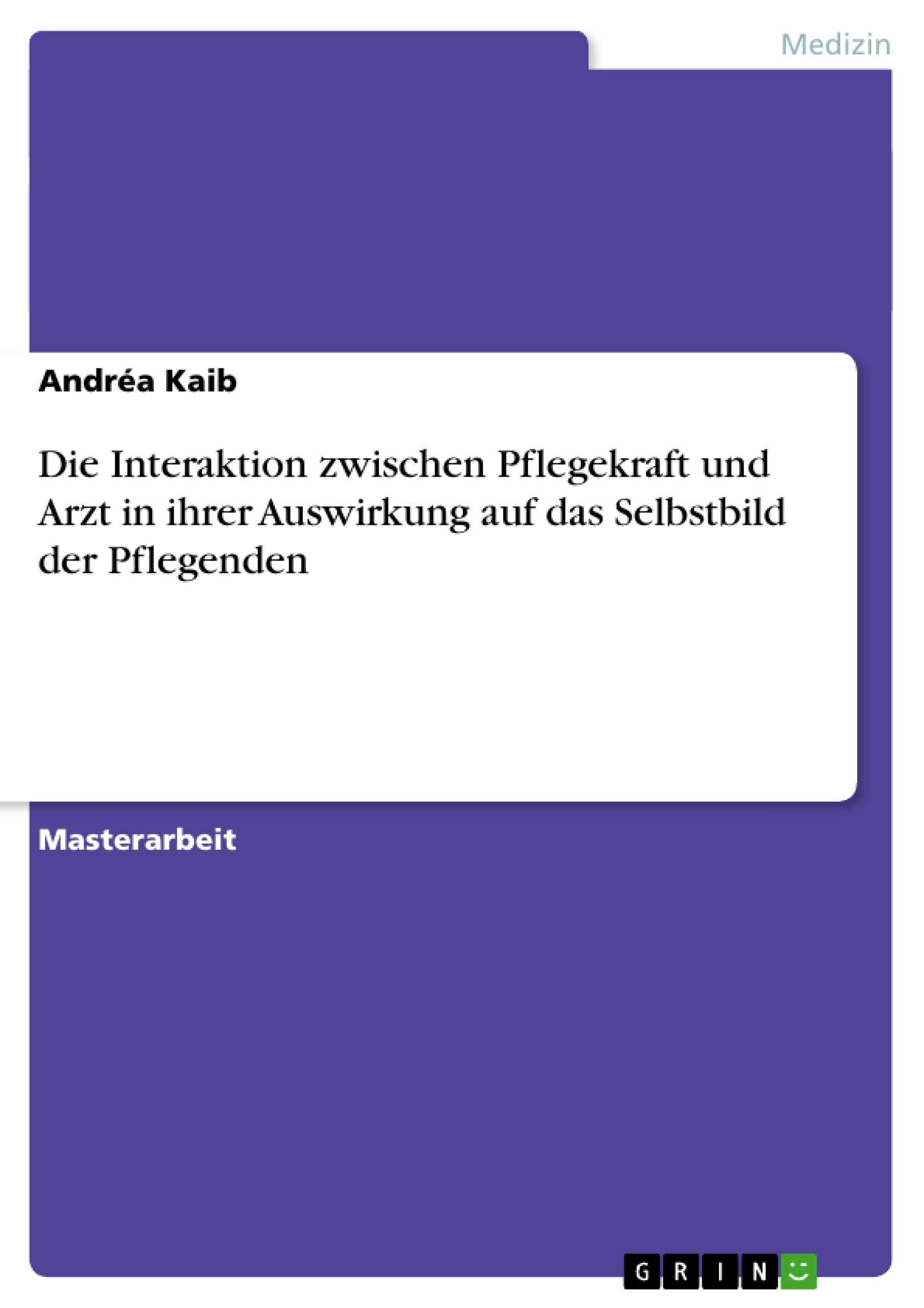

Kommentare