Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition und Charakterisierung
2.1. Die Problematik der Definition
2.2. Forschungsfelder
3. Die Geschichte der Nanoforschung
3.1 Die griechische Antike und der Nanokosmos
3.2 Von Isaac Newton zu Richard Feynman
3.2.1 „ Gott schuf harte Materie “ 6
3.2.2. Magische Mikroskope
3.2.3. Der 29.Dezember 1959 - Ein naturwissenschaftlicher Feiertag
3.3. Der Beginn des Kohlenstoffzeitalters10
3.3.1. Nanotechnologie am „Fußballfeld“
3.3.2. Das Fortschreiten der Nanoarchitektur
4. Anwendungsbereiche der Nano-Technologie
4.1. Nanokristalle und Designer-Moleküle
4.2. Beschichtungen und Inhaltsstoffe aus Nanomaterialien
4.2.1. Oberflächenbeschichtungen
4.2.2. Titandioxid - Schreckgespenst und Hoffnungsträger
4.3. Weitere Anwendungsgebiete der Nanotechnologie - Eine exemplarische Aufzählung mit Hinweisen auf die Relevanz im ArbeitnehmerInnenschutz
5. Ein Blick in die Zukunft
6. Nanotechnologie am Arbeitsplatz
6.1. Tätigkeitsbereiche
6.2. Derzeitiger Stand der Evaluierung
7. Die herrschende Rechtslage in Österreich
7.1. Ein Überblick über das österreichische Chemikalienrecht
7.2. Überblick über den ArbeitnehmerInnenschutz
7.3. Nanotechnologie und gefährliche Materialien am Arbeitsplatz
7.3.1. Definition „gefährliche Materialien“
7.3.2 Kontrollmechanismen
7.3.3. Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen
7.3.3.1. Kennzeichnung
7.3.3.2. Sublimierung
7.3.3.3. Maßnahmen zur Gefahrenverhütung
7.3.3.4. Messungen
7.3.3.5. Persönliche Schutzausrüstung
7.3.3.6. Untersuchungen
7.3.4. Pflichten der ArbeitnehmerInnen
7.3.5. Das Leistungsverweigerungsrecht des § 8 AVRAG 42
8. Die Rechtslage in der Europäischen Union
8.1. Die REACH Verordnung - Das Kernstück des Chemikalienrechts der EU 43
8.1.1. Allgemeines Registrierungsverfahren
8.1.2. Besonderes Registrierungsverfahren - Stoffsicherheitsbericht
8.1.3. Nach der Registrierung
8.1.4. Informationen in der Lieferkette - Sicherheitsdatenblatt
8.1.5. Zulassungsverfahren
8.2. ArbeitnehmerInnenschutz im europäischen Recht
8.3. Die Rechtslage in Nicht-EU-Ländern am Beispiel der Schweiz
9. Risikobewertung als Instrument zur Rechtsanpassung
9.1. Aufgaben der Risikobewertung
9.2.Prozesse und Methoden der Risikobewertung
9.2.1. Institutioneller Rahmen
9.2.3. Methoden der Risikobewertung
9.2.3.1. Die FMEA-Methode
9.2.4. Messmethoden für Nanopartikel
9.2.4.2. Kondensationskeimzähler (CPC)
9.2.4.3. Nano-Differenzieller Mobilitätsanalysator (Nano-DMA)
9.2.4.4. Nano-Aerosol-Sampler (NAS)
9.2.4.5. Fazit
9.3. Derzeitiger Forschungsstand hinsichtlich gesundheitlicher Folgen
9.3.1. Toxikologische Untersuchungen von Kohlenstoffnanoröhrchen
9.3.2. Amorphe Kieselsäure
9.3.3. Titandioxid
9.3.4. Fazit
9.4. Nanotechnologie als internationale Herausforderung
10. Adaptions- und Veränderungsbedarf des nationalen und europäischen Rechtsrahmens
10.1. Adaptions- und Veränderungsbedarf im Stoffrecht
10.1.1. Allgemein verbindliche Definition
10.1.2. Anmeldung von Neustoffen
10.1.3. Nanomaterialien als Altstoff
10.1.3.1. Ablehnung des Altstoff-Begriffs für Nanomaterialien
10.1.3.2. Überarbeitung der Aktualisierungspflicht
10.1.3.3. Kennzeichnung und Nomenklatur
10.1.4. Fazit
10.2. Adaptions- und Veränderungsbedarf im ArbeitnehmerInnenschutzrecht
10.2.1. Festlegung von Grenzwerten
10.2.2. Kontroll- und Messverfahren
10.2.3. Schutzmaßnahmen im Einzelnen
10.2.3.1. § 41 ASchG
10.2.3.2. § 42 ASchG
10.2.3.3. § 43 ASchG
10.2.3.5. Informationen
10.2.4. Arbeitsmedizinische Aspekte
11. Resümee und Prognose
12. Literaturverzeichnis
13. Anhänge
1. Einleitung
Es ist der Wunsch eines jeden Menschen, nach Größerem zu streben. Die Wissenschaft jedoch löste sich bereits zu einer Zeit von dieser Vorstellung, in welcher Mikroskope noch nicht einmal denkbar waren und jeder, der behauptete, es gäbe kleinere Teilchen als einen Kieselstein, als Schwätzer und Spinner dargestellt wurde.
Schon immer träumten Philosophen und Wissenschaftler von einem Mikrokosmos, von jenen Teilen, die für den Normalsterblichen unsichtbar sind, ]von jener Materie, welche die Welt in ihrem Innersten zusammenhält.
Mehr als 2000 Jahre später fand man heraus, dass auch der Mikrokosmos riesig ist im Vergleich zu jenen Teilchen, welche den Mikrokosmos formen. Ein Atom unterteilte sich zunächst in Protonen, Neutronen und Elektronen, nun unterteilen sich auch diese Bestandteile in Quarks und wahrscheinlich noch kleinere Materie.
Im Rahmen der Nanowissenschaften versucht man, jene winzigen Teilchen im Nanometerbereich industriell zu verwerten. Spätestens mit dem Zeitpunkt, in dem erkannt wurde, dass Nanoteilchen ein anderes physikalisches und chemisches Verhalten darbieten als in „großer“ Form (auch hier sprechen wir von Mikrometern), wurde jene zunächst noch mystisch anmutende Wissenschaft schlagartig interessant, obgleich sie in ihrer öffentlichen Rezeption den Status des Rätselhaften noch nicht ablegen konnte.
Jede neue Technologie braucht Kontrolle, die Nanotechnologie begegnet uns sowohl in der industriellen Produktion, als auch im Haushalt oder im Krankenhaus. Im Zuge von Risikobewertungen und Technikfolgenabschätzungen werden in dieser Arbeit gesetzliche Regelungen vorgeschlagen, welche die Handhabung von Nanomaterialien in einen rechtlichen Rahmen bringen.
Gerade im Rahmen des ArbeitnehmerInnenschutzes ist es in höchstem Maße von Relevanz, die gesundheitlichen Risiken von Nanomaterialien genau zu analysieren und auf dieser Basis arbeitsrechtliche Bestimmungen zu konstruieren.
Derartige Forschungen laufen sowohl auf innerstaatlicher, als auch auf europäischer Ebene sowohl im Bereich des Chemikalienrechts, als auch im Medizinrecht, Konsumentenschutz und Arbeitsrecht. Ein erster Schritt seitens der Republik Österreich wurde durch die Implementierung einer eigenen Forschungsstelle an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften namens „Nano Trust1 “ gesetzt. Inzwischen beschäftigen sich zahlreiche Behörden und Institute mit dieser hochaktuellen Wissenschaft. In dieser Arbeit wird zunächst ein Einblick in die naturwissenschaftliche Dimension der Nanowissenschaften gegeben, um in einem weiteren Schritt auf die bereits bestehende österreichische und europäische Rechtslage einzugehen, wobei auch Rechtsvergleiche zu Deutschland und der Schweiz angestellt werden. Zudem werden unter Zuhilfenahme neuerer Risikoeinschätzungen eventuelle Schwachpunkte im Arbeitsschutz aufgezeigt und insgesamt der Regelungsbedarf analysiert.
Mein Interesse an den Nanowissenschaften gewann ich im Zuge von Praktika in der Arbeiterkammer Klagenfurt, wo ich einen guten Einblick in den technischen ArbeitnehmerInnenschutz gewinnen konnte. Im Zuge eines Gespräches mit einem Sachbearbeiter wurde ich auf die Aktualität dieses Themas aufmerksam gemacht.
Mit dieser Arbeit möchte ich den bisherigen Forschungs- und Regelungsstand sammeln und auf eventuelle Lücken und deren Schließung eingehen. Es soll eine Sensibilisierung für die Mechanismen des Arbeitsschutzes und dessen Begleitforschung geschaffen werden und gleichsam in eine Welt vorgedrungen werden, die mit menschlichen Dimensionen nicht mehr begreifbar ist.
2. Definition und Charakterisierung
2.1. Die Problematik der Definition
Es scheint für uns Menschen logisch und nicht weiter verwunderlich zu sein, dass alles kleiner wird. Man könnte es als eine Art Postulat der Wissenschaft bezeichnen, oder als eine natürliche Begebenheit.
In unserer Zivilisation hat das Wort „nano“ eine seltsam anmutende Bedeutung. Es bedeutet klein, nein, winzig. Für die Wissenschaft jedoch ist diese Bedeutung von trivialer Natur.
Die Nanotechnologie bezeichnet nicht bloß eine Größe, sie überwindet den Übergang zwischen der wahrnehmbaren (=makroskopischen) Welt und jener Welt, in der die Materie geformt wird. Innerhalb dieser Dimension finden Operationen statt, welche nicht zuletzt das Ziel haben, Materie zu manipulieren, zu verändern und zu perfektionieren.
Nach einer langen Vorlaufzeit, die geprägt war durch wissenschaftliche Diskurse, einigte sich die Wissenschaft darauf, dass Nanostrukturen, um dem Begriff „nano“ gerecht zu werden, eine Größe zwischen einem und 100 Nanometern (1 Nanometer = 0,000000001m oder 1*10-*9m) aufweisen müssen Im Laufe der Zeit wurden weitere Kriterien eingeführt, durch welche der Begriff „Nanotechnologien“ bzw. „Nanowissenschaften“ abgesteckt wurde. So wurden unter Nanowissenschaft all jene Disziplinen subsumiert, die größenspezifisch (also in dem durch den Begriff „nano“ abgestecktem Rahmen) neue Effekte und Eigenschaften erforschen und dokumentieren und im weiteren Sinne die technische Nutzbarkeit von Materialien im Nanometer-Bereich anstreben.2
Die Problematik der Definition verbirgt sich in der Frage, ob Nanotechnologien denn überhaupt „Technologien“ im wissenschaftlichen Sinne seien? Hierbei ist zum Einen anzumerken, dass es sich bei der Nanotechnologie im engeren Sinne nicht bloß um eine, sondern um eine Vielzahl von technologischen Faktoren handelt, zum Anderen ist es bis dato nur in sehr beschränktem Umfang möglich, mit Hilfe der Nanowissenschaft Produkte und Verfahren zu kreieren, die für den Markt von gesteigertem Interesse wären.
Gerade in unserer Zeit, in welcher die Nanotechnik noch in ihren Kinderschuhen steckt, bedarf es zunächst einer weitläufigen Grundlagenforschung, eine Kommerzialisierung ist noch nicht denkbar (obgleich der Begriff „nano“ seinen Einzug in die Werbung bereits vollzogen hat). Viele ForscherInnen bevorzugen daher den Begriff „Nanowissenschaft“ (engl. nano science) anstelle des mit Kommerzialisierung verbundenen Begriffs „Nanotechnologie“.3
2.2. Forschungsfelder
Die Nanowissenschaft ist geprägt von einer weitreichenden interdisziplinären Verknüpfung.
In der Vergangenheit wurde jene Disziplin entweder von der Physik oder von der Chemie für sich beansprucht. Heute versteht sich die Nanowissenschaft als eine interdisziplinäre Forschung, in welcher Chemie, Physik, Biologie und Ingenieurswissenschaften miteinander verknüpft sind.4 Dies ergibt sich aus dem reichen Anwendungsspektrum der Nanotechnologien innerhalb aller Naturwissenschaften. Auch die Medizin als Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie und Physik hat ein hohes Interesse an den Fortschritten der „nano science“, hofft diese doch, etwa mithilfe kleiner Roboter den menschlichen Körper „reparieren“ zu können.
3. Die Geschichte der Nanoforschung
3.1 Die griechische Antike und der Nanokosmos
Die allerersten „Nanoprozesse“ -um sich Bedeutung dieser Wissenschaft im Klaren zu
werden- sind bereits lange vor der Existenz des Menschen durchaus erfolgreich verwirklicht worden. Vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren wurden aus kleinsten Zellen, die ihrerseits wieder aus Teilchen im Nanometerbereich bestanden, Bakterien, Viren und Kleinstlebewesen. Aus diesen Lebewesen wurde die Fauna und Flora unserer Erde geformt. Man kann also feststellen, dass die Nanotechnologie per se bereits älter als die Menschheit ist.
Die Geschichte der Nanoforschung beginnt - streng genommen - mit der griechischen Antike, in welcher Philosophen die Universalstellung der Gelehrten innehatten. Griechenland galt zu dieser Zeit als Wiege der Zivilisation und der Wissenschaft. Den Anstoß für die Suche nach den großen Dingen des Universums im Kleinen begann mit den Ausführungen Demokrits. Demokrit war ein Naturphilosoph und gehörte der philosophischen Strömung der Vorsokratiker an. Laut seinen Ausführungen besteht der Kosmos aus kleinen, untrennbaren Teilchen, die „ atomos “ (unteilbar) genannt werden. Diese verbinden sich zu Strukturen (Entstehung des Lebens) und trennen sich wieder (Tod). Die Vorstellung eines Atoms (der Begriff leitet sich vom Wort „atomos“ ab) darf jedoch nicht in unserem heutigen Zusammenhang verstanden werden. Demokrit nahm an, dass jedes Atom eine feste geometrische Form habe, wobei sich die Atome untereinander so zusammenfügen, wie sie zusammengehören (der „Bauplan“ wurde von Demokrit jedoch nicht genau analysiert).5
3.2 Von Isaac Newton zu Richard Feynman
3.2.1 „ Gott schuf harte Materie “
Nach Demokrit, wurde die Physik und Chemie der kleinsten Teilchen Jahrhunderte lang ad acta gelegt. Erst rund zweitausend Jahre später, am Beginn der Aufklärung, kam die Frage, was das Universum zusammenhalte, wieder auf das Spielfeld der Wissenschaft.
Erst Isaac Newton warf im Jahre 1704 in seinem wissenschaftlichen Traktat „Opticks“ jene Frage wieder auf. Er stellte fest, dass im Zuge der Schöpfung durch Gotteshand die Welt aus kleinsten Partikeln geschaffen wurde, die nichts auf der Welt zu teilen imstande sein würde. Hierbei führte Newton das Modell Demokrits fort, betonte jedoch die Unteilbarkeit in einem besonderen Ausmaß.6
Die Wissenschaft verabschiedete sich jedoch bald von Newtons These und im Jahre 1897 schließlich trat der Physiker Joseph Thomson den Gegenbeweis an, indem er das Elektron entdeckte. Hiermit verwies er das Newten’sche Modell in seine Grenzen, konnte sich das Elektron doch durch harte Materie hindurch bewegen. Kurze Zeit später nahm Ernest Rutherford jene Erkenntnis auf und stellte fest, dass sich selbst jenes als kleinstes unteilbares Teilchen dargestelltes Atom in einen Kern und eine Hülle aufteile. Und wieder wurde die wissenschaftliche Dimension winziger. Ebendieser Rutherford entdeckte, wie auch viele seiner Kollegen und auch eine Kollegin (die Rede ist von Marie Curie), dass beim Zerfall des Atomkerns Radioaktivität frei wird. Somit wurden die Theorien Newtons und Demokrits endgültig falsifiziert. Schließlich stellte sich die Frage, welche Teilchen beim Zerfall des Atomkerns freigesetzt würden und welche Größe diese aufweisen. Schließlich wurde auch der Atomkern in Protonen und Neutronen unterteilt.
Der deutsche Physiker Niels Bohr entwickelte im Jahre 1913 unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse seiner Vordenker das erste Atommodell. Er stellte ein einfaches Wasserstoffatom da, welches aus einem Kern und einem Elektron bestand, das um den Kern kreiste. Somit wurde dem geheimnisvoll anmutenden Atom eine konkrete Form gegeben; Es konnte erstmals plastisch dargestellt werden.
3.2.2. Magische Mikroskope
Zwar waren Schrödinger, Bohr und Konsorten in der Lage, das Vorhandensein von Teilchen im Nanometerbereich theoretisch zu errechnen, eine Visualisierung schien zu diesem Zeitpunkt jedoch nahezu ausgeschlossen. Es existierten bloß simple Lichtmikroskope, diese wiesen jedoch eine viel zu schwache Vergrößerung auf, um nur im Entferntesten in den Nanokosmos vorzudringen.
Im Jahr 1931 entstand schließlich -wie so oft in der Wissenschaft durch Zufall- das erste Elektronenmikroskop. Ernst Ruska , ein Doktorand an der TU Berlin, nahm an einem Forschungslabor teil, dessen Ziel es war, ein besseres Oszilloskop zu entwickeln. Hierfür bündelte er mittels eines Magnetfeldes Elektronenstrahlen, um einen genaueren Punkt zu treffen, als er plötzlich den Vergrößerungseffekt bemerkte. Unter Hinzufügung einer zweiten Strahlenlinse gewann Ruska die 17-fache Vergrößerung eines einfachen Platingitters, welches sich zwischen der Linse und der Strahlenquelle befand. Dies war die Geburtsstunde des Elektronenmikroskops.7
In den folgenden Jahrzehnten gab es innerhalb der Mikroskopie wenige Fortschritte. Zwar wurde das Elektronenmikroskop weiterentwickelt, ein erneuter „ naturwissenschaftlicher Coup“ blieb jedoch aus.
Erst im Jahr 1978 kam wieder Bewegung in die Forschung, als der Schweizer Heinrich Rohrer , der als Physiker im IBM Labor beschäftigt war, einen verheißungsvollen Einfall hatte. Rohrer hatte einen besonderen Faible für den „Tunneleffekt“ (ein atomares Teilchen kann auch dann eine energetische Barriere überwinden, wenn die Barriere eine höhere Energie aufweist, als das Teilchen per se) und stellte sich die Frage, ob es nicht möglich wäre, mithilfe des Tunneleffekts die Beschaffenheit einer Oberfläche darzustellen. Zusammen mit seinen deutschen Kollegen Gerd Binning konstruierte Rohrer eine Anlage, bei welcher eine feine Nadelspitze über eine Oberfläche gebracht wird und mittels eines speziellen Kristalls bewegt wird. Die Nadel wird nun systematisch über die Oberfläche bewegt und stellt dadurch eine Art Landkarte dar. Nach einigen Verfeinerungen war es Binning und Rohrer schließlich möglich, einen Silizium-Kristall bildlich darzustellen. Damit gelang dem Rastertunnelmikroskop der Durchbruch, konnte doch zur damaligen Zeit ein solcher Kristall nur theoretisch errechnet werden. Das Rastertunnelmikroskop darf jedoch nicht mit einem herkömmlichen Mikroskop verwechselt werden, da es mehr wie ein Taststock funktioniert denn ein Mikroskop. Die Mühen Rohrers und Binnings blieben nicht ohne Erfolg, 1986 wurde ihnen zusammen mit Ernst Ruska der Nobelpreis verliehen.8
Noch heute ist das Rastertunnelmikroskop und seine Varianten „state of the art“ in der Nanoforschung.
3.2.3. Der 29.Dezember 1959 - Ein naturwissenschaftlicher Feiertag
Am 29. Dezember 1959, ein Tag welcher in der Nanowissenschaft beinahe den Charakter eines Feiertags besitzt, hielt der amerikanische Physiker Richard Feynman einen Vortrag vor den renommiertesten Physikern der Vereinigten Staaten, welcher für Aufsehen sorgte. In seinem Vortrag sprach Feynman von der Manipulation von kleinsten Teilchen.
Zwar konnte man zu dieser Zeit kleinste Teilchen mittels Elektronenrastermikroskope sichten, von einer Manipulation war jedoch mangels eines adäquaten Werkzeugs einerseits und wegen der noch immer nicht zufriedenstellenden Auflösung des Elektronentransmissions- Mikroskops andererseits noch nicht die Rede. Feynman hatte jedoch zumindest hinsichtlich des Werkzeugs bereits eine Idee parat. Er griff die Funktionsweise von elektrischen Greifarmen auf, welche ja bereits in Kernkraftwerken oder in der Forschung mit giftigen und nuklearen Materialien verwendet wurden und bekundete seinen Willen, diese bis auf atomare Ebene zu verkleinern. So sollten Nano-Greifarme entstehen, welche die Materie umzugestalten in der Lage sind.9
Der erste Schritt zur Verwirklichung von Feymans Ausführungen gelang 1989 in einem Labor von IBM. Der Physiker Don Eigler erkannte, dass sich Xenonatome auf einer Platinoberfläche verformten, wenn er mit der Spitze seines Rastermikroskopes nah an die Oberfläche heranging. Schließlich gelang es ihm, unter Erhöhung des Tunnelstroms (=Elektronenstroms) das Atom herauszuziehen und an einer anderen Stelle zu platzieren. Aus 35 Xenonatomen formte Eigler schließlich den Schriftzug „IBM“ auf einer Platinoberfläche und bewies somit, dass auch ein Werkzeug in dieser Größenordnung nicht mehr unrealistisch war.
3.3. Der Beginn des Kohlenstoffzeitalters
3.3.1. Nanotechnologie am „Fußballfeld“
Der Begriff „ Kohlenstoffzeitalter “, wie die Zeit beginnend in der zweiten Hälfte des 19.10
Jahrhunderts von Niels Boeing sehr treffend bezeichnet wird, dreht sich vor allem um ein Material, welches wegen seiner Unzerstörbarkeit in aller Welt hochbegehrt war, der Stahl. Der Kohlenstoff per se stellt für die Nanoforschung ein fantastisches chemisches Element dar, es wird zeitweise als „Architekt“ innerhalb des Nanokosmos bezeichnet.
Je nach Umgebung, also Temperatur und Druck, bildet der Kohlenstoff andere Formen, sei es nun der wertvolle und extrem harte Diamant, oder der weiche Graphit. Der Kohlenstoff bindet sich wegen seiner Elektronenkonfiguration jedoch auch mit anderen Elementen in einem variantenreichen Ausmaß, weshalb er getrost als ein Allrounder bezeichnet werden darf.
Im Jahre 1985 schließlich lud ein Team von Chemikern der Rice University in Houston (Texas, USA) angeführt von Robert F. Curl und Richard E. Smally den britischen Forscher Harold Kroto ein, um neue Erkenntnisse über die Kohlenstoffchemie im All zu gewinnen. Konkret ging es um den Aufbau der Hülle eines so genannten „Roten Riesen“ (ein bereits erloschener oder sich im Erlöschen befindlicher Stern). Mittels einer Vorrichtung, welche aus einer rotierenden Graphitscheibe bestand, aus der mittels eines Lasers Kohlenstoffstücke herausgeschossen wurden, entstand plötzlich eine Formation, welche den Wissenschaftern ein Rätsel aufgab. Es handelte sich hierbei um ein Sechseck aus Kohlenstoffatomen, das sich nicht mit anderen Atomen und Molekülen verband. Das Molekül ging als C60-Molekül, Nanofußball oder „ Buckyball “ in die Geschichte der Naturwissenschaft ein und bescherte Kroto und seinen Kollegen 1996 den Nobelpreis für Chemie.
3.3.2. Das Fortschreiten der Nanoarchitektur
Mit der Entdeckung des Buckyball wurde zum ersten Mal der Begriff „Nanoarchitektur“ auf die Bühne der Wissenschaft gebracht. Die Frage, die sich jedoch nach dem Abklingen der ersten Aufbruchsstimmung stellte war: „Wofür brauchen wir einen 6 nm großen Fußball?“.
In Japan forschte das Elektrounternehmen NEC bereits fieberhaft nach einer Verwendung. Schließlich gelang es dem Forscher Sumio Iijima , den Nanofußball aufzuschneiden und eine der bienenwabenförmigen Strukturen zusammenzurollen. Zeitgleich mit Forschern von IBM schuf Iijima den ersten „ Nanotube “. Dies löste einen wahren Hype innerhalb der Nanoforschung aus und in Intervallen von wenigen Wochen wurden neue Verwendungszwecke für Nanotubes entdeckt und dokumentiert. Der Werkstoff der Zukunft war geboren.11
Die Nanotechnologie entwickelt sich Monat für Monat weiter, scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten bieten sich den Forscherinnen und Forschern und bald ist vielleicht ein Leben ohne Nanotechnologie nicht mehr vorstellbar.
Doch bereits in unserer Zeit ist die Nanotechnologie schon zu einem wichtigen Forschungsund Wirtschaftsfaktor geworden, vieles davon läuft jedoch für den Normalsterblichen – gleichsam den Nanoteilchen - unsichtbar ab.
4. Anwendungsbereiche der Nano-Technologie
4.1. Nanokristalle und Designer-Moleküle
Mit der Entwicklung der Nanotubes kam plötzlich Bewegung in die Nanoforschung. Woche um Woche, Monat um Monat kamen ForscherInnen auf neue Anwendungsbereiche, mochten sie auch noch so kühn sein. Bald fand man heraus, dass Nanotubes eine wesentlich höhere Steifigkeit als Stahl aufweisen, womit sie unter Anderem als Spitze für Elektronenraster- Mikroskope eingesetzt werden könnten. Auch den Herstellern von Computerchips wurde bald der Nanotube schmackhaft gemacht, da er wesentlich schneller als Kupfer leitete und zusätzlich bessere Wärmeleitwerte als Diamant aufwies. Warum nach wie vor Nanotubes nicht flächendeckend im Einsatz sind, rührt von den hohen Herstellungskosten, die sich auf bis zu 1000 Dollar pro Gramm belaufen.
Im Laufe der Nanoforschung wurden auch andere Elemente, vor allem Halbleiter wie Silizium oder Gallium, auf ihre Nano-Fähigkeit hin getestet und man kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Unter einer Größe von 20 nm verhielten sich die Teilchen plötzlich anders, als im „großen“ Zustand. Dies rührt von der Tatsache, dass Festkörper zur Bildung einer klar definierten Oberfläche Energie aufwenden müssen, welche in die Außenatome transferiert wird. Wird nun von außen Energie in Form von Wärme zugeführt, so verflüssigt sich der Stoff, wohingegen dasselbe Material im Nanometerbereich verschiedene feste Phasen annehmen kann. So werden aus den „Nanofußbällen“, also aus Sechsecken unter Erhöhung des Drucks rechteckige Strukturen.12
Eine weitere Eigenart von Nanoteilchen liegt im Verhalten ihrer Elektronen. In Festkörpern bewegen sich die Elektronen in einer Art Energieband, während sie in Atomen innerhalb ihrer Schale frei umherschwirren. Zwischen 2 und 20 nm liegt jene Übergangszone, in welcher sich die Atome langsam zu Bändern formen.
Innerhalb dieses Größenverhältnisses fungieren Nanomaterialien wie künstliche Atome, da sie hinsichtlich des Elektronenflusses noch den Käfigeffekt aufweisen. Selbst bei einer Überlagerung von Elektronen (in einem Nanohalbleiter befinden sich Millionen von Atomen) sind die Levels immer noch scharf voneinander abgegrenzt, sodass diese sich hervorragend für optische Schaltungen oder sogar Quantenpunktlaser eignen (durch die scharfe Abtrennung kommt es zu keinen Interferenzen und es entsteht ein extrem reines Licht). Um jedoch einen funktionierenden Quantenpunktlaser zu produzieren, müssen ca. 200 Millionen (sic!) Nanostrukturen pro Quadratzentimeter angeordnet werden. Nun würde dies mittels eines ER- Mikroskops zwar möglich sein, wäre jedoch zeitlich nicht zu bewältigen. Die Natur jedoch bietet die Lösung für dieses Problem, sie organisiert sich selbst. Dies wird am Beispiel eines Experimentes deutlich: Dampft man Indiumarsenid auf einen Untergrund aus Galliumarsenid, so türmen sich die Iridiumarsenid-Moleküle auf. Legt man schließlich mehrere Schichten übereinander, so entstehen pyramidale Strukturen. Mit dieser Technik lassen sich binnen kürzester Zeit Milliarden, wenn nicht Billionen Nanoteilchen pro Quadratzentimeter „aufhäufen“. Durch diesen natürlichen Vorgang können Quantenlaser ohne größeren Zeitaufwand hergestellt werden.13
Doch wie will die Wissenschaft die Quantenpunktlaser nutzen? Denkbar wäre beispielsweise eine neue Darstellungsform für TV-Geräte und Bildschirme, da aufgrund der Präzision der optischen Leitfähigkeit Farben und Strukturen noch genauer dargestellt werden können. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verbesserung von Telekommunikationssystem mittels Nanotechnologie, welche dadurch noch schneller und präziser werden könnte.
In der gesamten Elektrotechnik besitzt die Nanotechnologie ein enormes Potenzial, welches bis dato nur durch den Kostenfaktor gebremst wird.
4.2. Beschichtungen und Inhaltsstoffe aus Nanomaterialien
4.2.1. Oberflächenbeschichtungen
Ein Ausfluss der Nanotechnologie, der sich zuweilen auch als Werbemaßnahme gut in Szene setzen kann, ist die Möglichkeit, mittels nanoskaligen Beschichtungen Materialien beispielsweise zu härten, oder wasserabweisend zu machen.
Diese Eigenschaft hat die Natur bereits seit mehreren Milliarden Jahren vorgesehen. Sie transportiert Materialien, die sich nicht lösen lassen, in Form von kleinen stabilisierten Partikeln - so genannten Kolloiden - mittels einer Flüssigkeit. Lässt man nun die Flüssigkeit austrocknen, verketten sich die Moleküle. So geschehen bei der Verbindung „ Silanol “ , welche aus, durch Sauerstoffatome verbundenen Alkoholmolekülen, mit einem Siliziumatom in der Mitte besteht. Durch die Austrocknung entstehen nanoskalige Kolloide in Form eines zähflüssigen Gels, welche sich aufgrund ihrer Transparenz auf Oberflächen auftragen lassen.
Schließlich experimentierte der Chemiker Helmut Schmidt mit der Verbindung von Kolloiden mit organischen Materialien. Wie es in der Wissenschaft schon beinahe Usus ist, verhalfen einige glückliche Zufälle und jahrelanges Forschen zu erstaunlichen Ergebnissen. Trug man bestimmte Stoffe in kolloidaler Form auf Oberflächen auf, so veränderten diese die Beschaffenheit der Fläche.
Trägt man beispielsweise eine Lösung mit Fluorsilanen auf eine Oberfläche auf, so ordnet sich die Verbindung dahingehend, dass die Fluoratome sich oben befinden, also die Beschichtung bilden. Nachdem Fluorsilane hydrophob (=wasserabweisend) sind, bilden Wassermoleküle auf der Oberfläche perlenartige Strukturen anstatt diese zu benetzen. Der gleiche Effekt kann bei der Lotusblume beobachtet werden, wobei dies jedoch physikalische Ursachen hat (die Haut der Blüten ist mit nanoskaligen Vertiefungen versehen, sodass das Wasser eine geringere Angriffsfläche hat).14
Natürlich kommt uns dieses Konzept bekannt vor, bereits seit etlichen Jahren wurde Teflon zur Beschichtung von Pfannen und Küchengeräten im täglichen Leben zu einem wahrlich treuen Diener. Der Vorteil an der Nanobeschichtung liegt jedoch zum Einen in der Transparenz, zum Anderen auch in der Härte des Fluors. Während bereits der kleinste Kontakt mit einer Gabel Wunden in die Teflonbeschichtung schlägt, kann die Nanobeschichtung ohne Spuren bestehen.
Aufgrund dieser Tatsache ist eine Kolloidbeschichtung auch in der Automobilbranche höchst gefragt. Immer wieder stoßen Passanten mit scharfen Gegenständen auf den empfindlichen Autolack und verewigen sich dadurch. Seit 2004 werden Autos im Rahmen des letzten Fertigungsschritts mit dem kratzfesten Nanolack besprüht, welcher bis dato jedoch noch nicht zu 100% kratzfest ist. Zwar ist die Forschung bereits auf einem dementsprechenden Niveau angelangt, die Kosten für eine flächendeckende Anwendung wären jedoch zu hoch.
Eine weitere praktische Anwendungsmöglichkeit wurde durch die Forschung mit Metalloxiden erschlossen. Besprüht man beispielsweise eine Fliese im Badezimmer mit einer kolloidalen Metalloxidlösung, so entsteht dadurch eine Katalysator-Fläche, welche organische Moleküle in der Luft in Bestandteile zerlegt. Dadurch könnten auch ohne Sprays und Duftkerzen, die der Gesundheit zum Teil schaden, unangenehme Gerüche neutralisiert werden, auf gleiche Weise kann auch Trinkwasser aufbereitet werden.15
Noch heute werden in kurzen Abständen neue Beschichtungen mittels nanoskaligen Kolloiden entworfen und aufgrund der Vielfältigkeit der Anwendungsbereiche ist noch kein Ende in Sicht. Und doch gibt es eine Verbindung, die gleichsam hoch geschätzt als auch gefürchtet wird und die es dem Autor wert erscheint, ihr ein eigenes Kapitel zu widmen.
4.2.2. Titandioxid - Schreckgespenst und Hoffnungsträger
Nicht nur im juristischen Sinne ist Titandioxid (TiO2) ein Thema, um das sich viele Meinungsverschiedenheiten ranken. Von vielen Nanowissenschafter wird es als der Allrounder schlechthin bezeichnet, andere sehen darin -so möchte man meinen- beinahe den Untergang der Menschheit.
Der praktisch bekannteste Anwendungsbereich von Titandioxid ist die Kosmetikindustrie. In Sonnenschutzmittel absorbieren nanoskalige Titandioxidpartikel die für den Menschen gefährliche und karzinogene (=krebserregende) UV-Strahlung. Gleichzeitig ist jenes Material durchsichtiger als es Sonnencreme bis dato war, somit können weiße Rückstände auf der Haut vermieden werden. Dies ist jedoch als ein rein kosmetischer Faktor zu verstehen, für den Menschen indes von höchster praktischer Relevanz.16
Ein weiterer Anwendungsbereich der Nanoforschung mittels Titandioxid ergab sich aus dem Bedürfnis nach erneuerbaren Energien. In den 1980er Jahren versuchten Wissenschaftler der ETH Lausanne rund um den Chemiker Michael Grätzel , die Photosynthese der Pflanzen auf chemischer Basis für den Menschen nutzbar zu machen.
Grätzel schaffte es, Titandioxid so fein zu mahlen, dass eine vollkommen transparente Lösung entstand. Mittels eines Farbstoffes, der auf die Kolloide aufgetragen wurde, wollte Grätzel durch einen Laser die Elektronen des Farbstoffes anregen und in die Lösung befördern. Bald darauf stellte sich heraus, dass es in der Lösung zu einer Ladungstrennung kam. Im weiteren Verlauf wurde das Titandioxid mit einem Ruthenium-Farbstoff und einer so genannten Ester- Gruppe (schwefelhaltige Molekülgruppierung) vermischt und auf ein Titanblech aufgetragen. Grätzel fand heraus, dass bei der Sensibilisierung der Elektronen mit Licht ein Stromfluss messbar wurde, welcher sich beim Auftragen auf eine raue Platte steigerte. Die Grätzel-Zelle war geboren.17
Zwar haben Grätzel-Zellen einen geringeren Wirkungsgrad als herkömmliche Solarzellen, sind jedoch robuster und weisen eine deutlich längere Lebensdauer auf. Zusätzlich sind Lichtabsorbtion und Ladungstransport voneinander getrennt, während bei Solarzellen die Halbleiter zugleich Licht absorbieren und die daraus gewonnene Ladung weiter transportieren müssen. Zahlreiche Experimente bewiesen, dass Grätzel-Zellen mit rotem Farbstoff bessere Energielieferanten sind, als Silizium-Zellen. Inzwischen haben schon mehrere Unternehmen mit der Vermarktung begonnen, bis zur Alltagstauglichkeit wird jedoch noch einige Zeit vergehen.
Ein weiterer Anwendungsbereich von Titandioxid ist die Katalyse, also die Reinigung durch Zersetzung organischer Substanzen. An der Universität in Tokio wurde mit Filterwannen mit Filtern aus TiO2 experimentiert. Unter Einwirkung von Sonnenlicht reinigte der japanische Wissenschaftler Kazuhito Hashimoto das Abwasser eines Tomatengewächshauses binnen sechs Stunden. Durch die beweglichen Elektronen des Titandioxid oxidierten Schadstoffe zu ungefährlichen Substanzen und der Wiederverwertbarkeit des Wassers stand nichts mehr entgegen. Hashimoto sieht die Anwendbarkeit der so genannten Photokatalyse unter anderem auch im Reisanbau, wo er mittels beschichteten Glasfasermatten die chemische Belastung des Wassers um 94% reduzieren konnte.18
Inzwischen forschen auch europäische Projekte an den katalytischen Eigenschaften nanoskaliger Substanzen, die insbesondere auch in der Entsorgung von Schwermetallenvisionär gedacht gar in der Klärung der Entsorgungsfrage von Atommüll- gipfeln könnten. Dies ist jedoch reine Zukunftsmusik und zum derzeitigen Stand nicht absehbar.
Titandioxid jedoch hat auch negative Seiten. Des Öfteren wurde ihm eine große Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Natur attestiert, auf die im Rahmen des Kapitels über die Risikoforschung noch einzugehen sein wird.
4.3. Weitere Anwendungsgebiete der Nanotechnologie - Eine exemplarische
Aufzählung mit Hinweisen auf die Relevanz im ArbeitnehmerInnenschutz Die vorhergehende Aufzählung stellt jene Bereiche vor, in welcher Nanotechnologie bereits medienwirksam verarbeitet wurde (viele Sonnencremen werben bereits mit dem Wort „Nano“), längst ist diese jedoch nicht als abschließend zu betrachten. Es folgt nun eine exemplarische Aufzählung jener Bereiche, die vor allem für den Einzelnen von praktischer Relevanz sind.
a) EDV19
Die Computer- und Chiptechnik wird ständig miniaturisiert und strebt danach, Speichermedien im Nanometerbereich zu schaffen. Derzeit ist die kleinste Fläche in der Beschichtung einer Festplatte, die ein Bit darstellt, ungefähr 200nm lang und 20nm breit. Die Fläche wirkt wie ein Magnet, indem die Elektronenspins und die Magnetisierung konstant in die gleiche Richtung wirken. Man kann sich den Spin als die Drehbewegung eines Kreisels vorstellen. Je nach Richtung des Magnetfeldes wird der binäre Code (1 oder 0) gelesen. Die Möglichkeit einer weiteren Verkleinerung wurde von IBM erforscht, das Ergebnis war jedoch ernüchternd. Ab einem gewissen Grad der Verkleinerung fängt der „Kreisel“, ein Ensemble aus Elektronen, an zu wanken und verliert den konstanten Spin, wodurch das Bit unbrauchbar gemacht wird. Dieser Effekt wird „superparamagnetisches Limit“ genannt. Wissenschaftler von IBM nahmen sich des Problems an und erfanden eine neuartige Speichertechnologie, welche auf nanomechanischen und nicht mehr rein magnetischen Prinzipien beruht, den so genannten „Millipedechip“ (Millipede= Tausendfüssler). Im Prinzip handelt es sich hierbei um eine Anordnung von Hebelarme, deren Spitze aus Silizium besteht. Bereits über 4000 solche Hebelarme befinden sich im Zentrum des Chips. Das Speichermedium per se besteht aus einem wenige Nanometer dicken Polymerfilm aus Silizium-Substrat. Wird nun ein Hebel unter Spannung gesetzt, so wird das Silizium-Substrat elektrostatisch angezogen.
Auf die Kunststoffplatte, auf welcher sich der Silzium-Film befindet, wirkt dabei ein Druck von sagenhaften 10 Tonnen pro Quadratzentimeter. Das Loch, welches durch den Druck in der Kunststoffplatte entsteht, weist eine Größe von 10x15 nm auf und ist somit um ein Vielfaches kleiner als alles bisher Erreichte. Wird der Speicher nun gelesen, so wird die Spitze des Greifarms über die Oberfläche geführt, durch die Änderung des elektrischen Widerstandes wird der Wert 1 erkannt. Um den Wert zu überschreiben, wird das Loch zugedrückt, indem unmittelbar daneben (auch hier sprechen wir von wenigen Nanometern) ein neues Loch gestanzt wird. Mit dieser „Nano-Lochkarte“ soll es bald möglich sein, ungeheure Datenmengen auf kleinsten Raum zu speichern. Insgesamt ist im der EDV- Bereich jedoch kein merkenswerter Regelungsbedarf festzustellen, da die Automatisierung in der Branche bereits deutlich überwiegt und eine Exposition nanoskaliger Teilchen unwahrscheinlich ist.
b) Sensorik20
Es ist bekannt, dass das menschliche Geruchsorgan - anders als bei vielen anderen Säugetieren - eher schwach ausgeprägt ist. So hat der Mensch nur 10 Millionen Riechzellen in der Nase, wohingegen ein Hund mit 230 Millionen Riechzellen in der Lage ist, feinste Gerüche zu erkennen und von anderen in ihren Nuancen zu differenzieren. Im Bereich der Verbrechensbekämpfung (Bekämpfung von Schmuggler und zur Erkennung von Suchtgift) werden Hunde in der gesamten Welt verwendet. Nun stellt sich die Frage, ob eine technische Vorrichtung in der Lage wäre, dieselbe Leistung zu erbringen mit dem Vorteil, nicht zu ermüden. IBM forschte bereits in den Neunziger Jahren an einem Sensor, welcher Düfte zuordnen konnte. Hierfür verwendeten die Wissenschaftler abermals kleine Hebel und versetzten diese mit einer Aluminiumspitze. Unter Einfluss von Wasserdampf (H²O) verbogen sich die Hebelchen.
[...]
1 vgl. Projektvorstellung Nano Trust, S. 72
2 vgl Gazsó et.al. S.2
3 vgl. Gaszó el al, S.3
4 vgl. Boeing S. 24
5 vgl Kunzmann el.al, S. 33
6 vgl . Boeing. S.20f.
7 vgl. Boeing. S. 42
8 vgl. Boeing, S. 46ff und Nimtz/Haibel S. 15
9 vgl. Boeing, S. 26f
10 vgl. Boeing, S. 66 ff.
11 vgl. Boeing, S. 70 ff.
12 vgl. Boeing, S. 76 f.
13 vgl. Boeing, S. 79 f.
14 vgl. Boeing, S. 93 f.
15 vgl. Boeing, S. 94 f. sowie BUND, S. 34
16 vgl. ÖNAP, S. 9“
17 vgl. Boeing, S. 134ff.
18 vgl. Boeing, S. 138f.
19 vgl. Boeing, S. 110ff.
20 vgl. Gaszó et.al. S.46f.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Angelo Turrini (Autor:in), 2010, Vor welche Herausforderungen stellt die aufkommende Nanotechnologie den Arbeitsschutz in Österreich und der Europäischen Union?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164143
Kostenlos Autor werden

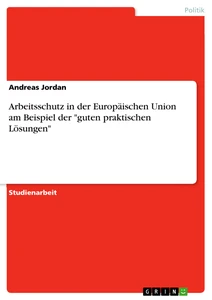







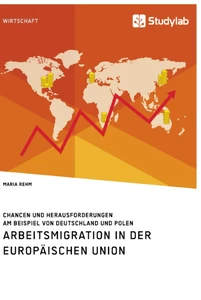


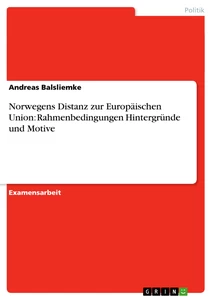




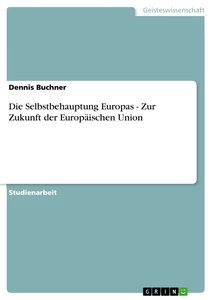
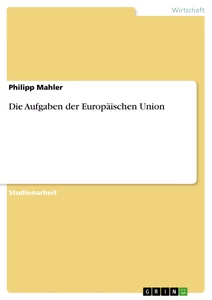

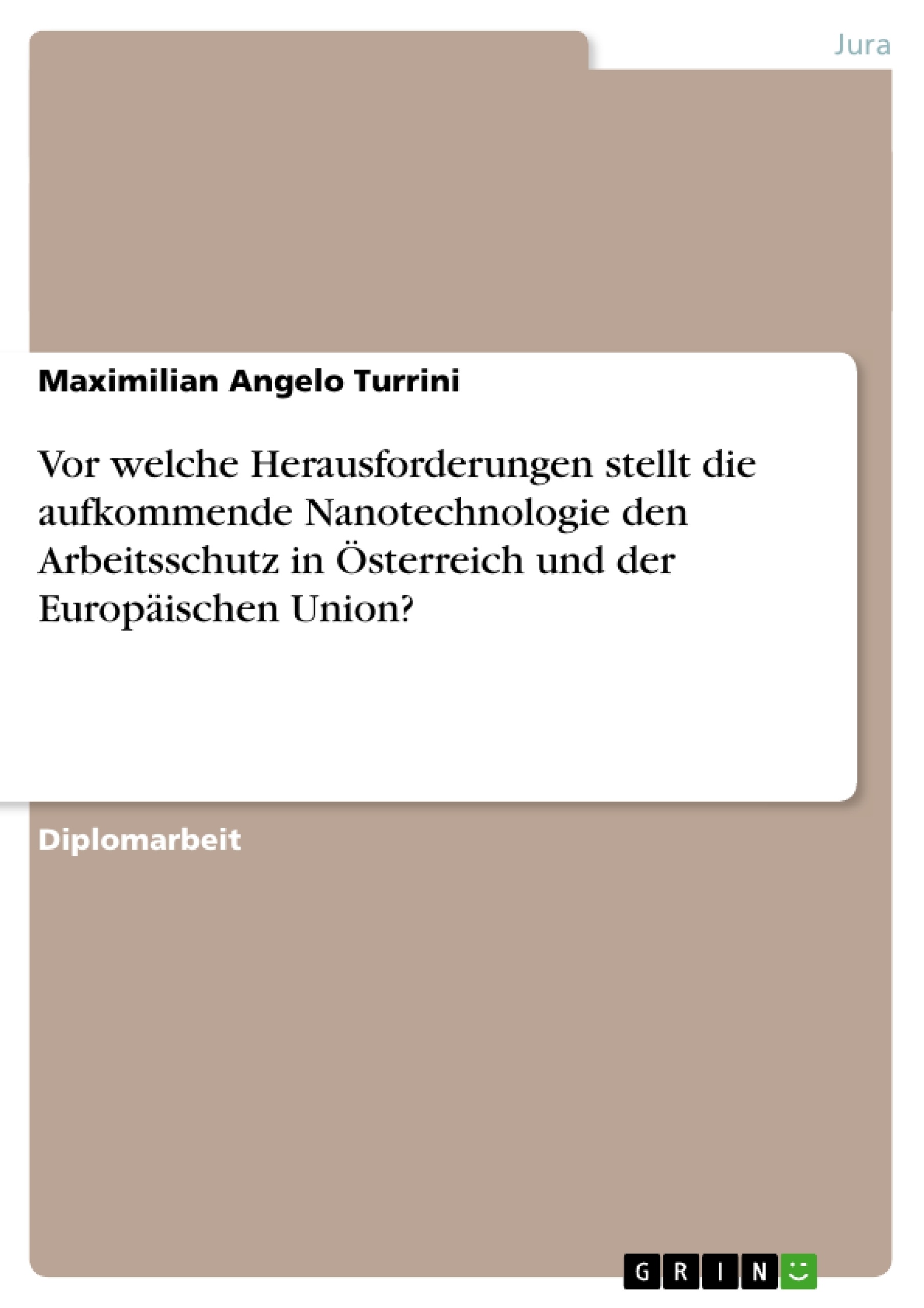

Kommentare