Leseprobe
Inhalt
Traumatherapie
1. Einleitung
2. Allgemeines zur Traumatherapie
2.1 Widerstände und Abwehrprozesse bei der Therapie traumatisierter Patienten
2.2 Regeln der Traumatherapie
3. Psychodynamische Therapien
3.1 Beschreibung allgemeiner Therapieansätze
3.2 Indikation
3.3 Forschungsergebnisse
3.4 Psychoanalytische Fokaltherapie der PTBS nach Lindy
3.5 Psychodynamische Therapie nach Horowitz
4. Kognitive Verhaltenstherapien
4.1 Theoretischer Rahmen
4.2 Kognitiv-behaviorale Behandlungstechniken
4.3 Forschungsbelege für die verschiedenen Behandlungstechniken
4.4 Breitspektrum-Therapie nach Scrignar
4.5 Die dialektisch-behaviorale Therapie bei Borderline-Patienten
5. Gruppentherapie
5.1 Definition
5.2 Gruppenpsychotherapie traumatisierter Patienten in homogenen Gruppen
5.3 Supportive Gruppentherapien
5.4 Psychodynamische Gruppentherapien
5.5 Kognitiv-behaviorale Gruppentherapien
5.6 Ergebnisse empirischer Studien
5.7 Das Göttinger Modell
6. Ehe- und Familientherapie
6.1 Theoretischer Rahmen
6.2 Systemische Therapieansätze
6.3 supportive Therapieansätze
6.4 Indikation
6.5 Forschungsergebnisse
7. Kreative Therapien
7.1 Definition
7.2 Klinische Bedingungen für den Einsatz kreativer Verfahren zur Traumatherapie
7.3 Behandlungskonzepte
7.4 Indikation
7.5 Techniken
7.6 Empirische und klinische Befunde
8. Zusammenfassende Bewertung
Literaturverzeichnis
Traumatherapie
1. Einleitung
Fischer und Riedesser unterscheiden in ihrem "Lehrbuch der Psychotraumatologie" (1998) zwischen postexpositorischer Traumatherapie und Therapie traumatischer Prozesse. Unter postexpositorischer Traumatherapie verstehen sie eine Trauma-Akuttherapie, die möglichst bald nach der Einwirkungsphase des Traumas stattfinden sollte, also dann, wenn die Betroffenen sich von der direkten Einwirkung der traumatischen Situation zu erholen beginnen. Sinn dieser Art von Therapie ist es, streßreduzierend zu wirken, verzögert auftretende posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) oder Chronifizierungen zu mindern und die Fixierung pathologischer Reaktionen zu vermeiden. Bei den traumatischen Prozessen hingegen hat sich die Persönlichkeit an die traumatische Erfahrung angepaßt und hat gelernt mit ihr zu leben. Die traumatischen Ereignisse liegen längere Zeit zurück und unterliegen oft einer Erinnerungsverzerrung. Manchmal sind sie verdrängt oder zwar erinnerbar, jedoch ohne die zugehörige emotionale Bedeutung, also abgespalten. Dies hat meist dazu geführt, daß sich Persönlichkeitsstrukturen wie ein Schutzwall um die "Wunde" herum organisiert haben. Die Psychotherapie traumatischer Prozesse besteht hier in der Bearbeitung der verzerrten Abwehrstrukturen in Verbindung mit einer Stärkung der gesunden Strukturen und zielt auf Wiedererleben, Durcharbeiten und die Integration der traumatischen Erfahrung ab. In der Praxis lassen sich diese beiden Arten der Therapie jedoch kaum trennen, meist befinden sich die Therapien wohl irgendwo zwischen diesen beiden Polen. In den folgenden Betrachtungen werden hauptsächlich Verfahren vorgestellt, die man eher der akuten Traumatherapie zuordnen würde.
2. Allgemeines zur Traumatherapie
2.1 Widerstände und Abwehrprozesse bei der Therapie traumatisierter Patienten
Da sie spätestens in der Therapie zwangsläufig damit konfrontiert werden, ist es für Traumatherapeuten unbedingt nötig, sich mit der eigenen Traumageschichte auseinanderzusetzen, um verschiedene Gefahren zu vermeiden.
Eine dieser Gefahren ist beispielsweise, daß verdrängte oder nicht genügend bearbeitete Erfahrungen das Verständnis für die Traumatisierung anderer Menschen behindern oder verzerren können. Selbsterkenntnis ist hier eine Voraussetzung dafür, andere Menschen verstehen zu können. In diesem Zusammenhang spielt auch der Egozentrismus des Helfers eine Rolle. Es läßt sich nämlich oft beobachten, daß Personen, die sich im Traumabereich engagieren, eigene Traumata durchlebt haben und für sich eine mehr oder weniger gute Lösung im Umgang damit gefunden haben. In diesem Falle besteht nun die durchaus verständliche Neigung, auch anderen das zukommen zu lassen, was sich für die eigene Person als nützlich erwiesen hat. Als Folge werden z. B. nur solche Therapieformen empfohlen, die man selbst durchgemacht und als hilfreich erlebt hat, womit eine differenzierte Betrachtung des Problems unmöglich wird. Dieses Phänomen stellt nicht nur in der Therapie ein Problem dar, sondern auch in der Forschung.
Ein weiteres zentrales Hindernis für die Therapie traumatisierter Personen ist die Tendenz, den Opfern die Schuld an dem zuzuschreiben, was ihnen angetan wurde oder sie zumindest als mitverantwortlich anzusehen. Diese Tendenz findet sich bei der sozialen Umgebung ebenso wie bei den Opfern selbst. Hierbei handelt es ich um eine komplexe Abwehrstrategie, bei der mehrere Mechanismen zusammenspielen. Einer dieser Mechanismen ist der Täuschungseffekt der Retrospektive. Kurz gesagt beinhaltet er, daß wir bereits vorgefallene Ereignisse als vergleichsweise wahrscheinlich und vorhersehbar ansehen, auch dann, wenn sie objektiv zufallsgesteuert eintreten oder extrem unwahrscheinlich sind. Ein Vergewaltigungsopfer hätte also nach dieser Logik mit der Vergewaltigung rechnen und vorsichtiger sein müssen, z. B. keinen so kurzen Rock tragen dürfen oder nicht gerade diesen Weg nehmen sollen. Wer sich dieser Täuschung überläßt erzielt einen beträchtlichen Gewinn. Denn wenn das Ereignis vorhersehbar war, ist es auch kontrollierbar, folglich kann man sich sicher und überlegen fühlen, wenn man sich "vorsieht" und nicht so "unvorsichtig handelt" wie das Opfer. Dies ist natürlich nur eine illusionäre Sicherheit, denn traumatische Ereignisse sind in der Regel für die Betroffenen keineswegs vorhersehbar und meist extrem unwahrscheinlich.
2.2 Regeln der Traumatherapie
Aufgrund der großen Anzahl von Widerständen und Abwehrstrategien, die natürlich auch bei professionellen Helfern auftreten und von denen im vorigen Abschnitt einige genannt wurden erscheint es hilfreich Verhaltensrichtlinien für die Traumatherapie aufzustellen. Wilson (1989) hat einige Regeln formuliert, die auf einem breiten Konsens unter Traumatherapeuten und -forschern beruhen. Einige der wichtigsten sind:
1. Nicht-beurteilende Akzeptierung des Opfers:
Gelingt es dem Therapeuten, sich von den eigenen Abwehrtendenzen freizumachen, so kann er die Offenheit und empathische Bereitschaft entwickeln, die Traumageschichte zu hören und den Patienten seine emotionale Erschütterung mitteilen zu lassen.
2. Sofortige Intervention und die Beschaffung von Hilfe:
Um ein Grundgefühl von Sicherheit wieder herstellen zu können benötigen Traumaopfer möglichst schnell so viel soziale, psychische und ökonomische Hilfe wie möglich.
3. Erwartung massiver Gegenübertragungsreaktionen: Der Therapeut muß auf massive Gegenübertragung vorbereitet sein.
4. Bereitschaft, sich testen zu lassen:
Da Traumapatienten oft jegliches Vertrauen verloren haben unterziehen sie Menschen, bevor sie sich ihnen anvertrauen, einer Reihe von Tests, die entscheiden sollen, ob sie das Vertrauen verdienen.
5. Übertragung als einen Prozeß der Wiederaufnahme von Beziehungen und somit als auf das Trauma bezogen ansehen
6. Ausgehen von der Hypothese, daß psychotraumatische Belastungssymptome durch das aktuelle traumatische Ereignis hervorgerufen werden:
Nur unter dieser Voraussetzung kann der Patient sich angenommen fühlen und sich auf die traumatische Erlebnisverarbeitung einlassen. Erst wenn das aktuelle Trauma durchgearbeitet ist, können auch Zusammenhänge mit früheren traumatischen Ereignissen und der Lebensgeschichte bearbeitet werden.
7. Information über die Natur und die Dynamik von traumatischen Reaktionen soll ein Bestandteil der Traumatherapie sein, so daß der Patient seine Symptome als normale Folgeerscheinung einer anomalen Situation erleben kann.
8. Traumatische Ereignisse können zu Veränderungen der Ich- und Identitätsentwicklung führen.
9. Verwerfung, Spaltung und Formen von Dissoziation gehören zu den Abwehrmechanismen, die einem psychischen Trauma folgen.
10. Selbstbehandlungsversuche durch Alkohol oder Drogen sind bei psychotraumatischen Belastungssyndromen weit verbreitet, um den extremen Erregungszustand des autonomen Nervensystems zu mildern.
11. Soziales Engagement und Sprechen über das Trauma fördern den Erholungsprozeß.
12. Die Transformation des Traumas ist ein lebenslanger Prozeß:
Auch wenn im Rahmen einer Therapie eine traumatische Erfahrung erfolgreich durchgearbeitet werden konnte, bleibt bei dem Betroffenen eine lebenslange Erschütterung zurück.
3. Psychodynamische Therapien
Psychoanalytisch orientierte Therapeuten nutzen bei der Therapie von Traumapatienten, wie auch bei anderen Störungsbildern, den kontrollierten Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung. Unter Übertragung versteht man Einstellungen des Patienten gegenüber dem Therapeuten, die primär die Beziehungsmuster des Patienten widerspiegeln. Gegenübertragung bezieht sich auf die Reaktionen des Therapeuten auf den Patienten (z. B. Gedanken, Gefühle), die aus persönliche Erfahrungen und Einstellungen des Therapeuten resultieren, und nicht therapeutische, rationale Reaktionen darstellen. Auch das Wissen über Widerstand, unbewußte Dynamik und deren Zusammenhang mit der aktuellen Lebensgeschichte sind unerläßliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Traumatherapie.
Das Ziel der Psychoanalyse ist es dabei, die versuchten Konfliktlösungen der Patienten, die sich in bestimmten Symptomen ausdrücken, in ihrer inneren Widersprüchlichkeit und ihrem Wiederholungszwang allmählich bewußt zu machen und die traumatogenen Affektstürme in Worte zu fassen, denn Wortgebung bedeutet in dieser Therapie Distanz und damit Befreiung.
Aus der psychoanalytischen Theorie entwickelten sich eine Anzahl von Therapieansätzen, die sich darin unterscheiden, wie sie mit den o.g. Konzepten umgehen. Im folgenden sollen nun zunächst einige dieser Ansätze vorgestellt werden. Danach werden zwei spezifische systematische Traumatherapien vorgestellt, die posttraumatische Fokaltherapie nach Lindy und das therapeutische Vorgehen von Horowitz.
3.1 Beschreibung allgemeiner Therapieansätze
Bei der formellen Psychoanalyse treffen sich Patient und Therapeut vier oder fünfmal pro Woche über zwei bis sieben Jahre. Während man Erwachsene mittels freier Assoziation im klassischen Couchsetting behandelt, erhält man bei Kindern den Zugang zu intrapsychischen Vorgängen durch ihr Spielen. Analytiker können sich im Grad ihrer Aktivität unterscheiden, aber sie streben alle an, in ihren Reaktionen dem Patienten gegenüber neutral zu bleiben.
Der Erfolg der Psychoanalyse resultiert aus den wachsenden Einsichten des Patienten in seine eigenen Strategien, Wahrnehmungen und Reaktionen auf die Umwelt. Um dies zu erreichen setzt man die freie Assoziation ein: Der Patient soll dabei sagen, was auch immer ihm gerade einfällt, egal wie unwichtig, banal oder gefährlich dieser Gedanke auch erscheinen mag. Die Analyse folgt diesen Assoziationen und untersucht Träume, symptomatische Handlungen, Übertragung und Gegenübertragung, um das komplexe Netzwerk der Ideen, Erinnerungen, Wünsche und Ängste zu erklären, die die Psyche dieser einzigartigen Persönlichkeit ausmachen. Es ist wichtig, daß der Therapeut hierbei nur als Helfer angesehen wird. Tatsächlich ist es der Patient, der sich selbst analysiert.
In der psychodynamischen Therapie finden ein oder zweimal pro Woche (oder noch seltener) Sitzungen von 45 bis 50 Minuten statt. Patient und Therapeut sitzen sich gegenüber. Obwohl die Therapeuten hier aktiver sind als in der Psychoanalyse, das heißt mehr Kommentare machen, emotionaler sind usw., streben sie dennoch Neutralität gegenüber den bewußten und unbewußten Sorgen des Patienten an. Der therapeutische Prozeß kann sich hauptsächlich auf die Übertragung beziehen, der Schwerpunkt kann aber auch mehr auf aktuellen Konflikten des Patienten liegen. Das Ziel der psychodynamischen Therapie ist es, das Selbstverständnis des Patienten zu fördern und seine Ich-Stärke zu verbessern.
Stützende Psychotherapie wird oft als weniger expressiv als andere Formen der psychodynamischen Therapie charakterisiert. Die Therapeuten sind in allgemeinen aktiver in ihren Interventionen und unterstützen die Abwehr des Patienten eher, als daß sie sie interpretieren. Dies geschieht, indem sie das Selbstwertgefühl und die Copingstrategien, die der Patient selbst bereits gefunden hat, unterstützen. In diesem Ansatz geht es also weniger darum, unbewußte Konflikte aufzudecken, als darum, das intrapsychische Gleichgewicht wiederherzustellen. Probleme werden im Hier und Jetzt angegangen und nicht mittels Durcharbeiten der Entwicklung des Patienten und seiner intrapsychischen Strukturen. Der Therapeut nimmt weniger Interpretationen der Übertragung vor, allerdings werden die Beziehungsmuster des Patienten trotzdem berücksichtigt.
Die interpersonelle Psychotherapie (IPT) ist eine zeitlich begrenzte, standardisierte Behandlung, die üblicherweise zusammen mit psychodynamischer/expressiver Therapie angewendet wird, die aber auch supportive Elemente beinhaltet. Der Therapeut nimmt hier eine explorierende Haltung ein und konzentriert sich auf Interventionen, die die Beziehungen des Patienten außerhalb der Therapie betreffen, anstatt auf das Übertragungsgeschehen.
Hypnose und andere Abreaktionstechniken werden manchmal in der Absicht angewendet, bei traumatisierten Patienten verdrängtes Material zu Tage zu bringen. Diese Techniken werden nicht als selbständige Therapien für PTBS angesehen, sondern eher als nützliche Begleiterscheinungen in der psychodynamischen Therapie.
3.2 Indikation
Wie bei allen Therapieformen gibt es auch hier Patienten, für die diese Art von Therapie nicht so nützlich (oder vielleicht sogar eher schädlich) ist wie für andere. Gabbard (1994) listet Eigenschaften auf, die für eine expressive Psychotherapie (also z. B. eine Psychoanalyse) hilfreich sind:
1. eine starke Motivation, sich selbst zu verstehen
2. hoher Leidensdruck, so daß der Patient einen Anreiz hat, eine Psychotherapie durchzustehen
3. die Fähigkeit zur Regression und zur Aufgabe der Kontrolle über Gefühle und Gedanken, aber auch die Fähigkeit relativ schnell wieder die Kontrolle zurückzugewinnen und über die Regression zu reflektieren ("regression in the service of the ego")
4. Frustrationstoleranz
5. Fähigkeit zur Einsicht
6. ein intaktes Realitätsbewußtsein
7. bedeutsame und beständige Objektbeziehungen
8. eine einigermaßen gute Impulskontrolle
9. die Fähigkeit, weiterhin seiner Arbeit nachzugehen
Zusätzlich betont Gabbard auch die Fähigkeit eines Patienten, eine starke, vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten einzugehen.
Bei PTBS-Patienten sind allerdings nicht immer alle o.g. Attribute vorhanden. Sie zeigen vielmehr folgende Tendenzen:
- Vermeidung von traumatischem Material
- Angst, von Gefühlen, Gedanken oder Bildern überwältigt zu werden
- verminderte Frustrationstoleranz
- eingeschränkte Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen zu beginnen oder aufrechtzuerhalten
- schwache Impulskontrolle
- Schwierigkeiten, einer Arbeit nachzugehen
Aus diesem Grund müssen Behandlungen für Traumapatienten modifiziert werden, z. B. indem man Behandlungen anwendet, die an die Möglichkeiten des Einzelnen angepaßt sind und schrittweise vorgehen, um ihn nicht zu überlasten.
Folgende Eigenschaften würden eine eher stützende Psychotherapie nahelegen:
- anhaltende Ichschwäche
- akute Lebenskrise
- geringe Angst- oder Frustrationstoleranz
- geringe Einsichtsfähigkeit
- schwaches Realitätsbewußtsein
- schwer eingeschränkte Objektbeziehungen
- begrenzte Impulskontrolle
- geringe Intelligenz oder organisch bedingte kognitive Einschränkungen
- Schwierigkeiten, sich selbst zu beobachten
- begrenzte Fähigkeit, eine tragfähige Beziehung zum Therapeuten aufzubauen
3.3 Forschungsergebnisse
Horowitz und seine Kollegen (1993, 1994) fanden in mehreren empirischen Studien heraus, daß ein Thema, das mit einem traumatischen Ereignis zusammenhängt, von Intrusionen und Vermeidungsverhalten, Emotionalität, Fragmentation wichtiger Gedanken, verbalem und nonverbalem Abwehrverhalten und spezifischer Mimik begleitet ist, wenn es in einer psychodynamischen Therapiesitzung auftaucht. Das Erkennen solcher Reaktionen kann für Patient und Therapeut ein Hinweis auf traumatische Themen und Ereignisse sein und damit dazu beitragen, diese besser zu bearbeiten.
Brom, Kleber und Defares (1989) führten eine kontrollierte Studie über die Wirksamkeit dreier verschiedener Therapien bei PTBS durch. Sie verglichen Desensibilisierung, Hypnotherapie und psychodynamische Kurzzeittherapie (nach Horowitz) miteinander. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß die verschiedenen Behandlungen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe besser abschneiden, das heißt die Symptome der PTBS stärker reduzieren. Allerdings profitierte nicht jeder Patient davon und die Effekte waren nicht immer sehr groß. Ebenfalls waren die Unterschiede zwischen den drei Behandlungsarten nicht wesentlich. Während die psychodynamische Behandlung die größte Anzahl an Sitzungen benötigte, zeigten sich hier gleichzeitig auch die kleinsten Fortschritte. Wiederholte Erhebungen an den gleichen Patienten zu späteren Zeitpunkten zeigten jedoch gerade bei dieser Therapieform größere Fortschritte. Die Autoren schließen daraus, daß psychodynamische Therapien Copingmechanismen mobilisieren, die auch nach der Beendigung der Therapie weiterhin wirksam sind.
Zusätzlich zu diesen empirischen Ergebnissen gibt es noch eine große Anzahl klinischer Belege für die Wirksamkeit von psychodynamischen Therapien, z. B. von Lindy (1988), der Kriegsveteranen aus dem Vietnamkrieg behandelte. Solche klinischen Studien wurden weder ausreichend kontrolliert durchgeführt, noch sind sie strikt bei der Wahl der Meßinstrumente. Sie sind aber verläßlich genug, um die Wirksamkeit von Psychoanalyse und psychodynamischer Therapie bei Traumapatienten zu bestätigen.
3.4 Psychoanalytische Fokaltherapie der PTBS nach Lindy
Grundlage der posttraumatischen Fokaltherapie nach Lindy (1993) ist die Erfahrung, daß Reinszenierungen in der Therapie und Übertragungsmuster in erster Linie auf die traumatische Erfahrung verweisen. Psychoanalytiker sind es gewohnt, die Übertragungsphänomene in Bezug auf frühkindliche Erfahrungen des Patienten zu deuten. In der posttraumatischen Fokaltherapie führt dies leicht in die Irre. Vielmehr bietet sich hier die Chance, aus einer Übertragungsinszenierung bisher unbekannte oder noch nicht verarbeitete Aspekte des Traumas zu erschließen. Inszenierungen von Übertragung und Gegenübertragung werden daher zu einem vertieften Verständnis der traumatischen Erfahrung genutzt. Die Übertragungswahrnehmungen und -deutungen haben in den drei Phasen der Therapie verschiedene Funktionen.
Ziel der Anfangsphase ist es, ein Arbeitsbündnis herzustellen, in dem der Patient genügend Vertrauen hat, um den Therapeuten "hinter die Traumamembran mitzunehmen" und ihn an seinen seelischen Verletzungen teilhaben zu lassen. Traumapatienten sind zunächst extrem mißtrauisch und davon überzeugt, daß niemand, der nicht die gleiche Erfahrung gemacht hat, sie verstehen könne. Sie weisen das Angebot des Therapeuten auf Teilnahme, Empathie und Verständnis häufig zurück. Nach Lindy handelt es sich hierbei um Beziehungstests, die eine erneute Traumatisierung durch einen unempathischen oder ungeeigneten Therapeuten verhindern sollen. Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen deutet der Therapeut in dieser Phase als Ausdruck von Erfahrungen, die zu dem gegenwärtigen Mißtrauen des Patienten führten.
In der Mittelphase geht es um das Herausarbeiten der spezifischen Konfiguration der traumatischen Situation. Übertragungswahrnehmungen werden hier dazu herangezogen, bestimmte Aspekte der traumatischen Erfahrung zu verstehen, die sich bislang noch der Erinnerung und dem Bewußtsein des Patienten entziehen.
Die Rekonstruktion der traumatischen Erfahrungen soll zugleich die sonst oft emotional überladene therapeutische Beziehung entlasten. Traumapatienten stehen meist unter einem hohen Gefühlsdruck, der die therapeutische Beziehung leicht "überschwemmen" kann. Analytiker, die normalerweise mit direkten Übertragungsdeutungen arbeiten, sollten sich hierin zurückhalten, da Deutungen im Sinne einer direkten Kommunikation über die therapeutische Beziehung die Intensität der Übertragungsgefühle noch verstärken können. Benutzt man allerdings in der Mittelphase der Behandlung Übertragungsreaktionen des Patienten für ein vertieftes Verständnis der spezifischen Konstellation traumatischer Situationsfaktoren, dann kommen oft Einzelheiten in den Blick, die bislang übersehen wurden, die aber eine starke emotionale Bedeutung haben. Patienten können sich jetzt an Brutalitäten, Erniedrigungen und andere Erlebnisse erinnern, die sie vorher nicht zulassen konnten. Gleichzeitig gewinnt das Trauma an Kontur, es nimmt Grenzen an und gliedert sich in einzelne Teilaspekte, welche die Patienten mehr und mehr mit ihren alltäglichen Reaktionen und Ängsten in Verbindung bringen können.
Der Patient lernt in der Mittelphase besondere Gefühle wie Scham, Schuld, Angst oder Ekel mit bestimmten Subkategorien der traumatischen Erfahrung in Verbindung zu bringen. So kommt allmählich eine immer bessere Kenntnis der traumatischen Erfahrung zustande. Der Patient kann sich als Opfer der Situation erleben und seinen Opferstatus dadurch überwinden, daß er sich mehr und mehr als Überlebenden verstehen kann, das heißt die Kompetenz und Kontrolle über die traumatische Erfahrung zurückgewinnen kann.
In der nächsten Therapiephase steht die persönliche Bedeutung des Traumas, die nur auf dem Hintergrund der Lebensgeschichte verständlich wird, im Vordergrund. Die Bedeutung des Traumas entspricht einem Bruch in der Lebensgeschichte des Betroffenen. Das prätraumatische und posttraumatische Selbst sind nicht mehr dieselben, und eine Brücke zwischen beiden existiert noch nicht.
Lindy erwähnt dazu das Beispiel eines Vietnamveteranen, der Exekutionen durchgeführt hatte, in der Annahme, es handele sich dabei um Vietcongführer und Kollaborateure des Vietcong. Später mußte er aber feststellten, daß unter den Exekutierten ein kleiner Junge war, mit dem er sich angefreundet hatte und dessen Familie nicht mit dem Vietcong, sondern mit den Amerikanern sympathisierte. Da Loyalität und Schutz für Schwächere immer wichtige Themen in seinem Leben gewesen sind (er hatte schon früh für seine kranke Mutter sorgen müssen), fühlte er sich hintergangen und in seinem Vertrauen in die Armeeführung getäuscht. Sein Selbstverständnis als zuverlässiger und fürsorglicher Mensch, der für seine Familie und Freunde aufopfernd sorgt, war in seinem Kern erschüttert worden. Es existierten jetzt zwei völlig unvereinbare Selbstbilder, ein prä- und ein posttraumatisches.
Nach Lindy ist es wichtig, daß es dem Therapeuten gelingt, für diese tiefe Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses einfühlsame Worte zu finden, damit der Betroffene sich verstanden fühlt und die Teile des "zerbrochenen Selbst" wahrnehmen kann. Von dort aus kann der Patient dann eine Art Metaschema konstruieren, das die verlorene Kontinuität zwischen prä- und posttraumatischer Persönlichkeit allmählich wieder herstellen kann.
Das Ziel der psychoanalytischen Fokaltherapie nach Lindy läßt sich als Wiederaufnahme jenes lebenslangen Entwicklungsprozesses zusammenfassen, der durch die traumatische Erschütterung abrupt unterbrochen war. Symptomreduktion steht in diesem Behandlungskonzept nicht im Vordergrund, sondern ist eine Folge des wiederaufgenommenen Entwicklungsprozesses.
3.5 Psychodynamische Therapie nach Horowitz
Das therapeutische Vorgehen nach Horowitz knüpft an die Bearbeitung der persönlichkeitstypischen Erlebniszustände an, die das Trauma hervorbringt. Horowitz nimmt eine natürliche Verarbeitungstendenz des Menschen an, welche aus folgenden Stadien besteht:
1. Verleugnung und Vermeidung
2. Intrusive Phänomenen in Gefühl und Vorstellung
3. Durcharbeiten
4. Vollendung
Abweichungen von dieser natürlichen Verarbeitungstendenz sollen therapeutisch korrigiert werden, um so die Selbstheilungskräfte des Patienten zu unterstützen. Die Traumaverarbeitung ist vollendet, wenn die Person in der Lage ist, Erinnerungen und Gefühle, die im Zusammenhang mit dem Trauma stehen, bewußt hervorzurufen, ohne ihnen ausgeliefert zu sein. Ein zweites Kriterium ist die Integration er traumatischen Erfahrung in die Selbststruktur und die Ich-Identität.
Die Fixierung auf eines der Verarbeitungsstadien ist nach diesem Modell ein pathologischer Zustand, der durch therapeutische Hilfe korrigiert werden kann. Das therapeutische Vorgehen verfolgt dabei zwei grundlegende Ziele:
- Interventionen, die die Wiederaufnahme des Traumaverarbeitungsprozesses fördern
- Arbeit an dem habituellen Kontrollstil, das heißt den Coping- und Abwehrstrategien des Patienten
[...]
- Arbeit zitieren
- Nicola Ferdinand (Autor:in)Gernot Quinten (Autor:in), 2002, Traumatherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16302
Kostenlos Autor werden





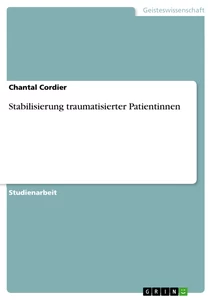














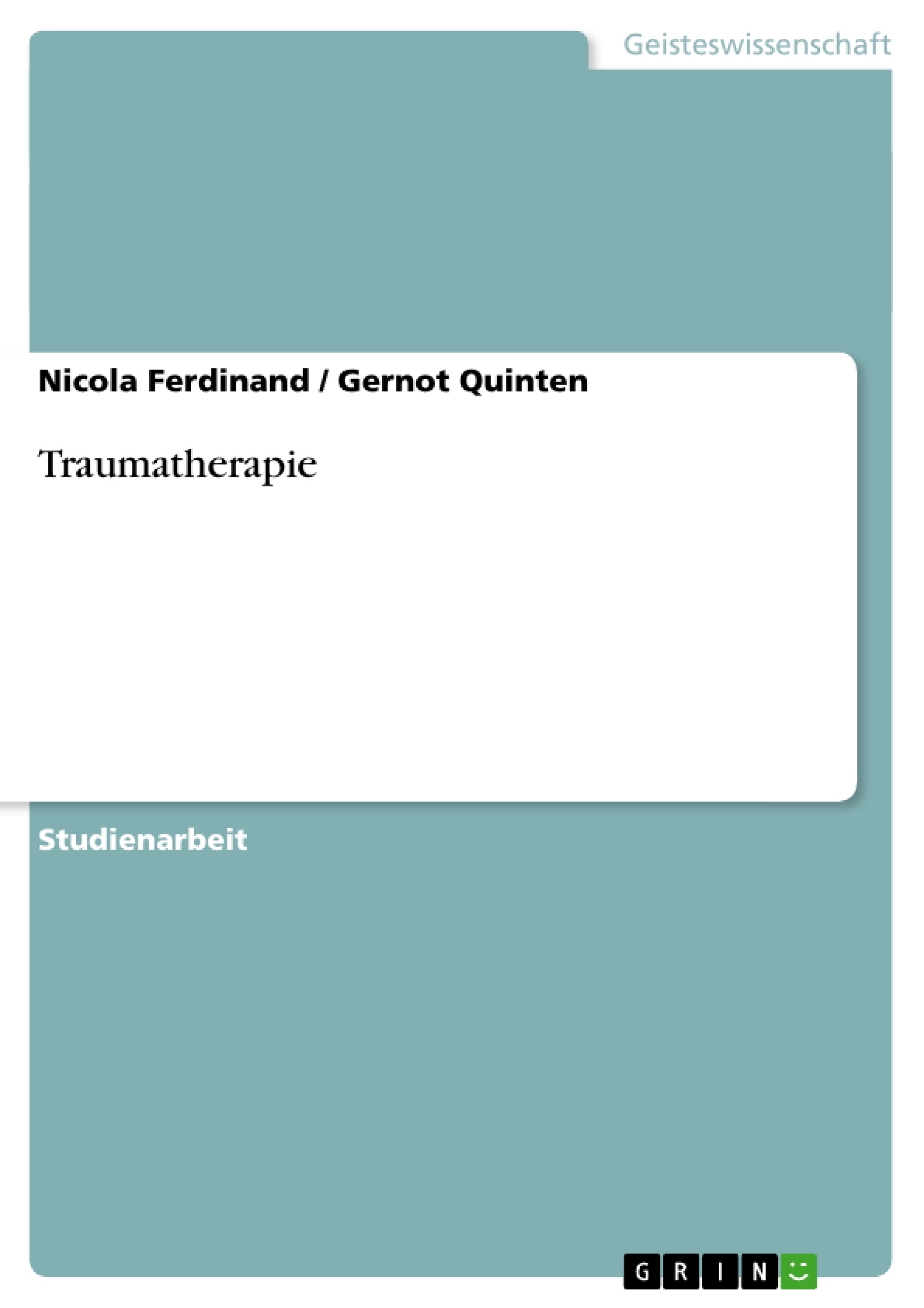

Kommentare