Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Krise der politischen Repräsentation
2.1 Erosion oder Wandel von sozialstrukturellen Bindungen
2.2 Der Wahlakt als Marktakt oder die Bedeutung von Weltanschauungen und sozialem Kapital
2.3 Die Auswirkungen auf das deutsche Parteiensystem
3 Die FDP – Aufstieg seit 2001, Gewinn 2009 und Verlust 2010
3.1 Die Neuausrichtung der Partei ab 2001
3.2 Die starke Mobilisierung von Wählern vor und während der Bundestagswahl 2009
3.3 Von der Bundestagswahl zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 – Wo sind die Mobilisierten hin?
4 Die Piratenpartei – Eine neue Anti-Parteien-Partei?
4.1 Von der Gründung 2006 bis zur Bundestagswahl 2009 – Entdeckung eines neuen Wählerpotentials im Internet?
4.1.1 Sympathisanten, Wähler und Aktive
4.1.2 Inhalte und Kommunikation über das Internet
4.2 In die Parlamente oder APO 2.0? – Richtungsentscheidungen nach der Bundestagswahl 2009
5 Zusammenfassung und Ergebnisse – Was sagen uns die Phänomene?
5.1 Die Wähler als Akteure im Mittelpunkt: Parallelen zwischen den Phänomenen
5.2 Krisenphänomene oder Wandel der politischen Kultur?
6 Schluss und Fazit
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Krise der Volksparteien scheint ein fester Bestandteil des bundesdeutschen Parteienwettbewerbs geworden zu sein. Union und SPD verlieren in der Gesamtschau schon seit Jahren immer mehr Mitglieder und Wählerstimmen. Dagegen werden die kleinen Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke immer stärker. Die Letzteren scheinen das verlorengehende Vertrauen in die ehemals großen Volksparteien aufzunehmen. Doch die Bundestagswahl 2009 und besonders die Zeit danach haben die weiterführenden Auswirkungen dieses Prozesses sichtbar gemacht. Denn das entgegengebrachte Vertrauen der Wähler in die FDP, das bei der Bundestagswahl 2009 mit 14,6 Prozent der Zweitstimmen ungewöhnlich hoch war, und damit das schon bekannte Phänomen der Wanderung des Vertrauens von den Volksparteien zu den „Kleinen“ deutlich wie nie zuvor zu bestätigen vermochte, hat sich in der kurzen Zeit danach bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2010 und darüber hinaus extrem verflüchtigt. Allein von einer Krise der Volksparteien zu sprechen reicht deshalb wohl endgültig nicht mehr aus. Die Wählerwanderung hin zu den kleinen Parteien scheint alles andere als stabil zu sein. Nicht nur, dass sich der Zuspruch zu den „Kleinen“ über einen längeren Zeitverlauf auch untereinander verschiebt; die deutlich drittstärkste Partei bei der Bundestagswahl ist in nur knapp einem dreiviertel Jahr zur deutlich schwächsten etablierten Partei geworden.
Die Wirkung einer Krise der politischen Repräsentation auf das gesamte Parteienspektrum scheint nun empirisch nachweisbar zu sein. Denn nicht nur die etablierten Parteien sind betroffen. Mit dem Aufkommen einer neuen politischen Bewegung – der Piratenpartei – kommt auch bei der Mobilisierung einer vermeintlich schwierig zu repräsentierenden Wählergruppe, nämlich den Erstwählern und sehr jungen Wahlberechtigten, ein neuer Aspekt ans Licht. Mit einem spezifischen Thema – dem Internet –, das von den etablierten Parteien weitgehend nicht auf die politische Agenda gesetzt wird oder dort nur unter völlig anderen Vorzeichen bearbeitet wird, wurde in kurzer Zeit eine beachtliche Mobilisierung erreicht. Es gibt also unter den kleinen Parteien neue Potentiale für eine weitere Ausdifferenzierung unseres bundesdeutschen Parteiensystems.
Nun wurden und werden in der Wissenschaft viele Modelle diskutiert, die die Veränderungen im politischen Feld erklären sollen. Sie reichen von der Theorie einer völligen Bindungslosigkeit und Unabhängigkeit der Wähler über einen Wandel eben jener Bedingungen der Gebundenheit bis zum Festhalten an statischen Konfliktlienen und Zugehörigkeiten. Ich möchte auf einige dieser Theorien näher eingehen, um in diesem Kontext die beiden aktuellen Phänomene der FDP und der Piratenpartei näher zu betrachten.
Hierzu stelle ich zunächst einige Ansätze dieser Theorien vor, ergründe ihren Erklärungsgehalt und beziehe sie schließlich allgemein auf das gesamte deutsche Parteiensystem, um meine beiden Beispiele einordnen zu können. Dies geschieht unter Punkt 2: „Die Krise der politischen Repräsentation“.
Darauf folgt die Betrachtung meines ersten Beispiels. Hierbei möchte ich die Entwicklung der FDP in den letzten Jahren nachzeichnen, um erklären zu können, wie die FDP bis zur Bundestagswahl 2009 immer mehr Stimmen an sich binden konnte. Wichtig dabei soll auch sein, wen die FDP auf welche Weise erreichen konnte. Welche Strategie hat die Partei verfolgt und welche Wählerlager sprach sie gezielt an? Auf dieser Grundlage soll dann auch die aktuelle Krise der FDP betrachtet werden. Warum und bei wem hat sie so schnell so viel Vertrauen verloren? All dies ist Thema des dritten Punktes „Die FDP – Aufstieg seit 2001, Gewinn 2009 und Verlust 2010“.
Es folgt als Viertes die Betrachtung der Piratenpartei. Da sie noch eine sehr junge Partei ist, soll zunächst ihre Gründung und Entwicklung bis heute im Mittelpunkt stehen. Der thematische Ursprung weist bereits auf ein bestimmtes Wählerpotential hin. Dennoch ist die Ausrichtung und Beschaffenheit der Piraten noch sehr in Bewegung. Es stellt sich die Frage, warum sie sich als neue Anti-Parteien-Partei ausgibt und damit auch zu einem Sammelbecken für verschiedene politische Strömungen geworden ist. Wer hat diese Partei gewählt und wer engagiert sich in ihren neuartigen Strukturen? Mit Punkt 4, „Die Piratenpartei – Eine neue Anti-Parteien-Partei?“, wird dieser Themenkomplex bearbeitet.
Nach der Beschäftigung mit diesen beiden Phänomenen werde ich mich im Schlussteil meiner Arbeit mit den Zusammenhängen beschäftigen. Gibt es Parallelen zwischen den beiden bearbeiteten Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Wählerverhalten und damit auch mit der Krise der politischen Repräsentation stehen? Meiner Meinung nach gibt es diese. Es ist bei beiden Parteien eine programmatische Verengung zu beobachten. Dabei ist wichtig, die Wähler als Akteure in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Wie reagieren sie auf das Verhalten der Parteien? Schließlich sollen die Ergebnisse auf ihre Bedeutung für die Gesamtdiskussion hinterfragt werden. Welche Aussagen lassen sich mit Blick auf das deutsche Parteiensystem und die politische Kultur treffen?
2 Die Krise der politischen Repräsentation
Zunächst ordne ich meine Arbeit in den aktuellen Forschungsstand ein, besonders hinsichtlich der Theorien über die Erklärungsmöglichkeiten des vornehmlich deutschen Wahlverhaltens und des daraus resultierenden Parteiensystems. Natürlich sind diese Theorien, die hier zur Anwendung kommen, nicht nur für den deutschen Kontext gedacht oder stammen aus diesem. Aber ich werde aufgrund meiner Fokussierung auf das deutsche Parteiensystem und zwei deutsche Beispiele die Theorien nur hinsichtlich ihres Gehalts auf die deutschen Verhältnisse bearbeiten. Außerdem verfolge ich hauptsächlich die sozialstrukturelle Debatte, da diese mir für die Erklärung des Wählerverhaltens und des Zustands der Gesellschaft in ihrer Beziehung zum politischen Feld am sinnvollsten erscheint.
Die grundsätzliche Frage, die in diesem Teil meiner Arbeit beantwortet werden soll, ist, wie politische Repräsentation überhaupt geschehen kann und auf welcher Grundlage diese erfolgt. Niklas Luhmann schreibt hierzu aus der Sichtweise der System- und Demokratietheorie: „Ihr Thema sieht sie infolgedessen im Problem der Übertragung von Erwartungen, Interessen und Forderungen aus dem Bereich des Publikums in den Bereich der Politik und Verwaltung, also in die Entscheidungsprozesse des politischen Systems, und in der Verwandlung privater in öffentliche, partikularer in allgemeine Interessen, die dadurch vermeintlich vollzogen wird.“ (Luhmann 2010: 397) An diesem Problem setzt die Aufgabe für die Parteien bei der Repräsentation an. Sie müssen Werte, Einstellungen und Interessen aus den alltäglichen Zusammenhängen in das politische Feld oder, wie Luhmann es nennen würde, in das politische Funktionssystem übersetzen. Luhmann würde nicht von einem Feld sprechen, da die sozialen Felder nach der Theorie von Pierre Bourdieu und Michael Vester et al. miteinander in Wechselbeziehungen stehen, während die gesellschaftlichen Teilsysteme der modernen, auf funktionaler Differenzierung beruhenden Gesellschaft nach Luhmann unabhängig voneinander operieren (vgl. Vester et al. 2001: 150 ff.; Rosa/Strecker/Kottmann 2007: 184). Ich folge im Weiteren den Annahmen der Feldtheorie von Bourdieu und Vester et al. und werde auf die Unterschiede zwischen den jeweiligen Ansätzen nicht weiter eingehen, da diese theoretischen Aspekte nicht Teil meiner Arbeit sind. Wichtiger ist dagegen, wonach sich die Parteien bei der Aufgabe einer Übersetzung der Werte und Interessen aus dem einen Bereich in den anderen richten können. Luhmann macht auf die Bedingungen für eine gelungene politische Repräsentation aufmerksam, bei der „[…] sehr komplexe sozialstrukturelle Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wenn die Kommunikation vom Publikum zur Politik wirklich als dominant und repräsentativ institutionalisiert werden soll.“ (Luhmann 2010: 398)
Bourdieu spricht von der Repräsentation als „[…] der Stellvertretung, kraft deren der Repräsentant die Gruppe darstellt, die ihn darstellt. […] Personifikation einer fiktiven Person, einer gesellschaftlichen Fiktion, reißt er jene, die er dem Anspruch nach vertritt, aus dem Zustand von isolierten Individuen[…]“ (Bourdieu 1985: 37 f.) Bei dieser Stellvertretung handele es sich um eine politische Arbeitsteilung, deren ökonomische und soziale Bedingungen man genau in den Blick nehmen müsse (vgl. Bourdieu 2001: 67). Dabei achtet er besonders auf die Auseinandersetzungen im politischen Feld, welche Akteure dabei welche Interessen verfolgen und wie sie dies tun. „Das politische Feld ist daher der Ort der Konkurrenz um die Macht, die eine Konkurrenz um die Laien ist, genauer: um das Monopol auf das Recht, im Namen eines mehr oder weniger großen Teils der Laien zu sprechen und zu handeln.“ (Bourdieu 2001: 96)
Er versteht also unter Repräsentation die politische Stellvertretung einer in ihren alltäglichen Zusammenhängen von der Politik isolierten Gruppe von „Laien“, die im Zuge einer Arbeitsteilung durch die Repräsentanten vertreten wird bzw. sich vertreten lässt. Damit hängt nach Luhmann ein Kommunikationsprozess zusammen, der zwischen den arbeitsteilig getrennten Gruppen stattfinden muss, genauer gesagt von den Bürgern in Richtung der Repräsentanten „dominant“ stattfinden sollte. Es wird deutlich, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen für die Repräsentation von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb soll diese im Folgenden genauer betrachtet werden.
Bourdieu geht grundsätzlich schon einmal sehr kritisch auf sie ein. Er wendet sich gegen die Vorstellung, die Beziehung zwischen der politischen Elite, die er als Besitzer des Monopols über die politischen Produktionsinstrumente bezeichnet, und der sog. Masse sei ein Naturgesetz, da diese Masse aufgrund der natürlichen menschlichen Bedürfnisse und Eigenschaften geführt werden möchte, und zwar von dieser wie auch immer gearteten, ebenfalls mit einem natürlichen Machthunger ausgestatteten, politischen Elite. Denn diese Beziehung sei ein Produkt bestimmter Konstellationen des politischen Feldes, die sich grundsätzlich verändern können (vgl. Bourdieu 2001: 67 f.).
Diese Konstellationen, die Einfluss auf die Repräsentationsbeziehung haben, entstehen aus dem Handeln der Akteure, also u.a. der Parteien und Wähler. Und gerade die Wähler sind gemeint, wenn hier begrifflich das Publikum, die Laien oder einfach die Masse genannt werden. Ihr Handeln, besonders das Wahlverhalten, soll im Mittelpunkt meiner Betrachtungen stehen.
2.1 Erosion oder Wandel von sozialstrukturellen Bindungen
Eine Beziehung ist geprägt durch ein Verhältnis zueinander. Dieses zwischen den beiden im vorigen Punkt genannten Gruppen bestehende Verhältnis ist durch sozialstrukturelle Voraussetzungen geprägt, die sowohl Luhmann als auch Bourdieu ansprechen. Ich möchte im Folgenden auf die Betrachtung dieser Voraussetzungen näher eingehen, wobei die Debatte hierüber grob zwischen zwei Polen eingeordnet werden kann.
Der eine Pol geht davon aus, dass sämtliche sozialstrukturell bedingten Bindungen, die auch das Wahlverhalten beeinflusst haben, im Verlauf einer zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft an Bedeutung verloren haben. Diese These lässt sich auf differenzierte Weise Ulrich Beck und Anthony Giddens abgewinnen. Beck spricht schon in den 1980er Jahren zum einen davon, dass sich die herkömmliche Klassengesellschaft in Ablösung durch eine „Risikogesellschaft“ befände (vgl. Beck 1986: 25 ff.). Diese Risikogesellschaft trägt dabei im Vergleich zur alten Klassengesellschaft übermäßig postmaterialistische Werte in sich. Die Verteilungslogik hat sich demnach von der alten materialistischen zur postmaterialistischen gewandelt, da aus der klassischen Reichtumsverteilung in der Mangelgesellschaft durch die Linderung der echten materiellen Not und dem gleichzeitigen Anstieg der mit produzierten Risiken eine Risikoverteilung geworden sei. So haben postmaterialistische Interessen wie Umweltschutz oder Gesundheit in der Gesellschaft starken Zuspruch erhalten. Zum anderen kommt es nach Beck zu einer stetig ansteigenden Individualisierung durch die zunehmenden Zwänge einer Mobilität und Flexibilität, die alte Bindungen stark beeinträchtigt und lockert.
Diese Veränderungen können auf das Wahlverhalten übertragen werden. Die postmaterialistischen Werte haben definitiv ihren Zugang zum politischen Feld und zu den etablierten Parteien gefunden. Allein die Geschichte der Grünen belegt dies. Die These einer starken Individualisierung ist dagegen kritischer zu betrachten. Auch Giddens ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Er hat auf Grundlage dieser Annahmen zunächst in Großbritannien mit New Labour ein neues Politikmodell entworfen, das er treffend mit „jenseits von Links und Rechts“ tituliert hat (vgl. Giddens 1997). Dabei spielen beide Thesen von Beck eine Rolle. Auch Giddens geht von einer starken Bedeutung der postmaterialistischen Werte aus, besonders in den mittleren sozialen Lagen der Gesellschaft, die er in Großbritannien für New Labour als Wählerpotential möglichst vollständig erschließen wollte. Darüber hinaus glaubt er ebenfalls an die starke Individualisierung der Bevölkerung, die eben deshalb durch ein neuartiges Politikmodell mobilisiert werden muss. Dieses bezeichnet er als „Politik der Lebensstile bzw. Lebensführung“ (vgl. Giddens 1997: 35 f., 132 ff.; Mouffe 2008: 110 f.).
Er verbindet also zwei Thesen miteinander, deren Zusammenhang aber hinterfragt werden sollte. Die postmaterialistischen Werte haben ihren Platz in der Auseinandersetzung des politischen Feldes zu Recht eingenommen. Aber aus diesem Zustand die Bindungen an gegebene soziale Strukturierungsmechanismen zu vernachlässigen, lässt aus heutiger Sicht eine zweifelhafte Gewichtung der verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen vermuten. Chantal Mouffe hat diesen Aspekt des Giddens‘schen Ansatzes insoweit kritisiert, als dass dieses Modell die existierenden Machtstrukturen, die die Sozialstruktur beeinflussen, nicht hinterfragt. „Die zentrale Schwachstelle des Versuchs der Theoretiker des Dritten Weges […] liegt darin, dass er auf der Illusion basiert, man könne, solange man keinen Gegner definiert, fundamentale Interessenkonflikte umgehen.“ (Mouffe 2008: 109) Giddens würde dies deshalb nicht tun, da er durch eben diese Politik eine „win-win-Situation“ für alle erzeugen wolle (vgl. Mouffe 2008: 107 ff.). Er selbst schreibt hierzu: „Die emanzipatorische Politik ist eine Politik der Lebenschancen und daher ausschlaggebend für die Schaffung von Handlungsautonomie. […] Die Lebenspolitik ist keine Politik der Lebenschancen, sondern eine Politik der Lebensstile. Dabei geht es um Auseinandersetzungen und Kontroversen über die Art und Weise, in der wir […] in einer Welt leben sollten, in der das, was früher entweder von der Natur oder von der Tradition bestimmt wurde, nunmehr Gegenstand menschlicher Entscheidungen ist.“ (Giddens 1997: 36) Hierin finden sich beide genannten Thesen wieder. Bei den Auseinandersetzungen geht es um die postmaterialistischen Werte, wobei jeder durch den Wegfall der traditionalen Bindungen volle Handlungsautonomie erlangt habe. Es stellt sich aber nun die Frage, ob denn diese Vorbedingungen wirklich erfüllt sind. Hat die emanzipatorische Politik, wie er es schreibt, bereits Lebenschancen und Handlungsautonomie für alle geschaffen, um nunmehr frei von Bindungen wählen und entscheiden zu können? Oder hat Giddens nur ganz bestimmte soziale Gruppen im Blick, nämlich die besonders als Wahlklientel für New Labour gedachten mittleren Milieus, denen er diese gewonnene Handlungsautonomie zuschreibt? Dies würde für eine sehr eingeschränkte Sichtweise sprechen.
An dieser Stelle kommt der zweite Pol der Diskussion zum Tragen. Die Sozialstrukturanalyse von Vester et al. kritisiert aufgrund ihrer empirischen Forschung, dass es sehr wohl noch bedeutende soziale Bindungen gibt. Ihr Modell des sozialen Raums, das sich an das Konzept von Bourdieu (vgl. Bourdieu 1982) anlehnt und dieses weiterentwickelt hat, verdeutlicht das Wirken eines sozialen Kräftefeldes. Dieses beeinflusst alle Individuen, die dadurch nicht völlig frei im Raum schweben, sondern sich nach Habitus und Kapital- bzw. Ressourcenausstattung im sozialen Raum anordnen und angeordnet werden. „Fremdbestimmung und Selbstbestimmung sind insofern kein Gegensatz, sondern Teil derselben Praxis.“ (Vester et al. 2001: 150) Dabei können verschiedene Gruppen empirisch nachgewiesen werden, die als soziale Milieus bezeichnet werden und jeweils bestimmten Traditionslinien folgen. Sie stellen aber schon eine modernisierte Form ihrer jeweiligen Traditionslinie dar. Es ist demnach keine Erosion der traditionellen sozialstrukturellen Bindungen festzustellen, sondern ein Wandel dieser durch Modernisierung. Bindungen können sich dabei verschieben oder neu ausrichten, aber es gibt keine ungebundenen Individuen mit absoluter Handlungsautonomie.
Beck widerspricht der These einer sozialen Strukturiertheit auch nicht direkt, geht aber von einer Möglichkeit der freien Wahl des Lebensstils aus, der in Relation zu den sozialen Bindungen stark an Bedeutung gewonnen hätte. Er sagt: „Relativ konstant geblieben sind in der Entwicklung der Bundesrepublik die Verteilungsrelationen sozialer Ungleichheit, geändert haben sich gleichzeitig, und zwar ziemlich drastisch, die Lebensbedingungen der Menschen. […] Es entstehen der Tendenz nach individualisierte Existenzformen und Existenzlagen, die nun ihrerseits – um des eigenen materiellen Überlebens willen – sich selbst immer nachdrücklicher und ausschließlich zum Zentrum ihrer eigenen Lebensplanung und Lebensführung machen müssen.“ (Beck 1983: 36, 42) Demnach müsste jeder seine Existenzlage, also auch „sein“ Milieu, tendenziell frei wählen können. Dies ist nach den Erkenntnissen von Bourdieu und Vester et al. aber nicht möglich. Der Habitus, also die innere Haltung eines jeden Menschen zur äußeren Welt, der mit dem Lebensstil eng korreliert, kann nicht einfach durch den eigenen Willen verändert werden. Er bildet sich über einen langen Zeitraum aus und besteht zum Teil aus überlieferten Mentalitätsmustern, auf die das Individuum ohne Weiteres überhaupt keinen Einfluss hat. Ein Wandel des Habitus ist zwar möglich, kann aber nur sehr langsam und unter großen Anstrengungen und entsprechenden Rahmenbedingungen geschehen, was Bourdieu als Hysteresis-Effekt bezeichnet (vgl. Bourdieu 1982: 187 f.).
Die Frage ist nun, was die unterschiedlichen Positionen in dieser Debatte für die Erklärung des Verhaltens des entscheidenden Akteurs im Parteienwettbewerb, dem Wähler, bedeuten. Nach M. Rainer Lepsius gab es in Deutschland bis zur Weimarer Republik vier „sozialmoralische Milieus“, die als politische Lager lange Zeit das Wahlverhalten der breiten Bevölkerung bestimmten: Das katholische, das protestantisch-liberale, das sozialistische und das konservative Lager. Diese Lager hatten sich entlang der gesellschaftlichen Konfliktlinien Kapital und Arbeit, Stadt und Land, Religion und Staat etc. herausgebildet. Sie modernisierten sich im Laufe der Zeit, blieben aber entlang der jeweils vorherrschenden Konfliktlinien bestehen (vgl. Lepsius 1993; Vester 2002: 108 f.). Vester et al. haben in ihrer Studie nach der aktuellen Konfiguration eben dieser Konfliktlinien gesucht und dabei sechs verschiedene „gesellschaftspolitische Lager“ empirisch ausfindig gemacht, die sich nach ihren jeweiligen Weltanschauungen voneinander unterscheiden: Das radikaldemokratische, das sozialintegrative, das skeptisch-distanzierte, das traditionell-konservative, das gemäßigt-konservative und das enttäuscht-autoritäre Lager (vgl. Vester et al. 2001: 58 ff.). Diese unterscheiden sich von den sozialen Milieus, da im politischen Feld eine andere Logik herrscht als in den alltäglichen Auseinandersetzungen. Die gesellschaftspolitischen Lager sind aber dennoch eng mit der Sozialstruktur verknüpft, da die jeweiligen politischen Repräsentanten der Lager und die entsprechend Repräsentierten oftmals aus verschiedenen sozialen Milieus stammen. Sie bilden also milieuübergreifende Koalitionen. Heiko Geiling beschreibt dies folgendermaßen: „Alltagsweltlich bzw. milieuspezifisch geformte Erfahrungen, Wünsche, Hoffnungen, Ressentiments, Befürchtungen und darüber entstehende Gesellschaftsbilder werden im Idealfall in den Vergesellschaftungen der intermediären Organisationen abgeschliffen und integriert, um sie politikfähig zu machen.“ (Geiling 2009: 5) Dieser Zustand stellt gewisse Anforderungen an die Akteure, deren Nichterfüllung zu einer Krise der Repräsentation führen kann. „Dass dies nicht ohne Probleme geschieht – insbesondere dann, wenn diese Vermittlungsarbeit zwischen Milieu und Politik […] zu scheitern droht, zeigt die gegenwärtige Krise unserer Volksparteien.“ (Geiling 2009: 5 f.)
Wenn ich im Folgenden von Lagern spreche, so meine ich in der Regel die gesellschaftspolitischen Lager nach Vester et al. auf Grundlage der Weltanschauungen. Es gibt aber auch das dichotome Modell der parteipolitischen Lager, wobei zwischen „linkem Lager“ und „bürgerlichem bzw. konservativem Lager“ unterschieden wird. In diese parteipolitischen Lager werden die etablierten Parteien eingeordnet. Auch dieser Lagerbegriff taucht an der einen oder anderen Stelle auf.
Luhmann geht auf diese Bruchstelle zwischen dem alltäglichen und dem politischen Feld ebenfalls ein, allerdings aus dem Blickwinkel der Systemtheorie. Daher kommt er zu anderen Ergebnissen. Für ihn gilt demnach, dass es keine exakte Repräsentation geben kann, also keine genaue Korrelation zwischen gesellschaftlichen Interessenskonstellationen und politischen Kräftegruppierungen, da im relativ autonomen System der Politik, wie auch Bourdieu und Vester et al. für ihr Konzept des politischen Feldes feststellen, politische Konflikte nach politischen Kriterien geführt werden. Aber die politischen und gesellschaftlichen Interessen müssen nach Luhmann korrelierbar bleiben, wobei die Korrelation selbst zum Gegenstand politischer Entscheidungen werden muss (vgl. Luhmann 2010: 402 f.). Vester et al. haben dies mit den verschiedenen Logiken im alltäglichen und politischen Feld beschrieben, wobei die Vermittlungsarbeit zwischen den Feldern, wie sie Geiling bezeichnet hat, aus dem politischen Feld heraus geleistet werden muss. Die voneinander verschiedenen Logiken der beiden Teilsysteme begründet Luhmann damit, dass die Erlebensbereiche der Politiker und der Zuschauer, also der Wähler, jeweils begrenzt sind und weit auseinanderliegen, weshalb ein System zwischen ihnen vermitteln muss (vgl. Luhmann 2010: 406).
Damit kommt er Bourdieu und Vester et al. nah, bringt aber an dieser Stelle die Massenmedien als Vermittlungssystem in den Zusammenhang ein. Ihm fehlt hier der Blick für die vermittelnden Elemente, die bereits in den Feldern des sozialen Raums vorhanden sind, um sie später wiederum mit dem Begriff des „opinion leaders“ zu benennen. Er stellt fest, dass die informelle politische Meinungsbildung des Publikums oftmals mit einer einflussreichen Kommunikationstätigkeit eines solchen Meinungsführers zusammenhängt. „Der Einfluß im elementaren, kleingruppenmäßigen Prozeß politischer Meinungsbildung beruht aber weitgehend auf unpolitischen Mitteln […]: auf diffuser sozialer Nähe und dadurch begründetem Vertrauen, auf persönlicher Eindruckskraft und Darstellungsgewandtheit, auf wie auch immer begründetem sozialem Status.“ (Luhmann 2010: 409 f.) Er unterschätzt aber diese vermittelnde informelle Ebene, wenn er die Massenmedien als entscheidendes Vermittlungssystem nennt und die informellen Prozesse eher in einfachen Gesellschaften als dominant verortet. Dies liegt m.E. nach an seiner Systemtheorie, nach der die Massenmedien ein offizielles Bestandteil des politischen Systems sind und deshalb im Zentrum seiner Betrachtung stehen. Darauf weist folgendes Zitat hin: „Der Fall des opinion leaders zeigt, daß auch stark differenzierte, hochkomplexe Sozialordnungen jener einfachen Mechanismen der Reduktion von Komplexität nicht ganz entraten können und daß traditionale, informale, strukturell nicht eindeutig zuzuordnende Prozesse auch hier, wenngleich im Schatten der offiziellen Systembauten, ihre Funktion erfüllen.“ (Luhmann 2010: 410) Luhmann meint hier mit dem Begriff der Systembauten m.E. die Massenmedien als vierte Gewalt und wertet die anderen Prozesse als fast schon altertümliche Traditionen ab, die die nach seinen Worten hochkomplexe Sozialordnung als überstilisiertes, sehr abstraktes Modell erscheinen lässt. Dabei sollten diese Mechanismen und Elemente als mindestens gleichbedeutsame Akteure betrachtet werden, die im Prozess der Vermittlung unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Folgt man nun dem Erklärungsmodell von Beck und Giddens, so haben zusammen mit den sozialstrukturellen Bindungen die gesellschaftspolitischen Lager, also die vermittelnde Instanz, größtenteils ihre Wirkungen verloren. Agieren die Wähler als völlig individualisierte Akteure ohne jegliche Bindung, dann stellt sich die Frage, wonach sie ihre Wahlentscheidung ausrichten. Und ist dies nicht der Fall, wie es die Studien von Vester et al. nahelegen, welche Mechanismen haben dann zusätzlich zu den herkömmlichen Milieu- und Lagerbindungen noch Einfluss auf die Wahlentscheidungen? Schließlich scheinen die Wahlergebnisse der letzten Jahre, z.B. die Ergebnisse der FDP 2009 und 2010, kurzfristigere Verschiebungen und damit eine gewisse Instabilität im Wahlverhalten zu bestätigen. Hierzu schreiben Vester und Geiling: „Sowohl die klassischen Ansätze, die von langfristigen Bindungen und Trennlinien – sog. »cleavages« - ausgehen, als auch Individualisierungs-Ansätze, die eine graduelle Erosion der Bindungen annehmen, gehen von allmählichen, sehr langfristigen Veränderungen aus. Die neuen, oft kurzfristigen und schockartigen Demobilisierungen wie auch der langfristige Seitenwechsel vermeintlich treuer Stammwählerschaften müssen andere Ursachen haben.“ (Vester/Geiling 2009: 25) Dieser Frage soll im nächsten Abschnitt näher nachgegangen werden.
2.2 Der Wahlakt als Marktakt oder die Bedeutung von Weltanschauungen und sozialem Kapital
Folgt man zunächst der These von Beck und Giddens, so fällt ein sozialstrukturell begründbares Bindungsgeflecht als Erklärungsmodell für das heutige Wahlverhalten aus. An seine Stelle tritt häufig ein rationalistisches Konzept, das teilweise ökonomistische Züge trägt. Der Wähler, zu dem keine langfristige Bindung durch eine Partei oder ein politisches Lager (mehr) besteht, muss daher durch eine schlau konzipierte Kampagne vor und während des Wahlkampfes gezielt angesprochen und kurzfristig mobilisiert werden. Der Wähler kann also aus einem Angebot an Parteien auswählen und wählt frei nach seiner Interessenslage die vermeintlich beste Partei.
Heinrich Oberreuter spricht dieses Konzept in Bezug auf das Modell der Volksparteien mit Blick auf Otto Kirchheimer und Anthony Downs an (vgl. Oberreuter 2009: 46). Die „catch all party“ nach Kirchheimer und die „multipolicy party“, die Downs‘ ökonomischem Verständnis von Demokratie folgt, stehen sich demnach sehr nahe durch das „[…] Phänomen des Wettbewerbs, das Stimmenmaximierungsprinzip, die Partei als Marken- und Massenartikel, die Mobilisierung der Wähler für Handlungspräferenzen […]“. Dennoch hätten diese Konzepte auf die deutschen Volksparteien nie vollständig zugetroffen, da sie stets eine starke Wertorientierung und spezifische gesellschaftlich-politische Affinitäten besessen hätten. Linke und rechte Volkspartei hätten sich somit immer voneinander unterschieden (vgl. Oberreuter 2009: 47). Die dadurch entstandenen Bindungen hätten so lange Bedeutung gehabt, bis sie durch Auflösungsprozesse in Folge einer Modernisierung in der Gesellschaft, auch durch einen Wertewandel durch eine Individualisierung, verloren gegangen wären. Die Parteien hätten infolgedessen, auch durch die Anforderungen an moderne Politikvermittlung durch die Medien, verstärkt auf Visualisierung und Personalisierung gesetzt. Sie seien zu „professionalisierten Medienkommunikationsparteien“ geworden, die mehr durch Images und weniger durch Inhalte mobilisieren wollen (vgl. Oberreuter 2009: 48 ff.).
Auch Hans Jörg Hennecke folgt dieser Linie, wenn er argumentiert: „In Zeiten nachlassender Parteibindungen sind Wahlkämpfe weniger denn je missionarische Überzeugungsschlachten, sondern mehr denn je Mobilisierungskampagnen, die sich darin entscheiden, welcher der Parteien es in dem größten Ausmaß gelingt, eigene Anhängerschaften und Stammwähler zur Stimmabgabe zu mobilisieren.“ (Hennecke 2009: 157) Er spricht sich also gegen die Bedeutung von inhaltlicher Überzeugungsarbeit aus, die zugleich als Bindeglied zwischen Weltanschauung der Wähler und der der Parteien dienen würde, sondern plädiert ebenfalls für Mobilisierungskampagnen. Sozialstrukturelle Bindungen und Weltanschauungen spielen auch für ihn zunehmend keine Rolle mehr. Dennoch spricht er im nächsten Satz von den „Stammwählern“. Natürlich gibt es diese Stammwähler, gerade bei den Volksparteien, nach wie vor in erheblichem Ausmaß. Aber das Konzept der Bindungslosigkeit kann das Vorhandensein von Stammwählern eigentlich nicht hinreichend begründen. Hennecke bringt noch ein weiteres Konzept in die Diskussion ein, das das Verhalten der Parteien erklärbar machen soll. In seinem Aufsatz, der bezeichnenderweise „Wählermarkt und Koalitionsmarkt“ heißt (vgl. Hennecke 2009: 148 ff.), entwirft er ein Modell von zwei miteinander verbundenen „Märkten“, die für die Strategien der Parteien im Parteienwettbewerb bedeutend sind: Dem Wählermarkt und dem Koalitionsmarkt. Auf dem Wählermarkt würde es demnach um Stimmenmaximierung gehen, während auf dem Koalitionsmarkt, bei dem es um Mehrheitsbildung zwischen den Parteien geht, pragmatische Offenheit, Flexibilität, aber auch klare Zielsetzung notwendig seien. Dies würde für die Parteien oft zu einem großen politischen Spagat führen, bei dem aber Integrationskraft, Glaubwürdigkeit und Konsistenz nicht allzu sehr leiden dürften. Er behält dabei die Grundannahmen in Bezug auf das Verhalten der Wähler bei und schaut nur noch auf das Verhalten der Parteien. Daher kann er zur Klärung des eigentlichen Problems aus meiner Sicht nicht viel beitragen.
Fasst man die Thesen vom Bindungsverlust mit denen eben dargestellten zusammen, so scheint die Möglichkeit massiver Stimmenbewegungen bei jeder Wahl fast vorprogrammiert. Gelingt einer Partei im Wahlkampf keine überzeugende Mobilisierungskampagne, so dürften die Wahlergebnisse für diese unmöglich ähnlich gut ausfallen wie für eine Partei mit einer überzeugenden Kampagne. Selbst wenn es einer Partei gelungen sein sollte, sich bei der letzten Wahl als „Marke“ zu etablieren, so würde dies allein durch die Individualisierungstendenz und die schnelllebige Medienwelt nicht mehr genügen. Aber können diese Konzepte als Erklärungsansatz für das tatsächliche Wahlverhalten wirklich überzeugen? Was hat der Gedanke eines Wählermarktes und seine Mobilisierungskampagnen mit Repräsentation zu tun? Hennecke hat selbst darauf hingewiesen, dass in diesem Feld noch mehr von Bedeutung ist, nämlich „Integrationskraft, Glaubwürdigkeit und Konsistenz“. Außerdem spricht er von einem „realistischen Erwartungsmanagement“, um „Vertrauens- und Integrationskrisen“ zu verhindern.
Diesem Aspekt sind auch Geiling und Vester nachgegangen, um die eher kurzfristigen Stimmenverschiebungen zu erklären (vgl. Vester/Geiling 2009). Sie gehen davon aus, dass neben den sich wandelnden sozialstrukturellen Bindungen auch soziales Kapital der Parteien eine bedeutende Rolle für das Wahlverhalten spielt. Dabei verstehen sie unter dem sozialen Kapital der Parteien die Menge an Vertrauen, die sie sich bei der Bevölkerung erworben haben. Hierbei ist aber nicht ein kurzfristiger Werbeeffekt gemeint, sondern eine langfristig aufgebaute Vertrauensbasis. Um diese zu erarbeiten und zu pflegen sind daher keine Medienkampagnen und verstärkten Personalisierungen der Wahlkämpfe wichtig, sondern das langfristige und kleinteilige Engagement vor Ort an der Basis. Nun beschreiben Geiling und Vester die aktuelle Situation so, dass die schon länger anhaltende, tiefgreifende Akzeptanzkrise der Volksparteien eben durch einen starken Verlust an sozialem Kapital erklärt werden könne. Zwar wäre das soziale Kapital der Volksparteien nicht bei den ersten Enttäuschungen verloren gegangen, aber durch immer neue Enttäuschungen hätten sich viele Wähler nach und nach abgewendet. Dabei ist zu beachten, dass soziales Kapital in Form von Vertrauen schneller verloren gehen kann, als dass es aufgebaut werden kann. Ad hoc Mobilisierungen sind daher viel schwieriger zu erzeugen als ad hoc Demobilisierungen. Und selbst wenn sie gelingen, heißt das nicht, dass daraus auch soziales Kapital erwächst. Der Wahlkampf ist vielleicht gewonnen, aber keine langfristige Wählerbindung. Wird diese nicht langfristig erarbeitet, so können die eben gewonnen Wählerstimmen bei der nächsten Wahl schon wieder abgewandert sein.
Nach Geiling und Vester ist genau dies den Volksparteien passiert. Sie haben soziales Kapital und damit Wählerbindungen verloren, was zu einer dauerhaften Abkehr dieser Wähler geführt hat. Erst dies habe den kleinen Parteien überhaupt die Möglichkeit eröffnet, um ihrerseits vor Ort eigene dauerhafte Bindungen und damit soziales Kapital aufzubauen. Die Frage ist nun, wie die kleinen Parteien mit diesen Möglichkeiten, die aus der Krise der Volkparteien erwachsen, umgehen.
Zunächst bleibe ich aber noch beim Konzept des sozialen Kapitals. Auch Luhmann hat in seiner politischen Soziologie, die aus der Blickrichtung der Systemtheorie geschrieben wurde, vom Wähler und seinem Vertrauen gesprochen. Er nennt die Wähler „das Publikum in seiner Zuschauerrolle“, das auf „Symptome der Vertrauenswürdigkeit“ achtet, wobei es sich ein mehr oder weniger sachgerechtes und rationales Urteil über die Vertrauenswürdigkeit von Personen bildet. Dabei handele es sich um eine symbolische Kontrolle, die im Falle eines Vertrauensbruchs überscharf reagiert und den Politiker bzw. die Partei, die ihn stützt, disqualifiziert (vgl. Luhmann 2010: 405). Er befindet sich damit sehr nah am Konzept des sozialen Kapitals, allerdings nur dem auf Personen bezogenen. Er sieht nicht wie Vester und Geiling mit ihrem Konzept, dass auch Parteien als Akteure im politischen Feld sozusagen institutionalisiertes soziales Kapital aufbauen und auch wieder verlieren können. Letztlich sind es natürlich immer Personen als handelnde Akteure, die hinter dem Handeln von Parteien stehen. Aber diese Personen treten nicht unbedingt aus der Handlungseinheit Partei heraus und sind dann als Einzelpersonen für den Wähler erkennbar.
Bourdieu weist darauf hin, dass beide Arten von sozialem Kapital (er spricht an dieser Stelle von politischem Kapital), das persönliche und das delegierte Kapital, im politischen Feld zur Anwendung kommen. Bei dem persönlichen Kapital „[…] bezieht der Politiker seine magische Macht über die Gruppe aus dem Glauben der Gruppe an seine Repräsentation der Gruppe, die eine Repräsentation der Gruppe selbst und ihrer Beziehungen zu den anderen Gruppen ist.“ (Bourdieu 2001: 99) Mit Gruppe ist hier die Wählerklientel gemeint, die aufgrund des Vertrauens in einen Politiker oder eine Politikerin mehr diesen oder diese wählt als seine oder ihre Partei. Das delegierte Kapital ist dagegen das durch eine Partei in Form von Treue und Anerkennung aus früheren politischen Auseinandersetzungen akkumulierte soziale Kapital, das begrenzt und provisorisch auf Mandatsträger und Funktionäre dieser Partei übertragen werden kann, aber immer im Besitz der Institution Partei verbleibt (vgl. Bourdieu 2001: 101 f.). Geiling und Vester weisen aber darauf hin, dass gerade das persönliche Kapital oftmals überbewertet wird, indem es von den Medien und der rationalistischen Wahlforschung in Form einer zunehmenden Personalisierung und angeblichen Individualisierung als persönliches Charisma immer stärker in die Rolle eines Entscheidungsmerkmals gehoben wird, das über Sieg oder Niederlage bei Wahlen entscheidet. Dadurch wird es aber zum Fetisch, da der Entstehungshintergrund des sozialen Kapitals, der viel mehr mit dem delegierten Kapital einer Partei zusammenhängt, vernachlässigt wird. Stattdessen „[…] wird die Begeisterungs- und Mobilisierungsfähigkeit dem Zauber der Politikerpersönlichkeit zugeschrieben […]“ (Vester/Geiling 2009: 38). Das delegierte Kapital muss, wie es auch Bourdieu beschreibt, über einen längeren Zeitraum hinweg erarbeitet werden, und zwar nicht nur von einer charismatischen Persönlichkeit, sondern von der Partei als Ganzes.
Hierbei ist auch wichtig, was für ein Bild des zentralen Akteurs, dem Wähler, vermittelt wird. Beim Konzept des sozialen Kapitals wird deutlich, dass sich ein Wähler langfristig mit einer Partei beschäftigt, sie beobachtet und sich auch mit ihr identifizieren kann. Dies geschieht nicht unbedingt aktiv im politischen Feld, da dieses weitgehend Reservat der gebildeten und höheren Klassen geblieben ist, sondern oftmals durch informelle, interpersonelle Netzwerke im Nahbereich der sozialen Milieus. Lässt sich ein Wähler willentlich oder unbewusst repräsentieren, geschieht dies nicht nur am Wahltag. Identifiziert sich ein Wähler nun nicht mehr mit „seiner“ Partei, weil er mehrfach enttäuscht wurde, so ist dies nicht erst am vermeintlich entscheidenden Wahltag erfolgt, sondern resultiert aus einem längeren Prozess. Bei dem Modell ohne längerfristige Bindungsmöglichkeiten, bei dem in einem politischen Markt der Wähler spezifisch nach seinen Interessen mobilisiert werden soll, richtet sich die dafür notwendige Mobilisierungskampagne fast ausschließlich auf den Wahltag. Es geht nicht um die längerfristige Repräsentation eines Wählers, sondern um seine kurzfristige Gewinnung für die Stimmenabgabe. Für den längeren Prozess, der mit dem Modell des sozialen Kapitals zusammenhängt, wäre dieser kurzfristige Mobilisierungsversuch allerdings nur von geringer Bedeutung. Er könnte die langfristig herausgebildete Einstellung des Wählers nur schwerlich so schnell in die entscheidende Richtung verändern. Das Bild vom Akteur ist also verschieden.
Genau dieser Aspekt ist für den Mechanismus des sozialen Kapitals entscheidend. Worauf baut Vertrauen auf? Vertrauen wird nicht im leeren Raum erzeugt, sondern hängt noch von anderen Bedingungen ab. Vertrauen in ein Parteiimage ist tatsächlich volatil. Die sechs gesellschaftspolitischen Lager, die ich im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt habe, bilden die Struktur, in der die Praxis des sozialen Kapitals beobachtet werden kann. Die langfristig herausgebildeten Einstellungen der Wähler sind die Weltanschauungen, die den jeweiligen Lagern zugrunde liegen und zwischen dem Wähler als Individuum und der jeweiligen Partei stehen (vgl. Vester et al. 2001: 58 ff., 444 ff.). Die Parteien repräsentieren daher eher eine oder mehrere dieser Weltanschauungen und weniger einzelne Individuen. Hierzu benötigen sie aber Vertrauen in Form von sozialem Kapital, um die entsprechenden Weltanschauungen für die Wähler wirklich glaubwürdig zu repräsentieren. Die kurzfristigen Mobilisierungskampagnen setzen demnach an der falschen Stelle an. Um einzelne Wählergruppen kurzfristig zu mobilisieren, überspringen sie diese vermittelnde Ebene der Weltanschauungen. Um wirklich langfristigen Erfolg zu haben, müssten sie aber versuchen diese Weltanschauungen an sich zu binden. Dabei werden Koalitionen gebildet zwischen den repräsentierenden Eliten und den repräsentierten Klienten aus den entsprechenden Lagern. Die Krise der Repräsentation besteht demnach darin, dass die Parteien bestimmte Weltanschauungen nicht mehr repräsentieren, die sie früher erreichen konnten. Die Weltanschauungen haben aber trotzdem nach wie vor Bedeutung, da oftmals nur die Partei gewechselt wird und nicht das gesellschaftspolitische Lager. Vester et al. haben empirisch nachgewiesen, dass ein gesellschaftspolitisches Lager durchaus von mehreren Parteien repräsentiert werden kann. Was sich verändert ist also die Bindung zu einer bestimmten Partei und deren Eliten, nicht aber die Bindung zu einer bestimmten Weltanschauung und damit zu einem bestimmten Lager. Vester beschreibt dies folgendermaßen: „Wenn es sich gleichsam um „Familienzerwürfnisse“ zwischen den politischen Eliten und ihren Stammklientelen handelt, dann sind alle Erklärungen zweifelhaft, die die „Schuld“ kulturpessimistisch nur bei einer Seite suchen: in der Fragmentierung, Individualisierung oder Bindungslosigkeit „des modernen Menschen“ oder in der Unverantwortlichkeit oder Selbstbedienungsmentalität „der Politiker“. Es geht nicht um moralische Eigenschaften, sondern um politische Beziehungen.“ (Vester 2002: 114 f.)
2.3 Die Auswirkungen auf das deutsche Parteiensystem
Die milieuübergreifenden Koalitionen innerhalb weltanschaulicher Lager zwischen repräsentierenden Eliten und repräsentierten Klientelen sind zwar kein Naturgesetz, doch historisch die Regel. Selbst wenn die politischen Eliten nicht aus einem höheren Milieu stammten, wie z.B. bei der sozialistischen Bewegung, so brauchten auch diese Bewegungen Eliten als Fachleute mit entsprechenden Kompetenzen, um sich auf dem politischen Feld behaupten zu können, und bildeten diese somit aus der eigenen sozialen Klasse heraus (vgl. Vester 2002: 109 f.). Doch was ist nun in Folge der Krise der politischen Repräsentation mit dem deutschen Parteiensystem passiert?
Die beiden Erklärungsmodelle, die ich dargestellt habe, haben eine unterschiedliche Sicht auf den Wähler, kommen aber mit Blick auf die Parteien zunächst auf die gleichen Ergebnisse. Gerade der Zuspruch zu den Volksparteien nimmt ab, aber ein stabiler Trend zu den kleinen Parteien ist ebenfalls nicht zu bestätigen. Stefan Marschall schreibt mit Verweis auf Wolfgang Rudzio von drei Phasen der politischen Kultur in Deutschland, wobei die gegenwärtige dritte Phase die der „kritischen Distanziertheit“ wäre. Sie hätte ca. 1983 eingesetzt, befördert durch Parteispenden- und Korruptionsskandale, und habe zu einer wachsenden Parteien- und Politikverdrossenheit geführt. Es sei zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen politischen Eliten und der Bevölkerung gekommen (vgl. Marschall 2007: 57 f.). Hierbei werden aber einige Ebenen miteinander vermischt. Parteien- und Politikverdrossenheit sind nicht dasselbe und setzen auch an verschiedenen Stellen des politischen Feldes an. Politikverdrossenheit schiebt das Problem zu der Bevölkerung, die in großen Teilen grundsätzlich die politische Auseinandersetzung und ein Engagement in politischen Fragen ablehne. Parteienverdrossenheit sieht das Problem dagegen stärker bei den Parteien angesiedelt, die zu einer Entfremdung beigetragen hätten und unter den Wähler- und Mitgliederverlusten zu leiden haben. Die Problemsachlage muss also differenziert betrachtet werden.
Folgt man der These der Bindungslosigkeit, so liegt das Problem tatsächlich auf Seiten der Wähler. Die Parteien müssen demnach ihre Strategien dieser Veränderung anpassen und auf kurzfristige Erfolge setzen. Sie müssen sozusagen unter erschwerten Bedingungen „kampagnenfähig“ werden. Eine differenziertere Begründung des Problems fällt bei der Anwendung dieser Theorie schwer. Die zunehmende Bindungslosigkeit der Menschen durch die Modernisierung der Gesellschaft steht demnach absolut und für den Moment unveränderlich fest. Folgt man dagegen der These der Repräsentationskrise und des sozialen Kapitals, so zeigt sich ein vielfältigeres Bild der Problemsachlage. Den Volksparteien ist es demnach zunehmend nicht mehr gelungen, die sich wandelnden Weltanschauungen zu repräsentieren. Durch entsprechende Mängel in jeweils bestimmten thematischen Bereichen (z.B. bei der Union konservative Kernthemen, bei der SPD Kernthemen der sozialen Gerechtigkeit) ging den Parteien soziales Kapital bei ihren Wählern verloren. Bei diesen Entwicklungen spielen auch Tendenzen wie die Individualisierung der Gesellschaft eine Rolle, aber es handelt sich dabei nur um einen Teilaspekt größerer Prozesse. Dieses Erklärungsmodell scheint sich darin zu bestätigen, dass sich die in der Geschichte der Bundesrepublik neu entstanden Parteien aufgrund einer Nichtrepräsentation von bestimmten Weltanschauungen etablieren konnten. So wurde die postmaterialistische Weltanschauung der Grünen, die aus gesellschaftlichen Wandlungsprozessen entstanden war und sich in verschiedenen Themenfeldern widerspiegelte (Umwelt, Frieden), von den etablierten Parteien, besonders von der SPD, nicht genügend repräsentiert. Dadurch wurde der Erfolg der Grünen erst ermöglicht. Aber es müssen nicht nur neue Weltanschauungen sein, die nicht repräsentiert werden, sondern es können auch ältere sein (soziale Gerechtigkeit, Konflikt Arbeit und Kapital), wie bei der Entstehung der Partei Die Linke zu beobachten war.
Ich werde mich in dieser Arbeit aber zwei anderen Beispielen widmen, die noch aktueller sind. Die FDP hat mit ihrem Wahlerfolg bei der Bundestagswahl 2009 und den deutlichen Einbrüchen in der Gunst bei Meinungsumfragen und der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 ein weiteres Kapitel zu ihrer turbulenten Parteiengeschichte hinzugefügt. Und die Piratenpartei hat als Neugründung ebenfalls mit einem Wahlerfolg für ihre Verhältnisse bei der Bundestagswahl für Aufsehen gesorgt. An dieser Stelle möchte ich diese beiden Fälle in den Gesamtzusammenhang einordnen.
[...]
- Arbeit zitieren
- M.A. Sebastian Krätzig (Autor:in), 2010, Wandel des Wahlverhaltens. Das deutsche Parteiensystem und die Krise der politischen Repräsentation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162125
Kostenlos Autor werden



















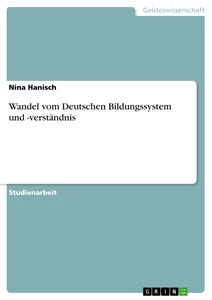



Kommentare