Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
THEORETISCHER TEIL
1. Einleitung
2. Motive
2.1 Zwei Analyseperspektiven: Druck oder Zug
2.2 Motivstärke
2.3 Motivkomponenten
2.4 Primäre und sekundäre Motive
2.5 Die klassische Motivtrias: Leistung, Macht und Anschluss
2.5.1 Das Leistungsmotiv
2.5.2 Das Machtmotiv
2.5.3 Das Anschlussmotiv
2.6 Implizite versus explizite Motive
2.6.1 Implizite Motive
2.6.2 Explizite Motive
2.6.3 Die Interaktionshypothese
2.6.4 Validitätsbereiche impliziter und expliziter Motive ..
2.7 Motivdiagnostik
2.7.1 Projektive Verfahren
2.7.2 Fragebogenverfahren am Beispiel der Personality Research Form
2.7.3 Semiprojektive Verfahren am Beispiel des Multi-Motiv Gitters
3. Persönliche Homepages
3.1 Definition persönlicher Homepages
3.2 Klassifikation persönlicher Homepages
3.3 Verbreitung persönlicher Homepages
3.4 Inhalte persönlicher Homepages
3.5 Motive für persönliche Homepages
3.6 Zielgruppen persönlicher Homepages
3.7 Selbstdarstellungstheorie
4. Ziel der Untersuchung
5. Fragestellung und Hypothesen
EMPIRISCHER TEIL
6. Methode
6.1 Allgemeine Beschreibung der Untersuchung
6.1.1 Untersuchungsinstrumente
6.1.2 Untersuchungsmaterialien .
6.1.3 Umgang mit Störvariablen
6.2 Stichprobenbeschreibung
6.3 Untersuchungsdesign
6.3.1 Prädiktorvariablen
6.3.2 Responsevariablen
6.3.3 Zusätzliche Variablen
6.4 Untersuchungsablauf
7. Ergebnisse
7.1 Interraterübereinstimmungen
7.2 Motivthematische Homepageinhalte und Motive der Probanden
7.3 Fragebogen „Persönliche Homepages“
7.3.1 Gewünschte Rubriken auf persönlichen Homepages
7.3.2 Gründe für eine persönliche Homepage
7.3.3 Erfahrungen mit persönlichen Homepages
7.3.4 Teilnahme an der „Untersuchung zur Wahrnehmung von Persönlichkeitsmerkmalen“
8. Diskussion
9. Zusammenfassung
10. Literaturverzeichnis
Anhang
THEORETISCHER TEIL
Im Zeitalter des Internets sind Homepages inzwischen weit mehr als nur eine Modeerscheinung und längst nicht mehr Großunternehmen und der Prominenz vorbehalten. Der Besitz einer persönlichen Homepage ist heute viel mehr allen Altersgruppen vom Teenager bis zum Senior, allen Personengruppen vom Single über das Pärchen bis zur Großfamilie und nahezu allen Nationalitäten zugänglich und aufgrund der weiterhin steigenden Zahlen zur Domainentwicklung (DENIC, 2006) offensichtlich noch längst nicht gesättigt.
In den vergangenen Jahren sind mit dem Trend zur persönlichen Homepage auch eine Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema einhergegangen (Machilek, Schütz & Marcus, 2004; Schütz, Machilek & Marcus, 2003; Döring, 2001). Die meisten der etwa 40 empirischen Arbeiten zum Forschungsgegenstand persönliche Homepages weisen aufgrund von Problemen einer adäquaten Stichprobenziehung jedoch eher explorativen Charakter auf (Schütz, Machilek & Marcus, 2003).
Das Beispiel der Homepage eines 17-Jährigen, der derzeit als Austauschschüler in Chile lebt und seine Erlebnisse vor Ort im Blog mit Bildern und Texten dokumentiert, ist ebenso charakteristisch für die Vielfalt der Selbstdarstellungen im Internet, wie die Seite der Bürokauffrau, die über ihre Bewerbungshomepage nach ihrer Elternzeit versucht zurück in den Beruf zu kehren. Albert, der privat auf seiner Homepage Informationen über erforderliche Rechnereinstellungen für den Internetzugang mit T-Online sammelt und diese interessierten Besuchern zu Verfügung stellt, ist ein weiteres Exempel. Und schließlich die Homepage der Großfamilie, die von A wie Auto, bis Z wie Zwergkaninchen alles über sich preisgibt und Verwandte und Freunde mittels ausführlicher Fotodokumentationen, Webcam und Gästebuch über die aktuellsten Geschehnisse auf dem Laufenden hält.
Was ist es nun aber, was Menschen dazu bewegt, der Öffentlichkeit Details aus Privat- und Berufsleben zu präsentieren? Die bunte Palette beispielhaft dargestellter persönlicher Homepages, wie sie das World Wide Web tatsächlich beinhaltet, macht deutlich, dass die Motive, eine persönliche Homepage zu besitzen, alles andere als einheitlich sind.
Die Frage nach Motiven menschlichen Handelns reicht in der Geschichte der Menschheit weit zurück. Im Alltag kommt die Frage nach Motiven oder Motivunterschieden meist dann auf, wenn verschiedene Menschen in derselben Situation, wie zum Beispiel bei der Gestaltung ihrer persönlichen Homepage, unterschiedlich handeln. Von den Handelnden genannte Gründe für ihr Tun sind meist trivial und können nur einen Teil der Verhaltensunterschiede erklären. Offensichtlich scheinen die eigenen Motive weder ohne Weiteres wahrgenommen, geschweige denn verbalisiert werden zu können.
Die durch diese Feststellung angeregte Forschung stellte immer wieder nur mäßige bis Nullkorrelationen zwischen den Ergebnissen projektiver Verfahren und Fragebogenverfahren der Motivdiagnostik fest (Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998; Emmons & McAdams, 1991). Augenscheinlich sprach dies für die Erfassung unterschiedlicher Konstrukte durch projektive und fragebogenbasierte Verfahren (vgl. McClelland, Clark, Robey & Atkinson, 1958; Schultheiss & Brunstein, 2001; Spangler, 1992). Aufbauend auf diesen Befunden postulierten McClelland, Koestner und Weinberger 1989 ein Modell, das von der unabhängigen Koexistenz impliziter und expliziter Motive ausgeht (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989). Während explizite Motive das Selbstbild einer Person widerspiegeln und mittels Selbstbericht erfasst werden können, entziehen sich implizite Motive weitgehend der Introspektion und können daher nur indirekt gemessen werden (Brunstein, 2006).
Erfolgt die Gestaltung persönlicher Homepages nun also bewusst und an expliziten Motiven orientiert oder spielen hier unbewusste, implizite Motive des Homepagebesitzers die entscheidende Rolle? Die vorliegende Untersuchung soll erstmals empirisch die motivationalen Hintergründe für die Gestaltung persönlicher Homepages beleuchten. Im Speziellen soll dabei die Frage beantwortet werden, ob es explizite oder implizite Motive einer Person sind, die sich bei der Gestaltung einer persönlichen Homepage widerspiegeln.
Im Folgenden werden zunächst eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand der Motivationsforschung skizziert, die klassische Motivtrias vorgestellt, Grundlagen der Motivdiagnostik erläutert und die Unterscheidung impliziter und expliziter Motive im Detail dargestellt. Im nächsten Abschnitt rundet die Darstellung des aktuellen Forschungsstands zum Thema persönliche Homepages den theoretischen Teil der Arbeit ab.
Ausgehend von diesem theoretischen Hintergrund werden anschließend das Ziel der Untersuchung, die Fragestellungen und die Hypothesen der vorliegenden Arbeit erläutert, bevor die Vorstellung der angewandten Untersuchungsmethode, der Ergebnisse und die kritische Auseinandersetzung mit diesen im Diskussionsteil folgen.
Die vorliegende Arbeit wurde von Prof. Dr. Stapf betreut und von Dipl. Psych. Iva Slavova angeleitet. Für die fachliche Betreuung, die vielen Anregungen und Hilfestellungen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.
Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die zu jedem Zeitpunkt hinter mir standen und mich in meinen Entscheidungen bestärkt haben, meinem Lebenspartner Rodja Marzschesky, der elf Semester lang die Höhen und Tiefen meines Studiums geduldig miterlebt hat und immer an meiner Seite stand und Inge und Kurt Marzschesky, die mich stets und in jeder Form unterstützt haben.
2. Motive
Unter dem Begriff Motiv wird die Bereitschaft verstanden, auf bestimmte Klassen von Zielzuständen mit typischen Affektmustern zu reagieren (Langens, Schmalt & Sokolowski, 2005). Für die Persönlichkeitspsychologie spielen Motive eine so wichtige Rolle, weil sie als relativ überdauernde Bewertungsdispositionen verstanden werden (Heckhausen, 1989), die für die Wahrnehmung, Deutung und Interpretation von Situationen und darin entstandener Ziele und Erwartungen ausschlaggebend sind (Schmalt & Sokolowski, 2000). Motive haben keine direkten Erlebniskorrelate, sondern sind als theoretische Konstrukte nur indirekt in ihren Auswirkungen beobachtbar (Schmalt et al., 2000).
Es ist Aufgabe von Motiven, potenzielle Zielzustände zu bewerten und Aufmerksamkeit auszurichten (Schneider & Schmalt, 2000). Dies geschieht oft unwillkürlich (Langens, Schmalt & Sokolowski, 2005) und somit ohne bewusste Steuerung, sobald ein entsprechender motivthematischer Hinweisreiz in der Umwelt vorliegt (Schmalt et al., 2000). Durch das Auftreten eines solchen spezifischen situativen Hinweisreizes wird ein Motiv aktiviert und es entsteht Motivation (Brunstein, 2006). Die eintretende selektive Informationsverarbeitung steuert nun Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisinhalte und -leistungen (Schmalt et al., 2000). Schmalt und Sokolowski (2000) gehen davon aus, dass diese selektive Informationsverarbeitung sicherstellt, dass ein positiv bewerteter Zielzustand auch verwirklicht werden kann. In der Folge kommt es zu entsprechendem Verhalten, um den angestrebten Zielzustand zu erreichen. Selbst unter widrigen Umständen wird das auf den Zielzustand ausgerichtete Verhalten konsequent weiterverfolgt (Schmalt et al., 2000).
Während unter Motiven also eine ständige, latent vorhandene Verhaltensbereitschaft, wie zum Beispiel Ängstlichkeit, zu verstehen ist, handelt es sich bei der Motivation eher um einen psychologischen Zustand, wie zum Beispiel Angst (Heckhausen, 1989). Schon Kurt Lewin postulierte in seiner Feldtheorie (1963), dass die Entstehung der aktuellen Motivation und des Verhaltens erst durch das Zusammenwirken von Personen- und Umweltfaktoren erklärbar ist (Lewin, 1963). Bei dieser „Person x Situation“-Interaktion treffen die Bedürfnisse, Ziele und Motive der Person mit den Gelegenheiten und möglichen Anreizen der Situation zusammen, um eine Handlung hervorzurufen (Heckhausen &
Heckhausen, 2006; Abbildung 1). Motivation ist also zu verstehen als der aktuelle Prozess, der durch die Anregung eines Motivs ausgelöst wird.
Nach McClelland erfüllt ein Motiv, das durch die Aufforderungsgehalte seiner Umwelt angeregt wurde, somit drei Funktionen: es energetisiert, orientiert und selegiert Verhalten, das für seine Befriedigung relevant ist (McClelland, 1980, 1987).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Grundmodell der „klassischen Motivationspsychologie“ nach Rheinberg, 2002, S. 72. (Die Anreize der Situation regen die Motive der Person an. Motivation entsteht aus der Wechselwirkung von Motivausprägung und situationalem Anreiz.)
2.1 Zwei Analyseperspektiven: Druck und Zug
In den historischen Ansätzen der Motivationspsychologie existieren die zwei Analyseperspektiven der Motivation durch „angetriebenes/gedrücktes“ Verhalten, im Sinne von Druck und „angezogenes“ Verhalten, im Sinne von Zug (Rheinberg, 2004). Wie Rheinberg berichtet, beschrieben schon Freud, Lorenz und Hull (Freud, 1905, 1915; Lorenz, 1942, 1963; Hull, 1943, 1952, zitiert nach Rheinberg, 2004) Triebe und Instinkte als verantwortlich für „angetriebenes/gedrücktes“ Verhalten. Vor allem lebenserhaltende Bedürfnisse wie Atmung, Hunger und Durst werden durch periodisch entstehende innerorganismische Spannungen erklärt, die eine Entladung durch entsprechende Aktivitäten erfordern. Defizite in diesen Bereichen können bei ausreichender Ausprägung zu einer Unterbrechung, Verschiebung oder Änderung anderer Aktivitäten führen. Die Koppelung von Trieb und Befriedigungshandlung, die die Ausführung des befriedigenden Verhaltens sicherstellt, kann angeboren oder durch Lernerfahrungen in der Vergangenheit erworben sein (Rheinberg, 2004). Rheinberg spricht in diesem Fall von einem „innerorganismisch verankerten Motivationssystem“ (Rheinberg, 2004, S.16), das jedoch nicht unabhängig von Anreizen der Umwelt agiert und Aktivitäten auf einen Zielzustand ausrichtet (Rheinberg, 2004).
Insbesondere komplexe Handlungsweisen können jedoch besser durch anziehende Zukunftsereignisse erklärt werden. „Zeitlich überdauernde Vorlieben für bestimmte Klassen von Zuständen“ (Rheinberg, 2004, S.18) erklären den „Zug“, höher organisierte Handlungen auszuführen. Die langfristige Ausrichtung des Verhaltens durch das Leistungs-, Macht- oder Anschlussmotiv (siehe 2.5) kann unter anderen auf diese Weise erklärt werden (Rheinberg, 2004).
Während also im Fall des gedrängten Verhaltens spezifische Schemata der durch Triebe aktivierten Aktivitäten bereits vorliegen müssen, führen die Motive einer Person im Fall angezogenen Verhaltens zunächst zu einer Bewertung potentieller Zielzustände und werden erst bei positiver Bewertung und entsprechender Situationsangemessenheit tatsächlich realisiert (Rheinberg, 2004).
2.2 Motivstärke
Wie bereits dargestellt, entscheiden die Motive einer Person darüber, welches Ziel von einer Vielzahl von möglichen Zielen tatsächlich verfolgt wird. In der Regel handelt es sich um Ziele, die individuell motivkongruent sind. Im Anschluss wird das Verhalten durch das Motiv bis zur Zielerreichung gesteuert. Motive geben also Aufschluss über die Art der Ziele und die generelle Richtung des Verhaltens (Schmalt et al., 2000).
Den durch Motive definierten Zielzuständen wird ein hoher Generalisierungsgrad nachgesagt (Langens et al, 2005), so dass sie intraindividuell konsequent in unterschiedlichsten Lebenssituationen verfolgt werden. Gemäß Heckhausen (1989) variiert die Stärke der Motive interindividuell jedoch deutlich. Nicht jeder Mensch weist dieselbe Ausprägung eines Motivs auf und so zeigen sich auch personenspezifische Präferenzen bezüglich verfolgter Handlungsziele (Heckhausen, 1989).
Der Einfluss der Motivstärke ist weit reichend. Nach Langens, Schmalt und Sokolowski (2005) liegt die Anregungsschwelle, im Sinne der erforderlichen Anreizintensität zur Motivationsentstehung, zum Beispiel bei einem stark ausgeprägtem Motiv deutlich niedriger als bei einem nur schwach ausgeprägten Motiv. Das Motiv wird im ersten Fall von einer Vielzahl von Situationen angeregt, während im Letzteren nur eine sehr begrenzte Anzahl von Situationen zu einer Anregung des Motivs führt (Langens et al., 2005). Laut Langens et al. (2005) wird auch die Richtung des Verhaltens durch die Zielwahl indirekt von der Motivstärke beeinflusst. Motivkongruente Handlungsziele werden, unabhängig von deren Bewusstseingrad, bis zur Zielerreichung verfolgt, während andere, unerwünschte Ziele vermieden werden. Die Intensität und Dauer eines Verhaltens gehören ebenfalls in den Einflussbereich der Motivstärke: je stärker ein Motiv ausgeprägt ist, desto intensiver und dauerhafter wird das entsprechende Verhalten ausgeführt werden. Ein stark ausgeprägtes Motiv führt, im Vergleich zu einem schwach ausgeprägten Motiv, zu einer stärker selektiven Informationsverarbeitung, bei der zielrelevante Informationen bevorzugt bearbeitet werden und bei der die Konzentration auf eine bestimmte, motivrelevante Tätigkeit automatisch erzeugt wird. Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit zur Befriedigung eines Motivs geführt haben, werden zukünftig vermehrt eingesetzt. Solche automatischen Lernprozesse gehören ebenso in den Einflussbereich der Motivstärke (Langens et al., 2005).
Die Ursachen interindividueller Motivunterschiede sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt. Die Vermutung biologisch angelegter Motivsysteme und einer Formung durch Lernerfahrungen liegt jedoch nahe (Langens et al., 2005).
2.3 Motivkomponenten
Die Unterscheidung zweier unabhängiger Motivkomponenten geht weit in der Geschichte der Persönlichkeitspsychologie zurück und wurde 1935 von Kurt Lewin begründet (Lewin, 1935). Nach Langens et al. (2005) treibt die Hoffnungskomponente, orientiert an der erfolgreichen Verwirklichung des angestrebten Zielzustandes, das Verhalten voran und entspricht einer aufsuchenden Motivation. Die Furchtkomponente dagegen stellt eine mögliche Verfehlung des Motivziels in den Vordergrund und kommt somit einer meidenden Motivation gleich (Langens et al., 2005). Die Ausprägung der beiden Motivkomponenten variiert interindividuell zwischen verschiedenen Menschen und intraindividuell zwischen verschiedenen Motiven. Während bei hoffnungsmotivierten Personen die Hoffnungskomponente eines Motivs überwiegt, übernimmt bei furchtmotivierten Menschen die Furchtkomponente diese Funktion. Bei entsprechend motivthematischen Anreizen wird die jeweilige Motivkomponente dann handlungsleitend.
2.4 Primäre und sekundäre Motive
Eine weitere Unterscheidung ist die Unterteilung der Motive in zwei unterschiedliche Motivarten. Heckhausen (1989) beschreibt, dass jeder Mensch zum einen angeborene Bedürfnisse mit einer genetischen Grundlage und phylogenetischer Entwicklung besitzt, die als biogene oder primäre Motive bezeichnet werden. Zu diesen Bedürfnissen gehören zum Beispiel Hunger, Durst, Sexualität und Schlaf. Sie dienen der Aufrechterhaltung der physiologischen Lebensbedingungen, dem Überleben der Gattung Mensch und dem physischen Wohlergehen. Zum anderen besitzt der Mensch gelernte bzw. erworbene Dispositionen, die auf Persönlichkeitseigenschaften basieren, im Laufe der Entwicklung entstehen und deren Ausprägung von den individuellen Erfahrungen abhängt. Hierzu zählen zum Beispiel die Bedürfnisse nach Leistung, Macht und Anschluss. Diese Motive werden als soziogene, psychogene oder sekundäre Motive bezeichnet (Heckhausen, 1989).
2.5 Die klassische Motivtrias: Leistung, Macht und Anschluss
Murray (1938) ist die Schlüsselfigur der persönlichkeitstheoretischen Motivationsforschung. Er erstellte einen Katalog mit 20 psychogenen Bedürfnissen (Murray, 1938, zitiert nach Heckhausen, 1989), die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die darin enthaltenen drei Motive Leistung (Achievement), Macht (Dominance) und Anschluss (Affiliation) können in nahezu allen alltäglichen Situationen angeregt werden. Aufgrund dieser Tatsache haben sie daher bis heute das größte Forschungsinteresse auf sich gezogen (Langens et al., 2005). Die erwähnten Motive Leistung, Macht uns Anschluss sind für die vorliegende Untersuchung von besonderer Bedeutung und werden daher nachfolgend im Detail dargestellt.
Tabelle 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkungen. Die Abkürzung „n“ steht für engl. „need“ (dt.: Bedürfnis)
2.5.1 Das Leistungsmotiv
Das Leistungsmotiv ist das mit Abstand am besten erforschte Motiv. McClelland und Atkinson gelten als die Urheber der Leistungsmotivationsforschung (Atkinson, 1957, 1958; McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953). Das Leistungsmotiv wird bei einer Auseinandersetzung mit Gütemaßstäben angeregt (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953) und soll optimalerweise ein Erfolgserlebnis hervorrufen (Rheinberg, 2004). Das Leistungsmotiv verfügt über die bereits erwähnte Hoffnungs- und Furchtkomponente (siehe 2.3). Eine stark ausgeprägte Hoffnung auf Erfolg lässt Personen danach streben, diesen Gütemaßstab zu übertreffen und Stolz bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit zu empfinden (Langens et al., 2005). Typischerweise werden solche Anforderungen gewählt, die vielleicht gerade noch zu schaffen und damit als Herausforderung zu betrachten sind (Rheinberg, 2004). Rheinberg (2004) beschreibt zwei unterschiedliche Bezugsnormen, die den eigenen Gütemaßstab definieren können. Während bei der individuellen Bezugsnorm die eigene Leistung mit dem bisherigen Leistungsniveau verglichen wird (Beispiel: „Ist meine letzte Leistungsbeurteilung besser ausgefallen als die Vorherige?“), werden bei der sozialen Bezugsnorm Bezugsgruppen zum Vergleich herangezogen (Beispiel: „Ist meine Leistungsbeurteilung besser als die meiner Kollegen?“; Rheinberg, 2004). Personen mit einer ausgeprägten Hoffnung auf Erfolg orientieren sich primär an der individuellen Bezugsnorm (Brunstein & Hoyer, 2002). Informationen über ihren Leistungsverlauf sind diesen Personen wichtiger als die reine Auskunft über ihren leistungsbezogenen Rangplatz in der Gruppe beim Vergleich mit der sozialen Bezugsnorm.
Langens et al. (2005) beschreiben, dass Personen mit einer starken Furcht vor Misserfolg generell die Auseinandersetzung mit Gütemaßstäben vermeiden, um ein mögliches Scheitern nicht als eindeutigen Hinweis auf mangelnde Fähigkeiten zu interpretieren. Leistungssituationen stellen sich diese Personen nur, wenn die Situation so arrangiert wurde, dass sie die Verantwortung für einen Misserfolg nicht bei sich suchen müssen. Die Wahl einer extrem schweren Aufgabe, an der auch die meisten anderen Menschen scheitern würden, oder das Hinauszögern der Aufgabenbearbeitung bis die wenige verbleibende Zeit keine vernünftige Lösung der Aufgabe mehr ermöglicht, gehören zu deren typischen Taktiken (Langens et al., 2005).
2.5.2 Das Machtmotiv
Das Machtmotiv äußert sich in dem Bedürfnis, sich stark und einflussreich zu fühlen (Winter, 1992). Wie auch das Leistungsmotiv verfügt auch das Machtmotiv über zwei Komponenten. Personen mit einer ausgeprägten Hoffnung auf Kontrolle genießen es, ihre Überlegenheit, je nach Veranlagung, durch körperliche Präsenz oder intellektuelle Streitgespräche zu demonstrieren (Langens et al., 2005). Dynamisches Machtgeschehen erfordert nun den Widerstand des Gegenübers (Rheinberg, 2004). Als begehrteste Machtquellen nennt Brunstein (2006) Prestige, Besitz, Status, Führungspositionen oder die Kontrolle über Informationen. Das Ziel eines solchen Machtgebarens ist es, das Erleben und Verhalten anderer zu kontrollieren und dabei den eigenen Machtbereich auszuweiten (Brunstein, 2006).
Langens et al. (2005) beschreiben, dass sich Furcht vor Kontrollverlust dagegen in dem Bestreben äußert, eigene Machtressourcen zu sichern. Personen mit starker Furcht vor Kontrollverlust leben ständig in der Sorge, andere Menschen könnten ihren Machtbereich einschränken, ihnen Informationen vorenthalten oder sie anderweitig benachteiligen. Die Annahme, Gefühle der Schwäche und Minderwertigkeit meiden zu wollen, liegt daher nahe (Langens et al., 2005).
Insgesamt stellt Rheinberg (2004) fest, dass die Machtmotivationsforschung sowohl auf der theoretischen, als auch auf der empirischen Ebene aufgrund der Komplexität ihres Untersuchungsgegenstandes noch lange nicht soweit entwickelt ist wie die Forschung zum Leistungsmotiv (Rheinberg, 2004).
2.5.3 Das Anschlussmotiv
Das Anschlussmotiv wird angeregt in Situationen, in denen mit fremden oder wenig bekannten Personen Kontakt aufgenommen und interagiert werden kann (Langens et al., 2005). Heckhausen (1989) beschrieb das Anschlussmotiv folgendermaßen:
... was der Motivationsforschung mit dem ‘Anschlussmotiv’ vor Augen stand, ist die täglich wahrnehmbare Grenzlinie, die zwischen den uns vertrauten und den fremden Mitmenschen verläuft. Aus Fremden Bekannte und schließlich Vertraute und freundschaftlich Gesinnte zu machen, dass man dabei aber auch zurückgewiesen werden kann, das ist das Thema des Anschlussmotivs. (Heckhausen, 1989, S. 343)
Die beiden Komponenten des Anschlussmotivs sind die Hoffnung auf Anschluss und die Furcht vor Zurückweisung. Das Anschlussmotiv zielt also auf die Herstellung, Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung einer wechselseitigen positiven Beziehung ab, wobei Zurückweisung durch andere Menschen vermieden werden soll (Langens et al., 2005). Hierbei ist gemäß Brunstein (2006) besonders hervorzuheben, dass Personen mit hoher Furcht vor Zurückweisung nicht weniger Umgang mit anderen Menschen haben und auch ihre Einstellungen gegenüber zwischenmenschlichen Kontakten alles andere als ablehnend sind. Ingesamt sind diese Menschen in Anwesenheit fremder Personen jedoch weniger zuversichtlich, stärker angespannt, ängstlich und gestresst, was sich auf die Interaktionspartner überträgt. Hohe Furcht vor Zurückweisung geht zudem meist mit einer weniger beliebten und insgesamt einsameren Selbstbeurteilung einher (Brunstein, 2006).
2.6 Implizite versus explizite Motive
Aufbauend auf zahlreichen Befunden, die für die Erfassung unterschiedlicher Konstrukte durch projektive (siehe 2.7.1) und fragebogenbasierte (siehe 2.7.2) Motivmessungen sprechen (vgl. McClelland, Clark, Robey & Atkinson, 1958; Schultheiss & Brunstein, 2001; Spangler, 1992;), formulierte McClelland 1980 erstmals die These, dass implizite und explizite Motive auf unterschiedliche Aspekte des Verhaltens Einfluss nehmen (McClelland, 1980).
Während implizite Motive durch operantes Verhalten zum Ausdruck kommen, geschieht dies bei expliziten Motiven durch respondentes Verhalten (Brunstein, 2006). McClelland bezeichnete unter Eigeninitiative der Person entstandenes, spontan ohne längeres Nachdenken ausgeführtes und über längere Zeiträume wiederholtes Handeln erforderndes Verhalten als operant (McClelland, 1980). Unter respondentem Verhalten dagegen verstand McClelland Verhalten, „das durch klar identifizierbare Umstände der Situation hervorgerufen …, bewusst abgewogen und reflektiert … und durch eine Person willentlich beeinflusst werden kann“ (Brunstein, 2006, S.239). Seine Unterscheidung zwischen operantem und respondentem Verhalten wurde durch eigene und Untersuchungen von McAdams und Constantin (1983), deChrams et al. (1955), Biernat (1989) und Brunstein und Hoyer (2002) immer wieder gestärkt (Biernat, 1989; Brunstein & Hoyer, 2002; deCharms, Morrison, Reitman & McClelland, 1955; McAdams et al., 1983; McClelland, 1985a).
Drei grundlegende Gruppen von Befunden sprechen für die prognostische Spezifität impliziter und expliziter Motive (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989):
- Implizite und explizite Motive beeinflussen unterschiedliche Verhaltensklassen.
- Implizite und explizite Motive werden von unterschiedlichen Anreizen aktiviert.
- Implizite und explizite Motive stehen mit unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen in Zusammenhang.
McClelland et al. entwickelten daraufhin 1989 ein Modell, das von der Koexistenz zweier unterschiedlicher Arten von Motiven ausgeht. Implizite Motive werden dabei durch die Messung mittels projektiver Verfahren (siehe 2.7.1) operational definiert, während dies bei expliziten Motiven durch die Messung mittels Fragebogen (siehe 2.7.2) geschieht (McClelland et al., 1989). Eine tabellarische Übersicht grundlegender Unterschiede impliziter und expliziter Motive findet sich in Tabelle 2.
Die Unterscheidung impliziter und expliziter Motive spielt für die vorliegende Untersuchung eine elementare Rolle. Daher wird im Folgenden detailliert auf diese Unterscheidung eingegangen.
2.6.1 Implizite Motive
Implizite Motive beruhen auf früh gelernten, vorsprachlichen Erfahrungen (McClelland & Pilon, 1983) und sind daher Methoden des Selbstberichts nicht zugänglich (Brunstein, 2006). Ihre nicht bewusste und eng mit emotionalen Erfahrungen verknüpfte Repräsentationsform (Woike, McIeod & Goggin, 2003) lässt auf einen genetisch determinierten Ursprung schließen (Brunstein, 2006). Implizite Motive werden durch natürliche, angeborene Auslöser wie aufgaben- und tätigkeitsbezogene Anreize in Form von Schwierigkeit und Herausforderung angeregt (Spangler, 1992) und sind laut Brunstein (2006) mit langfristigem Verhalten oder spontan (operant) auftretenden Gedanken korreliert (z.B. Berufserfolg, Tagträume, Erinnerungen; Brunstein, 2006). Sie sagen aufgrund des Genusses der Aktivität an sich eher spontanes Handeln und zeitlich überdauernde Verhaltenstrends vorher (Brunstein & Hoyer, 2002). Selbstreflexion und bewusste Verhaltenkontrolle sind für die Anregung eines impliziten Motivs oder seine Umsetzung in instrumentelle Handlungen nicht erforderlich (McClelland et al., 1989). Da implizite Motive nicht bewusst repräsentiert sind, ist deren Erfassung nicht über Fragebogen sondern nur über indirekte Methoden wie projektive (siehe 2.7.1) oder semiprojektive Verfahren (siehe 2.7.3) möglich (Brunstein, 2006). Dem traditionell postulierten Zusammenhang impliziter Motive mit Bedürfnissen, also needs, folgend, werden die Motive Leistung, Macht und Anschluss häufig als nAch (Leistungsmotiv), nPow (Machtmotiv) und nAff (Anschlussmotiv) bezeichnet (vgl. Murray, 1938).
2.6.2 Explizite Motive
Laut Brunstein (2006) spiegeln explizite Motive Werte, Ziele und Selbstbilder einer Person wider, die sie sich selber zuschreibt und mit denen sie sich identifiziert (Brunstein, 2006). Daher werden sie häufig auch als selbstattribuierte Motive (Brunstein, 2006) oder als „values“ (vgl. Atkinson, 1964; McClelland, 1985) bezeichnet. In Einklang mit dieser Tradition haben sich die Bezeichnungen vAch (Leistungsmotiv), vPow (Machtmotiv) und vAff (Anschlussmotiv) etabliert (vgl. Atkinson, 1964; McClelland, 1985).
Explizite Motive geben die Vorstellung einer Person bezüglich ihrer handlungsleitenden Motive wieder und stehen theoretisch dem Selbstkonzept nahe (Woike, McIeod & Goggin, 2003). Explizite Motive zeigen primär Einfluss auf kurzfristige Entscheidungen und Bewertungen, die Individuen bewusst kontrollieren und somit gezielt mit dem eigenen Selbstbild in Übereinstimmung bringen können (Brunstein & Hoyer, 2002). Jedoch müssen die sich selbst zugeschriebenen Motive einer Person nicht unbedingt mit denjenigen Motiven übereinstimmen, die dem Handeln der Person tatsächlich zugrunde liegen (Brunstein, 2006). Explizite Motive werden erst im Kontext der Entwicklung sprachlich repräsentierter Selbstkonzepte ausgebildet (McClelland & Pilon, 1983). Sie beruhen im Gegensatz zu impliziten Motiven auf sozialen Lernerfahrungen, werden daher auch durch sozial-evaluative Anreize aktiviert und sind eng an das kognitive System gebunden (Spangler, 1992). Sie beruhen auf stark kognitiv elaborierten Konstrukten und sagen unmittelbare Reaktionen auf strukturierte Situationen hervor, in denen die entsprechenden sozialen Anreize vorhanden sind (Brunstein, 2006). Durch soziale Appelle, wie zum Beispiel eine Versuchsanweisung, kommt es zu Aktivierung und zu Vorhersagen bezüglich situationsspezifischem, respondentem Verhalten, so dass zum Beispiel Lernleistungen in einer Laborsituation möglich werden (McClelland et al., 1989). Da explizite Motive also bewusst zugänglich sind, kann deren Erfassung über Fragebogenverfahren (siehe 2.7.2) erfolgen. Im Gegensatz zu impliziten Motiven sind explizite Motive dem Einfluss sozialer Erwünschtheit ausgesetzt (Brunstein, 2006). Es finden sich daher nur niedrige oder Nullkorrelationen zwischen diesen beiden Motivklassen (McClelland, 1985).
2.6.3 Die Interaktionshypothese
Die Koexistenz zweier voneinander unabhängiger motivationaler Systeme schließt jedoch eine Wechselwirkung impliziter und expliziter Motive in der Entstehung von Verhalten und Erleben von Individuen nicht aus (Brunstein, 2006). Heckhausen und Heckhausen formulieren diese Tatsache als Interaktionshypothese (Heckhausen & Heckhausen, 2006). Implizite Motive üben eine energetisierende Funktion innerhalb der Verhaltensregulation aus, expliziten Motiven dagegen wird eine lenkende Funktion zugeschrieben (Biernat, 1989; McClelland, 1985a). Während also unbewusst hoch generalisierte Präferenzen bezüglich der Auseinandersetzung mit bestimmten Anreizen in unterschiedlichen Lebensbereichen bestehen (implizite Motive), hängt die Entscheidung über den Lebensbereich, also das „Wo“ ebenso wie das „Wie“, im Sinne einer bestimmten Verhaltensweise, von bewussten Zielen, Werten und Einstellungen (explizite Motive) der Person ab (Brunstein, 2006). Sowohl in Laboruntersuchungen (French & Lesser, 1964) als auch in realen Lebenssituationen (Langens, 2001) wurden Hinweise auf ein solches koalistisches Zusammenwirken impliziter und expliziter Motive gefunden.
Jedoch wirken implizite und explizite Motive nicht immer harmonisch zusammen. Wenn Personen sich Ziele setzen, die durch kein äquivalentes Motiv unterstützt werden, treten ebenso Diskrepanzen zwischen impliziten und expliziten Motivtendenzen auf, wie durch auftretende Konflikte zwischen der Verwirklichung eines persönlichen Ziels und der Befriedigung eines andersthematischen Motivs (Winter, 1996). Die Konsequenz ist in diesen Fällen ein erhöhter Bedarf an Selbstkontrollstrategien bei der Verwirklichung von Zielen (Kuhl, 2001).
Tabelle 2
Übersicht grundlegender Unterschiede impliziter und expliziter Motive nach McClelland, Koestner & Weinberger (1989)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.6.4 Validitätsbereiche impliziter und expliziter Motive
Zahlreiche Untersuchungen haben die Validitätsbereiche impliziter und expliziter Motive näher beleuchtet, wobei derzeit zur Validität des Leistungsmotivs die umfassendste Forschung besteht.
Die prognostische Stärke impliziter Motive liegt bei einem hohen impliziten Leistungsmotiv an sich bzw. bei dessen Verbindung mit einem hohen Machtmotiv (McClelland & Boyatzis, 1982, zitiert nach Brunstein, 2006) unabhängig von Ausbildungsniveau, Intelligenz oder Temperament in der erfolgreichen Vorhersage beruflicher, unternehmerischer und ökonomischer Erfolge (Brunstein, 2006). Explizite Motive können dagegen mit keiner vergleichbaren Validität bei der Vorhersage von Merkmalen der Produktivität, Innovation und Kreativität im Erwachsenenalter aufwarten (McClelland & Boyatzis, 1982, zitiert nach Brunstein, 2006). Zudem geht ein hohes implizites Leistungsmotiv zugleich mit einem positiven Selbstbild genereller intellektueller Fähigkeiten einher (Brunstein, 2006). Während implizite Leistungsmotive außerdem den Einsatz von Anstrengung bei leistungsbezogenen Aufgaben voraussagen, erlauben explizite Leistungsmotive Vorhersagen über die Entscheidung zur Ausführung leistungsbezogener Tätigkeiten (Brunstein & Hoyer, 2002). In aufgabenorientierter Atmosphäre, d.h. ohne externen Leistungsdruck und mit nur dem Anreiz der Schwierigkeit, Komplexität und Neuheit der gestellten Aufgabe, führt ein hohes implizites Leistungsmotiv bei größerer Anstrengung und Ausdauer zur besseren, schnelleren oder effektiveren Aufgabenbearbeitung (Brunstein, 2006). Das implizite Leistungsmotiv sagt zudem operante, nicht aber respondente Formen des Leistungsverhaltens hervor (Spangler, 1992).
Implizit leistungsmotivierte Kinder können Belohnungen aufschieben und Versuchungen widerstehen, was elementare Voraussetzung dafür ist, sich mit Ausdauer und Konzentration schwierigen Aufgaben zu widmen (Mischel & Gilligan, 1964). McClelland (1989) vermutete, dass unterschiedliche erzieherische Praktiken ebenfalls Einfluss auf die impliziten und expliziten Motive haben (McClelland, 1989). In den Untersuchungen von McClelland und Pilon (1983) und McClelland (1987) fand sich tatsächlich, dass die Kontrolle körperlicher Bedürfnisse (Sauberkeits- und Reinlichkeitserziehung) ebenfalls eine wichtige Rolle bei Entwicklung des impliziten Leistungsmotivs spielt (McClelland, 1987; McClelland & Pilon, 1983). Trash und Elliot (2002) stellten ergänzend fest, dass sich das implizite und explizite Leistungsmotiv in manchen Bereichen annähern, in anderen dagegen grundlegend unterscheiden. Je stärker eine Person selbstbestimmt agiert, desto höhere Übereinstimmungen fanden sich zwischen implizitem und explizitem Leistungsmotiv (Trash & Elliot, 2002).
Erwachsene mit hohem impliziten Machtmotiv haben laut McClelland (1987) und McClelland und Pilon (1983) frühe, ungestörte Erfahrungen der eignen Wirksamkeit auch in Form aggressiven Verhaltens machen dürfen. Das explizite Machtmotiv bei Erwachsenen dagegen scheint in Zusammenhang mit hohen Selbstständigkeitsforderungen, Leistungserwartungen und mit häufiger Bestrafung und körperliche Züchtigung bei Feindseligkeiten gegenüber den Eltern zu stehen (McClelland & Pilon, 1983; McClelland, 1987).
Implizite Anschlussmotive sagen die Häufigkeit vorher, mit der Personen mittelbar (z.B. Briefeschreiben) oder unmittelbar (z.B. Konversation) in Kontakt zu anderen Personen stehen (McClelland, 1985a).
2.7 Motivdiagnostik
Die Messung von Motiven stellt in der Psychologie ein ausgesprochen interessantes Feld dar, da Motive, wie bereits erwähnt, eine zentrale Rolle bei der Verhaltensregulation spielen. Sowohl in pädagogischen, als auch in arbeitspsychologischen Kontexten eröffnet die Motivmessung daher neue Handlungsspielräume (Langens, Schmalt & Sokolowski, 2005). Wie viele andere Felder der Psychologie war auch die Motivdiagnostik in den letzten Jahren unterschiedlichen Trends unterworfen. Während in den 50er und 60er Jahren die Motivdiagnostik mittels projektiver Verfahren, wie dem thematischen Apperzeptionstest (TAT; Murray, 1938) florierte, wurden in den 70er Jahren respondente Meßmethoden in Form von Fragebögen wie zum Beispiel der Personality Research Form von Jackson (PRF, Jackson, 1974) immer beliebter (Schmalt et al., 2000). deCharms, Morrison, Reitman und McClelland gehörten 1955 zu den ersten Autoren, die aufgrund gefundener Diskrepanzen zwischen mittels TAT (Murray, 1979) erfassten und mit Hilfe von Fragebögen erfassten Motiven, die konvergente Validität des TAT (Murray, 1979) in Frage stellten (deCharms, Morrison, Reitman & McClelland, 1955). Selbst unter Bezug auf den gleichen motivthematischen Inhalt, schienen TAT-geleitete und fragebogenbasierte Motivmessungen unterschiedliche Konstrukte zu erfassen und damit diskriminante Validität aufzuweisen (Brunstein, 2006). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch zahlreiche andere Studien (vgl. McClelland, Clark, Robey & Atkinson, 1958; Schultheiss & Brunstein, 2001; Spangler, 1992). Mäßige (Emmons & McAdams, 1991) bis Nullkorrelationen (Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998) zwischen TAT- (Murray, 1979) und Fragebogenwerten waren an der Tagesordnung. Zusätzlich wurden die psychometrischen Gütestandards des TAT (Murray, 1979), insbesondere hinsichtlich Wiederholungszuverlässigkeit und interner Konsistenz, in Frage gestellt (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989).
Die erstmals von McClelland et al. (1989) eingeführte Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Motiven (McClelland et al., 1989; siehe 2.6) löste die Debatte bezüglich der unterschiedlichen Ergebnisse für ein Motiv bei TAT (Murray, 1979) und Fragebogen, da zwei voneinander unabhängige Motivationssysteme postuliert und damit Erklärungen für die unterschiedlichen Ergebnisse aufgezeigt werden konnten.
Seit Mitte der 70er Jahre kommen auch methodisch zwischen diesen beiden Verfahrenstypen platzierte und daher als semiprojektive Verfahren bezeichnete Methoden (Schmalt, 1999; Sokolowski, Schmalt, Langens & Puca, 2000) wie das Multi-Motiv Gitter (MMG; Schmalt, Sokolowski & Langens, 1999, 2000) zum Einsatz.
Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Persönlichkeitsmessung werden im Gebiet der Motivdiagnostik heute alle drei dieser methodisch unterschiedlichen Verfahren eingesetzt. Im Folgenden werden daher die gebräuchlichen Verfahren der Motivdiagnostik näher betrachtet und die in dieser Arbeit eingesetzten Persönlichkeitsverfahren PRF (Stumpf, Angleitner, Wieck, Jackson & Beloch-Till, 1985) und MMG (Schmalt et al., 1999) im Detail dargestellt.
2.7.1 Projektive Verfahren
Wie bereits erwähnt, beeinflussen Motive die Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen. Diese Tatsache hat sich die Motivdiagnostik zu Nutze gemacht und daraus ein simples Grundprinzip zur Motivmessung entwickelt. Langens et al. (2005) berichten, dass die Grundannahme projektiver Verfahren besagt, dass unbewusste Bedürfnisse und Wünsche in das Testmaterial projiziert werden. Projektive Verfahren erfassen damit die impliziten Motive einer Person, die über ein direktes Befragen nicht zugänglich sind. Durch die Darbietung mehrdeutiger Reize wird versucht herauszufinden, welche Anreizstrukturen die Testpersonen darin zu entdecken meinen. Die Aussagen der Testpersonen werden im Anschluss nach formalen bzw. inhaltlichen Merkmalen kodiert und Rückschlüsse auf latente Bedürfnisse, Motive, Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften gezogen (Langens et al., 2005). Nach McClelland (1980) erfassen projektive Verfahren das Verhalten einer Person, das der Eigeninitiative der handelnden Person entspringt und spontan und ohne längere Überlegungen wiederholt über einen längeren Zeitraum ausgeführt wird. Sie werden daher auch als operante Verfahren bezeichnet (McClelland, 1980).
Laut Amelang und Schmidt-Atzert (2006) bieten operante Verfahren eine Reihe von Vorteilen. Durch die geringe Transparenz für die Testpersonen ermöglichen sie einen Einblick in die tatsächlichen zentralen Wünsche, Einstellungen und Bedürfnisse der Personen. Zudem bauen projektive Verfahren durch ihren spielerischen Charakter Antwortwiderstände ab und ermöglichen auch die Erfassung schwer verbalisierbarer Sachverhalte mit hohem emotionalem Gehalt. Ein weiter Vorteil liegt in der Tatsache, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, so dass sozial erwünschte Antworten daher bei operanten Verfahren kein Problem sind (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006).
Genau dies ist jedoch laut Fisseni (1997) gleichzeitig auch der größte Nachteil projektiver Verfahren. Ohne klare Auswertungs- und Interpretationsnormen hängt die Qualität der Auswertung und damit die Qualität der Diagnose allein vom Auswerter ab. Mit Ausnahme weniger Verfahren liegen Normen nur im Sinne grober Richtwerte vor. Erst durch entsprechendes Erhebungs- und Auswertungstraining des Untersuchers, ausreichend Erfahrung und ständige Supervision lässt sich Objektivität erreichen. Auch die Durchführungsobjektivität ist aufgrund der mehrdeutigen Reize zu bemängeln. Der erforderliche Schluss vom Indikator (Testmerkmal) auf das induzierte Merkmal (Persönlichkeitsmerkmal) führt zu einer unbefriedigenden Validität dieser indirekten Verfahren. Retest-Reliabilität und innere Konsistenz sind niedrig. Projektive Verfahren werden den Gütekriterien der klassischen Testtheorie daher in Bezug auf Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität, Reliabilität und Validität der Interpretationen nur in begrenztem Maße gerecht (Fisseni, 1997).
Projektive Verfahren arbeiten mit den unterschiedlichsten mehrdeutigen Reizen. Beim Rorschach-Test (Rohrschach, 1992), einem Formdeuteverfahren, werden den Probanden zu deutende Tafeln mit symmetrischen Tintenklecksen präsentiert. Andere Verfahren dagegen arbeiten, wie der zeichnerisch/gestalterische Sceno-Test (von Staabs, 1995), mit vorgegebenen Materialien, aus denen eine symbolische Szene gestaltet werden soll. Der thematische Apperzeptionstest (TAT; Murray, 1979) gehört zu den verbal-thematischen Verfahren und ist eines der bekanntesten, wenn gleich auch vielfach kritisierten projektiven Verfahren (Brunstein, 2006). Er eignet sich für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene gleichermaßen (Brunstein, 2006). Gemäß Rheinberg (2004) wird den Probanden eine Auswahl von sechs bis sieben aus 20 mehrdeutigen Bildern präsentiert, auf denen meist soziale Situationen dargestellt sind. Die Aufgabe der Probanden liegt darin, kreative Fantasiegeschichten zu diesen mehrdeutigen Bildern zu schreiben, aus denen hervorgeht, was auf dem Bild geschieht, was die beteiligten Personen denken, fühlen und wollen, wie es zu der jeweiligen Situation kam und wie die Geschichte ausgehen wird (Rheinberg, 2004). Mit Hilfe eines Inhaltsschlüssels werden anschließend Punktwerte für die Motive Leistung, Macht und Anschluss und entsprechende Motivkennwerte des Probanden ermittelt (Brunstein, 2006).
Entsprechend der allgemeinen Kritik an projektiven Verfahren (vgl. Heckhausen, 1989; Brunstein, 2006) ist die Auswertung des TAT (Murray, 1979) sehr aufwändig. Nach Heckhausen (1989) ist der TAT (Murray, 1979) auch nach den Kriterien der klassischen Testtheorie kein gutes Verfahren (Heckhausen, 1989). Ihm werden mangelnde Reliabilität im Sinne einer geringen Split-Half-Reliabilität (nicht homogene „Antworten“ bei verschiedenen Bildern) und einer geringen Retest-Reliabilität nachgesagt (Heckhausen, 1989). Bezüglich der Retest-Reliabilität lässt sich jedoch anmerken, dass die Probanden angewiesen werden, möglichst kreative Geschichten zu erfinden und daher versuchen könnten, möglichst wenige Wiederholungen einfließen zu lassen. Die geringe Split-Half- Reliabilität wiederum könnte das Resultat unterschiedlich motivthematisch anregender Bildsituationen sein. Laut Heckhausen (2006) kann Auswertungsobjektivität beim TAT (Murray, 1979) nur unter den oben genannten Trainingsbedingungen und entsprechender Erfahrung gewährleistet werden. Es wurde allerdings argumentiert, die Testgütekriterien könnten aufgrund der besonderen Natur des Tests nicht auf den TAT (Murray, 1979) angewendet werden. In der empirischen Forschung hat sich der TAT (Murray, 1979) dennoch bewährt, wobei er keine verlässlichen Aussagen über die Motive von Individuen, sondern nur über Gruppenunterschiede machen kann (Heckhausen, 2006).
2.7.2 Fragebogenverfahren am Beispiel der Personality Research Form
Fragebogenverfahren werden auch als respondente Verfahren bezeichnet. Der Begriff „respondent“ bezeichnet Verhaltensweisen, die als Antwort reaktiv auf bestimmte, eindeutig auszumachende Stimuli auftreten (McClelland, 1989). McClelland (1980, 1985) setzt respondente Verfahren mit Fragebogenverfahren der Motiv- und Persönlichkeitsdiagnostik gleich, da diese Verfahren den Probanden sprachlich formulierte Items unterschiedlicher Generalisierbarkeit zur Bearbeitung vorlegen (Sokolowski, 1995, zitiert nach McClelland, 1980, 1985). Die Bearbeitung von Fragebögen dient der Erhebung selbstattribuierter expliziter Motive und ist vergleichbar mit Einstellungsmessverfahren (McClelland et al., 1989). Fragebogenverfahren beruhen auf der Grundannahme, dass bewusste Bedürfnisse und Wünsche durch Befragung messbar sind. Insbesondere die Ökonomie von Fragebögen bezüglich Kosten, Bearbeitungs- und Auswertungszeit stellt einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Verfahren der Motivmessung dar (Heckhausen, 1989). Im Gegensatz zu projektiven Verfahren gelten Fragebogenverfahren zudem gemeinhin als objektiv, reliabel und valide (Schmalt & Sokolowski, 2000). Jedoch sind Fragebogen weniger valide, wenn es um die Vorhersage von operantem Verhalten geht (Schmalt & Sokolowski, 2000). In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Fragebögen, die speziell zur Erhebung eines Motivs - meist des Leistungsmotivs - entwickelt wurden (Koestner, Weinberger & McClelland, 1991). Andere Persönlichkeitsinventare, wie zum Beispiel die Personality Research Form (Jackson, 1974), zielen dagegen auf die Erhebung mehrerer Motive.
Bei der Entwicklung von Fragebögen zur Messung grundlegender Handlungsmotive orientierten sich viele Autoren zunächst an Murrays (1938) bereits erwähnter Klassifikation und Beschreibung psychogener Bedürfnisse (Murray, 1938; siehe 2.7.1). Die Personality Research Form von Jackson (1974), die Skalen enthält, bei denen Personen Auskunft über ihr Streben nach Leistung (Achievement), Macht (Dominance) und Anschluss (Affiliation) geben, ist das bekannteste Instrument, das auf diese Weise konstruiert wurde (Brunstein, 2006).
Für die vorliegende Untersuchung wurde die Deutsche Personality Research Form (PRF; Stumpf, Angleitner, Wieck, Jackson & Beloch-Till. 1985) zur Erfassung der expliziten Motive der Probanden ausgewählt, da sie Leistungs-, Macht- und Anschlussmotiv zugleich erhebt und als eine der am häufigsten verwendeten Persönlichkeitsinventare mit zufriedenstellenden psychometrischen Eigenschaften geeignet erschien. Im Folgenden wird die Deutsche PRF (Stumpf et al., 1985) daher als Beispiel für ein respondentes Verfahren näher beschrieben.
Die Personality Research Form
Gemäß Stumpf, Angleitner, Wieck, Jackson und Beloch-Till ist die Personality Research Form nach Jackson (1974) ein multivariater Fragebogen, der im Sinne von Murrays Personologie grundlegende Persönlichkeitseigenschaften erfasst. Sie gilt als valide und ökonomisch und ermöglicht eine umfassende alltagsrelevante Charakterisierung der Probanden im Sinne normalpsychologischer Konzepte. Insbesondere Aspekte des Leistungs- und Sozialverhaltens gelten als Schwerpunkt des Verfahrens. Die Personality Research Form (Jackson, 1974) ist eine der am häufigsten angewendeten anglo-amerikanischen Persönlichkeitsinventare, wobei die Deutsche Personality Research Form (PRF; Stumpf et al., 1985) eine gekürzte Übersetzung der Originalversion darstellt. In einem mehrstufigen Verfahren und unter wiederholter Revision und Äquivalenzprüfung an zweisprachigen Probanden wurde sie auf den deutschen Kulturkreis adaptiert und neu validiert. Die folgenden Ausführungen beziehen sich aufgrund deren Verwendung in der vorliegenden Arbeit auf die Deutsche Personality Research Form (Stumpf et al., 1985). Sie liegt in den zwei parallelen Formen KA und KB vor, die jeweils 234 Items beinhalten. Alle Items sind als Aussagen formuliert, die eine dichotome Beurteilung (richtig bzw. falsch) erfordern.
[...]
- Arbeit zitieren
- Julia Marzschesky (Autor:in), 2007, Die Rolle impliziter und expliziter Motive bei der Gestaltung persönlicher Homepages, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161879
Kostenlos Autor werden

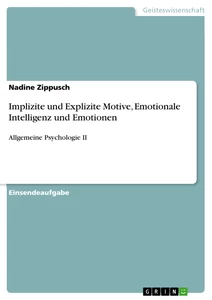


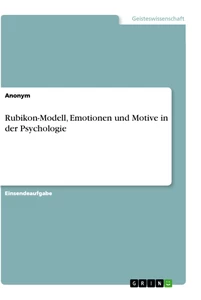

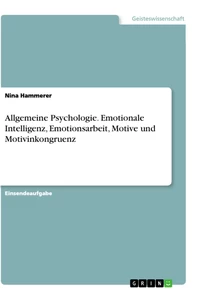





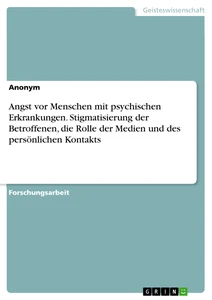

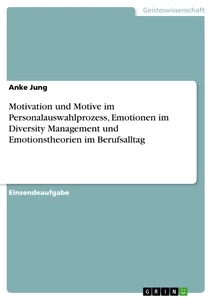





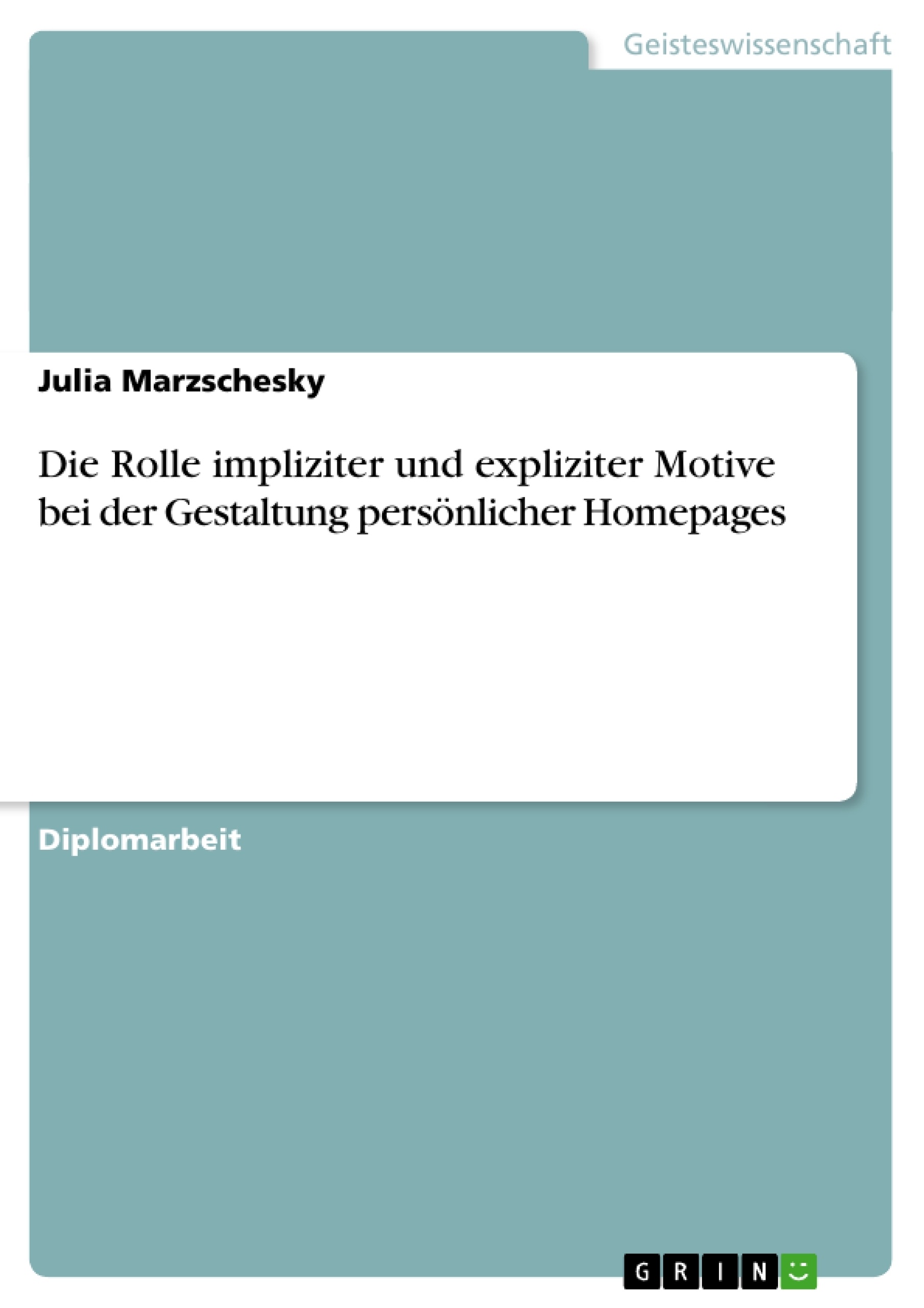

Kommentare