Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmungen
2.1 Definition von Partnerschaft
2.1.1 Funktion von Partnerschaft
2.1.2 Theorien zur Partnerwahl
2.2 Definition von Liebe
2.2.1 Romantische Liebe als traditionelles Ideal
2.2.2 Partnerschaftliche Liebe als post-romantisches Ideal
2.2.3 Verliebtheit am Anfang
2.3 Definition von Ehe
2.3.1 Qualitativer Stellenwert der Ehe
2.3.2 Quantitativer Stellenwert der Ehe
2.3.3 Status Quo von Scheidung und Trennung
3. Herausforderung gesellschaftlicher Entwicklungstrends
3.1 Individualisierung von Lebenslagen
3.1.1 Subjektiver Wertewandel
3.1.2 Konsumentenbeziehung als Trennungsrisiko
3.2 Flexibilität und Mobilität als Kennzeichen der Gegenwart
3.2.1 Rivalität zwischen beruflichen und privaten Ansprüchen
3.2.2 Wochenendbeziehung als Trennungsrisiko
4. Interpersonale Störer und Förderer der Beziehungsstabilität
4.1 Potentielle Beziehungskiller
4.1.1 Einfluss der Herkunftsfamilie
4.1.2 Auswirkungen von Stress
4.1.3 Verlust der sexuellen Leidenschaft
4.1.4 Untreue verletzt
4.1.5 Destruktive Aggression
4.2 Grundlegende Strukturelemente stabiler Zweierbeziehungen
4.2.1 Ausdrucksformen der Intimität
4.2.1.1 Positive Grundstimmung und Wertvorstellungen
4.2.1.2 Sexualität als Ausdruck der Paargemeinschaft
4.2.1.3 Intensiver Austausch im Gespräch
4.2.2 Ausdrucksformen der Individualität
4.2.2.1 Achtung der Individualität und Eigenart des Partners
4.2.2.2 Selbstachtung und Eigenverantwortung
4.2.2.3 Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen
4.2.3 Ausdrucksformen der Exklusivität
4.2.3.1 Abgrenzung zur Bewahrung des Binnenmilieus
4.2.3.2 Zeit für die Pflege der Paargemeinschaft
4.2.3.3 Zweitehen sind anders
5. Fehler und Möglichkeiten in der Paarkommunikation
5.1 Definition von Kommunikation und Interaktion
5.2 Ursachen zwischenmenschlicher Kommunikationsstörungen
5.2.1 Vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun
5.2.1.1 Ursachen für Empfangsfehler
5.2.1.2 Sendefehler auf der Selbstoffenbarungsseite
5.2.2 Konstruktion von Wirklichkeit nach Watzlawick
5.2.3 Kommunikationssperren nach Gordon
5.3 Merkmale gelungener Kommunikation
5.3.1 Fertigkeiten der Sprecherrolle
5.3.2 Fertigkeiten der Zuhörerrolle
5.3.3 Metakommunikation
6. Fehler und Möglichkeiten im Umgang mit Konfliktsituationen
6.1 Destruktiver Umgang mit Konflikten
6.1.1 Eskalation von Konflikten
6.1.2 Streit zwischen Kindern oder Erwachsenen
6.1.3 Sündenbock-Mechanismus
6.1.4 Schweigen ist nicht Gold
6.2 Konstruktiver Umgang mit Konflikten
6.2.1 Konflikte als Chance zur Entwicklung anerkennen
6.2.2 Keiner-Verliert-Methode nach Gordon
6.2.3 Gewaltfreies Kommunizieren nach Rosenberg
7. Beratung als externe Hilfe bei Beziehungsproblemen
7.1 Paarmediation
7.2 Paartherapie und Paarberatung
7.3 Beratung aus Sicht der Sozialen Arbeit
8. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„ Nichts gibt uns so sehr wie die gemeinsame Geschichte einer langfristigen Partnerschaft das Gefühl, einen Ort und eine Heimat in dieser Welt zu haben und nicht allein zu sein. “ (Jellouschek 2009, S. 22)
Mit diesem triftigen Argument untermauert Jellouschek, wie wertvoll und erstrebenswert eine dauerhafte Beziehung zu einem anderen Menschen ist. Er dürfte damit die Vor- stellung und Sehnsucht vieler Menschen ansprechen. Und in der Tat wird die Partner- schaft in Umfragen zur Lebenszufriedenheit als eine zentrale Quelle für Wohlbefinden, Lebensfreude und psychische Stabilität genannt (vgl. Hahlweg/ Bodenmann 2003, S. 192).
Schaut man sich jedoch die Scheidungsstatistik an, dann könnte man daraus schließen, dass das Leben mit einem anderen Menschen im Laufe der Zeit eher zu einer uner- träglichen Last wird: In Deutschland wird mittlerweile etwa jede dritte Ehe geschieden (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 33). Das betrifft im Jahr rund 200.000 Menschen. Bereits mehr als 40 Prozent der geschiedenen Paare scheitern in den ersten 10 Jahren ihrer Ehe (vgl. Stat. Bundesamt 2009, S. 61). In einem Diskurs über Beziehungen darf man jedoch die unverheirateten Paare nicht außer Acht lassen, denn genau genommen scheitern viele Beziehungen bereits bevor eine Eheschließung in Erwägung gezogen wird. Jellouschek bemerkt, dass in Großstädten bereits 50 Prozent der Paare nicht dauerhaft zusammen bleiben (vgl. Jellouschek 2009, S. 15).
Die Statistiken belegen, was ich auch seit einigen Jahren in meinem sozialen Umfeld wahrnehme: Im Freundes- und Bekanntenkreis ist die Menge der getrennten Paare größer, als die Zahl der Paare, die seit langem bestehen. Ich kenne viele Personen, die nach etwa zehnjähriger Beziehung nicht mehr mit dem Partner oder dem Vater bzw. der Mutter ihres Kindes zusammen sind. Hört und sieht man sich aufmerksam um, dann fällt auf: beim Thema „Trennung“ können Kollegen, KommilitonInnen, Freunde und Bekannte alle ein Wort mitreden, jeder kann von jemandem berichten, der mit seiner Partnerschaft unzufrieden ist oder sich getrennt hat. Meine Wahrnehmung stimmt mit der Erfahrung von Eva-Maria Zurhorst überein: „Kaum ein Tag in meinem Leben vergeht, ohne dass mir nicht jemand von den Schwierigkeiten in seiner Partnerschaft erzählt. Immer mehr Männer, Frauen und Paare scheinen in einer Sackgasse angekommen zu sein. (…) Es hat etwas von einer Epidemie. Der schleichende ... Krankheitsverlauf endet immer häufiger im Tod durch Scheidung“ (Zurhorst 2009, S. 31).
Ich fragte mich im Laufe der letzten Jahre immer häufiger, warum so viele Paare aus- einander gehen. Nach meiner Hypothese sind viele Trennungen und Scheidungen vermeidbar, wenn die Partner in ihrer Beziehung gewisse Umgangsregeln beachten. Die Diskrepanz zwischen den zahlreichen scheiternden Beziehungen und meiner persönlichen Überzeugung gab mir letztlich den Impuls für diese Arbeit und warf folgende Frage auf: Welche Bedingungen halten Partner zusammen und was gef ä hrdet die Stabilit ä t von Partnerschaften?
Nachdem mir das Studium der Sozialen Arbeit interdisziplinäres Wissen zum sozialen Miteinander vermittelt und dadurch u. a. meinen Blick auf Beziehungen geschult hat, werde ich, anhand soziologischer, sozialpädagogischer und -psychologischer Erkenntnisse und durch umfangreiche Literaturrecherche, Trennungsrisiken und Entwicklungschancen für die Paarbeziehung herausarbeiten.
Zu Beginn werde ich den Untersuchungsgegenstand „Partnerschaft“ genauer bestimmen und klären, unter welchen Aspekten Mann und Frau ihren Partner wählen. Ferner gehe ich auf den heutigen Stellenwert von Liebe und Ehe ein und erörtere die gegenwärtige Sachlage von Trennung und Scheidung einschließlich der damit verbundenen Folgen für alle Betroffenen. Im Hauptteil der Arbeit untersuche ich, welche gesellschaftlichen Entwicklungen die Stabilität von Beziehungen besonders beeinträchtigen. Mit dem Begriff „Beziehungsmanagement“ liegt der Schwertpunkt der Arbeit aber auf der interpersonale Ebene der Beziehungsgestaltung, weshalb in den Punkten 4 bis 6 die zwischenmenschliche Interaktion, die Kommunikation sowie das Konfliktmanagement thematisiert werden. Ich werde in diesen Kapiteln jeweils zunächst die destruktiven Faktoren darlegen und anschließend die entsprechenden konstruktiven Umgangsregeln gegenüberstellen. Bevor ich im Fazit die Ergebnisse zu Trennungsrisiken und Entwicklungschancen der Paarbeziehung zusammenfasse, stelle ich Beratungsangebote vor, auf die unzufriedene Paare zurückgreifen können, die ihre Beziehung stärken wollen. Zudem betrachte ich Beratungsarbeit im Kontext Sozialer Arbeit und in Abgrenzung zur therapeutischen Vorgehensweise.
Die vorliegende Arbeit ist für die Soziale Arbeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bedeutend: Soziale Arbeit bietet professionelle Unterstützung bei individuellen und sozialen Problemen und spricht damit Einzelne, Familien und Gruppierungen im Gemeinwesen an, die selbst Hilfe aufsuchen oder von anderen Personen und Institutionen als „hilfebedürftig“ an die Soziale Arbeit überwiesen werden (vgl. HerwigLempp/ Schwabe 2002, S. 475 f.).
Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes beschreibt mit den Worten „ Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung “ ein zentrales mensch- liches Grundrecht. Auf Basis der Sozialgesetzgebung trägt Soziale Arbeit diesem Grund- recht u. a. in der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) Rechnung. Mit ihrem „Doppelten Mandat“ von „Hilfe und Kontrolle“ hat Soziale Arbeit einerseits den Auftrag des staatlichen Systems, gesellschaftliche Normalzustände zu kontrollieren und zu stabilisieren, andererseits den Auftrag des Klienten, ihm bei der Lebensbewältigung des Alltags zu unterstützen. Um Normalverläufe zu gewährleisten, wirkt Sozialpädagogik erzieherisch auf das Verhalten von Personen ein, damit diese sich unter gesellschaft- lichen Rahmenbedingungen in der Lebenswelt integrieren können. Die Sozialarbeit setzt an der Veränderung der Lebenswelt an, indem sie u. a. Schwierigkeiten der Lebenswelt an das staatliche System zurückmeldet, die sich aus gesellschaftlichen Rahmen- bedingungen ergeben.
Im Bezug auf die Partnerschaftsproblematik lässt sich der Bedarf an Hilfe und Kontrolle damit begründen, dass eine „normale“ glückliche Partnerschaft das beste Umfeld für die gesunde psychosoziale Entwicklung von Kindern darstellt. Eine funktionierende, harmonische Eltern-Beziehung in der Herkunftsfamilie hat als wesentliche Sozialisationsinstanz Vorbildcharakter für die Heranwachsenden. Konflikthafte Beziehungen wirken sich dagegen negativ auf das Sozialverhalten sowie das psychische und physische Wohlbefinden der Erwachsenen und Kinder aus.
Aus den genannten und weiteren in der Arbeit zu erläuternden Argumenten, richtet sich die Arbeit vorrangig an Paare, die in ihrer Beziehung nicht zufrieden sind, viele Konflikte haben, aber ihr Zusammenleben verbessern, aufrechterhalten wollen. Ich möchte den Lesern Hilfe zur Selbsthilfe geben, indem ich zeige, wie adäquater Umgang innerhalb der Partnerschaft aussieht und welche externen Hilfen sich Paare einholen können. Natürlich richtet sich die Arbeit auch an alleinerziehende Männer oder Frauen, die eine stabile Partnerschaft anstreben und aufbauen wollen und gewillt sind, Fehler aus vergangenen Beziehungen zukünftig zu vermeiden. Auch zufriedene Paare können in dieser Arbeit Nützliches für ihr Miteinander erfahren.
Ich informiere über allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten partnerschaftlichen Interaktion, die alle sowohl auf heterosexuelle, als auch auf homosexuelle Partnerschaften, auf Paare mit oder ohne Kind zutreffen, es sei denn, ich hebe eine bestimmte Beziehungsform im Kontext von Definition oder Statistik explizit hervor. Eine Arbeit über die Paarbeziehung kann aus systemischer Sicht das Thema Kinder nicht aussparen. Im Zusammenhang mit dem Einfluss der Herkunftsfamilie, mit der Bedeutung für die Folgen von Trennung und Scheidung u. a., werden Kinder Erwähnung finden. Es ist allerdings nicht vorgesehen, homosexuelle Beziehungen oder eine bestimmte Altersgruppe separat zu untersuchen. Zudem wird der Trennungs- bzw. Scheidungsprozess selbst nicht thematisiert. Zur Vereinfachung sei erklärt, dass mit dem Begriff „Partner“ sowohl die männliche als auch die weibliche Form gemeint ist.
Ferner ist der Hinweis nötig, dass bei einem derart komplexen Thema die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit anstrebt und keine alle Aspekte bedenkende pädagogische, psychologische und soziologische Untersuchung ist. Es handelt sich mehr um Aspekte und Überlegungen, die von der Absicht getragen werden, den Leser anzuregen, seine eigene Beziehung und seinen persönlichen Anteil am Miteinander zu reflektieren, destruktive Muster und Ressourcen zu erkennen und Änderungsschritte daraus abzuleiten.
2. Begriffsbestimmungen
Die Begriffe Partnerschaft, Liebe und Ehe korrelieren miteinander, kann man doch davon ausgehen, dass Partnerschaft und Ehe auf Liebe basieren und Ehe eine Möglichkeit ist, seine Partnerschaft und Liebe zu besiegeln. Schon allein durch ihren Zusammenhang ist es sinnvoll, die Begriffe in einem Kapitel zu definieren. Zudem kommen ihnen in der Literatur oft gleiche Aufgaben zu, was in den folgenden Punkten genauer charakterisiert werden soll.
2.1 Definition von Partnerschaft
Wenn es um die Partnerschaft geht, dann finden sich in der Literatur vielfältige Definitionen. Im hier vorliegenden Abschnitt nehme ich eine Annäherung an den Begriff vor, indem ich mich einigen Meinungen anschließe.
Die Partnerschaft ist eine Beziehung, die zwischen zwei in ihrer Persönlichkeit einzigartigen Personen besteht und von diesen mit ihren jeweils individuellen Lebenserfahrungen gestaltet wird (vgl. Neyer 2003, S.166 f.). Als eine Beziehung kann man eine Dyade1 von Menschen bezeichnen, die in sozialer Interaktion2 zueinander stehen. Durch die Art der Interaktion kann eine Dyade charakterisiert werden und es kann von einer Beziehung gesprochen werden3 (vgl. Asendorpf/ Banse 2000, S. 3 f.).
Die Begriffe Beziehung und Dyade zur Definition von Partnerschaften zu nutzen ist sicher eine Möglichkeit, allerdings sind sie zu weit gefasst, wie Lenz ausführlich darstellt, weil in ihrem herkömmlichen Gebrauch alle Zweierkonstellationen bezeichnet werden (vgl. Lenz 2003, S. 43 f.).
So gibt es Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Personen gleichen oder auch ungleichen Geschlechts, berufliche Beziehungen zwischen Geschäftsleuten, die Partnerschaft in Form der Ehe oder die nichteheliche Beziehungsform, die Beziehung zwischen Eltern und Kind, die Freundschaftsbeziehung u. a. Deshalb hält Lenz den Begriff „Partnerschaft“ als Sammelkategorie für ungeeignet und verweist auf einen anderen Bedeutungszusammenhang, mit dem der Begriff bereits besetzt ist: „Unter `Partnerschaft´ wird ein kulturelles Ideal für die interne Gestaltung einer Beziehung verstanden. Das Ideal der Partnerschaft fordert unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit weitgehend gleiche Rechte und Pflichten für beide Beziehungspersonen und eine aus dem konstruktiven Miteinander gewonnene Verständigung über das gemeinsame Leben“ (Lenz 2003, S. 43).4
Lenz zieht einen neutralen Begriff „Zweierbeziehung“ vor, da er weniger festgelegt ist und damit offen für eine größere Vielfalt an Beziehungswirklichkeiten: „ Unter einer Zweierbeziehung soll ein Strukturtypus pers ö nlicher Beziehungen zwischen Personen unterschiedlichen und gleichen Geschlechts verstanden werden, der sich durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit (Exklusivit ä t) auszeichnet, ein gesteigertes Ma ß an Zuwendung aufweist und die Praxis sexueller Interaktion einschlie ß t bzw. eingeschlossen hat “ (ebd., S. 44, Hervorhebung i. O).
Die hier vorliegende Definition der Zweierbeziehung beschreibt ideal den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, da er gleichermaßen hetero- als auch homosexuelle Beziehungen umfasst, „... unabhängig davon, ob die beiden verheiratet sind, ein oder mehrere (gemeinsame) Kinder haben und/oder zusammenwohnen. (…) Emotionalität … und Sexualität werden als in dieser Konstellation wichtige Momente zwar benannt, ohne allerdings sie in einer bestimmten Gestalt und Konstanz als `das´ Bestimmungsmerkmal festzuschreiben“ (ebenda). Durch das Kriterium „Sexualität“ schließt der Begriff per se die geschäftliche Beziehung unter Kollegen, die Eltern-Kind-Beziehung, die Geschwisterbeziehung sowie die Freundschaftsbeziehung aus, welche auch nicht zum Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit gehören.
2.1.1 Funktion von Partnerschaft
Wieso sucht der Mensch überhaupt einen Partner? Unter dieser Fragestellung lässt sich klären, welche Funktion Partnerschaften zukommt.
Die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse nach Bindung und Nähe steht bei Partnerschaften im Vordergrund. Der Wunsch nach Bindung ist beim Menschen ein Instinkt, der im Laufe der Evolution entstanden ist. Er gilt als Überlebensmechanismus, der zunächst das sichere Aufwachsen des Kindes sichert (vgl. Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 2).
Der Psychoanalytiker John Bowlby erklärt in seiner Bindungstheorie das Bindungs verhalten zwischen Mutter und Kind, was sich durch die Art der Aufrechterhaltung von Nähe, den Protest bei Trennung sowie den Schutz vor Bedrohung charakterisieren lässt. „Sich gebunden zu fühlen heißt, sich sicher und geschützt zu fühlen. (…) Wenn uns Gefahr droht, klammern wir uns an unsere Bindungspersonen. Wenn die Gefahr vorüber ist, ermöglicht es uns ihre Anwesenheit, zu arbeiten, zu entspannen … aber nur, wenn wir uns sicher sind, dass die Bindungspersonen da sein werden, wenn wir sie wieder brauchen. Wir können stürmische Meere ertragen, wenn wir uns eines sicheren Hafens gewiss sind“ (Holmes 2002, S. 88 ff.).
Das Streben nach Bindung herrscht beim Menschen lebenslang vor und ist eher ein Prozess des sozialen Lernens. In der Jugend und dem frühen Erwachsenenalter ist es eine Entwicklungsaufgabe, sich von Bindungsfiguren zu trennen und neue Bindungen einzugehen (vgl. ebd., S. 89 f.). Ab dem Jugendalter tritt an die Stelle der Beziehung zu den Eltern die Liebesbeziehung, in der die Partner als Quelle für Geborgenheit, Zuwendung und Sicherheit des anderen agieren. So lässt sich die Bindungstheorie auch auf die Funktion von Liebesbeziehungen übertragen. Die meisten Paare, egal ob verheiratet oder nicht, erfahren durch ihren Partner Beruhigung und Sicherheit. Vor allem in Stresssituationen möchten sie den Partner bei sich haben, und sie protestieren, wenn er nicht verfügbar ist (vgl. Stöcker/ Strasser/ Winter 2003, S. 146).
Die Suche nach Nähe zwischen Individuen der gleichen Spezies ist ein menschliches Grundbedürfnis, aber in erster Linie das grundlegende Motiv, um das Bedürfnis nach Bindung zu befriedigen und Einsamkeit zu überwinden. (vgl. Grau 2003, S. 286 f.). Der entspannte Zustand der Bindung wird durch Nähe hergestellt, was „... von Sichtkontakt über körperliche Nähe und besänftigende Worte ohne Berührung bis zu engen Umarmungen und Liebkosungen reichen kann“ (Holmes 2002, S. 88).
Nähe5 beinhaltet aber nicht nur vorübergehende Interaktionen, wie Kuscheln oder Trösten, sondern ist, wie bereits angedeutet, das Ergebnis eines Annäherungsprozesses. Für das Konstrukt „Nähe“ ist einerseits offene und beidseitige Kommunikation, bestehend aus Verständnis, Wertschätzung und Unterstützung nötig, andererseits umfasst Nähe den Austausch positiver Emotionen, wie Liebe, Wärme, Vertrauen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit (vgl. Grau 2003, S. 290).
Da man sich in der Paarbeziehung am nächsten ist, können Partnerschaften das Be- dürfnis nach Nähe am besten erfüllen. Partnerschaft und Nähe haben eine hohe Bedeu- tung für das psychischen und physische Wohlbefinden. Sie kann aber auch umgekehrt durch destruktive Veränderungen zu einer Leidensquelle werden und durch mangelnde Nähe körperliche und psychische Störungen hervorrufen, wie hohen Blutdruck, De- pressionen oder Ängste. Personen die keine nahen Beziehungen pflegen, leiden häufig unter Einsamkeit. Allerdings ist hier nicht die geringe Anzahl oder Dauer von Kontakten für das Gefühl der Einsamkeit verantwortlich, sondern vielmehr die mangelnde Nähe der Kontakte (vgl. Hahlweg/ Bodenmann 2003, S. 192; Grau 2003, S. 287 f.). Partnerschaft ist nicht nur als vorübergehender Zustand, sondern als Entwicklungs- prozess zu verstehen, weshalb sie auch zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt: „Die individuelle Persönlichkeit prägt die Dynamik der Partnerschaft, aber die Persönlichkeit kann auch durch die Partnerschaft beeinflusst werden“ (Neyer 2003, S. 167). Im Hinblick auf die Entfaltung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist die Kombination von Ganzheitlichkeit und Dauerhaftigkeit von nicht zu vernachlässigender Relevanz. Das Besondere an einer Liebesbeziehung ist, dass man ganz man selbst sein und seine ganze ungeteilte Person einbringen kann sowie vom Partner ein ganzheitliches Bild von sich zurückgespiegelt bekommt (vgl. Schenk 1987, S. 209). „Kein mitmensch- liches Gegenüber vermag eine Person so intensiv in ihrer Identität6 und in ihrem Selbstwertgefühl zu bestärken wie ein Liebespartner. (…) Keine Beziehung fordert die Ich-Kräfte so heraus und strukturiert sie so stark wie eine alle Bereiche der Person um- fassende Begegnung von Liebenden“ (Willi 2000, S. 225).
Für Dauerhaftigkeit und gegen eine frühzeitige Trennung7 argumentiert Ulrich Beck, weil die Qualität verlässlicher Beziehungen nicht durch die Quantität vieler unverbind- licher Kontakte kompensiert werden kann: „ Die Palette der Kontakte wird eher größer, weiter, bunter. Aber ihre Vielzahl macht sie auch flüchtiger, leichter dem Fassadenspiel verhaftet. Intimitäten können ebenfalls auf diese Weise flüchtig, fast schon wie das Händeschütteln, ausgetauscht werden. Dies alles mag in Bewegung halten und Chancen eröffnen, und doch kann die Vielfalt von Beziehungen die identitätsbildende Kraft einer stabilen Primärbeziehung wohl nicht ersetzen“ (Beck/ Beck-Gernsheim 1990, S. 49).
2.1.2 Theorien zur Partnerwahl
Neben der Fragen nach der Funktion von Partnerschaft interessiert auch, nach welchen Kriterien man sich den Partner auswählt - in wen man sich eigentlich verliebt? Jeder kennt die Grundsätze „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ und „Gegensätze zie hen sich an“. Gemäß dieser widersprüchlichen Ansichten lassen sich neben soziobio logischen Ansätzen, familienökonomischen Konzepten oder auch Lerntheorien vor allem die Ähnlichkeits- und Komplementaritätshypothese gegenüberstellen. Die Paarforschung geht prinzipiell davon aus, dass sich Personen eher zu Partnern hingezogen fühlen, die ihnen in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht ähneln. Zeitgleich lässt sich diese zentrale These nicht als eigene Theorie abgrenzen, eher noch kann sie in unterschied- liche theoretische Ansätze integriert werden (vgl. Lösel/ Bender 2003, S. 46 ff.).
Die Ähnlichkeits- bzw. Homogamiethese versucht anhand vergleichbarer Merkmale die Anziehungskraft von Partnern zu erklären. Ähnlichkeiten zwischen Ehepartnern konnten in deutschen Studien im Hinblick auf soziale Schicht, ihr Bildungsniveau, in der Konfessions- sowie in der ethnischen Zugehörigkeit, im Alter, in sozialnormativen Orientierungsmustern, in den Freizeitinteressen und in bestimmten Persönlichkeits- variablen gezeigt werden. Während dessen besagt die Komplementaritätsthese, dass die Partner beim anderen gerade die Eigenschaften suchen, die sie selbst nicht haben (vgl. Nave-Herz 2006, S. 131 f.).
„Winch hat als Erster bereits 1958 die Homogamie- und die Komplementaritätsthese miteinander verknüpft, als er die sozialselektive Partnerwahl … mit persönlicher Wahl kombinierte … (...) Die Wahl eines Partners hängt zunächst von der Verfügbarkeit potentieller Partner ab; denn tatsächlich steht den meisten Menschen nur eine sehr begrenzte Menge von Personen zur Verfügung, aus der sie ihren potentiellen Partner oder die Partnerin auswählen können. (...) Relativ viel Kontakt hat man im Allgemeinen mit Personen ähnlicher soziokultureller Merkmale (= Homogamiethese), die also in der gleichen Gegend wohnen wie man selbst, die gleiche Ausbildung absolvieren, den gleichen oder ähnlichen Beruf ausüben und die gleichen Hobbys haben“ (ebd., S. 133). Es sind neben den Gelegenheiten also vor allem die Orte des Kennenlernens, wie Bildungseinrichtungen, Arbeitsplätze, Freizeitorte oder auch Freundschafts- und Bekanntenkreise, die eine homogene, schichtspezifische Partnerselektion bedingen (vgl. ebd.). „Aus dem so umrissenen Auswahlkreis … erfolgt die endgültige Partnerwahl nach dem Komplementaritätsprinzip“ (Winch 1958, S.14; zit. nach Nave-Herz 2006, S. 134). Winch hält fest, dass die Übereinstimmung von Interessen und Werten im Vordergrund steht, während später die wechselseitige Ergänzung und Befriedigung von Bedürfnissen durch umsorgen und umsorgt werden, eine wichtigere Rolle spielen (vgl. Lösel/ Bender 2003, S. 56).
Im Zusammenhang mit der Ähnlichkeitstheorie spielt auch die Herkunftsfamilie eine wichtige Rolle. In dieser hat man bestimmte Interaktionsmuster verinnerlicht, die zum Auslöser für positive Gefühle wie Nähe und Akzeptanz oder auch für negative Gefühle wie Verunsicherung oder Zurückweisung geworden sind. Auf der Suche nach einem Partner wirken die aus der Herkunftsfamilie8 bekannten Signale, die uns Nähe, Geborgenheit und Rückhalt versprechen. „Dies bedeutet: Aufgrund seiner früheren Erlebnisse in Kindheit und Jugend hat jeder von uns ein persönliches inneres Arbeits- modell über enge Beziehungen gebildet. (...) Dieses `Beziehungskonzept´ bestimmt im Wesentlichen, welchen Partner wir wählen, was wir von ihm erwarten, aber auch wie wir selbst die Partnerschaft gestalten“ (Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 5).
Die Ehetherapeuten Sautter betonen ebenfalls die Bedeutung vertrauter Gefühle für die Partnerwahl und machen gleichzeitig auf ein damit verbundenes Phänomen aufmerksam: „Die Frau, die in der Suchtfamilie aufwächst, findet den Mann mit der Sucht- problematik, der Mann, dessen Mutter grenzüberschreitend handelt, findet eine kontrollierende Ehefrau usw. (…) Das was Sie in ihrer Familie erlebt haben, das, was Ihnen zutiefst vertraut ist, strahlt der Partner aus, verbunden mit dem Versprechen, in diesem vertrauten Gefühl endlich geliebt zu werden. (…) Wir fühlen uns deshalb so ver- traut und zu Hause, weil es sich genau so anfühlt wie zu Hause, dort, wo unsere ersten Bindungswünsche erfüllt oder möglicherweise nicht so erfüllt wurden, wie es gut für uns gewesen wäre“ (Sautter/ Sautter 2007, S. 118 f.).
Kontrovers und damit der Komplementaritätsthese zustimmend, ist die Praxiserfahrung des Paartherapheuten Hehl, der das Neuartige, Unbekannte für sehr anziehend hält, vor allem, wenn die Erfahrungen im Elternhaus abschreckend waren. „Wenn es um Liebe geht, [ sucht man, D.F.] im anderen das Andersartige, das Neue“ (Hehl 2002, S. 29). Ähnlich der Komplementaritätsthese, nach der man Eigenschaften beim Partner sucht, die man selbst nicht hat, werden in der sogenannten Austauschtheorie Interaktionen ent- sprechend ihrer Kosten und Nutzen bewertet. Je höher dabei der Nutzen, also positive Erfahrungen und die Verwirklichung eigener Ziele durch die Beziehung, desto zufriede- ner sind die Partner. Allerdings wird die Beziehung stets auf Basis subjektiver Vergleiche bilanziert und bieten sich vermeintlich bessere Alternativen9 zur Bedürfnisbefriedigung, wird eine Trennung wahrscheinlicher (vgl. Schneewind/ Wunderer 2003, S. 230 f.). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ähnlichkeitstheorie mehr Bestätigung er- fährt, indem sie für die Partnerfindung die notwendige Ausgangsbedingung darstellt und für die spätere Stabilität der Beziehung ein entscheidender Faktor ist. Nachweislich kor- relieren bei zufriedenen Liebespaaren physische Attraktivität, Gesichtsmerkmale, das Alter, der Bildungsgrad, die Intelligenz, Temperament, Einstellungen zur Liebe und Partnerschaft sowie Lebensstile positiv miteinander (vgl. Lösel/ Bender 2003, S. 56 f.; Nave-Herz 2006, S. 132).
2.2 Definition von Liebe
In einer Arbeit über Paarbeziehungen darf das emotionale Band, was die Beziehungspersonen miteinander verbindet nicht unthematisiert bleiben, denn „... kein anderes Gefühl scheint so eng mit Paarbeziehungen assoziiert zu sein wie die Liebe“ (vgl. Lenz 2003, S. 249). Allerdings blendet die familiensoziologische Fachliteratur Liebe aufgrund ihres metaphysischen Charakters vielfach ganz aus oder schreibt ihr nur zu Beginn der Partnerschaft eine Rolle zu (vgl. Schreiber 2003, S. 111 f.).
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Perspektiven lässt sich in der Literatur der Wissen- schaftsdisziplinen Psychologie, Soziologie, Theologie oder Biologie keine einheitliche Definition des Liebesbegriffes ausmachen. Zudem steckt hinter dem Begriff „Liebe“ auch im Alltag nicht immer die Beschäftigung mit einem Gefühl, und sie wird nicht nur als Spezifikum von Zweierbeziehungen verstanden. Stattdessen kommt Liebe in ver- schiedenen Facetten vor, in der christlichen Nächstenliebe, der Mutterliebe, der Ge- schwisterliebe, der Kinderliebe oder auch der erotischen Liebe (vgl. Lenz 2003, S. 259). Meine Absicht ist es allerdings nicht, den Bedeutungszusammenhang all dieser Liebes- begriffe zu unterscheiden, auch werden das emotionale und physiologische Verständnis von Liebe nicht im Vordergrund meiner Ausführungen stehen.10 Ich thematisiere Liebe als ein soziokulturelles Phänomen, wodurch die Interaktionsebene ins Blickfeld rückt. Ich beginne mit der romantischen Liebe, die in der Fachliteratur eine exponierte Stellung einnimmt. Anschließend werde ich mich dem Diskurs über Veränderungen und das Ende der romantischen Liebe anschließen, in welchem die partnerschaftliche Liebe als Gestal- tungsideal in den Vordergrund rückt. Das Kapitel 2.2.3 gründet auf der o. g. Behauptung, dass Liebe nur am Anfang eine Rolle spiele und ordnet den Begriff „Verliebtheit“ in die Thematik ein.
2.2.1 Romantische Liebe als traditionelles Ideal
Der kulturelle Code der romantischen Liebe hat im bürgerlichen Roman bereits im 17. Jahrhundert Gestalt angenommen und fand gegen Ende des 18. Jahrhunderts seinen vollsten Ausdruck in der deutschen Romantik (vgl. Lenz 2003, S. 259 f.). Durch die lange Geschichte ist sie in vielfältiger Literatur thematisiert worden, mit unterschied- lichen Ergebnissen ihren Inhalt betreffend (vgl. Burkart 1998, S. 21). Einige zentrale Elemente seien kurz benannt: „Die romantische Liebe ist gekennzeichnet durch die Einheit von sexueller Leidenschaft und affektiver Zuneigung … (…) Die Sexualität wird zu einem gleichrangigen Thema aufgewertet, das an die Liebe untrenn bar geknüpft ist“ (Lenz 2003, S. 261, Hervorhebung i. O.).
Des Weiteren versteht sich romantische Liebe als Einheit mit und einzigen Grund für die Ehe. Romantische Liebe integriert auch die Elternschaft, durch die die höchste Stufe der Beziehung erreicht wird. Dauerhaftigkeit ist ein weiteres Element des romantischen Liebescodes, die erreicht wird, weil wahre Liebe per se keine Stabilisatoren brauche und zeitlich unbegrenzt sei. Dauerhaftigkeit korreliert mit der grenzenlos steigerbaren Individualität der einander Liebenden, weil sie für sich einmalig und unersetzbar sind und füreinander zum zentralen Sinn des Lebens werden. In diesem Zusammenhang ist Treue selbstverständlich und Eifersucht überflüssig (vgl. ebd., S. 261 f.).
„Angesichts dieser Wertschätzung der Individualität11 verleiht … die romantische Liebe dem Individuum auch … die Chance, in seiner Einzigartigkeit anerkannt und bestätigt zu werden. (…) Im romantischen Liebescode wird [ aber, D.F.] erst die erwiderte Liebe zur eigentlichen Liebe. Die Frau wird nicht mehr nur verehrt und idealisiert, wie es sehr ausgeprägt in der höfischen Liebe der Fall war, sondern nun werden ihre Gefühle ebenso wichtig, wie die des liebenden Mannes. In der romantischen Liebe geht es immer um die Gefühle und damit um das Glück beider Personen“ (ebd., S. 263).
In der romantischen Konzeption der Liebe steht also das Paar im Mittelpunkt und die psychische Verschmelzung beider Partner. Es geht um Zweisamkeit pur, um Exklusivität, die auch von anderen Bezugspersonen jenseits der Zweierbeziehung nicht berührt wird. Dadurch, dass Seelenvereinigung und Dauerhaftigkeit Maxime des romantischen Liebesverständnisses sind, ist sie das einzig mögliche Fundament einer Zweierbeziehung und spielt entgegen anderer Meinungen nicht nur am Beziehungsanfang eine Rolle (vgl. Burkart 1998, S.22; Lenz 2003, S. 281). „Nur die Liebe kann die Beziehung stiften und diese aufrechterhalten. Wo sie verblasst, zerbricht die Beziehung. Es gibt keine Kraft außer der Liebe, die Dauer sichert“ (Lenz 2003, S. 280).
2.2.2 Partnerschaftliche Liebe als post-romantisches Ideal
Sicher hat sich der eine oder andere Leser schon gedacht, dass Liebe im eben beschrie- benen Verständnis nicht in allen Punkten wirklichkeitsnah ist. Und in der Tat mehren sich Stimmen, die auf das Ende der romantischen Liebe verweisen, für die ein neues Modell von Liebe - die partnerschaftliche Liebe - in den Vordergrund rückt. „Jedenfalls ist nach Ansicht vieler Beobachter die romantische Liebe in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr lebbar: Weder in ihrer Beschränkung auf die Ehe, noch in ihrer Anlehnung animalisch-körperlicher Liebe zugunsten seelischer Vereinigung …, noch in ihrer heterosexuellen Ausschließlichkeit; und schon gar nicht in ihrer transzendentalen, `kosmischen´ Dimension, in ihrem religiösen Absolutismus“ (Burkart 1998, S. 25).
Lenz hebt drei Veränderungstendenzen in den Beziehungsnormen hervor, die das Liebesideal umformen. Das sind die Dominanz des Selbstverwirklichungsmotivs, das Verschwinden der Geschlechtsspezifik und der Bedeutungszuwachs der Kommunikation. Heute nimmt der Anspruch auf Selbstverwirklichung und das Streben nach persönlichem Wachstum einen hohen Stellenwert im Leben ein. Während im romantischen Liebesideal die Verpflichtung zur lebenslangen Bindung mit der grenzenlos steigerbaren Individualität verbunden ist, kann heute der Individualitätsanspruch mit der Bindung an eine feste Beziehung in Konflikt geraten (vgl. Lenz 2003, S. 271 f.). In intakten Beziehungen werden aber auch heute Selbstverwirklichung und Bindung nicht grundsätzlich als Gegensätze wahrgenommen12 (vgl. Schreiber 2003, S.146).
Heute haben sich, wie bereits erwähnt, die geschlechtsspezifischen Charakterzüge verän- dert. In der romantischen Vorstellungen von Liebe wurde von Frauen Sanftmut, Rück- sichtnahme und Wutkontrolle abverlangt. Anstelle der Ungleichbehandlung der Ge- schlechter treten nun gleiche Rechte und Pflichten in den Vordergrund - Konfliktver- meidung durch Kontrolle der Wut wird, wenn überhaupt, von beiden Seiten erwartet. Im Kontext von Gleichberechtigung kann man heute auch von einem androgynen Liebescode sprechen, was bedeutet, dass Frauen verstärkt das männliche Ideal der Unabhängigkeit übernehmen und sich auch nicht mehr nur auf den Privatbereich beschränken wollen (vgl. Lenz 2003, S. 273 f.). Neben der Betonung der Gleich- berechtigung in modernen Beziehungen gewinnt auch der wechselseitige kommunika- tive Austausch an Bedeutung. In diesem Zusammenhang erfährt das post-romantische Ideal einen therapeutischen Charakter. Lenz erläutert die Aufwertung der Kommuni- kation wie folgt: Das Gespräch wird „... zum kardinalen Medium, durch das die Grundlagen des Zusammenlebens ausgehandelt, festgeschrieben, bestätigt und auch wieder revidiert werden. Die Individuen werden auf ein hohes Maß an Kommunikations- bereitschaft und -fähigkeit verpflichtet, woran sich die Qualität der Zweierbeziehung immer wieder erweisen muss. (…) Beide Beziehungspartner werden im wechselseitigen Austausch Therapeuten füreinander. Jeder von beiden ist bereit, zuzuhören, zu verstehen und die Schwächen des anderen zu akzeptieren und umgekehrt seine eigenen Ängste und Befürchtungen mitzuteilen. Die kommunikative Aufladung der Beziehung bringt es auch mit sich, dass Abschied von der Konfliktvermeidung genommen wird“ (ebenda).13
Neben den drei grundlegenden Veränderungen im partnerschaftlichen Liebesideal ist zudem festzuhalten, dass aus Liebe heute nicht mehr zwingend die Ehe folgen muss.
Liebe ist also unabhängig von Ehe und Kinderwunsch möglich. Ferner wird heute nicht nur die exklusive Zweisamkeit14 betont, sondern der Kontakt zu anderen wichtigen Bezugspersonen gepflegt. Aufrichtigkeit und Offenheit gehören zu den heutigen Liebesleitvorstellungen, wodurch auch Sexualität erst in der Gegenwart, besonders nach der Aufklärungswelle Ende der 60er Jahre, zu einem lustvollen gemeinsamen Erfahrungsbereich für Mann und Frau geworden ist. Erst durch die weitestgehende Enttabuisierung und die offene Kommunikation individueller Bedürfnisse ist eine lustvolle Verschmelzung möglich (vgl. ebd., S. 279 ff.).
Koppetsch kritisiert, dass viele Autoren Partnerschaft und Liebe verschmelzen und be- tont den wesentlichen Unterschied: „In der Partnerschaft können Gegenleistungen einge- klagt werden, Leistungen an Bedingungen geknüpft werden. In der Liebe nicht.15 (...) Sie beruht ... auf der bedingungslosen und freiwilligen Hingabe. Das Opfer fungiert im Kon- text der romantischen Liebe ... als Liebesbeweis. Es zeigt an, inwieweit der Liebende bereit ist, auf etwas für ihn Wichtiges zu verzichten, … um sich ganz auf die Beziehung einzulassen. Im Widerspruch dazu [ legt Partnerschaft, D.F.] den Akzent auf die eher un- mittelbare Reziprozität16 und den Primat individueller Interessen … (…) Trotz ihrer Gegensätzlichkeit sollen Liebe und Partnerschaft hier jedoch keineswegs als sich gegenseitig ausschließende Beziehungsmuster, sondern vielmehr als Idealschemata ehelicher Kommunikation verstanden werden, die gleichermaßen in die Paarbeziehung eingreifen. Denn die meisten modernen Paare, die einerseits viel diskutieren und in bestimmter Weise eifersüchtig darüber wachen, nicht zu viel zu investieren, scheuen andererseits in bestimmten Situationen nicht davor zurück, sich ohne zu rechnen einzubringen, ohne Hemmungen zu geben“ (Koppetsch 1998, S.111 ff.).
Nach diesen Ausführungen scheint es also angemessen, von Vermischungen dieser Liebesideale auszugehen, statt von einer völligen Verdrängung des romantischen Ideals. Mitunter wird sogar die Dominanz des romantischen Ideals angenommen (vgl. Lenz 2003, S. 274, 288).
Durch das Nebeneinander beider Ideale „... potenziert sich die Möglichkeit, dass in einer Zweierbeziehung unterschiedliche Vorstellungen von `wahrer´ Liebe aufeinanderstoßen oder auch, dass eine Person selbst schwankt“ (ebd., S. 285).
Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass das romantische Liebesideal nicht allein gelebt werden kann, weil sie von den Beziehungspersonen einfordert, sich nur auf sie zu konzentrieren, während sie keine Notiz von zahlreichen Banalitäten des Alltags nimmt. Denn Liebende „...können nicht unentwegt im sozietätsfreien Raum zwischen dem `Nirvana der sinnfreien Körperlichkeit´ und dem ausgelassenen, reflexionsentlasteten Spiel frei schweben. Manchmal, allzu häufig wohl, müssen sie zurück in diese Welt. Dann müssen sie Probleme des Abwaschs lösen, des Verhältnisses zu Dritten, der Unterstützung in peinlichen Situationen und vieles andere. Paarbeziehungen brauchen deshalb heute wohl beides: Liebe und Partnerschaft“ (Burkart 1998, S. 43). Unter Rücksicht auf die individuell mögliche Verbalisierungsfähigkeit und Sensibilität sind die Beziehungspersonen folglich gefordert, ihre eigene lebbare Version der Liebe auszuhandeln17 (vgl. Lenz 2003, S. 286).
2.2.3 Verliebtheit am Anfang
Nun, wo die romantische und die partnerschaftliche Liebe als für die Beziehungsstabilität nicht zu vernachlässigende Interaktionsmuster deklariert wurden, stellt sich die Frage, weshalb andere Autoren der Liebe nur für den Anfang einer Beziehung eine Rolle zuweisen.
Mit anfänglichen Liebe meinen sie nicht die romantische Liebe, denn trotz „... des romantischen Liebescodes … wäre es verfehlt, anzunehmen, dass jede Zweierbeziehung aus Liebe entsteht. (…) Auch wenn Liebe als plötzliches Ereignis vorkommt, scheint sie doch eher eine Ausnahme als die Regel zu sein. Ungleich häufiger als die Liebe auf den ersten Blick scheint sich das Verliebtsein erst allmählich einzustellen“ (Lenz 2003, S. 291). „Mit der Liebe des Anfangs [ ist, D.F.] ohnehin `Verliebtheit´ gemeint, etwas Rauschhaftes, Ekstatisches, das Außeralltägliche, das bald verflogen ist: Entweder sie löst sich einfach auf, dann endet auch die Beziehung, oder sie verändert sich, durchläuft Methamorphosen: Sie wandelt sich in `reife´ Liebe, ... oder in `Partnerschaft´ ...“ (Burkart 1998, S. 36).
Beide Quellen machen darauf aufmerksam, dass die Verliebtheit nicht mit der dauerhaften Liebe gleichzusetzen ist. Gleichzeitig wurden zwei in ihr liegende Tendenzen angedeutet: Verliebtheit kann als Fundament für Wachstum der Liebesbeziehung verstanden werden. Andererseits trägt der rauschhafte Charakter der Verliebtheit die Gefahr in sich, diese Wachstumschance zu übersehen, wenn der Rausch nachlässt. Verschiedene Autoren charakterisieren die Verliebtheit sehr anschaulich:
„ Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann sind sie in der Regel von einer umfassenden Begeisterung für den anderen erfüllt. Man ist voller Bewunderung für all die guten Eigenschaften des anderen und tief gerührt, diesen Menschen an seiner Seite zu haben. Oft werden am anderen keinerlei Schattenseiten wahrgenommen und selbst wenn Au ß enstehende ihn differenzierter beurteilen, l ä sst man keine Schwachstellen gelten. Dies ist die berühmte `rosa Brille ´ “ (Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 129, Hervorhebung d. Verf.).
„ Die Verliebtheit am Anfang einer Beziehung ist oft deshalb so heftig, weil wir auf den Partner unser Ich-Ideal projizieren: Er scheint uns alles das zu verk ö rpern, was wir für unsere Erfüllung brauchen. Wir sehen also oft nicht wirklich ihn, sondern ihn nur insofern, als er auf unsere Wünsche `pa ß t ´ [sic!] . “ (Jellouschek 2009, S. 83, Hervorhebung d. Verf.).
Den Partner mit einem Heiligenschein auszustatten bringt aber die Gefahr mit sich, ent- täuscht zu werden, sobald das Gefühl vergeht. Denn Verliebtheit kann nicht verhindern, dass es in einer Beziehung Konflikte gibt. Und Liebe ist kein Ereignis, sondern ein Ent- wicklungsprozess, ein Weg mit Höhen und Tiefen. Während die Zugewandtheit zum Partner während der Verliebtheitsphase noch automatisch funktioniert, kann sie nur durch aktive Beziehungsarbeit Wirklichkeit bleiben (vgl. ebd., S. 20, 202 f.).
Verliebtheit ist allerdings nicht nur als trügerische Illusion zu deuten. Vielmehr kann sie nachhaltig wirken, wenn sich die Beziehung in einer Krise befindet. Die Erinnerung an die Verliebtheit ist es dann, die dem zweifelnden Paar das wahre Potential ihrer Verbindung zeigt. Wenn man den Partner nicht nur idealisiert und sich für den Partner zu seinem Ideal verbiegen lässt, dann kann man sich wahrhaft kennenlernen und die Verliebtheit kann zu echter Partnerliebe heranwachsen. Denn wahre Liebe bedeutet auch, die Schattenseiten des anderen anzuerkennen und an den Dingen zu arbeiten, die nicht ideal sind. Das Nachlassen des Verliebtheitsgefühls ist daher kein Hinweis darauf, dass man sich trennen muss (vgl. Zurhorst 2009, S. 134 f., 232).
Das Liebe im Zeitverlauf aber eher wächst, wenn auch einen anderen, reiferen Charakter entwickelt, das bestätigen auch befragte Ehepaare, die zwischen 10 bis 26 Jahren miteinander verheiratet sind (vgl. Schreiber 2003, S. 112 ff.). „Die Verliebtheit hat nach 15 oder 20 Ehejahren mit Sicherheit einen anderen Charakter als bei einem jungen Paar, das sich gerade im ersten Rausch der Gefühle einer frischen Liebe befindet. Während die letztere tendenziell zu maßlosen Idealisierungen und Illusionen neigt und im Partner häufig mehr die Projektion der eigenen Wünsche als eine reale Person wahrnimmt, ist die erstere in der Regel reifer und realistischer, was nicht heißt, dass sie weniger intensiv sein muss“ (ebd., S. 96).
Es ist, um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen, grundsätzlich nicht zutreffend, der Liebe, ganz gleich in welcher Form, nur anfangs einer Beziehung eine Rolle zuzuschreiben. Sie ist vielmehr: „Sich verlieben bedeutet Bindung herstellen; Liebe bedeutet Bindung erhalten“ (Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 3).
2.3 Definition von Ehe
„In unserer Gesellschaft ist die Ehe eine rechtlich legitimierte, auf Dauer angelegte Beziehung zweier ehemündiger18, verschiedengeschlechtlicher19 Personen. Eine vertraglich vereinbarte zeitliche Begrenzung der Ehe ist ausgeschlossen. (…) Nach § 1353 Abs. 1 BGB sind die Ehegatten einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet und tragen füreinander Verantwortung. (...) [ Zu den rechtlichen Pflichten z ä hlen u. a., D.F.] die häusliche Gemeinschaft, die eheliche Treue, die Sorge für Person und Vermögen des anderen Ehegatten und die Geschlechtsgemeinschaft. Da das Prozessrecht die gerichtliche Durchsetzung personaler Ehepflichten untersagt, hat die Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft letztendlich eher programmatischen Charakter“ (Peuckert 2008, S. 32 f., Hervorhebung i. O.).
Ehen unterscheiden sich also im Wesentlichen durch ihre rechtliche Legitimation durch den Staat von anderen Zweierbeziehungen (vgl. Lenz 2003, S. 45). Bei der Eheschließung spricht man auch von der Institutionalisierung der Paarbeziehung. Mit dem Begriff der Institution ist in der Soziologie ein Komplex sozialer Regeln gemeint, die sich durch Tradition, Brauchtum oder Gesetz legitimieren. Da Institutionen einem fortlaufenden Wandel unterliegen, wird in manchen aktuellen Veröffentlichungen die These von der De-Institutionalisierung der Ehe vertreten. Nave-Herz betont allerdings, dass die Ehe noch als Institution anzusehen ist, wenngleich der Verbindlichkeitscharakter einiger Normen abgenommen hat (vgl. Nave-Herz 2006, S. 37 f.). Auch Peuckert stellt den juristischen Orientierungsrahmen in der reellen Umsetzbarkeit in Frage, weil heute unterschiedliche, teils widersprüchliche Vorstellungen und Erwartungen an die Ehe geknüpft werden, „... (z.B. im Hinblick auf Liebe und Treue), die von den Betroffenen zu Beginn und im Verlauf der Ehe jeweils interpretiert und neu `ausgehandelt´ werden müssen, um einen vorläufigen Konsens herzustellen“ (Peuckert 2008, S. 71).20
2.3.1 Qualitativer Stellenwert der Ehe
Im hier vorliegenden Abschnitt möchte ich Überlegungen anbringen, inwieweit die Ehe die Qualtität der Zweierbeziehung verändert. Dabei interessiert vordergründig, was die Eheschließung für die Partner bedeutet, welchen subjektiven Wert die Institution Ehe für sie hat.
Die Hochzeit stellt zunächst ein Ritual zum Übergang von der informellen, nichtehelichen Partnerschaft, zur formellen Partnerschaft dar. Es werden neue Rechte und Pflichten erworben.21 Die Beziehungen zwischen den beiden Herkunftsfamilien werden neu geregelt und das neue Ehesystem wird im gesamten Familienverband verortet. Mit der Eheschließung werden Erbschaftslinien und familiäre Rollen neu festgeschrieben - aus der Mutter wird die Schwiegermutter, aus dem Partner möglicherweise nicht nur ein Ehepartner sondern auch ein Stiefvater, aus der Schwester die Schwägerin und so weiter. Die Eheschließung sichert weiterhin die soziale Zugehörigkeit der [ bereits vorhandenen, oder, D.F.] zukünftigen Kinder ab. Man kann in diesem Zusammenhang von einer Ordnungs- und Orientierungsfunktion sprechen.
Allerdings war der Übergang vor 30 Jahren noch einschneidender. Mit der Hochzeit war die Ablösung von der Herkunftsfamilie, die Einrichtung eines eigenen Hausstandes und der Kinderwunsch verbunden (vgl. Nave-Herz 2003, S. 27 f., 138 ff.). Heute findet die Ablösung von der Herkunftsfamilie aber nicht erst mit der Eheschließung statt, da die meisten vor der Heirat schon eine nichteheliche Lebensgemeinschaft pflegen und zusammenwohnen. „2007 gab die Hälfte der Verheirateten (49 Prozent) an, vorher bereits mit dem Partner/der Partnerin zusammengewohnt zu haben und zwar im Durchschnitt 2,3 Jahre“ (BMFSFJ 2009, S. 42).
„Unter einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (NEL) werden zwei erwachsene Personen unterschiedlichen Geschlechts mit oder ohne Kinder verstanden, die auf längere Zeit als Mann und Frau - ohne weitere Personen - einen gemeinsamen Haushalt führen, ohne miteinander verwandt oder verheiratet zu sein“ (Peuckert 2008, S. 62). Es handelt sich also lediglich um eine unvollständig institutionalisierte Lebensform, für die auch Begriffe wie „eheähnliche Gemeinschaft“ oder „Ehe auf Probe“ verwendet werden (vgl. ebd.). Auf der Ebene der informellen, alltäglichen Lebenswirklichkeit sind zudem kaum Unterschiede zwischen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften auszumachen: „Im Bett, in der Küche, beim Einkauf, beim Fernsehen, im Streit und in der Liebe - Ehepaare unterscheiden sich nicht von Paaren, die ohne staatliches Zertifikat zusammenleben […] Was zwischen Mann und Frau in einer festen Beziehung passiert, das kümmert sich nicht um Formalitäten“ (Burkart/ Kohli 1992, S. 107; zit. nach Schreiber 2003, S. 22). Die Eheschließung kann daher eher als Ritual zur Bestätigung der Paarbeziehung gelten, weniger als einschneidender Übergang.22 Wie bereits erwähnt, war noch vor 30 Jahren die Eheschließung durch den Kinderwunsch23 begründet, während heute aber die voreheliche Geburt eines Kindes nicht ungewöhnlich ist. Inwieweit besteht aber heute ein Zusammenhang zwischen Kinderwunsch und Eheschließung? Nave-Herz arbeitete heraus, dass die biologische Reproduktionsfunktion nicht grundsätzlich an Anerkennung verloren hat und begründet es damit, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder ehelich geboren und 50 Prozent der nichtehelichen Geburten durch die nachträgliche Eheschließung der biologischen Eltern legitimiert werden (vgl. Nave-Herz 2003, S. 83).
Peuckert ergänzt, dass der Anteil kindorientierter Eheschließungen sinkt, und die Zeitdauer zwischen Geburt eines Kindes und Heirat wächst (vgl. Peuckert 2008, S. 41). Der Familienreport 2009 kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Familiengründung seltener mit der Ehe einhergeht: „Die Folge der Geburt eines Kindes auf die Eheschließung hat sich seit 1970 auch deutlich verlängert von 1,97 auf 2,53 Jahre“ (BMFSFJ 2009, S. 42).
Der Kinderwunsch kommt also nicht als einziger Heiratsgrund in Betracht. Eine Studie unter 377 Paaren, die zwischen 1999 und 2005 geheiratet haben, ergab bei fast allen Befragten, dass die Liebe eine unverzichtbare Voraussetzung für die Eheschließung ist, wenngleich auch nur bei 14 Prozent als allein ausschlaggebendes Heiratsmotiv.24 Für 10,5 Prozent der Befragten ist die Hochzeit an den Kinderwunsch geknüpft und basiert auf dem Wunsch nach ökonomischer und rechtlicher Absicherung. Für ein Drittel erfährt die Ehe eine hohe Wertschätzung im Sinne traditioneller Normalität, für sie gehört Ehe und die festliche Heirat zum normalen Partnerschaftsverlauf. Die Ergebnisse zeigen, dass es gegenwärtig kein dominantes Heiratsmotiv gibt, dennoch die traditionelle Wertorientierung weit verbreitet ist (vgl. Peuckert 2008, S. 42 ff.).
Dass die Liebe als Fundament vieler Partnerschaften gilt, ist gleichzeitig ein Beleg für den Wandel der Ehe „... von der Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft, als deren primärer Zweck freilich die Zeugung und Erziehung legitimer Nachkommenschaft galt, (…) zu einer allein durch die interpersonale Beziehung der beiden Gatten konstituierten und ansonsten weitgehend zweckfreien Lebens- und Liebesgemeinschaft. Von der Verbindung zweier Sippschaften zur Verbindung zweier Individuen und von der Sachebene zur Liebesebene, so lässt sich in plakativen Formeln die Sozialgeschichte der Ehe vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart hinein auf den Punkt bringen“ (Schreiber 2003, S. 21).
Gleichzeitig bedeutet dieser Wandel den Wegfall traditioneller Garanten für die Ehesta- bilität, wodurch die Intimbeziehung im Hinblick auf Qualität und Stabilität zunehmend auf sich gestellt ist. Noch bis in die 60er Jahres des 20. Jahrhunderts stabilisierten insti- tutionelle Rahmenbedingungen die Ehe: Zum einen war die finanzielle Absicherung der Partner innerhalb der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft gewährleistet. Nach der Scheidung fehlte Frauen diese Art der sozialen Absicherung, weshalb es schlicht unmöglich war, aus der Ehe auszusteigen. Das hing auch mit den kulturell festgelegten Geschlechterrollen zusammen. Der Mann kümmerte sich um den finanziellen Absicherung in Form von Erwerbsarbeit, während die Frau für die Erziehungs- und Hausarbeit zuständig war. Durch die sich ergänzenden alltäglichen Notwendigkeiten entstand ein Abhängigkeitsverhältnis, dass die Ehe stabilisierte. Heute gehen mit den sich verändernden Rollen nicht selten konfliktreiche Aushandlungsprozesse einher.25 Des Weiteren fällt heute zunehmend die Einbindung in ein stabiles nachbarschaftliches und familiäres Umfeld weg. Und nicht zuletzt gibt es einige stabiliserende Normen nicht mehr, wie die christlich-religiöse Norm von der Unauflöslichkeit der Ehe. Die staatliche Gesetzgebung steht einer Scheidung heute nicht mehr im Weg (vgl. ebd., S. 42 f.).
Da institutionelle Rahmenbedingungen an Kraft verlieren, ergeben sich für die Qualität und Stabilität der Ehe zwei Konsequenzen: Erstens sind die Garanten für eine stabile Ehe heute innerhalb der Beziehung zu suchen. Es ist Sache der Ehepartner, die Grund- lagen des alltäglichen Zusammenlebens in der Ehe zu definieren. Die zwischenmensch- liche Qualität entscheidet über die Stabilität der Ehe (vgl. ebd., S. 23, 43 ff.). Zweitens kommt der Paarbeziehung in der individualisierten26 Gesellschaft nicht nur die Aufgabe zu, „... die stabilen Gemeinschaftsstrukturen von einst durch eine verlässliche Bindung an den Partner zu kompensieren, sondern sie soll auch das Bedürfnis befriedigen, dem Leben `Sinn und Verankerung´ zu geben.“ (Beck-Gernsheim 1986, S. 214; zit. nach Schreiber 2003, S. 25). Sinn und Verankerung entsprechen trotz der These von der Veränderung des institutionellen Rahmens nach wie vor der bereits o. g. Ordnungs- und Orientierungsfunktion der Ehe. „Die Ehe (…) schafft eine Ordnung, in der es möglich wird, das eigene Leben als sinnvoll zu erfahren“ (Lenz 2003, S. 49).
Der Ehe kommt insgesamt eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung und die Stabilisierung der Identität27 zu. Im Sinne einer stabilen Zweierbeziehung hat sie damit schon eine Schlüsselrolle inne (vgl. Schreiber 2003, S. 24 f.). Lenz betont ebenfalls, dass sie das wichtigste Unterstützungssystem ist: „Während sexuelle Bedürfnisse noch vergleichbar leicht ausgelagert werden können (…) gibt es für Zweierbeziehungen als Unterstützungssystem - zumindest unter gegenwärtigen Bedingungen - kein funktionales Äquivalent“ (Lenz 2003, S. 112).
Das bestätigt auch Peuckert, indem er belegt, dass sowohl in der Ehe als auch in der nichtehelichen Zweierbeziehung der jeweilige Partner am häufigsten als die Person genannt wird, auf dessen praktische und emotionale Unterstützung man in allen Lebensphasen rechnen kann (vgl. Peuckert 2008, S. 72). Nach wie vor fungiert die Familie als Solidargemeinschaft und die Mehrheit der Bundesbürger überträgt ihr eine zentrale Rolle für das persönliche Glück, wozu mehrheitlich auch der Kinderwunsch zählt. Der (Ehe-)Partner wird als Vertrauensperson für mögliche Unterstützung und für Feedback zum eigenen Verhalten geschätzt (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 46 f.).
Umso erstaunlicher ist es, dass der Wunsch, auf Dauer zusammenzubleiben, in den bisher zitierten Studien nicht als Heiratsmotiv genannt wurde.28 Das könnte daran liegen, dass überwiegend Personen über 60 die Ansicht vertreten, dass man heiraten sollte, wenn man mit einem Partner auf Dauer zusammenlebt, während im Alter von 18-30 dauerhaftes Zusammenleben seltener einen Grund für eine Heirat darstellt (vgl. ebd., S. 47). Die genannten Erkenntnisse zum qualitativen Bedeutung der Ehe sind allesamt Argumente für die Notwendigkeit einer positiven Beziehungsarbeit und gegen eine frühzeitige Trennung. Gleichzeitig begründen sie den Sinn der hier vorliegenden Arbeit, Wege intrinsischer Entwicklungschancen aufzuzeigen.
2.3.2 Quantitativer Stellenwert der Ehe
In der Literatur wird die Frage diskutiert, ob die Ehe ihre Monopolstellung als zentrale Form des Zusammenlebens verloren hat.
Lenz vertritt die Meinung, dass zwischen Ehe und Unehelichkeit kein wesentlicher Unterschied gesehen werde. Die Ehe habe an Symbolwert verloren, weil die Heirat mehrfach legitimierungsbedürftig geworden sei. Die Veränderung begründet er mit der zunehmenden Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Ende der 90er Jahre gab es in Deutschland 2,1 Millionen Haushalte mit nichtehelichen Lebens gemeinschaften (vgl. Lenz 2003, S. 16 f.). 2006 gab es bereits etwa 2,4 Millionen nichteheliche Lebensgemeinschaften. 60 Prozent sind dabei ledige Partner, also nicht bereits geschieden oder verwitwet. Zudem sind nichteheliche Lebensgemeinschaften für Jüngere attraktiver als für Ältere. Unverheiratete Paare sind im Durchschnitt 14 Jahre jünger, als Ehepaare (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 28 f.).
Statt von nichtehelicher Lebensgemeinschaft wird auch von der „Vorstufe zur Ehe“ gesprochen, wenn beide Partner schon zur Ehe entschlossen sind, sie aber aus ökonomischen Gründen aufschieben. Mit „Ehe auf Probe“ wird die Phase im Prozess der Partnerwahl verstanden, in der man prüft, ob man reif für die Ehe ist (vgl. Peuckert 2008, S.64 ff.). „[ Aber nur, D.F.] ein Teil der nichtehelichen Lebensgemeinschaften wird mit dem festen Vorsatz geschlossen, dass in absehbarer Zeit geheiratet wird, oder um auszuprobieren, ob man im Beziehungsalltag auch zusammenpasse. In der Mehrzahl der Fälle dürfte es sich dagegen um eine neue Form des informellen Zusammenlebens handeln, die gewählt wird, ohne dass die Frage einer möglichen Eheschließung auf der Tagesordnung steht. Dies schließt jedoch nicht aus, dass sich das zusammenlebende Paar zu einem späteren Zeitpunkt dennoch entschließt zu heiraten. [Vielmehr ist davon auszugehen, D.F.], … dass es sich bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften in den allermeisten Fällen um ein `Durchgangsstadium´ handelt, das entweder in einer Ehe oder mit der Trennung endet. Nur für eine Minderheit scheint diese Lebensform eine dauerhafte Alternative zur Ehe zu sein“ (Lenz 2003, S. 17). Die hier gemachten Aussagen zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft widersprechen der These vom Monopolverlust der Ehe. Welche Argumente sprechen dann dafür?
Laut Datenreport 2008 lebten 2006 insgesamt 18,7 Millionen Ehepaare in Deutschland. Damit ist seit 1996 ein Rückgang von 920.000 Ehen zu verzeichnen. Eine Ursache liegt in der rückläufigen Zahl der Eheschließungen, die im Jahre 2006 374.000 betrug und damit weit unter der Zahl von noch 700.000 Hochzeiten im Jahr 1960 liegt (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 28, 32). Im Jahr 2007 haben sich mit knapp 369.000 Paaren noch weniger Personen trauen lassen. Allerdings ist selbst das noch kein Beweis für den Werteverlust der Ehe. Die Paare lassen sich heute vor allem mehr Zeit zum heiraten. Das Erstheiratsalter steigt kontinuierlich an (vgl. BMFSFJ 2009, S. 42). So waren im Jahr 1985 ledige Männer bei der Hochzeit im Durchschnitt 26,6 Jahre und die ledigen Frauen 24,1 Jahre alt. 2007 haben die Männer im Durchschnitt mit erst 32,7 Jahren und die Frauen mit 29,8 Jahren geheiratet (vgl. Stat. Bundesamt 2009, S. 56).
Das Jahrbuch 2009 gibt anhand tabellarischer Übersichten Auskunft über die Ehedauer 2007 geschiedener Ehen, die möglicherweise ein Indiz für einen geringeren Stellenwert der Ehe sein könnte. Von insgesamt 187.072 geschiedenen Ehen sind ca. 29.565 Ehen nach 16-20 Jahren geschieden worden, etwa 21.461 Ehen nach 26 und mehr Jahren. Also haben insgesamt 37 Prozent aller Scheidungspaare 2007 mindestens 16 gemeinsame Jahre miteinander verbracht, jedes elfte Paar war mehr als 26 Jahre verheiratet. 10.983 Paare, also 5,8 Prozent, haben sich im „verflixten siebten Jahr“ getrennt (vgl. Stat. Bundesamt 2009, S. 61).
Wenn man von der Ehedauer spricht, dann muss man bedenken, dass eine starke Zu- nahme der Lebenserwartung, „... die in Deutschland von 1960 bis 1997/1999 für Männer um ca. sechseinhalb Jahre auf 74,4 Jahre und für Frauen um knapp achteinhalb Jahre auf 80,6 Jahre angestiegen ist“, zur Bedeutungszunahme der Nachfamilienphase beiträgt. In aller Regel, „… ist die Schrumpfung der Familie auf das Ehepaar bereits abgeschlossen, wenn die Eltern 50 Jahre alt werden oder kurz danach. Den 20 bis 25 Jahren Familien- haushalt steht ein ähnlich langer Zeitraum gegenüber, in dem das Ehepaar wieder allein ist“ (Lenz 2003, S.11).
„Lag die durchschnittliche Ehedauer zu Beginn des letzten Jahrhunderts bei etwa 15 Jahren, so kann sie heute - sofern alles gut geht - 50 Jahre und mehr betragen. Sie eine Beziehung drei - bis viermal solange lebendig zu erhalten, stellt ganz neue Anforderungen“ (Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 130).
„Die meisten Ehen werden im Alter beider Partner zwischen 40 und 45 Jahren geschieden. (…) [ Trotzdem, D.F.] gab es in Deutschland nie zuvor so viele Ehen die bereits 40 Jahre und länger halten“ (BMFSFJ 2009, S. 43).
Natürlich ist es nicht zu vernachlässigen, dass sich die Scheidungszahl von 103.927 Ehe- scheidungen 1970 bis 2000 mit 194.408 Scheidungen fast verdoppelt hat (vgl. Schreiber 2003, S.19).
Allerdings ist mit den o. g. 187.072 Ehescheidungen im Jahr 2007 wieder ein Rückgang zu verzeichnen (vgl. Stat. Bundesamt 2009, S. 61). Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann bestätigen, dass die Zahlen der Scheidungen bereits seit 2005 sinken (vgl. BMFSFJ 2009, S. 43).
Fasst man aber nun die genannten die Fakten zusammen, dann sollten sinkende Heiratszahlen, ein späteres Heiratsalter und hohe Scheidungszahlen nicht so stark blenden, „... dass man die überwiegende Mehrheit der in einer Ehe lebenden deutschen Bevölkerung nicht mehr erkennt“ (Schreiber 2003, S. 18).
Folgende Abbildung verdeutlicht, dass die traditionelle Lebensform Ehe deutlich überwiegt. Knapp drei Viertel der in Deutschland lebenden Familien sind Ehepaare (vgl. BMFSFJ 2009, S. 30).
Abbildung 1: Familienformen 2007 (Quelle: BMFSFJ 2009, S. 30)
Alternative Lebensformen sind nicht die zentrale Form des Zusammenlebens. Noch immer betrachten es die meisten Menschen als selbstverständlich, im Laufe ihres Lebens eine Ehe einzugehen. So erweist sich die Ehe nach wie vor als das Modell, dass eine zentrale Orientierungsfunktion in unserer Gesellschaft innehat und das nicht nur für verschiedengeschlechtliche Partner.29 Die Gesellschaft scheint also nicht ehemüde zu sein und aus sich heraus zu einem gewissen Maß an institutioneller Ordnung und Sicherheit zu neigen (vgl. Schreiber 2003, S. 19 ff.).
2.3.3 Status Quo von Scheidung und Trennung
Nun untersuche ich aktuelle Statistiken zu Trennung und Scheidung sowie die damit verbundenen Folgen für die Betroffenen, um zu begründen, weshalb adäquates Beziehungsmanagement angebracht ist.
Es ist nicht nur so, dass externe Garanten der Ehestabilität wegfallen und die Lebenserwartung neue Herausforderungen an die Partner stellt - vielmehr ist Scheidung heute eine legitime Möglichkeit ehelicher Konfliktlösung geworden. Heute wird die Scheidung nicht mehr als moralisches Versagen verstanden, eher noch müssen sich diejenigen rechtfertigen, die eine offensichtlich unglückliche Ehe aufrecht erhalten (vgl. Schreiber, S. 44).
Nach § 1565 Abs.1 BGB kann eine Ehe heute geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Eine Ehe ist gescheitert, „... wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wiederherstellen.“ Es ist zwar so, dass die Ehen nach wie vor mehrheitlich durch den Tod eines Partners beendet werden, dennoch ist nach derzeitigen Verhältnissen damit zu rechnen, dass mehr als jede dritte Ehe im Laufe der Zeit wieder geschieden wird (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 32 f.). Man geht sogar davon aus, dass in Großstädten heute jede zweite Ehe geschieden wird (vgl. Hahlweg/ Bodenmann 2003, S. 193).
In allen Ehejahren der letzten Jahrzehnte ist ein tendenzieller Anstieg des Scheidungsniveaus zu erkennen. Die meisten Scheidungen zeigen sich dabei vor allem nach einer Ehedauer von 5 bis 9 Jahren und in Form der späteren Scheidung nach dem 19. Ehejahr. Erklärungen können hier die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen und Unabhängigkeit im mittleren Lebensalter sein sowie die höhere Lebenserwartung. So scheitern Ehen heute vor allem, wenn aus dem Paar eine Familie wird und umgekehrt, wenn aus der Familie wieder ein Paar wird (vgl. Peuckert 2008, S. 171). Nicht zu vernachlässigen ist, dass vor allem in den jungen Scheidungsjahren minderjährige Kinder von Trennungen betroffen sind. Allein 2007 waren von einer Scheidung ihrer Eltern 145.000 Kinder betroffen. (vgl. BMFSFJ 2009, S. 43). Von den 187.072 Scheidungen im Jahre 2007 war allein in 49.298 Fällen schon ein minder- jähriges Kind betroffen, in 33.828 Fällen schon zwei minderjährige Kinder (vgl. Stat. Bundesamt 2009, S. 61). Zwar sind in knapp der Hälfte der Scheidungen keine Kinder involviert, dennoch ist es so, „... dass für Kinder die Scheidung ihrer Eltern ein großes Leid und in der Regel auch eine starke, sich über Jahre oder gar jahrzehnte auswirkende negative Beeinträchtigung ihrer persönlichen Entwicklung bedeutet. (…) Subjektiv erfahren Kinder die Scheidung ihrer Eltern häufig als ein Verlassenwerden von den Eltern, sie beziehen die Scheidung - übrigens quer durch alle Altersstufen - auf sich selbst ...“ (Schreiber 2003, S. 31).
Eine Scheidung der Eltern gehört für Kinder zu den am meisten belastenden Lebensereignissen. Mittelfristig sind besonders das Selbstwertgefühl der Kinder, soziale und kognitive Kompetenzen und die schulischen Leistungen der Scheidungskinder betroffen sowie die emotionale Bindung zwischen Kind und den Eltern geschwächt. Nachhaltig verändert die Scheidung der Eltern aber vor allem die Vater-Kind-Beziehung. 35 Prozent der Scheidungskinder pflegen zu Beginn des Erwachsenenalters nur noch eine relativ schwache Beziehung zum Vater. Ebenfalls langfristig wirkt die Scheidung auf den Aufbau und die Stabilität einer eigenen Beziehung. Das eigene Scheidungsrisiko wird durch die Trennung der Eltern nachweislich erhöht (vgl. BMFSFJ 2005, S. 119 f.).30
Man muss bedenken, dass zu den Scheidungskindern noch diejenigen Kinder dazu kommen, die aus einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft heraus die Trennung erleben. Laut 7. Familienbericht werden etwa ein Fünftel aller Kinder in den alten und ein Drittel in den neuen Bundesländern ihre Kindheit nicht mit beiden leiblichen Eltern verbringen, sondern Erfahrungen in andern Familienformen machen und eventuell mehrmals einen Wechsel zwischen verschiedenen familiären Settings bewältigen müssen (vgl. BMFSFJ 2006, S. 116). Beziehungen unverheirateter Paare scheitern in den ersten 6 Jahren dreimal häufiger als Ehen. Gehört ein Kind zur Beziehung, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Trennung der leiblichen Eltern bis zu dessen 18. Lebensjahr 80 Prozent (vgl. Peuckert 2008, S. 172).
Diese Erkenntnis gewinnt insofern an Bedeutung, als dass die nichtehelichen Paarbeziehungen zugenommen haben31 und gleichzeitig die Auflösungen von Beziehungen von Generation zu Generation gestiegen sind. Nach einer Studie zu spätmodernen Beziehungswelten sind von 1.966 Trennungen lediglich 9 Prozent Scheidungen. Die Gründe für die Auflösung der Partnerschaft unterscheiden sich nicht grundlegend von denen der Ehe, aber bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften entfallen in der Regel gerichtliche Auseinandersetzungen, wodurch sich Trennungen jederzeit umsetzen lassen. Durch die höhere Trennungsbereitschaft machen junge Menschen heute vermehrte Trennungserfahrungen als frühere Generationen und müssen sich folglich mehr mit ihren Beziehungsvorstellungen und Realisierungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Dabei bedauern nur wenige Personen die Vielzahl ihrer festen Beziehungen. Mehrheitlich werden die Trennungen zwar als schmerzhaft, aber zugleich als wichtig für die Stärkung der eigenen Beziehungsfähigkeit bewertet, da man so Beziehungserfahrungen sammeln konnte (vgl. ebd., S. 72 ff., 173).
Scheidungen werden hingegen nicht als normale Statuspassage im Familienzyklus verstanden (vgl. Schreiber 2003, S. 30). „Insgesamt zeigt die Forschung der 90 Jahre, dass eine Scheidung beträchtliche Belastungen für das Leben der Betroffenen mit sich bringen kann … sich jedoch auch umfassende Unterschiede in den Reaktionen der Probanden [ zeigen,D.F.]. So bringt die Scheidung für einige Menschen große Vorteile32 mit sich, andere leiden unter einer zeitweiligen Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens, für wieder andere wird dadurch ein Abwärtstrend eingeleitet, von dem sie sich nie mehr richtig erholen“ (BMFSFJ 2005, S. 118). Allerdings ist davon auszugehen, dass das höchste Stressniveau bereits vor dem Entschluss zur Scheidung herrscht. Während Männer ihre Unzufriedenheit meist durch Aggression ausdrücken, erhöht sich vor allem für Frauen, die ihre Beziehung als unbefriedigend erleben, das Risiko an einer Depression zu erkranken um 50 Prozent. Zudem beeinflusst ein von Kritik und Abwertung geprägtes Gesprächsverhalten die Immunfunktionen der Partner negativ. Werden dann noch Zigaretten oder Alkohol als Puffer gegenüber belastenden Lebenslagen konsumiert, wird die Entstehung von Krankheiten beschleunigt (vgl. Hahlweg/ Bodenmann 2003, S. 196 ff.). Eine Scheidung selbst ist vor allem in ökonomischer Hinsicht für die Frauen einschneidend, die bis dahin im Rahmen einer geschlechtsspezifischen Rollenverteilung für die Haus- und Erziehungsarbeit zuständig, aber selbst nicht erwerbstätig waren. Der Lebensstandard von Müttern ist nach der Scheidung um die Hälfte niedriger als bei den Vätern (BMFSFJ 2005, S. 119). Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass drei Viertel aller Geschiedenen wieder heiraten (vgl. Hahlweg/ Bodenmann 2003, S. 192).
Der Anstieg der Scheidungszahlen in den letzten 40 Jahren nahm Einfluss auf die Pluralisierung33 der Lebensformen. Neben der Möglichkeit der Wiederheirat wohnt ein beträchtlicher Teil nach der Trennung allein oder in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Sind bereits Kinder vorhanden, kommt als Lebensform die Ein- Eltern-Familie in Frage, im Falle der Wiederheirat werden diese zu Stiefkindern, Familien zu Patchwork-Familien, Eltern zu Stiefeltern (vgl. Peuckert 2008, S. 183). „Entsprechend wächst der Dschungel elterlicher Beziehungen: meine, deine, unsere Kinder mit den jeweils damit verbundenen unterschiedlichen Regelungen, Empfindlichkeiten und Konfliktzonen für alle Betroffenen“ (Beck 1986, S. 163).
Um Scheidungen und Trennungen und die damit einhergehenden negativen Auswirkungen für alle Betroffenen zu vermeiden, ist die Auseinandersetzung mit den wachsenden beziehungsdestabilisierenden Ursachen auf gesellschaftlicher sowie partnerschaftlicher Ebene vonnöten, um daraus Entwicklungschancen abzuleiten.
[...]
1 Die Dyade ist ein Subsystem, was zwei Individuen miteinander verbindet, Paare, Geschwister, die Mutter Kind-Beziehung. Neben Dyaden organisiert sich jede Familie auch durch Triaden, Eltern-Kind-Subsystemen und Mehrpersonen-Subsystemen (vgl. Scheib/ Wirsching 2002, S. 168).
2 vgl. 5.1 zur Definition von Interaktion
3 vgl. 2.2 zur Definition von Liebe als eine Form von Interaktion und Charakteristikum der Paarbeziehung
4 vgl. 2.2.2 zur Bedeutung partnerschaftlicher Liebe als Gestaltungsideal einer Beziehung
5 Bei Kleinkindern ist die emotionale Nähe zwingend an physische Präsenz gebunden, hingegen sie bei Erwachsenen kognitiv repräsentiert ist. Bei Säuglingen wurde beobachtet, dass es nicht ausreicht, sie mit Nahrung zu versorgen. Fehlende emotionale und physische Nähe bewirken extreme Entwicklungsverzögerungen und können bis zum Tode führen (vgl. Grau 2003, S. 289, 297).
6 Hirt sieht es auch so, dass die Identität nur durch dauerhafte, verlässliche Beziehungen zu anderen Menschen gestärkt wird. Er definiert Identität als „... mein Gefühl, mir selbst gegenüber kein Fremder, sondern ein Mit-mir-bekannt-Gewordener zu sein“ (Hirt 2008, S. 32).
7 „... mit dem Wissen, dass die meisten Scheidungen in den ersten 5 Jahren eingereicht werden … müssen wir feststellen, dass die Menschen offensichtlich zu schnell aufgeben“ (Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 10).
8 vgl. 4.1.1 zum Einfluss der Herkunftsfamilie
9 vgl. 3.1.2 zur Konsumenteneinstellung
10 Mit der Erforschung der Emotion in Zweierbeziehungen befasst sich die Emotionssoziologie, vgl. dazu Flam 2002 u.a. (vgl. Lenz 2003, S. 258).
11 vgl. 4.2.2.1 zur Wertschätzung der Individualität des Partners
12 Kapitel 4.2 zeigt, wie eine intakte Beziehung den beiden Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und Bindung Ausdruck verleiht.
13 Das Zitat verdeutlicht, dass, um dem partnerschaftlichen Liebesideal Rechnung zu tragen, die Themen Kommunikation und Konfliktmanagement in dieser Arbeit nicht außer Acht gelassen werden dürfen.; vgl. Kapitel 5. und 6.
14 vgl. 4.2.3 zu Ausdrucksformen der Exklusivität
15 Diese Meinung vertritt auch Zurhorst und begründet dies mit der Liebe zum eigenen Kind, welche auch ohne Bedingungen genuin besteht (vgl. Zurhorst 2009, S. 61).
16 Unter der „Gesetzmäßigkeit der Reziprozität“ versteht man eine Ausgewogenheit im Geben und Nehmen. Eine Wechselseitigkeit besteht besonders beim Kennenlernen, in der ersten Verliebtheit, in der man per se bereit ist, zu geben und beim anderen den Wunsch der Erwiderung auslöst (vgl. Schindler/ Hahlweg/ Revenstorf 2007, S. 18).; vgl. 4.2.2.3
17 Es reicht allerdings nicht aus, Liebe durch Partnerschaft zu ersetzen. Liebe muss, wenn auch latent, weiter wirken, damit die Beziehung bestehen bleibt (vgl. Burkart 1998, S. 39).; vgl. 2.2.1
18 Es müssen u. a. die Volljährigkeit und die Geschäftsfähigkeit der Partner vorliegen. Keiner von ihnen darf bereits verheiratet sein, und Verwandte in gerader Linie kommen nicht für eine Ehe in Frage (vgl. Nave-Herz 2003, S. 123 f.).
19 Seit August 2001 besteht mit der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ auch für homosexuelle Paare eine Institution mit eheähnlichen Rechten und Pflichten (vgl. Lenz 2003, S. 45).
20 Das Aushandeln betrifft, wenn auch selten, die institutionell vorgesehene häusliche Gemeinschaft der Ehe: „Auch Ehepaare können in zwei Haushalten leben“ (Lenz 2003, S. 18). Ursachen können hier z. B. in den hohen Anforderungen an die Berufsmobilität liegen (vgl. ebd., S. 19).; vgl. 3.2.2 zur Wochenendbeziehung
21 Es werden z. B. das Erbrecht, das Recht auf ärztliche Auskunft über den Partner und das Zeugnis verweigerungsrecht u. a. erworben (vgl. Peuckert 2008, S. 73).
22 Der vorehelichen Lebensgemeinschaft wird hinsichtlich der Ehestabilität ein positiver Effekt zugesprochen, weil nicht zusammenpassende Partner vor der Heirat „aussortiert“ werden können. Die Trennungsrate nichtehelicher Paare ist innerhalb der ersten 6 Jahre zwar dreimal höher als bei den Ehen, aber eine vorherige Bestandsphase von etwa 2 Jahren wirkt sich eher stabilisierend für die Folgeehe aus (vgl. Peuckert 2008, S. 74 f.).
23 „Die biologische Reproduktionsfunktion wurde zu allen Zeiten in unserem Kulturbereich der Ehe zugeschrie ben, was bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts galt. Unterstützt wurde diese Funktionszuschreibung an die Ehe durch die Diskriminierung bei Nichterfüllung dieser Erwartung. Das war der Fall, wenn eine Ehe kinderlos blieb … oder bei einer nichtehelichen Geburt“ (Nave-Herz 2003, S. 79).
24 Dass aus Liebe heute nicht mehr automatisch die Ehe folgt, wird auch damit begründet, dass dem Paar unterschiedliche Beziehungsformen offen stehen, um sexuelles Erleben und gemeinsamen Alltag zu erlangen (vgl. Lenz 2003, S. 15).
25 vgl. 3.2.1
26 vgl. 3. zur Individualisierung
27 vgl. 2.1.1
28 Dabei ist die Ehe, die in der Absicht der Dauerhaftigkeit eingegangen wird, von höherer Stabilität gekennzeichnet. Der Glaube an die Ehe als lebenslanger Wert ist ein intrinsischer Stabilitätsfaktor, weil die Ehe als Prozess anerkannt wird, indem das Aufrechterhalten durch Entwicklungsbereitschaft durch adäquate Beziehungsarbeit zum Gelöbnis gehören (vgl. Schreiber 2003, S. 100; Doherty 2003, S. 33 f.).
29 Im Jahr 2006 wies der Mikrozensus rund 62.000 gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften aus, also Paare gleichen Geschlechts, die in einem Haushalt zusammen wohnen. 19 Prozent davon (12.000) waren zugleich eingetragene Lebenspartnerschaften, d. h. Paare mit Trauschein (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 29).
30 vgl. 4.1.1 zum Einfluss der Herkunftsfamilie; Das zerstörerische Potential einer Scheidung stellen andere Autoren in Frage, nach denen die elterliche Scheidung bestimmte soziale Kompetenzen bereichern könne und die gesunde psychosoziale Entwicklung mit einem breiten Spektrum familiärer Lebensformen vereinbar sei (vgl. BMFSFJ 2005, S. 120). Weitere Überlegungen dazu sind in dieser Arbeit nicht vorgesehen.
31 In Deutschland ist die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften von 1996 bis 2006 um 32 Prozent auf 2,4 Millionen gestiegen (vgl. Stat. Bundesamt 2008, S. 28).
32 Bei Gewalterfahrungen innerhalb der Beziehung kann eine Trennung eher ratsam und für die Betroffenen eine Erlösung sein, vor allem, wenn der Täter weder schuldeinsichtig noch theraphiebereit ist (vgl. Doherty 2003, S. 69).
33 Pluralisierung meint, dass die Zahl verschiedenartiger Lebensformen größer geworden ist. Allerdings haben sich weniger die äußeren Formen, sondern vielmehr die Binnenstrukturen differenziert. Pluralisierung ist u. a. als Folge der Individualisierung zu verstehen, als Ausdruck veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse (vgl. Limmer/ Ruckdeschel/ Schneider 2002, S. 29).
- Arbeit zitieren
- Doreen Förste (Autor:in), 2010, Beziehungsmanagement in Partnerschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161214
Kostenlos Autor werden












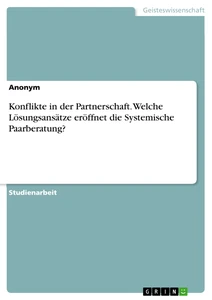

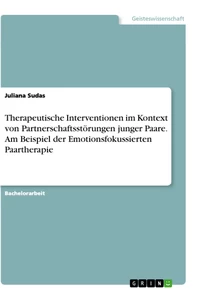







Kommentare