Leseprobe
INHALT
1. Einleitung
2. Kinder- und Jugendhilfe
2.1 Rechtliche Grundlagen
2.2 Die Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe
2.2.1 Familienunterstützende Hilfen
2.2.2 Familienergänzende Hilfen
2.2.3 Familienersetzende Hilfen
3. Geschichtliches und Theoretisches zum Systemischen Arbeiten
3.1 Kernfragen systemischer Theorie
3.2 Was ist ein „System“, wie entsteht es und was bewirkt es?
3.2.1 Problemsysteme
4. Prinzipien systemtheoretischer Praxis
4.1 Krankheitskonzepte und Diagnosen aus systemischer Sicht
4.2 Systemtherapeutische Grundhaltungen
4.3 Systemische Frage- und Interviewtechniken
4.4 Umdeutungstechniken, positive Konnotation und die Externalisierung von
Problemen
4.5 Repräsentationsformen für Systeminformationen und metaphorische Techniken ...
4.6 Schlussinterventionen
5. Grundlagen des systemischen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen
5.1 Spezifische Formen der Kontaktgestaltung
5.2 Räumliches Setting
5.3 Bekanntmachung der Grundregeln
6. Erhebung physischer, psychischer und sozialer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in intensiv- und individualpädagogischen Maßnahmen
6.1 Fragestellung
6.2 Methode
6.3 Befragte
6.4 Quantitative Auswertung
6.5 Fazit
7. Durch die Hilfeform bedingte Spezifitäten in der systemischen Bearbeitung ausgewählter Störungsbilder
7.1 Somatische Beschwerden
7.1.1 Essstörungen
7.1.1.1 Beziehungsmuster
7.1.1.2 Zur Bearbeitung von Essstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.1.1.3 Zur Bearbeitung von Essstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
7.1.2 Schlafstörungen und Alpträume
7.1.2.1 Beziehungsmuster
7.1.2.2 Zur Bearbeitung von Schlafstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.1.2.3 Zur Bearbeitung von Schlafstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
7.1.3 Sprachstörungen
7.1.3.1 Beziehungsmuster
7.1.3.2 Zur Bearbeitung von Sprachstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.1.3.3 Zur Bearbeitung von Sprachstörungen in familienersetzenden Settings
7.1.4 Kopfschmerzen
7.1.4.1 Beziehungsmuster
7.1.4.2 Zur Bearbeitung von primären Kopfschmerzen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.1.4.3 Zur Bearbeitung von primären Kopfschmerzen in familienersetzenden Hilfeformen
7.2 Psychische Beschwerden
7.2.1 Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen
7.2.1.1 Beziehungsmuster
7.2.1.2 Zur Bearbeitung von Hyperaktivität und Konzentra tionsstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.2.1.3 Zur Bearbeitung von Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
7.2.2 Stimmungsschwankungen
7.2.2.2 Zur Bearbeitung von Stimmungsschwankungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.2.2.3 Zur Bearbeitung von Stimmungsschwankungen in familienersetzenden Hilfeformen
7.2.3 Wahrnehmungsstörungen
7.2.3.1 Beziehungsmuster
7.2.3.2 Zur Bearbeitung von Wahrnehmungsstörungen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.2.3.3 Zur Bearbeitung von Wahrnehmungsstörungen in familienersetzenden Hilfeformen
7.2.4 Ängste
7.2.4.1 Beziehungsmuster
7.2.4.2 Zur Bearbeitung von Ängsten in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.2.4.3 Zur Bearbeitung von Ängsten in familienersetzenden Hilfeformen
7.3 Soziale Auffälligkeiten
7.3.1 Lügen
7.3.1.1 Beziehungsmuster
7.3.1.2 Zur Bearbeitung von Lügen in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.3.1.3 Zur Bearbeitung von Lügen in familienersetzenden Hilfeformen
7.3.2 Distanzlosigkeit
7.3.2.1 Beziehungsmuster
7.3.2.2 Zur Bearbeitung von Distanzlosigkeit in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.3.2.3 Zur Bearbeitung von Distanzlosigkeit in familienersetzenden Hilfeformen
7.3.3 Aggressives und gewalttätiges Verhalten
7.3.3.1 Beziehungsmuster
7.3.3.2 Zur Bearbeitung von aggressivem und gewalttätigem Verhalten in familienunterstützenden und familienergänzenden Hilfeformen
7.3.3.3 Zur Bearbeitung von aggressivem und gewalttätigem Verhalten in familienersetzenden Hilfeformen
7.4 Abschlussbemerkungen
8. Fazit und Ausblick
9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
10. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Systemisches Denken, Handeln und Arbeiten ist weiterhin auf dem Vormarsch und hat sich in vielen Anwendungsfeldern bewährt. Trotz kontroverser Diskussionen von Autoren im Rahmen anderer Disziplinen wie beispielsweise der Soziologie, die eine systemtheoretische Sicht als unangemessen, nicht „bis zum Ende gedacht“ oder einfach nur als überholt ansieht[1], scheint eine systemische Sichtweise im Bereich der Sozialen Arbeit Früchte zu tragen. Die Verbindung zwischen Pädagogik einerseits und Systemdenken andererseits führt möglicherweise dazu, dass das Individuum seine Wichtigkeit und Präsenz behält, die Systeme, in denen es sich bewegt — auch wenn diese sich zunächst als „undurchsichtig“ oder „verworren“ darstellen — aber nicht als ausgeschlossen, sondern vielmehr als ressourcenbringend angesehen werden. Es wird also Abstand von der herkömmlichen, „problemzentrierten Denkweise“ genommen und ein Schwerpunkt auf den Zusammenhang, die Wechselwirkungen und die Muster von problematischen Weisen des Denkens, Handelns und Fühlens des Individuums im Kontext eines komplexen Systems gelegt. Hier kann eine Sichtweise, die sich immer nur mit einem Problemsystem befasst, sehr erfolgversprechend sein, zumal sich der Fokus nicht auf Unmengen hochkomplexer einzelner Systeme, sondern auf Lösungen bestimmter Aspekte richtet. Es ist jene Idee, die den Anstoß zu dieser Magisterarbeit gab.
Die Frage, die sich nun hieraus ergibt, lässt sich etwa so formulieren: Welche Konzepte und Methoden gibt es in der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die zu einer Lösung bestimmter Auffälligkeiten führen? Und: Ist jedes Konzept für jede Hilfeform in der Kinder- und Jugendhilfe geeignet und sinnvoll oder gibt es möglicherweise Probleme oder Grenzen in der Anwendung?
Im Folgenden soll nun zunächst der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt werden. Hierbei möchte ich zu Beginn kurz auf die Geschichte und die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe eingehen. Dies soll als Basis zur darauf folgenden Beschreibung und Definition einzelner Hilfeformen dienen, welche im weiteren Verlauf die Grundlage für einen Abgleich mit den Konzepten systemischen Denkens und Handelns bilden.
Anschließend werden in Kapitel 3 die theoretischen Aspekte der Systemischen Arbeit dargestellt. Da die Systemtheorie eine über viele Jahre gewachsene und sich ständig bewegende Theorie ist, die keine festgeschriebenen, immer anwendbaren Gedanken, Ideen, Methoden bereithält (denn damit würde sie sich selbst verleugnen und eine Veränderung, die gleichzeitig auch Verbesserung sein kann, verhindern), möchte ich dieses Kapitel relativ knapp fassen und nur mit den wichtigsten Annahmen einer systemtheoretischen Sichtweise bestücken.
Im darauf folgenden Kapitel soll dann jenes Thema diskutiert werden, welches vor allem im systemischen Arbeiten immer wieder — auch als Problem — auftaucht: Klassische Krankheitskonzepte und klinische Diagnosen. Sie dienen einerseits als Grundlage für bestimmte Hilfen, andererseits können sie aus systemischer Sicht dazu führen, ein Problem zu chronifizieren und die Menschen zu etikettieren bzw. stigmatisieren. Ob es hier eine für beide „Parteien“ akzeptable Lösung geben kann oder ob es ein „notwendiges Miteinander“ bleiben muss, soll in Kapitel 4 genauer erörtert und eine Basis für die anschließende Darstellung systemtherapeutischer Grundprinzipien und einzelner grundlegender Techniken und Methoden der systemischen Arbeit geschaffen werden. Diesen allgemeinen Aspekten wird in Kapitel 5 eine spezifischere Färbung hinzugefügt, die durch eine Darstellung von Grundlegendem zum systemischen Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen erreicht werden soll.
Im sich anschließenden 6. Kapitel möchte ich eine eigene Erhebung beschreiben, die mittels Fragebogen durchgeführt wurde. Sie zielte darauf ab, darlegen zu können, welche Probleme und Störungen bei Kindern und Jugendlichen hauptsächlich anzutreffen sind, die durch die Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. Die Erhebung wird desha]lb vor allem mit Blick auf die Häufigkeit der Störungen ausgewertet, wobei die Zahlen mit Angaben relevanter Literatur verglichen werden sollen.
Die Störungen, die am häufigsten genannt wurden, bilden die Grundlage für das abschließende 7. Kapitel. Unterteilt in somatische, psychische und soziale Störungen sowie Auffälligkeiten, werden die einzelnen Störungsbilder beschrieben, hinsichtlich ihrer Beziehungsmuster untersucht und Methoden sowie Konzepte zur „Verflüssigung“ der Probleme dargestellt. Hierbei werden auch die verschiedenen Formen der Kinder- und Jugendhilfe wieder eine große Rolle spielen, denn die einzelnen Konzepte und Methoden sollen auf ihre Umsetzbarkeit und ihre Relevanz innerhalb der speziellen Hilfeformen hin untersucht und diskutiert werden. Im abschließenden 8. Kapitel möchte ich ein Fazit ziehen sowie einen Ausblick geben.
2. Kinder- und Jugendhilfe
Seit etwa 100 Jahren läuft der Prozess der Institutionalisierung und Verrechtlichung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Die Wurzeln der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe finden sich in den Sozialreformen des Kaiserreichs. Dort wurde sie, noch beschränkt auf große Städte, ein eigenständiger Handlungsbereich kommunaler Sozialpolitik. Sie bildete sich also erst mit dem massiven Modernisierungsschub aus, den Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts erfahren hat. Plötzlich war es gesellschaftlich sinnvoll, den Erziehungsgedanken in die Sozialpolitik einfließen zu lassen. Denn es entstanden vor allem durch die Urbanisierung in den Großstädten Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche, die konkreten Anlass für sozialpädagogische Innovationen gaben. Familiäre und nachbarschaftliche Bindungen begannen sich aufzulösen, und vor allem die Industrieproduktion schaffte einen neuen Typus des bindungslosen jugendlichen Arbeiters. So kam es zu einer systematischen Verzahnung von öffentlichen Erziehungsmaßnahmen und Staatsgewalt. Doch aufgrund der enormen Ausdifferenzierung und Institutionalisierung der öffentlichen Jugendhilfe kam es zu einer organisatorischen Zersplitterung, deren Vereinheitlichung in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum wegweisenden Thema in den Reformbestrebungen wurde. Bereits vor Ausbruch des Krieges wurden erste städtische Jugendämter eingerichtet, die eine Verbindung zwischen Staat und Erziehung ermöglichten und die als organisatorische Zentren der neuen Maßnahmen und Einrichtungen fungieren sollten (vgl. Sachße 1996, S.557ff).
Anfang der 1960er Jahre kam es zu einem neuen Schub von gesellschaftlicher Individualisierung, die zur weiteren Vergesellschaftung von Erziehung führte. Dies spiegelt sich in den Strukturen und in der Systematik des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) wider. Dieser dort begonnene Prozess ist bis heute nicht zum Abschluss gekommen — es scheint vielmehr so, als ob die Bedeutung öffentlicher Erziehung immer mehr wächst. Mit Blick auf das KJHG zeigt sich, dass öffentliche Erziehung heute allerdings nicht mehr den repressiven Charakter der vorangegangenen Jahre trägt, sondern das Augenmerk verstärkt auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen und erzieherische Hilfen zur Stützung und Ergänzung von Familien gerichtet wird (vgl. Sachße 1996, S.557ff).
Der Prozess der Ausweitung der öffentlichen Jugendhilfe lässt sich vor allem auf die Destabilisierung der Familie zurückführen. Kleinere Familien, weniger Geschwister, kaum mehr Kontakt zu Nachbarn, weniger Einbindung etc. — eben all jene Phänomene, die Ullrich Beck als „Zweite Moderne“ beschreibt, in der die Individualisierung so weit fortgeschritten ist, dass sich die traditionellen Bindungen verflüchtigen und so einerseits individuelle Möglichkeiten offenstehen, die andererseits jedoch Wahl- und Entscheidungszwänge hervorbringen, die oftmals zu einer Überforderung führen (vgl. Beck 1986). So entwickelte sich die öffentliche Jugendhilfe zu einer Institution, die die gesamte Bevölkerung in der Familienerziehung ergänzt und unterstützt. Öffentliche Erziehung ist heute unumgänglich, wenn man die Entwicklungen der Frauenerwerbstätigkeit, des Arbeitsmarktes oder die vorhin beschriebenen Phänomene der Zweiten Moderne nicht außer Acht lassen möchte. Es ist allerdings eben nicht mehr der kontrollierende Eingriff in die Familie, sondern die Verfügbarkeit der Jugendhilfe, auf die es ankommt und die in unserer Gesellschaft so wichtig geworden ist. Dass hierzu allerdings in höchst problematischen Fällen ein Eingriff in die Familie nötig ist, um beispielsweise das Kindeswohl zu gewährleisten, steht außer Frage. All diese Tendenzen führen dazu, dass die öffentliche Jugendhilfe immer größeren Anforderungen gewachsen sein muss (vgl. Sachße 1996, S.557ff).
Dies wird besonders deutlich, wenn man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts vor Augen führt. Hiernach haben 2008 insgesamt mehr als eine halbe Million Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen. Von den familienunterstützenden Hilfen wurde die Erziehungsberatung mit 307.494 neu begonnen Hilfen am häufigsten genutzt. Das entspricht etwa einem Drittel der gesamten neu begonnen Hilfen zur Erziehung und verdeutlicht den Bedarf von Unterstützung bei der Erziehung. Das Alter, in dem die Hilfen am meisten in Anspruch genommen werden, liegt zwischen 6 und 12 Jahren (insgesamt 126.780 Kinder) (vgl. Statistisches Bundesamt 2010, S.6). Dadurch erscheint es besonders angebracht, die pädagogische und systemische Arbeit mit Kindern und (jungen) Jugendlichen zu beleuchten. Dies wird einen großen Teil dieser Arbeit darstellen und soll im besten Fall eine Hilfestellung bei der Arbeit der Pädagogen und Sozialarbeiter in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sein.
Eine Ausdifferenziernng und Spezialisierung auf bestimmte „Problemkontexte“ ist die Folge. Durch die unterschiedlichen Formen der Hilfeeinrichtungen, ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, ein pädagogisches Handlungskonzept aufzuzeigen, welches in jeder Hilfeform angewendet werden kann, vor allem, da die methodische Arbeitauch stark in Abhängigkeit vom institutionellen Kontext variiert. Aufgrund dessen, und mit Blick auf die fast unüberschaubare Menge an spezifischen Hilfeformen, sollen im Folgenden zunächst die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe und anschließend die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, gegliedert nach Intensität des Eingriffs in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, dargestellt werden. Dies soll den Überblick erleichtern und eine Grundlage schaffen, störungsspezifische Methoden und Konzepte der systemischen Arbeit mit bestimmten Hilfeformen in Verbindung zu bringen und auf ihre Möglichkeiten und Grenzen hin zu diskutieren.
2.1 Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe finden sich, neben ihren Verankerungen in Grundgesetz (GG) und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), hauptsächlich im Sozialgesetzbuch (SGB). Dort sind vor allem die Bestimmungen des 8. Teils des SGB (SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)) relevant, die im Folgenden dargestellt werden und als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen sollen. Des Weiteren bleibt anzumerken, dass nicht jeder Paragraph angesprochen werden soll, sondern nur jene, die m.E. nötig sind, um den Grundcharakter der Kinder- und Jugendhilfe zu erfassen.
Zu Beginn das Grundgesetz. Art. 1 GG und damit die Spitze des Grundgesetztes bildet das Gesetz zur Menschenwürde, den Menschenrechten und der Rechtsverbindlichkeit des Grundrechts. Art. 1 zeigt also als oberstes Staatsziel die Gewährleistung der Menschenwürde des einzelnen an und lässt sich in Verbindung mit Art. 2 („Persönliche Freiheitsrechte“) und 3 („Gleichheit vor dem Gesetz“) (GG) als Grundlage für alle anderen Gesetze fassen, die für die Kinder- und Jugendhilfe von Bedeutung sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt innerhalb des GG ist der in Art. 20 definierte soziale Rechtsstaat. Von hier sind alle positiven Gesetze abzuleiten, die für die Sozialpädagogik und die Sozialarbeit entscheidend sind (vgl. Buchkremer 1995, S.231ff). Der jedoch in der Praxis der Kinder- undjugendhilfe wohl am häufigsten gebrauchte ist Art. 6 („Ehe — Familie — Kinder“). Hier ist das natürliche Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder verankert (Abs. 2). Allerdings wird schon hier deutlich, dass es sich nicht nur um das Recht der Eltern handelt, sondern es wird weiter betont, dass es genauso auch ihre Pflicht ist. D.h. allerdings auch, dass, wenn die Eltern ihre Pflicht nicht erfüllen, die staatliche Gemeinschaft dafür Sorge tragen muss, dass das Kind oder der Jugendliche trotzdem so leben kann, wie es seine Rechte vorsehen. Das staatliche Wächteramt greift also dann ein, „wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen“ (Art.6, Abs.2 GG). Dieser Artikel steht in Verbindung mit dem Gesetz des BGB zu gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§1666 BGB und §1666 a), das die Verhältnismäßigkeit und den Vorrang öffentlicher Hilfen regelt. Er spielt vor allem bei solchen Interventionen der Kinder- und Jugendhilfe eine Rolle, die schwerwiegend in die
Lebenswelt der Familie eingreifen. Dies sind natürlich alle Fälle, in denen Kinder und Jugendliche von Seiten des Jugendamtes oder dem Jugendgericht den Eltern bzw. dem Familienleben entzogen werden. Stationäre Hilfeeinrichtungen werden nun benötigt. Hier kommt es zu einer Verknüpfung mit dem SGB. Mithilfe des Sozialgesetzbuches sollen soziale Gerechtigkeit und Sicherheit verwirklicht werden. Des Weiteren dient es dazu, soziale und erzieherische Hilfen zu gestalten. Buchkremer fasst den Sinn des SGB folgendermaßen zusammen: „Das Sozialrecht soll dazu beitragen, daß[2] jeder Mensch entsprechend den Rechts- und Verfassungsprinzipien seine Grundrechte verwirklichen kann“ (1995, S.233). Er spielt damit vor allem auf §1 SGB Abs. 1 an, in dem die Aufgaben des Sozialrechts festgehalten sind. Das Sozialgesetzbuch umfasst insgesamt zehn Bände — der achte ist, wie bereits angesprochen, das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und soll nun erläutert werden.
Das KJHG löste 1990 das aus dem Jahr 1923 stammende Jugendwohlfahrtsgesetz ab. Es stellt die Grundlage für den gesamten Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und umfasst auch „Entwicklungs-, Erziehungs- und Förderbereiche und geht somit weit über den Rahmen dessen hinaus, was sich unter dem Titel Sozialgesetzbuch vermuten ließe“ (Buchkremer 1995, S.234). Alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sollten sich am Wohl des Kindes, des Jugendlichen oder Heranwachsenden orientieren. Dies leitet §1 SGB VIII ein, indem dort das Recht eines jeden jungen Menschen auf „Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (ebd.) festgelegt wird. Dabei muss zwischen drei Ebenen unterschieden werden. Erstens soll, wie gerade dargestellt, die individuelle Ebene Beachtung finden, in der neben der Förderung vor allem auch der Schutz vor Benachteiligung verankert ist (vgl. Textor 2010, o.S.). Dieser Präventionsgedanke stellt die Strukturmaxime des Sozialgesetzbuches und wird im KJHG besonders aufgegriffen und umgesetzt (vgl. Trenczek 2010, o.S.). Die zweite Ebene betrifft die Familie. Hier soll beispielsweise durch Beratung der Erziehungsberechtigten oder durch eine intensive sozialpädagogische Familienhilfe die positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden. Die dritte Ebene bezieht sich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so sein sollen, dass Kinder und Familien auf eine Umwelt treffen, die gerade Minderjährige vor Gefahren schützt. Die Kinder- und Jugendhilfe wird dabei „zur Interessenvertretung für alle Heranwachsenden und ihre Familien“ (Textor 2010, o.S.) und „[s]ie muss die Bedürfnisse junger Menschen in die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse und politischen Entscheidungen einbringen und auf die Berücksichtigung und Umsetzung dieser Interessen hinwirken“ (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 1988, S.9, zitiert nach Textor 2010, o.S.). Wie die Umsetzung der Kinder- und Jugendhilfe aussieht und welchen weiteren Anforderungen sie unterliegt, soll an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
Das KJHG ist in zehn Kapitel gegliedert. In Kapitel 1 (§§1 bis 10 SGB VIII) sind die Leitlinien und Begriffe des Grundgesetzes genauso verankert wie auch die Zuständigkeiten, Vorschriften und Ausführungsbedingungen. Durch das Gesetz wird bereits eine Komplementarität in den Aufgaben der Jugendhilfe geschaffen, die in der sozialpädagogi- sehen Fachwelt schon lange unter dem Schlagwort des „Doppelmandates“ diskutiert und häufig als Problem empfunden wird. So ist es einerseits beispielsweise nach §1, Abs. 3, Satz 4 SGB VIII Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Lebensbedingungen, in denen eine positive Entwicklung erfolgen kann, aufzubauen oder vorhandene Ressourcen auszuschöpfen, um damit die Bedingungen zu optimieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe mögliche Schutzinterventionen vorzunehmen, wenn Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen abzusehen oder bereits eingetreten sind (siehe hierzu beispielsweise $42 SGB VIII) (vgl. Buchkremer 1995, S. 233ff). Zuständig für die Kinder- und Jugendhilfe sind die freie und die öffentliche Jugendhilfe, die zur Kooperation aufgefordert werden (§§3 und 4 SGB VIII), wobei den Trägern der freien Jugendhilfe gemäß dem Subsidiaritätsprinzip der Vorrang der Initiative zugesprochen wird. Die Leistungsverpflichtungen richten sich allerdings an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, da sie „zu einer flächendeckenden Gesamtverantwortung für die Grundausstattung mit den gebotenen Jugendhilfeeinrichtungen beauftragt werden“ (Buchkremer 1995, S.235). Die Träger der öffentlichen und „freien“ Jugendhilfe werden im fünften Kapitel (§§69 bis 81 SGB VIII) des KJHG näher benannt, in dem auch die Leistungen und Entgelte, die Qualitätsentwicklung und die Jugendhilfeplanung bestimmt sind.
Das zweite Kapitel (§§11 bis 26 SGB VIII) des KJHG regelt die verschiedenen Leistungsansprüche von Kindern und Jugendlichen. Hier werden neben der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz auch die Förderung der Familie (beispielsweise durch Beratung der Familie oder durch Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen) und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege festgelegt. Im zweiten Kapitel (§§27 bis 41 SGB VIII) werden allerdings auch jene Hilfeformen festgelegt, die im Folgenden immer dann wieder eine Rolle spielen werden, wenn es um die einzelnen beschriebenen Hilfemaßnahmen in der
Kinder- und Jugendhilfe gehen wird[3]. Die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind damit die für diese Arbeit wichtigsten. Im Unterabschnitt „Hilfe zur Erziehung“ ist neben einer allgemeinen Definition auch die Erziehungsberatung, die soziale Gruppenarbeit, der Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, die sozialpädagogische Familienhilfe, die Erziehung in einer Tagesgruppe, die Vollzeitpflege, die Heimerziehung und mit ihr sonstige betreute Wohnformen sowie die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung geregelt. Auch sie scheinen nach Eingriffsintensität geordnet worden zu sein, was in der Beschreibung der Maßnahmeformen in der Kinder- und Jugendhilfe im folgenden Kapitel aufgegriffen werden soll. Hieran schließen sich die Abschnitte „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§35a SGB VIII) und „Gemeinsame Vorschriften für die Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (§§36 bis 40 SGB VIII). Sie regeln vor allem die administrativen Tätigkeiten wie beispielsweise die Erstellung des Hilfeplans, die Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der Familie oder die Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge.
Das dritte Kapitel (§§42 bis 60) umfasst Fälle, in denen außerfamiliäre Instanzen Rechte und Pflichten zum Eingreifen in die Familie wahrzunehmen haben. Dies kann zum einen das Jugendamt selbst sein, zum anderen sind auch Eingriffe durch das Vormundschafts- oder Jugendgericht denkbar und möglich. Hier spielen die bereits angesprochenen §§1666 und 1666a BGB und §50 SGB VIII eine tragende Rolle, denn durch die entsteht die Möglichkeit zum Entzug des elterlichen Sorgerechts. Aber auch weniger schwere Eingriffe werden hier ermöglicht. Es handelt sich dabei zum Beispiel um §42 SGB VIII durch den die vorläufige Maßnahme der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen geregelt wird oder um bestimmte familienpflegerische Tätigkeiten oder Einrichtungen, die zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bestimmt sind.
In den folgenden Kapiteln stehen hauptsächlich administrative Dinge im Vordergrund, weshalb eine kurze Aufzählung genügen sollte. Das vierte Kapitel (§§61 bis 68 SGB VIII) widmet sich dem Schutz von Sozialdaten und spielt für die Thematik dieser Arbeit eine nur untergeordnete Rolle. Kapitel fünf wurde bereits in Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung von öffentlichen und freien Trägern angesprochen. Auch Kapitel sechs und sieben (§§82 bis 89h SGB VIII) treffen Festlegungen, die beispielsweise die Aufgaben der Länder und des Bundes oder die sachlichen und örtlichen Zuständigkeiten betreffen. Weitere Gesetze, zum Beispiel zur Kostenbeteiligung lassen sich in Kapitel acht (§§90 bis 97c SGB VIII) finden. Kapitel neun ist der Kinder- und Jugendhilfestatistik gewidmet und Kapitel zehn den Straf- und Bußgeldvorschriften.
Festzuhalten bleibt, dass die Gesetze zur Kinder- und Jugendhilfe weitreichende Möglichkeiten eröffnen, die selbst schwerste Eingriffe in das natürliche Recht der Eltern auf Erziehung rechtfertigen und damit weitreichende Veränderungen mit sich bringen können.
2.2 Die Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe
Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sind vielfältig. Die Hilfen zur Erziehung müssen allerdings auch darauf ausgelegt sein, denn laut Gesetz hat jeder Personenberechtigte Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, deren Art und Umfang sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall richten soll (vgl. §27 SGB VIII).
Es lässt sich also feststellen, dass der Gesetzgeber bereits viele Hilfen initiiert und institutionalisiert hat. In der Praxis kommt hinzu, dass viele Hilfen besonders spezialisiert sind und dadurch eine nahezu unüberschaubare Fülle an unterschiedlichen Hilfeeinrichtungen entstanden ist, die an dieser Stelle nicht alle detailliert benannt werden können. Die folgenden drei Kapitel sind deshalb gegliedert in Familienunterstützende, Familienergänzenden und Familienersetzende Hilfen, die auch nur knapp dargestellt werden sollen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Hilfeformen der Kinder- und Jugendhilfe (nach Jordan 2005, S.165)
Diese Aufteilung erscheint mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit ratsam, denn anhand der Einwirkungsintensität und des Kontaktes zu Personen der Herkunftsfamilie sollte es möglich sein, zu bestimmen, welche systemischen Konzepte hilfreich sind. Ohne vorgreifen zu wollen, scheint es logisch, dass ein Konzept innerhalb einer Familienberatung (hier eingeordnet als Familienunterstützende Hilfe) sicherlich sehr hilfreich sein kann, um ein bestimmtes Problem, oder um beim Thema dieser Arbeit zu bleiben, ein bestimmtes Störungsbild zu bearbeiten. Das gleiche Konzept kann in der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe allerdings auch etwas auslösen, was der Beziehung zwischen Sozialpädagogen und Kind/Jugendlichem viel mehr schadet als nützt. Welche Konzepte dies sind und wie und wo sie zur Anwendung kommen können, soll im Laufe der Arbeit geklärt werden.
2.2.1 Familienunterstützende Hilfen
Familienunterstützende Hilfen umfassen Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, die Erziehungsbeistände und Sozialpädagogische Familienhilfe. Im Folgenden möchte ich nun alle vier Formen der Familienunterstützenden Hilfen definieren und beschreiben, damit ein einheitliches Verständnis der Hilfeformen vorliegt. Eine solche Definition ist m.E. unumgänglich, wenn professionelles Handeln geplant werden soll.
Erziehungs- oder auch Familienberatung genannt, ist eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die darauf abzielt, die Personensorgeberechtigten so zu unterstützen, dass sie ihrer Erziehungsverantwortung nachkommen können. Sie soll das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen sicherstellen. Konkret bedeutet dies, dass Erziehungsberatung, ganz im Sinne des §28 SGB VIII, „bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren“ (ebd.) unterstützen soll. Dies schließt die Hilfe bei Erziehungsfragen genauso ein, wie eine Unterstützung bei Trennung oder Scheidung. Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. unterscheidet in ihren „Empfehlungen zu Leistungen, Qualitätsmerkmalen und Kennziffern“ zwischen drei Leistungsgruppen: Beratungsangebote, Präventive Angebote und Vernetzungsaktivitäten (vgl. Gerth/Menne/Roth 2010, S. 10ff). Allein diese Aufteilung verdeutlicht das breite Spektrum der Erziehungsberatung noch einmal. Festzuhalten bleibt, dass Erziehungsberatung meist auch eine institutionelle und damit professionalisierte Beratung ist, die sich von der informellen Beratung im alltäglichen Kontext unterscheidet. Eine strukturierte Methodik gilt zudem als Kennzeichen professioneller Beratung. Dies wird zusätzlich vom Gesetzgeber forciert, da hier festgelegt wird, dass „Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen
Zusammenwirken [sollen], die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind“ (§28, Satz 2 SGB VIII). Wenn man Erziehungsberatung so versteht, ist sie „ein auf die Lösung von Problemen abzielendes, prozessorientiertes, interaktionelles dynamisches Geschehen, das in Kontextzusammenhängen stattfindet, zeitlich begrenzt und professionell strukturiert ist“ (Hundsalz 2003, S.16). Dass dies ein Ort ist, an dem lösungsorientierte, systemische Kurzzeitberatungen sicherlich gut aufgehoben sind, mag wohl niemand bezweifeln. Die konkreten Konzepte, die in dieser Hilfeform zum Tragen kommen, werden Thema des siebten Kapitels sein.
Die soziale Gruppenarbeit ist ebenfalls Bestandteil der Hilfen zur Erziehung des SGB VIII. Hier wird sie unter §29 definiert als eine Arbeit, deren Zielgruppe sich vor allem aus älteren Kindern und Jugendlichen zusammensetzt. Soziale Gruppenarbeit soll dabei helfen, Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensprobleme zu überwinden, indem durch gruppenpädagogische Konzepte soziales Lernen in einem Gruppensetting gefördert werden soll. Zum Teil wird innerhalb der Literatur das Problem thematisiert, dass der Gesetzgeber kaum Hinweise auf die Indikation gibt (vgl. Bauer/Blumenberg 2004; Goll 1993). Die soziale Gruppenarbeit ist also weder auf die Familie als solche fokussiert, noch auf intensive, individuelle Einzelbetreuung, sondern sie ist vor allem auf Probleme ausgerichtet, die Kinder und Jugendliche innerhalb einer Gruppe, außerhalb der Familie, bearbeiten können. Welche spezifischen Störungsmuster in einem solchen Setting aufgegriffen und bearbeitet werden können, wird sich ebenfalls im Verlauf dieser Arbeit herausstellen.
Erziehungsbeistände oder Betreuungshelfer „sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern“ (§30 SGB VIII). Es handelt sich hierbei also um Maßnahmen, die sich auf Kinder oder Jugendliche beziehen und gleichzeitig aber das soziale Umfeld, systemisch gesprochen die Systeme, in denen das alltägliche Leben verläuft, mit in den Blick nehmen. Durch das Wort „Verselbstständigung“ drängt sich der Verdacht auf, dass das Angebot des Erziehungsbeistands, wenn auch vom Gesetzgeber nicht explizit vermerkt, wohl eher auf Jugendliche ausgerichtet ist. Außerdem wird hier die Familie weniger als bei anderen sozialpädagogischen Hilfen in den Blick genommen. Im Gegensatz zur im Anschluss dargestellten Sozialpädagogischen Familienhilfe soll hier das Kind bzw. der Jugendlichen und dessen Wunsch auf Unterstützung mehr im Mittelpunkt des sozialpädagogischen Handelns stehen (vgl. Jordan 2005, S.175)
Sozialpädagogische Familienhilfe zeichnet sich durch eine intensive Betreuung und Begleitung von Familien aus. Gesetzlich geregelt in §31 SGB VIII, soll sie Familien bei ihren Erziehungsaufgaben ebenso unterstützen wie bei der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme. Hierzu zählt auch die Hilfe bei dem Kontakt mit Ämtern und Institutionen. Auch die Unterstützung bei Krisen und Konflikten soll durch eine sozialpädagogische Familienhilfe gewährleistet werden. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Schlagwort dieses Settings, welches meist auf Dauer angelegt ist und die Mitarbeit der Familie erfordert (vgl. ebd.). Dass diese Art der Hilfe auf Dauer angelegt ist, lässt erahnen, dass es sich hierbei um Adressaten handelt, welche als sogenannte „Multiproblemfamilien“ definiert werden. D.h., dass die Störungen und Probleme innerhalb der Familie so massiv sind, dass nur eine lange, intensive Intervention erfolgversprechend erscheint. Solche Familien befinden sich meist in gravierenden Mängellagen (Arbeit, Wohnung, Finanzen, Bildung...). Da eine Sozialpädagogische Familienhilfe etwa 10 bis 15 Stunden in der Woche bei einer Familie verbringt, ist diese Hilfeform als die eingriffsintensivste der familienunterstützenden zu nennen (vgl. Nielsen 1999, S. 164).
2.2.2 Familienergänzende Hilfen
Familienergänzende Hilfen umfassen gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Tagesgruppen und sozialpädagogische Tagespflege. Im Gegensatz zu den bereits dargestellten familienunterstützenden Hilfen sind die nun hier angesprochenen Hilfen insofern eingriffsintensiver, als dass sie die Familienmitglieder, zumindest zeitweise, aus der Familie herauslösen. Sie gehören zu den teilstationären Maßnahmen und schaffen so einen Schnittpunkt zwischen ambulanten familienunterstützenden Hilfen und stationären familienersetzenden Hilfen. So ist es möglich, die fachlichen Ressourcen und Kompetenzen intensiv zu nutzen und gleichzeitig das familiäre und soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen zum Teil zu erhalten.
Streng genommen sind gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach §19 SGB VIII keine Hilfen zur Erziehung, sondern gehören zum Abschnitt „Förderung der Erziehung in der Familie“. Dies spielt allerdings für die hier zu behandelnde Thematik keine Rolle, und deshalb sollen sie als familienergänzende Hilfe ihren Platz finden. Gemeinsame Wohnformen sind für Mütter und Väter vorgesehen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder benötigen. Hier geht es also einerseits um das Wohl des Kindes, andererseits sollen die Eltern aber auch dazu befähigt werden, später selbst finanziell für ihr Kind Sorge zu tragen, denn der Gesetzgeber schreibt vor, dass während der Zeit der Unterbringung darauf hingewirkt werden soll, „dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt“ (§19, Abs. II SGB VIII). Hieraus ist ersichtlich, dass diese Hilfeform vor allem für junge Mütter und Väter konzipiert ist, die mit der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder als zusätzliche Verantwortung noch überfordert sind. Das Ziel ist es, die Eltern zu befähigen, später selbstständig gemeinsam mit dem Kind/den Kindern leben zu können (vgl. Tammen 2004, S.326).
Die Erziehung in der Tagespflege richtet sich nach §32 SGB VIII. Hiernach sollen Tagesgruppen die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern, indem soziales Lernen innerhalb der Gruppe vermittelt wird. Des Weiteren wird eine Begleitung der schulischen Förderung angestrebt, und die Elternarbeit soll unterstützt werden. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in der Familie zu sichern (vgl. ebd.). Durch den Wortlaut des Gesetzes wird zugleich die Zielgruppe deutlich: Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, bei denen eine Herausnahme aus der Familie zwar in Erwägung gezogen wird, dies aber möglichst durch das intensive pädagogische Gruppensetting vermieden werden soll (vgl. Späth 2001, S.573).
Ähnlich der Erziehung in Tagesgruppen ist die Sozialpädagogische Tagespflege. Sie richtet sich nach §§22 bis 26 SGB VIII und zielt darauf ab, Kinder über Tag zu betreuen. Sie soll „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§22, Abs.2, 1. SGB VIII) fördern und zusätzlich „die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen“ (§22, Abs.2, 2. SGB VIII). Dass diese Hilfeform als sozialpädagogische Arbeit definiert wird, ist m.E. etwas irreführend. Denn eine solche Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege soll nach dem Gesetzgeber von „Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen“ (§23, Abs.3, Satz 1 SGB VIII) ausgeübt werden. Auch der Zusatz: „Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben“ (§23, Abs.3, Satz 2 SGB VIII) zeigt, dass eine sozialpädagogische Ausbildung keine Voraussetzung ist. So ist die Definition sehr uneindeutig. Festzuhalten bleibt jedoch, dass eine ganztägige Betreuung, egal von wem sie übernommen wird, einen intensiven Eingriff in die Familie darstellt und die Kompetenzen vorhanden sein müssen, professionell mit Problemen der Kinder und der Familie umzugehen. Trotz der unklaren Begrifflichkeit erscheint es mit Blick auf diese Arbeit also sinnvoll, die Tagespflege als Setting einzubeziehen und Konzepte aufzuzeigen, die einer möglicherweise auch nicht sozialpädagogisch ausgebildeten Betreuungspersonen helfen könnten, Störungen und Probleme des Kindes und innerhalb des Familiensystems zu bearbeiten.
2.2.3 Familienersetzende Hilfen
Familienersetzende Hilfen stellen die eingriffsintensivste Form der Hilfen zur Erziehung dar. Sie umfassen die Vollzeitpflege, die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnfor- men sowie die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Alle drei sind stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können.
Die Vollzeitpflege ist gesetzlich in §33 SGB VIII festgehalten. Sie soll dazu dienen, Kindern und Jugendlichen, entsprechend ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand, „in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform [zu] bieten“ (§33, Satz 1 SGB VIII). Die Bindungen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie sollen hierbei nicht außer Acht gelassen werden. Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche müssen in geeigneten Formen der Familienpflege untergebracht werden. Diese sollen, wenn nicht vorhanden, geschaffen oder ausgebaut werden (vgl. §33). Wie solch eine „geeignete Form“ aussehen soll, definiert der Gesetzgeber nicht. Es wird allerdings deutlich, dass bei dieser Hilfeform die Elternarbeit zum konstitutiven Bestandteil wird, denn nur wenn positive Veränderungen in der Herkunftsfamilie stattfinden, kann eine Rückführung des Kindes anvisiert werden. Zu beachten ist, dass diese Art der Unterbringung Priorität vor der Heimunterbringung nach §34 SGB VIII hat. Was der Begriff „Familienpflege“ verdeutlicht, ist, dass diese Hilfeform von Personen übernommen werden kann, die keinerlei bestimmte Qualifikationen aufweisen müssen. M.E. kann diese Lücke, die der Gesetzgeber offen lässt, zu weitreichenden Problemen führen. Zum einen kann die gebotene Elternarbeit und die Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus schwierigsten Verhältnissen nur schwer von Personen übernommen werden, die keine pädagogische oder psychologische Ausbildung besitzen und im Bereich der sozialen Arbeit nicht geschult sind (vgl. Wabnitz 2009, S.87ff). Die Beziehungsarbeit zu Kindern/Jugendlichen und Eltern muss mit viel Professionalität aufgebaut und ausgebaut werden. Ob dies wirklich möglich ist, ohne in einer der Disziplinen ausgebildet zu sein, ist zu bezweifeln. Zum anderen kommt hinzu, dass diese Personen vom Jugendamt tatsächlich als Pflegepersonen in Anspruch genommen werden, was dazu führt, dass ausgebildete Sozialpädagogen, Pädagogen, Lehrer, Psychologen, die in diesem Bereich tätig sein möchten, aufgrund des finanziellen Aspekts, weniger belegt werden. Diese Kosteneinsparungen werden so auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen und sind m.E. mit dem Anspruch des Kindeswohles nicht zu vereinbaren. Bevor die Unterbringung in dieser Hilfeform verwirklicht wird, sollte deshalb regelmäßig geprüft werden, ob eine Unterbringung mit professionellem Hintergrund nach §§34 oder 35 SGB VIII möglich ist. Sie sollte dann m.E. der Vollzeitpflege vorgezogen werden.
§34 SGB VIII umfasst sowohl die Heimerziehung als auch sonstige betreute Wohn- formen. Die Heimerziehung hat die wohl längste Tradition bei den Hilfeformen in Deutschland. Trotzdem, oder gerade deshalb, gab es in diesem Bereich in den letzten Jahren viele Veränderungen. Große Heime sind kleineren Wohngruppen gewichen, die häufig auf bestimmte Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen spezialisiert sind. Diese engeren Betreuungs settings sollen die Möglichkeit bieten, mehr Alltäglichkeit zu vermitteln. Diese stationären Hilfen sind die teuersten der Erziehungshilfen, obwohl sie nur zeitlich befristete Hilfen bis zur Volljährigkeit darstellen. Die Adressaten dieser Hilfeform sind Kinder und Jugendliche, „die in ihrer Herkunftsfamilie keine hinreichenden Erziehungsund Entwicklungsbedingen (mehr) vorfinden, wenn deshalb ein Milieuwechsel erforderlich ist und wenn keine andere geeignete Hilfeart (insbesondere nach § 33) im Einzelfall in Betracht kommt“ (Wabnitz 2009, S.90). Hilfen nach §34 SGB VIII müssen im Gegensatz zum eben vorgestellten §33 SGB VIII von professionell ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Gesetzes. Hiernach sollen die Kinder und Jugendlichen „durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung [gefördert] werden“ (§34, Satz 1 SGB VIII). Wie auch schon in der Vollzeitpflege ist die Elternarbeit Bestandteil dieser Hilfeform, denn auch hier wird, wenn möglich, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie angestrebt. Da dies in diesem Hilfestadium aber häufig nicht mehr realisiert werden kann, ist eine weitere Aufgabe innerhalb der Heimerziehung, die Kinder und Jugendlichen auf die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten. Der Gesetzgeber betont, dass stationäre Hilfen, die nach §34 SGB VIII angeordnet werden, auf Dauer angelegt sind. Gerade bei älteren Jugendlichen ist das Ziel der Unterbringung in der Verselbstständigung definiert.
Die intensivste Betreuungsform ist die „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ nach §35 SGB VIII. Sie soll vor allem „Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen“ (ebd.). Auch diese Form der Hilfe ist auf Dauer angelegt und soll mehr als alle anderen Hilfen zur Erziehung an den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen ausgerichtet werden. Sie zeichnet sich durch die besonders nahe Betreuung aus, die durch einen Betreuungsschlüssel von 1:1 oder 1:2 (in seltenen Fällen auch 1:3) gewährleistet wird. Hier wird also deutlich, dass Kinder und Jugendliche mit starken Störungen und Auffälligkeiten zu Adressaten dieser Hilfeform werden. Denn eine solch individuelle und intensive Betreuung, in der eine enge Beziehung zwischen betreuender Person und Jugendlichem aufgebaut wird, kann weder in einem Heimsetting noch in einer Wohngruppe mit wechselndem Personal erreicht werden. Innerhalb der Praxis wird meist noch einmal zwischen individual- und intensivpädagogischen Settings unterschieden. In intensivpädagogischen Maßnahmen wird ein gewisses Maß an Kleinstgruppenfähigkeit bei den Kindern und Jugendlichen vorausgesetzt. Dies bedeutet auch, dass die Beziehungsfähigkeit nicht so stark eingeschränkt ist, dass ein Zusammenleben mit anderen, wenigen, Bezugspersonen möglich ist. Individualpädagogische Settings unterscheiden sich davon noch einmal in ihrer Intensität, denn hier kann nur durch einen engen und nahen Beziehungsaufbau erreicht werden, dass das einzelne Kind oder der einzelne Jugendliche die volle Aufmerksamkeit der professionellen Betreuungsperson bekommt und es so möglich wird, einige Defizite wieder aufzuarbeiten. Meistens werden diese Settings im Wohnraum der als Sozialpädagogen, Psychologen, Lehrer oder Erzieher ausgebildeten Personen geleistet. Ein angestrebtes Ziel dabei ist es, die Wirklichkeitskonstruktionen der Kinder und Jugendlichen durch ein völlig verändertes Umfeld zu dekonstruieren und durch eine neue zu ersetzen. In dem Gastel- tern-Prinzip sollen sie lernen, was ein intaktes Umfeld bedeutet und wie ein funktionierendes Prinzip von Beziehungen aussehen kann (vgl. Pro Prognos 2010, o.S.).
3. Geschichtliches und Theoretisches zum Systemischen Arbeiten
Systemisches Denken und Handeln ist nur zu verstehen, wenn man die Geschichte der Systemischen Therapie und Beratung ein wenig kennt. Im Gegensatz zu anderen Therapierichtungen, wie beispielsweise der Psychoanalyse, kann man hier keinen Begründer nennen, aus dessen Ideen sich alle Theorien entwickelt haben. Vielmehr gibt es eine große Zahl an Persönlichkeiten, die begannen, die Probleme und Störungen der Menschen aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus zu bearbeiten. Die Geschichte beginnt in den 1950er Jahren, in denen man anfing, die Settings der Einzel- und Gruppentherapie zu verlassen und sich der Familie zuzuwenden. Es waren in den Anfängen der systemischen Therapie beispielsweise die Arbeiten Gregory Batesons, die den Blick vom Individuum ablösten und auf die komplette Familie lenkten (deren Mitglieder psychische Störungen hatten) mit ihren Mustern innerhalb ihrer Konflikte, ihrer Beziehungen und ihrer Kommunikation. Ein weiterer Vordenker dieser Zeit war der Amerikaner Harry Stuck Sullivan, der vor allem psychische Störungen als Ausdruck und Folge bestimmter Beziehungsmuster sah (vgl. Stierlin 2001, S.258ff).
Die Familientherapie entstand, und das Konzept fand immer mehr Anhänger. Doch je mehr sie sich etablierte, desto häufiger wurde sie in Frage gestellt. Die Kritik richtete sich vor allem auf die Familienorientierung, denn die Familie stellt eben nur eine Form der sozialen Organisation des Menschen dar. „Das Familiensystem ist nur eine Idee, die uns alle vom Weg abgebracht hat. Es ist besser, das Konzept des Familiensystems völlig beiseite zu lassen und über die Behandlungseinheit als Bedeutungseinheit zu reflektieren“, so Boscolo et al. 1988. Die systemische Perspektive, die eine bestimmte Weise der Weltwahrnehmung darstellt, wurde immer wichtiger. Systemtheoretische Überlegungen beschäftigen sich mittlerweile mit der Frage danach, wie sich Menschen in ihren sozialen Systemen organisieren und wie sie ihre gemeinsame Wirklichkeit erzeugen. Systemische Techniken sollen helfen herauszufinden, welche Bedingungen dem menschlichem Denken und Erleben zugrunde liegen und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu hinterfragen, um sie dann zu „verstören“ (Schweitzer/von Schlippe 2007, S.17ff).
Ein weiterer Faktor, der eine Bestimmung der systemischen Therapie und Beratung erschwert ist, dass es eben die systemische Therapie oder Beratung nicht gibt. Es ist ein Überbegriff, der eine Vielzahl von Modellen einschließt. Sie sind von einer unüberschaubaren Anzahl an Strömungen, Arbeiten und Ideen beeinflusst, sodass eine Aufzählung zum einen den Rahmen dieser Arbeit um ein Vielfaches überschreiten würde und zum anderen für die Fragestellung wenig Sinn macht[4].
Ein Ansatz, der m.E. die Problematik in der sozialen Arbeit aufgreift, und sich zudem gut integrieren lässt, ist das Konzept der Lösungsorientierten Kurzzeittherapie. Sie unterscheidet sich einerseits von der üblichen systemischen Therapie und grenzt sich andererseits aber auch explizit von der Familientherapie ab. Es wird von der ersten Frage an direkt auf die Lösung zugesteuert und das Problem erst einmal ausgeblendet, denn es gilt der Leitspruch: „Problem talk creates problems, solution talk creates solutions!“ (Schweitzer/von Schlippe 2007, S.35). Die lösungsorientierte Form der Therapie wurde in den 1970er Jahren in den USA von Steve de Shazer und seinem Team entwickelt[5]. 5 Sie stellten sich gegen die Vorstellung der Psychotherapie, dass es zwischen Problem und Lösung einen Zusammenhang gäbe, und gingen vielmehr von dem Gegenteil aus. Nach diesem Ansatz müssen nur die Interventionen so passen, dass die Lösung sozusagen von selbst auftaucht (vgl. de Shazer 1989, S.12). Hierfür ist vor allem die Ressourcenorientierung ein entscheidendes Merkmal. Sie wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch näher erläutert werden. Ziel ist es, die therapeutische Intervention so kurz wie möglich zu halten, d.h., die begonnene Maßnahme ist auf baldmöglichste Beendigung angelegt.
Nach dieser kurzen Darstellung der Geschichte und der verschiedenen Strömungen der systemischen Arbeit soll im Folgenden noch einmal verstärkt auf die theoretischen Aspekte des systemischen Ansatzes eingegangen werden. Hierfür soll zunächst das Verständnis der Welt und der Wirklichkeit aus der systemischen Sicht beschrieben werden. Begriffe wie Konstruktivismus und sozialer Konstruktionismus, Kausalität und Rekursivität stehen im Vordergrund der Betrachtung. Im Anschluss daran steht der Versuch, Systeme zu erklären, um eine Grundlage für die anschließende Thematisierung von Problemsystemen zu schaffen.
3.1 Kernfragen systemischer Theorie
„Ein System ist nicht ein Etwas, das dem Beobachter präsentiert wird, es ist ein Etwas, das von ihm erkannt wird“ (Maturana 1982, S.175). Maturana spielt hiermit auf die Idee an, dass das Leben aus systemischer Sicht als eine Art Erkennen angesehen wird. Es ist der Konstruktivismus der zeigt, dass Systeme nie „wirklich“ existieren, sondern dass sie erst durch unsere Wahrnehmung erschaffen werden (vgl. Rosa/Kottmann/Strecker 2007, S.182). So wie aus konstruktivistischer Sicht die ganze Welt erst durch unsere Wahrnehmung erzeugt wird. Ein System wird also immer erst von einem Beobachter erkannt, und es muss immer auch in Beziehung zu dem Erkennenden gesehen werden. Es gibt also keine Wirklichkeit, die unabhängig von ihrem Betrachter wäre. Der Konstruktivismus ist die Grundlage des gesamten systemischen Denkens. Die Kernfrage, sie sich hieraus ergibt, ist, wie wir selbst aktiv an der Konstruktion unserer eigenen Welt teilhaben. Um Erkennen zu können, müssen wir Unterscheidungen treffen und Konzepte über die Welt entwickeln. So sind Begriffe wie „Körper“, „Krankheit“, „Gesundheit“, „Familie“ etc. genau solche Konzepte. Da es sich um konstruierte Konzepte handelt, können sie in Frage gestellt werden[6]. Zudem ist es wichtig, zu unterscheiden, wo sich diese Konzepte, von denen man ausgeht und spricht, befinden. Von Foersters drastische Formulierung ,,[d]ie Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (v. Foerster 1981, S.40) meint (in etwas abgeschwächter Form), dass es sich bei Begriffen, die wir gebrauchen, um „Möglichkeiten des Begreifens“ (Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S. 87, Hervorhebung im Original) handelt. Die Wirklichkeit ist also kein starres Bild, welches von jedem gleich wahrgenommen wird, sondern ein Modell, an dem wir aktiv mit konstruieren. Die Welt ist vielmehr ein Prozess. Dieser Prozess ist allerdings kein individueller, sondern ein konsensueller, denn wir Menschen leben immer auch in sozialen Gefügen. Das, was unsere Wirklichkeit also ausmacht, entsteht durch einen Dialog mit unserer Umwelt und durch einen „langen Prozeß von Sozialisation und Versprachlichung“ (Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S.89). Interessant sind in diesem Zusammenhang zwei Forschungsprojekte, die sich mit der Konstruktion von „gesund“ und „krank“ beschäftigen.
Rosenhan, ein amerikanischer Psychologe, untersuchte 1973, welche Konstruktionen in Nervenkliniken bezüglich der genannten Beschreibungen stattfinden. Dazu ließ er sich gemeinsam mit einigen Mitarbeitern freiwillig unter dem Vorwand „Stimmen zu hören“ einweisen. Nach der Einweisung in die Klinik verhielten sie sich so, wie es außerhalb „normal“ gewesen wäre. Keiner wurde durchschaut und die Behandlung dauerte zwischen 7 und 52 Tagen. Nur einige der Mitpatienten behaupteten, es wären Journalisten oder Wissenschaftler. Bei den Ärzten verhielt es sich anders. Nachdem die Krankheitsbestimmung feststand, wurde jede weitere Verhaltensweise als Bestätigung der Diagnose angesehen. Mit der Diagnose wurde also eine Wirklichkeit erschaffen, die alle weiteren klinischen Maßnahmen rechtfertigte. Jeder einzelne Forscher wurde mit der Diagnose „Schizophrenie in Remission“ entlassen (vgl. Gminder 2006, S.57).
Ähnliches wurde auch von Watzlawick und seinem Team beschrieben. Zwei renommierte Psychiater wurden getrennt voneinander gebeten, zu Forschungszwecken ein Gespräch mit einem Schizophrenen zu führen, bei dem es sich in Wirklichkeit um den jeweils anderen Psychiater handelte. Beide behaupteten natürlich, anerkannte Psychiater zu sein, was bei beiden die Annahme bestärkte, ihr Gegenüber sei wirklich schizophren. Vor allem die Tatsache, dass die Behandlungstechniken nicht griffen, verstärkte diesen Glauben noch. Einer der beiden Psychiater legte im Nachgespräch dar, dass er noch nie einen so renitenten Fall von Schizophrenie erlebt habe, der zusätzlich noch mit Größenwahn gepaart sei. Der „Schizophrene“ habe sich sogar Visitenkarten drucken lassen (vgl. Gminder 2006, S.57).
Diese beiden Geschichten zeigen noch einmal deutlich, dass jede Be- und Zuschreibung ein Konstrukt unserer selbst ist. Informationen, die uns vorweg vermittelt werden, scheinen zusätzlich die Macht zu besitzen, unser eigen erschaffenes Bild zu beeinflussen und sozusagen „vorherzubestimmen“. Es macht vor allem die Konsequenz klar, dass „Beobachter“ und „Beobachtetes“, „Forscher“ und „Erforschtes“ nie zu trennen sind, denn auch „die Ergebnisse der modernen Gehirnforschung zeigen uns heute, dass der Mensch gar nicht anders kann, als sich Bilder zu machen und damit die Welt im Kopf entstehen zu lassen“ (Urban 2002, S.11).
Ein Ansatz der in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, ist der des sozialen Konstruktionismus. Sein Hauptvertreter Ken Gergen beschreibt das „Modell vom Menschen als soziale Konstruktion, dessen Handeln in einer komplizierten Weise mit den gesellschaftlichen Prozessen verwoben ist“ (1990, S.191). So wird der Mensch also selbst zu einer sozialen Konstruktion. Diese Vorstellung führt dazu, dass der Mensch so wird „wie die anderen — und er selbst — ihn sich vorstellen“ (Gergen 1990, S. 195). Genau diese Vorstellung ist es, die bei dem Thema dieser Arbeit von besonderer Bedeutung ist. Denn alle Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern sind nicht nur von den Sichtweisen des „normalen“ sozialen Umfelds betroffen. Sie unterliegen in besonderer Weise der Aufmerksamkeit der Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Sie machen sich eine Vorstellung von ihren Klienten, die mit viel Erfahrungswissen gespickt ist. Ein Problem, das sich hieraus ergibt, betrifft vor allem jene Maßnahmen, die auf bereits beendete Hilfen aufbauen. Denn hier gibt es Akten über jeden Einzelnen, die ihn sozusagen schon „vorkonstruieren“. So bleibt wenig Platz für eigene Konstruktionen des professionell Handelnden. Die Idee der Etikettierungsansätze spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Denn durch die Zuschreibung als „Klient“ einer Hilfemaßnahme ist es möglich, dass der Mensch das Bild von sich selbst als „Klient“ verinnerlicht und es so noch zu einer Verstärkung der Probleme kommt. Der systemisch arbeitende Sozialpäda- goge/-arbeiter kann hier unter Umständen mit Hilfe seiner Interventionen deeskalierend eingreifen, indem er darauf achtet, wie in den Systemen, mit denen er sich beschäftigt, gemeinsame Bedeutungen geschaffen werden. Dieser Aspekt der Zuschreibung wird noch einmal im folgenden Kapitel aufgegriffen, weshalb die Ausführungen dazu an dieser Stelle genügen sollen.
Die dargestellten Zusammenhänge lassen die Frage nach der Kausalität aufkommen. Sie kommt der Frage gleich, wer denn nun was verursacht. Das systemische Verständnis von Kausalität setzt die oben aufgeführten Bedingungen voraus: Ein System gibt es nicht ohne seinen Betrachter, und jeder, der in dem System involviert ist, kann ebenfalls zum Betrachter werden. Hier kommt nun ein Begriff des systemischen Denkens mit ins Spiel der besonders hervorzuheben ist: Es ist der des Musters. Der Begriff bezieht sich auf Muster von Beziehungen und Wechselwirkungen und macht gleichzeitig deutlich, dass „eine Änderung bei einem Teilbereich des Systems eine Veränderung bei einem anderen mit sich bringt“ (Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S.90). Eine solche Änderung ist ebenfalls nicht etwas, was objektiv geschieht, sondern sie wird von Personen des Systems unterschiedlich wahrgenommen. Sie verhalten sich daraufhin anders. Dies wiederum bewirkt eine Änderung sowohl bei dem Beobachter als auch bei den anderen Beteiligten. Eine solche Annahme über Zusammenhänge stellt die häufig verbreitete Meinung in Frage, dass alles eine oder mehrere Ursachen habe, und die Frage nach dem „Warum“ tritt in den Hintergrund. Einige Autoren sind deshalb der Ansicht, dass kausale Zusammenhänge in einem Systemkonzept nichts zu suchen haben, da eine solche Sicht bloß einen Komplexitätsreduktionsversuch des Beobachters darstellt. Sie verweisen auf die Rekursivität sozialer Prozesse, die in sozialen Systemen wirksam werden. Norbert Wiener prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der „zirkulären Kausalität“, der verdeutlichen soll, dass sich alle Teile eines Systems wechselwirkend beeinflussen. Jede Handlung hat also nicht nur Auswirkungen auf andere Teile des Systems, sondern wirkt gleichzeitig auch zurück auf die handelnde Person selbst. Dies wird als „Selbstrückbezüglichkeit“ oder „Selbstreferenz“ bezeichnet. Es ist also die Abkehr von der Suche nach Ursachen und die Hinwendung zu Mustern, die den Vorteil besitzt, dass auch der Beobachter in das System einbezogen
werden kann. Eine solche Sichtweise führt dazu, dass der Therapeut oder Berater immer auch Teil des komplexen Wechselgefüges wird und er die Wirkung seiner Interventionen niemals im Voraus berechnen kann. Gerade in der Arbeit mit Familien, in denen die verschiedensten Störungen vorliegen, kann eine solche Grundlage besonders erfolgversprechend sein. Denn eine Sichtweise, die alle Personen als Teil des gemeinsam entwickelten Musters ansieht, kann besonders gut implizierte Schuldvorwürfe verhindern. Daher wird in der systemischen Arbeit ein Patient meist auch als „Indexpatient“ verstanden, der die Rolle des „Anzeigers“ im System darstellt. Die Suche nach der Ursache der Störung wird damit nebensächlich (vgl. Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S.90ff).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein solches Denken eine gute Möglichkeit bietet, auf Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern angemessen einzugehen. Der Blick auf Muster kann m.E. auch dabei helfen, Wechselwirkungen zwischen Herkunftsfamilie, Kindern/Jugendlichen und Hilfeinstitutionen zu erkennen. Das Verständnis über die Rekursivität impliziert gleichzeitig auch eine Verantwortung der an der Hilfe beteiligten Systeme. Denn ,,[w]enn Wirklichkeit Ergebnis eines konsensuellen Abgleichungsprozesses ist, dann sind wir aufgefordert, ständig diesen Abgleichungsprozeß zu überprüfen“ (Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S.97). Dies könnte hilfreich sein bei der Vermeidung von Zuschreibungs- und Festsetzungsprozessen, die durch eine Einbindung in verschiedene oder mehrere Hilfemaßnahmen zustande kommen können.
3.2 Was ist ein „System“, wie entsteht es und was bewirkt es?
Das, was nun heute unter einem „System“ in Therapie und Beratung verstanden wird, hat seine Wurzeln in Biologie und Physiologie. Hier wurde in den 1950er Jahren von von Bertalanffy und Cannon eine erste Systemtheorie entwickelt. Der Aspekt davon, der als erstes den Durchbruch erlangte, war die Kybernetik (später als „Kybernetik 1. Ordnung“ bezeichnet), also die Steuerungslehre technischer Systeme. Die wichtigste Frage „war damals die nach der Erhaltung von Gleichgewicht, nach der Angleichung eines Ist- an einen Soll-Zustand, vor allem durch Zuführung von Informationen, die Abweichungen anzeigt und Korrekturen in Richtung des Sollzustandes einleitet (negatives Feedback)“ (Schweitzer/von Schlippe 2007, S.50). Es wurde also angenommen, dass selbst hochkomplexe Prozesse steuer- und planbar seien, wenn man sich die Komplexität nur realistisch vor Augen führt. Strukturelle und strategische Ansätze in der Familientherapie der 1960er und 1970er Jahre waren die Folge (vgl. ebd.). Diese frühe Systemtheorie interessierte sich also vor allem dafür, wie verschiedene „Systemparameter unter wechselnden Umweltbedingen konstant gehalten werden können — also für die Bedingungen des Gleichgewichts, der Homöostase“ (Schweitzer/von Schlippe 2007, S. 61).
Aus dem damaligen Verständnis heraus, entstanden in der Folge Definitionen von als Systemen, wie die von Hall und Fargen, nach der ein System als „Satz von Elementen oder Objekten zusammen mit den Beziehungen zwischen diesen Objekten und deren Merkmalen“ (1956, S.18) zu verstehen ist. In dieser Definition stecken allerdings zwei Probleme. Zum einen ist es fraglich, ob Objekte von ihren Eigenschaften getrennt werden können, und zum anderen kann ein System nicht nur durch seine Innenwelt definiert werden. Diese Ausgangslage zeigte sich in therapeutischen Prozessen jedoch als nicht besonders fruchtbar. Denn die Vorstellung, man könne auch familiäre Systeme zielbewusst planen und steuern, erwies sich als Fehlannahme. Denn wer sollte bestimmen, was der „SollZustand“ einer Familie ist? Zur gleichen Zeit gab es, ebenfalls wieder in den Naturwissenschaften, Entwicklungen, die die Idee der Homöostase hinter sich ließen. Bei chemischen Prozessen entdeckte Prigogine 1981, dass sich neue Ordnungen „wie von selbst“ (S.63) herausbildeten, und auch in der Physik gab es in der Synergetik[7] und der Chaostheorie[8] Phänomene, die Ähnliches zeigten. Mit den 1980er Jahren kam es also zu einer Hinwendung zur „Kybernetik 2. Ordnung“, die sich dadurch auszeichnet, dass die kybernetischen Gesetze selbst auf die Kybernetik bezogen werden[9]. Die Ansicht schließt die Vorstellung ein, dass sich Systeme durchaus selbst organisieren und neue Strukturen entwickeln können. So steht mittlerweile nicht mehr das Gleichgewicht der Systeme im Vordergrund, sondern deren Veränderungen, die eben nicht plan- oder steuerbar sind. Ebenfalls zu Beginn der 1980er Jahre wurde die Idee der Autopoiese (also der Selbstorganisation) sozialer Systeme wieder aufgegriffen, die bereits einige Jahre zuvor von Parsons entworfen und von Luhmann weiterentwickelt worden war.
Nach Parsons Verständnis lässt sich ein System „als Zusammenhang von aufeinander bezogenen Elementen definieren, die in einer geregelten Verbindung miteinander stehen und sich im Blick des Beobachters als strukturierte Einheit von ihrer Umwelt abheben“ (Rosa/Strecker/Kottmann 2007, S.153). Grundlegend daran ist der Aspekt, dass soziale Systeme aus den Interaktionen der Akteure gebildet werden. Luhmann, ein Schüler Parsons, sah soziale Systeme noch differenzierter als Parsons es getan hatte, und seine
Theorie selbstreferentieller Systeme wurde zum systemtheoretischen Paradigma. Ihm zufolge ist eine Ausdifferenzierung von Systemen nur dann möglich, wenn sie sich operativ schließen. Dies meint, dass alles, was innerhalb eines Systems geschieht, ausschließlich durch das System selbst bestimmt wird. Es reproduziert sich also selbst. Was Luhmann als „Ausdifferenzierung“ bezeichnet, ist das, was ein System eben erst zu einem System werden lässt: Die Unterscheidung zu seiner Umwelt. Diese Grenze, die dadurch aufgebaut wird, verhindert, dass die Umwelt einen determinierenden Einfluss auf die Zustände des Systems ausüben kann (vgl. Rosa/Strecker/Kottmann 2007, S.177). Dieser Aspekt zeigt die Grenzen der Einflussnahme der Umwelt als Planungseinheit. Die Umwelt, also auch der Therapeut, (Sozial-)Pädagoge, Berater, kann das System nicht in der Form beeinflussen, dass er es kontrollieren könnte. Die einzige Möglichkeit liegt darin, ein System zu „irritieren“, um es mit Luhmanns Worten zu sagen. Eine Irritation kann es also nur anstoßen, verstören und in Schwingung versetzen, sodass es in Bewegung gerät und sich selbst neu organisiert. Es handelt sich also um eine neue Konstruktion der Wirklichkeit, die durch das System als Reaktion auf eine Irritation von außen vorgenommen wird. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist auch die strukturelle Kopplung der Systeme. Hiermit sind Strukturen gemeint, „die Systeme in dem Sinn miteinander verbinden, dass sie festlegen, in welcher Hinsicht die Systeme füreinander relevant sind“ (Rosa/Kottmann/Strecker 2007, S.188). So sind psychische und organische System miteinander gekoppelt. Dieser Aspekt erscheint mit Blick auf das Thema dieser Arbeit besonders bedeutsam. Denn genau diese Kopplung ist es, die auch dem systemischen Krankheitsverständnis zugrunde liegt. Es wird im Folgenden wichtig werden, beide Systeme nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern sie als das zu sehen, was sie auslösen: Irritationen beim je anderen System. So ist eine Störung, die ein Kind oder ein Jugendlicher aufweist, immer auch als Reaktion auf Irritationen seines Systems zu verstehen.
3.2.1 Problemsysteme
Neben Problemsystemen gibt es in der inhaltlichen Typologie pädagogischer Systeme noch Kontext-, Relevanz- und Aktionssysteme. Im Folgenden soll allerdings nur auf Problemsysteme näher eingegangen werden, da sie zum Verständnis des Krankheits- und Störungsbegriffs aus systemischer Sicht besonders wichtig sind. Zudem soll auch der Problembegriff und dessen Chronifizierung beleuchtet werden, da dies im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe m.E. besonders wichtig erscheint.
Das systemische Verständnis von Problemen basiert auf dem Grundgedanken „problemdeterminierter Systeme“. Dies bedeutet, dass ein System nicht ein Problem „hat“, sondern, dass das Problem ein Strukturmerkmal dessen ist. So entsteht ein Problem nicht durch das System, sondern das Problem selbst erzeugt ein System. Dadurch werden Probleme auch nicht als „Ausdruck einer inhärenten ,Dysfunktionalität“ (Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.102) des Systems gesehen, sondern stellen sich als eine Folge einer Verkettung von Umständen dar. Dies impliziert, dass Schuldzuweisungen nicht möglich sind. Zusätzlich muss aus dieser Sicht auch nicht das System komplett verändert werden, sondern nur die Kommunikation um und über das Problem (vgl. ebd.). Dabei können die Problemdefinitionen der systemischen Therapie schon selbst mögliche Lösungswege innehaben, denn ein Problem wird hier zwar einerseits als unerwünschter Zustand, aber andererseits auch als generell veränderbar und veränderungsbedürftig, gesehen (vgl. Ludewig 1992, S.116). Schweitzer und von Schlippe nennen vier Faktoren, die durch ihr Zusammenwirken ein Problem konstituieren: Zuerst muss von verschiedenen Personen ein Problem als Zustand bestimmt werden, der so wichtig ist, dass dafür die Kommunikation über andere Dinge zurücktritt. Daraus ergibt sich zweitens, dass es immer auch jemanden geben muss, der diesen Zustand entdeckt und beschreibt. Dies ist gleichzeitig auch die erste Phase der Problemerzeugung und Problemerfindung. Drittens muss dieser Zustand von einigen der Beobachter als veränderungsbedürftig eingestuft und beschrieben werden. Dabei ist es wichtig, zwischen Problemen und Leiden zu unterscheiden, denn ein Leiden wird erst dann zu einem Problem, wenn der Betroffene es durch Kommunikation zum Ausdruck bringt. Der vierte und letzte Faktor zur Konstitution von Problemen ist die Ver- änderbarkeit, die von einigen Beteiligten innerhalb des Problemprozesses gesehen und eingefordert wird. Denn ein Problem wird nicht einfach als gegeben, als Schicksal angesehen, sondern als ein Zustand, der wieder beendet werden kann (vgl. Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.103ff). Dieser Blickwinkel ermöglicht die Annahme, dass ein Problem dann gelöst ist, wenn alle am Problem Beteiligten der Ansicht sind, dass das Problem gelöst sei. Dieses Problemverständnis ist auch für die Sicht auf psychische Krankheiten anzuwenden, wobei die Begriffe „Problem“ und „Krankheit“ m.E. auch synonym verwandt werden könnten.
Der systemische Blick sieht lebende Systeme als sich ständig verändernd und im Übergang an. Sie können sich also, wie bereits erwähnt, „nicht nicht verändern“ (Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.110 — Hervorhebung im Original). Und so stellt sich aus systemischer Sicht die Frage, wie es Kinder und Jugendliche schaffen, sich nicht zu verändern oder den Eindruck erwecken, dies nicht zu tun. Dies ist vor allem dann interessant, wenn sie in Kommunikation mit anderen Menschen stehen und trotzdem ein Problem behalten können, ohne dass dieses sich von alleine wieder auflöst. Behalten sie es länger, konstruieren sie (und ihre Eltern, vorausgesetzt, die Kinder leben noch bei ihnen) sich ein Leben um dieses Problem herum und erzeugen damit in sich einen chronifizierten Erlebenszustand. Diese Chronifizierung kann allerdings sehr selten alleine aufrechterhalten werden, und so werden weitere Beteiligte einbezogen. Gerade bei jenen Störungen, die im Folgenden im Mittelpunkt stehen werden, sind es sehr viele, die durch ineinandergreifende kommunikative Handlungen Chronizität erwirken: die Angehörigen (also vor allem die Eltern), das psychiatrische, medizinische oder pädagogische Fachpersonal, die verschiedenen Versorgungssysteme, die Medien, die Wissenschaft, sozialrechtliche Bestimmungen etc. Sie tragen alle dazu bei, dass sich Störungen verfestigen können und chronisch werden. Bastine (1998) veranschaulicht diesen Prozess folgendermaßen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Der Prozess der Chronifizierung eines Problems (nach Bastine 1998, S.160 in Jungnitsch 2009, S.59)
Die systemische Therapie ist deshalb zwar nicht unbedingt mit dem radikalen labeling approach gleichzustellen, der Krankheiten und Störungen einzig und allein als soziale Zuschreibung und Festlegung versteht; die Idee kann jedoch bestehen bleiben. Denn beiden Sichtweisen ist gemein, dass sie (vor allem psychische) Erkrankungen als im sozialen System verankert sehen und nicht das Individuum im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern das soziale System in dem es sich befindet (vgl. Jungnitsch 2009, S.58). Diese Sichtweise führt dazu, dass trotzdem angenommen werden kann, dass sich Störungen durch die Interaktion mit anderen Systemen verfestigen. Es entstehen Chronifizierungen von Problemen und Problemsysteme.
Hilfesysteme und die sozialrechtlichen Bestimmungen können also dazu beitragen, dass Störungen chronifiziert und konserviert werden. Der bereits oben beschriebene Begriff des „Problemsystems“, wie er im Systemischen zum Tragen kommt, kann es hier nun ermöglichen „die gesamte Organisation um ein Problem herum, die gesellschaftliche Organisierung psychischen Leidens als einen Teil des Problemzusammenhangs wahrzunehmen und zu hinterfragen“ (ebd.).
4. Prinzipien systemtheoretischer Praxis
Gleich zu Beginn sollte festgehalten werden, dass die systemische Therapie und Beratung „weder eine unmittelbar wissenschaftsgeleitete Anwendung systemtheoretischer Konzepte noch einen rein handwerklichen Satz von Techniken dar[stellt]“ (Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.116). Zwischen beiden Polen befinden sich der Therapeut/Berater, also die Person des systemisch Arbeitenden, sowie der Kontext, in dem er arbeitet. Es ist die Maxime, immer so zu handeln, dass sich die Anzahl der Möglichkeiten vergrößert, welche eine Reihe grundlegender und das konkrete Handeln antreibender Haltungen und Sichtweisen hervorbringt. Dies sind beispielsweise die Neutralität, die Prinzipien der Irreverenz, die Zirkularität, die Verstörung von Systemen, die Hypothesenbildung, sowie die Ressourcen- und Lösungsorientierung. All diese Ideen stellen eine Verbindung zwischen den systemtheoretischen Konzepten und dem handwerklichen Satz von Techniken her. Diese Grundhaltungen charakterisieren gleichzeitig auch die Interventionen systemischer Therapie und Beratung.
Zu Beginn soll jedoch zunächst das systemische Krankheits- bzw. Störungsverständnis nachgezeichnet werden, wobei auch die Haltung des Systemikers zu medizinischen und psychiatrischen Diagnosen dargestellt wird. Erst in einem zweiten Schritt werden die oben angesprochenen Grundsätze und deren praktische Umsetzung aufgegriffen.
4.1 Krankheitskonzepte und Diagnosen aus systemischer Sicht
Um den folgenden systemtherapeutischen Grundprinzipien eine Basis zu geben, empfiehlt es sich m.E., zunächst das zugrundeliegende Verständnis von Störungen, Auffälligkeiten, Krankheiten und den daraus resultierenden Diagnosen zu thematisieren.
Krankheiten, Störungen und Auffälligkeiten sind aus systemischer Sicht keine Eigenschaften eines Menschen, die er allein inne hat oder die so beherrschend sind, dass er sogar mit ihnen identisch wird („Ich bin ein Neurotiker“). Der systemische Ansatz verbietet deshalb die Reduzierung des Menschen auf seine Krankheit. Sie erscheint in diesem Licht vielmehr als „Teil einer größeren, je nach Perspektive als störend oder auch gestört erlebten Interaktion“ (Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.15). Dadurch können mehrere
Personen betroffen sein, so dass ihnen gemeinsam ein Krankheitswert beigemessen wird, da der Betroffene als Indikator nur einen Teil des sozialen Beziehungsgefüges seiner Umwelt darstellt. In diesem Zusammenhang bedeutend ist die Vorstellung, dass Symptome über eine Funktion innerhalb des Systems verfügen. Henning und Knödler (1998) sprechen in diesem Zusammenhang von vier zentralen Bedeutungen und Funktionen des Symptoms. Erstens stellen sie vergebliche und verzweifelte Lösungsversuche einer für Menschen nicht aushaltbaren Situation dar. Zweitens werden sie als verschlüsselte Hilferufe angesehen, die, vor allem bei Kindern, auf problematische Situationen aufmerksam machen. Drittens stellen sie Machtausübungen über eine Bezugsperson dar und können daher als Beziehungsmanipulation aufgefasst werden. Viertens werden Symptome in ihrer Funktion betrachtet, von Problemen mit engen Bezugspersonen abzulenken (vgl. ebd. S.40).
Körperliche Krankheiten, psychische Störungen und soziale Auffälligkeiten sind deshalb vor allem als Ausdruck bestimmter Beziehungsmuster anzusehen. Störungen sind so „auch Ausdruck einer bestimmten (vermutlich sehr schwierigen) Qualität von Beziehung“ (Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.137)[10]. Beziehungsmuster lassen sich aus den Merkmalen sozialer Systeme und ihrer internen Kommunikationsmuster[11] ableiten und sind die Verdichtung der Beziehungsgestaltung, welche mit dem Kommunikationsprozess der Beteiligten einhergeht. Es sollte jedoch klar sein, dass es der systemische Ansatz verbietet, einen linearen Zusammenhang zwischen einzelnen Beziehungsmustern und bestimmten Störungen zu sehen. Manche Beziehungsmuster treten nur möglicherweise gehäufter bei einzelnen Störungsbildern auf als andere.
Aus systemischer Sicht können sich sowohl soziale, wie auch psychische oder somatische Auffälligkeiten auf mehreren Systemebenen abspielen — werden diese Ebenen gemeinsam betrachtet, wird dies als „biopsychosoziales Krankheitsverständnis“ (Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.17) definiert. Dieses Verständnis entsteht durch die Annahme dreier Systemebenen: Die biologische, die psychische und die soziale Ebene. Die biologische Systemebene wird auch als das „gelebte Leben“ (Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.16) bezeichnet, da Interaktionen von Genen, Hormonen etc. als „krankhaft“ (ebd.) diagnostiziert werden können. Das „erlebte Leben“ (ebd.), das sich auf psychischer
Ebene abspielt, lässt einen Menschen sich durch Gedanken und Gefühle krank fühlen, d.h. das Selbsterleben krank zu sein, basiert auf der Interaktion verschiedener und manchmal auch widersprüchlicher Gefühle und Gedanken. Die dritte Ebene ist die soziale Ebene, in der nur ausschnitthaft die beiden vorherigen Ebenen eine Rolle spielen, denn es ist auch die Ebene des „erzählten Lebens“ (ebd.), und die Interaktion basiert auf Kommunikation, also all dem, was ein Gegenüber feststellen kann. Dabei ist diese Ebene immer bestimmt durch das, was der Mensch bereit ist, mitzuteilen oder unbewusst durch Mimik und Gestik mitteilt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Biopsychosoziales Krankheitsverständnis (Ruf 2005, S. 19 nach Retzer 2003, S.749)
Luhmann beschreibt diese drei Systemebenen als „operational geschlossen“ (Luhmann 1984, zitiert nach Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.16) und meint damit, dass sie nur die in ihnen ablaufenden Vorgänge mit ihren eigenen Operationen ausführen können und so zum einen nicht von außen steuerbar sind und zum anderen auch nur kleine Teile der in den anderen Systemen ablaufenden Prozesse als wichtig erkannt und verarbeitet werden können. Diese Systemebenen können gestört sein, was oft erst das „Ergebnis sozialer Aus - handlung“ (Schweitzer/von Schlippe 2007b, S.17) sein kann.
Teil dieser „sozialen Aushandlung“ stellen medizinische und psychiatrische Diagno - sen dar. Im Kontext von Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen sind Konstruktionen dieser Art besonders häufig. Sie lassen oftmals erst ein Problemsystem entstehen und tragen in großem Maße dazu bei, es aufrechtzuerhalten. Diagnosen werden sowohl zur Grundlage von Interventions- und Behandlungskonzepten als auch von Hilfeplänen. Diagnosen sind aus systemischer Sicht jedoch genauso mit Vorsicht zu genießen, wie auch die klassischen Krankheitskonzepte.
Anerkannte diagnostische Manuale (wie die ICD-10 und das DSM IV) setzen zwar mittlerweile an die Stelle des Krankheitsbegriffs den der Störung und die Logik der ICD-10 impliziert sogar eine Beziehungskomponente oder auch eine Beschreibungskomponente, denn: „Jemand ,stört’ und jemand fühlt sich ,gestört’“ (Schweitzer/v. Schlippe 2007a, S.24). Mit Blick auf die standardisierten Klassifikationssysteme der ICD (und auch des DSM) lässt sich also feststellen, dass dort mittlerweile versucht wird, die diagnostischen Kriterien von „unüberprüften und unüberprüfbaren Vorannahmen — und so auch von den Vorahnungen einer psychoanalytischen Neurosenlehre — zu reinigen“ (Stierlin 2001, S.261), dies jedoch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Denn eine solch standardisierte und operationalisierte Diagnostik setzt immer einen „von allen Benutzern der Leitfäden geteilten Kontext der Beobachtungen und der Beschreibung“ (ebd.) voraus, welcher aber nicht gegeben sein kann. Aber die bereits erstellten Klassifikationssysteme können auch für die systemische Arbeit hilfreich und nützlich sein, denn dort sind jahrelang gesammelte Erfahrungen und Beobachtungen zusammengetragen worden, die sicher mit einbezogen werden können. Deshalb ist eine strikte Abkopplung der systemischen Therapie von den klassischen medizinischen Diagnosemodellen, genauso wie eine radikale Abwendung von Krankheitskonzepten nicht sinnvoll (vgl. Stierlin 2001, S.263f).
4.2 Systemtherapeutische Grundhaltungen
Eine Grundlage systemtherapeutischer Arbeit ist eine neutrale Haltung. Neutralität ist eng verbunden mit dem Begriff der „Allparteilichkeit“, der die Fähigkeit beschreibt, für alle Familien- oder Systemmitglieder im gleichen Maße Partei ergreifen zu können. Es schließt die Fähigkeit mit ein, „die Verdienste jedes Familienmitgliedes (an)zuerkennen und sich mit beiden Seiten ambivalenter Beziehungen identifizieren zu können“ (Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.119). Neutralität ist eine Voraussetzung dafür, dass der systemische Therapeut oder Berater von allen Beteiligten als kompetent anerkannt und akzeptiert wird. Nur so ist es ihm möglich, nicht in bestehende Beziehungsmuster unhinterfragt einbezogen zu werden. Neutralität kann so auch als eine „wechselnde Parteilichkeit“ verstanden werden (vgl. Schwing/Fryszer 2007, S.86). Dies soll nicht bedeuten, dass der Beratende keine eigene Meinung haben darf; manchmal (wie bei Gewalt, sexuellem Missbrauch etc.) ist es sogar wichtig, die Meinung zu vertreten und nicht neutral der Tat gegenüberzustehen. Generell kann man zwischen verschiedenen Arten der Neutralität unterscheiden, deren Wahrung immer wieder überprüft werden sollte: Neutralität gegenüber Personen, Neutralität gegenüber den Problemen oder Symptomen, Neutralität gegenüber Ideen und Neutralität gegenüber dem Ergebnis (vgl. Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.120; Schwing/Fryszer 2007, S.86).
Neben einer neutralen Haltung des Therapeuten/Beraters kann in gewissen Situationen eine gute Portion Respektlosigkeit gegenüber Ideen nicht schaden. Irreverenz ist eine weitere Grundposition des systemischen Arbeitens und beschreibt die Flexibilität im Umgang mit Glaubenssätzen der systemischen Theorie (vgl. Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.122). Eckard Sperling, Pionier der psychoanalytischen Familientherapie, verdeutlicht diese Idee zum Beispiel mit der folgenden Aussage: „Ich glaube keiner Theorie, sondern ich benutze sie nur. Ich benutze von der Theorie jeweils das Teilstück, das mir hilft, (...) solange es mir hilft“ (Hosemann/Kriz/von Schlippe 1993, S.127). Eine solche Einstellung kann dabei helfen, innovativ und kreativ zu bleiben. Die Wahrung der Irreverenz sollte deshalb im therapeutischen Prozess immer wieder überprüft werden.
Zirkularität als Kernelement systemischer Theorie, wurde bereits im Kapitel „Kernfragen systemischer Therapie“ thematisiert und wird auch im Verlauf der Arbeit immer wieder auftauchen. Es sollte jedoch an dieser Stelle noch einmal das Verständnis von Zirkularität verdeutlicht werden. Zirkularität als Grundstock systemischer Theorie und Praxis meint erst einmal Kreisförmigkeit. Kreisförmiges, also zirkuläres, Denken versucht Verhaltensweisen, die in einem System auftauchen, als Regelkreise zu beschreiben. Die Eingebundenheit des Verhaltens in den Kreislaufprozess des Systems soll dadurch sichtbar werden. In der praktischen systemischen Arbeit sind es zunächst die zirkulären Hypothesen, die durch einzelne Ursache-Wirkungs-Hypothesen zusammengefügt werden (vgl. Schweitzer/von Schlippe 2007a, S.118). Das Prinzip von Ursache und Wirkung wird insoweit verworfen, dass Zirkularität in der Systemtheorie als Folge dieses Prinzips verstanden wird und auf die Ausgangsursache zurückführt. Sie kann dadurch verändert oder bestätigt werden (vgl. Mücke 2001, S.194ff).
Die Hypothesenbildung, wie auch die Prinzipien der Zirkularität oder der Neutralität, entstammen dem „Mailänder Modell“. Die Hypothese an sich ist eine vorläufige Annahme über komplexe Sachverhalte, die aufgrund der Hypothesenformulierung erklärt werden kann. Die vermuteten Zusammenhänge müssen daraufhin analysiert werden, wobei sich die Annahme entweder bestätigt oder als Irrtum erweist und damit zu verwerfen ist (vgl. Brockhaus 2001, S.233). Diese von der klassischen Theorie als Werkzeug genutzte Fragestellung wurde in der systemischen Therapie und Beratung umgedeutet und wird seither etwas anders verstanden.
[...]
[1] Schriftliche Versicherung 162
[2] Einsichtnahme in die Magisterarbeit 163
[3] Vgl. beispielsweise die Annahmen Latours (2010) oder die von Hardt und Negri (2001; 2004).
[4] Hier und im Folgenden wird die alte Rechtschreibung innerhalb direkter Zitate beibehalten.
[5] Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit.
[6] Einen Eindruck über die große Spannbreite systemischer Ansätze kann man sich beispielsweise gut bei Schweitzer/von Schlippe (2007a, S.24) verschaffen.
[7] Vgl. für eine ausführliche Einführung z.B. Walter und Peller (1994) oder Eberling und Hargens (1996).
[8] Vgl. hierzu Kapitel 4.1.2 der vorliegenden Arbeit.
[9] Vgl. Haken (1984).
[10] Vgl. Gleick (1990) oder Kriz (1992).
[11] Vgl. Hoffmann (1987) oder Schiepek (1991).
- Arbeit zitieren
- Katharina Lioba Kurzmann (Autor:in), 2010, Systemisches Arbeiten in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160403
Kostenlos Autor werden




















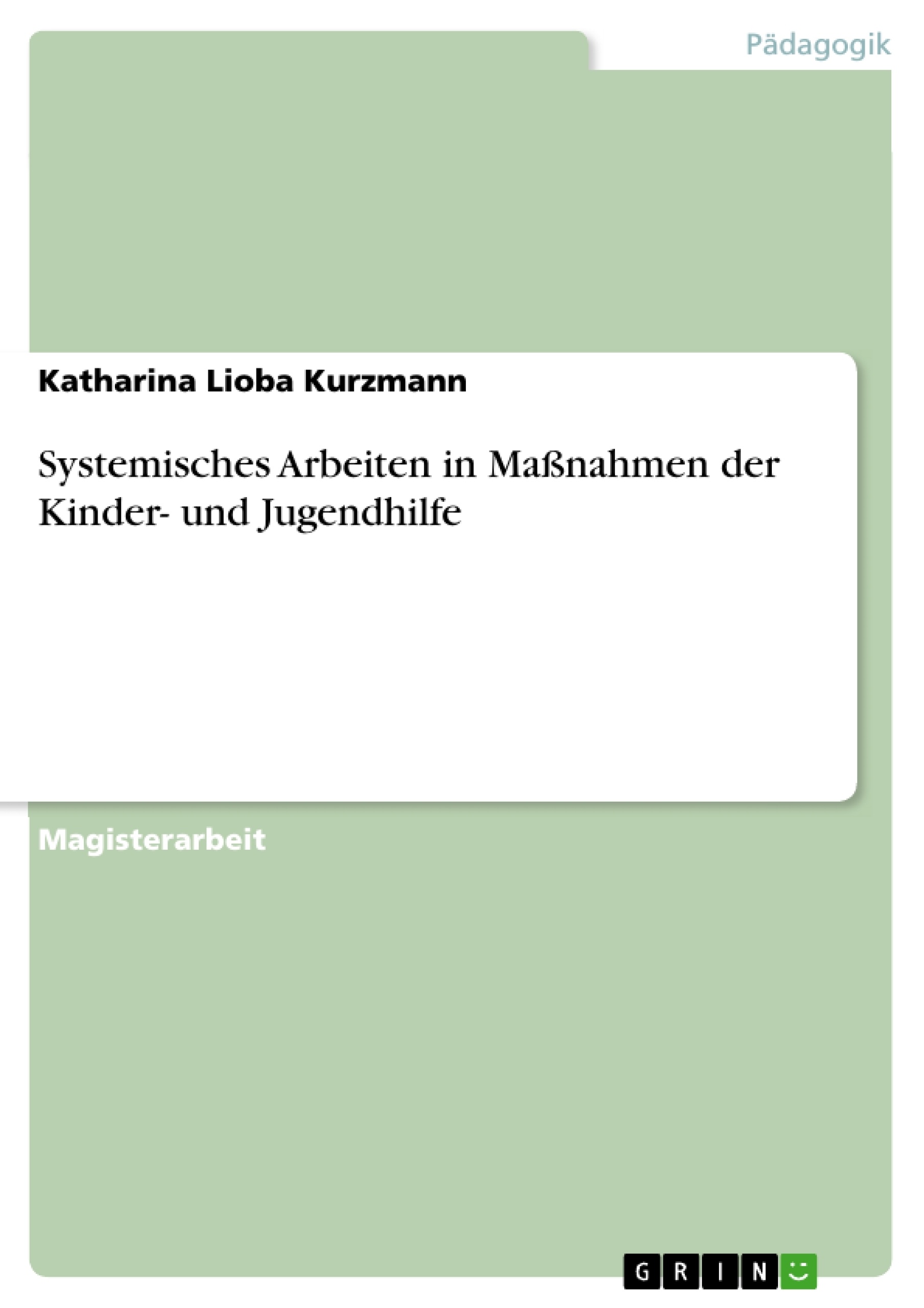

Kommentare