Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Kind und seine Medien
2.1 Das Kind und seine Kindheit
2.2 Medien für Kinder
2.2.1 Auditive Medien
2.2.2 Audiovisuelle Medien
2.2.3 Printmedien
2.3 Zeitschriften für Kinder
2.3.1 Der Begriff Zeitschrift
2.3.2 Zum Typ der Kinderzeitschrift
2.3.3 Historischer Rückblick
2.3.4 Die Situation heute
2.4 Exkurs: Qualität im Journalismus
2.5 Zusammenfassung
3. Der Markt der Kinderwissensmagazine
3.1 Definition
3.2 Marktübersicht
3.3 Porträts
3.3.1 Geolino
3.3.2 National Geographic World
3.3.3 Frag doch mal die Maus
3.3.4 Löwenzahn
3.3.5 Willi wills wissen
3.3.6 Zusammenfassung
4. Methodisches Vorgehen
4.1 Die Inhaltsanalyse als Forschungsmethode
4.2 Die Inhaltsanalyse im Kontext
4.3 Die empirischen Kategorien
5. Auswertung der Ergebnisse
5.1 Allgemeine Ergebnisse
5.2 Themen
5.3 Zielgruppe
5.4 Qualität in Kinderwissensmagazinen
5.5 Themenaufbereitung
5.6 Illustrationen
6. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Tabelle 1: Freizeitaktivitäten deutscher Kinder
Tabelle 2: Gerätebesitz deutscher Kinder
Tabelle 3: Internetnutzer 2008/2006
Tabelle 4: Darstellungsformen
Tabelle 5: Themen
Tabelle 6: Satzlängen
Tabelle 7: Überschriftenformulierungen
Tabelle 8: Qualität der Überschriften
Tabelle 9: Qualität der Vorspanne
Tabelle 10: Fremdwörter
Tabelle 11: Jugendsprache
Tabelle 12: Themenaufarbeitung
Tabelle 13: Themenaufarbeitung großer Sachbeiträge
Tabelle 14: Themenaufarbeitung Meldungen
Tabelle 15: Aktualität der Texte
Tabelle 16: Art der Texte
Tabelle 17: Verteilung Illustration/Text
Tabelle 18: Titelblattillustration
Tabelle 19: Illustrationen
Tabelle 20: Bildmotive
Abbildung 1: Handlungsorte
Abbildung 2: Themenaufteilung
Abbildung 3: Beitragslänge
Abbildung 4: Beitragslänge großer Sachbeiträge
Abbildung 5: Textlänge
Abbildung 6: Textgestaltung
Abbildung 7: Synonyme/Redundanzen
Abbildung 8: Bildqualität
„Niemand ist wol dermassen hölzern und unbelebt/daß sich nicht ein natürlicher Trieb bei ihm finden sollte/allerhand zu wissen/und berichtet zu seyn dessen/was ihm vorhin nicht kund gewesen: wie dann Aristoteles/der weise Heide/redet: Alle Menschen verlangen etwas zu wissen und zu erfahren. Selbst die Kinder fragen nicht allein ihre
Eltern/Seugammen/Lehrmeister/ und wer mit ihnen zu schaffen hat/ mit lallendem Munde: Was ist diß? Was ist das?“
Kaspar Stieler, 1694.1
1. Einleitung
Kinder sind neugierig. Kinder wollen die Welt entdecken. Kinder wollen wissen.
Das hat Kaspar Stieler (1632 - 1707), einer der ersten Zeitungswissenschaftler und der Erste, der einen umfassenden Versuch einer Gesamtdarstellung des Phänomens Zeitung erstellte, schon 1694 erkannt. Und bis heute ist an der Faszination nichts verloren gegangen, wenn ein Kind etwas für sich bis dato Unbekanntes neu entdeckt und mit staunenden großen Augen verarbeitet. Der Unterschied zu damals ist allerdings: heute stehen Kindern völlig andere Möglichkeiten zur Verfügung, Wissen zu erlangen, als noch zu Zeiten Stielers. Neben der Schule bieten beispielsweise Universitäten so genannte „Kinder-Unis“ an oder Museen veranstalten spezielle Kindertage. Eine sehr große Rolle spielen aber die Medien im Leben der heutigen Kinder. Gerade das zwiespältig gesehene Fernsehen stellt eine sehr große Vermittlungsinstanz von Wissen dar. Schon in den frühen 1970er Jahren wird die erste Wissenssendung für Kinder ausgestrahlt: seit 1971 erklärt Die Sendung mit der Maus auf ARD die Phänomene der Welt und 1979 bringt das ZDF mit Löwenzahn ein ähnliches Konzept auf Sendung. Heute gibt es nahezu auf jedem Sender mindestens eine Wissenssendung, die sich entweder an Erwachsene oder Kinder richtet.
Auch der Zeitschriftenmarkt konzentriert sich immer mehr auf das Konzept „Wissen“. Damit ist nicht der Wissenschaftsjournalismus gemeint, der neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in Fachzeitschriften publiziert, sondern der Populäre Wissensjournalismus, der Wissensthemen interessant, anschaulich und spannend in Zeitschriften wie GEO mit seinen verschiedenen Ablegern, National Geographic oder Wunderwelt Wissen aufbereitet. Auch immer mehr allgemeine Publikumszeitschriften oder Zeitungen veröffentlichen Ableger mit Wissensthemen. Hier seien genannt: ZEIT Wissen oder Spiegel Wissen. SZ Wissen, das Wissensmagazin der Süddeutschen Zeitung, wurde im Mai 2009 eingestellt.
Nun ist dieser Populäre Wissensjournalismus auch im Bereich der Kinderzeitschriften angekommen. Dieser hat einen sehr ausgeprägten historischen, aber auch sehr unübersichtlichen Hintergrund. Kinderzeitschriftentitel sind seit jeher sehr zahlreich auf dem Markt und niemand kann genau sagen, wie viele Titel eigentlich existieren. Auch scheint es, subjektiv betrachtet, dass die Qualität von Kinderzeitschriften, oft nicht hochwertig ist und Kinder nur mit minderwertigen Geschenken und grellen Aufmachungen zum Kauf geködert werden. Aus diesem Einheitsbrei stechen Magazine, die sich als Wissensmagazine für Kinder titulieren, besorgten Eltern, die um das intellektuelle Wohl ihrer Zöglinge besorgt sind, besonders ins Auge. Denn Magazine wie GEOlino und National Geographic World stehen, so scheint es, dem Magazinjournalismus für Erwachsene in nichts mehr nach.
Gerade weil Wissensjournalismus für Kinder und Erwachsene in den letzten Jahren so populär geworden und die Printforschung im Bereich Kinderzeitschriften im Gegensatz zu Kinderfernsehen und Internet vergleichsweise gering beschrieben ist, hat sich diese Arbeit zur Aufgabe gemacht, so genannte Kinderwissensmagazine genauer zu untersuchen. Dabei liefert sie eine Bestandsaufnahme der Kinderwissensmagazine auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt sowie eine Inhaltsanalyse, die die Titel GEOlino, National Geographic World, Frag doch mal die Maus und Löwenzahn auf ihre Themen, auf ihre Zielgruppenzugehörigkeit sowie auf ihre Qualität hin untersucht. Zum besseren Verständnis werden aber zuvor die Begriffe Kind und Kindheit definiert, einen Überblick über alle Kindermedien geschaffen sowie speziell auf die Kinderzeitschrift eingegangen. Dort wird der Begriff Zeitschrift allgemein, sowie der Begriff Kinderzeitschrift definiert. Einen Überblick über die Geschichte der Kinderzeitschrift geben der historische Rückblick sowie der heutige Stand. Um die Qualität im Journalismus genauer zu erklären, wird ein kurzer Exkurs dorthin unternommen.
Da, wie schon erwähnt, die Forschungsarbeit im Bereich Kinderzeitschriften erhebliche Defizite aufweist, wird diese Diplomarbeit hoffentlich helfen, die Lücke in diesem Gebiet zu verkleinern.
2. Das Kind und seine Medien
In diesem Kapitel wird zunächst einer der beiden Hauptbegriffe dieser Diplomarbeit dargestellt: das Kind. Dabei wird die Beschreibung des Unterschiedes zwischen dem Kind und der Lebensphase der Kindheit nicht vernachlässigt. Anschließend folgt eine Darstellung verschiedener Kindermedien. Hierzu werden auditive, audiovisuelle und Printmedien unterteilt. Bei den auditiven Medien, also den reinen Hörmedien, werden der Hörfunk und die Tonträger in den Mittelpunkt gestellt. Bei den audiovisuellen Medien, also Medien, die man gleichzeitig hören und sehen kann, werden das Kinderfernsehen, der Kinderfilm und das Internet thematisiert. Im Abschnitt Printmedien werden Zeitschriften bewusst nicht behandelt, da für dieses Thema ein separater Abschnitt folgt. Vielmehr werden hier Kindercomics und bewusst die Tätigkeit Lesen an sich thematisiert. Kinderzeitungen werden in diese Diplomarbeit nicht miteinbezogen, da es den Rahmen sprengen würde, und da Zeitungen noch keine besondere Rolle im Leben von Kindern spielen. Außerdem werden Versuche, in denen Kinder als Nachwuchsleser gewonnen werden sollen, erst seit den letzten Jahren im Rahmen von Projekten an Schulen unternommen und stecken deshalb noch in den Anfängen. Hierzu würde sich eine wissenschaftliche Arbeit lohnen, die sich explizit diesem Thema widmet.
Im Abschnitt Zeitschriften für Kinder wird zu Beginn die Zeitschrift allgemein beschrieben und anschließend speziell die Kinderzeitschrift. Ihre Geschichte wird im Abschnitt 2.3.3 und die heutige Situation in Abschnitt 2.3.4 kurz dargelegt. Um auf die Wichtigkeit von journalistischer Qualität auch im Kinderjournalismus aufmerksam zu machen, wird im Abschnitt 2.4 ein kurzer Überriss zum Thema Qualität im Journalismus wieder gegeben bevor die Zusammenfassung des Kapitels folgt.
2.1 Das Kind und seine Kindheit
Um überhaupt mit einer Analyse und einer Bestandsaufnahme von Kinderzeitschriften beginnen zu können, müssen erst wichtige Aspekte dieser Arbeit geklärt werden: das Kind und die Kindheit. Diese beiden Begriffe müssen deutlich differenziert werden, denn die Frage nach Kindheit ist eine sozialisationstheoretische Frage - die, nach der Entwicklung des Kindes fällt in die psychische und physische Dimension (vgl. Baacke 1984, S. 113f.). Am 31.12.2007 gibt es nach Angaben des statistischen Bundesamtes 10,5 Millionen Kinder zwischen null und 14 Jahren in Deutschland. Das sind etwa 13 Prozent der
Gesamtbevölkerung (vgl. www.destatis.de ). Dieser Anteil wird allerdings immer geringer, da die Geburtenrate sinkt und die Lebensphase der Kindheit stets kürzer wird, weil Kinder immer früher in die Pubertät kommen. Heute beträgt das Durchschnittsalter bei Eintreten in die Pubertät bei 11,5 Jahren - im Jahr 1800 liegt dieses Alter bei etwa 16 Jahren (vgl. Andresen/Hurrelmann 2007, S.37).
Über die Phasen der Kindheit ist sich die Literatur oft nicht einig. Die Altersgruppen sind nur eine ungefähre Markierung, da Kinder in ihrer Entwicklung unterschiedlich sind. Einige Wissenschaftler typisieren sechs- bis achtjährige, neun- bis elfjährige und die über zwölfjährigen, andere Vertreter der Entwicklungsforschung fassen das Alter zwischen neun und zwölf als die Mitte der Kindheit zusammen.
Für Waterstradt ist die Kindheit die Phase zwischen Geburt und Eintritt der Geschlechtsreife - unterteilt in die Stadien Neugeborenes, Säugling, Kleinkind und Schulkind. Während der Kindheit, deren meist entwicklungsförderndes Phänomen das Spiel ist, müssen Kinder bestimmte Aufgaben bewältigen, sind aber von der Verantwortung der Erwachsenenwelt befreit (vgl. Waterstradt 2007, S. 23f.).
Baacke typologisiert die Phasen der Kindheit in die frühe Kindheit, die von Geburt bis zum Alter von fünf Jahren dauert, und die Kindheit von sechs bis zwölf Jahren. Die Kindheit unterscheidet sich für ihn von der Jugendlichkeit, beginnend mit 13 Jahren, durch die Entfernung zur Erwachsenenwelt und sie stellt eine Phase der Beruhigung von der frühen Kindheit und eine Vorbereitung auf die Jugend dar (vgl. Baacke 1984, S.41ff.). „Eine in den Altersabgrenzungen offene, in sich dynamische, wandlungs- und perspektivenreiche Altersphase, deren Bestimmungsmomente in der wissenschaftlichen Debatte unklar bzw. strittig sind, die aber durch eine Tendenz nach Gegenwärtigkeit und Intensität gekennzeichnet ist, die unverletzt zu halten, Aufgabe pädagogischer Bemühung sein sollte“ (Baacke 1984, S. 48f.).
Die Entwicklung der Kindheit ist ein historischer Prozess in der Gesellschaft, der zeigt, dass Kindheit nicht immer gleich Kindheit ist. Bis Ende des Mittelalters existiert die Phase der Kindheit schlichtweg nicht, da Kinder in dieser Zeit wie kleine Erwachsene behandelt werden. Es gibt keine Vorstellung darüber, dass Kinder besondere Bedürfnisse haben könnten. Erst ab dem 18. Jahrhundert ändert sich das Verständnis und Kinder werden als Individuen wahrgenommen. Die Erziehung wird als wichtiges Instrument für die Entwicklung der Kinder erkannt und Erziehungsanstalten werden eingerichtet sowie die Schulpflicht eingeführt. Die Kindheitsphase wird nun als die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben angesehen. Weitere historische Schritte, die die Phase der Kindheit im Verständnis der
Menschen manifestierten, ist ein preußisches Gesetz von 1891, das die Kinderarbeit in Fabriken für Kinder unter 13 Jahren verbietet sowie die Entwicklung der Pädagogik als Wissenschaft im 20. Jahrhundert (vgl. Baacke 1984, S. 50 ff.; Andresen/Hurrelmann 2007, S. 37 ff.; Kommerell 2008, S.33; Lenzen 1989, S.845 ).2
Ein anderes Paradigma unterteilt die Geschichte der Kindheit in fünf Phasen: die Phase des Kindsmordes (Antike bis 4. Jahrhundert nach Christus), in dem sich die Eltern von ihren Ängsten bezüglich der Fürsorge befreien, indem sie das Kind umbringen; die Phase der Weggabe (4. bis 13. Jahrhundert); die Phase der Ambivalenz (14. bis 17. Jahrhundert), in der die Eltern erkennen, dass das Kind schutzbedürftig ist, aber auch geistig und moralisch geformt werden muss; die Phase der Intrusion (18. Jahrhundert) beziehungsweise der Erziehung; die Phase der Sozialistation (19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts), bei der es nicht mehr um die Unterwerfung des Kindeswillens geht, sondern darum, es im gesellschaftlichen Rahmen lebensfähig zu machen und zuletzt die Phase der Unterstützung (ab Mitte des 20. Jahrhunderts), die man auch die Phase der antiautoritären Erziehung nennt (vgl. Baacke 1984, S. 58ff.).3
Heute ist Kindheit eine Vorbereitungszeit auf das Leben, dessen Formen weitgehend vergesellschaftet sind. Kinder wachsen in einer Kommunikationsgesellschaft auf und sind regelrechte Medienkinder (vgl. Baacke 1984, S. 68ff; Baacke 1997, S. 63; Kübler 2002, S. 19; Charlton/Neumann 1992, S. 15; Paus-Haase/Höltershinken/Tietze 1990, S. 27), bei welchen die Gefahr besteht, dass die Kindheit, will man dem Medienkritiker Neil Postman glauben, durch das Fernsehen komplett verschwinden wird (vgl. Postman 1983).
Und so hat sich die heutige Medienpädagogik zum obersten Ziel gemacht, die Bildung von Medienkompetenzen zu fördern - also lehren, die Medien souverän zu bedienen, kritisch zu beurteilen und kreativ zu gestalten (vgl. Kübler 1985, S.295ff.; PausHaase/Höltershinken/Tietze 1990, S.32; Hugger 2008, S. 93).4
Es ist nun festzuhalten, dass die Kindheit eine Lebensphase ist und Kinder „Menschen, deren Wissen und Erfahrungsschatz, deren kognitive und emotionale Entwicklung, deren soziale Identität und deren Medienkompetenz erst am Anfang des Lebensprozesses stehen“ (Kommerell 2008, S.11).
2.2 Medien für Kinder
Medien für Kinder sind all die Medien, die für Kinder von Erwachsenen aus pädagogischen, fürsorglichen oder kommerziellen Motiven produziert und verkauft werden. Dazu gehören
Kinderzeitschriften, Kindercomics, Kinderbücher, Kinderzeitungen, Kinderfilme, Kinderfernsehen, Kinderfunk, Kindertonträger, Computer- und Videospiele für Kinder sowie Internetangebote, die sich speziell an Kinder richten. Überblickt man die Kindermedien, was bei der Fülle und Vielfalt des Angebots kaum noch gelingt, fallen einige Besonderheiten auf: Kindermedien sind mit einer Kontinuität beziehungsweise einer begrenzten Variabilität von Themen, Stoffen, Geschichten und Figuren ausgestattet. Das lässt sich dadurch erklären, dass sich das kindliche Publikum immer wieder erneuert und somit jeder neuen Generation die schon bewährten Stoffe immer wieder angeboten werden können (vgl. Kübler 2002, S. 20). Diese Wiederholung ändert aber nichts daran, dass Kinder seit jeher ihre Medien, sowie auch die Erwachsenen, zur Befriedigung von Wünschen, Interessen und Bedürfnissen nutzen und eine Art Belohnung von der Nutzung erwarten. Diese Theorie wird „Uses-and-Gratifications- Ansatz“ genannt. Kinder suchen in Medien nach ihren Helden und Vorbildern, sie wollen etwas über die Welt lernen und sich Neues aneignen, um die Welt zu verstehen und zu strukturieren (vgl. Dammler 2007, S.16).
Ein treffendes Beispiel dafür, wie Kinder ihre Medien nutzen zeigt eine qualitative Studie von Götz. Sie hat Kinder zu ihren Tagträumen befragt. Das Resultat: Medien verhindern das Erschaffen von kindlichen Fantasiewelten nicht, sondern geben im Gegenteil Anregungen dafür, eigene aufzubauen. Kinder nutzen Medientexte auf kreative Weise, indem sie herausgebrochene Medienelemente dauerhaft für die Inszenierung ihrer Handlungswünsche nutzen (vgl. Lemish/Götz 2006, S. 161).
Damit Kinder auch die für sie richtigen Medien nutzen können, liegt eine sehr hohe Verantwortung in den Händen der Kindermedienschaffenden. Journalisten von Kindermedien müssen ausreichend Kenntnis ihrer Zielgruppe besitzen, müssen deren kognitiven, emotionalen Voraussetzung und ihr Medienverhalten genauestens kennen, da sie eine bildende und erzieherische Aufgabe sowie medienpädagogische Funktion erfüllen. Sie müssen für die Rezipienten Zugänge öffnen und vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten in deren Alltag bieten (vgl. Kommerell 2008, S. 16f.), da Kindermedien, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden, heutzutage alltägliche Konsum- und Gebrauchsgegenstände für Kinder sind, an die sie sich von klein auf gewöhnen und vor denen sie nicht bewahrt werden können, indem man sie ihnen komplett vorenthält (vgl. Kübler 1985, S. 291).
2.2.1 Auditive Medien
Das Wort auditiv kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „das Gehör betreffend“ (DUDEN 1983, S.47). Das Ohr ist vor der Geburt das erste Sinnesorgan, das sich beim Embryo im Mutterleib nach etwa drei Wochen zu entwickeln beginnt. Das Kind nimmt also schon lange vor seiner Geburt Geräusche wahr und somit ist die Hörfähigkeit nicht nur für die kognitive, sondern für die ganzheitliche Entwicklung der Kindern von großer Bedeutung (Heidtmann 2004, S.37f.).
Auditive Medien für Kinder sind Medien, die mit dem Sinnesorgan Ohr rezipiert werden und bei welchen aufseiten des Senders wie auch aufseiten des Empfängers ein technisches Mittel erforderlich ist, weshalb sie auch tertiäre Medien heißen5 (vgl. Pürer 2003, S. 64). Über einen auditiven Kanal nehmen Rezipienten gesprochene Sprache wahr, wobei „paraverbale Komponenten wie Stimmvariation, Sprechgeschwindigkeit und Sprechrhythmus sowie extralinguistische Elemente (wie Lachen, Weinen, Husten, Rülpsen, Gähnen etc.) zugleich mit wahrgenommen werden“ (Pürer 2003, S.65). Auditive Medien sind somit unter anderem der Hörfunk, Tonträger wie CDs, Kassetten, Langspielplatten oder MP3-Player auf welchen Musik, Hörbücher, Hörspiele, Sprechbeiträge oder Moderationen rezipiert werden können.
Hörfunk
„Bis in die 1960er Jahre hinein hatten Hörfunkprogramme für Kinder überzeugende Qualitäten, sie waren zentrale Vermittlungsinstanzen für Kunst, Bildung und Unterhaltung“ (Heidtmann 2004, S. 41). Heute fungiert das Radio bei den meisten Mediennutzern nur noch als Nebenbeimedium.
Jüngere Kinder hören zunächst einmal in der Familie auf funktionale Weise die öffentlich- rechtlichen oder privaten Hörfunkwellen - meist Magazin- oder Musiksendungen - der Eltern mit. Die kindlichen Hörweisen werden zwischen oberflächlichem Hören und aufmerksamen Hören unterschieden. Oberflächlich hören Kinder bei Erwachsenenformate wie Nachrichten, Verkehrsfunk oder Wetterbericht. Aufmerksam werden sie bei verständlichen und lustigen Moderationen, Sketchen, Witzen, Hörspielen oder Magazinen für Kinder. Musikalische Präferenzen sind kurze, schnelle und rhythmische Musikstücke, Chart- Musik, Kinderlieder, Musikstücke mit verständlichen witzigen Texten oder Musikstücke, die in Verbindung mit interessanten Informationen, Erzählungen und Mitmachaktionen präsentiert werden. Kinder nutzen das Radio also vor allem als Stimmungsmacher- und Musikmedium (vgl. Schill 2004, S. 13f.).
Aufmerksames Hören der Kinder ist garantiert bei einem speziellen Kinderhörfunkprogramm, welches in den meisten Bundesländern von den öffentlich-rechtlichen Sendern bestimmt wird. Zwar ist das Programmvolumen teilweise geringer als das der privaten Sender, es wird jedoch regelmäßig und mit einer großen technischen Reichweite ausgestrahlt - im Gegensatz zu den privaten Anbietern. Breiter an Kinderprogrammen ist das Angebot in den Ländern, in denen alternative Anbieter wie offenen Kanäle und Bürgerfunkfenster stark vertreten sind. Allerdings werden diese Programme oft im Rahmen von Radiowerkstätten mit Kinderbeteiligung produziert, bei denen die professionelle Qualität zugunsten pädagogischer Ziele in den Hintergrund rückt. Als Beispiel für Qualität im Kinderhörfunkprogramm steht dagegen dir preisgekrönte Produktion „OHRENBÄR - Radiogeschichten für kleine Leute“, die seit dem 1. Oktober 1987 jeden Abend auf radioBERLIN, WDR 5, NDR Info zehn Minuten auf Sendung ist (vgl. Paus-Haase/Aufenanger/Mattusch 2000, S.163f; www.ohrenbaer.de).
Weitere spezielle Hörfunkprogramme für Kinder sind unter anderem Radio Mikro auf Bayern2Radio oder Radio Kakadu auf DeutschlandRadio Kultur. Heidtmann kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Kinderprogramme oft an zeitlich ungünstigen Sendeplätzen und in dritten oder vierten Programmen liegen, „die manchmal so kulturträchtig und elitär wirken, dass Kinder und Jugendliche sie nicht einschalten“ (Heidtmann 2004, S. 40). Es kennen auch nur sehr wenige Kinder (fünf Prozent) überhaupt die speziellen Kindersendungen des Hörfunks, und wenn sie sie kennen und nutzen, haben sie diese für gewöhnlich nicht selbst entdeckt, sondern sind gezielt auf sie aufmerksam gemacht worden, sei es in der Familie, im Kindergarten oder in der Grundschule. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Hörfunknutzungsstudie aus dem Jahr 2000, deren weitere Resultate sind, dass in erster Linie ältere Kinder sowie vor allem Mädchen Radio hören, dass die kindlichen Radionutzungshöhepunkte an den Vormittagen und Abenden der Wochenenden liegen, dass sehbehinderte Kinder gezielter Radio hören und dass aus Sicht der Eltern das Radio nur bei sieben Prozent der Kinder Lieblingsmedium ist - das Fernsehen dagegen bei 29 Prozent (vgl. Paus-Haase/Aufenanger/Mattusch 2000, S. 165ff.).
Die KIM-Studie6 prognostiziert eine rückläufige Radionutzung durch Kinder. Hörten 25 Prozent der sechs bis 13jährigen im Jahr 2006 noch täglich Radio, so waren es im Jahr 2008 nur noch 19 Prozent. Ebenso wird hier die Funktion des Radios als „Nebenbeimedium“ unterstrichen: 60 Prozent der Kinder hören das, was die anderen gerade hören, nur 38 Prozent wählen das Programm selbst aus (vgl. KIM-Studie 2008, S. 19).
Außerdem hat Radio keine gemeinschaftliche Funktion mehr. Radiohören ist „zu einer beliebten, zumeist nicht mehr reflektierten Gewohnheit geworden. Somit kommt dem Radio keine besondere kommunikative Funktion zu: Kinder nutzen es eher selten gemeinsam mit anderen Kindern; Radioangebote dienen kaum als Gesprächsthema.“ (Paus- Haase/Aufenanger/Mattusch 2000, S. 166f.).
Allerding lassen Kinder und Eltern deutlich erkennen, dass das Radio zwar im Leben von Kindern keine so große Rolle spielt, wie manches andere Medium, dass es aber bei Kindern nicht nur zum Alltag dazugehört, sondern dass sie klare Erwartungen an das Medium richten. Über zwei Drittel aller Kinder wünscht sich ein eigenes Kinderradio mit Vollprogramm in Anlehnung an den Kinderfernsehkanal von ARD/ZDF - sozusagen ein „KI.KA für die Ohren.“ (vgl. Paus-Haase/Aufenanger/Mattusch 2000, S. 104 u. 167).
Ein solches Kindervollprogramm im Hörfunk wird auch von vielen Kommunikationswissenschaftlern und Medienpädagogen gefordert, damit Kinder zum bewussten Zuhören herausgefordert werden, da kindliches Radiohören eine besondere Form der Medienaneignung ist, bei der sie sich zum einen Gehörtes „durch Imaginieren, Entziffern, ästhetisches Genießen und Verstehen innerlich erschließen müssen“. Zum anderen wird vermutet, dass sich in diesem Kontext die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern positiv entwickeln (vgl. Schill 2004, S. 14; Heidtmann 2004, S. 39f).
Ein eigenes Kinderradiovollprogramm wäre auch wichtig, „[d]a unter Kindern eine Vielfalt unterschiedlicher Radionutzungstypen existiert, [deshalb] kann ein Angebot für Kinder nicht eindimensional strukturiert sein, sondern muss in seinen verschiedenen Segmenten die differierenden Medienhandlungsweisen des jungen Publikums berücksichtigen. Ein differenziertes Programm aber ließe sich nur sehr schwer im vom Formatradio geprägten Standardprogramm der Sender realisieren. Nur ein eigenes Kinderradio wäre wirklich geeignet, die vielfältigen Wünsche der jungen Hörer und Hörerinnen so zu erfüllen, dass Radio ihnen Spaß macht und ihnen beim Erwachsenenwerden, beim Informieren und Orientieren in der Welt erfolgreich helfen kann.“ (Paus-Hasebrink 2004, S. 34).
Tonträger
Tonträger wie Hör- und Musikkassetten beziehungsweise CDs sind eigentlichen die ersten wahren Kindermedien. Über sie können Kinder als erste selbst verfügen, da für die Nutzung keine Lesefähigkeit benötigt wird und auch während der Nutzung keine Kontrolle der Eltern stattfindet - im Gegensatz zum Fernsehen - , da Tonträger im Regelfall vor dem eigentlichen Rezipieren von den Eltern beim Kauf überprüft beziehungsweise kontrolliert werden. Tonträger für Kinder haben nach den Kinderprintmedien die längste Tradition.
Schon im Jahr 1887 gibt Thomas Alva Edisons (1847-1931) Phonograph das Kinderlied „Mary had a little lamp“ wieder. Einige Jahre später, im Jahr 1900, präsentiert die Firma auf der Pariser Weltausstellung eine sprechende Puppe, in die ein Phonograph eingebaut ist. 1929 erscheinen erste Schallplattenkonzerte für Kinder mit Märchen nach den Gebrüdern Grimm. Da damalige Schellackplatten aber nur eine Länge von zweieinhalb Minuten haben, müssen die Märchen gekürzt werden und die Interpreten sehr schnell sprechen. In der NS-Zeit waren anschließend nur noch völkische Märchen auf Platte erlaubt. Nach dem zweiten Weltkrieg startet die Produktion von Kinderschallplatten erst wieder ab 1958. Bis Ender der 60er Jahre bleibt der Markt aber sehr klein, denn die Abspielgeräte sind sehr teuer - bis 1968 der erste Kassettenrecorder auf dem deutschen Markt erscheint. Da die Geräte leichter und billiger sind als Schallplattenspieler, lösen sie einen regelrechten Boom auf dem Kinderkassettenmarkt aus, der bis zum Ende der 1980er Jahre anhält. Insbesondere die seit 1978 erscheinenden Abenteuer von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg der Autorin Elfie Donnelly (geb. 1950) sind seit jeher bei Kindern sehr beliebt. Bis heute sind von dem sprechenden Elefanten 90 Folgen mit über 50 Millionen verkauften Kassetten erschienen und von der kleinen Hexe 70 Folgen. Hinzu kommen 35 Folgen von „Bibi und Tina“ - eine Weiterführung von Bibi Blocksberg, in der sie mit ihrer Freundin Tina Abenteuer auf einem Reiterhof erlebt. Mitte der 1990er sind etwa 4000 Titel verschiedenster Kinderhörspiele auf dem deutschen Markt. Ab diesem Zeitpunkt bricht ein Großteil der Vermarktung von Fernsehserien, die im Medienverbund auch auf Hörspielkassette erscheinen, weg und werden durch Video- und PC- Spiele ersetzt.
Mit höherem Alter lassen sich fast nur noch Mädchen für Hörspiele oder für Lesungen bekannter Kinderbücher begeistern. Gerade aber mit diesen klassischen Formen ist es den Marktführern inzwischen wieder gelungen, den Kindertonträgermarkt zu stabilisieren, womit er es dem inzwischen sehr erfolgreichen Markt der Erwachsenenhörbücher nachahmt. Hinzu bemühen sich viele künstlerisch und pädagogisch ambitionierte Verlage um wenig attraktive, aber profilierte Marktnischen und bieten Kinderlieder sowie zeitgenössische Jazz- und Popmusik für Kinder an. Recht selten geworden sind aufwendige Hörspiele, die allenfalls noch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten produzieren (vgl. Kübler 2002, S. 99ff.). Laut der KIM-Studie 2008 sind Hörspiele nur für 50 Prozent der Kinder eine Freizeitoption. 37 Prozent hören ein oder mehrmals pro Woche Hörspiele, zwölf Prozent jeden Tag. Im Vergleich dazu: fast 100 Prozent der Kinder schauen mindestens einmal pro Woche fern (vgl. KIM-Studie 2008, S.9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Freizeitaktivitäten deutscher Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
Abspielgeräte für Hörspiele und Musik sind CD-Player, Kassettenrecorder und MP3-Player. Mehr als die Hälfte der Kinder haben einen eigenen CD-Player und Kassettenrecorder. Einen MP3-Player besitzen mehr als ein Drittel der Kinder. Allerdings haben im Vergleich zur KIM-Studie 2006 vor allem MP3-Player deutlich mehr Verbreitung gefunden. Herkömmliche Abspielgeräte wie CD-Player, Kassettenrecorder oder auch Radiogeräte sind dagegen rückläufig (vgl. KIM-Studie 2008, S. 8).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.2: Gerätebesitz deutscher Kinder
2.2.2 Audiovisuelle Medien
Das Wort audiovisuell kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet „zugleich hör- und sichtbar, Hören und Sehen ansprechend“ (DUDEN 1983, S. 47). Audiovisuelle Medien sind also Medien, die mit Ohren und Augen wahrgenommen werden und ebenfalls wie die auditiven Medien so genannte tertiäre Medien, da sowohl Produzent wie auch Rezipient technisches Gerät nutzen muss. Zu audiovisuellen Medien zählen die älteren Medien - also das Fernsehen und der Film, sowie die neuen Medien Internet und Computer. Hier ist darauf hinzuweisen, dass ein Computer Voraussetzung für die Nutzung des Internets ist.
Bei Kindern wird heute der Umgang mit neuen audiovisuellen Medien vorausgesetzt, denn in den letzten Jahrzehnten kann man einen grundlegenden Medienwandel in unserem Land in Form einer stetig steigenden Angebotsvielfalt, Medienvielfalt und Nutzungsdifferenzierung, diagnostizieren (vgl. Schweer/Lukaszewski 2006, S. 133ff.).
Kinderfernsehen
Zwar wurden schon ab 1939 eine Stunde am Sonntagnachmittag Kindersendungen im Fernsehen gesendet (vgl. Latz 2006, S.11), aber der eigentliche Startschuss für das deutsche Kinderfernsehen ist der 17. März 1953. Bis 1959 existiert der Fernseh-Kinderfunk mit Dr. Ilse Obrig. Kritiker bezeichnen es als „kindertümelndes, bewahrpädagogisch konzipiertes Programm, in dem dressierte Kleine nach dem Vorbild der im Hörfunk üblichen Funkkinder artig mitspielen“ (Heidtmann 1992, S. 77). Als 1957 das Kinoverbot für Kinder unter sechs Jahren eingeführt wird, beschließen die ARD-Verantwortlichen ein Jahr später, keine Sendungen mehr für Kinder unter sechs Jahren auszustrahlen. (vgl. Latz 2006, S. 11). Später beginnen die Sender, um mit geringem finanziellem Aufwand ein regelmäßiges Kinderprogramm senden zu können, amerikanische Abenteuerserien zu kaufen. Das Kinderprogramm ändert sich, als Gert K. Müntefering 1963 die Redaktion „Kinder“ beim WDR übernimmt. Das ZDF strahlt zwar seit 1963 Sendungen aus, beginnt aber erst 1966 mit einem täglichen Nachmittagsprogramm, das bis Anfang der 1980er Jahr keine Eigenproduktion für Kinder enthält, sondern überwiegend Kurzfilmimporte. Ende der 1960er Jahre werden neue Impulse zu gesellschaftlichen und bildungspoltischen Reformen gesucht. Fernsehredakteure diskutieren, wie weit sie mit ihren Programmen soziales Lernen fördern können und führen Sendungen wie die Sesamstraße oder die Sendung mit der Maus ein.
In den 1980er Jahren unterliegt das öffentlich-rechtliche Fernsehen einem Trend zur Ausgewogenheit, der zum Verzicht auf gesellschaftskritische Ambitionen in den Redaktionen und zu einer Zunahme unverbindlicher Unterhaltung führt. Ab Mitte der 1980er Jahre verlagert sich die Hauptfernsehzeit der Kinder auf den Vorabend zwischen 17.30 und 20.00 Uhr - eine Zeit, zu der kaum spezielles Kinderfernsehen ausgestrahlt wird. Auf den Fernsehhitlisten tauchen deshalb, oft aus den USA importierte, actionreiche Vorabendserien, wie Knight Rider oder A-Team auf. Solche Vorabendserien sind deshalb so beliebt, weil sie Übereinstimmungen mit Zeichentrick- und Kinderserien aufweisen: sie arbeiten mit kurzen Spannungsbögen und setzen in regelmäßigen Abständen Höhepunkte, um die Zuschauer zu binden. Sie erzählen chronologisch fortlaufend und in kleinen inhaltlichen Einheiten zergliedert, deren Reihenfolge beliebig ist. So kann der Zuschauer an jeder beliebigen Stelle einsteigen und auch kleiner Kinder verstehen den Handlungszusammenhang (vgl. Heidtmann 1992, S. 78ff.).
Anfang der 1990er Jahre stehen Kindern durchschnittlich 100 Stunden eines für sie konzipierten Programms zur Verfügung. Das ändert sich schlagartig als das Kindervollprogramm eingeführt wird. Mitte der 1990er Jahre erhöht sich das wöchentliche Kinderprogrammkontingent auf ca. 220 Stunden (heute sind es etwa 400 Stunden). Im Juli 1995 startet Nickelodeon als erster privater Kindersender mit einem Vollprogramm und den Prinzipien Gewaltfreiheit, Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen, Gewährleistung eines umfassenden Angebots von Information und Unterhaltung sowie die Integration von Kindern aller Kulturen. Nickelodeon existiert bis 1998 und geht ab 2005 unter dem Namen Nick wieder auf Sendung im deutschen Fernsehen. Ab 1. Januar 1997 gliedern ARD und ZDF ihr Kinderprogramm aus dem Hauptprogramm aus und verlagern es in den eigens konzipierten „Kinderkanal“, genannt KI.KA (vgl. Stötzel 1998, S. 56ff.).
Heute existiert sogar ein Kindervollprogramm für Babys. Baby TV ist ein Sender für Kinder von null bis drei Jahren und stammt ursprünglich aus Israel. Seit Dezember 2005 ist er auch in Deutschland im digitalen Netz empfangbar. Der Sender wird allerdings von vielen Medienpädagogen, wie beispielsweise Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI, als völlig kontraproduktiv kritisiert. Kleine Kinder sollten, so der Tenor, unter zwei Jahren eigentlich gar nicht fernsehen, da sie nicht unmittelbar zwischen dem realen Leben und der Fernsehwirklichkeit unterscheiden können (vgl. Nieswiodek-Martin 2006, S. 19ff.).
Aber nicht nur Baby TV wird von Pädagogen und Medienwissenschaftlern kritisiert. Auch die Gewalt im Fernsehen beziehungsweise im Kinderfernsehen steht oft im Rampenlicht der Medienwirkungsforschung. Nadine Kloos, Redakteurin bei FLIMMO, ein Projekt des Vereins Programmberatung für Eltern e.V. und durchgeführt von JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis: „Die Befürchtungen sind verbreitet, dass Kinder oder Jugendliche gewalttätiges Verhalten von Medienfiguren nachahmen und dass sie durch Gewalt in den Medien gegenüber Gewalt in der Realität abstumpfen. Keine dieser beiden Wirkungsvermutungen konnte bisher wissenschaftlich zweifelsfrei belegt werden. Nachgewiesen ist jedoch, dass Medien eine verstärkende Wirkung haben: Erleben Kinder und Jugendliche in der Realität Zwang und Gewalt als probates Mittel zur Durchsetzung von Interessen, können Medieninhalte mit der gleichen Aussagerichtung diese Modelle weiter verfestigen. Damit fördern sie nachhaltig ein problematisches Gewaltverständnis. Fühlen sich Kinder oder Jugendliche von gewalthaltigen Medieninhalten angezogen, sind die Gründe dafür auch in ihrer Realität zu finden“ (zit. nach: Nieswiodek-Martin 2006, S. 44).
Des Weiteren wird an Gewalthandlungen im Fernsehen kritisiert, dass Kindern oft ein vereinfachtes Weltbild vorgeführt wird: einerseits die Guten - andererseits die Bösen, gegen die das erfolgreichste Mittel die Gewalt ist und der Einsatz selbstverständlich erlaubt, so dass die Folgen von Gewalt heruntergespielt werden (vgl. Nieswiodek-Martin 2006, S. 45f.). Da das Fernsehen das meist erforschte Medium ist, sind neben der Gewalt aber auch die Bildungschancen mit Hilfe des Fernsehens früh in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt.
Mit der Einführung des Fernsehens kommt die Idee, die Bildungschancen aller Bevölkerungsschichten mithilfe der Massenmedien zu verbessern und auszugleichen. Dieses Vorhaben wird in Form der Wissensklufthypothese, die erstmals von Tichenor, Donohue und Olien an der Minnesota University 1970 formuliert wurde, kritisch hinterfragt. Die Hypothese sagt aus, dass Bevölkerungsschichten mit höherem Sozial- und Bildungsniveau Information schneller und effektiver aufnehmen können als Schichten mit vergleichsweise geringerem Bildungsniveau, so dass sich die Wissenskluft zwischen den sozialen Gruppen tendenziell vergrößert. Es entstehen mehrere Annahmen, die später von Forschern aufgenommen werden: der Wissensabstand zwischen Privilegierten und Unterprivilegierten nimmt permanent zu, der Zusammenhang zwischen Bildung und Wissen ist kausal (wenig Bildung führt zu wenig Wissen; viel Bildung zu viel Wissen), der mediale Informationsfluss in die sozialen Systeme bewirkt immer das Phänomen der Wissenskluft und die Wirkung der Botschaften ist in den jeweiligen Bildungssegmenten homogen (vgl. Pürer 2003, S. 369ff.; Bonfadelli 2008, S. 270ff.; Bonfadelli/Saxer 1986; Winterhoff-Spurk 1999).
1968 werden die amerikanische Sendung Sesame Street sowie andere Wissenssendungen für Kinder entwickelt, um die Bildungsdefizite bestimmter Gruppen in der amerikanischen Gesellschaft zu verringern. Begleitend dazu wird eine Studie im Sinne der Wissensklufthypothese erstellt. Das Ergebnis zeigt, dass Kinder aus Schichten mit geringer Bildung zwar in der erhofften Weise von den Programmen profitieren - allerdings geschieht dies auch bei Kindern aus der Mittel- und Oberschicht und hier - ganz entgegen der Absicht der Produzenten - in stärkerem Maße. Die Sendungen tragen also zur Vergrößerung der Bildungsdefizite bei. Auch in Deutschland wurde die Sesamstraße so erforscht und derselbe Effekt zeigt sich. Hintergrund hierfür ist, dass sich bildungsnahe Eltern mehr um die Fernsehgewohnheiten ihrer Kinder kümmern (vgl. Winterhoff-Spurk 1999, S. 19ff.).
Kinderfilm
Kinderfilme sind Filme, die sich in erster Linie an Kinder richten. Der Hauptunterschied zwischen Familienfilmen und Kinderfilmen liegt darin, dass nur Kinderfilme spezifisch kindliche Erfahrungen transportieren. In Deutschland wird die Kinderfilmproduktion von Beginn an vernachlässigt.
Die ersten Kinderfilme sind im eigentlichen keine Filme speziell für Kinder, sondern Adaptionen von Märchen- und Sagenstoffe, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen ansprechen sollen, wie beispielsweise der älteste deutsche Märchenfilm Rübezahls Hochzeit aus dem Jahr 1916. In der Weimarer Republik wird 1920 das Reichslichtspielgesetz erlassen, das Kindern unter sechs Jahren den Gang ins Kino untersagt. Aus diesem Grund entwickelt sich in dieser Ära keine spezielle Kinderfilmproduktion. Erst Ende der 1920er beginnen Regisseure wieder Spielfilme für Kinder zu produzieren. Allerdings werden Kinderfilme meist mit Märchenfilme gleichgesetzt und Märchen der Gebrüder Grimm werden pädagogisch überarbeitet. Der einzige richtige Kassenerfolg der damaligen Zeit ist gleichzeitig der erste Klassiker des deutschsprachigen Kinderfilms - Gerhard Lamprechts Verfilmung von Emil und die Detektive aus dem Jahr 1931, die sich eng an Kästners Buchvorlage hält, die Großstadtrealität mit kindgemäßem Abenteuer verbindet und sich an Erzählmitteln des Hollywoodkinos orientiert, gleichzeitig aber Kinder als Akteure und Zuschauer ernst nimmt.
In der Zeit des Nationalsozialismus entstehen zehn explizit propagandistische Kinder- bzw. Jugendfilme.
Nach dem zweiten Weltkrieg blüht die westdeutsche Kinderfilmindustrie in den frühen 1950er Jahren auf. Allein im Jahr 1955 entstehen elf Kinderfilme. Allerdings werden meist wieder nur Grimmsche Märchen verfilmt, manche sogar mehrmals. Allein von Frau Holle existieren 16 Kinoadaptionen, die zwischen den Jahren 1948 und 1961 entstehen.
Ab 1957 ist es Kindern unter sechs Jahren wiederum verboten in das Kino zu gehen und so erlahmt die deutsche Kinderfilmproduktion zwischen 1958 und 1972 erneut - in dieser Zeitspanne entstehen nur drei Kinderfilme. Auch die Fernsehkonkurrenz ist ein Grund dafür: Kinder interessieren sich nicht mehr so stark für das Kino, denn das neue Medium Fernsehen hat schon in fast allen Haushalten Einzug gehalten. Verfügen 1959 erst zehn Prozent aller deutschen Haushalte über ein Fernsehgerät, sind es 1975 schon 93 Prozent. Auch die Einführung eines Kinderfilmpreises durch das Bundesministerium für Jugend und Familie kann die Steigerung der Kinderfilmanzahl nicht bewirken. 1970 wird der Preis mangels auszeichnungswürdiger Produktionen abgeschafft.
1972 wird mit dem Film Tschetan der Indianerjunge des Filmemachers Hark Bohm, dessen Erfolge darin liegen, dass er Kinder ernst nimmt und mit den dramaturgischen Mitteln des Erwachsenenfilms inszeniert, die Ära des neuen deutschen Kinderfilms eingeleitet. Drei Jahre später findet die 1. Internationale Kinderfilmwoche in Frankfurt statt, die bis heute existiert, statt. Es folgen die Zusammenschließung engagierter Filmemacher und anderen Künstlern zum Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. und die Gründung des Kinder- und Jugendfilmzentrums in der Bundesrepublik Deutschland. Ab Mitte der 1990er Jahre entstehen durchschnittlich drei Kinderfilme pro Jahr. Trotz aller Bemühungen haben aber kommerzielle Filme aus den USA - meist Disney Produktionen - doch mehr Erfolg (vgl. Kübler 2002, S. 82ff.; Heidtmann 1992, S. 39ff.).
„Der politisch ambitionierte, teils auch künstlerisch anspruchsvolle Kinderfilm hat es trotz wohlwollender Kritiken und erster Achtungserfolge schwer, sich im Kino zu behaupten, sich gegen die Konkurrenz gängiger Unterhaltungsware durchzusetzen“ (Heidtmann 1992, S. 44).
Internet/Computer
Zwar liegt das Fernsehen, was die Mediennutzungsdauer der Kinder betrifft, heute noch eindeutig auf den vordersten Rängen, aber die Internetnutzung holt immer weiter auf. Im Jahr 2008 schauen sechs bis 13jährige Kinder täglich durchschnittlich 91 Minuten fern - vor dem Computer sitzen sie „nur“ 40 Minuten. Beim Gerätebesitz sieht es ähnlich aus: fast 100 Prozent der deutschen Haushalte besitzt mindestens einen Fernseher - 43 Prozent der Kinder verfügen über ein eigenes TV-Gerät. Dagegen haben 88 Prozent der Haushalte mindestens einen Computer und 15 Prozent der Kinder einen eigenen Computer. Der Internetzugang der Haushalte wächst seit den letzten zehn Jahren steil an. Mittlerweile sind 85 Prozent der Haushalte vernetzt und 76 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren nutzen das
Internet regelmäßig (vgl. KIM-Studie 2008).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3 Internet-Nutzer 2008/2006
In einer Studie fanden Forscher heraus, dass bei Kindern die Internetnutzung und informellentdeckendes Lernen meist zusammen fallen. Lernzuwächse bei der Internetnutzung waren bei dieser Untersuchung bei allen Kindern unabhängig vom Alter beobachtbar, wobei bei jüngeren Kindern das manuelle Üben durch das wiederholte Besuchen gleicher Internetseiten dominiert und bei älteren Kindern die Klärung von Fragen, die während ihrer Internetbesuche auftauchen (vgl. Feil/Decker/Giger 2004, S. 205 u. 209).
Um Kinder vor unsicheren Seiten im Internet zu schützen, gibt es mittlerweile zahlreich Projekte, die versuchen, Kindern in Sachen Internet Medienkompetenz zu vermitteln. Beispiele dafür sind die Seiten www.internet-abc.de oder www.klick-tipps.net. Erst genannte Internetseite wird vom Adolf-Grimme-Institut betrieben und von den Landesmedienanstalten unterstützt. Das Portal bietet Kindern von fünf bis 12 Jahren Webseiten, mit welchen sie sich gefahrlos mit dem Internet vertraut machen können. Klick-tipps ist ein gemeinsames Projekt des Medien Kompetenz Forum Südwest und Jugendschutz.net. Bei diesem Portal handelt es sich um einen wöchentlichen Besprechungsdienst für empfehlenswerte Kinderseiten im Internet. Medienpädagogen recherchieren nach aktuellen und attraktiven Inhalten für Kinder. Sie wählen gute Angebote aus und beschreiben diese kurz. Zusätzlich werden die ausgewählten Seiten von Kindern bewertet (vgl. www.klick-tipps.net; www.internet-abc.de).
2.2.3 Printmedien
Printmedien sind Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Comics, Flugblätter usw., die ausschließlich visuell durch das Lesen wahrgenommen werden und somit sekundäre Medien, da nur auf Produzentenseite technisches Gerät benötigt wird (vgl. Pürer 2003, S. 64). So wie heute von Medienkritikern oft die Fernseh- oder Computernutzung verteufelt wird, wird vor einigen hundert Jahren das Lesen von Printmedien kritisiert: „Das unmäßige und zwecklose Lesen macht zuvörderst fremd und gleichgültig gegen alles, was keine Beziehung auf Litteratur und Bücherideen hat; also auch gegen die gewöhnlichen Gegenstände und Auftritte des häuslichen Lebens; also auch gegen das frohe Gefühl der Kleinen um uns her (…). Hierzu gesellt sich nicht selten eine träge Unlust zu jedem anderen hausväterlichen oder hausmütterlichen Geschäfte (…). Hat man endlich gar durch öfters anhaltendes Stillsitzen, und durch einseitige Beschäftigung der Seelenkräfte bei unnatürlicher körperlicher Ruhe, erst vollends seine Säfte verdickt, seine Nerven geschwächt und zur Ungebühr reizbar gemacht: dann fahre wohl, häusliche Glückseligkeit!“ (Joachim Heinrich Campe 1785, zit. nach: Paus- Haase/Höltershinken/Tietze 1990, S. 13). Und auch Jean Jacque Rousseau bezeichnet Bücher zu seiner Zeit als Geisel der Kindheit (vgl. Moser 1995, S. 9).
Bücher, Zeitschriften und Comics sind vor der Zeitung die beliebtesten Lesemedien der Kinder (vgl. KIM-Studie 2008, S. 23). Aus diesem Grund möchte dieser Abschnitt das Thema Lesen, seine Bedeutung und Comics besonders hervorheben. Über Kinderzeitschriften folgt ein separates Kapitel. Da Zeitungen von Kindern nicht so oft genutzt werden, wird dieses Printmedium vernachlässigt.
Bücher und Lesen
Trotz der herben Kritik, haben im ausgehenden 18. beziehungsweise beginnenden 19. Jahrhundert Bücher einen festen Platz im bürgerlichen Haushalt. Sie dienen der Unterhaltung und sind Bestandteil der moralisch-religiösen Erziehung. Lesen wird als soziale Interaktionsform verstanden, bei der der Vater als autoritäre Erziehungsinstanz seiner Familie vorliest. Bei älteren Kindern gibt es zwar des Öfteren eine „einsame Lektüre“, diese wird aber von den Erziehern skeptisch betrachtet. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird das autoritative Modell vom geselligen Umgehen mit der Literatur abgelöst. Lesen wird ein Teil der Familienunterhaltung: man liest sich gegenseitig vor oder veranstaltet literarische Rollenspiele. Kinder lesen zum Teil auch selber, die Lektüre wird allerdings von den Eltern ausgesucht. Im vergangenen Jahrhundert wird das Lesen zu einer einsamen, geistigen Tätigkeit und steht seit dieser Zeit in einer Konkurrenz mit den audio-visuellen Medien (vgl. Charlton/Neumann 1992, S. 28f.).
Heute ist der Begriff Lesen prestigebesetzt und wird gedanklich immer mit Bildung in Zusammenhang gebracht. Um Lesemedien überhaupt zu nutzen, werden mehrere Bedingungen vorausgesetzt - die wichtigste: die Lesekompetenz. Voraussetzungen dafür sind das Leseklima im sozialen Umfeld und Gesellschaft, die Verfügbarkeit von Lesestoff sowie die Einstellung zum Lesen. Ein wichtiger Grundstein dafür ist die Vorlesesituation in der Kindheit (vgl. Phillipp/Salisch/Gölitz 2008, S. 25; Fritz 1989, S. 14f.).
Leider verfügt nicht jeder Mensch über eine Lesekompetenz. In unserer heutigen Gesellschaft, in der zwar die Schulpflicht herrscht, gibt es immer noch mehrere Millionen Analphabeten. Dazu gehören die Sekundäranalphabeten, die zwar in der Schule lesen lernten, aber durch das stetige Nichtanwenden es wieder verlernten, sowie funktionale Analphabeten, die ihren Namen schreiben aber keinen längeren Text lesen können (vgl. Fritz 1989, S. 7). Was wird unter Lesekompetenz verstanden? Es ist nicht nur einfach die Fähigkeit, Buchstabe für Buchstabe zu entschlüsseln - die Lesekompetenz setzt tiefer an. Sie ist zum einen die Fähigkeit, einem Text die wesentliche Information zu entnehmen und bildet die Basis für weitere Medienkompetenzen. Zum anderen fördert Lesen die Sprach- und kognitive Entwicklung, steigert die Konzentrationsfähigkeit und regt die Phantasie an. Es fördert das Gedächtnis und die Schreibfähigkeit, die Kompetenz, lange Gedankengänge zu verfolgen und Kausalzusammenhänge zu erkennen (vgl. Fritz 1989, S. 78; Waterstradt 2007, S. 68f.; Sommer 1994, S. 60f.).
Durch mehrere Mediennutzungsstudien in Deutschland und Österreich Ende der 1980er wird herausgefunden, dass eine höhere Schulbildung zwar zu einer höheren Lesekompetenz führt, niedrig Gebildete ihre Lesekompetenz aber durch häufiges und insbesondere langes Buchlesen ausgleichen können, denn mittlerweile verweisen die Sozialisationsbedingungen auf ein besseres Leseklima in mittleren und niedrigeren Bildungsschichten als noch vor 50 Jahren. Die höchste Lesekompetenz haben also nicht zwangsläufig Menschen mit höherer Schulbildung, sondern diejenigen, die zu Hause und in ihrer Kindheit eine positive Einstellung zum Lesen erfahren haben, denn, ob man in einer Situation, die einen entsprechenden Handlungsspielraum lässt, zu einem Printmedium greift oder den Fernseher einschaltet, ist laut der Resultate eine Gewohnheit, deren Grundstein in der Kindheit gelegt wird. Die Familie hat somit eine große Bedeutung auf die Lesebiographie, das bedeutet, dass die Lesechancen von Kindern verringert sind, wenn Eltern ihren Mediengebrauch nur auf elektronische Medien einschränken und Printmedien aus dem Weg gehen. Wenn diese Voraussetzungen in einer Familie herrschen, kann das die Schule nicht mehr ausgleichen.
Allerdings ist es im Umkehrschluss wiederum so, dass Familien mit einer höheren Bildung eher zum Printmedium greifen (vgl. Fritz 1989 und 1991; Hurrelmann/Hammer 1996; Franzmann 2001, S. 30f.).
Interessant zu dieser Tatsache ist eine Studie, die Mitte der 1990er Jahre das Medienverhalten von Hauptschülern studiert. Hier gehört Lesen zu den unbeliebtesten Freizeitaktivitäten. Nur elf Prozent der Hauptschüler liest zu dieser Zeit gerne und null Prozent der Hauptschüler, deren Eltern beide arbeitslos sind, gibt an, gerne zu lesen (vgl. Bofinger/Lutz/Spanhel 1999). Neuere Studien, die das Thema Lesen Gegenstand zur quantitativen Mediennutzung machen, haben ermittelt, dass sich die Schere, zwischen Lesern und Nichtlesern immer weiter öffnet. Diejenigen, die lesen, lesen zunehmend mehr - aber jeder vierte liest überhaupt nicht mehr.
Studien, die das Lesen in Verbindung mit Kindern und Jugendlichen thematisieren, sind eher selten. Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Phillip, Salisch und Gölitz, die die Anschlusskommunikation behandeln - also wie und in welchem Umfang die Kinder mit ihren Freunden nach der Mediennutzung darüber sprechen. Ergebnis der Untersuchung ist, dass Computerspiele für alle Kinder häufiger Gesprächsthema sind als Bücher. Allerdings zeigt sich auch, dass je öfter Kinder zu Hause Bücher lesen und je positiver sie die Leseorientierung in ihrer Clique einschätzen, desto häufiger sprechen sie dort über ihre Romanlektüre (vgl. Phillipp/Salisch/Gölitz 2008).
Es sei zum Ende dieses Teilabschnittes noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig Lesen als grundlegende Kompetenz ist, es die kognitive Fähigkeiten fördert und sowohl für die Rezeption anderer Medien als auch für die Lebensbewältigung eine entscheidende Rolle spielen kann. Um ein Bogen zu dieser Untersuchung zu spannen, wird darauf aufmerksam gemacht, dass Kinderpresse eine große Rolle in der Leseförderung von Kindern inne hat, „da sie den Menschen in einer Entwicklungsphase anspricht, in der sich entscheidet, ob sich ein stabiles Leseinteresse herausbildet oder nicht“ (Sommer 1994, S. 82).
Kindercomics
Comics sind „eine spezifische Form von Literatur, nämlich die Literaturform der gezeichneten Bilderfolge, die durch unterschiedliche Trägermedien […] vermittelt wird. [Bei ihnen handelt es sich um] mindestens zwei aufeinander bezogenen Panels (voneinander getrennte Einzelbilder) […], in denen sich ein verbales und ein visuelles Zeichensystem verbinden. Text wir durch Sprechblasen, Blockkommentare oder lautmalerische Schriftgraphik in das Bild integriert.“ (Heidtmann 1992, S. 13).
Schon in Wilhelm Buschs Max und Moritz werden lautmalende Worte - so genannte Onomatopöien - benutzt. Die Bildergeschichten um die zwei Lausbuben erscheinen ab 1865 in der Satirezeitschrift Fliegende Blätter. Andere Autoren dieser Zeit benutzen bald wiederkehrende Charaktere oder vermenschlichte (anthropomorphe) Tiere, die heute zentrale Elemente Kindercomics sind. Allerdings trennen die deutschen Bildergeschichten bis ins 20. Jahrhundert Bild und Text oder bleiben gänzlich ohne Text. Die eigentlichen Comics - das Wort leitet sich aus grober Komik ab - entstehen in den USA.
Der Protagonist des ersten Comics ist ein Kind: The yellow Kid, ein Junge mit gelbem Nachthemd des Karikaturisten Richard Felton Outcault (1823 - 1928). Der Comicstrip erscheint erstmals 1896 in Joseph Pulitzers Zeitung New York World um Kunden zu fangen. Pulitzers Konkurrent William Randolph Hearst veröffentlicht ein Jahr später in seiner Zeitung New York Journal die Katzenjammer Kids - gezeichnet von dem Deutschamerikaner Rudolph Dirks (1877 - 1968), der nach und nach Sprechblasen in seine Bilder einführt und somit die spezifische Erzählform der Comics - eine Mischung aus Dialogen, Onomatopöien und actionbetonten Bildern - einführt. Im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte werden Comics in den USA immer beliebter: es erscheinen eigene Comicbücher und Sammelbänder. Diese Serien beeinflussen auch den damals jungen Walt Disney (1901 - 1966), der mit seiner Micky Maus später die bekannteste Comic-Figur schlechthin erschafft. 1938 erscheint in den USA mit Superman der erste Superhelden-Strip. Es folgen Batman und Spiderman. In Deutschland erreichen Zeitschriftenserien, besonders Vater und Sohn von e.o.plauen (Erich Ohser aus Plauen), sowie im Auftrag des Propagandaministeriums produzierte Bücher, die den Soldatenalltag verklären (Da lachen unsere Gebirgsjäger), Popularität. Ende der 1940er Jahre gelangen Comics von den amerikanischen Soldaten zu den jungen Lesern. Ihre Resonanz ermutigt kleine Verlage, eigene Serien herauszubringen oder Lizenzausgaben aus den USA zu vertreiben. So wird das westdeutsche Comic-Angebot allerdings weitgehend von klischeehaften amerikanischen Abenteuerserien geprägt. In den 1950er Jahren sind Comics in Deutschland harter Kritik seitens Eltern, Lehrer und Politiker ausgesetzt. 1953 wird das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften erlassen und die Literaturform Comic ist dadurch auf lange Zeit als Analphabeten- oder Kriminellenliteratur diskreditiert. Im selben Jahr entsteht auch erstmals der erfolgreichste einheimische Comic. Die Abenteuer um Fix und Foxi von Rolf Kauka (1917 - 2000), der seine Figuren dem Disney-Vorbild nacheifert, konnte man bis vor kurzem am Kiosk kaufen.7 Ebenfalls zum Publikumsliebling wird der Igel Mecki, der auf der Kinderseite der Programmzeitschrift Hör zu die jungen Leser unterhält und Micky Maus, die seit 1951 in Deutschland erscheint, da der dänische Gutenberghus Verlag in Stuttgart den Verlag Ehapa als Tochtergesellschaft gründet, um hier eine deutsche Ausgabe der bekannten Maus herauszugeben, die bereits 1954 eine Auflage von 400.000 erreicht und bis in die Gegenwart erfolgreichstes Reihenheft bleibt (vgl. Heidtmann 1992, S. 13ff.; Kübler 2002, S. 68ff.).
Mitte der 1960er Jahre folgen die Peanuts von Charles M. Schulz mit „pointiert-geistvollen, sophisticated Strips“ (Heidtmann 1992, S. 17), die vor allem ältere Schüler und Studenten als Leser gewinnen, Superman und Batman in Deutschland und die Abenteuer um den Gallier Asterix von Rene Goscinny (1926 - 1977) und Albert Uderzo (*1927). Asterix kann wohl als die Comicfigur gelten, die den Comics in Europa endgültig zur Anerkennung verholfen und ihnen einen eigenständigen europäischen Charakter verliehen hat.
Seit 1970 bietet die Comic-Szene ein verändertes Bild: der Anteil der Kinder-Comics ist gesunken und die Hälfte des Angebotes wendet sich an Erwachsene. Im Verlauf der 1970er Jahre machen sich die Comics dann endgültig auf den Weg zu einer graphischen Literatur, erschließen sich neue Formen des Realismus sowie der künstlerischen Verdichtung. Bei den Kinder-Comics ist das populärste Genre immer noch das Funnie, also ein komischer Comicstrip, der parodistische Elemente, Situationskomik und Zeitgeistanspielungen mengt. Die meisten Funnies, wie beispielsweise die Disney-Comics, arbeiten mit überwiegend anthropomorphen Tierfiguren, deren Eigenschaften stereotyp festgelegt sind. Die Handlungen werden im Laufe der Jahre immer beliebiger und austauschbarer. Das ist auch der Fall bei geschlechtsspezifischen Comics, die im Zuge von Marktdiversifikationen seit den 1980er Jahren entstehen, wie beispielsweise das Pferdecomic Wendy. Thema sind Mädchen, die gern reiten und in den Reitlehrer verliebt sind. Seit dieser Zeit sind Kindercomics bis heute meist in mediale Verbundsysteme wie Fernsehserien oder Computerspiele integriert (vgl. Heidtmann 1992, S. 13ff.; Kübler 2002, S. 68ff.).
2.3 Zeitschriften für Kinder
Der Hörfunk- und Fernsehbereich wird schon lange von der Kindermedienforschung angenommen. Hierzu gibt es zahlreiche Studien in der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung. Der Zeitschriftenbereich dagegen ist, wie bei den Erwachsenenzeitschriften, vergleichsweise wenig beschrieben. Bonfadelli hat im Jahr 2002 eine Liste mit zahlreichen Zeitschriftenanalysen aufgestellt, bei der keine Medieninhaltsanalyse von Kinderzeitschriften auftaucht (vgl. Bonfadelli 2002, S. 66ff.).
2.3.1 Der Begriff Zeitschrift
Die Zeitschrift wird seit Beginn ihrer Existenz beziehungsweise seit Beginn der Kommunikationsforschung eher stiefmütterlich behandelt:„Der fachwissenschaftliche Diskurs über die Thematik Zeitschrift ist heute in der Kommunikationswissenschaft nicht der lebhafteste. Zu keiner Zeit war die Zeitschriftenforschung ein gut erschlossenes Feld der Publizistik- beziehungsweise Kommunikationswissenschaft. Die Zeitschriften gehören in der gesamten deutschen Nachkriegsgeschichte eher zu den randständigen Themen“ (Vogel/Holtz- Bacha 2002, S.7). Erkennbar ist diese Tatsache auch daran, dass es sehr schwer ist, den Begriff Zeitschrift zu beschreiben, da es bis heute keine allgemein gültige Definition für die Zeitschrift gibt. Schon 1854 versuchen sich die Gebrüder Grimm in ihrem Deutschen Wörterbuch an einer allgemein gültigen Definition. Zeitschrift ist in ihren Augen „in modernem Sinne eine periodische meist zu bestimmten Terminen erscheinende Druckschrift in Heften mit wissenschaftlichen oder belletristischem Inhalt; als Übersetzung von Journal, chronicle…“ (zit. nach Kieslich 1969, S. 371).
Das Wort Zeitschrift taucht erstmals 64 Jahre zuvor auf einem Titelblatt auf - bei der Neuen musikalischen Zeitschrift für 1791 zur Beförderung einsamer und geselliger Unterhaltung. Parallel zum Begriff Zeitschrift werden die Begriffe Journal, Magazin oder Wochen- bzw. Monatsschrift verwendet. In den 1950er und 1960er Jahren wird eine Reihe von Versuchen unternommen, der Zeitschrift ein klares definitorisches Gesicht zu geben. So beschreibt Emil Dovifat beispielsweise die Zeitschrift mit folgenden Worten: „Die Zeitschrift dient einem umgrenzten Aufgabenbereich oder einer bestimmten Stoffdarbietung fortlaufend und in regelmäßiger Folge. Er bestimmt ihre Öffentlichkeit, ihre Tagesbindung, ihren Standort, die Mannigfaltigkeit ihres Inhalts und die Häufigkeit ihres Erscheinens.“ (Dovifat 1967, S. 14). Und Walter Hagemann bezeichnet Zeitschriften als „periodische Druckwerke, die in höchstens vierteljährlichem Rhythmus erscheinen und deren Schwerpunkt nicht auf der Verbreitung aktuellen und universellen Nachrichtenstoffes liegt“ (zit. nach Kieslich 1969, S. 374). Günter Kieslich hat die zahlreichen Definitionen Ender der 1960er Jahre interpretiert und kommt zu dem Schluss, dass alle Definitionen einen gemeinsamen Nenner haben: „Der Zeitschrift fehlt etwas, was die Zeitung mehr hat“ (Kieslich 1969, S. 375). Des Weiteren attestiert Kieslich, dass „periodisch-regelmäßigem Erscheinen, Zeitnähe, universaler oder auch nur fachlich-spezieller Thematik, allgemein-öffentlichem oder auch nur fachlich, beruflich oder gruppenmäßig begrenztem Wirkenwollen unter Umständen Zeitschrift sein kann“ (Kieslich 1969, S. 375). Heute hat laut Vogel die überwiegende Mehrheit der Presseforscher die Kriterien Dovifats - der wesentlichste Unterschied zwischen Zeitung und der Zeitschrift sei die Universalität des Inhalts - beibehalten (vgl. Vogel 2002, S. 14). Und Maurer und Reinemann geben 2006 eine kompakte, verkürzte Version der Definitionen wider. Sie bezeichnen Zeitschriften als periodisch erscheinende Presseerzeugnisse, die mindestens viermal jährlich erscheinen, keine Zeitungen sind und die charakteristischen Merkmale Periodizität, Kontinuität und Verzicht auf Tagesaktualität aufweisen (vgl. Maurer/Reinemann 2006, S. 75).
So wie die Definition ist aber auch die Etymologie des Begriffes nicht vollständig geklärt. Kieslich bezeichnet das Wort Zeitschrift als „eine Hilfskonstruktion, eine erst rund hundert Jahre nach der Konstituierung dieser Kommunikationsmöglichkeit als Sammelbegriff über das publizistische Phänomen und seine Erscheinungsformen gestülptes Verlegenheitswort. […]. Der Begriff Zeitschrift ist ein nicht organisch gewachsener Hilfsbegriff; er stellt sich vielmehr als eine Gattungs-Sammelbezeichnung dar, die von der Wortbedeutung her die Vielfalt der Erscheinungen, die sie umgreifen soll, nicht mehr fassen kann“ (Kieslich 1969, S. 379f). Kieslich ist es auch, der vorschlägt, die Suche nach einer verbindlichen Definition des Gesamtkomplexes Zeitschrift zurückzustellen, dafür aber zu versuchen, die Haupttypen der modernen Zeitschrift exakter zu bestimmen (vgl. Kieslich 1969, S. 381).
Dass auch dieses Unterfangen - also die Bestimmung einer einheitlichen Zuordnungssystematik - sowie die Schaffung eines einheitlichen Verzeichnisses aller Zeitschriften bislang nicht besonders von Erfolg gekrönt sind, kritisiert Vogel. Bis 1994 existiert eine amtliche Pressestatistik. Seither bedienen sich Wissenschaftler und auch andere Interessenten beispielsweise den Übersichten der IVW8 und des Stamms9. Daneben existieren aber viele weitere Verzeichnisse. Vogel fordert daher die Entwicklung einer modernen einheitlichen Pressesystematik durch die Wissenschaft (vgl. Vogel 2002, S. 21).
Unter den Bezeichnungen für die Gattungen der Presse gibt es bis heute nur zwei, bei denen seit Jahrzehnten weitgehend Einigkeit herrscht: dies sind die Tagespresse einerseits und die Fachpresse andererseits. Der Begriff Publikumszeitschriften löst die früheren Bezeichnungen der Unterhaltungszeitschriften beziehungsweise Freizeitschriften ab. Allerdings gibt es auch Stimmen gegen die Einbindung des Terminus Publikum weil dieser Wortsinn irreführend ist, da sein Publikum letztlich jedes Medium findet. Aus der übrigen Vielfalt der Presseprodukte werden bislang noch keine weiteren Gruppen derart hervorgehoben, wie die oben beschriebenen drei. Daher ist ein diesen ebenbürtiger Gattungsrang bei allen anderen Zusammenfassungen noch nicht gefestigt (vgl. Vogel 2002, S. 22f.).
Der Vollständigkeit wegen, werden hier trotz aller Unstimmigkeit eine einfache Typologisierung von Maurer und Reinemann aufgezeigt. Ihrer Meinung nach lassen sich Zeitschriften in Publikumszeitschriften (z.B.: Spiegel, Focus, BRAVO, GEOlino), Fachzeitschriften (z.B.: Publizistik, Arzt und Krankenhaus, Das Orchester), Special-Interest- Zeitschriften (z.B.: bike - Europas grösstes Mountainbike-Magazin, Blinker - Europas größte Anglerzeitschrift), Verbands- und Vereinszeitschriften (z.B.: ADAC-Motorwelt“), Amtszeitschriften (z.B.: Manchinger Anzeiger) und Alternative Zeitschriften typologisieren (vgl. Straßner, 1997, S. 25; Pürer/Raabe 1996, S. 30f; Maurer/Reinemann 2006, S. 75).
Der Zeitschriftensektor hat in den letzten 30 Jahren enorm zugenommen, so dass der Überblick fast nicht möglich ist. Waren Mitte der 1950er Jahre circa 5600 Zeitschriftentitel auf dem Markt, so waren es bei Beginn des neuen Jahrtausends mehr als 20.000 Titel. Beim Sektor Publikumszeitschriften, zu dem die Kinderzeitschriften gehören, unterscheidet die IVW 22 Untergruppen. Anfang der 1950er Jahre zählte man 200 Titel zu den Publikumszeitschriften, 2004 842 Titel, zu denen aber viele Line-Extensions (die bestehende Marke wird innerhalb der gleichen Produktkategorie auf ein neues Produkt transferiert. Beispiel: GEO - GEOlino) zählen. In den letzten Jahrzehnten wächst auch die Auflage der Publikumszeitschriften beträchtlich (1975: 70 Millionen Auflage; 1996: 128 Millionen Auflage). Allerdings schrumpft sie seit 2004 wieder, was unter anderem an der ausgeprägten Online-Nutzung liegen kann (vgl. Maurer/Reinemann 2006, S. 75ff.).
2.3.2 Zum Typ der Kinderzeitschriften
Für Kinderzeitschriften, die zum Sektor der Publikumszeitschriften zählen, existieren mehrere Definitionen. Unter anderem sind Kinderzeitschriften selbständige Publikationsorgane für Kinder bis zu zwölf Jahren, aber auch Erwachsenenzeitschriften beigelegte Seiten, die periodisch erscheinen und eine Mischung aus Unterhaltung, Wissensvermittlung und Verhaltensanleitung enthalten (vgl. Rogge/Jensen 1980, S. 178). Sommer erweitert diese Definition in dem er den Satz verkürzt: „Kinderzeitschriften sind für Heranwachsende bis zu etwa zwölf Jahren bestimmte selbstständige Publikationen, die periodisch (mindestens dreimal im Jahr) erscheinen“ (Sommer 1994, S. 16). Kurz definiert Kinderzeitschriften in ihrer Diplomarbeit mit den Worten „Kinderzeitschriften sind periodisch erscheinende Publikationsorgane in Form einer Zeitung oder Zeitschrift. Sie erscheinen selbstständig und sind speziell für die Altersgruppe der 3 - bis 12jähringen produziert. Sie dienen der Unterhaltung und Wissensvermittlung und geben Anregungen und Hilfen für den Sozialisationsprozess“ (Kurz 2000, S. 5). Allerdings besteht hier ein Widerspruch, da man, wie in Kapitel 2.3.1 erläutert, eine Zeitung nicht einer Zeitschrift gleich setzen kann. Eine weitere, umfassendere Definition liefert Gärtner: „Kinder- und Jugendzeitschriften sind speziell für Kinder und Jugendliche produzierte, zumeist selbständige, aber auch Zeitschriften oder Zeitungen beigegebene, periodische erscheinende Publikations- und Kommunikationsmittel, die Unterhaltung mit Belehrung, zuweilen auch mit Propaganda verbinden. […]. Sie sind Publikationen, die alleine mit Hinblick auf die Erfahrungs- und Interessenwelt des Jugendlichen gestaltet, entweder von Jugendlichen selbst oder aber von Erwachsenen redigiert und ediert werden“ (zit. nach Meier 2000, S. 639). Im Hinblick auf die Typologie der Kinderzeitschriften liefert Sommer im Gegensatz zu Rogge/Jensen und Kübler10 eine weitaus detailreichere Gruppierung. Er unterscheidet die Trägerschaft - handelt es sich um Kundenzeitschriften oder Verlagszeitschriften, letztere unterteilt er in Comic-Zeitschriften, Magazine (also Zeitschriften, die ein breites Spektrum unterschiedlicher Inhalte bietet) und Beschäftigungszeitschriften, die hauptsächlich Anleitungen zum Spielen und Basteln abdrucken. Des Weiteren unterscheidet er das Alter der Zielgruppe - also Leseanfängermagazine und Schülermagazine. Sommer erstellt auch fünf publizistische Merkmale für die Kinderpresse: Zielgruppe Kind, Periodizität, Universalität, Disponibilität und geringe Zugangsschwelle (vgl. Sommer 1994, S. 22ff.).
Die von Sommer aufgestellte Definition, Typologie und publizistischen Merkmale sollen im Laufe dieser Diplomarbeit behilflich sein, ein Profil der zu untersuchenden Kinderwissensmagazine aufzustellen. Die Funktionen von Kinderzeitschriften sollten laut Sommer folgende sein: die Vermittlung und Erläuterung aktueller Ereignisse, die Vermittlung von Informationen über Themen, in der sich die Kinder wiederfinden können, die Kinder unmittelbar betreffen und die Vermittlung von Grundwissen (vgl. Sommer 1994, S. 110). Weitere Aufgaben stellt Baugärtner an die Kinderpresse: Weckung von Neugierde, Unterhaltung, Anregung zum Weiterdenken, zum Experimentieren, zum Beobachten, zum verantwortungsbewussten Handeln, zur Stellungnahme, Kritik und Meinungsbildung. Der Funktionskatalog wird durch Förderung der Lesekompetenz sowie das Hinführen zur Medienkompetenz erweitert (vgl. Meier 2000, S. 644).
Bevor der Forschungsstand in der Medieninhaltsforschung aufgearbeitet und einige Zeitschriftenanalysen im Bereich der Kinder- und Jugendpresse beschrieben werden, muss auf die Vernachlässigung der Zeitschriftenforschung bezüglich Kinderzeitschriften aufmerksam gemacht werden. Es fällt nicht nur subjektiv auf, dass Studien zu Kinderzeitschriften kaum zu finden sind, auch die Forschung selbst stellt schon Anfang der 1980er Jahre fest, dass es an wissenschaftlichen Untersuchungen der Kinder- und Jugendpresse und spezielle an Inhaltsanalysen in der Jugendpresseforschung mangelt. Man geht damals schon davon aus, dass das Fernsehen alle anderen Kindermedien in den Schatten stellt und dass die Marktlage zu unübersichtlich ist (vgl. Knoche/Lindgens 1983 S. 111; Rogge/Jensen 1980, S. 179f.).
Mit der Entwicklung weiterer auditiver und audiovisueller Kindermedien wird die analytische Forschungslage der Kinderpresse nicht besser. Auch Anfang des jetzigen Jahrtausends klagen Forscher, dass dem Medium Kinderzeitschrift, trotz des Titelbooms und trotz der Vielfalt nur geringe Aufmerksamkeit zuteil würde. Dass Versuche für Gesamtdarstellungen und Untersuchungen viel zu lückenhaft seien und der Komplexität und Bedeutung dieses Mediums für das Mediensystem insgesamt nicht gerecht würden. Gründe dafür sind der viel zu schnelle Wechsel von Erscheinungswesen und Titel und dem Nichtvorhandensein eines Archives sowie die Konzentration auf Fernsehen, Internet und Computerspielen. Insgesamt ist die Forschungslage zur Kinder - und Jugendzeitschrift sogar als „desolat und desaströs“ anzusehen. Anfang der 1970er Jahre wird der Christian-Felix-Weiße-Preis für Forschungen in der Kinderpresse ausgeschrieben. Mangels vorliegender Untersuchungen kann dieser Preis aber nur wenige Male verliehen werden (vgl. Kübler 2002, S. 56; Meier 2000, S. 653; Nickel S. 27).
Dabei wäre die Erforschung aber sehr von Bedeutung, denn „trotz der Dominanz bewegter Bilder kommt der Kinder- und Jugendzeitschrift bei der Sozialisation von jungen Menschen eine entscheidende Bedeutung zu. Eine Beschäftigung mit den in der Forschung eher stiefmütterlich behandelten Periodika für Kinder und Jugendliche scheint kommunikationswissenschaftlich, sozialisationstheoretisch und medienpädagogisch mehr als geboten“ (Meier 2000, S. 638).
Von den wenigen Studien, die über Kinderzeitschriften existieren, erscheint die Erste im Jahr 1932. Es handelt sich um eine unveröffentlichte Dissertation von (Pirich-) Diederichs mit dem simplen Titel Kinderzeitschriften (vgl. Sommer 1994, S. 48f.). In den 1960er Jahren folgt die Publikation Das Elend der Jugendzeitschriften von Müller (vgl. Meier 2000, S. 653). Ende der 1960er Jahre verfasst Niedere ihre Studie Die Kinderzeitschrift im Urteil ihrer Leser. Eine empirische Studie über die inhaltliche und formale Gestaltung von Kinderzeitschriften. Die Arbeit wird 1970 mit dem bereits erwähnten Christian-Felix-Weiße-Preis ausgezeichnet und 1972 veröffentlicht. In der Studie geht es darum, herauszufinden, welche Stil- und Inhaltsvarianten in der Gestaltung einer Kinderzeitschrift wirksam sind. Ergebnis dieser Studie ist, dass im Bereich der Illustration der Realitätsanspruch des Kindes von hoher Bedeutung ist und dass im Bereich der Geschichten der Wirklichkeitssinn des Kindes vom Wunsch nach emotional befriedigenden Erlebnissen überlagert wird (vgl. Niederle 1972).
Knapp zehn Jahre später stellen Rogge und Jensen eine Inhaltsanalyse und Übersicht des westdeutschen Kinderzeitschriftenmarktes vor. Die Ziele sind die Schaffung eines Überblicks, Vorstellung von Analysekategorien für Kinderzeitschriften, Darlegung von Tendenzen anhand einiger Produkte, die Aufzeigung der kindlichen Zeitschriftennutzung und -rezeption. Das Ergebnis der Studie fällt für die Kinderzeitschriften negativ aus: „Die bildliche wie sprachliche Darstellung ist insgesamt kaum problematisierend, wenig kritisch und dient keinesfalls einer produktiven Irritation. Wissens- und Informationsvermittlung sind eher an enzyklopädischer Faktenhuberei orientiert; Unterhaltung an Klamotte, Klamauk und Action. Auseinandersetzungen mit kindlichen Alltagsproblemen, gesellschaftlichen und historischen Ereignissen werden ausgeklammert. So bieten Kinderzeitschriften inhaltlich wie formal ein Bild der fröhlichen Einfalt und ungetrübten Arglosigkeit“ (Rogge/Jensen 1980, S. 194). Rogge und Jensen kommen damit zu dem Schluss, dass die weltfremde Unbedarftheit, mit der sich viele Kinderzeitschriften tarnen, keinesfalls unproblematisch sei. „Da die Kinderzeitschriften als eine Sozialisationsinstanz ihre Rezipienten in der Entwicklung begleiten, prägen sie - wie die anderen Medien und Institutionen auch - das Verständnis der Kinder von Gesellschaft, ihr Verhalten, ihre Wahrnehmung, ihre Auffassung von
Unterhaltung und Information mit. So verstanden kommt der Kinderpresse - trotz ihrer vermeintlichen Harmlosigkeit eine ernstzunehmende gesellschaftliche und politische Funktion zu“ (vgl. Rogge/Jensen 1980, S. 187ff.).
In den folgenden fünf Jahren werden weitere Studien publiziert, die sich mit Kinderzeitschriften beschäftigten. So seien hier drei erwähnt: eine Inhaltsanalyse von Kinderwerbung in den Kinderzeitschriften Micky Maus, Fix und Foxi und Donald Duck (vgl. Schmidt 1987), eine Untersuchung über das Erscheinungsbild und die Inhaltsstruktur von Jugendzeitschriften (vgl. Knoche/Lindgens 1983)11 und eine Darstellung und Marktüberblick von Kinder und Jugendzeitschriften - allerdings aus der Schweiz (vgl. Doelker 1981).
Ende der 1980er Jahre erforscht Sommer, im Rahmen einer Dissertation, die gesamte Kinderpresse der Bundesrepublik Deutschland. Er untersucht alle Kinderzeitschriften, die in seine Definition fallen (s.o.) und zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt sind, mittels einer Inhaltsanalyse und einer Befragung von 120 Redaktionen. Sein Ziel ist es, den undurchsichtigen Markt der Kinderpresse transparenter zu machen, die äußere und innere Struktur zu analysieren und einen Marktüberblick zu schaffen. Resultate seiner Arbeit sind unter anderem, dass Comics und Werbezeitschriften eine ernst zunehmende Sparte im Bereich der Kinderpresse sind, dass die meisten Publikationstypen das Lesen fördern wollen und dass insgesamt zwar eine große äußere Vielfalt festzustellen ist, aber inhaltlich eine Konsonanz vorherrscht. Die Geschichten sind durchweg alle unaktuell, nicht ereignisbezogen und Alltagsprobleme der Kinder werden nicht aufgegriffen. Des Weiteren findet er heraus, dass die Kinderzeitschriften Mitte der 1980er Jahre meist keine moralisch relevanten Inhalte vermitteln wollen, wie es noch bei früheren Kinderzeitschriften der Fall ist und dass die meisten die kritische Auseinandersetzung mit dem Fernsehen und auch gesellschaftlich relevanten Themen vermeiden (vgl. Sommer 1994).
Mitte der 1990er unternehmen Baacke und Lauffer einen weiteren Versuch zur Übersicht über die damalige Kinder- und Jugendzeitschriftenlandschaft und deren inhaltlicher Struktur. Hier handelt es sich aber um keine wissenschaftliche Inhaltsanalyse, da immer nur eine Ausgabe der jeweiligen Publikation oberflächlich beschrieben wird (vgl. Baacke/Lauffer 1994). Auch der Medienjournalist Gangloff nimmt sich 1994 - allerdings auch ohne wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse - die Kinderzeitschriftenlandschaft vor und kommt zu dem Schluss, dass Qualität nur im Abonnement erhältlich ist (vgl. Gangloff 1994).
Im Jahr 2000 untersucht Nickel dem damaligen Markt und die Entwicklung der Mädchenzeitschriften - eine spezielle Zielgruppenzeitschrift in der Gruppe der Kinder- und Jugendpresse - mittels einer Befragung, einer Inhaltsanalyse, Leitfadeninterviews und einer Sekundäranalyse (vgl. Nickel 2000). Im selben Jahr verfasst Kurz in Form einer Diplomarbeit eine Marktübersicht und eine Empfehlungsliste von Kinderzeitschriften an der Fachhochschule Stuttgart im Studiengang „Öffentliches Bibliothekswesen“. Die Verfasserin vermerkt aber selbst, dass die Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Zudem ist keine wissenschaftliche Methode vorhanden (vgl. Kurz 2000).
Danach folgen keine wissenschaftlichen Arbeiten zu Kinderzeitschriften mehr. Kübler und Meier unternehmen in einer Monographie beziehungsweise einem Sammelband noch einmal den Versuch einer Übersicht, der aber kurze Zeit später nicht mehr aktuell ist (vgl. Kübler 2002; Meier 2000).
[...]
1 Stieler, Kaspar: Zeitungslust und Nutz. In: Hagelweide, Gert (Hrsg.): Vollständiger Neudruck der Originalausgabe von 1695, S. 8.
2 Diese Beschreibung der Entwicklung der Kindheit geht auf den französischen Historiker Phillipe Ariès (1914 - 1984) zurück.
3 Diese Phasen der Kindheit formulierte der amerikanische Psychologe Lloyd deMause (*1931).
4 Weiterführende Literatur zur Medienpädagogik: Baacke 1997; Hiegemann/Swoboda 1994; Moser 1995; PausHaase/Lampert/Süss 2002; Sandner/Gross/Hugger 2008;
5 Primäre Medien erfordern kein Gerät zwischen den Kommunikationspartner, sekundäre Medien erfordern
technisches Gerät auf Seiten der Medienproduzenten aber nicht auf Seiten der Rezipienten (vgl. Pürer 2003, S. 64).
6 Die KIM-Studie (Kinder und Medien) wird seit 1999 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest regelmäßig durchgeführt. Sie untersucht den Medienumgang 6-bis 13jähriger in Deutschland.
7 Da die Auflage innerhalb eines Jahres von 50.000 auf 18.000 sank, musste der Kleinverlag Tigerpress im Juni 2009 einen Insolvenzantrag stellen (vgl. Huber 2009, S. 8).
8 Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.
9 Stamm 2009. Presse- und Medienhandbuch. Band 2. Leitfaden durch Presse und Werbung.
10 Rogge/Jensen und Kübler unterteilen die Kinderpresse in kommerzielle Kinderzeitschriften, nicht-kommerzielle Kinderzeitschriften, Werbezeitschriften für Kinder, Kinderseiten in aktuellen Zeitungen und Publikumszeitschriften für Erwachsene und Schülerzeitschriften (vgl. Kübler 2002, S. 55; Rogge/Jensen 1980, S. 178).
11 Knoche und Lindgens untersuchten 1550 Zeitschriften nach dem Erscheinungsbild und 100 Zeitschriften nach inhaltlichen Kriterien. Es handelte sich in beiden Fällen um Jugendzeitschriften, die Mitte der 1970er erschienen.
- Arbeit zitieren
- Dip.-Journ. (Univ.) Christine Engel (Autor:in), 2009, Wissensmagazine für Kinder auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160214
Kostenlos Autor werden











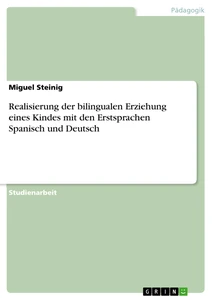







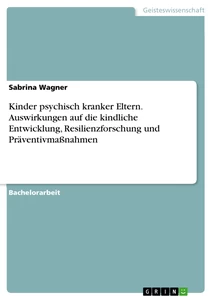


Kommentare