Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Die Bedeutung des Tourismus und seine Problemstellung
2. Negative Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt
2.1. Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Natur
2.1.1. Die Bedeutung der Landschaft für den Tourismus
2.1.2. Die Beeinträchtigung der Landschaft durch den Tourismus
2.1.3. Rückwirkung auf den Tourismus
2.2. Wechselwirkungen zwischen Flora & Fauna und Tourismus
2.2.1. Die Bedeutung von Flora & Fauna für den Tourismus
2.2.2. Die Beeinträchtigung von Flora & Fauna durch den Tourismus
2.2.3. Rückwirkungen auf den Tourismus
2.3. Wechselwirkungen zwischen Luft und Tourismus
2.3.1. Die Bedeutung der Luft für den Tourismus
2.3.2. Die Beeinträchtigung der Luft durch den Tourismus
2.3.3. Rückwirkungen auf den Tourismus
2.4. Wechselwirkungen zwischen Wasser und Tourismus
2.4.1. Die Bedeutung von Wasser für den Tourismus
2.4.2. Die Beeinträchtigung des Wassers durch den Tourismus
2.4.3. Rückwirkungen auf den Tourismus
2.5. Wechselwirkungen zwischen Klima und Tourismus
2.5.1. Die Bedeutung des Klimas für den Tourismus
2.5.2. Die Beeinträchtigung des Klimas durch den Tourismus
2.5.3. Rückwirkungen auf den Tourismus
3. Die Folgen des Tourismus am Fallbeispiel Nationalpark Bayerischer Wald
3.1. Geschichte des Nationalparks Bayerischer Wald
3.2. Negative Auswirkungen des Tourismus auf den Nationalpark
3.3. Präventive Maßnahmen gegen diese negativen Auswirkungen
4. Zusammenfassung und Ausblick
- Arbeit zitieren
- Jakob Burkhart (Autor:in), 2010, Tourismus und Ökologie - Auswirkungen des Tourismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159946
Kostenlos Autor werden
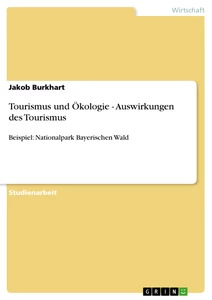
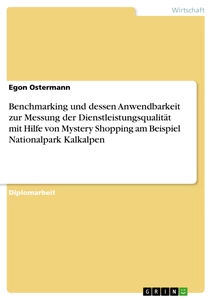
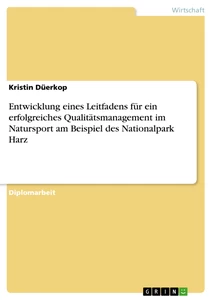

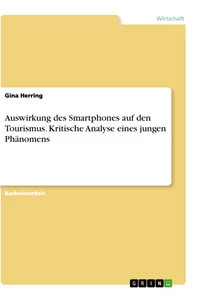
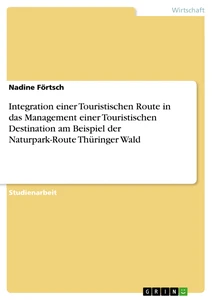
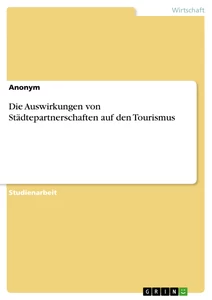
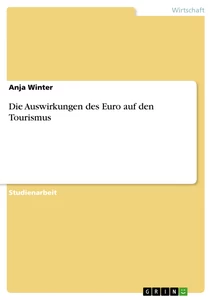
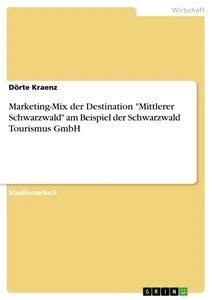
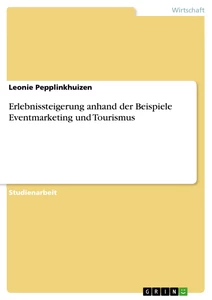
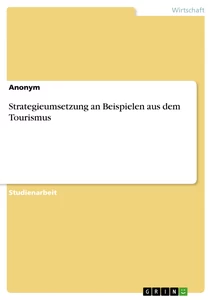
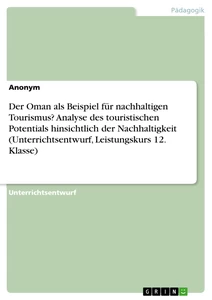
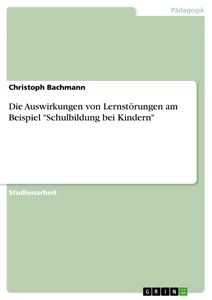
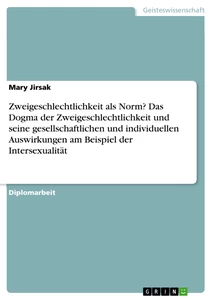
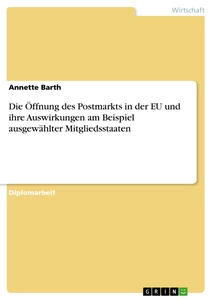
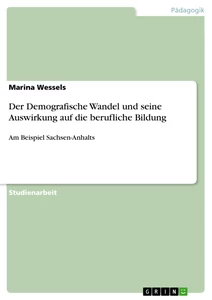
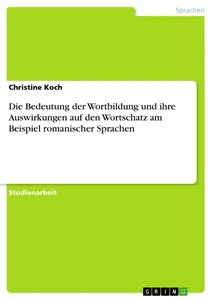
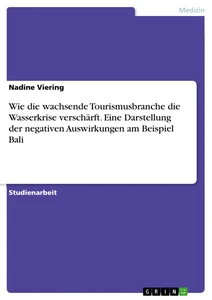
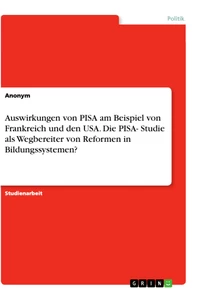
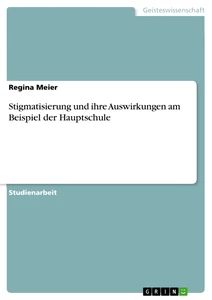
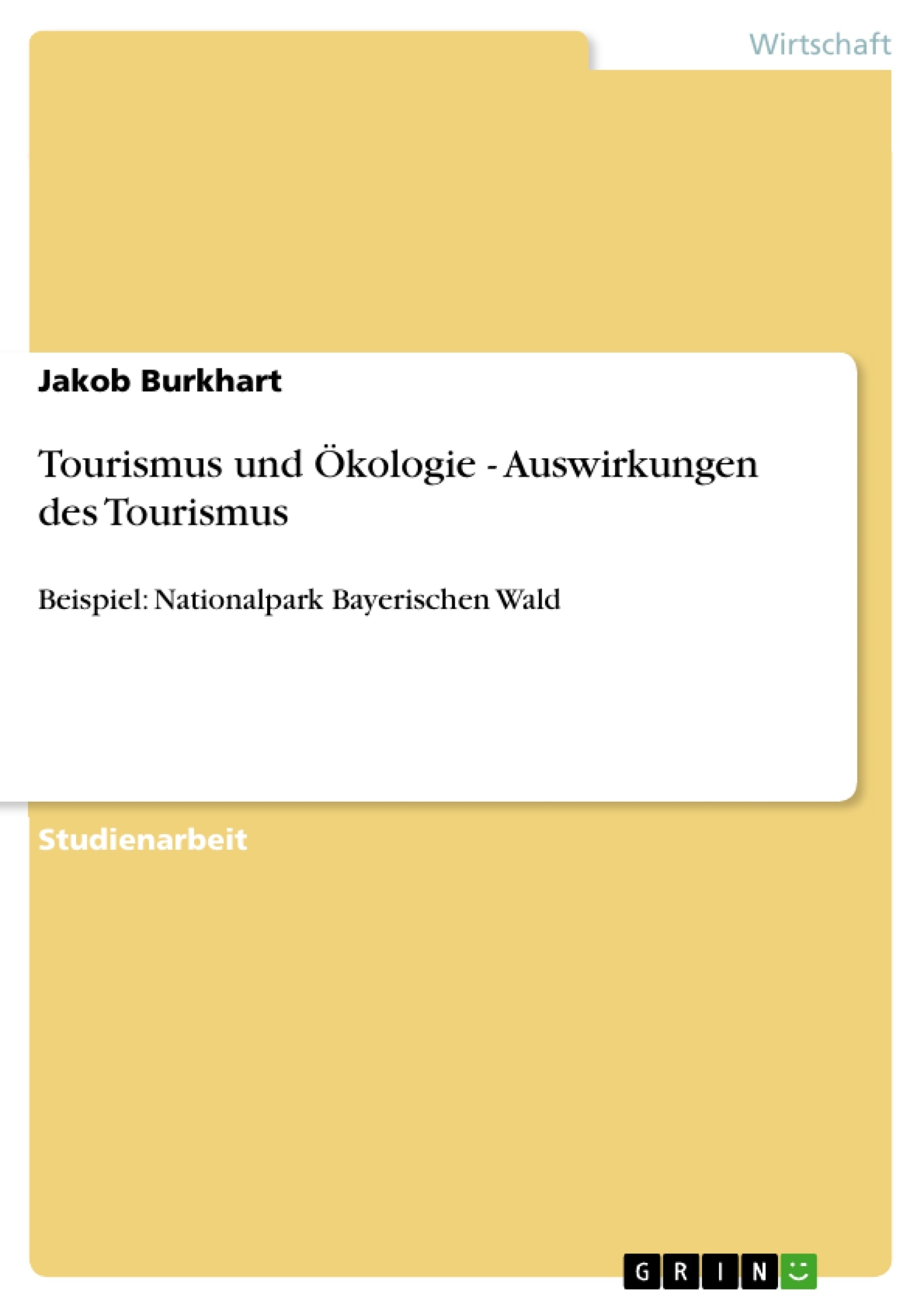

Kommentare