Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Grundlagen zur Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen
1.1 Normalisierung
1.2 Selbstbestimmung/ Empowerment
1.3 Integration/ Inklusion
1.4 Teilhabe
1.5 Ausbau neuer Wohnmöglichkeiten
1.6 Demographische Entwicklung
1.7 Schlussfolgerung zur Fragestellung
2. Begriffserklärungen
2.1 Einrichtungen nach dem HeimG und Finanzierung im Gegensatz zu Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI
2.2 Tabellarische Darstellung der verschiedenen Berufe in Einrichtungen der Behindertenhilfe
2.3 Unterschiede Heilerziehungspfleger/ Pflegefachkraft
2.4 Grund- und Behandlungspflege aus verschiedenen Gesichtspunkten
3. Stellungnahmen zu behandlungspflegerischen Maßnahmen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
3.1 Aus Sicht des Bundesverbandes der evangelischen Behindertenhilfe
3.2 Aus Sicht der Fachverbände der Behindertenhilfe
3.3 Aus Sicht der Diakonie
3.4 Aus Sicht der hessischen Heimaufsicht
3.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Stellungnahmen
4. Haftungsrechtlicher Aspekt
4.1 Fachaufsicht
4.2 Delegationsverantwortung
4.3 Übernahmeverantwortung/ Durchführungsverantwortung
4.4 Kommunikationsverantwortung
4.5 Deliktische Haftung
4.6 Vertragliche Haftung
5. Personalentwicklung
5.1 Grundlagen der Personalentwicklung
5.2 Einstellung von Pflegefachkräften
5.3 Koopertion mit benachbarten Einrichtungen
5.4 Erstellung eines „internen Pflegestützpunktes“
5.5 Entwicklung vorhandener pädagogischer ausgebildeter Mitarbeiter
5.5.1 Weiterbildung zum Altenpfleger für Heilerziehungspfleger
5.5.2 Interne Fortbildungen
5.5.3 Strukturierung der Fortbildungen
5.5.4 Weiterbildungsmöglichkeiten
5.6 Bildung von Pflegefachabteilungen
5.7 Bildung eines Fachkreises Pflege
5.8 Beauftragung eines externen Pflegedienstes
5.9 Veränderungen auf Grund des Paradigmenwechsels
5.10 Einsatzmöglichkeiten für älteren Mitarbeitern
5.11 Ausgliederung von Mitarbeitern aus den stationären Einrichtungen
5.12 Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften
5.13 Beauftragung eines externen Unternehmens
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Internet Quellen
Einleitung
Durch den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe, geprägt durch seine Ter- mini wie Normalisierung, Integration und Teilhabe, entstanden Alternativen zu den bislang bekannten stationären Wohnformen für Menschen mit Behinderungen.
Über viele dieser oft lapidar benutzen Begriffe wird nicht nachgedacht, aber sie integrieren sich in den Alltag der Menschen mit und ohne Behinderung und wer- den so zu einem Teil ihres Lebens.
Durch die Forderungen der Normalisierung oder Teilhabe hat sich die Struktur in den stationären Einrichtungen verändert. Oft wird das Bild von älteren Menschen oder Menschen mit schweren, schwersten oder mehrfachen Behinderungen und Menschen mit herausforderndem Verhalten geprägt. Menschen mit leichteren Be- hinderungen haben bereits den „Absprung“ aus den stationären Einrichtungen ge- schafft und wohnen in ambulanten Wohnformen oder werden in ihrer eigenen Wohnung unterstützt. Aber auch vor den verbliebenen Betreuten wird der Wandel nicht halt machen, auch sie werden mit der Zeit aus den noch vorhandenen großen Einrichtungen in einzelne, dezentralisierte, gemeindenahe Häuser und Wohnun- gen ziehen.
Diese strukturellen Veränderungen haben Konsequenzen für die Mitarbeiter in den stationären Wohnformen mit sich gebracht. Wer momentan noch in einer gro- ßen Einrichtung arbeitet, muss sich mit Dezentralisierungsprojekten befassen und mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen. Bewohner werden zu Klienten mit eigenen Rechten und eigenen Vorstellungen, darüber wie sie ihr Leben leben und gestalten wollen. Die Einführung des persönlichen Budgets und dem damit ver- bundenen Selbstbestimmungsrecht und den Selbstbestimmungspflichten gab An- lass über seine Arbeit, die man als Mitarbeiter leistet, nachzudenken und zu re- flektieren. Das Angebot muss nun auf die Nachfrage abgestimmt sein, eine Betreuung im Sinne von einem „Rund-um-sorglos-Paketen“ ist nicht mehr ge- wollt. Der Mitarbeiter gilt nicht weiter als Experte für die Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen, sondern muss sich an den Wünschen des Men- schen mit Behinderung orientieren und ihm dabei als Begleiter zur Seite stehen.
Dies könnte auch beinhalten, dass man nur einen Lebensbereich eines Menschen mit einer Behinderung betreut und ein anderer Kollege einen weiteren Lebens- bereich begleitet. Man nimmt als Mitarbeiter nicht mehr an allen Abschnitten des Lebens des Menschen mit einer Behinderung teil.
In den stationären Einrichtungen steigt die Anzahl an pflegebedürftigen Bewoh- nern, worauf die Einrichtungen durch ihre pädagogische Ausrichtung nicht einge- stellt sind. Vor ein paar Jahren stellte sich die Frage: „Wie gehe ich mit dem Be- darf an behandlungspflegerischen Maßnahmen in einem rein pädagogisch ausgebildeten Team um?“ noch nicht. Nun müssen diese Mitarbeiter Tätigkeiten ausführen, für die sie nicht ausgebildet worden sind.
Dies wirft nun Fragen auf, denen sich die Leitungspersonen, das Controlling und nicht zuletzt die verantwortlichen Mitarbeiter in den Personalabteilungen im Hin- blick auf ihre Personalentwicklung stellen müssen.
Hierbei soll noch erwähnt sein, dass Personalentwicklung immer im Zusammen- hang mit dem Leitbild der Einrichtung sowie dem vorhandenen oder zu ent- wickelnden Qualitätsmanagement und der allgemeinen Organisationsentwicklung zu sehen ist. Alle diese Teile sind einzeln zu betrachten und auszuarbeiten, jedoch darf nicht außer acht gelassen werden, dass es letztendlich immer um das gesamte Unternehmen geht und nicht um die einzelnen Bruchstücke. So muss sich zum Schluss jede einzelne Ausarbeitung wie ein Puzzlestück in das Gesamtgefüge ein- setzen lassen. In dieser Arbeit wird jedoch nur auf die Personalentwicklung einge- gangen. Die möglichen Personalentwicklungsmaßnahmen müssen immer indivi- duell an ein Unternehmen angepasst werden und können im Rahmen dieser Arbeit als Hilfestellung gesehen werden.
Weiterhin wird in der vorliegenden Arbeit bei spezifischen Sachverhalten wie der Finanzierung der Heimplätze in der Behindertenhilfe und der Frage nach dem Pflegefachkraftstatus von Heilerziehungspflegern auf das Bundesland Hessen und den Zeitraum bis April 2010 Bezug genommen, da zu diesem Zeitpunkt das Land Hessen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, noch kein eigenes Heimgesetz (oder ähnliches) erlassen hat.
Auch wenn der Begriff des Bewohners in der Fachterminologie Anlass zu Diskus- sionen gibt, wird er in der folgenden Abhandlung im Kontext mit stationären
Wohnformen verwendet. Klient wird als Begriff für alle Menschen mit einer Be- hinderung genutzt, die auf eine Dienstleistung, die durch Dritte erbracht wird, an- gewiesen sind.
1. Die Veränderung der Bewohnerstruktur in der stationären Behindertenhilfe
In diesem Punkt wird auf die verschiedenen Termini in der Behindertenhilfe ein- gegangen, die wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in diesem Bereich ge- nommen haben und weiterhin nehmen werden.
In der Schlussfolgerung werden die Begriffe kritisch beleuchtet und die praktische Entwicklung in den Einrichtungen nochmals kurz dargestellt.
1.1 Normalisierung:
In den 1950ern wurde erstmals im skandinavischen Raum die Formel des Norma- lisierungsprinzips geprägt (im Laufe der Zeit prägten andere Autoren auch die Be- griffe Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung). Dazu schrieb Bank-Mik- kelsen 1969 in einer Zusammenfassung zu seinem Verständnis des Normalisierungsprinzips: „ Als Ziel einer modernen Betreuung von geistig Behin- derten sehen wir die möglichst weitgehende `Normalisierung´ der Lebensbedin- gungen an. ... So streben wir die Eingliederung der Behinderten in die Gemein- schaft auf jede nur mögliche Weise an. ...“ (vgl. Schäder 2002: 60).
Wobei Normalisierung nicht die Anpassung des Menschen mit einer Behinderung an die gesellschaftliche Norm bedeutet, sondern eine Reduzierung der Hilfsange- bote zum Ziel hat. „ Das bedeutet, dass dem Individuum nur diejenigen Hilfsange- bote zur Verfügung gestellt werden, die es zur Überwindung seiner durch die Be- hinderung bedingten Einschränkung benötigt.“ (vgl. Göbel 2007: 66).
Zudem wurde nach Möglichkeiten gesucht die Lebensläufe der Menschen mit ei- ner Behinderung an die Lebensläufe von Menschen ohne Behinderung anpassen zu können (vgl. Kruse 2010: 14). Dies bedeutet, dass man versucht hat für Men- schen mit einer Behinderung die gleichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch für Menschen ohne eine Behinderung als „normal“ gelten. Eine Ausbildung absolvieren, danach aus dem Elternhaus ausziehen und beginnen, ein soweit mög- lichst unabhängiges Leben trotz der vorhandenen Einschränkungen zu führen.
In der Folge der Psychiatrie-Enquete des Deutschen Bundestages 1975, des Be- kanntwerdens der Betreuungsskandale in großen Einrichtungen und der immer größer werdenden Distanz der eigenen Mitarbeiter zu den traditionellen Anstalts- abläufen bekam das Lebenshilfekonzept immer mehr Aufschwung. So begann der Ausbau von teilstationären Einrichtungen nach dem Lebenshilfekonzept aber auch gleichzeitig der Ausbau, Umbau und die z.T. konzeptionelle Umstrukturierung von Anstaltsplätzen (vgl. Schädler 2002 : 61 f).
Bank-Mikkelsen sowie die Bundesvereinigung der Lebenshilfe kommen unabhän- gig voneinander zu dem Schluss, dass sich die Arbeit in vollstationären Einrich- tungen der Behindertenhilfe zukünftig stärker mit Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen und älteren Menschen mit Behinderungen beschäfti- gen muss (vgl. Schädler 2002: 61).
Genau dies sieht Gaedt als Nachteil des Deinstitutionalisierungsbestrebens an, da sich vollstationäre Einrichtungen durch den Auszug von Menschen mit leichten und mittelgradigen Behinderungen mehr zu „Schwerstbehindertenzentren“ ent- wickeln würden (vgl. Schädler 2002: 66).
Wenn man von Normalisierung spricht, muss man auch die Mitarbeiter einbezie- hen, die oft in der Rolle als „Beschützer“ oder „Besserwisser“ auftreten. Manche Mitarbeiter in der stationären Eingliederungshilfe versuchen Bewohner „zu ihrem Glück zu zwingen“ und denken, dass Sie besser wissen, was den Bewohnern ge- fällt oder gut tut. Dies führt zu einer Überbehütung der Menschen mit Behinde- rung. So erleben sie selten das Gefühl des Scheiterns und können nur bedingt eine Frustrationstoleranz entwickeln. Im Zuge der Normalisierung muss man sich aber mit dem Scheitern auseinandersetzen, da neue Wege auch Misserfolge beinhalten können. Deshalb gehört genau dieses (der Misserfolg) zum Normalisierungsprin- zip, da ein Mensch mit Behinderung genauso an Dingen scheitern kann, wie ein Mensch ohne Behinderung. „Dieses Scheitern-Können gehört zum Menschsein dazu.“ (vgl. Schulz- Nieswandt 2007: 36).
Diese Diskussionen der 1970er und 1980er Jahren haben jedoch zu keiner nen- nenswerten Veränderung in der stationären Behindertenhilfe in Deutschland ge- führt. Die Sicherung von Macht und Einfluss schien unter den Akteuren stärker verbreitet zu sein als das fachliche Interesse und die Veränderungsbereitschaft (vgl. Schädler 2002: 67).
Wenn man Normalisierung und ihre Ziele im heutigen Kontext mit der gesell- schaftlichen Entwicklung betrachtet, muss man sich fragen: Ist es überhaupt mög- lich ein „normales“ Leben zu führen? In der heutigen Zeit gibt es nur noch selten
„Normalität“ an der sich Lebensentwürfe orientieren können. An wem oder was soll sich dann der Mensch mit einer Behinderung orientieren? Vielleicht an der „Normalität“, dass nichts mehr „normal“ ist (vgl. Hano 2009: 125)?
1.2 Selbstbestimmung/ Empowerment
Mitte der 1990er Jahren gewinnt die Ausrichtung der Menschen mit einer Behin- derung am Thema Selbstbestimmung weiteren Aufschwung. Dies wurde durch fachlich-konzeptionelle Entwicklungen und sozialpolitische Veränderungen ge- stützt. Jedoch sind es die Menschen mit Behinderung selbst, die diesen Prozess durch die Veränderung ihres Selbstverständnisses vorantreiben. Sie fordern mehr Entscheidungsautonomie, um ihr Leben (ihre Lebensläufe) selbst (mit) zu bestim- men und zu gestalten. Dies hat zur Folge, dass auch Menschen mit einer Behinde- rung in die Pflicht genommen werden, für ihr Leben eigenverantwortlich zu sein. Dies wurde ihnen bislang durch das Erbringen von einem „Rund-um- Sorglos-Pa- ket“ abgenommen bzw. gab man ihnen erst gar nicht die Möglichkeit Eigenver- antwortung zu übernehmen (vgl. Hano 2009: 125).
1.3 Integration/ Inklusion:
Der Begriff der Integration bildete sich in der Elternbewegung gegen Ende der 1960er Jahre. Diese Eltern widersetzten sich dagegen, dass ihre Kinder aus ihrem natürlichen sozialen Umfeld herausgerissen wurden, um in sonderpädagogischen Einrichtungen „betreut“ zu werden, anstelle einer Integration in einem „Regelkin- dergarten“ oder einer „normalen“ Schule. Diese Forderungen wurden von vielen Menschen und unterschiedlichen Seiten beleuchtet, was, wie zu erwarten war, Be- fürworter und Gegner der Integration und ihrer Begrifflichkeit zur Folge hatte. Unter dem standhaften Druck der Initiativen wurde der Begriff der Integration in die Schulgesetze aufgenommen und führte dazu, dass er zum „Schlachtruf“ für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am „normalen“ Bildungssystem wurde.
In der Arbeit mit erwachsenen Menschen mit einer Behinderung führte der Begriff der Integration zu einer Spaltung in zwei Lager. Eine Gruppe sah den Begriff der Integration als Möglichkeit, Trennungslinien zwischen Menschen mit und ohne eine Behinderung aufzuheben und eine größtmögliche und erwünschte Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung an der Gemeinschaft zu realisieren. Die an- dere Gruppe empfand die Integration als Anpassungs- und Unterdrückungsprozess der Menschen mit einer Behinderung, sie verfolgte das Ziel der Emanzipation und die damit verbundene Entwicklung von eigenem Selbstbewusstsein (vgl. Quack 2010: 85 ff).
Ergebnis des Bildungsgipfels der UNESCO 1994 in Salamanca war die Forde- rung, dass „ausnahmslos allen Kindern eine die unterschiedlichen Ressourcen je- des Kindes wertschätzende Bildung in Regelschulen zu ermöglichen“ ist (Quack 2010: 87). Da diese Ergebnisse den Inhalten und Forderungen der Integrationsbe- wegung in Deutschland ähnelten, wurde der englische Begriff „inclusion“ mit dem deutschen Wort Integration übersetzt. Integrationsforscher begannen seit etwa dem Jahr 2000 ihre Kritik an dem Integrationsbegriff zu intensivieren. Als Abgrenzung und Weiterentwicklung zu dem bisherigen Begriff der Integration be- nutzen sie den Begriff der Inklusion in Anlehnung an die internationale Fachdis- kussion. Obwohl dieser Begriff für viele Fachleute keine inhaltliche Neuerung mit sich brachte, verbreitete sich das Paradigma der Inklusion sehr schnell. Grundlage des inklusiven Denkens ist, dass ein Problem nicht von der Person ausgeht, son- dern in einer Wechselwirkung zwischen der Person und ihrer Umwelt entsteht. So würden in einer inklusiven Gesellschaft keinerlei Untergruppen existieren (dies ist nicht nur auf Menschen mit einer Behinderung bezogen, sondern betrifft auch an- dere „Randgruppen“) (vgl. Quack 2010: 87 ff). Ob dies möglich ist, wird hier nicht näher diskutiert. Es hinterlässt sicherlich einige offene Fragen.
Der Begriff der Inklusion wird zudem als Leitbegriff in der Konvention der Ver- einten Nationen zu den Rechten von Menschen mit einer Behinderung benutzt und wurde dadurch auch zu einem „Leitstern“ in Deutschland. Hier sieht Conty eben- falls den Begriff der Inklusion als einen Begriff, der „umfassende grundrechtsba- sierte und werthaltige Qualitäten“ (Conty 2010: 7) mit sich bringt, jedoch in naher Zukunft nicht erreicht werden kann. Er betrachtet das Konzept als einen Weg in die richtige Richtung und als einen „Ansatz für umfassende Bildungs- und Gesell- schaftsentwicklung.“ (Conty 2010: 7).
Sperl wiederum sieht den Inhalt des Begriffes der Inklusion wie folgt: Inklusion bedeutet, dass der Einzelne sich mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten in die Gesellschaft mit einbezieht und somit eine größere Teilhabe erfährt, als wenn er sich nicht aktiv mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringt (vgl. Sperl 2010: 39).
1.4 Teilhabe:
Der Begriff der Teilhabe wurde erstmals im SGB IX angewendet. Er ist an den Begriff der „Partizipation“, der in der „Internationalen Klassifikation der Funk- tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) zu finden ist, angelehnt. Mit der Schaffung des SGB IX und dem dazugehörigen Begriff der Teilhabe wurde die selbstbestimmte Teilhabe in allen Lebensbereichen von Menschen mit Behin- derung in den Mittelpunkt gestellt.
„ „Die Teilhabe umschreibt die Beteiligung der Person an der Gestaltung der Pro- zesse in den für sie bedeutsamen Lebensbereichen (...). Vollständige Teilhabe an einem Lebensbereich liegt dann vor, wenn eine Person selbstbestimmt, gleichbe- rechtigt und unabhängig, ihre Gegenwart und Zukunft gestalten kann“ (Grampp 2003, S. 35).“ (vgl. Kruse 2010: 16 f).
1.5 Ausbau neuer Wohnmöglichkeiten:
In den 1960er und 1970er Jahren entstanden durch Elterninitiativen viele neue Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, diese beinhalteten u.a. alternati- ve Wohnmöglichkeiten zur vollstationären Unterbringung (vgl. Kruse 2010: 13).
Es wurden Plätze im ambulanten Wohnen geschaffen, die sich zwar in der Nähe der Kerneinrichtung, jedoch oft beispielsweise in einem Wohngebiet im Nachbar- ort befanden. So konnte man die „Vorzüge“ der stationären Einrichtung genießen
(umfangreiche Freizeitangebote, Großküche, Wäscherei etc.), lebte aber in einer anderen Umgebung, so dass man sich nicht mit den „eigenen Dorfstrukturen“ aus- einandersetzten mussten.
1.6 Demographische Entwicklung:
Die momentan steigende Zahl an Menschen mit einer Behinderung in vollstatio- nären Einrichtungen, besonders der Anstieg von älteren Menschen mit einer Be- hinderung ist in Zusammenhang mit folgenden Punkten zu erklären:
- Durch die Ermordung von Menschen mit einer Behinderung in den Zeiten des Nationalsozialismus beträgt das jetzige Durchschnittsalter der Men- schen mit einer Behinderung in vollstationären Einrichtungen 40 - 50 Jahre. Dies hat zur Folge, dass weniger Menschen in den Einrichtungen verster- ben, als neue Menschen mit einer Behinderung einziehen.
- Durch den medizinischen Fortschritt und die gute Betreuung haben Men- schen mit einer Behinderung eine höhere Lebenserwartung als noch vor ein paar Jahren.
- Der Personenkreis von Menschen mit Doppeldiagnosen, Menschen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen und chronischen psychischen Kra- nkheiten nimmt zu. (vgl. Hano 2009: 119).
1.7 Schlussfolgerung zur Fragestellung
Mit den Einführungen des Sozialgesetzbuches IX und dem § 11 Absatz 1 Satz 2 des Heimgesetzes („die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstver- antwortung der Bewohnerinnen und Bewohner wahren und fördern, insbesondere bei behinderten Menschen die sozialpädagogische Betreuung und heilpädagogi- sche Förderung sowie bei Pflegebedürftigen eine humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde gewährleisten“) und der Entwicklung des per- sönlichen Budgets wurde die Diskussion über Normalisierung der Hilfen und In- dividualisierung der Dienstleistungen in der Eingliederungshilfe immer wieder neu entfacht.
Viele vollstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe gründeten FED´s (Fa- milien Entlastender Dienst) oder FÜD´s (Familien Unterstützender Dienst) als ambulante Zweige ihres Angebotes. Die Wohnplätze im ambulanten Wohnen/ Be- treuten Wohnen wurden ausgebaut und man versuchte Wohngruppen/einheiten aus der „dorfähnlichen“ Struktur der Einrichtungen in Wohngebiete auszulagern.
Die Überprüfungen der Notwendigkeit eines stationären Wohnplatzes (bei Neuan- trag sowie bei Wiederantrag) seitens der Kostenträger nahmen zu. Es wurde ge- nauer auf die Begründungen für eine vollstationäre Unterbringung geachtet und die Wünsche der Klienten bei der Wohnplatzsuche stärker berücksichtigt.
Nach der Diskussion um die Normalisierung, Enthospitalisierung und De- Institu- tionalisierung wird aktuell ein Konzept der gemeindenahen Versorgung verfolgt. Hierzu sollen Häuser und Wohnungen in Wohngebieten angemietet werden, oder kleine Häuser für etwa 20- 30 Menschen mit Behinderungen in bestehenden Wohngebieten bzw. Neubaugebieten gebaut werden. So wird zwar die „dorfähnli- che“ Struktur vieler großen Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung aufgelöst. Wenn man jedoch die Definition und die Merkmale der „Totalen Insti- tutionen“ nach Goffman zugrunde legt, wird hier nur ein Merkmal der „Totalen Institutionen“ beseitigt, nämlich die „.. Beschränkung des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt ...“ (vgl. Göbel 2007: 9).
Trotz der Nachbarschaft von Menschen mit und ohne Behinderung bleibt der Charakter einer Einrichtung erhalten. Dienstzeiten der Mitarbeiter geben dem Tagesablauf eine vorbestimmte Struktur. Auch hier wohnen die Menschen mit ei- ner Behinderung unter „deren gleichen“. Eine Individualisierung jedes Einzelnen ist auch hier kaum möglich, wenn man von der Einrichtung seines Zimmers (falls es sich um ein Einzelzimmer handelt) absieht. Freizeitaktivitäten die nicht selbst- ständig durchgeführt werden können, sind von der Struktur des Dienstplanes und des Wohlwollens des Mitarbeiters abhängig, den man wiederum mit den Mitbe- wohnern teilen muss. Zählt hier „Wer zuerst kommt, malt zuerst?“ Auch die Inte- gration in „normale“ Vereine, wie z.B. einen Sportverein oder die freiwillige Feu- erwehr ist schwer möglich. Die meisten Vereine sind momentan noch nicht auf die Integration von Menschen mit einer Behinderung in ihre Strukturen eingestellt.
Eine vollständige Umsetzung des Normalisierungsprinzips oder die vollkommene Selbstbestimmung des Lebens eines Menschen mit einer Behinderung scheint nicht möglich. Sie sind meist in irgendeiner Weise von einer Dienstleistung ab- hängig, die einer klaren Struktur unterliegt. Der ambulante Pflegedienst kommt zu einer bestimmten abgesprochenen Zeit, ob dies gerade gewünscht ist oder nicht. Die Betreuer haben eine festgelegte Dienstzeit, also sind sie von .. bis .. anwesend, Änderungen dieser Zeiten sind meist nur mit langen Planungen und Absprachen möglich. Spontane Unternehmungen oder Willensänderungen können kaum be- rücksichtigt werden. Zudem teilt der Mensch mit Behinderung meist eine Woh- nung oder ein Haus mit mehreren Menschen mit Behinderung, die dann gemein- sam betreut werden.
Trotzdem sollte man die Ansätze der Normalisierung, Integration, Selbstbestim- mung und Teilhabe weiter verfolgen, auch eine teilweise Umsetzung dieser Ansät- ze ist ein guter (hoffentlich großer) Schritt in die richtige Richtung.
2. Begriffserklärungen
In Abschnitt stellt die Unterschiede hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften, des beschäftigten Personals und der Finanzierung zwischen einer Einrichtung der Be- hindertenhilfe und einer Pflegeeinrichtung dar.
Zudem wird die Auswirkung der Landesgesetze auf Einrichtungen der Behinder- tenhilfe sowie die Ausbildung und der Einsatz von Heilerziehungspflegern beleuchtet.
Ebenfalls wird auf die im deutschen Sprachraum vorzufindende Trennung der Grund- und Behandlungspflege aus verschiedenen Blickpunkten eingegangen.
2.1.Einrichtungen nach dem HeimG und Finanzierung im Gegensatz zu Pflegeein- richtungen nach dem SGB XI
Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden im Heimgesetz § 1 Absatz 1 geregelt
„ (1) Dieses Gesetz gilt für Heime. Heime im Sinne dieses Gesetzes sind Einrich- tungen, die dem Zweck dienen, ältere Menschen oder pflegebedürftige oder behin- derte Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung und Verpflegung zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten, und die in ihrem Be- stand von Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben werden. ...“
Aufgrund des Vorranges der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sind Ein- richtungen der Eingliederungshilfe keine Pflegeeinrichtungen. Dies ist in § 71 Abs. 4 SGB XI „Pflegeeinrichtungen“ festgeschrieben (vgl. SGB XI).
Da Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht § 71 SGB XI unterliegen, werden für den Hauptteil der Heimplätze, ausgenommen Plätze die einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen zur Grundlage haben oder solche die von Menschen mit Be- hinderungen und zusätzlicher Pflegestufe in Anspruch genommen werden, nicht die für Pflegeeinrichtungen geltenden Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen an- gewandt. Durch diesen Zusammenhang erklärt sich die personelle Zusammenset- zung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Trotz eines Anstiegs des Pflegebe- darfs und des Bedarfs an behandlungspflegerischen Maßnahmen, sind die Fachkräfte in Einrichtungen der Behindertenhilfe meist pädagogisch, sonderpäd- agogisch oder sozialpädagogisch ausgebildet.
Dies resultiert aus dem teilhabeorientierten Hauptauftrag der Einrichtungen (vgl. BEB 2009: 7).
Menschen mit einer Behinderung die in vollstationären Einrichtungen in Hessen leben, werden mit Hilfe eines Metzlerbogens eingeschätzt und erhalten durch die Beurteilung der einzelnen Items einen Punktewert. Dieser Punktewert führt zu ei- ner Eingruppierung in eine Hilfebedarfsgruppe. Diese Hilfebedarfsgruppe ist wie- derum Grundlage für das vom LWV (Landeswohlfahrtsverband) gezahlte Heimentgelt. Dieses Heimentgelt wird für alle 5 Hilfebedarfsgruppen (1-5) mit je- der Einrichtung spezifisch ausgehandelt. In diese Verhandlungen fließen die Lei- stungen der Einrichtung, die Örtlichkeit (städtisch oder ländlich), ein Investitions- betrag für notwendige Renovierungen und weitere einrichtungsspezifische Dinge mit ein. Momentan wird eine Umstellung vom Metzlerbogen auf den ITP (In- tegrierte Teilhabe Planung) in zwei Pilotregionen getestet. Der ITP ermittelt durch eine vorher vereinbarte Zielsetzung einen Minutenwert, der zur Umsetzung dieser Ziele in der Einrichtung benötigt wird. Dieser Minutenwert wird auf der Grundla- ge eines wissenschaftlich erstellten Zeiterfassungsbogens in eine Leistungsgruppe umgerechnet. Auch hier wird für alle 7 Leistungsgruppen (1-7) und die zusätzli- chen Gruppen U1 (diese hat einen Minutenwert unter der Eingruppierung zu der Leistungsgruppe 1 erreicht) und 7+ (diese hat einen Minutenwert über der Ein- gruppierung zu Leistungsgruppe 7 erreicht) ein einrichtungsspezifisches Entgelt auf der gleichen Basis wie für den Metzlerbogen verhandelt. Die Pilotregionen haben die Umstellung auf den ITP am 01.02.2010 begonnen und sollten sie vor- aussichtlich bis 31.12.2010 beibehalten. Nach der Beendigung und Evaluation ist eine Umstellung von Metzler auf ITP in ganz Hessen geplant. (telefonische Aus- kunft durch eine Mitarbeiterin des LWV Hessen am 14.04.2010)
Menschen mit einer Behinderung, die zusätzlich zu ihrer Hilfebedarfsgruppe/ Lei- stungsgruppe einen Pflegebedarf haben, bekommen Leistungen nach § 43a SGB
XI. Dieser Paragraph besagt, dass die Pflegekasse einen Betrag von max. 256 € im Monat zu dem vereinbarten Heimentgelt hinzubezahlt. Dies kommt jedoch nicht dem Menschen mit Behinderung zu Gute sondern entlastet den Sozialhilfe-
träger, d.h. der LWV Hessen erhält die 256 € monatlich und verrechnet dies mit dem Heimentgelt das er der Einrichtung für den jeweiligen Bewohner zahlt.
Im Gegensatz zu den Kosten in einer Pflegeeinrichtung übernimmt der LWV fast alle anfallenden Kosten, eine Ausnahme stellen die Lebensunterhaltskosten dar. Diese Regelungen finden sich in den §§ 92 SGB XII „Anrechnung bei behinderten Menschen“ und 92a SGB XII „Einkommenseinsatz bei Leistungen für Einrichtungen“ .
Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nach dem § 71 SGB XI Absatz 2: „...selbstän- dig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige:
1. unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft ge- pflegt werden, ...“
2. ganztätig (vollstationär) oder nur tagsüber oder nur nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden können. ...“
Dies stellt bereits einen Unterschied zu den Einrichtungen der Behindertenhilfe dar, da diese unter dem Aspekt der Teilhabe von Mitarbeitern mit einer pädagogi- schen Ausbildung „betreut“ werden.
Personen die in einem Pflegeheim untergebracht sind, haben vorher das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 SGB XI durchlaufen. Hier wird die Voraussetzung der Pflegebedürftigkeit geprüft und eine Einordnung in eine Pflegestufe vorgenommen. In § 15 SGB XI sind die Pflegestufen (insgesamt 3) aufgeführt und die inhaltlichen Richtlinien zur Einstufung in eine Pflegestufe auf- geführt. § 43 SGB XI regelt die Inhalte der Leistungen und die dafür gezahlten Entgelte für die Pflegeheime.
Ist ein Bewohner nicht in der Lage die anfallenden Mehrkosten für die Unterbrin- gung in einer Pflegeeinrichtung durch seine Rente oder sein Vermögen zu bestrei- ten, werden die Angehörigen nach einer Vermögensprüfung dazu herangezogen oder die Mehrkosten von dem Sozialhilfeträger beglichen.
2.2 Gegenüberstellung der verschiedenen Berufsbilder in Einrichtungen der Behindertenhilfe
Zur Vollständigkeit muss hier erwähnt werden, dass außer den in der folgenden Tabelle aufgeführten Berufen auch Sozialpädagogen (BA Soziale Arbeit), Heil- pädagogen und Kinderkrankenschwestern/ -pfleger (die zu dem Kreis der Pflege- fachkräfte zählen) in Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten. Diese werden jedoch nur zu einem geringen Teil eingesetzt und aus diesem Grund die in der Ta- belle nicht berücksichtigt wurden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Arbeit zitieren
- Ute Schulz (Autor:in), 2010, Die Veränderung der Bewohnerstruktur in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und die damit verbundenen Konsequenzen für die Personalentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158277
Kostenlos Autor werden
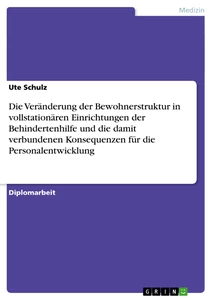















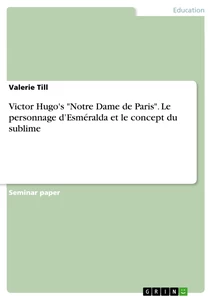



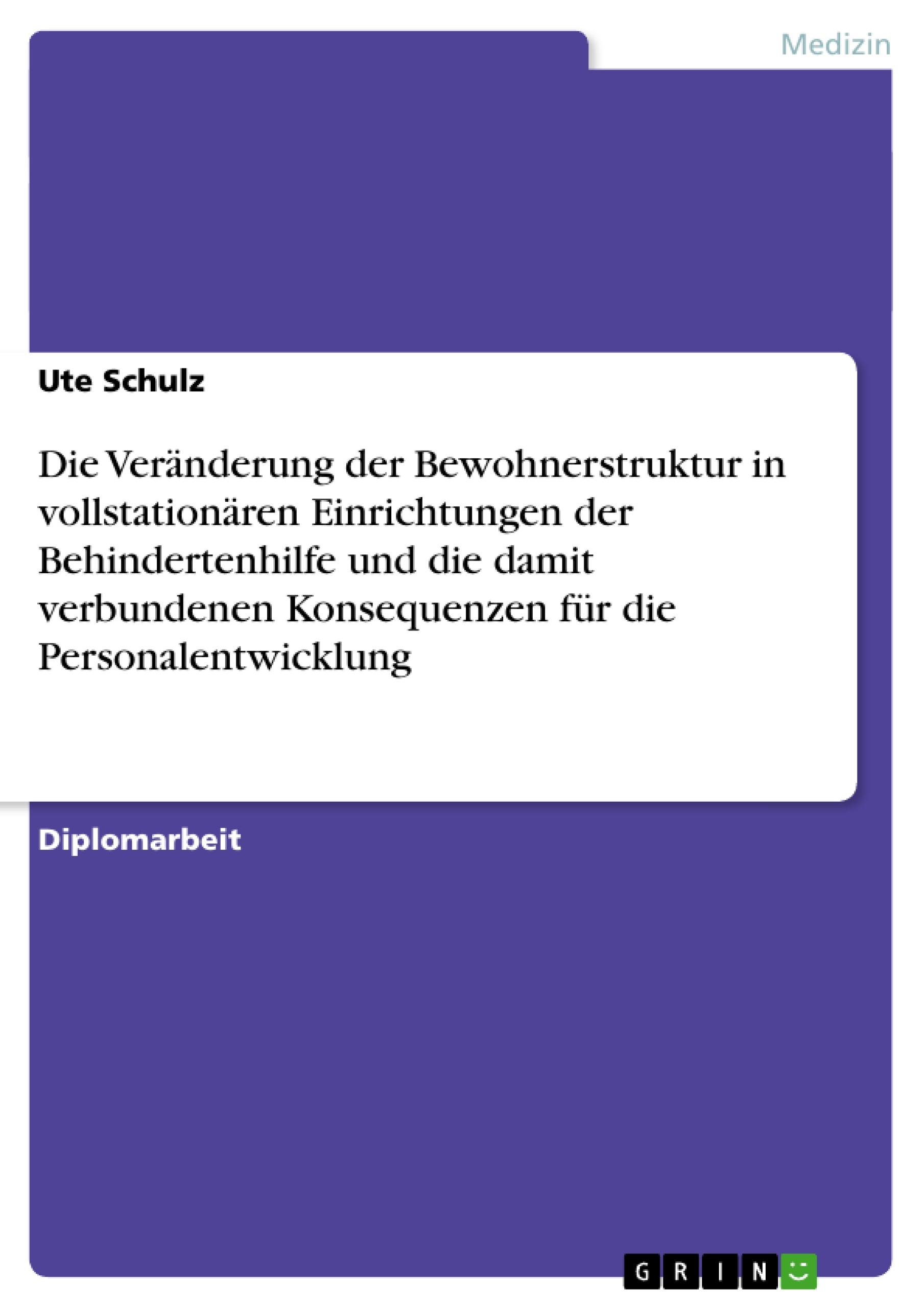

Kommentare