Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Transformation in der Literatur
2.1 Typologie politischer Systeme
2.1.1 Merkmale demokratischer und autokratischer Systeme
2.1.2 Stabilität politischer Systeme
2.1.3 Typen autoritärer und totalitärer Systeme
2.2. Die Transformationstheorie
2.2.1 Der Transformationsbegriff
2.2.2 Politische und wirtschaftliche Transformation
3 Analyse der ausgewählten Länder
3.1 Zur Analyse Ostdeutschlands
3.1.1 Der Transformationsschock der Jahre 1989 bis 1991
3.1.2 Der Entwicklungsprozess in Ostdeutschland bis heute
3.1.3 Zwischenfazit und Ausblick
3.2 Zur Analyse Polens
3.2.1 Die wirtschaftliche Entwicklung in den Übergangsjahren
3.2.2 Der Entwicklungsprozess Polens bis heute
3.2.3 Zwischenfazit und Ausblick
3.3 Zur Analyse der Tschechischen Republik
3.3.1 Die Entwicklung in der ČSFR von 1991 bis Ende 1992
3.3.2 Der Entwicklungsprozess der Tschechischen Republik
3.3.3 Zwischenfazit und Ausblick
3.4 Abschließender Vergleich der analysierten Länder
4 Regionalökonomische Analyse der ausgewählten Länder
4.1 Zur Methodik der durchgeführten Clusteranalyse
4.2 Ergebnisse der Clusteranalyse in den ausgewählten Ländern
4.2.1 Ergebnisse des Bruttoinlandsprodukt pro Kopf-Vergleichs
4.2.2 Ergebnisse des Vergleichs der Arbeitslosenquoten
4.3 Fazit der regionalökonomischen Analyse
5 Schlussbemerkungen
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Datenquellen
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im vergangenen Jahr 2009 jährte sich der Beginn der politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen in den ehemaligen Staaten des kommunistischen Ostblocks zum zwanzigsten Mal. In Berlin, Warschau und Prag wurde dieses Jubiläum als der Sieg der Macht des Volkes über die undemokratische, repressive sowie durch Mangelwirtschaft und persönliche Entbehrungen gekennzeichnete Staats- und Wirtschaftsform der sozialistischen Planwirtschaft gefeiert. Erst das Auflehnen der Bevölkerung gegen diese hatte dazu geführt, dass in der DDR, in Polen und in der Tschechischen Republik – genau wie in allen anderen Satellitenstaaten der damaligen Sowjetunion auch – Ende der 1980er Jahre die Grenzen zum Westen hin geöffnet wurden. Dort hatten sich erfolgreich, in Form von wirtschaftlichem und persönlichem Wohlstand, demokratisch freie Marktwirtschaften etabliert. Deren politischen und ökonomischen Strukturen und Gegebenheiten stellten den Referenzpunkt, das anzustrebende Ziel, aller einzuleitenden Reformmaßnahmen dar. Diese Maßnahmen zielten alle darauf ab, die politische und wirtschaftliche Transformation, also den Systemwechsel – weg von Kommunismus und Planwirtschaft hin zu Demokratie und Marktwirtschaft – möglichst rasch bewerkstelligen zu können. Dieses Bestreben wurde jedoch durch die Relikte der bis dahin vierzig Jahre andauernden „Misswirtschaft“ [Sandgruber/Loidol, 2001, S. 15] erheblich erschwert, so dass dieser Systemwechsel nicht ohne Kosten in Form von einer sinkenden gesamtwirtschaftlichen Produktion, steigenden Verbraucherpreisen und sozialen Härten, wie eine steigende Arbeitslosigkeit, von Statten gehen konnte.
Gegenstand dieser Arbeit ist es, speziell die wirtschaftlichen Entwicklungen in der DDR, in Polen und in der Tschechischen Republik seit 1989 darzustellen.
Dennoch sollen zu Beginn auch theoretische Grundlagen aus der Politikwissenschaft bezüglich verschiedener Staatsformen erörtert werden. Das sozialistische Politiksystem des Sowjettyps konnte nur mittels einer repressiven und undemokratischen Machtausübung gegenüber der Bevölkerung bestehen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Niederschlagung der Aufstände in Polen im Juni 1956 oder in der ČSSR im August 1986. Es stellt sich also die Frage, ob eine autokratische Staatsform, wie sie beispielsweise die Kommunistischen Parteien unter der Führung der Sowjetunion in den verschiedenen Ländern in Mittel- und Osteuropa einrichteten, auch ohne Gewalt überlebensfähig ist.
Da die Geschichte gezeigt hat, dass dies im Falle der drei Länder nicht möglich war, wird in dieser Arbeit zudem erläutert, welche Elemente ein Übergang zu einer demokratischen Staatsform und einem freien Wirtschaftssystem beinhalten muss, um eine erfolgreiche Transformation durchlaufen zu können. Nachdem folglich im zweiten Kapitel eine mehr theoretisch-politikwissenschaftliche Untersuchung dargestellt wird, folgt in den nächsten Kapiteln eine mehr wirtschaftlich-empirische Sichtweise.
Hierbei werden insbesondere auch die schwierigen Jahre des Übergangs nach dem Zusammenbruch des politischen Systems betrachtet. Es stellt sich die Frage, wie schnell sich diese Transformationsländer – Ostdeutschland wird in dieser Arbeit wie ein eigenständiges Land behandelt – von den politischen Umbrüchen, die auch unmittelbare Auswirkungen auf das wirtschaftliche System hatten, erholen und den angestrebten Konvergenzpfad zu den westlicheren Ökonomien einschlagen konnten. Des Weiteren wird dargestellt, wie sich Erfolge und Rückschläge in den jeweiligen Entwicklungsprozessen dieser Länder auf das erklärte Ziel der Erhöhung der Wirtschaftskraft und der Lebensverhältnisse ausgewirkt haben.
Durch die Aufnahme in das Staatengebiet der Bundesrepublik stellt Ostdeutschland im Vergleich zu den anderen beiden Ländern gewissermaßen einen Sonderfall dar. Aus diesem Grund sollen die westlicheren Bundesländer als Referenzobjekt bezüglich einer eventuellen wirtschaftlichen Konvergenz dienen. Neben einem komparativen Vergleich zwischen den drei behandelten Ländern, ist folglich auch bei diesen beiden von Interesse, wie sie sich gegenüber anderen OECD-Ländern entwickelten. Dies soll im Folgenden in Kapitel 3 anhand ausgewählter Indikatoren dargestellt werden.
Trotz eines eventuell zufriedenstellenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumspfades können auf der Regionalebene erhebliche Unterschiede bestehen. Beispielhaft kann hierfür die Diskussion um die Existenz so genannter ostdeutscher Leuchttürme als förder- und entwicklungsfähige Wirtschaftszentren im Gegensatz zu den Peripheriegebieten stehen [vgl. Braun/Eich-Born, 2008]. Wie sich regionale Unterschiede der Regionen in Ostdeutschland, Polen und der Tschechischen Republik bezüglich des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf und der Arbeitslosenquoten darstellen, wird dann abschließend in Kapitel 4 im Rahmen einer Clusteranalyse näher untersucht.
2 Transformation in der Literatur
In den folgenden theoretischen Ausführungen soll speziell auf die verschiedenen Formen von politischen Systemen eingegangen werden und zudem darauf, nach welchen Kriterien die hiervon real existierenden Varianten klassifiziert werden können (Kapitel 2.1.1). Des Weiteren soll erläutert werden, ob der Zusammenbruch des politischen Systems in den ehemaligen Staaten des Ostblocks auf systemendogene Ursachen zurückgeführt werden kann (Kapitel 2.1.2). Nachdem dieses geklärt wird, wird auf die Klassifizierung verschiedener nichtdemokratischer Systeme – wie sie auch in der DDR, in Polen und der Tschechischen Republik vorlagen – eingegangen (Kapitel 2.1.3), bevor eine genauere Erklärung des Transformationsbegriffes (Kapitel 2.2.1) und eine theoretische Betrachtung der notwendigen Voraussetzungen sowie der möglichen Verlaufsformen von politischen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen folgen wird (Kapitel 2.2.2).
2.1 Typologie politischer Systeme
Nach Merkel ist ein politisches System ein funktional spezialisiertes Teilsystem, dessen Aufgabe es ist, durch die gesellschaftliche verbindliche Allokation von Werten und Gütern das Überleben der Gesamtgesellschaft zu sichern [vgl. ebenda]. Andere Komponenten des Gesamtsystems Staat sind zusätzlich noch die vorhandenen Teilsysteme wie Wirtschaft, Wissenschaft und Recht. Im Gegensatz zum politischen Subsystem verfügen die anderen Systemkomponenten nicht über besondere staatliche Gewalt- und Sanktionsmittel um eben dieses Ziel des Überlebens der Gesamtgesellschaft zu erhalten oder beizuführen. Max Weber sprach hierbei vom „Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit“ [Weber, 1972, S.822], die dem politischen Teilsystem die Aufgabe der Organisation des Gesamtsystems zukommen lässt.
Diese Legitimation des Teilsystems Politik zur genannten Organisation des Gesamtsystems bedarf einer Ausbildung von Strukturen und Mechanismen, die den Zugang zur und die Sicherung der politischen Macht ermöglichen. Hierbei sollen das politische System kennzeichnenden Normen den Herrschaftsanspruch und die spezifische Konfiguration der staatlichen Herrschaftsinstitutionen im betrachteten System charakterisieren.
Diese Charakterisierung und somit auch das Vergleichen der verschiedensten vorliegenden Systemformen des politischen Teilsystems, also die Regierungslehre, geht bis in das fünfte vorchristliche Jahrhundert in Griechenland zurück[2]. Die damalige politische Landkarte war geprägt von zahlreichen Stadtstaaten, deren genauere Beschreibung bezüglich der vorchristlichen politischen Gegebenheiten sich vor allem in den Schriftstücken der antiken griechischen Philosophen und Historikern Thukydides (ca. 455-396) , Plato (427-347) und Aristoteles (384-322) wieder finden lässt, deren Aufzeichnungen und Untersuchungen als die ersten Schritte im Bereich der vergleichenden Regierungslehre gelten.
Nach dem Niedergang der Poliskultur erlosch auch gleichsam allmählich das Interesse an der vergleichenden Regierungslehre. Erst mit Beginn des Zeitalters der Renaissance und der in dieser Zeit sich herausbildenden Königreiche mit einer starken Zentralgewalt, wie zum Beispiel in Frankreich, Spanien und England, sowie der zu dieser Zeit erfolgten territorialen Entdeckungen in Afrika, Asien und Amerika und in der Konsequenz das Aufeinandertreffen mit nichtchristlichen Mächten und fremdartigen politischen Strukturen führte wieder zu einem Aufflammen der vergleichenden Literatur bezüglich der Staats- und Regierungsformen. Der Italiener Machiavelli (1469-1527) sowie der Franzose Bodin (1530-1596) sind hierbei als eine der wichtigsten Staatstheoretiker, die sich mit den komparativen Formen der vorliegenden Machtkonstellationen beschäftigten, zu nennen. Unter dem Eindruck einer neuen Form der politischen Organisation des Gemeinwesens, die sich im 16. bis 18. Jahrhundert herauskristallisierte, nämlich der „moderne Flächen- und Nationalstaat“ [Brunner, 1979, S. 25], kamen neue Ansätze der Regierungslehre auf[3].
Autoren wie der französische Baron de Montesquieu (1689-1755) versuchten Mitte des 18. Jahrhunderts eine Synthese dieser neuen verschiedenen Methoden auf komparativer Basis unter der Einbeziehung von Realfaktoren wie den politischen Institutionen oder ökonomischen Gegebenheiten einem „Absolutheitsanspruch“ [Brunner, 1979, S. 32] gerecht zu werden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es vor allem die deutsche Allgemeine Staatslehre mit seinen Begründern von Mohl (1799-1875) und dem Schweizer Bluntschli (1808-1881), deren Veröffentlichungen einer großen Synthese folgend maßgeblich zur Vergleichbarkeit von Regierungsformen diente.
Ihren Höhepunkt erreichte die Staatslehre dann um die Jahrhundertwende in der Allgemeinen Staatslehre, in der bereits von der „Doppelnatur des Staates“ [Brunner, 1979, S. 35] als ein gesellschaftliches Gebilde mit rechtlichen Institutionen ausgegangen wurde. Diese Differenzierung spielt dann auch unten bei der Betrachtung der verschiedenen Herrschaftssysteme wie der Demokratie und den autokratischen Systemen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
Während sich auch über den ersten Weltkrieg hinaus die Staatenlehre vor allem auf die Untersuchung und den Vergleich von demokratischen Strukturen beschränkte, musste sich nach dem zweiten Weltkrieg ein grundlegender Wandel vollziehen. Der Glaube an die „alleinige Maßgeblichkeit der demokratischen Regierungsform“ [Brunner, 1979, S. 36] war erschüttert. Neben den westlichen Demokratien etablierten sich sowohl kommunistische Diktaturen als, zu dieser Zeit noch nicht abzusehende vorübergehende Regierungsformen, als auch die heterogene Staatengruppe der Entwicklungsländer der Dritten Welt als dauerhafte Staats- und Regierungsformen auf der politischen Landkarte aus. Die vorherrschende Staatslehre konzentrierte sich nunmehr nicht nur auf die westlichen Demokratien, sondern musste sich sowohl in regionalen als auch in gegenständlicher Hinsicht erweitern.
Durch die Betrachtung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems unter Hitler zu Zeiten des zweiten Weltkrieges wurde bereits der Begriff des Totalitarismus entwickelt.
In gegenständlicher Hinsicht musste der Forschungsbereich der vergleichenden Regierungslehre um den der politischen Soziologie erweitert werden. Die sozialen Kräfte hinter den politischen Institutionen wurden nun mehr und mehr beachtet. Politische Parteien, Interessengruppen, das Wählerverhalten und die politischen Eliten rückten nun immer mehr in das Interesse der Forscher, mit dem Hintergrund, dass man eine realistische Einteilung der unterschiedlichen staatlichen Gegebenheiten nicht ohne diese nicht direkt politischen aber gesellschaftlich wichtigen Teilnehmer des politischen Meinungsbildungsprozesses durchführen kann (Institutionalismus[4] ).
Um nun die Vergleichbarkeit zu erhöhen, war es Ziel, eine wissenschaftliche Theorie zu erarbeiten, mit der es möglich sein würde, äußerst unterschiedliche Regierungssysteme zu vergleichen und diese dann entsprechenden Ordnungstheorien zuordnen zu können. Es bedurfte also sachgerechten Vergleichsmaßstäben. Einer der Grundgedanken war hierbei, „dass das politische System eine von der gesellschaftlichen Umgebung abgrenzbare Gruppe von Elementen bilde.“ [Brunner, 1979, S. 42].
Neben der Institutionenforschung nahm auch die Analyse des Wandels und der Transformation politischer Institutionen seitens der Transformations- beziehungsweise Systemwechselforschung zu. Ein – vor allem im deutschsprachigen Raum - wichtiger Hauptakteur auf diesem Gebiet ist der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel [vgl. Helms/Jun, 2004, S. 32] , auf dem auch die Festlegung der Bedingungen zur folgenden Bewertung und Einteilung von Staats- und Regierungsformen in demokratische und autokratische Systeme zurückgeht.
2.1.1 Merkmale demokratischer und autokratischer Systeme
Wie bereits oben erwähnt erfuhr die Untersuchung der politischen Systeme im Mittelalter mit deren Stadtwirtschaften ihre erste Bedeutsamkeit im Bereich der Staats- und Regierungslehre. Diese Idee des Begriffes der Stadtwirtschaft hat man jedoch als „genetischen Begriff“ [Weber, 1968, S. 235] konstruiert. „Tut man dies, so bildet man den Begriff der „Stadtwirtschaft“ nicht etwa als einen Durchschnitt der in sämtlichen beobachteten Städten tatsächlich bestehender Wirtschaftsprinzipien, sondern ebenfalls als einen Idealtypus“ [Weber, 1968, S. 235].
Die Bildung solcher Idealtypen ist folglich nicht das Ziel, jedoch als Mittel um die Vergleichbarkeit von politischen Systemen zu erhöhen, beziehungsweise erst möglich zu machen, durchaus adäquat.[6]
Die Einteilung der politischen Systeme nach Merkel erfolgt somit deduktiv, also nach der Bildung von Idealtypen so wie es von Weber beschrieben wurde. Die große Vielfalt der unterschiedlich real existierenden Systeme soll so nach logischen Zusammenhängen gegliedert werden. Merkel verweist auf Unterscheidungsmerkmale zur Einteilung der politischen Herrschaft in den einzelnen Systemen auf Klassifikationskriterien wie der Herrschaftslegitimation, dem Herrschaftszugang, das Herrschaftsmonopol, die Herrschaftsstruktur, dem Herrschaftsanspruch und die Herrschaftsweise als Abgrenzungsmerkmale zwischen demokratischen und autokratischen Systemen, wobei Brunner sich auf die vier Einteilungsgrundlagen Herrschaftsstruktur, Herrschaftsumfang, Herrschaftsziele und Herrschaftsausübung beschränkt und hierbei die Herrschaftsstruktur als die „primäre Einteilungsgrundlage“ [Brunner, 1979, S. 64] aus theoretischen, praktischen und ideengeschichtlichen Gründen sieht.
Aus dieser theoretischen Sicht kommt der Struktur des Herrschaftsapparates die wichtigste Bedeutung zu. Aus praktischer Sicht kommt zudem dem Unterscheidungsmerkmal der Herrschaftsstruktur die Vorreiterrolle gegenüber den anderen möglichen Abgrenzungskriterien zu, da hierbei die Abgrenzungsschwierigkeiten noch am geringsten sind. Insbesondere bei der Beantwortung der Frage, ob im politischen System ein, zwei oder mehrere Herrschaftszentren vorliegen, es sich also um monistische oder pluralistische Herrschaftsstrukturen handelt.
Unter dem Merkmal der Herrschaftsstruktur ist nach Merkel folgendes zu verstehen:
„Ist die staatliche Macht auf mehrere Herrschaftsträger verteilt oder in der Hand eines einzigen Machtträgers? Dabei kann der „einzige Machtträger“ sowohl eine einzelne Person, eine Gruppe, Junta, Partei oder Komitee sein. Die Frage nach der Herrschaftsstruktur berührt die die traditionelle, schon vor John Locke und Montesquieu gestellte Frage nach der Gewaltenteilung, Gewaltenhemmung und Gewaltenkontrolle [Merkel, 1999, S. 26].“
Um nun die einzelnen Herrschaftstypen genau zu definieren und voneinander abzugrenzen und um zu deuten, ob auch wirklich eine Transformation, also ein wirklicher Systemwechsel vorliegt[7], beschränkt sich Merkel jedoch nicht nur auf das beschriebene Merkmal der Herrschaftsstruktur, sondern stellt diesem, wie bereits erwähnt noch andere Unterscheidungskriterien zur Seite. Diese sind neben der Herrschaftslegitimation auch die Kriterien des Herrschaftszugangs, des Herrschaftsanspruchs, das darauf abzielt, wie groß die Regelungs- und Interventionstiefe der staatlichen Herrschaft gegenüber der Bevölkerung ist und ob zum Beispiel Grund- und Menschenrechte von diesen außer Kraft gesetzt werden, der Herrschaftsweise sowie die Frage in welchen Händen das Herrschaftsmonopol zur Durchsetzung von Entscheidungen liegt. Eine genauere Übersicht der Merkmale dieser Kriterien ist auch in Tabelle 1 gegeben.
Tabelle 1: Merkmale von demokratischen, autoritären und totalitären Systemen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Merkel, 1999, S. 28
Nach diesen genannten Unterscheidungskriterien lassen sich nun ebenso fast alle politischen Systeme den drei Grundtypen Demokratie, autoritären Systemen und totalitären Systemen zuordnen, wobei für die beiden letzteren auch der Überbegriff autokratische Systeme verwendet werden kann.
Während folglich bei Demokratien der Herrschaftszugang als offen angesehen wird, die Auswahl der Herrschaftsträger durch ein im Großen und Ganzen offenes Wahlrecht, sowohl aktiv als auch passiv erfolgt, die Herrschaftsstruktur pluralistisch durch Gewaltenteilung, Gewaltenkontrolle und somit auch durch Gewaltenhemmung der Herrschaftssubjekte geprägt ist, der Herrschaftsanspruch (eng) begrenzt ist, die Herrschaftsausübung rechtsstaatlich, also auf legitimen Normen basierend und die Legitimation zur Herrschaft auf das Prinzip der Volkssouveränität zurückgeht, erfahren diese Merkmale in autoritären Systemen doch zum Teil erhebliche Einschränkungen.
Der Herrschaftszugang erfolgt hierbei beispielsweise nicht durch ein universelles Wahlrecht wie es bei Demokratien der Fall ist. Es liegt vielmehr ein eingeschränktes Wahlrecht vor, das heißt Bevölkerungsgruppen oder ganzen Bevölkerungsschichten wird das Recht auf Mitbestimmung der politischen Herrscher verwährt. Die Herrschaftsstruktur ist in Bezug auf Gewaltenteilung, Gewaltenkontrolle und Gewaltenhemmung deutlich eingeschränkt, also als semipluralistisch einzuordnen. Der Herrschaftsanspruch ist als sehr umfangreich anzusehen und geht weit in die Individualsphäre hinein. Die Herrschaftsweise ist nicht rechtsstaatlich normiert, des Weiteren repressiv und die Herrschaftslegitimation folgt bestimmten Mentalitäten.
Der Begriff der Mentalität geht auf die Unterscheidung des deutschen Soziologen Theodor Geiger (1891-1952) zurück, der unter Mentalitäten im Gegensatz zu Ideologien subjektive, kognitive, mehr emotionale als rationale Herangehensweisen versteht. Ideologische Gedankensysteme hingegen sind mehr oder weniger strukturiert und von Intellektuellen herausgearbeitet oder werden zumindest von diesen unterstützt und bieten für verschiedene Situationen einen effizienten und vorbestimmten Lösungsansatz [vgl. Geiger, 1932, S. 77 ff.].
In totalitären Systemen als gegensätzlichem Pol zur Demokratie ist der Herrschaftszugang geschlossen, das heißt die über die politische Macht Verfügenden, deren Anschauungen nach Legitimierten, können nicht durch Wahlen abgesetzt oder beschränk werden. Die Herrschaftsstruktur ist monistisch, es existiert somit nur ein Herrschaftszentrum. Der Herrschaftsanspruch ist unbegrenzt und total, die Herrschaftsweise repressiv, nicht rechtsstaatlich, systematisch oder sogar terroristisch und von einer „umfassenden Weltanschauung mit absolutem Wahrheitsanspruch überwölbt“ [Merkel, 1999, S. 27].
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sechs demokratischen Herrschaftskriterien von autoritären Systemen durchweg verletzt werden, wohingegen totalitäre Systeme diese völlig aufheben. Anschaulich lassen sich die Unterscheidungsmerkmale in Tabelle 1 darstellen.
Wie bereits erwähnt, benutzt Merkel vor allem das Merkmal der Herrschaftsstruktur als klares Abgrenzungskriterium zwischen autokratisch-monistischen und demokratisch-pluralistischen Systemen. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass eine völlige Trennung zwischen Exekutive und Legislative vorliegen muss, um von einem demokratischen System sprechen zu können. Solch eine klassische Gewaltenteilung liegt in den heute vorliegenden politischen Systemen eigentlich nur in dem präsidentiellen Regierungssystem der USA und teilweise in denen in Lateinamerika vor. In der Bundesrepublik Deutschland oder in Großbritannien mit deren parlamentarischen Regierungssystemen sind dagegen die Grenzen zwischen Legislative und Exekutive zum Teil stark verwischt.[8]
Als ein allgemein geltendes Merkmal für alle Demokratien gilt jedoch, dass im Gegensatz zu autokratischen Systemen eine generelle Unbestimmtheit der Ergebnisse politischer Entscheidungen vorliegt. Dies ist natürlicherweise darauf zurückzuführen, dass der Einfluss einzelner Akteure auf die politisch zu treffenden Entscheidungen durch das Vorhandensein mehrerer Herrschaftszentren beschränkt ist. Im Gegensatz zu autoritären oder totalitären Systemen sind die Entscheidungsergebnisse also nicht ex ante bestimmt und mehr offen. Diese kommen durch einen Prozess, in dem konkurrierende politische Kräfte aufeinander wirken und Mehrheiten folgend, zu Stande, was auch Auswirkungen auf die Stabilität und die Legitimation von politischen Systemen zur Folge hat.
2.1.2 Stabilität politischer Systeme
Wie die Geschichte zeigte, kam es immer wieder zu Systemwechseln von demokratischen zu totalitären Systemen oder vice versa. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington (1927-2008) sprach in seinem Buch „The Third Wave“ aus dem Jahre 1993 sogar von drei großen Demokratisierungswellen im Laufe des 20. Jahrhunderts.[9] Er legt seiner Einteilung die verschiedenen Demokratisierungswellen und deren Revisionen dem Demokratiebegriff nach Schumpeter zu Grunde. Nach diesem ist die demokratische Methode diejenige, in „der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen eines Volkes erwerben“ [Schumpeter, 1950, S. 428]. Nach Huntington existieren politische Systeme mit demokratischem Charakter nicht nur in modernen Zeiten, sondern auch bereits in früheren Zeiten, in denen Stammes- oder Dorfhäuptlinge bereits nach Abstimmungen und Mehrheitswahlen gewählt wurden. Der Ausgangspunkt für demokratische Regulierungen im Westen fand demnach in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts statt, als die Bürger von Hartford und der umliegenden Städte am 14. Januar 1638 „The Fundamental Orders of Connecticut“ unterzeichneten, die heute als die erste geschriebene Verfassung gilt, wobei dieser Anstoß keine größere Adaptionswirkung hatte und somit bereits nach einem Jahrhundert keinerlei demokratische Institutionen mehr in der westlichen Welt vorhanden waren.
Moderne Demokratie, wie es Huntington bezeichnet, ist jedoch nicht durch Demokratie in einem Stamm, Dorf oder Stadtstaat gekennzeichnet, sondern durch das Anwenden von demokratischen Prinzipien auf ganze Staaten. Die bereits genannten Wellen der Demokratisierung in Zeiten jener modernen Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass es innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine signifikant größere Zahl von Umwälzungen in politischen Systemen von nichtdemokratischen zu demokratischen Systemen gibt, als in ihrer Umkehrung.
Die ersten beiden großen Demokratisierungswellen begannen demnach Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, sowie in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Während die erste dieser beiden Wellen ein knappes Jahrhundert dauerte, war die zweite mit knapp zwei Jahrzehnten deutlich kürzer. Dazwischen lagen jeweils Zeiten der Ent-Demokratisierungen, in denen vor allem jüngere Demokratien oftmals wieder in nichtdemokratische Systemformen zurückdrifteten. Die dritte, und bis dato letzte Welle der Demokratisierung, begann nach dieser Einteilung im Jahre 1974 mit dem Ende der portugiesischen Diktatur Caetanos und dauert bis heute an, wobei genauere zeitliche Abgrenzungen der unterschiedlichen Wellen aufgrund des Durcheinanders der Geschichte, die sich nicht immer in wünschenswerte Boxen einteilen lässt, nicht möglich ist. Die verschiedenen Demokratisierung- und Ent-Demokratisierungswellen nach Huntington [vgl. Huntington, 1993, S. 16] lassen sich also folgendermaßen darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die erste Welle der Demokratisierung hat ihre Wurzeln in der Amerikanischen und in der Französischen Revolution, die beide gegen Ende des 18. Jahrhunderts stattfanden. Das übermäßige Aufkommen von demokratischen Strukturen auf Staatsebene war eine vorwiegende Erscheinung des 19. Jahrhunderts gewesen.
Die Frage, wer denn letztendlich zum Volk gehört und somit an der Demokratie teilhaben durfte, wurde im Laufe der Vergangenheit stets anders beantwortet. So waren es in der Demokratie Athens nur die männlichen Vollbürger, später dann nur die männlichen Bürger die einem gewissen Stand angehörten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Frauen dann ebenfalls nach und nach dem Volk, der Demos, zugerechnet. Erst kurze Zeit vor dem ersten Weltkrieg, bzw. dann nach 1918 wurde in der Mehrzahl der westlichen Industriestaaten das universelle Wahlrecht eingeführt und seitdem erfüllen diese Länder die oben beschriebenen Kriterien (Tabelle 1, S. 8) von inklusiven, modernen Demokratien.
So ist es also nicht verwunderlich, wenn die Anforderungen an ein demokratisches System der ersten Welle der Demokratisierung exklusiver waren und nicht denen entsprachen, die heute angelegt werden. So genügten zu damaligen Zeiten die Kriterien, dass es zum Einen 50 Prozent der männlichen Bürger erlaubt war zu wählen und zum Anderen die verantwortliche Exekutive ihre Macht auf eine überwiegende Unterstützung in einem gewählten Parlament stützen können oder periodisch wieder gewählt werden konnten.
Unter Zugrundelegung dieser beiden genannten Anforderungen gilt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit deren Präsidentschaftswahlen im Jahre 1828 den Beginn der ersten Demokratisierungswelle nach Huntington darstellten.
Die erste Ent-Demokratisierungswelle begann darauf folgend im Oktober 1922 mit Mussolinis Marsch auf Rom, in Folge dessen die faschistische Bewegung die politische Macht in Italien übernahm. Vorwiegend drifteten vor allem jüngere demokratische Staaten wieder in nichtdemokratische Regierungsformen ab, die gerade vor oder nach dem ersten Weltkrieg demokratische Strukturen übernommen hatten. Auch die in dieser Arbeit genauer betrachteten Länder Deutschland, Polen und die damalige Tschechoslowakei gehörten zu diesen Staaten, die im Zuge dieser zweiten Welle die zuvor erlangten demokratischen, freiheitlichen Strukturen wieder aufgaben bzw. aufgeben mussten. Deutschland verlor schrittweise demokratische Prinzipien durch die Machtübernahme Hitlers im Jahre 1933 sowie dem folgenden Ausbau des Führerstaates, Polen im Zuge des Maiputsches im Mai 1926, in dem Marschall Jozef Pilsudski mit Hilfe eines Staatsstreiches an die Macht kam und politische Oppositionelle sowie ethnische Minderheiten unterdrückte und verfolgen ließ, sowie letztendlich durch den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands im Jahre 1939 als Beginn des zweiten Weltkrieges. Die Tschechoslowakei musste sich ebenfalls dem territorialen Großmachstreben Hitlerdeutschlands fügen und war spätestens nach dem Einmarsch deutscher Truppen im Jahre 1939 kein freiheitlich demokratisch organisierter Rechtsstaat mehr.
Gegen Ende des zweiten Weltkrieges setzte dann die zweite, kurze Welle der Demokratisierung ein. Begleitet wurde diese von einer Zweiteilung der Welt in einen demokratisch-kapitalistischen und einen sozialistisch-autoritären Staatenblock. Das Schicksal der Geschichte sorgte dafür, dass Westdeutschland vor allem unter den Siegermächten USA, Großbritannien und Frankreich von nun an demokratisch freiheitliche Strukturen implementieren konnte, während sich Ostdeutschland und Polen der kommunistischen Diktatur unterwerfen mussten, die später ebenfalls die Tschechoslowakei vereinnahmte. Diese Trennung der politischen Weltkarte überdauerte auch die zweite Ent-Demokratisierungswelle in den Jahren 1958-1975, die vor allem auf militärische Staatsstreiche in Lateinamerika beruht. Da vor allem auch langjährige, mehr gereifte Demokratien wie Chile oder Uruguay solchen Putschen zum Opfer fielen, stellte sich konsequenterweise in der Theorie die Frage, ob das demokratische System wirklich das System ist, das den autokratischen Systemen bezüglich deren Eignung zum Lösen der auftretenden Probleme und dessen Anwendbarkeit vor allem in minder entwickelten Ländern übermächtig ist, aber auch, ob es vor allem in entwickelten Ländern die notwendige Anpassungs- und Überlebensfähigkeit besitzt.
Diese Fragen konnten, vorerst zumindest und mit offenem Ausgang, mit dem Beginn der dritten Demokratisierungswelle und vor allem mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Staatenblockes der Sowjetunion beantwortet werden. So beschrieb Huntington die Situation derart: „Once again, however, the dialectic of history upended the theories of social science“ [Huntington, 1993, S. 21].
Was mit dem Ende des Estado Novo (Neuer Staat) und des autoritären Regimes der Diktatoren Salazar und Caetano in Portugal im Jahre 1974 und Südeuropa begann und mit der Absetzung von Militärregierungen zum Teil durch freie Wahlen in Lateinamerika und Asien fortgeführt wurde, fand im Zusammenbruch des kommunistischen Ostblockes gegen Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts schließlich seinen Höhepunkt. Auch in den Satellitenstaaten des Warschauer Paktes wie der noch existierenden Volksrepublik Polen, der damaligen Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik (ČSSR) sowie der ehemaligen DDR führten die Bestrebungen nach Glasnost und Perestrojka, eingeleitet von Michail Gorbatschow mit dem Ziel, eine Antwort auf die vielfältigen wirtschaftlichen Probleme und innerstaatlichen, sozialen Unzufriedenheiten des Staatenbündnis geben zu können, dazu, dass im Jahr 1989 die alten kommunistischen, repressiven Strukturen von freien demokratischen Prozessen abgelöst wurden.
So kam es in Polen unter anderem auf Druck der Streik- und Gewerkschaftsbewegung Solidarność (Solidarität) zu als freie, wenn auch mit ausgehandelten Rahmenbedingungen, titulierbaren Wahlen, in denen der liberale Schriftsteller Tadeusz Mazowiecki erster nichtkommunistischer Ministerpräsident seit dem zweiten Weltkrieg wurde. In 1990 folgten dann ebenfalls die ersten freien Parlamentswahlen in der ČSSR, in denen Václav Havel das Vertrauen als Ministerpräsident ausgesprochen wurde. Mit den ersten und letzten freien Wahlen der DDR, der Volkskammerwahl 1990, die den Spitzenkandidaten Lothar de Maiziére als Ministerpräsidenten hervorbrachte, und schließlich mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 wurde auch hier das Ende des kommunistischen, unfreien und repressiven Systems der Sowjetunion besiegelt.
Sicherlich sind die politischen Umwälzungen nicht generell auf die Stabilität oder Instabilität gewisser politischer Systeme zurückzuführen. Vielmehr sind, wie gesehen, für jeden Fall gewisse Spezifika zu nennen, die zu Situationen führen, in denen das vorherrschende System zugunsten eines anderen Systems weicht oder weichen muss. Dennoch lassen sich verallgemeinernde Aussagen treffen, die dazu führen, dass aufgrund der systemspezifischen Strukturen und Verfahren von einer endogenen Stabilität von demokratischen Systemen und einer endogenen Instabilität von autokratischen Systemen gesprochen werden kann [vgl. Merkel, 1999, S. 57].
Ein politisches System gilt dann als stabil, wenn die „innere Konstruktion der vielfältigen Wechselbeziehungen“ [Merkel, 1999, S. 57] von Strukturen und Akteuren so angelegt ist, dass es ihm möglich ist, diejenigen Aufgaben zu lösen, die die Umwelt, also beispielsweise die Wirtschaft, die Gesellschaft oder die internationale Staatenwelt an ihm stellt. Durch den stetigen Wandel der Umwelt werden also an das politische System Anforderungen bezüglich dessen Anpassungs-, Wandlungs- und Innovationsfähigkeit gestellt [vgl. ebenda]. Damit dies möglich ist, müssen folgende Herausforderungen bewältigt werden:
- Politische und gesellschaftliche Integration (Integrationskapazität)
- Ressourcenmobilisierung ( Mobilisierungskapazität)
- Aufrechterhaltung friedlich geregelter Beziehungen mit anderen Staaten (internationale Anpassungskapazität)
- Beteiligung der Bevölkerung am politischen Entscheidungsprozess (Partizipationskapazität)
- Verteilung des Sozialprodukts durch wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen auch jenseits des Marktes (Distributionskapazität)
Um nun den natürlichen Herausforderungen, die an ein politisches System gestellt werden, entgegentreten zu können, müssen diese Problemlösungskapazitäten auf einem systemerhaltenden Niveau entwickelt werden. Um diese Notwendigkeiten für die drei Systemarten Demokratie, autoritäres und totalitäres System nun darzustellen, wird exemplarisch hierfür auf das von Easton entwickelte und von Almond und Powell weitergeführte Systemmodell zurückgegriffen.[10] Nach diesem Modellansatz benötigt das vorhandene politische System einen Input an Unterstützungsleistungen (aktiv und passiv) der mit diesem System lebenden Bürger. Diese Unterstützung und gewissermaßen Identifizierung der Bürger mit dem politischen System sind somit eine unverzichtbare Ressource, die das System benötigt um den Forderungen der Umwelt an das System entgegentreten zu können und in politische Entscheidungen umzuwandeln und diese dann in Form von Gesetzen, Erlassen und Verordnungen, also hoheitlich durchgesetzten politischen Entscheidungen, zu implementieren [vgl. Almond/Powell, 1988, S. 21].
Der Output, also die materiellen Politikergebnisse, sowie der Input, also die aktive Unterstützung und die passive Loyalität der Adressaten des Outputs des politischen Systems, sind durch einen Rückkopplungsmechanismus verbunden. Kommt es demnach beispielsweise durch Funktionskrisen in Teilen des politischen Systems oder generell zu einem unbefriedigenden Output für die gesamte oder für Teile der Bevölkerung, so nimmt der systemstabilisierende Input ab. Dieser Unterstützungsinput lässt sich generell in diffuse und spezifische Unterstützung [vgl. Easton, 1965, S. 267 ff.] einteilen, wobei die spezifische Unterstützung der Bürger sich danach richtet, wie diese subjektiv ihre materielle Wohlfahrt und Sicherheit gewährleistet sehen. Die diffuse Unterstützung hingegen bezieht sich auf die grundsätzliche Anerkennung und Legitimität der Fundamente der politischen Ordnung. Zeitlich vorübergehende Schwächen dieser beiden Legitimitätsquellen können jedoch untereinander kompensiert werden. So ist es beispielsweise möglich, dass eine „verminderte Leistungsperformanz des Systems“ [Merkel, 1999, S. 60] durch eine grundsätzliche Akzeptanz der vorhandenen Normen, Strukturen und Verfahren ausgeglichen wird. Schwächen der spezifischen Unterstützung werden durch eine starke diffuse Unterstützung kompensiert oder umgekehrt [vgl. ebenda].
Problematisch wird es für die Legitimation des politischen Systems jedoch, falls beide Varianten der Unterstützung für längere Zeit entzogen werden. Die Politik kann also ihre Funktionen nicht mehr ausreichend erfüllen und wird instabil. Dies führt gegebenenfalls zu einem höheren Maß an Repressionen von Seiten des politischen Systems gegenüber seinen Bürgern und könnte somit weitere destabilisierende Wirkungen haben [vgl. ebenda].
Die endogene Stabilität demokratischer Systeme
Wie bereits beschrieben, verfügen Demokratien im Gegensatz zu autoritären Systemen und sowieso gegenüber totalitären Systemen über einen offenen Herrschaftszugang, der durch ein universelles Wahlrecht geregelt wird, wobei „die Zahl der den Mehrheitswillen bildenden Menschen (...) selbst in den extremsten Demokratien kaum ein Drittel oder ein Viertel aller Normunterworfenen“ [Kelsen, 1966, S. 328] entspricht. Dennoch besteht in einem demokratischen System eine Art Feedback- Mechanismus, der den autokratischen Systemen in deren Urform verwehrt bleibt und dazu führt, dass Demokratien zu einem kontinuierlichen Lernprozess gezwungen werden. Versagt die Regierung zum Einen darin, die von den Bürgern geforderten Güter bereitzustellen und zum Anderen für innere und äußere Sicherheit zu sorgen sowie wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit bereitzustellen (spezifische Unterstützung), dann besteht die Möglichkeit, die Machtinhaber demokratisch abzuwählen. Die Machthaber müssen sich also schon aus reinem Eigeninteresse an die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen und effiziente Lösungsansätze entwickeln. Es existiert also ein Konkurrenzmechanismus zwischen Regierungs- und Oppositionspartei in demokratischen Systemen, der die Regierung zu Flexibilität, Adaptionsfähigkeit und Innovationsfähigkeit zwingt [vgl. Kelsen, 1966, S. 346].
In demokratischen Systemen ist die Teilhabe der Bevölkerung und die Eigenverantwortung und Eigenständigkeit der vorhandenen Teilsysteme wie beispielsweise der Wirtschaft, Kultur, Recht oder der Wissenschaft um ein gewisses Maß höher als in autoritären beziehungsweise totalitären Systemen. Diese komparativen Vorteile sind jedoch kein Garant für interne Stabilität der Demokratie. Zusätzlich sind begünstigende Faktoren von Nöten, die sich positiv auf die gewünschte Stabilität des Systems auswirken. Als am wichtigsten wird hierbei „ein bestimmtes Maß an sozioökonomischer Entwicklung und ein prinzipieller Konsens oder Kompromiss der politischen Eliten hinsichtlich der fundamentalen demokratischen und rechtsstaatlichen Spielregeln“ [Merkel, 1999, S. 62] genannt (diffuse Unterstützung). Als Beispiele in denen diese übereinstimmende Akzeptanz bzw. die damit einhergehende Forderung nach politischer Weiterentwicklung eines Systems und deren Mitwirkenden nicht, oder nicht in ausreichendem Maße, vorhanden waren, gelten die Demokratien Weimars (1919-1933), Österreichs (1919-1934) oder Spaniens (1931-1936). In diesen Fällen haben sowohl Polarisierung von politischen Eliten als auch das Vorhandensein von semi- bzw. illoyalen Eliten den stetigen, notwendigen Legitimitätszuwachs des vorhandenen Systems behindert. Im Gegensatz hierzu war es jedoch auch jungen Demokratien, wie beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich nach dem Ende des zweiten Weltkrieges sowie dem postfrankistischen Spanien auch unter schwierigen Bedingungen möglich, rasche Konsolidierungserfolge vorzuweisen. Als Gründe gelten hier aus polittheoretischer Sicht vor allem, dass sich eben dieser geforderte Kompromiss unter den relevanten gesellschaftlichen und politischen Eliten durchsetzen konnte. Zudem waren jedoch auch die sozioökonomischen Umstände als stabilitätsfördernd einzuschätzen [vgl. ebenda].
Empirische Untersuchungen wie die von Welzel aus dem Jahre 1996[11] kommen zudem zu der Erkenntnis, dass der Zusammenbruch von Demokratien mit dem Anstieg ihrer Existenzdauer unwahrscheinlicher wird. Welzel nannte hier einen Zeitraum von 15 Jahren, nach dem es unwahrscheinlich ist, dass demokratische Systeme zusammenbrechen. Sicherlich gibt es auch hier Ausnahmen wie Brasilien 1964 sowie Chile und Uruguay 1973. Im Gegensatz dazu lässt sich für Diktaturen jedoch keine ähnliche Stabilisierungsschwelle zeigen [vgl. Welzel, 1996, S. 97].
Man kommt also zu dem Ergebnis, dass demokratische Systeme sich bei einer verändernden Umwelt anpassen können, wohingegen bei autokratischen Systemen solche Wandlungsprozesse zu einer Bedrohung in deren politischen Existenz führen.
Die endogene Instabilität autokratischer Systeme
„Im Vergleich zu Demokratien sind autokratische Systeme partizipationsfeindlich, geschlossen, unflexibel, adaptions- und innovationsträge“ [Merkel, 1999, S. 63]. Dadurch vermindert sich unweigerlich die Leistungsfähigkeit des Systems. Aufgrund der fehlenden Antizipationsfähigkeit an den Bedürfnissen und Belangen der Bevölkerung durch die innere Geschlossenheit des politischen Herrschaftssystems gehen unweigerlich Effizienz- und Erneuerungspotentiale verloren, die durch das stetige in Bewegung sein der Umwelt von Nöten wären. Dass die liberalen Demokratien linke wie rechte Totalitarismen sowie autoritäre Regime bisher in Bezug auf ihre Überlebensdauer zumeist übertroffen haben ist natürlich sowohl innen- als auch außenpolitischen Gegebenheiten zuzuschreiben. Zu vermuten ist jedoch auch, „dass es Gründe gibt, die dieses Scheitern aus den Legitimationsideologien diktatorischer Herrschaft selbst zu erklären vermögen“ [Saage, 1995, S. 14], auch wenn Bracher davon ausgeht, dass es eine Schwierigkeit darstellt, ideologische Regime von deren Mitte heraus zu überwinden, da diese zumeist im Alleinbesitz der vorhandenen Kommunikationsmittel sind oder diese zumindest mehrheitlich kontrollieren [vgl. Bracher, 1982, S. 16].
Gerade jedoch im Hinblick auf die Legitimationsbeschaffung stehen autokratische und totalitäre Systeme aufgrund fehlender möglicher Teilhabe der Bevölkerung den demokratischen Systemen mit ihrem offenen Machtzugang nach. Diese verminderte Leistungsfähigkeit und die fehlende Möglichkeit der Legitimationsbeschaffung haben zusammengenommen das Potential, sich gegenseitig zu verstärken und somit zu einem erheblichen Destabilisierungsproblem für autokratische Systeme zu werden. Aufgrund des nicht oder nur eingeschränktem Vorhandensein von freien Wahlen in autokratischen Systemen kann zudem von einer strukturellen Lernschwäche dieser gesprochen werden [vgl. Merkel, 1999, S. 65]. Durch diesen fehlenden Rückkopplungsmechanismus ist in autokratischen Systemen, wie oben bereits beschrieben, die Möglichkeit der Abstrafung der politischen Machthaber bei nicht zufrieden stellender Machtausübung nicht gegeben. Geheimdienste, denen in autokratischen Systemen oftmals eine wichtige politische Bedeutung zukommt, können hier das Vorhandensein von Wahlen nicht ersetzen und sanktionieren hingegen mehr die Regierten als die Regierenden [vgl. Scharpf, 2004, Kap. 2.1].
Was gerade auch bei kommunistischen Diktaturen der Fall ist, ist die vermeintliche Illusion, der politische Apparat könne zudem auch alle anderen Teilsysteme, vor allem das Teilsystem Wirtschaft planen und diktieren, getreu dem Prüfkriterium sozialistisch-nicht sozialistisch und nicht dem Wirtschaftlichkeitskriterium effizient-nicht effizient. Wirtschaftliche Krisen oder auch die Unterversorgung der Bürger mit materiellen Gütern wurden so auch unmittelbar dem politischen System angelastet, weshalb auch hier eine weitere Erosion der Legitimation stattfinden kann [vgl. ebenda].
Die Abschaffung der individuellen Grund-, Menschen- und Bürgerrechte, wie es in destabilisierendem Maße vor allem in linken wie rechten Autokratien zu Stande kam, stellen ebenso nicht die genannten Präferenzen des Betroffenen, also der Bürger, dar. Hierdurch versuchen politische Machthaber sich den nicht gewollten politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Legitimationsquellen zu entledigen. Diese vertikalen Eingriffe und somit das Eingreifen des Herrschaftsanspruches in das Alltagsleben der Bürger, haben jedoch wiederum unmittelbare Auswirkungen auf die Legitimation von politischen Systemen. Linke wie rechte nichtdemokratische Systeme haben hierbei mit der gleichen Problematik zu kämpfen. So konnten beispielsweise die kommunistischen Regime in Osteuropa durchaus zeitweise positive Legitimationswirkungen entfalten. Hinderlich war jedoch die Zukunftsorientiertheit der politischen Moral des Marxismus-Leninismus, in der die Emanzipation von der Klassenherrschaft, die Irrationalität des Marktes, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sowie die Notwendigkeit der Einschlagung des richtigen Weges propagiert wurde. Dieser neu zu gehende Weg verlangte in der Gegenwart die Bereitschaft der Individuen zumindest vorübergehend auf ihre persönlichen Interessen und Wünsche zu verzichten um langfristig in das „Reich der Freiheit“ [Merkel, 1999, S. 63] zu gelangen. Die politisch Herrschenden und die ideologischen Vordenker verlangten in der Gegenwart Entbehrungen und Unterwerfungen hinzunehmen, um in Zukunft, also nach dem Sieg des sozialistischen Systems über das kapitalistische, zu Wohlstand und Freiheit zu gelangen. Je länger jedoch dieser Weg der Entbehrlichkeiten wurde und je größer der materielle Rückstand gegenüber den „irrationalen Marktgesellschaften“ [ebenda] wurde, desto weniger war die Bevölkerung, also die die sich in Verzicht üben mussten, bereit, diesen Weg in das „nationale Glück“ [ebenda] mitzugehen, wodurch die Notwendigkeit zu Repressalien von Seiten des politischen Systems zu- und deren Legitimation abnahm [vgl. Merkel, 1999, S. 64].
Ähnlich verhält es sich bei autoritären und totalitären Systemen die am rechten Ideologierand anzusiedeln sind. Grundlage ist hierbei ebenfalls wieder die ausgeprägte Regelungs- und Interventionstiefe des politischen Systems gegenüber seinen Bürgern. Durch einen umfangreichen oder gar unbegrenzten Herrschaftsanspruch in Form von der Ausschaltung von Normen und Rechten soll Sicherheit, Ordnung, Entwicklung und Wohlstand erreicht werden. Während in kommunistischen Systemen das Volkseigentum proklamiert wurde, demnach die Sozialisierung des Eigentums als das Ziel ausgegeben wurde, war dies in rechten nichtdemokratischen Systemen, wie beispielsweise dem nationalsozialistischen Deutschland, nicht unbedingt der Fall. Privateigentum und private Kapitalgewinne, genauso wie die Bildung von ausdifferenzierten Klassen innerhalb der Gesellschaft waren durchaus erwünscht, so lange der Erbringer den totalitären Ansichten und Bestimmungen Gefolge leistete. Den Bürgern wurde es also sehr wohl zugestanden, persönliche Besitztümer zu haben und durch unternehmerischen Erfolg diese zu vermehren, wobei auch genau hierin die „ideologische Legitimationsfalle“ [Merkel, 1999, S. 64] von Rechtsdiktaturen bestand. Wirtschaftlicher Aufschwung und erlangter Wohlstand führen dazu, dass die von einem Großteil der Bürger- und Grundrechten entledigten „mündigen Wirtschaftsbürger“ [ebenda] ihre politische Mündigkeit fordern und somit auch Änderungen und Anpassungen der Gegebenheiten des totalitären Systems oder gar das Ende von diesem fordern, wobei in beiden Fällen die ideologische Legitimation des herrschenden Politsystems verloren gegangen ist [vgl. Merkel, 1999, S. 64].
Somit lässt sich als Abschluss dieser systemtheoretischen Überlegungen bezüglich der endogenen Stabilität beziehungsweise Instabilität demokratischer und autokratischer Systeme festhalten, dass aufgrund der offeneren und stabileren inneren Konstruktion und der größeren Fähigkeit, systemrelevante Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, sowie die erforderliche Unterstützung in der Bevölkerung für die auftretenden Anforderungen zu mobilisieren, Demokratien längerfristig stabiler sind als Autokratien. Den autoritären und totalitären Systemen kommt somit auf Dauer die Legitimationsgrundlage bei ausbleibendem Erfolg (links autoritär/totalitär) oder bei zunehmendem wirtschaftlichem Erfolg (rechts autoritär/totalitär) abhanden, mit der Konsequenz, dass ein Kreislauf von Repressionen und weiterem Legitimationsentzug initiiert wird.
2.1.3 Typen autoritärer und totalitärer Systeme
Während zunächst mit der Demokratie und der Autokratie lediglich zwischen zwei Grundtypen der politischen Herrschaft unterschieden wurde, in Folge dessen die Demokratie als der freie Staat, in dem „der Wille des Staates oder die Rechtsordnung von denjenigen selbst erzeugt wird, die dieser Ordnung unterworfen sind“ [kelsen, 1966, S. 326] und die Autokratie als der unfreie Staat, in dem „die staatliche Ordnung unter völligem Ausschluss der ihr Untertanen von einem einzigen, allen anderen darum als Herr Gegenüberstehenden gesetzt wird“ [ebenda] bezeichnet wurde, ist es nach dem Auftreten des Nationalismus bzw. des Stalinismus – die eine Form von autokratischen Systemen mit überaus totalitären Herrschaftsansprüchen hervorbrachten – förderlich, diese Einteilung auf die bereits erwähnten drei Typen zu erweitern. Die autokratischen Systeme werden also weitergehend noch in autoritäre sowie totalitäre Systeme unterteilt [vgl. Merkel, 1999, S. 24].
Aus theoretischer Sicht ist das Auftreten von Idealtypen wie sie beispielsweise auch in Tabelle 1 (S. 8) genannt werden wünschenswert, jedoch unwahrscheinlich. Auch Kelsen, mit dessen Einteilung in lediglich die beiden Pole Demokratie und Autokratie musste feststellen, dass die „Wirklichkeit [...] mehr oder weniger weitgehende Annäherungen an den einen oder anderen polar entgegen gesetzten Idealtypen“ [Kelsen, 1966, S. 327] mit sich bringt und es „eine kontinuierliche Reihe von Übergängen von dem einen zum anderen“ [ebenda] gibt und auch bedarf. Auch Merkel verfolgt das Ziel Idealtypen zu generieren, die dem Test mit der Realität bestehen würden, kam jedoch nicht umhin, seine grobe Einteilung in autoritäre beziehungsweise totalitäre Systeme nochmals zu differenzieren. So unterscheidet er beispielsweise die autoritären Systeme in semiautoritäre, vollkommen autoritäre und prätotalitäre beziehungsweise posttotalitäre Systeme, je nachdem ob die real existierenden Erscheinungsformen eher dem freiheitlichen, fortschrittlichen und partizipationsfreundlicherem System der Demokratie ähneln (semiautoritäre Systeme), eher der Grundform der autoritären Systemen wie in Tabelle 1 beschrieben nahe kommen, oder von deren Struktur her an der Schwelle zu totalitären, also nicht rechtsstaatlichen, monistischen mit unbegrenztem Herrschaftsanspruch aufgebauten Systemen stehen (prätotalitäre/posttotalitäre Systeme).
Nach Linz lassen sich autoritäre Varianten zu demokratischen aber auch zu totalitären Systemen dadurch unterscheiden, dass diese einen gewissen Pluralismus besitzen, jedoch keine ausgearbeitete und leitende Ideologie. Stattdessen zeichnen sie sich des Weiteren dadurch aus, dass diese keine ausgeprägten Mentalitäten besitzen und überwiegend keine extensive oder intensive politische Mobilisierung stattfindet. Gerade die „Mehrdeutigkeit von Opposition“ (Linz, 2000, S.141), die das Vorhandensein eines (eingeschränkten) politischen Pluralismus voraussetzt, wie beispielsweise die besondere Position der Kirche, der Rechtssprechung oder der Beamtenschaft, die sich alle in autoritären Strukturen mehr oder weniger einen gewissen autonomen Existenzraum erhalten können und somit als „Kanal für oppositionelle Gefühle“ (ebenda) dienen können, stellen einen großen Unterschied zu totalitären Herrschaften dar, in denen zumeist eine klare Grenzlinie zwischen Opponenten und Regime vorliegt.
Merkel greift zwar auch auf diese Einschätzung zurück, jedoch nicht ohne dem Hinweis, dass es eine Schwäche dieser Abgrenzung sei, dass keine präziseren Kriterien angeboten werden, nach denen eindeutiger feststellbar ist, ab welchem Zustand der Pluralismus eingeschränkt oder gar von einem Monismus zu sprechen sei. Außerdem ist nach seiner Meinung nicht hinreichend geklärt, wann eine Gesellschaft als mobilisiert beziehungsweise demobilisiert zu gelten hat.
Typen autoritärer Systeme
Während Linz versucht, real auftretende Systeme mit Hilfe von plausiblen, historisch verankerten Merkmalen und Kriterien zu unterscheiden und zu beschreiben – wodurch gezwungenermaßen die Übersichtlichkeit und klare Abgrenzungsfähigkeit verloren geht – begnügt sich Merkel auf das Anwenden eines „Primärkriteriums“ (Merkel, 1999, S. 37) um repräsentative Idealtypen der beobachtbaren Systeme zu kreieren. Er verwendet in seiner Argumentation wiederum einzig das Kriterium der Herrschaftslegitimation, nach der es zweckmäßig ist, „die Arbeiten der Herrschaft je nach ihrem typischen Legitimitätsanspruch zu unterscheiden“ [Weber, 1972, S.122], da dies kein „entscheidender Missstand“ [ebenda] ist. Dadurch erhöht sich ebenfalls die Unterscheidbarkeit und Nachvollziehbarkeit, weshalb dieser Darlegung nun hier ebenfalls gefolgt werden soll. Es ist demnach zwischen neun auftretenden Grundtypen autoritärer Herrschaften im 20. Jahrhundert zu unterscheiden:
- Kommunistisch-autoritäre Regime
- Faschistisch-autoritäre Regime
- Militärregime
- Korporatistisch-autoritäre Regime
- Rassistisch-autoritäre Regime
- Autoritäre Modernisierungsregime
- Theokratisch-autoritäre Regime
- Dynastisch-autoritäre Regime
- Sultanistisch-autoritäre Regime
Sicherlich lassen sich auch innerhalb dieser getroffenen Einteilung noch unterschiedliche Varianten und Untertypen denken. Um aber nicht Gefahr zu laufen, in eine deskriptive Beliebigkeit bei der Typenbildung zu verfallen, ist es für diese Zwecke vollkommen ausreichend, sich diesen Grundtypen autoritärer Systeme zu widmen. Supplementär zum Primärkriterium Herrschaftslegitimation grenzt Merkel schließlich noch nach den verschiedenen möglichen Auftrittsformen der Machthaber ab. Er berücksichtigt hierbei vor allem die fünf am häufigsten auftretenden Varianten Führer, Partei, Militär, Klerus und Monarch und beschreibt somit die Grundtypen autoritärer Systeme ab dem 20. Jahrhundert folgendermaßen, wobei die ersten beiden Varianten näher erläutert werden sollen:
1. Kommunistisch-autoritäre Regime: Diese lassen sich in kommunistische Parteidiktaturen beziehungsweise Führerdiktaturen unterscheiden, wobei nur erstere zu den autoritären Systemen zu zählen sind. Letztere werden allgemein zu den totalitären Systemen gerechnet.
Als historische Beispiele für eine autoritäre kommunistische Parteidiktatur dienen vor allem das Sowjetreich und dessen politisches System in den Jahren 1924-1929, 1953-1956, als auch die in dieser Arbeit näher betrachteten Zeit von 1985-1991, also bis zum Zusammenbruch des so genannten Ostblockes, mit dessen sozialistischen System in beispielsweise Ungarn, Polen, der ČSSR sowie der DDR. Als Grundlage dieses Systems diente vor allem die leninistische Staats- und Parteitheorie, in der die kommunistische Partei sich selbst als „Avantgarde der Arbeiterklasse“ [Merkel, 1999, S. 38] bezeichnete und einziges legitimes Machtzentrum des Staates darstellte, neben dem in der Regel keine anderen Parteien existierten. Ausnahmen hiervon waren lediglich abhängige Satellitenparteien. Eigentliches Machtorgan war das Politbüro, in diesem Falle das Politbüro des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion. Merkmal dieser Organisationsform war, dass ein enger Führungszirkel weitestgehend unabhängig von der zentralistisch gesteuerten Parteibasis die politischen Entscheidungen traf. Kennzeichnend für diesen Typus eines autoritären politischen Systems war also das Innehalten der Macht durch ein kollektives Führungsgremium, ein Minimum an Pluralismus sowie die Tatsache, dass der Herrschaftsanspruch der politischen Akteure nicht alle Winkel des Alltagslebens der Bevölkerung erfasst hat.
2. Faschistisch-autoritäre Regime: Im Gegensatz zu dem vorher betrachteten kommunistischen Systemen treten die faschistische Herrschaftsform lediglich als faschistische Führerdiktatur auf und nicht als Parteiensystem. Aus diesem Grunde ist die Differenzierung zwischen faschistisch-autoritären Systemen und faschistisch-totalitären Systemen nicht derart groß wie bei den kommunistischen Formen. Zwar treten auch in dieser auf einen Führer ausgerichtete Herrschaftsform, Parteien, ein organisierter Staatsapparat oder die faschistische Bewegung als Machtfaktoren innerhalb dieses Systems auf, es müssen sich diese jedoch immer einem Führer, der für sich das Alleinstellungsmerkmal beansprucht, unterordnen.
Dieser allein hält letztendlich die autoritäre bzw. totalitäre Gewalt in seinen Händen. Faschistische Regime greifen häufig auf vormoderne, mythische Ordnungsmuster als deren Ideal zurück. So berief sich beispielsweise der ehedem radikale Sozialist Mussolini stets auf den Mythos der Romanität als anzustrebenden Zustand, mit dem Gedanken, mit Hilfe von Repressionen und Manipulationen den Prozess der Emanzipation und Aufklärung zu unterbinden. Nach Nolte sind vor allem das genannte Führerprinzip, Antisozialismus, Antiliberalismus, eine korporatistische Organisationsstruktur und Ideologie, eine starke Parteiarmee sowie die Stützung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, im Gegensatz zu kommunistischen Regimen, kennzeichnend für diese Systemstruktur [vgl. Nolte, 1966, S. 64 ff.]. Als Beispiele für ein autoritäres Regime des faschistischen Typs können das bereits erwähnte Italien unter Mussolini gelten, als auch sicherlich der Ustascha-Staat Unabhängiges Kroatien in den Jahren 1941-1945 unter dem Schutz der Wehrmacht oder das Regime Antonescus in Rumänien ebenfalls während des zweiten Weltkrieges. Ob der deutsche Nationalsozialismus ebenfalls zu den faschistisch-autoritären Regimen zu zählen ist, ist in der Fachliteratur umstritten. Die Mehrheit vertritt jedoch die Auffassung, dass dieses mit der Proklamation der Ermächtigungsgesetze im Jahre 1933 und der folgenden weitestgehenden Ausschaltung der Gewaltenteilung sowie vieler Grundrechte und aufgrund der sehr geschlossenen Weltanschauung der Machthaber zu den totalitären Regimen gerechnet werden muss [vgl. Linz, 2000; Merkel, 1999; Nolte, 1966].
Obwohl versucht wird die real existierenden Typen autoritärer Regime auf eine der hier genannten Möglichkeiten zu projizieren, so ist dies dennoch aufgrund der realen Komplexität nicht immer möglich. Innerhalb dieser Formen auf die sich Merkel hier fokussiert hat, gibt es sicherlich auch Arten, die mehr zu den semiautoritären Typen, also eher den demokratischen Formen zugewandt und mit diesen vergleichbar sind, während andere mehr den totalitären Systemen ähneln (prätotalitär/posttotalitär). Auf einem Kontinuum von idealer Demokratie zu perfektem Totalitarismus liegen autoritäre Regime in einer mittleren Zone, dienen also entweder als Übergang hin zu demokratischen oder zu totalitären Systemen. Dieses Übergangsstadium kann allerdings auch längere Zeiträume beinhalten.
Den Gegenpart der Demokratien stellen also die totalitären Systeme dar. Diese traten zwar zumeist nicht in derart häufigen Grundformen wie autoritäre Systeme auf aber geschichtlich doch sehr oft und dann zumeist mit großer Macht. Diese sollen nun näher betrachtet werden.
Typen totalitärer Systeme
Wie bereits erwähnt sind die Trennlinien zwischen autoritären und totalitären Herrschaftsordnung nicht so stark ausgeprägt wie zwischen demokratischen und autoritären Politiksystemen. So stellt sich in der Fachliteratur[13] immer noch die Frage, ob das faschistische Italien unter Mussolini oder das nationalsozialistische Deutschland eher zu den autoritären oder den totalitären Regimen zu zählen hat. Überwiegend kommt man jedoch zu dem Entschluss, dass Mussolini sein geschaffenes System zwar stato totalitario nannte, dies jedoch nur seinen Wunsch- und Zielvorstellungen entsprach und das faschistische Italien tatsächlich mehr zu den oben beschriebenen faschistisch-autoritären Regimen gezählt werden muss. Klarer, auch wenn hierbei ebenfalls unterschiedliche Meinungen bestehen, ist die Zuordnung des nationalsozialistischen Deutschlands zu den totalitären Systemen. Die Sowjetunion unter Stalin hingegen ist klar als ein totalitäres System anzusehen. Knackpunkt dieser Unterscheidung ist oftmals, dass linke totalitäre Systeme das einzige Machtzentrum in einem System darstellen, während in rechten oftmals sogar erwünscht ist, dass autonome Teilsysteme wie Wirtschaft oder Kirchen weiter bestehen. Dieses Privileg galt jedoch in diesen lediglich unter dem Vorbehalt, dass sie sich auf Linientreue mit den politischen Machthabern befinden mussten.
Das Wesen eines totalitären Regimes besteht folglich darin, das Alltagsleben der Bürger zu beherrschen sowie deren Meinungen, Gedanken und Handlungen zu kontrollieren. Dies wirft jedoch die Frage auf, wann die totalitäre Durchdringung in der Gesellschaft erreicht ist und ob noch gesellschaftliche Nischen bestehen dürfen, wie beispielsweise oben erwähnt die katholische Kirche im faschistischen Italien oder das Vorhandensein einer starken wirtschaftlichen Basis durch private Unternehmen im Dritten Reich. Des Weiteren stellt sich die Frage ob es genügt, wenn die Bevölkerung nicht gegen das totalitäre Regime opponiert und sich damit arrangiert, oder ob gefordert wird, dass die Menschen in deren Gedanken und Meinungen ebenfalls vollkommen hinter der Idee der politischen Machthaber stehen müssen.
Eine Auflistung von Kriterien, die gelten soll, um ein System als totalitäres Regime zu deklarieren, entwarfen die beiden Totalitarismusforscher Friedrich und Brzezinski. Nach dieser ist das Vorhandensein einer das System überwölbenden Ideologie, die alle lebenswichtigen Aspekte der menschlichen Existenz umfasst ebenso Voraussetzung wie das nur eine einzige Massenpartei existiert, die üblicherweise von einem Führer gelenkt wird. Dieser besitzt ein vollständiges Monopol, hat Verfügungsmacht über alle Medien und Massenkommunikation und stützt sich auf einen repressiven Partei- und Geheimdienst. Das Teilsystem Wirtschaft wird nach dessen Erfordernissen gelenkt und kontrolliert [vgl. Friedrich/Brzezinski, 1956, S. 610 f.]
Die beiden Autoren betonen hierbei, dass diese sechs Charakteristika für totalitäre Systeme nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen. Erst das Auftreten vieler oder sogar das Zusammenspiel aller Merkmale kennzeichnen diese Regime aus. Denn einzelne Symptome wie Geheimdienstkontrolle, Repressionen und Terror existieren ebenso in autoritären Systemen, das Monopol auf Kernwaffen ist auch in Demokratien üblich und wenn die vollkommene Herrschaft über die Wirtschaft ein alleinstehendes Merkmal wäre, dann würde Deutschland vor 1938 nicht als totalitäres System bezeichnet werden können [vgl. ebenda].
Schließlich lassen sich unter Anwendung dieser Kriterien auf die vorhandenen realen Systeme, genau so wie bei den autoritären Systemen, mögliche Subtypen von totalitären Systemen erkennen. Nach Merkel sind diese kommunistisch-totalitäre Regime, faschistisch-totalitäre Regime und theokratisch-totalitäre Regime mit folgenden Merkmalen:
1. Kommunistisch-totalitäre Regime: Kennzeichnend für totalitäre Systeme ist der geschlossene Herrschaftszugang, wodurch in kommunistisch-totalitären Systemen die kommunistische Partei die führende Rolle übernimmt, deren Herrschaftszugang vom Politbüro oder vom Generalsekretär geregelt wird. Des Weiteren herrschen in solchen Systemen keine Ansätze von wirtschaftlichem, gesellschaftlichem oder politischem Pluralismus, die Herrschaftsstruktur ist somit monistisch. Ein vollkommener Herrschaftsanspruch, der weit in das Bewusstsein der Herrschaftsunterworfenen hinein reicht, wird durch eine repressive, wenn nicht sogar terroristische Herrschaftsweise durchgesetzt, die jegliche Opposition und Widerstand verhindern soll. Die umfassende marxistisch-leninistische Weltanschauung ist hierbei Grundlage der Argumentation für deren totalitären Herrschaftsanspruch. Der KP-Generalsekretär tritt zumeist als Führer der Staats – und Parteimacht auf.
Typische Beispiele für diesen Totalitarismus waren vor allem die Sowjetunion unter Stalin (1929-1953) sowie die Volksrepublik China unter Mao Tse-Tung (1949-1976). Diese beiden historisch wohl gewichtigsten Erscheinungsformen von kommunistisch-totalitären Regime sind den kommunistischen Führerdiktaturen zuzurechnen, in denen charismatische Führer als primus inter pares eine Vormachtstellung im politischen System inne haben. Eine andere, oftmals nicht ganz so terroristisch und repressiv auftretende Form dieses Regimetypus ist die kommunistische Parteidiktatur. Je nach Kontroll- und Durchdringungsintensität der Gesellschaft durch den kommunistischen Staatsapparat kann diese pluralistischere Erscheinungsform sogar als autoritäre Herrschaftsvariante, wie beispielsweise in Polen oder Ungarn auftreten. Einer Parteidiktatur ist es aber ebenso möglich als totalitäre Form, ähnlich wie Führerdiktaturen, aufzutreten, wie es historisch beispielsweise in der DDR oder in der ČSSR der Fall war.
2. Faschistisch-totalitäre Regime: Wie bei kommunistisch-totalitären Regimen auch, muss der Herrschaftszugang völlig geschlossen sein, eine monistische Herrschaftsstruktur vorliegen, die Herrschaftsweise terroristisch und der Herrschaftsanspruch total sein. Alle weiteren Charakteristika sind vergleichbar mit den oben beschriebenen faschistisch-autoritären Systemen. Wie ebenfalls bereits erwähnt ist die Trennlinie zwischen faschistischen-nichtdemokratischen Systemen noch stärker verwässert als bei kommunistisch-nichtdemokratischen Systemen. Als historisch einziges Beispiel für ein solch faschistisch-totalitäres Regime kann mit all seinen Diskussionen das nationalsozialistische Deutschland gelten.
3. Theokratisch-totalitäre Regime: Diese Art von Regimen tritt insbesondere in der islamischen Variante auf. Oftmals genügt nicht nur die theokratische Legitimation zur Sicherung der politischen Herrschaft, sondern die eingesetzten Führer erklären zum Ziel, das gesellschaftliche Leben der Bürger bis in die Intimsphäre hinein zu kontrollieren. Die Religion stellt hierbei eine allumfassende Legitimationsideologie dar. Die Mullahs, als geistliche Vordenker und Gelehrte des islamischen Fundamentalismus stellen hierbei das Äquivalent zu den kommunistischen Parteiorganisationen dar. Da die islamische Theokratie nach Merkel jedoch in die kapitalistische Organisation der Wirtschaft nicht eingreift und sich somit ein wichtiger Teilbereich ihrer Kontrolle entzieht, stellt das theokratisch-totalitäre Regime zwar einen Idealtypen dar, der jedoch in der Realität bis jetzt noch nicht verwirklicht worden ist.
Zusammenfassung der Diskussion
Zusammenfassend lässt sich also nochmals feststellen, dass autoritäre Regime die Freiheit der Bürger begrenzen, während diese in totalitären Regimen abgeschafft wird [vgl. Arendt, 1955, S. 67]. Ziel der Staatstheoretiker ist es immer Idealtypen zu kreieren, um eine Einteilung und Vergleichbarkeit der zu beobachtenden Herrschaftsformen herzustellen. „Von besonderer Bedeutung sind dabei allerdings die Übergangsformen und Variationen“ [Bracher, 1982, S. 122], um der komplexen Realität näher zu kommen. Auch unter den in dieser Arbeit näher betrachteten Staaten des Sowjetreiches[14] gab es noch Unterscheidungen. So waren die ehemalige DDR und die damalige ČSSR eher zu der kommunistisch totalitären Form zu zählen, während die Volksrepublik Polen weniger totalitär als mehr autoritär bezeichnet wurde.
Bei autokratischen Systemen, zu denen folglich auch die Staatsformen der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten gehörten, geht man von einer endogenen Instabilität aufgrund des überhand nehmenden Lerndefizits durch fehlende Teilnahmemöglichkeiten der Bevölkerung aus. Dies und zudem auftretende Probleme der sozialistischen sowie faschistischen nichtdemokratischen Regierungsformen in Bezug auf deren Unterstützung durch die Bevölkerung ließen die Legitimation für die jeweiligen Machthaber sinken. Gründe waren hierfür der mit zunehmender Dauer ausbleibende wirtschaftliche Erfolg oder die geforderten Mitspracherechte aufgrund des eintretenden wirtschaftlichen Erfolges. Auf das Schwinden der Unterstützung der Gesellschaft für das politische System wurde oftmals repressiv von Seiten der Staatsmacht reagiert und somit unweigerlich eine Negativspirale zwischen wachsender Unmut der Bevölkerung und Unterdrückungsmechanismen in Gang gesetzt, wie sich beispielsweise in den durch die sowjetische Armee blutig niedergeschlagenen Aufständen in der Tschechoslowakei oder in Polen gezeigt hat.
Wie Huntington darstellte, gab es im Laufe des 20. Jahrhunderts drei Demokratisierungswellen, wobei die dritte mit dem Ende des portugiesischen Salazar/Caetano-Regime seinen Anfang nahm, im Zusammenbruch des Sowjetreiches seinen Höhepunkt fand und bis heute noch andauert.
In den vorangegangenen Absätzen wurde erörtert, wie sich die Geschichte der vergleichenden Regierungslehre über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und welche Charakteristika für die verschiedenen Zeitepochen auftraten. Daraufhin wurde der theoretische Unterschied zwischen demokratischen und autokratischen Systemen mit Hilfe von Erkennungsmerkmalen dargelegt, um somit deren Stabilitätseigenschaften tiefer gehend untersuchen zu können. Im letzten Kapitel sollten dann die genaueren Subtypen von autoritären und totalitären Systemen untersucht werden. Festhalten lässt sich, dass die in hier im Mittelpunkt stehenden Länder[15] Polen, die ČSSR sowie die DDR aufgrund deren Systemstruktur und -merkmale instabil waren, wie sich gegen Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch real durch den Runden Tisch der Verhandlungen der Solidarność-Gewerkschaft, dem Mauerfall mit den vorangegangenen Großdemonstrationen in der DDR oder der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei gezeigt hat.
Das Aufbegehren der Bevölkerung nach wirtschaftlichem Wohlstand, höherwertigen Produkten, persönlicher Freiheit sowie dem Ende der politischen und militärischen Unterdrückung war es zu verdanken, dass Gorbatschow sich gezwungen sah, seine Perestrojka- und Glasnostreformen umzusetzen, um somit den letzten Versuch zu initiieren, den schleichenden Zerfall des damaligen Ostblockes zu stoppen. Wie die Geschichte jedoch gezeigt hat, war auch dieser Versuch vergeblich. Mitgliedsländer des sowjetischen Reiches forderten nach Jahren der Gleichschaltung und Gemeinschaft im untergehenden Kommunistenreich ihre Rechte nach Selbstbestimmung und staatlicher Unabhängigkeit. All dies führte dazu, dass das sozialistisch-planwirtschaftliche System Ende der 1980er Jahre zusammenbrach und der Weg zu einer Implementierung eines demokratisch-freiheitlichen Markt- und Staatssystem frei war. Aus diesem Grund sollen nun speziell die verschiedenen Merkmale der vorherrschenden politischen und wirtschaftlichen Transformationstheorien näher erläutert werden.
2.2. Die Transformationstheorie
Bevor auf eine genauere Untersuchung der Transformationstheorien eingegangen werden kann, ist es zunächst notwendig, den Begriff der Transformation näher zu erläutern und gegenüber anderen Begrifflichkeiten, die vor allem im Zusammenhang mit den Geschehnissen gegen Ende der 1980er Jahre in Ostdeutschland und den mittelosteuropäischen Ländern verwendet wurden, abzugrenzen.
Daraufhin wird dann von theoretischer Seite gezeigt, wie die Übergänge zum Einen von einem autokratischen System zu Demokratie und zum Anderen von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft erreicht werden können und welche Reformmaßnahmen hierfür eingeleitet werden müssen. Speziell soll hierbei auch auf die unterschiedlichen Ansätze für eine Etablierung dieser Reformen eingegangen werden.
2.2.1 Der Transformationsbegriff
Generell werden im Zuge des Zusammenbruch des früheren Sowjetreiches Begriffe wie Regimewandel, Systemwandel, Systemwechsel, Transition oder Transformation gebraucht, um den in dieser Arbeit beschriebenen Fall des Übergangs zu einer Demokratie zu erklären, wobei im Grunde auch der umgekehrte Weg, also die Veränderung des Systemtypus hin zu autokratischen Systemen, damit dargestellt werden kann [vgl. Merkel, 1999, S. 74 ff.].
Unter einem Regime- bzw. Systemwandel versteht man allgemein die Situation, in der sich Strukturen als auch grundlegende Funktionsweisen eines Systems beginnen zu verändern. Der Unterschied zu einem Systemwechsel besteht nun darin, dass bei einem Regime- oder Systemwandel offen bleibt, ob der Prozess des Wandels vollständig in einem anderen Systemtypus endet. Bei einem Systemwechsel geht man dagegen definitiv von einem abgeschlossenen Prozess hin zu einem neuen politischen Systemtypus aus [vgl. ebenda].
Der Begriff Transition erlangte durch das Forschungsprojekt unter dem Namen Transition to Democracy aus dem Jahre 1986 erstmals größere politikwissenschaftliche Bedeutung[16]. Vor allem die Unsicherheiten des Endes eines Systemwechsels spielte hierbei eine große Rolle. Transition bedeutet übersetzt Übergang, wobei genauer auch die Deutung Übergang zur Demokratie diesem semantisch gleichgesetzt werden kann.
Nohlen definiert als Transition die Betrachtung des Gesamtkomplexes aus „Bedingungen, Faktoren und Verlaufsmustern der Demokratisierung politischer Systeme“ [Nohlen, 1988, S. 4], die vor allem durch die Erforschung der Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika und Südeuropa entstand und sich hauptsächlich der Rolle der Akteure in den Übergängen zur Demokratie und einer systematischen Periodisierung des Transitionsprozesses widmet [vgl. ebenda].
Bezogen auf den politischen Umbruch in Mittelosteuropa ab 1989 hat sich hingegen weitestgehend der Begriff Transformation in der volkswirtschaftlichen Literatur etabliert. Dieser beschreibt nun in einem engeren Zusammenhang den
„Systemwechsel, der mit der Ablösung einer zentralen Verwaltungswirtschaft durch die Marktwirtschaft, dem Wechsel von der Diktatur einer Partei zu einer freiheitlichen Demokratie und dem Übergang von einer autoritär verfassten zu einer pluralistischen Gesellschaft verbunden ist“ [Sandschneider, 1995, S. 33].
Der Transformationsbegriff hat sich aber ebenso als „Oberbegriff für alle Aspekte der Veränderung eines Systems und seiner Subsysteme“ [ebenda, S. 38] in der sich damit befassenden Literatur etabliert. Er greift somit semantisch weiter als der Transitionsbegriff. Die Transformation eines Systems schließt die Begriffe Regimewandel, Systemwandel, Wandel, Systemwechsel oder Transition mit ein und beinhaltet folglich die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umformungen eines Systems [vgl. ebenda].
In den hier folgenden Ausführungen wird versucht, diese Differenzierung der Begrifflichkeiten zu respektieren. Transformation soll als Synonym für den Übergang von einer autokratischen Systemform zu einer demokratischen benutzt werden. Inbegriffen sind hierbei neben den politischen Systemveränderungen insbesondere auch die Teilsysteme Wirtschaft und Gesellschaft. Da im Nachhinein betrachtet der Zusammenbruch des Ostblockes und dessen Weg auf zu einer freiheitlich-demokratischen Systemordnung nach zwei Jahrzehnten als erfolgreich und größtenteils als abgeschlossen betrachtet werden kann, soll auch weiterhin der Begriff des Systemwechsels für die Geschehnisse der im Mittelpunkt stehenden Länder Polen, der ehemaligen DDR und der damaligen Tschechoslowakei verwendet werden können.
2.2.2 Politische und wirtschaftliche Transformation
Wie dargestellt, beinhaltet der Begriff der Transformation sowohl den gesellschaftlichen, als auch den wirtschaftlichen und politischen Übergang. Da die betrachteten Länder sich von einem autokratischen Regime zu einer Demokratie gewandelt haben, reicht es aus, den Prozess lediglich in diese Richtung zu untersuchen. Im Folgenden soll somit sowohl der politische Übergang von einem autokratischen Regime zu einem demokratischen sowie der wirtschaftliche Übergang von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft dargestellt werden.
Der Weg vom Kommunismus zur Demokratie[17]
Mit Beginn der dritten Demokratisierungswelle in den 1970er Jahren und dann nochmals verstärkt seit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches kam es verstärkt zu einer Theoriedebatte in der Transformationsforschung. Deren Anfänge reichen aber bereits bis in die 1950er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück.
Obwohl ein vollkommener Systemwechsel vielfältig, komplex und oftmals lange Zeit beansprucht, lässt sich feststellen, dass eine Transformation eines Systems essentiell aus drei Phasen besteht, die ein Transformationsland zu einer erfolgreichen Implementierung eines neuen politischen Systems durchlaufen muss. Diese Phasen sind:
1. Ende des autokratischen Regime (Liberalisierung),
2. Institutionalisierung der Demokratie (Demokratisierung) und
3. Konsolidierung der Demokratie,
wobei die verschiedenen Inhalte der jeweiligen genannten Phasen dann von dem angestrebten „wie“ der Ausgestaltung des Transformationsprozesses abhängen. Dies soll jedoch erst in einem weiteren Schritt dieser Arbeit betrachtet werden.
Neben diesen genannten drei Phasen, deren Abtrennung untereinander sicherlich nicht immer als strikt anzusehen ist, sondern zudem davon abhängt, wie die Umsetzung verschiedener Teilbereiche des politischen Systems bzw. auch der Willen zur Umsetzung dieser möglich und vorhanden ist, spielen auch die „vorautokratischen Demokratieerfahrungen“ [Merkel, 1999, S. 120] und die Art des autokratischen Regimes bzw. dessen zeitliche Dauer vor dem Beginn des Umbruchs eine gewichtige Rolle.
Bezug nehmend auf die genannten drei Phasen sollen diese nun näher beschrieben werden:
Zu 1. Ende der autokratischen Systems (Liberalisierung):
Die drei Haupttransformationsphasen werden also eingeleitet vom Ende des autokratischen Systems. Natürlich gibt es für jeden einzelnen Systemwechsel spezifische und nur für diesen Fall zutreffende Ursachen. Dennoch lassen sich bei Betrachtung der vielen Systemtransformationen in allen Regionen der Erde „Ursachenbündel“ [Merkel, 1999, S. 123] erkennen, die verallgemeinernde Aussagen über die Gründe zulassen.
Wie bereits erwähnt können Anlässe für das Zusammenbrechen autokratischer Systeme beispielsweise Legitimitätskrisen aufgrund ökonomischer Ineffizienzen, ökonomischer Effizienzen oder politischer Schlüsselereignisse sein. Diese alle können unter dem Begriff „systeminterne Ursachen“ [ebenda] zusammengefasst werden. Das Aufbegehren aufgrund einer nicht mehr hinnehmbaren Wettbewerbsfähigkeit des eigenen wirtschaftlichen Sektors war sicherlich auch mit Grund für das Opponieren der Bevölkerung in den ehemaligen sowjetisch-kommunistischen Regimen, gefolgt von einer Repressionsstrategie der politischen Machthaber. Zunehmende Legitimitätsdefizite aufgrund ökonomischer Effizienzen traten wie bereits erwähnt in rechtsgerichteten Regimen auf. Als politische Schlüsselereignisse, die zumeist zusammen mit Legitimitätsdefiziten aufgrund ökonomischen Effizienzen oder Ineffizienzen auftraten, gelten beispielsweise der Tod eines Diktators (beispielsweise Franco 1975) oder aufkommende regimeinterne Elitenkonflikte.
Als „systemexterne Ursachen“ [ebenda] für das Ende nichtdemokratischer Regime zeichneten sich vor allem Kriegsniederlagen, der Wegfall externer Unterstützung oder ein so genannter Dominoeffekt verantwortlich. Herausragendes Beispiel für die Initiierung eines Systemwechsels durch eine Kriegsniederlage ist sicherlich das Ende des nationalsozialistischen Deutschlands im Jahre 1945. Als weitere systemexterne Ursache – auch für den Zusammenbruch des Ostblockes und somit auch dem Ende der Regime in der DDR, in Polen und der ČSSR – kann der Wegfall der Unterstützung von außen sein. Das zentralisierte Staatengebilde der Sowjetunion war auf Moskau bzw. Russland als der Pol dessen Satellitenstaaten fixiert. Das Ende des Leitgedankens des „sozialistischen Internationalismus“ [Merkel, 1999, S. 128] und somit das Aufgeben der Breschnew-Doktrin ließ die Interventionsgefahr der Truppen des Warschauer Paktes wegfallen und ermöglichte so auch erst den nachfolgenden Systemwechsel. Aufgestachelt durch Berichte über die Geschehnisse und durch TV-Übertragungen aus anderen kommunistischen Staaten der Sowjetunion in Zeiten des Zusammenbruchs der Regime ist auch die Wirkung dieser Propaganda, gerade auf die Eliten des Landes die dem System oppositionell gegenüberstehen, nicht zu vernachlässigen, weshalb auch dieser Dominoeffekt ein Grund für einen möglichen Beginn einer Systemtransformation darstellen kann.
Mögliche Verlaufsformen der ersten Phase eines Transformationsprozesses können beispielsweise ein von alten Regimeeliten gelenkter Systemwechsel sein. Hierbei initiieren die autokratischen Machthaber früherer Regime die Ablösung des Systems und begleiten den Verlauf der Implementierung des neuen demokratischen Systems. Ebenso kann das Abdanken der autokratischen Machthaber, wie beispielsweise im Falle Spanien nach dem Militärputsch 1974, durch einen von unten, also von der Bevölkerung, erzwungenen Umsturz von Statten gehen. Diese Form des Aufbegehrens der Gesellschaft gegen die autokratischen Machthaber verläuft zumeist unblutig, zum Teil durch Verhandlungen zwischen Regime- und Oppositionseliten und endet erfahrungsgemäß schnell in dem Ende der nichtdemokratischen Herrschaft. Die Aufbegehrenden, oftmals aus der Mittelschicht oder dem Proletariat stammend, prangern die offenkundigen Missstände in einer derart großen Zahl an, dass eine Unterdrückung der Demonstrationen und Meinungskundgebungen durch repressive Gewalt oftmals wenig erfolgversprechend wäre.
Im Gegensatz zu einem von unten erzwungenen Systemwechsel, der von der bürgerlichen Schicht initiiert wird, spricht man von einem ausgehandelten Systemwechsel, wenn zwischen Eliten des Regimes und deren Opposition eine Pattsituation vorliegt und keine der beiden Seiten die Macht besitzt, „einseitig die Modalitäten der zukünftigen politischen Herrschaft zu definieren“ [Merkel, 1999, S. 131]. In Folge dieser Verhandlungen sollen dann der bestehende Herrschaftsanspruch, der Herrschaftszugang, die Herrschaftsstruktur und die Herrschaftsweise neu definiert werden und mehr an demokratische Prinzipien angepasst werden, wobei der Ausgang des Verhandlungsprozesses in diesem Falle relativ offen ist. Die alten Kader des Regimes verfügen noch über erhebliche Machtressourcen des Staatsapparates, so dass der Erfolg des Systemwechsels erheblich davon abhängt, in wie weit sich die reformwilligen und verhandlungsbereiten Eliten des alten Regimes gegen deren innerpolitischen, reformunwilligen Widersacher durchsetzen und somit Demokratisierung und Liberalisierung weiter vorangetrieben werden kann. Als Beispiel kann hierfür das Eintreten und das verstärkte Aufkommen der Solidarność-Gewerkschaft in Polen gegen Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts gesehen werden, die zwar größtenteils von den einfachen Arbeitern unterstützt wurde und für deren Belange eintrat, allerdings der Machtwechsel und der Übergang zu demokratischeren Systemelementen dann in Folge von Verhandlungen am runden Tisch hauptsächlich zwischen der Gewerkschaft und der kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ausgehandelt wurde.
Vor allem in Osteuropa führte oftmals das Zusammenspiel von inneren und äußeren Faktoren zum Zusammenbruch des kommunistischen Regimes. Neben den bereits erwähnten externen Faktoren wie das Aussetzen der Breschnew-Doktrin oder dem internen, verhandlungsbasierten Beginn des Umbruches in Polen, war sicher der Kollaps der gesamten sozialistischen Staatsdoktrin die Initialzündung für den Weg in ein demokratischeres System. Dies war jedoch sicherlich nur aufgrund der Rebellion an der Basis möglich. Dennoch war die Geschwindigkeit mit der dieser gesamte Systemtypus in allen Staaten des Sowjetreiches abrupt in sich zusammenbrach und einen Dominoeffekt auslöste, in Folge dessen es zur Implosion des gesamten Staatengebildes kam, bemerkenswert. Einige der in Folge dieser Geschehnisse neu gegründeten Staaten, wie beispielsweise Slowenien oder Estland, können als Demokratien bezeichnet werden, die sich aufgrund des Kollapses dort etablieren konnten.
Während in Polen folglich vor allem aufgrund von Verhandlungen von Arbeitnehmervertretern die Anfänge für eine Demokratisierung gemacht wurden, kam es dagegen in der DDR oder der damals noch existierenden Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik durch Proteste und Kundgebungen zu einem von unten erzwungenen Systemwechsel, der größtenteils nicht über den Verhandlungsweg erreicht wurde. Beiden war ebenfalls gemeinsam, dass die eingeleitete Demokratisierung sowohl im Falle der DDR als auch in der ČSSR mit einer Neugründung von Staaten einherging. Letztere streifte hierbei die Bevormundung und Kontrolle durch den Kommunismus ab und gründete die liberalisierte Tschechische und Slowakische Föderative Republik (Tschechoslowakei), während die DDR Teil der BRD wurde und deren freiheitlich-demokratische Staatsform übernahm.
Zu 2. Institutionalisierung der Demokratie (Demokratisierung):
Die Phase der Demokratisierung nach der hier getroffenen Einteilung erstreckt sich somit beginnend mit der Endphase des autokratischen Regimes bis zum Beginn der demokratischen Konsolidierung, die nach Merkel damit beginnt, dass eine neue demokratische Verfassung verabschiedet wird, die den politischen Wettbewerb und Entscheidungsverfahren normiert und legitimiert. Nach Rüb ist die Demokratisierungsphase als Prozess definiert,
„in dem die unbegrenzte, unkontrollierte und kompromisslos eingesetzte politische Macht von einer sozialen Gruppe oder Person auf institutionalisierte Verfahren verlagert wird, die die exekutive Macht begrenzen, laufend kontrollieren, regelmäßig verantwortbar machen und kontingente Ergebnisse ermöglichen“ [Rüb, 1996, S.114].
Dies bedeutet also, dass Regeln implementiert werden, die für Regierende und Regierte gleichermaßen gelten. Der Demokratisierungsprozess beginnt,
„wenn die Kontrolle der politischen Entscheidungen den alten autoritären Herrschaftseliten entgleitet und demokratische Verfahren überantwortet wird, deren substantielle Ergebnisse sich a priori nicht mehr bestimmen lassen“ [ebenda].
Alte Normen und Institutionen besitzen nicht mehr, oder nur noch zum Teil, Geltung, während neue Institutionen und Regeln noch nicht oder nur zum Teil etabliert worden sind. Ebenso wird damit begonnen die bis dahin vorherrschenden sozialistischen Planungsverfahren durch marktwirtschaftliche, auf Privateigentum und Eigenverantwortlichkeit basierenden, Allokationsmechanismen zu ersetzen. Um des Weiteren nicht nur ein Wirtschaftssystem zu etablieren, das den Ansprüchen an eine moderne Marktwirtschaft entspricht, muss das ganze Systemgebilde zum Teil von Grund auf erneuert werden. Die Gewährung individueller Verfügungs- und Handlungsrechte, die grundlegende Veränderung der konstituierenden Elemente einer Wirtschaftsordnung, wie Planungskompetenz und die Eigentumsordnung, sind hierbei nur einige der Maßnahmen die in den verschiedenen Sektoren eingeleitet werden müssen. Neben Reformen im politischen Teilsystem, wie beispielsweise die Zerschlagung der bisher herrschenden bürokratischen Machtstrukturen, sowie der Aufbau einer neuen öffentlichen Verwaltung sind vor allem auch Reformen im Subsystem Wirtschaft notwendig, die nach dem Ende der Planwirtschaft eingeleitet werden müssen. v. Beyme spricht hierbei von einem „Problem der Gleichzeitigkeit“ [v. Beyme, 1994, S. 192], das zuvor kein marktwirtschaftliches System hat je bewältigen müssen [vgl. ebenda].
Dass Maßnahmen mit dem Ende der Autokratie getroffen werden müssen, um den Weg zu einer liberalen, demokratischen Staats- und Wirtschaftsform gehen zu können, steht außer Frage. Mit welcher Geschwindigkeit und Intensität musste von jedem, in diesem Falle ex-kommunistischen Land selbst abgewogen und bewertet werden.
Die am weitläufigsten verbreitenden Ansätze um die anstehenden Anforderungen und Aufgaben meistern zu können sind die beiden Transformationsansätze der so genannte Schocktherapie bzw. dem Ansatz des Gradualismus, die später in diesem Kapitel noch genauer beschrieben werden sollen.
Aufgrund der Übergangsphase, in der die alten Normen und Regeln noch nicht vollständig abgeschafft wurden, die neuen gewünschten demokratischen Richtlinien jedoch noch nicht vollkommen implementiert sind, besitzen die politischen Akteure einen weitaus größeren Handlungsspielraum als in bereits konsolidierten demokratischen Systeme. Bindende Normen, sozial verankerte Interessen und etablierte Institutionen schränken die politischen Entscheidungsträger noch nicht in dem Maße ein, so dass die politischen Überzeugungen aber auch Eigeninteressen der politischen Akteure eine überaus wichtige Rolle spielen. Die Problematik besteht nun darin, dass von den verantwortlichen Akteuren Regeln im Rahmen des Demokratisierungsprozesses entworfen werden, die sowohl für sie selbst gültig sein sollen, als auch als gemeinhin akzeptierte Verfahren für die folgenden politische Kräfte, Konflikte und Generationen Bestand haben sollen. Ziel sollte es also sein, eine Balance zwischen den Teilinteressen der politischen Machthaber und dem Allgemeinwohl zu finden. Dieses Eigeninteresse der politisch Verantwortlichen, die vor allem in den neu etablierten demokratischen Regierungen häufig aus den Hauptakteuren der Regimeopposition – aufgrund deren Anstrengungen und zumeist Verdienste im Rahmen des Systemwechsels – bestanden (zum Beispiel Lech Wałęsa, Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność und von 1990-1995 Staatspräsident im nachkommunistischen Polen), führte dann u.a. dazu, dass die Ausgestaltung des neu zu installierenden demokratischen Regierungssystems auch häufig von der Frage der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative und somit von Machtzuständigkeiten geleitet wurde[18].
Zu 3. Konsolidierung der Demokratie
Nachdem beschrieben wurde welche Gründe für ein Ende eines autokratischen Systems vorliegen müssen und dadurch gezeigt wurde, wie sich die Institutionalisierung der Demokratie auf die beiden Teilsysteme Politik und Wirtschaft auswirken kann und welche Schritte initiiert werden müssen (vgl. hierzu auch Tabelle 2, S. 43) um die alten sozialistischen Strukturen abzustreifen, beschreibt die dritte und letzte Phase eines Transformationsprozesses die weitere Implementierung und Etablierung von demokratisch-freiheitlichen Institutionen, Normen und Regeln.
Als Beginn der demokratischen Konsolidierung können sowohl die Gründungswahlen, demnach die ersten freiheitlichen, nach demokratischen Prinzipien gehaltenen Wahlen, oder die Verabschiedung der demokratischen Verfassung genannt werden. Diese soll garantieren, dass die politischen Akteure beginnen ihr Verhalten und ihre Entscheidungen nach den demokratischen Normen, die nun institutionell abgesichert sind, auszurichten. Sicherlich beschränkt sich diese Argumentation mehr auf den Part des politischen Subsystems. Dessen Aufgabe ist es jedoch die Normen und Verfahrensmechanismen zu setzen, nach denen sich andere Teilsysteme wie Wirtschaft richten müssen. Anzumerken bleibt jedoch noch, dass der Konsolidierungsprozess in einzelnen Teilbereichen auch bereits dann beginnen kann, bevor alle relevanten demokratischen Institutionen durch Normen, Gesetze oder der Verfassung etabliert sind.
Nach Merkel und Puhle gilt eine Demokratie dann als konsolidiert,
„wenn alle politisch signifikanten Gruppen die zentralen politischen Institutionen des Regimes als legitim ansehen und die Spielregeln der Demokratie befolgen, die Demokratie also sozusagen „the only game in town“ (Przeworski) ist“ [Merkel/Puhle, 1999, S. 136]
Der Übergang von der Phase der Institutionalisierung der Demokratie zur Konsolidierung dieser verläuft also trotz der Zuhilfenahme von Abgrenzungskriterien fließend. Diese beiden Phasen und deren Inhalte greifen also ineinander über und können nicht separat voneinander betrachtet werden.
Nach Merkel beruht eine erfolgreiche Konsolidierung eines demokratischen Systems auf vier „analytische Ebenen“ [Merkel, 1999, S. 145]. Nach diesen muss neben einer konstitutionellen Konsolidierung ebenso eine repräsentative Konsolidierung, eine Verhaltenskonsolidierung und eine Konsolidierung der Bürgergesellschaft stattfinden. V. Beyme hält als wichtigste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Konsolidierungsphase vielmehr das rasche Beseitigen der alten Eliten, ein hohes Bildungsniveau sowie das Vorhandenseins eines Sogs zahlreicher bestehender Systeme des neuen Typus und eventuell die Möglichkeit des Einstieges in ein bereits bestehendes System, wie es beispielsweise im Falle Ostdeutschlands mit der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland der Fall gewesen ist [vgl. v. Beyme, 1994, S. 199].
Der bereits erwähnte 4-Ebenen-Ansatz von Merkel bezieht sich hingegen mehr auf eine zeitliche Abfolge und auf Interdependenzen zwischen den einzelnen Ebenen, die sich zum Teil untereinander bedingen. Die erste Ebene, die konstitutionelle Konsolidierung, bezieht sich auf zentrale politische Verfassungsinstitutionen wie die Regierung, das Parlament, das Staatsoberhaupt als auch die Judikative und das Wahlsystem, die als erstes und häufig auch am zügigsten demokratisiert werden bzw. demokratischen Regeln untergeordnet werden. Die vierte und letzte Ebene hingegen hat weniger mit der Implementierung von demokratischen Strukturen als mit der Herausbildung einer neuen Mentalität einer Gesellschaft zu tun. Der Prozess beinhaltet die „Herausbildung einer Staatsbürgerkultur als soziokulturelle(n) Unterbau der Demokratie“ [Merkel, 1999, S. 146] und kann Jahrzehnte oder ganze Generationen dauern. Erst wenn diese, am längsten andauernde Ebene, abgeschlossen ist, kann tatsächlich von einer konsolidierten, gefestigten und auf allen Ebenen akzeptierte Demokratie gesprochen werden. Die demokratische Herrschaftsordnung ist somit dann als vollkommen stabil anzusehen wenn das politische System mit ausreichender aktiver und passiver Unterstützung aus der Gesellschaft versorgt wird und sich eine „civic culture“ bzw. „civil society“ [ebenda] herausgebildet hat. Dies bedeutet, dass die demokratischen Werte und Einstellungen vollkommen akzeptiert und getragen werden (civic culture) und auch die Bürger sich aktiv am demokratischen Geschehen in der Gesellschaft und gegenüber dem Staat beteiligen (civil society).
Zwischen diesen beiden Ebenen liegen des Weiteren die beiden weiteren Voraussetzungen für eine vollkommen konsolidierte Demokratie, nämlich die repräsentative Konsolidierung und die Verhaltenskonsolidierung (zweite und dritte Ebene). Beide beziehen sich sowohl auf das Herausbilden und Bekräftigen von Parteien und Interessenverbänden als auch auf das Übereinstimmen der informellen Gesellschaftsakteure wie Finanzkapital, Militär, Großgrundbesitzer oder Unternehmen mit den demokratischen Institutionen und Normen.
Während die erste Ebene also mit der Verfassungsgebung oder mit den demokratischen Gründungswahlen abgeschlossen ist, wird diese dann im Anschluss noch erheblich dadurch beeinflusst, wie sich die Akteure der zweiten Ebene, also die Parteien und Interessenverbände, konsolidieren. Die gemeinsame Konfiguration der ersten beiden Ebenen hat dann zudem noch Auswirkungen darauf, ob sich das vollkommene Durchdringen der Prinzipien auch in den anderen Teilsystemen außer der Politik durchsetzt. Erst wenn die Konsolidierung des Subsystems Politik sowie der anderen Teilsysteme wie Militär oder Wirtschaft abgeschlossen ist, kann sich auch innerhalb der Bevölkerung erst ein vollständig nach demokratischen Leitlinien konformes Denken und Handeln einstellen. Erst anschließend ist eine vollständige Konsolidierung einer neuen Demokratie abgeschlossen und kann somit als Leitbild für andere Transformationsökonomien dienen.
Nach der nun überwiegend politischen Betrachtung des Transformationsprozesses, also die Frage wann ein politisches System den Übergang von einem autokratischen System zu einer Demokratie bewerkstelligt hat und welche Voraussetzungen dafür vorhanden sein müssen, soll im Folgenden nun das Augenmerk auf die wirtschaftliche Konsolidierung der Transformationsländer gerichtet werden. Wie die vier Konsolidierungsebenen nach Merkel auch gezeigt haben, steht meist zu Beginn der Konsolidierungsphase der Demokratie die Einführung eines rechtlichen Rahmens, der die Privat- und Eigentumsrechte der einzelnen Bürger garantieren soll. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Erträge und Kosten von ökonomischen Entscheidungen auch privatisiert werden und so die Eigenverantwortlichkeit der Entscheidungsträger erhöht wird. Dies ist auch für die Etablierung der Marktwirtschaft als einzig geltendes Wirtschaftssystem von Nöten, denn hierdurch werden die Voraussetzungen geschaffen um den langen Weg, weg von Kommunismus und Planwirtschaft, hin zu einem Modell, das auf den Allokations- und Signalmechanismen des Marktes beruht, zu bewerkstelligen.
Wie bereits erwähnt sind die beiden Teilsysteme der Politik und der Wirtschaft aufgrund der unmittelbaren Interdependenzen nicht getrennt voneinander zu betrachten. Dennoch soll nun in den folgenden Ausführungen versucht werden die in einem Transformationsprozess notwendigen Reformen und die theoretischen Ansätze zur Durchsetzung der Marktwirtschaft darzustellen.
Der Weg von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft
Im Zuge des Transformationsprozesses der Mittelosteuropäischen Staaten[19] war es nicht nur Ziel sich dem vorherrschenden undemokratisch-repressiven Politiksystem zu entledigen, sondern es sollten zudem die marktwirtschaftlichen Allokationsmechanismen mit dessen Anreiz- und Selektionsfunktionen die sozialistischen Planungsmethoden ersetzen. Ineffizienzen, nicht marktfähige Produktionen und wirtschaftliche Stagnation waren nur einige der Gründe für das Begehren nach und die Notwendigkeit von gesamtwirtschaftlichen Reformen.
„Obwohl die Neue Politische Ökonomie flexible Verfahren predigt, überwogen wieder lineare Stadienlehren des Übergangs“ [v. Beyme, 1994, S. 203]. Wesentliche Bestandteile des Wechsels zu einem marktwirtschaftlichen System sollten vor allem die Schaffung eines rechtlich-institutionellen Rahmens, die gesamtwirtschaftliche Stabilisierung und zuletzt eine auf breiter Front organisierte Privatisierung der Staatsbetriebe sein [vgl. ebenda].
Vor allem das Problem des optimalen Zeitpunktes und der Weg der Privatisierung der staatseigenen Betriebe wurde in der Fachliteratur kontrovers diskutiert[20], genau wie die Frage, ob die makroökonomische Stabilisierung zuerst erfolgen sollte, wie es beispielsweise Fischer und Gelb fordern [vgl. Fischer/Gelb, 1991, S. 199].
Kaum Dissens herrscht im Gegensatz jedoch darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einen erfolgreichen, wenn auch wie im Falle der mittel- und osteuropäischen Transformationsländer im Nachhinein mit vielen Entbehrungen verbundenen, Übergang bewerkstelligen zu können. Reformen mussten in allen Sektoren durchgeführt werde, denn eine Transformation „will be embedded in an all-embracing reorientation of each and every structure“ [Kloten, 1993, S. 122].
Die Erneuerung des monetären Sektors beinhaltete beispielsweise den Abbau der Preissubventionen (vgl. Tabelle 2) die getätigt wurden, um Mieten bezahlbar zu lassen aber auch um die häufig nicht wettbewerbsfähigen Produkte exportieren zu können. Die Schaffung eines zweistufigen Bankensystems mit einer unabhängigen Notenbank und im Wettbewerb zueinander stehenden Geschäftsbanken, damit die Kreditvergabe von der staatlichen Steuerung befreit werden konnte, oder das Einführen der freien Konvertibilität der eigenen Währung, um auf dem internationalen Finanz- und Gütermarkt existieren zu können, waren nur einige der Punkte die in Angriff genommen werden mussten. Reformen im realen Sektor forderten darüber hinaus sowohl die Entflechtung von Bürokratien als auch die zu Kombinaten und Konglomeraten zusammen gewürfelten Unternehmen und Branchen und deren Privatisierung. Gleichzeitig sollte die Implementierung des Wettbewerbsprinzips erfolgen. Dies beinhaltete die Schaffung und Neuorganisation neuer kleinerer Geschäftseinheiten, das Ausrichten der Unternehmen auf effizienz- und gewinnorientierte Maßstäbe, sowie die Privatisierung dieser [vgl. Siebert, 1991, S. 9].
Des Weiteren mussten im Zuge der Reform des Rechts- und Verwaltungssystem neue, den demokratischen Prinzipien entsprechenden Normen, etabliert werden, die eine größere Trennung von Politik und Wirtschaft mit sich brachten und auf dem privatwirtschaftlichen, konkurrenzdenkenden Leistungsprinzip beruhten. Der Aufbau eines geeigneten, kompetitiven Handelsrechts, Wettbewerbsrechts und Privatrechts, die Rechtssicherheit geboten und internationalen Standards entsprechen sollten, war ebenso dringlich wie die Sicherstellung der Finanzierung des Staates durch ein funktionsfähiges Steuersystem. Der Abbau und die Umstrukturierung des überdimensionierten öffentlichen Sektors – dem in der Planwirtschaft eine zentrale Rolle der Wirtschaftsorganisation zugekommen war – war unabdingbar und musste in dem Aufbau einer schlankeren, mehr angemessenen und mit weniger Kompetenzen ausgestatteten öffentlichen Verwaltung enden. Es mussten also eine Reihe von Maßnahmen auf den verschiedensten Ebenen eingeleitet werden, „damit nicht nur ein Wirtschaftssystem entsteht, sondern damit dieses System auch im Sinne einer modernen Marktwirtschaft funktionsfähig ist“ [Habuda et al., 1996, S. 6]. Eine Übersicht der dringlichsten und essentiellen Bestandteile eines Wechsels von einem planwirtschaftlichen System zu einem marktorientierten ist in Tabelle 2 zu sehen.
Tabelle 2: Generelle Bestandteile eines Systemwechsels
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Habuda et al., 1996, S. 7
Von Beginn an als schwierig gestaltete sich jedoch die Frage, mit welcher Geschwindigkeit und Reihenfolge diese Maßnahmen angegangen und implementiert werden sollten. Hierin lassen sich in der historischen Betrachtung vor allem drei Ansätze finden. Je nach Länge und Kombinationen der einzelnen Wechselelemente wird hierbei von einem Ansatz der Schocktherapie, auch Big-bang-Strategie, oder des Gradualismus gesprochen. Von vielen Autoren wird im Nachhinein jedoch Abstand von den sehr strikten Vorgehensweisen dieser beiden Methoden genommen und ein Mittelweg, entsprechend einer Verfeinerung der Strategievorschläge, also ein Timing oder Sequencing der anstehenden Reformvorhaben, propagiert [vgl. Habuda et al., 1996, S. 6 f.].
Schocktherapie vs. Gradualismus
Die vorherrschenden Wechselstrategien in den ehemaligen Sowjetstaaten folgten der Theorie des Big-bang. Mit Ausnahme von Ungarn, dessen Transformationsansatz wahrscheinlich noch am ehesten dem gradualistischen Denken zuzurechnen war, wollten alle anderen Länder die Gefahr vermeiden, dass eine langsame und bruchstückhafte Reformierung aufgrund zu großer Entbehrungen und somit schwindendem Rückhalt in der Bevölkerung wieder rückgängig gemacht werden könnte. Dies basiert auf Aussagen der Neuen Politischen Ökonomie, die davon ausgeht, dass von „wählerstimmenmaximierenden Politikern nicht zu erwarten ist, ein unpopuläres Reformprogramm lange durchzuhalten“ [Gawel, 1994, S. 70]. Es galt also gerade diese Zeit als das „window of opportunity“ [Wolf, 1999, S 4] für tief greifende Reformen zu nutzen, bevor die Unterstützung für einen weiteren anstrengenden Reformprozess nachlassen würde. Bei näherer Betrachtung der Wahlergebnisse der zweiten demokratischen Wahlen erweisen sich diese angeführten Befürchtungen auch nicht als grundlos. Wurden bei den Gründungswahlen häufig noch Politiker oder Parteien gewählt, die erheblich am Umsturz des alten Regimes beteiligt waren, so wurden diese dann bei den folgenden Parlaments- oder Präsidentenwahlen zumeist wieder abgewählt (Polen) oder erlitten zumindest herbe Verluste in der Zustimmung der Bevölkerung (Tschechien). So ist es nicht verwunderlich, dass Politiker schon aus reinem Eigennutz versucht hatten die Transformationskosten (Inflation, Arbeitslosigkeit, Produktionsrückgang etc.) so gering wie möglich zu halten und einen schnellen Übergang zum neuen System zu erreichen. Wie sich im Nachhinein jedoch herausstellte waren die politischen und wirtschaftlichen Einschnitte und die Enttäuschungen in der Bevölkerung dann trotz des Versuchs eines schnellen Wechsels zu groß, als dass sich der Wunsch eines sprunghaften Übergangs mit der anschließenden Erhaltung der Macht erreichen ließ [vgl. Rosati, 1991, S.215].
Es war Ziel der Schocktherapie, „Grausamkeiten (...) nur für eine kurze Zeitspanne und durchgreifend (zu) begehen, damit die gesellschaftliche Selbstregulierung möglichst früh wieder in ihre Rechte eintreten kann“ [v. Beyme, 1994, S. 221], oder, um es mit den Worten des damaligen tschechischen Finanzministers und jetzigen Präsidenten Václav Klaus auszudrücken: „A chasm cannot be crossed in two steps“ [Wolf, 1999, S. 3].
Grundlage für diesen Theorieansatz, der vor allem auch von neoliberalen, angelsächsischen Wirtschaftswissenschaftlern wie Dornbusch, Gelb, Sachs und Lipton – die beide auch als Berater der polnischen Regierung im Zuge des Transformationsprozesses fungierten – getragen wurden, waren die Programme des Internationalen Währungsfonds (IWF), der stets ein rasches und konzentriertes Vorgehen einem evolutorisch-gradualistischem vorzog [vgl. Rosati, 1991, S. 215]. Dies bedeutete, dass sowohl die gleichzeitige makroökonomische Stabilisierung, Preisliberalisierung und Preisstabilisierung als auch das schnelle Durchsetzen der Eigentumsrechte und die damit einhergehende rasche Privatisierung der beste Weg sei, um einen schnellen Übergang zu einer funktionsfähigen Marktwirtschaft zu erreichen. Unzulänglichkeiten in der Gesetzgebung werden hierbei durch das Beschränken dieser auf das Mindestnotwendige zu Beginn in Kauf genommen [vgl. Gawel, 1994, S. 70]. Des Weiteren wird angeführt, dass auch aufgrund von Interdependenzen der einzelnen Reformen eine möglichst gleichzeitige Durchführung dieser von Nöten sei. Da die Bevölkerung nicht länger gewillt sei die leeren Versprechen nach wirtschaftlichem Wohlstand zu ertragen, sollte hierin durch ein rasches Vorgehen ebenfalls das Vertrauen und der Rückhalt für die anstehenden Reformen gestärkt werden [vgl. Siebert, 1991, S. 19 f.].
Auch der damalige polnische Finanzminister Balcerowicz, der mit seinem nach ihm benannten Plan maßgeblich für die wirtschaftlichen Umstrukturierungen im Zuge des Umbruches 1989/1990 in Polen verantwortlich war, folgte diesen Theorien. Seiner Ansicht nach können Reformen, die schrittweise durchgeführt werden aufgrund dieser gegenseitigen Interdependenzen der Teilbereiche nicht oder nicht wie erwünscht wirken. So würde beispielsweise die finanzielle Kontrolle des öffentlichen Sektors ohne aktiven Wettbewerb keinen Sinn machen. Aktiver Wettbewerb sei hingegen wiederum vom freien Handel abhängig sowie dem Zugang zu Devisen [vgl. Habuda et al., 1996, S. 9]. Durch das schrittweise Einführen von notwendigen Reformen würden diese nur limitiert zur Geltung kommen und damit einen Teil ihrer erwarteten Wirkung verlieren. Auch eine Freigabe der Preise würde ohne einer Zerschlagung der übermäßig auftretenden Monopolstruktur, begleitet von Reformen zur Handelsliberalisierung, wirkungslos bleiben [vgl. Wolf, 1999, S. 4]. Folglich sollen makro- und mikroökonomische Reformen gleichzeitig durchgesetzt werden. Ein schneller Übergang zur Marktwirtschaft ist somit nur gewährleistet, wenn die Elemente der administrativen Vorbereitung, der Makroliberalisierung sowie der Privatisierung möglichst zeitgleich durchgeführt werden. Die Existenz und Notwendigkeit dieser Elemente wird sowohl von den Anhängern der Schocktherapie als auch des Gradualismusansatzes grundsätzlich anerkannt, wobei die Diskrepanzen in den Empfehlungen bezüglich der Geschwindigkeit und der Gleichzeitigkeit der Durchführung der Maßnahmen liegen [vgl. Gawel, 1994, S. 69].
Die zu erwartenden Transformationskosten in Form von Arbeitslosigkeit, Produktionsrückgängen und Preissteigerungen sollten so gering wie möglich gehalten werden. Dies war nach Ansicht der Anhänger der Schocktherapie nur möglich, wenn so schnell wie möglich ein positiver gesamtwirtschaftlicher Wachstumspfad eingeschlagen wird, was wiederum nur durch eine unverzügliche Implementierung der umfassenden Reformen möglich sei [vgl. Dornbusch, 1991, S. 169].
Um diese hohen Transformationskosten nun größtenteils zu vermeiden, basiert der Ansatz der Gradualisten darauf, einen langsamen Übergang des einen Systems zum anderen zu generieren. „The wise man tests the stones before crossing the river“ [Wolf, 1999, S. 3]. Hierbei wird ebenfalls akzeptiert, dass zumindest vorübergehend eine Koexistenz von alten und neuen Regulationsformen besteht [vgl. Habuda et al., 1996, S. 10]. Hauptargument hierfür ist das beinahe außer Kraft setzen beider Systeme und das Abschaffen von Institutionen, ohne eine unmittelbar mögliche Etablierung von neuen. Man ist der Ansicht, dass die Ineffizienz der Planwirtschaft auch dadurch abgelegt werden könne, wenn diese zumindest vorübergehend beibehalten werde und durch das allmähliche Einsetzen von Privatisierungen und marktkonformen Normen von ihren Fesseln [vgl. Wolf, 1999, S. 4] befreit werden könne. Außerdem soll der Staat bei noch nicht privatisierten Unternehmen neben der Finanzpolitik und den Investitionen auch die Löhne weiterhin kontrollieren. Grund hierfür ist die befürchtete geringe Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und ihren Produkten. „Statt „nur“ Ordnungspolitik muss die Regierung während der ganzen Transformationsphase aktive Industriepolitik betreiben“ [Gawel, 1994, S. 72]. Ein dezentrales Aushandeln der Löhne zwischen Gewerkschaften und Unternehmensvertretern berge ein zu großes Risiko den Forderungen nachzukommen, die Löhne unabhängig von der jeweiligen, zumeist geringen, Produktivität zu setzen. Voraussetzung für das Durchsetzen von wettbewerbsfähigen Löhnen ist zuvor eine erfolgreiche Bekämpfung der aufkommenden Transformationsinflation, die insbesondere aufgrund von Preisliberalisierungen und der, aufgrund fehlender Anlagemöglichkeiten, aufgestauten Geldmenge häufig in Erscheinung trat. Auch bei der Schocktherapie war es eine Bedingung für deren Erfolg, dass die Lohnkontrolle im Staatssektor aufrechterhalten werde. Dies sollte hier jedoch nicht durch Eingriffe des Staates, sondern durch den Risikofaktor Gewerkschaften gewährleistet werden [vgl. v. Beyme, 1994, S. 221 f.].
Befürworter des gradualistischen Ansatzes betonen, dass die Implementierung von rechtlichen und effektiven Reformen Zeit benötigt. So kann beispielsweise das Fehlen eines marktorientierten Bankensystems und die noch nicht genügend vorhandene Rechtssicherheit, insbesondere bezüglich Eigentumsrechten und Vertragsrechten gemäß internationalen Standards, dazu führen, dass neue inländische oder ausländische Unternehmen den Markteintritt scheuen. Dies könnte dann bei einer Liberalisierung der Preise ebenso zu Monopolpreisen führen. Des Weiteren war die Befürchtung, dass die Auferlegung von harten Budgetbeschränkungen, was bedeutet, dass die Marktteilnehmer eigenverantwortlich für deren Entscheidungen sind und nicht mit einem bail-out durch den Staat rechnen können [vgl. Siebert, 1991, S. 7] für Unternehmen ohne einen funktionsfähigen Kreditmarkt, auf dem diese sich mit Fremdkapital versorgen können, zu weiteren Insolvenzen führen würde und sich somit die Transformationsrezession weiter vertiefen könnte [vgl. Wolf, 1999, S. 4].
Vor allem ost- und westeuropäische Wissenschaftler wie Kloten, Calvo, Kornai, Murrell oder Frenkel befürworten die gradualistische Strategie. Eine weitere Argumentation für einen mehr geregelten und gestaffelten Übergang war, dass „bei jeder Transformation (...) die Gefahr (besteht), dass die Regierung die Kontrolle über ihr Budget und die Geldmenge verliert, so dass Inflationsdruck erzeugt wird“ [v. Beyme, 1994, S. 221], wodurch die gewünschte makroökonomische Stabilität und somit eine Einbeziehung in den Weltmarkt erschwert werden würde. Abwertungen der eigenen Währung, höhere Risikozinsen und ein Wettbewerbsnachteil für die einheimischen Firmen wären hinderliche Begleiterscheinungen hiervon. Aufgrund der meist mehr als mangelhaften Faktorausstattung und der nicht marktfähigen Produktionen wäre eine zu rasche Konfrontation mit den harten Regeln des Marktes zudem nicht förderlich [vgl. ebenda].
Kloten, schlägt einen Übergang in aufeinander folgenden Phasen vor, der sich auf eine Zeitspanne von 500 Tagen bezieht. Dies geschieht in Anlehnung an das 500-Tage-Programm des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Jawlinski, der damit einen Fahrplan für die Transformation der sowjetischen Wirtschaft erstellt hatte, der jedoch verworfen wurde. Im Gegensatz zur Schocktherapie beabsichtigte dieser Plan jeder der vier vorgesehenen Phasen einen Zeitraum von 100 bis 150 Tage einzuräumen um so einen wirkungsvollen und mit geringeren volkswirtschaftlichen Kosten verbundenen Systemwechsel zu vollziehen. Als Voraussetzung galt es wiederum, zuerst einen mit einem liberalen Wirtschaftssystem kompatiblen legislativen und institutionellen Rahmen zu schaffen. Das Schaffen von Eigentumsrechten und Privatisierungen, der Aufbau von sozialen Sicherungssystemen, die Etablierung von Wettbewerbsrechten und eines zweistufigen Bankensystems waren Aufgaben, die aufgrund derer Komplexität, der Interdependenz und Auswirkungen auf andere anfallende Umstrukturierungsmaßnahmen nicht ad-hoc vollzogen werden konnten und sollten. Erst nachdem die erwünschten Regularien etabliert und akzeptiert waren sollte eine auf Stabilität und Haushaltskonsolidierung ausgerichtete Geld- und Fiskalpolitik durchgesetzt werden sowie eine Preisliberalisierung stattfinden, um dadurch die Integration in den Weltmarkt vorzubereiten. „Economic reforms in transition should start with the build-up of an institutional infrastructure before prices are liberalized“ [Wolf, 1999, S. 5]. Nachdem in den ersten beiden Phasen die Grundlagen und Voraussetzungen für die Etablierung eines freien Wirtschaftssystems geschaffen werden sollen, soll anschließend in den beiden letzten Phasen die Konsolidierung dieses vorangetrieben werden. Die Privatisierung auf breiter Front, die Etablierung einer marktkonformen Wirtschaftspolitik, eine auf Wachstum und Fortschritt ausgerichtete Haushalts- und Firmenpolitik, sowie ein effizientes und angemessenes Marktsystem bedürfen eines längeren Zeitraumes um als gefestigt und vertrauenswürdig zu gelten [vgl. Kloten, 1993, S. 125].
Ein Strukturwandel war aufgrund der Ausrichtung der ehemaligen Staaten des Ostblockes auf die Schwerindustrie und Agrarprodukte unumgänglich, da diese mit der Produktionsstruktur moderner Marktwirtschaften nicht kompatibel waren. Eine zu geringe Produktdifferenzierung, eine zu große Produktionstiefe und kaum vorhandene Arbeitsteilung verlangten somit Investitionen, für die wiederum Voraussetzungen geschaffen sein müssen. Eine unmittelbare Liberalisierung hat nach Ansicht der Gradualisten den vollkommenen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit zur Folge [vgl. Habuda et al., 1996, S. 10]. Vielmehr sollte, je nach Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Wirtschaftszweiges, dieser durch eine angepasste Ausgestaltung der Außenhandelsliberalisierung schonend mit dem internationalen Wettbewerb konfrontiert werden und aufwendig erarbeitete Maßlösungen gesucht werden [vgl. Gawel, 1994, S. 71]. Dahinter stand die Befürchtung, „dass Branchen, die eigentlich aufgrund potentiell vorhandener komparativer Vorteile wettbewerbsfähig wären, bei radikaler Liberalisierung zusammenbrechen würden“ [ebenda].
Zusammenfassend lässt sich bei Betrachtung der beiden Transformationstheorien festhalten, dass sich diese vor allem hinsichtlich der Rolle des Teilsystems Politik und der Bewertung des Staates als Gesetzgeber, aber auch als möglicher Teil des Marktes, unterscheiden. Entscheidend war hierbei die Frage, ob die unsichtbare Hand des Marktes oder eine unterstützende Hand des Staates ergiebiger ist für den zu vollziehenden Systemwechsel [vgl. Gawel, 1994, S. 70].
Die zumeist neoliberalen Befürworter der Schocktherapie stehen Interventionen des Staates sehr kritisch gegenüber. Gerade ein zu mächtiger und alles planender Staat stellte den Grund für das Zusammenbrechen des ehemaligen Ostblockes dar. Aktivitäten des Staates auf dem Markt würden nach deren Meinung nur zu Verzerrungen und Fehlallokationen führen und somit zu einer Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt. Die Maximierung dieser und ein rasches wirtschaftliches Wachstum kann am besten durch einen freien Markt, flankiert mit umfassender und sicherer Gewährung von privaten Eigentumsrechten, makroökonomischer Stabilisierung und der Implementierung einer umfassenden freiheitlichen Gesetzgebung maximiert werden. Schon alleine die Absenz des Staates als Marktbeteiligter wird demnach zu einem raschen Herausbilden eines funktionsfähigen Marktes und dessen Spieler führen und auftretende Probleme werden von diesen selbst gelöst. „Hinter diesem Crash-Konzept steht die Überzeugung, dass die schnellste Einführung marktwirtschaftlicher Allokationsmechanismen der kürzeste Weg zur Überwindung der wirtschaftlichen Krise ist, die zumeist schon vor Beginn der Transformation geherrscht hatte“ [ebenda]. Der gradualistische Ansatz erzeugt nach deren Meinung nur unnötigerweise hohe Transformationskosten. Der Verlust an Zeit durch zu zaghaftes Handeln der Verantwortlichen könne zudem zu einem nachlassenden Reformwillen oder im schlimmsten Falle zu einem Umdenken der verantwortlichen Protagonisten führen. Nach Meinung der „Schocktherapisten“ ist es beinahe unmöglich die Transformationsökonomie vor oder während der Liberalisierung ohne eine Strukturreform auf den Arbeits- und Kapitalmärkten bei weiter bestehenden Fehlallokationen und weichen Budgetrestriktionen zu stabilisieren [vgl. ebenda].
Es gilt also die Gunst der Stunde und den allgemein vorhandenen Aufbruchwillen zu nutzen um schnellstmöglich Fakten schaffen zu können, wodurch eine Umkehr des Prozesses aufgrund nachlassender Unterstützung, auch in der Bevölkerung, nicht mehr möglich oder mit noch höheren Kosten verbunden wäre
Im Gegensatz hierzu ist für die Anhänger des Gradualismusansatzes ein wirkungsvoller und starker Staat, wenn auch mehr abgespeckt als zu Zeiten der Planwirtschaft, gerade für den Übergang zu einem neuen Wirtschaftssystem unabdingbar. Preis- und Lohnkontrollen von staatlicher Seite sollen dazu führen, dass der Faktor Arbeit aufgrund von Inflation oder Gewerkschaftsinteressen nicht zu teuer wird, um dadurch einen Wettbewerbsnachteil für die einheimischen Firmen zu verhindern. Außerdem sind gerade in einer jungen Demokratie die Interessengruppen wie beispielsweise Gewerkschaften noch nicht derart ausgeprägt und mächtig, so dass dies aber ebenso zu zu niedrigen Löhnen führen könnte, um damit ein binnenwirtschaftliches Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage nach Gütern zu schaffen, was ebenso für eine Regulierung durch den Staat spricht. Die vorübergehende Beibehaltung fester Wechselkurse, um aufgrund der zu erwartenden Abwertung der Währung die Importfähigkeit der heimischen Wirtschaft nicht zu gefährden und unausgeglichene Handelsbilanzen zu generieren, ist dementsprechend ein weiterer Punkt in dem ein neutraler Akteur wie der Staat eingreifen sollte. Privatisierungen sind nur dort sofort durchzuführen, wo dies auch gewinnbringend möglich ist. Der Rest der staatseigenen Betriebe sollte je nach Art der geplanten Privatisierung restrukturiert, erneuert oder liquidiert werden, wobei hier nicht nur privates Kapital, gerade in strategisch wichtigen Branchen, eingesetzt werden sollte. Eine weitere Befürchtung war, dass im Zuge einer unverzüglichen Liberalisierung auf dem Finanzmarkt die Fremdkapitalzinsen aufgrund der allgemein vorherrschenden Unsicherheit und den möglichen makroökonomischen Verwerfungen, wie beispielsweise einem starken Produktionsrückgang, zu sehr steigen würden und somit der dringende Investitionsbedarf in den maroden Kapitalstock behindert werden könnte. Nach Meinung des häufig von Praktikern befürworteten Ansatzes sind die schnelle und umfassende Implementierung von Reformen aufgrund der Interdependenzen und der verzögerten Wirkungen (time-lags) ohne staatliche Aufsicht unpraktisch und schädlich. „The pursuit of self-interest unrestrained by suitable institutions carries no guarantee of anything except chaos“ [Kregel, 1992, S 1]. Genau wie die Anhänger der Schocktherapie halten es die Gradualisten aufgrund der maroden Wirtschaft und der institutionellen Unterschiede der beiden Systeme ebenso für unumgänglich, dass die Bevölkerung in den jeweiligen Transformationsländern Entbehrungen und soziale Einschnitte, zumindest im Zuge des Wechselprozesses, wird hinnehmen müssen. Diese sollen aber durch das allmähliche Durchsetzen der Reformen abgemildert und verteilt werden. So soll die Unterstützung der Bevölkerung gesichert werden, was nach Meinung derer der einzige Weg ist, den langen Prozess des Systemwechsels erfolgreich durchzustehen [vgl. Hall/Elliott, 1999, S.1 ff.].
Welche der beiden Ansätze, und ob überhaupt einer dieser beiden, denn nun besser für den Systemwechsel in Volkswirtschaften ist geeignet ist, ist umstritten. Für beide Theorien der Transformation lassen sich positive und negative Beispiele finden. Generell treten aber immer noch Fragen bezüglich der Geschwindigkeit der Implementierung der Transformationsreformen auf. Diese sind beispielsweise welche Rolle der Staat einnehmen soll, und vor allem wie viel Staat, wenn überhaupt, für einen erfolgreichen Übergang nötig ist, welche Rolle ausländische Unterstützung in Form von beispielsweise Transferzahlungen spielen oder generell, wie die im Rahmen eines völligen Systemwechsels anfallenden Transformationskosten gesenkt werden können. Es lässt sich jedoch feststellen, dass in der Literatur die Diskussion über die Anwendung der beiden Ansätze weitestgehend ausgestanden ist [vgl. Habuda et al., 1996, S. 12].
Nach nun nahezu zwanzig Jahren praktischer Erfahrung der Transformationsländer und bei Betrachtung der Resultate der Übergangspolitik lässt sich feststellen, dass viele Maßnahmen einen zu großen Zeitbedarf haben, als das diese im Rahmen einer Schocktherapie sofort ihre Wirksamkeit entfalten könnten. Es kann also im Rahmen einer Big-bang-Strategie nicht darum gehen für alle auftretende Probleme gleichzeitig eine Lösung zu finden, sondern vielmehr müsse den einzelnen Reformen die Zeit zur Vorbereitung und Durchführung gegeben werden, die diese benötigen, um die Wirkung entfalten zu können, die sie sollen. „Der Übergang wird also immer gradueller Natur sein“ [Habuda et al., 1996, S. 13]. Kloten wies ebenso darauf hin, dass die Frage nach großen oder kleinen Schritten nicht gewählt werden kann wie erwünscht. Auf der einen Seite ist es nötig wichtige Reformvorhaben unmittelbar auf den Weg zu bringen, um Voraussetzungen für den Übergang zu schaffen, während die Implementierung anderer Strukturen längere Zeit benötigen oder auch erst angegangen werden sollten wenn bestimmte Strukturen bereits geschaffen wurden. „Thus, there is a need to search for appropriate combinations of large, medium- sized and small steps” [Kloten, 1993, S. 126]. Wie diese Kombination in der Realität nun aussehen kann, soll in der folgenden Darstellung des dritten möglichen Übergangspfades dargestellt werden.
Verfeinerung der Strategievorschläge: Timing und Sequencing
Dieser dritte Ansatz der in der Literatur der Transformationsstrategien zu finden ist, baut zwar auf die Ansätze der Schocktherapie und des Gradualismus auf, ist jedoch im Gegensatz zu diesen mehr an die, im Rückblick beobachtbaren, Realitäten angepasst. Diese wirtschaftspolitische Alternative setzt sich aus einem Big-bang in der frühen Phase der Transformation und dem anschließenden Widmen der Aufgaben, die einen längeren Zeitraum benötigen, also gewissermaßen einer graduellen Fortführung, zusammen [vgl. Habuda et al., 1996, S. 13].
Diejenigen marktwirtschaftlichen Anpassungen, die sich in einem Schritt durchführen ließen, betreffen hauptsächlich die Planungskompetenz und stellen den ersten Schritt von der zentralisierten Planung und Lenkung hin zu einem marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystem dar. Die Liberalisierung von Preisen, Löhnen und Zinsen würde eine solche unmittelbar durchführbare Maßnahme darstellen. Weitere wären die Etablierung von harten Budgetbeschränkungen für Banken und Unternehmen sowie die Einführung der Währungskonvertibilität. Diejenigen Aufgaben, die sich nicht in einem Schritt erreichen lassen, wären in erster Linie die Schaffung einer neuen Eigentumsordnung und die Umstrukturierung und Entzerrung des Institutionengefüges [vgl. ebenda].
Der Reformierung des institutionellen Gebildes wird jedoch unbedingten Vorrang eingeräumt. Die Schaffung von Eigentumsrechten und eines Rechtssystems, das marktwirtschaftlichen und internationalen Ansprüchen genügt, zählen hierzu und sollten neben einer monetären Stabilisierung, einhergehend mit der Abschaffung der administrativen Preise, unmittelbar durchgeführt werden. Hierdurch soll ein Anpassungsdruck auf die Unternehmen geschaffen werden, der zu einer Verbesserung des Marktangebots führen soll, wobei dies bei den noch nicht zerschlagenen Kombinaten und Konglomeraten mit wahrscheinlicher Monopolstellung aufgrund des fehlenden Wettbewerbs eher unwahrscheinlich sein kann. Es stellt sich also die Frage ob die Privatisierung und Entflechtung der Staatsbetriebe nicht doch vorher bewerkstelligt werden sollte, um den Anpassungsdruck der Unternehmen durch Marktkonkurrenz zu erhöhen. Eine andere Möglichkeit, um die Marktmacht der größtenteils noch nicht zerschlagenen ehemaligen Staatsunternehmen zu schmälern, wird in einer eventuellen gleichzeitig durchgeführten umfassenden Außenhandelsliberalisierung gesehen, wobei hierbei damit argumentiert wird, dass eine simultane gesamtwirtschaftliche Liberalisierung und eine außenwirtschaftliche Öffnung die Anpassungsfähigkeit der Volkswirtschaft übersteigen würde und zu einer unnötig schnell steigenden Arbeitslosigkeit führen würde, was wiederum für ein Timing der bevorstehenden Maßnahmen sprechen würde. Eine stufenweise Liberalisierung von Branchen und Preisen im Inland und eine anschließende Durchführung der Handelsliberalisierung nach außen werden hier als gangbaren Mittelweg angesehen. Wenn nach diesem Prinzip der inländischen Freigabe der Preise immer noch Monopolstellungen erhalten bleiben würden, hätten die Unternehmen keinen Anreiz diese über Preispolitik auszunutzen, da sie sich dem Konkurrenzdruck des Weltmarktes, durch die in absehbarer Zeit folgende Öffnung des heimischen Marktes, gegenüber sehen würden. Wird jedoch die Außenhandelsliberalisierung mit all den begleitenden Maßnahmen wie die Einführung der Währungskonvertibilität gleich zu Beginn in einem Schritt durchgeführt, so ist die inländischen Preisfreigabe vor allem bei den handelbaren Gütern nicht mehr dringend und kann zu Gunsten anderer notwendiger Maßnahmen verschoben werden [vgl. ebenda].
Das hier gezeigte Beispiel sollte einen Eindruck gegeben haben, welche unterschiedlichen Ansätze und Lösungen zur Durchführung einer erfolgreichen Transformation unabhängig von den beiden vorherrschenden Theorien des Big-bang oder des Gradualismus gegeben werden. Das Feld auf dem unterschiedliche Reihenfolgen der entsprechenden Schritte vorgeschlagen werden ist breit gefächert. Sollen die Unternehmen, die in einem ersten Schritt entflechtet und reorganisiert werden, sofort harten Budgetbeschränkungen unterworfen werden, oder würden diese Beschränkungen eher die Umstrukturierung des Unternehmenssektors behindern. Auch die Frage, ob die Sanierung der Betriebe von privater Hand getragen werden soll, oder ob der Staat diese zuerst sanieren und dann veräußern sollte ist ein häufig diskutiertes Problem, das in den einzelnen Ländern jeweils anders gehandhabt wurde [vgl. ebenda], auf das in der Untersuchung der einzelnen Länder noch genauern eingegangen werden soll.
Die Liste der Vorschläge zur optimalen Implementierung der nötigen Reformmaßnahmen ließe sich nun beliebig fortführen. Problematisch hierbei ist jedoch, dass viele Reformvorschläge aufgrund fehlender realer Vergleichsobjekte auf Transformationen innerhalb von bereits existierenden Marktwirtschaften basieren. Als gute Beispiele für einen gelungenen Wechsel von einem System zum anderen wurden häufig die Transformationen der ostasiatischen Länder Anfang und Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts oder der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg genannt [vgl. v. Beyme, 1994, S. 200]. Bei genauerer Betrachtung dieser fällt jedoch auf, dass beispielsweise auch Südkorea und Taiwan nicht den gleichzeitigen Schritt einer politischen und wirtschaftlichen Transformation wagten und auch in der BRD das so genannte Wirtschaftswunder unter Ludwig Erhard nicht aufgrund eines völlig liberalisierten Marktes stattfand, sondern auch beispielsweise der Wohnungsmarkt noch unter dem Einfluss des Staates stand, so dass „auch Erhard die völlige Liberalisierung des Marktes nicht mehr erlebte“ [ebenda].
Die Abkehr von den traditionellen Theorieansätzen der Schocktherapie und des Gradualismusansatzes hat sich also weitestgehend vor allem in der Praxis durchgesetzt. Es besteht die Einsicht, dass manche Reformschritte unmittelbar getätigt werden müssen, um das bestehende System abzulösen und die Bevölkerung, aber auch die politischen Entscheidungsträger, auf einen Weg zu führen der gegangen werden muss und eine Umkehr nicht möglich sein soll. Andere, deren Wirkungen bei unvollkommenen Voraussetzungen nicht klar abzusehen sind und eventuell schädlich wirken können oder von Haus aus eine längere Implementierungszeit benötigen, sollen erst im Nachhinein durchgeführt werden, um eine Überanstrengung der Transformationswirtschaft und deren Teilnehmer zu verhindern. Das Zeitfenster zur Implementierung der nötigsten Reformen sollte zudem genutzt werden, was jedoch nicht heißt, dass eine umfassende Reformierung des bestehenden Systems unmittelbar nötig ist. Vielmehr kommt es aufgrund der Wechselwirkungen und der unterschiedlichen Zeitdauer der einzelnen Reformen darauf an, ein genau aufeinander abgestimmtes Reformpaket zu initiieren, das nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt werden kann. Der Transformationsprozess selbst ist also „nicht ein Kontinuum, sondern eine Abfolge unterschiedlicher Phasen“ [Süssmuth, 1998, S. 13].
Viele Reformschritte müssen erst deren Wirksamkeit entfalten, bevor andere daran anschließen können. „Mit Ausnahme der Preisliberalisierung und der Öffnung der Gütermärkte braucht (beispielsweise) die Etablierung einer marktkonformen Mikrostruktur deutlich mehr Zeit, als ihr eine idealtypische Schocktherapie zugesteht“ [Gawel, 1994, S. 73]. Auf der Makroebene stellt sich dann gewissermaßen die Frage ob die unmittelbare Durchführung der dortigen Reformschritte ohne eine wettbewerbskompatible Mikrostruktur (Finanzmärkte, Firmenautonomie, rechtliche Grundlagen etc.) hilfreich ist.
Es geht also nicht darum nach dem Faktor Zeit zu handeln – wobei dieser natürlich aufgrund der anfallenden Transformationskosten nicht außer Acht gelassen werden darf – sondern darum, den bestmöglichen und effizientesten Maßnahmenkatalog für einen absehbaren und unterstützungswerten Zeitraum mit möglichst geringen Wohlfahrtsverlusten zu finden, wobei die Reformer pragmatisch, den aktuellen Problemen in der jeweiligen Transformationsökonomie entsprechend, Maßnahmen durchführen sollten [vgl. Habuda et al., 1996, S. 23].
Wie diese jeweiligen Maßnahmen und die Bewerkstelligung des Transformationsprozesses sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung aussehen, soll nun in den folgenden Kapiteln für Ostdeutschland, Polen und die Tschechische Republik dargestellt werden.
[...]
[1] das folgende Kapitel bezieht sich überwiegend auf Merkel, 1999, S. 23 ff.
[2] für genauere Ausführungen bezüglich der Historie der vergleichenden Regierungslehre siehe Brunner, 1979, S. 22 ff
[3] für eine genauere Darstellung und Beschreibung der verschiedenen Ansätze der Regierungslehre siehe Brunner, 1979, S. 22 ff.
[4] vgl. hierzu Helms/Jun, 2004, S. 65 ff.
[5] die folgenden Ausführungen in diesem Kapitel beruhen mehrheitlich auf Merkel, 1999, S. 28 ff.
[6] für genauere Untersuchungen der Argumentation für bzw. wider der Bildung solcher Idealtypen, sowie deren Einordnung in die Typologie der verschiedenen Ansätze der Regierungslehre siehe Weber, 1968, 240 ff.
[7] zur genaueren Unterscheidung zwischen Transformation, Transition, Systemwandel und Systemwechsel siehe weiter unten in dieser Arbeit
[8] für eine tiefer gehende Analyse der politischen Strukturen in den USA, Großbritannien und Deutschland siehe Steffani, 1979, S. 61 ff.
[9] für vertiefende Ausführungen vgl. Huntington, 1993, S. 13 ff., worauf auch die folgenden Darstellungen größtenteils beruhen
[10] für eine ausführliche Darstellung des Modells siehe Easton, 1965, S. 46 ff. beziehungsweise Almond/Powell, 1988, S. 15 ff.
[11] zur genaueren Untersuchung von Stabilisierungserfolgen von Demokratien und Autokratien vergleiche Welzel, 1996
[12] das folgende Kapitel bezieht sich hauptsächlich auf die Ausführungen von Merkel, 1999, S. 23-57 und Linz, 2000, S.20-37 sowie S.129-257
[13] für eine genauere Diskussion dieser Thematik vgl. Linz, 2000, Bracher, 1982, Merkel, 1999 oder Arendt, 1955
[14] gemeint sind hier und im folgenden die zuletzt 15 Sowjetrepubliken sowie die so genannten Satellitenstaaten Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Ungarn und Tschechoslowakei
[15] die Bezeichnung Länder zielt in dieser Arbeit ebenso auf Ostdeutschland ab, obwohl nach der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland kein eigenes Staatsgebiet in dem Sinne wie in der Volksrepublik Polen, der Republik Polen, der ČSSR, der ČSFR oder später der Tschechischen Republik vorliegt
[16] für eine nähere Betrachtung des genannten Forschungsprojektes vgl. O´Donnell/Schmitter, 1986
[17] die folgenden Darstellungen basieren weitestgehend auf Merkel, 1999, S. 119 ff.
[18] für eine tiefer gehende Betrachtung der Regierungssysteme in Polen, der BRD und in der Tschechischen Republik vgl. Leschke/Sauerland, 1993, S. 42 ff., Vodička, 2005, S. 66 ff. und Glaeßner, 2006, S. 279 ff.
[19] hierzu zählen: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, wobei die Bezeichnung zumeist auf die in dieser Arbeit betrachteten Länder Polen und die Tschechische Republik abzielt
[20] für eine genauere Darstellung der Diskussion über die verschiedenen Sequenzen einer Transformation vgl. Zecchini, 1991, S. 165-233
- Arbeit zitieren
- Matthias Brendlein (Autor:in), 2010, Die Transformationsprozesse in Ostdeutschland, Polen und in der Tschechischen Republik seit 1989, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157804
Kostenlos Autor werden


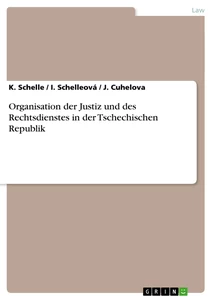








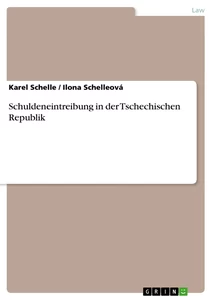


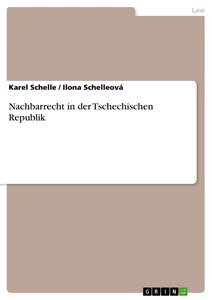

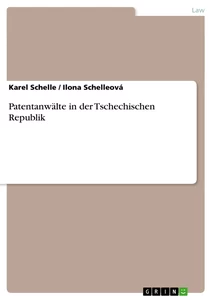



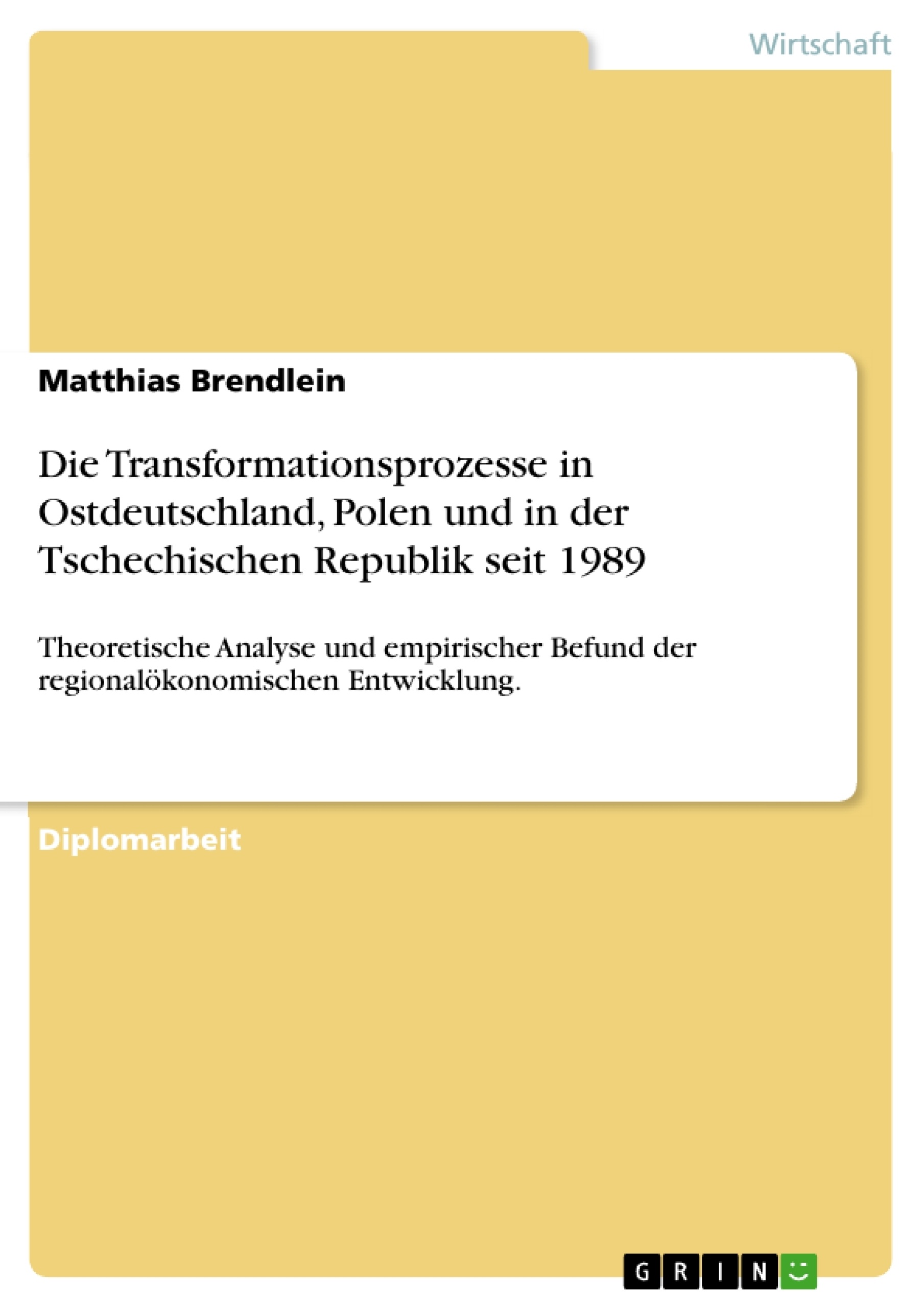

Kommentare