Leseprobe
Einleitung
Mädchen sind von Natur aus die besseren Fremdsprachenlerner; ihnen liegt das im Blut. So sagen die Lehrer und Eltern. Aber auch die Wissenschaft beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Geschlechterdifferenzen im Leistungsniveau der Kinder und sucht nach Ursachen und Erklärungsversuchen. Während sich die Mehrheit der Forschungsarbeiten mit den vermeintlichen Leistungsdefiziten der Mädchen in mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereichen beschäftigen, gibt es für die unterschiedlichen Leistungsniveaus im gesteuerten Fremdspracherwerb noch nicht annähernd viele wissenschaftliche Studien. Doch die weit verbreitete Auffassung der weiblichen Überlegenheit im Fremdsprachenerwerb kann nicht nur auf die Naturgegebenheiten zurückzuführen sein. Gibt es tatsächlich kognitive Geschlechtsunterschiede? Welche Einflussfaktoren spielen neben den biologischen Faktoren außerdem eine Rolle? Wie kann das Geschlecht Interesse und Selbstkonzept beeinflussen und zu unterschiedlichen Leistungen im Fremdspracherwerb führen? Haben sich Geschlechterrollen durch wissenschaftliche Erkenntnisse verändert oder bleiben sie trotz moderner Konzepte und Theorien fest in der Gesellschaft verankert? Welche Maßnahmen müssten getroffen werden, um die Geschlechterdifferenzen im gesteuerten Fremdspracherwerb in der Schule zu verringern?
Warum nimmt der Faktor Geschlecht überhaupt eine solch große Rolle im Leben und Denken der Menschen ein? Wie kommt es dazu, dass trotz zahlreicher Arbeiten und Studien in der Fremdsprachenforschung nach wie vor von weiblicher Superiorität ausgegangen wird? Diese Auffassung steht jener gegenüber, deren Kernaussage darin besteht, dass eine männliche Überlegenheit in naturwissenschaftlichen, technischen Bereichen sowie hinsichtlich des räumlichen Wahrnehmungsvermögens bestehe. Dabei werden Geschlechterrollen und Stereotype immer wieder aufgegriffen und in Forschungsarbeiten zitiert, um Geschlechterdifferenzen zu begründen, die scheinbar geringer sind als sie in der Öffentlichkeit, bzw. den Medien diskutiert werden. Interessanterweise - oder erstaunlicherweise - sind etablierte Geschlechterbilder in der Gesellschaft fest verankert und nur sehr schwer veränderbar, da sie über Jahrzehnte hinweg existieren konnten und zur gesellschaftlichen Ordnung einen gewissen Beitrag leisteten. In Bezug auf die weibliche Überlegenheit im Fremdsprachenlernen werden die Auffassungen zu Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischen Eigenschaften zum Großteil nicht angezweifelt, sondern als Gegebenheiten und Tatsachen hingenommen wie das folgende Zitat zusammenfassend belegt:
Multilingualism, second language learning (SLL), and gender? Don't we already know that women are ‚better at languages' and more willing to interact in their second language (L2)? Or that immigrant women don't learn the language of their new country because their husbands don't let them out of the house? Or that women are more prestige-conscious, which leads them to spearhead language shift? And that they are a subordinate group with no option but to maintain minority languages? Even this short list of widely held assumptions about multilingualism, SLL, and gender reveals how contradictory these assumptions are. So, no, as a matter of fact, we don't know any of these things (Pavlenko & Piller 2001: o. S.; zit. in Schmenk 2007: 124; Hervorh. im Orig.).
Neben den allgemeinen und traditionellen Geschlechterbildern, die auch in den Medien des 21. Jahrhunderts noch großen Anklang finden, wie sich während der Recherchen herausstellte, scheint es als könne jeder Mensch über diese Thematik reden und schreiben. Nicht zuletzt auch dadurch begründet, dass die Variable Geschlecht jeden Mann als auch jede Frau betrifft und sie fest in das alltägliche Leben eingebunden ist, auch außerhalb des schulischen Kontexts. Demzufolge ist auch jeder, der sich wissenschaftlich mit dieser Thematik befasst mit allgemeinen Geschlechterstereotypen konfrontiert, wenn er oder sie sich auch in Objektivität übt. Der Wunsch nach Geschlechterdifferenzen und somit einer (Geschlechts)-Identität „is strong enough to compensate for what, from a purely academic standpoint, are obvious shortcomings or contradictions in the evidence presented" (Cameron 1996: 49). Ist es möglich, dass das Interesse der Menschen an den Geschlechterbildern und deren Funktion zur Aufrechterhaltung dieser dichotomen Entweder-Frau-oder-Mann-Haltung führt? Weshalb behaupten Forscher nach neueren Erkenntnissen, dass Geschlecht sowohl sozial als auch biologisch konstruiert sei? Die Selbstverständlichkeit mit der das Thema Geschlecht auch außerhalb der Wissenschaft behandelt wird, resultiert in Unmengen an Fragen, die sicher nicht in vollem Umfang innerhalb dieser Arbeit beantwortet werden können. Da diese Thematik höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht an Attraktivität und Aktualität verlieren wird, sollen die hier dargestellten Einblicke in die Forschungslage wiederum zu neuen Fragen führen, die den Zusammenhang von Fremdsprache, Geschlecht und zukünftigen Unterricht zu erklären versuchen.
Da sich die Arbeit mit dem Geschlechtsbegriff und dem gesteuerten Fremdspracherwerb in der Schule beschäftigt, soll der erste Teil vorrangig der Einführung in das Forschungsfeld sowie der Darstellung grundlegender Begriffe dienen. Besteht ein Zusammenhang zwischen den biologischen Geschlechtsunterschieden und den sozialen Geschlechterdifferenzen? Welchen Einfluss haben soziale Geschlechtsunterschiede auf das Leben der Menschen? Um diese Fragen im Ansatz zu beantworten, werden die Lerntheorien und die Entwicklung sowie Bedeutung des Selbstbildes dargestellt. Des Weiteren wird auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität als auch auf den Erwerb von Geschlechterrollen und die damit verbundenen geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster kurz eingegangen. In dem letzten Abschnitt des ersten Teils der Arbeit werden nicht nur Geschlechterrollen und Geschlechtsstereotype im historischen Kontext betrachtet, sondern es soll hierbei auch einführend erklärt werden, weshalb Wissenschaftler, aber auch ein Großteil der Gesellschaft der Meinung sind, dass Mädchen und Frauen im (gesteuerten) Fremdsprachenerwerb den Jungen und Männern überlegen seien.
Fragen, die am Ende des ersten Teils dieser Arbeit offen bleiben müssen, sollen im zweiten Teil wieder aufgegriffen und detaillierter diskutiert werden. Dabei wird es im Besonderen darum gehen, welche Rolle das Selbstkonzept, geschlechterdifferente Denkvorlieben als auch Interessenunterschiede für das unterschiedliche Leistungsniveau im gesteuerten Fremdsprachenerwerb spielen. Ferner wird auf den Aspekt, warum Geschlecht ein Problem in der Fremdsprachenforschung darstellt, kurz einzugehen sein, wenngleich nicht alle Perspektiven der aktuellen Forschungslage berücksichtigt werden können. Hierbei liegen die Schwerpunkte v.a. auf der Diskussion über kognitive Geschlechtsunterschiede und einem weiteren wesentlichen Einflussfaktor auf erfolgreiches Fremdsprachenlernen: der Motivation. Gibt es geschlechtsspezifische Motivation? Wenn ja, wodurch ist sie gekennzeichnet? Wie kann Motivation gefördert werden und was kann sie behindern? Abschließend wird herauszustellen versucht, welche Konsequenzen sich aus der aktuellen Forschungslage und den entwickelten Konzepten für den zukünftigen Fremdsprachunterricht ableiten lassen.
TEIL I: GRUNDLEGENDE BEGRIFFE UND BEFUNDE ZUR ENTWICKLUNG VON GESCHLECHTSIDENTITÄTEN, GESCHLECHTERROLLEN UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN UNTERSCHIEDEN IM FREMDSPRACHENERWERB
1. Die Variable Geschlecht in verschiedenen wissenschaftlichen Kontexten
Damit die Variable Geschlecht im Zusammenhang mit der Fremdsprachenforschung untersucht werden kann, werden vorrangig Definitionen und Erklärungsansätze für Geschlechterbilder und geschlechtsspezifische Leistungsdifferenzen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontexten betrachtet, um in das Forschungsfeld einzuführen. Dabei soll auch deutlich werden, inwiefern sich verschiedene Auffassungen der Geschlechterrollen sowie Geschlechterdifferenzen aufgrund historischer Entwicklungen1 verändert haben.
1.1 Biologisch begründete Geschlechterdifferenzen
Zunächst unterscheidet man das Geschlecht von Männern und Frauen durch die jeweiligen biologischen Merkmale, unter welchen vornehmlich die verschiedenen Funktionen bei der Fortpflanzung (Reproduktion) sowie die hormonellen und anatomischen (körperlichen) Unterschiede verstanden werden (vgl. Klann-Delius 2005; Richter 1996; Zimbardo et al. 2004). Asendorpf hebt dabei zusätzlich den Aspekt hervor, dass „[biologisches] Geschlecht… auf genetischer (und nicht wie alltäglich auf anatomischer) Ebene untersucht werden [sollte]";, denn die Chromosomenstellung, XX oder XY, ist verantwortlich für die weiteren hormonellen und damit anatomischen als auch psychologischen Entwicklungsprozesse in der pränatalen Phase sowie nach der Geburt (Ibid. 2004: 377; vgl. Richter 1996). Durch die Aktivität der Chromosomenanlage mit dem genetischen Material kommt es innerhalb der ersten zwölf Wochen bei männlichen und weiblichen Feten zur Herausbildung der entsprechenden Keimdrüsenanlagen (Hoden, Eierstöcke), die dann wiederum bestimmte Sexualhormone produzieren. „Es wäre aber falsch anzunehmen, dass ab diesem Alter Progesteron nur von genetisch weiblichen und Androgene nur von genetisch männlichen Feten produziert würden"; (Asendorpf 2004: 377). Vielmehr handelt es sich um ein quantitatives Verhältnis der Hormonproduktion, welches das hormonelle Geschlecht definiert; d.h., dass alle Feten sowohl männliche als auch weibliche Hormone in verschiedenen Mengen je nach Geschlechtsdrüsenanlage produzieren (vgl. ibid.).2 Der Hormonspiegel des Fetus wird die Entwicklung der Geschlechtsorgane sowie des Gehirns beeinflussen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass „biologische Faktoren an der Ausbildung geschlechtsdifferenzierter Verhaltensweisen mit beteiligt sind"; (Klann-Delius 2005: 174). Dennoch ist der pränatale Hormonspiegel nicht allein für spätere Verhaltensdispositionen entscheidend, sondern Faktoren wie u.a. der allgemeine Gesundheitszustand, die Ernährung, aber auch Stress beeinflussen die Produktionsmenge und Ausprägung der Geschlechtshormone maßgebend, was sich wiederumauf das geschlechtsspezifische Verhalten auswirken kann (vgl. Kimura 2000; Klann-Delius 2005). Auch Halpern (2000) bestätigt diese Annahme, dass Gene nicht losgelöst von den späteren Umwelteinflüssen betrachtet werden können, wenngleich bestimmte - mitunter auch geschlechtsdifferente - Verhaltensweisen und intellektuelle Fähigkeiten durch die chromosomale, genetische und hormonelle Konstellation gewissermaßen vorbestimmt sind. Dabei ist entscheidend, dass Menschen nicht nur beeinflusst werden, sondern mit ihrer Umwelt in eine Art Wechselwirkung treten, in dem sie selbst ihre Umwelt an ihre Fähigkeiten und Anforderungen assimilieren: ";New conceptualizations now include the idea that individuals influence their environment in ways that make separation of heredity and environment impossible" (ibid.: 180).
Vielfach wurden Geschlechtsunterschiede in Verhaltensweisen auch durch evolutionstheoretische Ansätze zu erklären versucht; das bedeutet, man führte die Geschlechterdifferenzen vor allem auf unterschiedliche Aufgaben bei der Fortpflanzung zurück, die eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zur Folge hatte (vgl. Klann-Delius 2005). Frauen sind „nicht nur für Geburt und Aufzucht von Nachwuchs biologisch ausgerüstet, sondern auch für Verhaltensweisen, die damit in Zusammenhang stehen, v.a. im… kommunikativen Bereich"; (Richter 1996: 14f.). Zudem fehlten ihnen von Natur aus die Anlagen zu Aggressivität als auch Leistungsmotivation (vgl. ibid.). Diese evolutionsbiologischen Ansätze wurden und werden in der Forschungsliteratur durchaus skeptisch betrachtet, da sie nicht nur unzureichend diskutiert werden, sondern auch, weil sie empirisch nicht belegbar sind „and they ignore large bodies of data that do not conform to these explanatory frameworks. Virtually any finding can be ";explained" post hoc by hypothesizing how it might have been advantageous to hunter-gatherers". (Halpern 2000: 15). Dennoch wird die Tatsache, dass Verhaltensdispositionen auch auf evolutionär bedingte Verhaltenstendenzen zurückgeführt werden können, nicht völlig zurückgewiesen, da davon auszugehen ist, dass das menschliche Gehirn ";reflect the adaptive pressures of evolution" (Halpern 2000: 226).
Aber die biologischen Erklärungsansätze allein sind nicht ausreichend für die Begründung von Geschlechterdifferenzen. Im Zusammenhang mit den biologischen Faktoren stehen auch die im folgenden Abschnitt kurz dargelegten psychologischen Eigenschaften von Männern und Frauen.
1.2 Erklärungsansätze für psychologische Geschlechtsunterschiede
An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass die (physikalischen) Hirnstrukturen und deren Funktionen nicht losgelöst von psychologischen Unterschieden und geschlechtsdifferenten Verhaltensweisen betrachtet werden dürfen. Die komplexen Strukturen des menschlichen Gehirns, die Funktionsweisen der Hormone, die je nach Geschlecht in unterschiedlichen Mengen produziert und ausgeschüttet werden, rufen zwangsweise auch verschiedene Verhalten und Denkvorlieben hervor. Während die Geschlechtsunterschiede in der Kognition im zweiten Teil noch einmal ausführlicher behandelt werden, soll es im Folgenden vorrangig um die Einflussfaktoren gehen, die das Geschlechtsbild beeinflussen. Das soziale Geschlecht, das den Erwerb von Geschlechtsidentitäten als auch von Geschlechterrollen mit einschließt, gilt als ‚psychologisches Phänomen' und bildet einen Gegensatz zum biologischen Geschlecht (vgl. Zimbardo et al. 2004). Die Diskussion über Geschlecht als psychologisches Phänomen und Folge des Sozialisationsprozesses findet ihre Erweiterung darin, dass Geschlecht vielmehr als ein soziales Konstrukt zu verstehen und somit mitunter auch unabhängig von den biologischen Voraussetzungen sei. Denn nicht immer bedeutet das biologische Geschlecht für ein Individuum auch die zugehörige Geschlechtsidentität und/oder Geschlechterrolle, z. B. bei Transsexuellen. Robert Stoller untersuchte in den 1960er Jahren dieses Phänomen am Beispiel der Geschlechtsidentitäten bei Transsexualität und Intersexualität. Dabei entwickelte [er] die Unterscheidung zwischen sex und gender auf der Basis der Unterscheidung von Natur und Kultur: Kultur wirkt auf die Natur ein, d.h., das biologische Geschlecht/sex des Menschen bildet nur eine Basis für dessen kulturelle Prägung zu einer bestimmten soziokulturellen Geschlechtsidentität/gender (Schmenk 2002: 136; Hervorh. im Orig.).
Der Begriff gender ist demnach eine Alternative zum biologischen Geschlecht3. Allerdings kann auch das soziale Geschlecht nicht völlig losgelöst von dem biologischen Geschlecht betrachtet werden, da es die Basis für die weitere psychologische Entwicklung bildet.
Hormonell und genetisch bedingte geschlechtsspezifische Verhaltensweisen sowie die Identifizierung mit den in der Gesellschaft vorherrschenden weiblichen bzw. männlichen Rollen bestimmen den (sozialen) Alltag von Männern und Frauen. Die Psychologie untersucht u.a. die Ursachen und Motive, wie soziale Geschlechtsunterschiede auf der Basis biologischer Unterschiede zu begründen sind, bzw. inwieweit sie unabhängig von den biologischen Merkmalen das Leben der Menschen beeinflussen.
1.2.1 Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen
Die Geschlechtsidentität, die als das Bewusstsein und auch die Akzeptanz des eigenen biologischen Geschlechts und des Mann- bzw. Frauseins definiert ist, bildet eine Basis für Geschlechterrollenerwerb, d.h. gewünschte geschlechtsspezifische Verhaltensmuster von Männern und Frauen in einer Gesellschaft (vgl. Zimbardo et al. 2004; Richter 1996). Der Erwerb von Geschlechterrollen ist nicht Bestandteil der körperlichen (biologischen, genetischen) Beschaffenheit eines Menschen, sondern geschieht durch die Sozialisation in einer bestimmten Gesellschaft. Hingegen kann der Erwerb der Geschlechtsidentität nicht durch Sozialisationsprozesse erklärt werden, hat aber auch nicht ausschließlich genetische Ursachen. Allerdings sind sich Wissenschaftler nicht einig, wodurch genau und wie solche Prozesse ablaufen und vor allem, ab wann Geschlechtsidentitäten erworben und gefestigt werden. Geschlechtsidentität scheint in Verbindung mit der individuellen Persönlichkeitsentwicklung zu stehen, die an anderer Stelle thematisiert werden soll.
Viele Forscher gehen davon aus, dass Sozialisation und somit auch der Erwerb von Geschlechterrollen schon mit der Geburt beginnt, da Eltern unterschiedliche Verhaltensweisen gegenüber einem neugeborenen Jungen oder Mädchen zeigen (vgl. Zimbardo et al. 2004)4. Dennoch erweist es sich als kompliziert, genau zu bestimmen, welche Einflussfaktoren - biologische und/oder soziale - für welche geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen verantwortlich sind. Diese Tatsache lässt sich nicht nur unmittelbar aus den Argumenten der verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten ableiten, sondern auch aus der Annahme, dass geschlechtsspezifisches Verhalten und/oder dessen Erwartung gegenüber den Mitmenschen unbewusst aktiviert werden kann.
Untersuchungen zur Thematik des Sozialisationsprozess bzgl. der Übernahme geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen ergaben, dass es zwar „einige Grundmuster der Arbeitsteilung [gibt], die bei den meisten Völkern gelten. Es gibt aber auch ganz erhebliche Differenzen in anderen Bereichen, die die Annahme der „Universalität"; zweifelhaft erscheinen lassen"; (Richter 1996: 142). Somit gelten bestimmte Geschlechtsstereotype nur für bestimmte Kulturkreise, die jedoch nicht auf jeden einzelnen Menschen innerhalb dieser Kultur gelten müssen, denn „die meisten Gesellschaften dürften bevorzugt diejenigen Verhaltensmuster zu Kristallisationslernen ihrer Stereotypbildung machen, die den natürlichen Dispositionen der Mehrzahl ihrer Mitglieder am bequemsten entgegenkommen"; (Bischof-Köhler 2002: 28; zit. in Klann-Delius 2005: 157; Hervorh. von mir, S.F.). Es ist unschwer erkennbar, dass vermeintliche Geschlechtsunterschiede sowohl im Denken als auch im Verhalten sowie die Erwartungshaltungen gegenüber Männern und Frauen im alltäglichen Leben eine große Bedeutung haben, wobei die dichotomische Zuordnung als selbstverständlich gilt (vgl. Schmenk 2002).
Da davon auszugehen ist, dass in jeder Gesellschaft Stereotype vorherrschen, die Emotionen, Wahrnehmungen und Einstellungen determinieren, gibt es auch Geschlechtsstereotypen, die in bestimmten Gesellschaften als entweder „typisch weiblich"; bzw. „typisch männlich"; eine allgemeine Gültigkeit haben (vgl. Halpern 2000). Im Verlauf der Entwicklung des Individuums werden diese geschlechtstypischen Merkmale aktiv als auch passiv erworben, die dann wiederum Verhaltensmuster, Einstellungen sowie Wahrnehmung von Geschlechterrollen, aber auch die Identifizierung mit dem eigenen Geschlecht (Geschlechtsidentität) prägen. Nach den lerntheoretischen Erklärungsansätzen nimmt man an, dass geschlechtstypisches Verhalten sowie die Einstellungen erlernt werden, indem Verhaltensmuster verstärkt bzw. bekräftigt oder indem bestimmte Personen mit Vorbildfunktion imitiert werden (vgl. Asendorpf 2004).
1.3 Lerntheoretische Konzepte zur Erklärung von Geschlechtsdifferenzen
Lernen gilt als Produkt der genetischen Anlagen, d.h. dass das Lernpotenzial je nach genetischen Voraussetzungen des Individuums unterschiedlich5 sein kann. Zudem ist Lernen ein Prozess, basierend auf Erfahrungen, von denen wiederum die Realisierung des Lernpotenzials abhängig ist (vgl. Zimbardo et al. 2004). Da man Lernen an sich nicht beobachten kann, beurteilt man den Lernerfolg anhand erbrachter Leistungen, die man u.a. auch in Testverfahren messen kann. Allerdings muss man hierbei zwischen Leistung und Lernen unterscheiden, denn nicht alles Gelernte wird sich in Leistung bzw. offenem, beobachtbaren und messbaren Verhalten äußern, wie beispielsweise Verständnis für etwas bzw. jemanden haben (vgl. ibid.). Wie Lernen und Erwerb von Verhaltensmustern - und somit Geschlechterrollen - stattfindet, beschreiben die lerntheoretischen Konzepte.
1.3.1 Behavioristische Lerntheorien und Verhaltensanalyse
John Watson (1878-1958) gilt als Begründer des Behaviorismus, der sich ausschließlich auf beobachtbares Verhalten konzentrierte und „behauptete, dass die Introspektion - Selbstberichte über Empfindungen, bildhafte Eindrücke und Gefühle - kein akzeptables Mittel zur Untersuchung von Verhalten sei"; (Zimbardo et al. 2004: 244). Burrhus F. Skinner (1904-1990) erweiterte Watsons Theorie, in dem er nicht nur die geistigen Prozesse aufgrund ihrer Subjektivität aus der Wissenschaft zurückwies, sondern behauptete, dass sie seien auch nicht die Ursachen von Verhalten (vgl. ibid.; Hasselhorn et al. 2006). Seine vier operante Lernprinzipien sollen genügen, um Lernprozesse als Assoziation zwischen Verhalten und Belohnung zu verstehen - ohne innere Vorgänge wie zum Beispiel Denken. Diese Auffassung des Behaviorismus dient als Grundlage der Verhaltensanalyse6, deren Forscher sich mit Umweltdeterminanten, welche Verhalten und Lernen bestimmen, befassen (vgl. ibid.; Asendorpf 2004). Die Arten des Lernens unterteilt man in klassisches und operantes Konditionieren, diese sollen aber im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert diskutiert, sondern lediglich kurz dargestellt werden.
Lernen als Verhaltensänderung im Sinne des klassischen Konditionierens ist begründet durch Ivan Pavlov (1849-1936) und ist folglich auch als Pavlov'sche Konditionierung bekannt. „Der Organismus lernt eine neue Assoziation zwischen zwei Stimuli [Reizen] -einem Stimulus, der zuvor die Reaktion nicht hervorrief, und einen Stimulus, der die Reaktion natürlicherweise hervorrief"; (Zimbardo et al. 2004: 246). Der Kern dieses lerntheoretischen Ansatzes ist der Reflex, so wie Speichelfluss, Kniesehnenreflex oder auch Schluckreflex. Solche Reflexe sind ungelernte Reaktionen, welche aber für den Organismus notwendig bzw. relevant sind und deshalb durch natürliche Stimuli hervorgerufen werden (vgl. ibid.). Interessant, auch im Rahmen des Rollenerwerbs innerhalb einer Gesellschaft, ist der Aspekt, dass „klassisch konditionierte Reaktionen nicht durch bewusstes Denken aufgebaut werden [und deshalb] sind sie auch schwer durch bewusstes Denken zu eliminieren"; (ibid.: 257). Verhaltensmuster können somit auch ohne den bestimmten Stimulus, der dieses Verhalten ausgelöst hatte, über mehrere Jahre bestehen bleiben - ohne, dass man weiß, warum man in einer spezifischen Situation eine ganz bestimmte Reaktion zeigt.
Lernen als Verhaltensänderung im Sinne der operanten Konditionierung geht zurück auf ein Experiment mit Katzen von Edward L. Thorndike (1874-1949), der die Grundlage des Lernens durch die Assoziation zwischen Reizen (Sinneseindrücken) und Reaktionsimpulsen (Handlungen) erklärte. Wichtig dabei ist, dass durch „Stärkung oder Schwächung von Assoziationen als Folge von Handlungskonsequenzen…, die [eine Person] als befriedigend oder lustvoll (Belohnung) empfindet";, eine Stärkung (oder Minderung) einer gebildeten Assoziation bewirkt wird7 (Hasselhorn et al. 2006: 38). Das bedeutet, dass eine Reiz- Reaktion-Verbindung entsteht. Die Grundlage des Handelns sind die Erfahrungen ihrer Konsequenzen, nicht spezielle Reize (Stimuli) wie beim klassischen Konditionieren. Im Fall des Geschlechterrollenerwerbs bedeutete dies, dass geschlechtstypisches Verhalten dann wiederholt wird, wenn die Umwelt positiv darauf reagiert. Dabei spielen Verstärkung und Bestrafung8 eine Rolle, wobei letztere die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Reaktion (Verhalten) senken soll (vgl. Zimbardo et al. 2004). Diese unterschiedlichen Reizbedingungen, Verstärkung und Bestrafung, sollen wie folgt zum gewünschten bzw. unerwünschten Verhalten führen: „Durch Kontrolle der für den Lernenden attraktiven Reize, etwa nach den Prinzipien variabler Verstärkungspläne, [ließe] sich Verhalten gezielt formen"; (Hasselhorn et al. 2006: 65).
Doch reduziert der Behaviorismus „das Feld der Psychologie"; ausschließlich auf messbare, beobachtbare Vorgänge beim Lernen, bzw. Verhalten, welches in Verbindung mit Umweltreizen steht (Zimbardo et al. 2004: 841). Wie bereits erwähnt wurde, tragen nach behavioristischer Auffassung, Vorgänge, die mental ablaufen und nicht beobachtbar sind, wie beispielsweise Denken, sich Erinnern usw., nichts der Wissenschaft bei. Darum können die behavioristischen Theorien nur Teilprozesse erklären. Zwar wurden diese Theorien vielfach modifiziert, relativiert und sind durch andere Lerntheorien nicht zu ersetzen; dennoch reichen die behavioristischen Erklärungsansätze allein bei weitem nicht aus, den Erwerb von Geschlechterrollen zu begründen (vgl. Mitschian 2000):
Wie alle anderen psychologischen Lerntheorien stellt auch der behavioristische Theorienkomplex nur ein Modell dar, das einen Teil der beim Lernen stattfindenden Vorgänge zutreffend beschreibt, für andere jedoch nicht relevant ist, sich dort dann sogar als störend oder absolut verhindernd erweisen kann (Mitschian 2000: 2).
Denn das Individuum entwickelt sich in einer bestimmten Umwelt und deren Einflussfaktoren, wobei die individuelle Persönlichkeit „als Summe der offenen und verdeckten Reaktionen verstanden [wird], die zuverlässig aufgrund der Verstärkungsgeschichte einer Person ausgelöst werden"; (Zimbardo et al. 2004: 625). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Mensch laut der behavioristischen Ansätze eine weitestgehend passive Rolle einnimmt. Er scheint nicht in der Lage zu sein, auf seine Umwelt einwirken zu können. Geschlechtsdifferenziertes Verhalten wird dem Individuum „ansozialisiert";, in dem es für gewünschte Verhaltensmuster gelobt und belohnt wird, bzw. für unerwünschtes, unangemessenes Verhalten bestraft wird. Doch nicht nur eigene Erfahrungen prägen Verhaltensmuster, sondern auch das Beobachten anderer Mitmenschen resultiert mitunter in bestimmtem Verhalten.
1.3.2 Beobachtungslernen, Lernen am Modell und die sozial-kognitive Lerntheorie
Das Modelllernen (Lernen durch Beobachten) von Albert Bandura (geb. 04.12.1925), Anfang der 1960er Jahre, orientierte sich zwar an dem behavioristischen Konzept, doch kritisierte es Skinners radikal-behavioristische Auffassung des Lernens in „Ein-Personen-Situationen"; (Bandura et al. 1963: o. S.; zit. in Hasselhorn et al. 2006: 48). Demzufolge verhalten sich Menschen nach einem gewünschten Verhaltensmuster, wenn sie beobachten, dass Mitmenschen, die sich ebenso verhalten, eine positive Verstärkung (Belohnung) erfahren. Das Imitieren des Verhaltens von Modellpersonen schwächt die These, dass Verhalten „ausschließlich über Verstärkungskontingenzen erfolgt";, ab (Hasselhorn et al. 2006: 48f.). In diesem Fall spricht man dann von stellvertretender Verstärkung, bzw. stellvertretende Bestrafung, die mitunter einen stärkeren Effekt auf das eigene Verhalten erzielen können als die direkte Verstärkung, bzw. Bestrafung (vgl. ibid.).
Besonders soll an dieser Stelle der Sozialisationsprozess in den Vordergrund gestellt werden. Mitmenschen, bzw. das soziale Umfeld (Familie, Gleichaltrige, Schule, Medien usw.) besitzen Wissen, Einstellungen und Erfahrungen, mit denen das Kind unmittelbar konfrontiert wird. „Sehr früh wird jedes Individuum aufgrund seines biologischen Geschlechts in die Gesellschaft eingeordnet"; (Beerman et al. 1992: 54). Menschen besitzen sie Fähigkeit, über das Beobachten anderer, Konsequenzen für spezifisches Verhalten vorauszusehen und speichern diese Erkenntnisse; somit können sie auch ggf. aus Fehlern der anderen lernen ohne die Erfahrung selbst zu machen. „Sie können… Einstellungen und Überzeugungen erwerben, wenn sie einfach nur zu sehen, was andere tun und welche Konsequenzen sich daraus ergeben"; (Zimbardo et al. 2004: 629).
[...]
1 Dabei werden historische Aspekte der westlichen Industrieländer betrachtet, da hier die meisten Studien durchgeführt wurden und mehr kulturelle Aspekte zu weit führen würden.
2 Somit entwickeln sich aus dem Chromosomengeschlecht die geschlechtsspezifischen Keimdrüsenanlagen, die für die differentiellen Sexualhormone verantwortlich sind (vgl. Richter 1996: 117).
3 Schmenk (2002) verweist bzgl. der Entstehung des gender-Begriffs auf die Arbeit von Simone de Beauvoir, die biologistische Ansätze zur Erklärung und Begründung des Status der Frauen „aufgrund mangelnder Beweiskraft"; ablehnt (ibid. 186). Zwar benutzt sie den Terminus gender nicht, doch „[d]er von ihr formulierte Gegensatz des biologischen Geschlechts und soziokulturell bedingter geschlechtsspezifischer Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums gilt bis heute als Ausgangspunkt für die Erläuterung der Bedeutung gender-Begriffs"; (ibid. 186; Hervorh. im Orig.).
4 Andere wiederum vertreten die Auffassung, dass Eltern auf die sich entwickelnde Geschlechtsidentität bereits vor der Geburt eines jeden Kindes einwirken, weil „[sie]… über ein ausgeprägtes Geschlechtstereotyp [verfügen], ein kulturell geprägtes Meinungssystem über Eigenarten der beiden Geschlechter, das von früh an ihre Erwartungen prägt und dadurch ihre Wahrnehmung beeinflusst"; (Asendorpf 2004: 376).
5 Das betrifft Tiere ebenso. Amphibien, z.B., haben ein anderes Leistungspotential als Säugetiere.
6 Nach wie vor geht es hierbei nicht um die Beziehung zwischen Verhalten und mentalen Prozessen.
7 Law of Effect
8 Man unterscheidet hierbei positive und negative Verstärkung sowie positive und negative Bestrafung.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Fuchs (Autor:in), 2008, Bedingungen des SchülerInnenengagements im Fremdsprachenunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156149
Kostenlos Autor werden













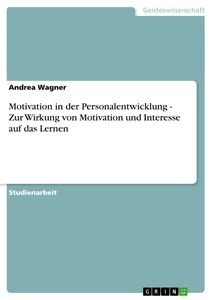
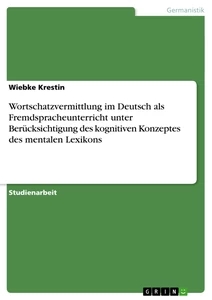







Kommentare