Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 DIE SOZIALE KOMPETENZ KOOPERATIONSFAHIGKEIT
2.1 Kompetenz: ein mehrdeutiger Begriff
2.2 Was bedeutet Soziale Kompetenz?
2.3 Kooperation erfordert Kooperativitat?
3 WIE ERLERNEN WIR KOOPERATIVES DENKEN, VERHALTEN UND HANDELN?
3.1 Neurobiologische Betrachtung
3.1.1 Ausstattung, Entwicklung und Funktionen des Gehirns
3.1.2 Neuronale Plastizitat und Spiegelphanomen
3.1.3 Neurotransmitter-, Belohnungs- und Bewertungssystem
3.1.4 Was beeinflusst das Lernen?
3.2 Padagogische Betrachtung
3.2.1 Erlebnispadagogik
3.2.1.1 Ganzheitlichkeit und Menschenbild
3.2.1.2 Handlungs- und Prozessorientierung
3.2.1.3 Erlebnis- und Erfahrungsorientierung
3.2.2 Was beeinflusst das Lernen?
3.3 Psychologische Betrachtung
3.3.1 Theorie des sozialen Lernens
3.3.2 Kognitive und moralische Entwicklungstheorie
3.3.3 Die personenzentrierte Personlichkeitstheorie
3.3.4 Was beeinflusst das Lernen?
3.4 Soziale Kompetenz erlernen
4 WIE KANN KOOPERATIVITAT ENTWICKELT WERDEN?
4.1 Neurodidaktische Folgerungen und das Zuricher Ressourcen Modell
4.2 Erlebnispadagogische Folgerungen und Trainings
4.3 Sozialpsychologische Folgerungen und Modelle
5 1ST KOOPERATION EINE EVOLUTIONARE STRATEGIE?
6 SCHLUSSWORT
7 QUELLENVERZEICHNIS
1 Einleitung
Die altlateinischen Spruchweisheiten „quid pro quo“ und „manus man- um lavat“[1] drucken eine Erfahrung aus, die ein verlassliches Zusam- menwirken von Menschen beschreibt. Jedoch ist diese noch selbstver- standlich? Ist dieser „Ehrenkodex“[2] noch gultig? Das Prinzip von Neh- men und Geben ist offensichtlich nicht mehr modern. Langst scheinen Gewinnmaximierung und Vorteilssuche, auch durch eine neoliberale Wirtschaftswelt, vorherrschendes Prinzip zu sein; das gegenseitige Tra- gen in einem Sozialstaat wird herausgefordert.[3] Spielt in unserem Zu- sammenleben Reziprozitat oder Altruismus noch eine Rolle? Oder hat sich die darwinistische von den Sozialbiologen favorisierte Annahme eines „egoistischen Gens“ durchgesetzt? Stecken wir in einem Dilemma, indem wir uns nach gegenseitig unterstutzenden Strukturen sehn- en, jedoch nicht bereit sind fur das Allgemeinwohl auf personliche Vor- teile zu verzichten?
In der Literatur, in den Medien, in der Politik und im personlichen Um- feld sind Entwicklungen und Ansatze in die entgegengesetzte Richtung erkennbar. Angesichts der Konflikte, der Klimaveranderungen, der Glo- balisierungsfolgen und der Wirtschaftskrise erleben Verantwortungsbe- wusstsein, burgerschaftliches Engagement und soziale Teilhabegedan- ken eine Renaissance. Diese Bewegungen sehen die Zukunft nicht im Gegeneinander und in der Konkurrenz, sondern im zusammenwirken- den Miteinander, im Aufbau langfristiger und verlasslicher Beziehungen, sei es personlich, okonomisch oder politisch. Eine Herausforderung! Diese Bewaltigungsstrategie, diese Art der Problemmeisterung erfordert Fahigkeiten kommunikativer, emotionaler, sozialer Art. Ist dabei Koop- eration, kooperatives Verhalten und Handeln eine dienliche GroGe? Ist diese Fahigkeit, Strategie angeboren? Erlernen wir sie? Kann sie durch Trainings gefordert werden? Oder liegt die Losung in der „Sozialpille“[4], wo wir eine Dosis Stimmungsaufheller oder Oxytocin einnehmen, um freundlicher, kooperativer, friedlicher zu werden?
Neben diesen Fragestellungen war zugleich eine konkrete Praxiserfahr- ung in der Sozialen Arbeit als Integrationshilfe gemaG §35a des SGB VIII innerhalb des Diakoniewerks Essen leitend. Eine Mutter suchte fur ihr Kind, mit der Diagnose ADHS und Schulschwierigkeiten, uber das Jugendamt Unterstutzung in einer Tagesgruppe. In Aktionen und im Spiel zeigte das Kind ein dominantes, extrem Aufmerksamkeit fordern- des Verhalten. Gesprache zur Verarbeitung emotionaler Erfahrungen und Beziehungsangebote scheiterten an seinem Misstrauen. Das Kind nahm gerne, aber war nicht bereit etwas von sich zu geben. Wie sind diese Verhaltensmuster entstanden? Konnen neue Erfahrungen dies verandern und Vertrauen wachsen lassen?
Kooperationsfahigkeit als eine Soziale Kompetenz ist auf unterschied- lichen Ebenen gefragt, sei es als Alltagskompetenz, als Bildungsziel oder als berufliche Fahigkeit. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, was sich hinter dem Begriff Kompetenz verbirgt, um im Folgenden So- zialkompetenz zu erlautern. In diesem Rahmen findet eine Darstellung von Kooperation, Kooperativitat statt. Im Weiteren wird betrachtet wie sich kooperatives Denken, Handeln und Verhalten aus neurobiologisch- er, padagogischer und psychologischer Sicht entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen:
- Wie lernen wir?
- Was beeinflusst das Lernen? Sind es Erfahrungen, Einsichten, oder Vorbilder, Werte?
- Spielen Beziehungen im Lernprozess eine Rolle oder eher Be- lohnungssysteme?
- Welche anthropologischen, ontogenetischen Annahmen bilden den Hintergrund?
Die Arbeit stellt den Wert integrierender Modell fur die Fragestellung heraus und verweist zum Schluss auf die Tiefendimension von Kooperation.
2 Die Soziale Kompetenz Kooperationsfahigkeit
Unter den wechselnden und leicht konturlosen Ausfuhrungen in der Literatur uber Soziale Kompetenz taucht neben Teamfahigkeit, Kon- fliktfahigkeit und Kommunikationsfahigkeit die Kompetenz Kooperationsfahigkeit auf. Es wird im Folgendem Kapitel geklart, was unter Kompetenz verstanden wird, da dieser Begriff im Zuge von PISA[5] eine steile Entwicklung hinter sich hat, als fachliche und soziale Kompetenz eine gefragte Schlusselqualifikation ist und sowohl in der Definitions- frage als auch in der Entstehungsweise viele nuancierte Antworten zu finden sind. Innerhalb der bildungstheoretischen, der bildungsokono- mischen und der sozialwissenschaftlichen Diskussion spielt die Entwicklung von Sozialer Kompetenz eine neue Rolle. In diesem Rahmen wird Kooperation, Kooperationsfahigkeit erlautert.
2.1 Kompetenz: ein mehrdeutiger Begriff
In der etymologischen Forschung des Wortes Kompetenz stellt Anne Muller-Ruckwitt in ihren bildungstheoretischen Untersuchungen dar, dass der Begriff aus dem lateinischen kommt und zunachst „zusam- menfallen“ oder „etwas (gemeinsames) erstreben“ bedeutet. Es zeigt sich im Angesicht der geschichtlichen Entwicklung, daft der Begriff ein Rechtsbegriff im klerikalen Raum, spater im sakularen Raum war. An- schaulich listet sie die heutigen zahlreichen Begriffsbilder auf, die von „Oberlebenskompetenz“ uber „Rasenkompetenz“ bis hin zum „Kompe- tenz-Kandidaten“ reichen. In der Beobachtung der alltagssprachlichen Verwendung zeigt sie daher, dass Kompetenz auf den Einzelnen be- zogen eine Eigenschaft wie Fachfertigkeit und auf Institute bezogen einen Zustand wie Zustandigkeit entspricht. Sie unterscheidet zwischen den feinen Aussageabsichten von: „kompetent sein, kompetent han- deln“ welche die „Selbstbestimmung“ aufzeigen und „ uber Kompetenz verfugen, Handeln aus Kompetenz“, die auf die „Weltbewaltigung“ ver- weist (vgl. Muller-Ruckwitt, 2008, S. 103-112).
Die Brockhaus-Enzyklopadie ordnet dem Begriff drei Momente zu, die auch der Padagoge Heinrich Roth benennt. Diese im Folgenden be- nannte Trias zielt in seinem Handlungskompetenzmodell auf die Er- ziehung zur Mundigkeit.
„Kompetenz (lat. „das Zusammentreffen“) die, -/-en, 1) allg.: i. w. S. Sachverstand, Fahigkeit, Zustandigkeit; i. e. S. die Fahigkeit eines Menschen, bestimmten Anforder- ungen gewachsen zu sein. K. kann sich auf unterschied- liche Bereiche und Aufgabenstellungen beziehen, so etwa auf den zwischenmenschlichen Bereich (Sozialkompe- tenz), die eigene Person (Selbstkompetenz) oder bestim- mte Wissens- und Arbeitsgebiete (Fachkompetenz).“ (Brockhaus, Enzyklopadie, 2006, Bd.15)
Erkennbar ist hier, daft Kompetenz dem Individuum zugeordnet und nicht wie in anderen Feldern auf eine kollektive Fahigkeit oder institutio- nelle Zustandigkeit verwiesen wird. Offen bleibt, ob intrinsische oder extrinsische Motive enthalten sind oder ob ein Wille, ein Bewusstsein, ein reflexives Urteilen das Streben nach Kompetenz vorantreibt oder diese Fahigkeiten eine Disposition des Menschen sind.
Der Kompetenzbegriff ist in der bildungspolitischen Debatte seit der PISA -Studie zum Schlusselbegriff geworden. Hier ist die Rede von Ba- siskompetenzen wie Lesekompetenz und mathematische -und natur- wissenschaftliche Grundbildung, die von komplexen Handlungskompe- tenzen (selbstreguliertes Lernen und Soziale Kompetenz) begleitet wer- den.[6] In der beruflichen Qualifikation ist neben der Sachkompetenz die Soziale Kompetenz gefragt. Es hat sich in der Fachdiskussion die Er- kenntnis durchgesetzt, daft sie eine Basis bildet, um eine effektiv-fach- liche Zusammenarbeit und eine qualitative Problembearbeitung zu er- moglichen.
Anne Muller-Ruckwitt stellt die Problematik einer eindeutigen Definition und das Ausbleiben einer Theorie und Systematik fest. Sie folgt der auf- geworfenen Frage, ob mittels dieses Begriffes die Zwangslage der Pa- dagogik zwischen Bildung und Qualifikation aufzulosen sei und mit dem Kompetenzbegriff eine neue Bildungsqualitat Einzug erhalt. In ihrer Be- trachtung des Begriffs aufterhalb des erziehungswissenschaftlichen Kontext erkennt sie folgende Momente von Kompetenz:
- „Deskriptionskategorie und analytische Grofte
- Synonym fur (angeborene) Fahigkeit und formal-funk- tionale Kategorie
- anthropologische Grundannahme und inharentes Potential, dass prozessual in Wechselwirkung mit der (belebten wie unbelebten) Umwelt ausgebildet wird“ (Muller-Ruckwitt, 2008, S. 240-245)
In der Betrachtung des Begriffes Kompetenz im padagogischen- erzieh ungswissenschaftlichen Kontext zeichnet sich ab, daft er abhangig vom Verstandnis des Bildungsbegriffes ist, der sich wiederum aus dem Ver standnis der Entwicklung des Individuums erschlieftt. Stichworte wie Mundigkeit, Identitat, Personlichkeitsentwicklung, Autonomie, Solidar- itat, Bewaltigung von Lebensaufgaben, Erziehungsziel und Qualifikation zeigen den Zusammenhang auf. Sowie Anne Muller-Ruckwitt weist auch Eckhard Klieme in seinem Artikel auf die oft verwendete Kom petenzdefinition von Franz E. Weinert hin. Kompetenzen sind „die bei Individuen verfugbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fahigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu losen, sowie, die damit verbundenen motiva- tionalen, volitionalen und sozialen Fahigkeiten, um die Problemlosungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu konnen.“ (Weinert, 2001, S.27f)
Eckhard Klieme stellt fest, daft sich Franz E. Weinert auf die kognitive Dimension beschrankt. Und auch hier wird Kompetenz allein im Indivi- duum verortet; die Entwicklung von Kompetenz durch Interaktion und gruppendynamischer Prozesse bleibt aufter Acht. Jedoch verweist dieses Zitat mehr als die lexikalische Ausfuhrung auf die Performanz, die Zielrichtung von Kompetenz hin. Klieme spricht sich daher gegen ein allgemeines Konstrukt aus, sondern pladiert fur einen bereichsbezog- enen Anwendungsbegriff, indem prozessual spezifische Fachfahigkei- ten aufgebaut werden. Somit sind fur ihn Kompetenzteile messbar und durch gezielte Forderung erhohbar.
Anne Muller-Ruckwitt stellt in ihrer Betrachtung heraus, daft Bildung eine Bedingung des Menschseins ist, das Verhalten zu sich und zu an- deren beinhaltet und einer ethischen Verantwortung folgt. Somit ist Kompetenz im Menschen verankert und hat kognitive, soziale und mo- ralische Anteile und geht von einem personalen Menschenbild aus. Sie sieht im Konzept Dieter-Jurgen Lowisch, der zwischen Kompetenz er- sten Grades (Fachhandeln) und zweiten Grades (personales Vernunft- handeln) unterscheidet, ein theoriestiftendes Konzept. Deshalb bemerkt sie:
„Kompetenz inkludiert methodisch reflektiertes Wissen ebenso wie sachliches und moralisches Urteilsvermogen und ist als komplexe Bewaltigungsfahigkeit daruber hinaus auf Entscheidungssituationen bezogen, die ein Handeln erfordern.“ (Muller-Ruckwitt, 2008, S.257)
Auch Roland Reichenbach, der dem Kompetenzdenken ein destrukti- ves Potential unterstellt, stellt die Motive der Kompetenzbildungsdiskus- sion in Frage und stellt ein Kompetenzideal vor, welches an anthropolo- gische Annahmen gekoppelt ist. Er geht dem moralischen Ideal nach und stellt eine Verbindung zwischen Kompetenz und Tugend her, da beide ein lebenspraktisches Konnen umschreiben.
Festzuhalten ist: Kompetenzen sind individuell erlernte Fahigkeiten, die sich im sozialem Prozess entwickeln. Sie stellen sich z.B. als Wissen und Konnen, als kognitive Problemlosefahigkeit, als komplexe Bewalti- gungsfertigkeit oder als Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz dar. Sie sind situationsabhangig und beinhalten eine Umsetzungsfahigkeit. Dieses Handeln orientiert sich an Werten und an reflektierten Erfahrungen. Die Fragen nach Wirksamkeit, Lernbarkeit, Transferierbarkeit, Bildbar- keit, Messbarkeit, Entwicklung, Forderung und Zielrichtung begleiten und fordern die Begriffsauslegung.
2.2 Was bedeutet Soziale Kompetenz?
Ebenso komplex wie der Begriff Kompetenz erscheint der davon ausge- hende Teilbegriff Soziale Kompetenz zu sein. Die Brockhaus-Enzyklo- padie fuhrt ihn so aus:
„Soziale Kompetenz, Sozialpsychologie: allg. die Fahigkeit des Menschen, sich in sozialen Situationen an gemessen zu verhalten. Haufig wird S. als ein ausgewog- enes Verhaltnis von individueller Selbstverwirklichung und sozialer Anpassung beschrieben. (,..)S. wird ab fruhester Kindheit durch das Zusammenleben mit anderen Men- schen(...) erlernt. Einflusse auf die Entwicklung von S. haben neben Umweltfaktoren auch individuelle Person- lichkeitsmerkmale wie Intelligenz, Charakter und Temperament. (...).“ (Brockhaus-Enzyklopadie, 2006, Bd. 25 )
Damit sind mit Sozialer Kompetenz die Identitatsbildung, die Rollenfin- dung und Personlichkeitsentwicklung verbunden. Wie sich genau die Genese, die Bedeutung und die Performanz von Sozialkompetenz er- schliefet und sich in den unterschiedlichen Disziplinen darstellt ist ein breites Feld. Auf Grund dessen werden Gedanken uber den Begriff und einige Perspektiven zu diesem Begriff aufgezeigt, um spezifische Mom- ente festzuhalten.
Der Padagoge Reichenbach kritisiert:
„soft skills, sind immer dann einsatz- und paarungsbereit, wenn es irgendwie um das Personliche, das Interpersonal und/oder Soziale geht (und das ist haufig der Fall).“ (Reichenbach, 2008, S. 36)
Zu Recht! In der Beschreibung aus verschiedenen fachlichen Perspektiven von Sozialer Kompetenz erscheinen breit gefacherte Kataloge[7], die von Autonomie bis Wertschatzung reichen. Der Begriff ist zu einem Sammelbecken von verschiedensten Fahigkeiten geworden und scheint sich in seiner metaphorischen Bedeutung aufzulosen. Die Herausgeber Carsten Rohlfs, Marius Harring und Christian Palentien sahen sich ver- anlasst auf Grund des Facettenreichtums in ihrer Sammlung zur Kom- petenz-Bildung zwischen den sozialen, emotionalen und kommunika- tiven Kompetenzen, die in abhangiger Verwandtschaft zueinander ste- hen, zu unterscheiden, um dem zu zerfliefeenden Kompetenzbegriff und dem Begriff der Sozialen Kompetenz Konturen zu geben.
Die Psychologie unterscheidet in ihren Arbeitsbereichen diverse Be- deutungen von Sozialer Kompetenz. Hinsch und Pfingsten stellen in ihrer gruppentherapeutischen Konzeption fest:
„Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfugbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motor- ischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situ- ationen zu einem langfristig gunstigen Verhaltnis von posi- tiven und negativen Konsequenzen fur den Handelnden fuhren.“ (Hinsch, 2007, S. 5)
Sie sehen Soziale Kompetenz nicht als Personlichkeitseigenschaft an, da diese situationsabhangig und veranderbar ist. Sie erweitern die kog- nitive Fahigkeit um die emotionale und motorische. Sie benennen drei Momente: Fahigkeit, soziale Situation und Konsequenz. Fur sie ist die Gruppe der Lernort um soziale Kompetenzen fur eine gelingende Be- ziehungsarbeit zwischen Selbstwahrnehmung und sozialer Akzeptanz zu entwickeln.
Ahnlich sieht es Barbara Langmaack, die, vom TZI-Modell nach Ruth Cohn ausgehend, auf die Situationsabhangigkeit hinweist und die Auf- zahlungen von Sozialkompetenzen in einem allgemeinen Moment zu- sammen fasst, namlich zielgerichtet auf Kommunikation und Koopera- tion. Aus dieser Handlungsfahigkeit erschliefet sich ihr das Ziel von Sozialer Kompetenz:
„Soziale Kompetenz ist ein Bundel von Fahigkeiten, um in sozialen Situationen auf der zwischenmenschlichen Ebe- ne zu kommunizieren und zu kooperieren. Mit fachlichem und methodischem Konnen zusammen bildet soziale Kompetenz den Dreiklang, aus dem Handlungsfahigkeit entsteht. Alle drei zusammen werden eingesetzt, um eine erwunschte oder geforderte Wirkung unter Einbeziehung personlicher und kollektiver Werte zu erzielen.“ (Langmaack, 2004, S.23)
Die Entwicklungspsychologie versteht unter Sozialer Kompetenz die Bewaltigungsfahigkeit der Entwicklungsaufgaben und der sozialen Herausforderungen. Im integrativen Modell hat Kanning drei Winkel zusammengefuhrt. Er spricht vom perzeptiven-kognitiven, vom mo- tivationalen-emotionalen und vom behavioralen Bereich, die bei der Entwicklung berucksichtig werden sollten. Der Sozialpsychologe Wolfgang Roth sieht die Einbettung von Sozialer Kompetenz in Situationen. Im Vordergrund steht zwar die Personlichkeit, jedoch sieht er ein Zusammenspiel von emotionaler und kommunikativer Fahigkeiten im individuellen und kollektiven Prozess. Dies hat Miller in seiner soziolog- ischen Lerntheorie im Blick auf die Bedingungen der Prozesse zusam- mengefuhrt. Sein Ansatz lautet: „Lernen im Kollektiv und Lernen eines Kollektives“ (Miller, 1996, S.32). Das Interaktion- und Partizipationsver- mogen des Einzelnen in der Gruppe und der Gruppe an sich sind Grundfaktoren.
Die Erlangung Sozialer Kompetenz ist in der Padagogik ein wesent liches Erziehungsziel, welches dem Bereich soziales Lernen (heimlicher Lehrplan) untergeordnet ist. Dieses Lernen beginnt in der Familie, formt sich in sozialen Beziehungen und setzt sich fort, wird durch Erziehungs und Bildungseinrichtungen erganzt. Kunert und Stanat benennen im Rahmen der PISA Untersuchung von facherubergreifenden Kompeten zen folgende Richtung von Sozialkompetenz:
„Schuler und Schulerinnen sollten lernen, gesellschaftliche Verantwortung zu ubernehmen, politische Handlungsfor- men einzuuben sowie Konflikte in der Gesellschaft kon- struktiv auszutragen.“ (Deutsches Pisa-Konsortium, 2003, S.165)
Somit wird Soziale Kompetenz als Handlungsfahigkeit beschrieben, die einem mundigen, politischen und sozial verantwortungsvollem Individu- um zu Eigen sein soll. Die Vermittlung ist gepragt von kooperativen, demokratischen und mitbestimmenden Partizipationsformen.
Durch diese Perspektiven ist sichtbar, dass Soziale Kompetenz ein mehrdimensionaler Begriff ist, der von Personlichkeitsanlagen und Um- welt beeinflusst, von individuellen Handlungsfahigkeiten ausgeht, die sich im Sozialisationsprozess entwickeln. Grundlagen bilden emotio- nale, kommunikative, interaktive Fahigkeiten, die zugleich die Vollzugs- weise in verschiedenen sozialen Situationen sind. Sie bilden und voll- ziehen sich im Wechselspiel von Selbstverwirklichung und sozialer An- erkennung. Hinter Sozialer Kompetenz stehen individuelle und kollek- tive Vorstellungen und Werte, die die Wirkung, das Ziel bestimmen.
2.3 Kooperation erfordert Kooperativitat?
Auf der dritten, untergeordneten Ebene findet sich Kooperativitat, d.h. die Fahigkeit, die Bereitschaft zu kooperieren. Auch dieser Begriff weist Mehrdeutigkeit und Bedeutungsvielfalt auf und basiert auf dem Vorgang Kooperation. Dieser wird im Alltag als die funktionale Zusammenarbeit von Individuen oder die fachliche Vernetzung von Institutionen, Syste- men und Bereichen verstanden. In der Literatur sind verschiedene Aus- richtungen in diesem Sinne zu finden: Kooperation von Jugendhilfe und Schule“; Kooperation in sozialen Organisationen“, Konfrontation und Kooperation“[8]. Dies setzt eine Kompatibilitat der Bereiche, eine ge- meinsame Zielorientierung und ein kooperatives Handlungsvermogen der Akteure voraus. Kooperation ist dabei abhangig von Situationen, Werten und Zielen, von Personen und Willen und beschreibt zumeist einen zeitlich begrenzten Zusammenschluss autonomer Teile (Institution, Individuum), indem es zu einer Systemneubildung mit synerge- tischen oder optimierenden Effekten kommt.
„Kooperation (kirchenlat. „Mitwirkung) die, -/en
1) allg.: Zusammenarbeit, bes. auf polt. oder wirtschaftl. Gebiet
2) Wirtschaft: als betriebl. K. die Zusammenarbeit zw. den Aufgabentragern in einer Organisation (v.a. in einem Unternehmen) zum Zweck der gemeinsamen Erfullung der Organisationsaufgaben.“(Brockhaus-Enzyklopadie, 2006, Bd.15)
Kooperation ist an entsprechende Erwartungen (quid pro quo), Rechte und Pflichten geknupft, die Absprachen und Vereinbarungen erfordern. Sie kann auch spontan und ohne Vereinbarungen entstehen[9] und sich in verschiedenen Formen, Graden und Qualitaten vollziehen. Stabile Kooperation benotigt gewachsenes Vertrauen. Regeln einer gelungen- den Zusammenarbeit beschreibt eine Kompetenztrainingssammlung:
- Ideen anderer werden proaktiv aufgegriffen es setzt sich keiner auf Kosten anderer einseitig durch
- Gesprachspartner sehen sich als gleichberechtigt an
- Verzicht auf Konkurrenzdenken und Machtinteressen wahrend der Kooperation." (Heyse; Erpenbeck, 2004, S.303)
Kooperativitat setzt sozial akzeptiertes Verhalten voraus, bzw. ist davon beeinflusst, sowie gepragt vom individuellen und kollektiven Bewusst- sein. Vom Individuum aus gesehen sind ein Grundverstandnis von Zu- sammenarbeit und die Bereitschaft, sich auf diesen Prozess einzulas- sen, erforderlich. Aus der Sicht der Gruppe ist das Wissen um Prozesse (Problemlosung/ Entscheidung), Bedingungen und Strukturen der Grup- penarbeit, die Fahigkeit der Eignung und Leistung und Vereinbarungen, sowie Ziele erforderlich. Kooperativitat ist eine unter vielen sozialen Fahigkeiten, die in Wechselwirkung zueinander stehen und sich somit bedingen, beeinflussen oder auch blockieren.
Egon Bloh, der das handlungsorientierte Lernen mit Neuen Medien vor- antreibt , fasst in seiner Untersuchung: „Entwicklungspadagogik der Ko- operation“ folgende Bedeutungen zusammen:
-„ Kooperation als sozial-okonomische Organisationsform
- Kooperation als soziale Norm,
- Kooperation als soziale Einstellung
- Kooperation als soziale Interdependenzstruktur
- Kooperation als soziale Verhaltens-, Handlungs-, oder Interaktionsform
- Kooperation als Fahigkeit oder („Schlussel“-)Qualifikation (Bloh, 2000, S.9f)
Er weist auf die Problematik hin, dass Kooperation im Zusammenhang mit Wettbewerb, Konkurrenz und Konflikt diskutiert wird und fragt an, ob sie uberhaupt auf derselben Ebene verhandelt werden konnen. Dazu benennt er Mythen, die entgegen Kooperation stehen und Wettbewerb und Konkurrenz als Bildungsmodi favorisieren. Kooperation sieht er als ein padagogisches Basiskonzept, verbunden mit theoretischer, prak- tischer, reflexiver und diskursiver Rationalitat, die entwicklungstheore- tisch als Kompetenz auch eine Interaktions- und Personlichkeitsdim- ension hat.
Kooperation, kooperatives Handeln und Verhalten ist ein Planungs- und Handlungsmuster, das kognitive, kommunikative und emotionale Fahigkeiten erfordert. Sie findet in der Interaktion statt und setzt Erfahrungen und Uberzeugungen, also Wille und Sinn voraus. Wie kommt es dazu?
3 Wie erlernen wir kooperatives Denken, Verhalten und Handeln?
Dieser Teil widmet sich den Theorien und Erkenntnissen dreier Fach- diziplinen. Dabei werden insbesondere die erforderlichen Axiome und die Bedingungen die das Lernen beeinflussen, fordern und/oder behin- dern, von Interesse sein. 1st das Lernen in und durch soziale Bezuge konstitutiv? Wie bildet sich Soziale Kompetenz? Wovon ist das Erlernen der Kooperativitat abhangig?
Behauptungen zur Folge liegt noch keine Entstehungstheorie sozial kompetenten Verhaltens vor.[10] Deshalb versucht die Autorin neurobio- logische, psychologische und padagogische Erkenntnisse der Entsteh- ung und Bildung von Sozialer Kompetenz gebundelt darzustellen, um Lernbedingungen zu erkennen.
3.1 Neurobiologische Betrachtung
Die Neurowissenschaften bzw. die Gehirnforschung beschaftigt sich mit der Entwicklung, dem Aufbau und der Funktion der Bestandteile des Gehirns. Dabei waren drei diagnostische Verfahren bahnbrechend fur den heutigen Kenntnisstand. Das Elektronenmikroskop (1933) zeigt Prozesse und Strukturen von Zellen und ermoglicht Synapsen und der- en Plastizitat zu erkennen; die Computertomographie (1972) durchleu- chtet das Gehirn und seinen Stoffwechsel und kann dies in Fotos dar- stellen; die Kernspintomographie (1984) hat die Methode CT erweitert und kann durch die Nutzung von Magnetfeldern verschiedene Schnitt- ebenen sichtbar machen. So ist es moglich, ein bestimmtes Verhalten und Vorgange des Lernens in den Stoffwechselaktivitaten zu lokalisier- en. Die Analyse der Befunde dieser Verfahren lasst wissenschaftlich sagen, „dass Verhalten und Erleben, also alle seelischen Pro- zess etwas mit dem Gehirn zu tun haben. Dabei ist auch klar, dass unterschiedliche Regionen des Gehirns be- stimmte Funktionen von Verhalten und Erleben steuern.
Diese Regionen stehen auf einer hochkomplexen Art mit- einander in Verbindung und regeln und steuern sich ge- genseitig.“ (Schmitt, 2008, S.31)
Somit werden im Folgenden zusammenfassend die genetische Ausstat- tung, die Gehirnentwicklung, die hier wichtigen Hirnregionen, die hochkomplexen Netzwerke, sowie die Speicherung von Erfahrungen und die Lerneinflusse dargestellt. Die folgenden Ausfuhrungen und Zusammen- fassungen nehmen hauptsachlich Bezug auf Thomas Schmitt, Gerhard Roth und Manfred Spitzer.
3.1.1 Ausstattung, Entwicklung und Funktionen des Gehirns
In jedem Zellkern sind Erbinformationen zur Entwicklung und Funktion enthalten, welches man zusammenfassend Genom bezeichnet. Dies ist in Chromosomen (beim Menschen sind es insgesamt 46 Chromosome) gespeichert, die sich aus Desoxyribonukleinsaure (DNA) und Proteinen zusammensetzt. Ein Gen, ein Teil der DNA, verantwortlich fur die Pro- duktion der Proteine, dem eine prozesssteuernde Funktion innewohnt, kann aktiv —inaktiv, intensiv-schwach sein. Gene enthalten evolutionare Informationen, die durch Erlebnisse und Umwelterfahrungen in ihrer Entfaltung (Entwicklung und Funktion von Zellen) beeinflusst werden. Das Gehirn hat sich in seiner Entwicklung den Herausforderungen der Umwelt angepasst, kann jedoch nicht sofort auf viele Umweltwechsel reagieren. Es besitzt zwei Zelltypen, zu einem die Gliazellen, teilungs- fahige Gewebezellen und zum anderem Nervenzellen, die teilungsbe- grenzt sind, jedoch Neuroblasten (Vorlauferzellen der Nervenzellen) in Reserve halten. Diese spielen bei der Neuroplastizitat eine Rolle.
Der Entwicklungs- und Wanderungsprozess der Nervenzelle (mit der Geburt und danach) zu ihrem Einsatzort wird „Migration“, der Einricht- ungsprozess .Aggregation1' genannt. Bis zum 5. Lebensjahr nehmen die Synapsen als Kontaktstellen der Nervenzellen, die Migration und Aggregation abhangig von anregenden Umweltreizen zu; ein komplexes Nervennetzwerk entsteht. Es existieren fur verschiedene Nervenbildun- gen unterschiedliche Zeitfenster. Zwischen dem 5. und 15. Lebensjahr kommt es zur Eingrenzung und Reduktion dieser Verbindungen, die durch Gene, Hormone und Umwelteinflusse bedingt wird.
„Einige Autoren gehen davon aus, dass neuronale Verbindungen, die bis zu diesem Zeitpunkt durch Ubung und Nutzung stabilisiert wurden, den Prozess der Beschnei- dung uberstehen und dem Menschen Zeit seines Lebens stabil zur Verfugung stehen, wahrend nur unregelmaGig genutzte Verbindungen eher zugrunde gegen.“ (Schmitt, 2008, S.41)
Das Gehirn besitzt Plastizitat (Formveranderung), da es unter system eigenen und umweltbedingten Faktoren Nervenzellen und Synapsen netzwerke entwickelt. Jede Umwelterfahrung wird in Form der inneren Reprasentanz gesichert und im Laufe der Zeit strukturiert und gebun delt. Im jungen Erwachsenenalter hat sich das neuronale Netz zu einer Kommunikationssteuerungszentrale -nach innen und auGen- verfestigt; besitzt jedoch weiterhin eine Anpassungsfahigkeit und in einigen Teilen, wie im Frontalhirn, bedingt ein zeitunabhangiges Entwicklungs- und Veranderungspotential bis ins hohe Alter.
„In und mit diesen Verbindungen findet Informationsverar- beitung in Form von Wahrnehmen, Lernen und Denken statt.“ (Spitzer, 2007, S. 54)
Wo sind in der Funktionspalette des Gehirns die notwendigen Prozesse fur kooperatives Denken und Handeln zu finden? Planungs- und Um- setzungshandeln, sowie das Sozialverhalten sind im vorderen Cortex des Gehirns zu orten. Im hinteren Cortex findet sich die Verarbeitung von Wahrnehmungen, welches z.B. der Kommunikation und Empathie dient. Motivationale und emotionale Fertigkeiten finden sich im Zwi- schenhirn. Das limbische System[11], welches wie ein Saum um den Hirnstamm liegt, besteht u.a. aus den Amygdalae (Mandelkernen), dem Hippocampus (Seepferdchen) und den Gurtelwindungen.
[...]
[1] Obersetzung: 1 =“dieses fur das“ und 2 =“eine Hand wascht die andere“
[2] wie der Handschlag im Handwerk vor Jahren noch sicher ein Geschaft besiegelt hat
[3] vgl. Diskussion 2010 uber die „Spatromische Dekadenz“ der Hartz IV-Empfanger
[4] vgl. Schramm, 2010
[5] Programme for International Student Assessment
[6]vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2003
[7] vgl. z. B. Katalog in: Grofeer, 2009, S.28-31
[8] S. Ahmed, 2010; H.-J., Balz,2009; CH. Vietzke, 2008;
[9] vgl. Punkt 5
[10]siehe z.B. Kieper; Mischke, 2008
[11] Es existieren unterschiedliche Uberzeugungen, was zu diesem System gehort und wofur dieses System in seiner Funktion und Wirkung steht. Fur einige ist dieser Begriff sogar uberholt. In dieser Arbeit wird die Darstellung von Schmitt und in Erganzung von Spitzer und Roth verwendet.
- Arbeit zitieren
- Nicole Mosler (Autor:in), 2010, Was beeinflusst das Lernen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155498
Kostenlos Autor werden


















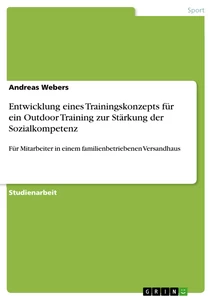

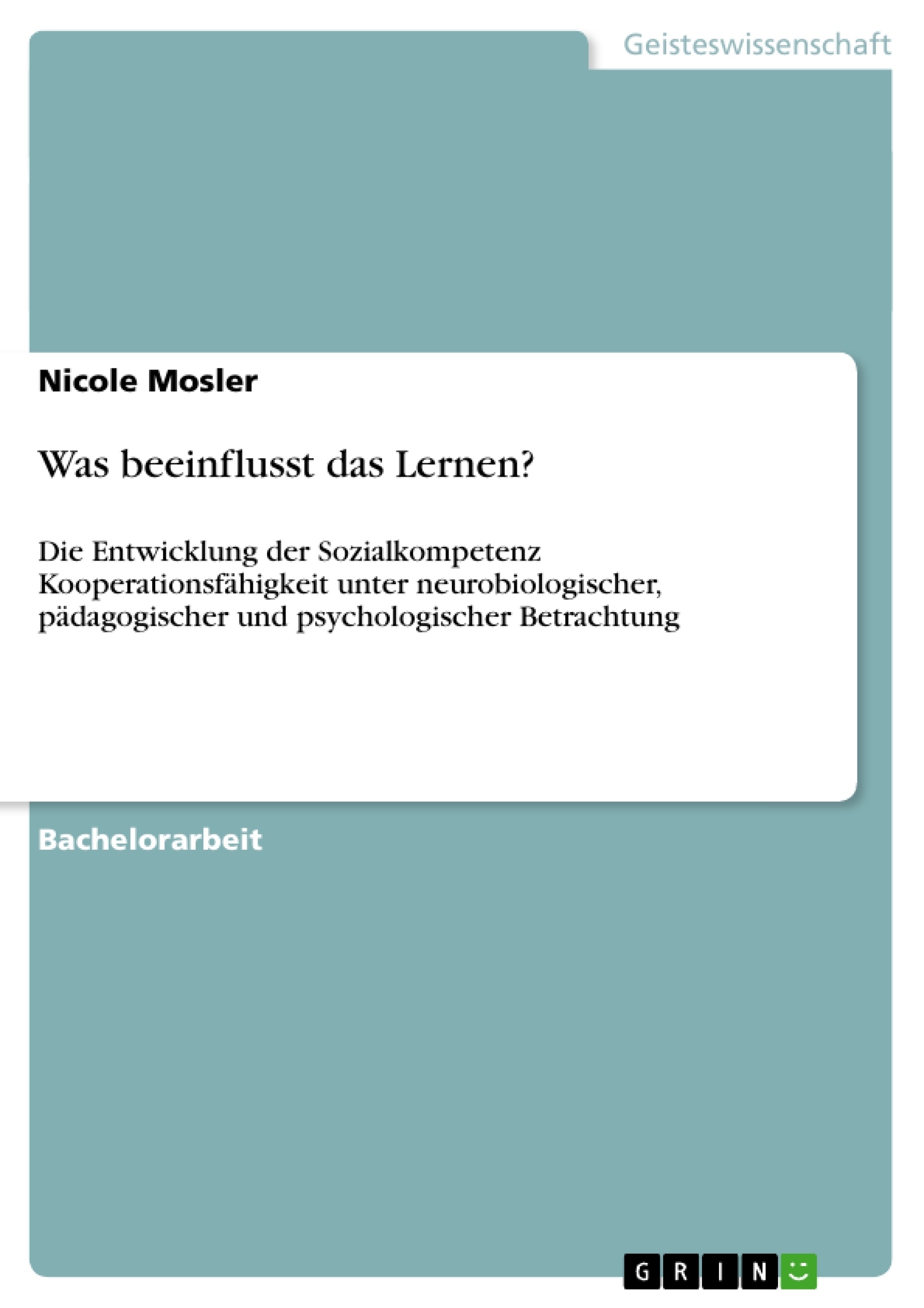

Kommentare