Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Begründung der Themenwahl
1.2 Inhaltliches Vorgehen
1.3 Methodisches Vorgehen
2 Dyskalkulie
2.1 Terminologie
2.1.1 Diskrepanzdefinition
2.1.2 Dyskalkulie aus therapeutischer Sicht
2.1.3 Fazit
2.2 Ursachen
2.2.1 Individuumsbezogene Ursachen
2.2.2 soziokulturelle und familiäre Ursachen
2.2.3 schulische Ursachen
2.3 Komorbiditäten
2.3.1 Komorbide neuropsychologische Störungen
2.3.2 Komorbide psychiatrische Erkrankungen
2.3.3 Komorbide psychosomatische Erkrankungen
2.4 Epidemiologie
2.5 Geschlechterverhältnis
3 Neuropsychologische Grundlagen des Rechnens
3.1 Zahlenverarbeitungsmodelle
3.1.1 Das Single-Route-Modell
3.1.2 Das Multi-Route-Modell
3.1.3 Das Triple-Code-Modell
3.2 Befunde zur Lokalisation von Rechenprozessen
4 Mathematische Grundbegriffe und der Erwerb mathematischer Kompetenzen: zentrale Aspekte und mögliche Schwierigkeiten
4.1 Die Zahl
4.1.1 Der Zahlbegriff
4.2 Die Zählentwicklung
4.2.1 Hürden beim Erwerb der Zählkompetenz
4.3 Dekadisches Stellenwertsystem
4.3.1 Hürden des dekadischen Stellenwertsystems
4.4 Mengen
4.4.1 Mengenbegriff
4.4.2 Invarianz von Mengen
4.4.3 Hürden der Mengenvorstellung
4.5 Arithmetische Operationen
4.5.1 Der Erwerb des rechnerischen Denkens
4.6 Addition
4.6.1 Zählende Rechenstrategien
4.6.2 Heuristische Strategien
4.7 Subtraktion
4.7.1 Zählende Rechenstrategien
4.7.2 Heuristische Strategien
4.8 Hürden der Addition und Subtraktion
5 Lehrplan für den Mathematikunterricht
6 Erläuterung des praktischen Vorhabens
7 Anamnese
7.1 Vorstellung der Schülerin
7.2 Schulischer Werdegang
7.3 Lebensumstände der Schülerin
7.4 Fehleranalyse des Klassenarbeitsheftes
7.5 Mathematische Kompetenzen, Strategien und Defizite der Schülerin
7.6 Verhaltensbeobachtung
7.7 Der Dyskalkulie – Fragebogen
7.8 Zusammenfassung der Anamnese
8 Zielformulierung
8.1 Begründung des Förderziels
9 Die Messinstrumente vor der Förderung
9.1 Der DEMAT 3+
9.1.1 Beschreibung der ersten Durchführung des DEMATs 3+ am 28.05. 2008
9.1.2 Ergebnisse der ersten Durchführung
9.1.3 Interpretation der Ergebnisse
9.2 Test zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 1000
9.2.1 9.2.1 Beschreibung der ersten Durchführung des Testes zu Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 1000 am 10. 06. 2009
9.2.2 Ergebnisse der ersten Durchführung
9.2.3 Interpretation der Ergebnisse
10 Vorstellung der Fördereinheit
10.1 1Förderziele
10.2 1Aufbau der Förderung
10.2.1 Orientierung im Zahlenraum bis 1000
10.2.2 Gesetz der Konstanz der Summe
10.2.3 Gesetz der Konstanz der Differenz
10.2.4 Analogiebildung
10.3 Übersicht der einzelnen Förderstunden
10.4 Exemplarische Beschreibung der einzelnen Förderstunden
10.4.1 Beschreibung der Förderstunde am 16.06.2009
10.4.2 Beschreibung der Förderstunde am 24.06.2009
10.4.3 Beschreibung der Förderstunde am 19.08.2009
10.4.4 Beschreibung der Förderstunde am 21.08.2009
10.4.5 Beschreibung der Förderstunde am 02.09.2009
10.5 10.5 Allgemeine Umstände der Förderung
11 Die Messinstrumente während und nach der Förderung
11.1 DEMAT 3+
11.1.1 Beschreibung der zweiten Durchführung am 11.09.2009
11.1.2 Ergebnisse der zweiten Durchführung
11.1.3 Interpretation der Ergebnisse
11.1.4 Vergleich der Ergebnisse beider Durchführungen
11.2 Test zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 1000
11.2.1 Beschreibung der zweiten Durchführung am 28.08.2009
11.2.2 Ergebnisse der zweiten Durchführung
11.2.3 Beschreibung der dritten Durchführung am 15.09.2009
11.2.4 Ergebnisse der dritten Durchführung
11.2.5 Vergleich der Ergebnisse der drei Durchführungen
12 Diskussion der Ergebnisse
13 Überprüfung des Förderziels
14 Schlussfolgerungen und Ausblick
15 Literaturverzeichnis:
1 Einleitung
1.1 Begründung der Themenwahl
Meine Motivation und mein Interesse, mich mit dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden Thema zu beschäftigen, entstand bereits vor einigen Jahren durch meine Tätigkeit als Nachhilfelehrerin für Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, da ich hierbei die dringende Notwendigkeit geeigneter Förderkonzepte – speziell im Bereich Dyskalkulie[1] – erfahren habe, welche trotz ihres unschätzbaren Wertes für schülerorientiertes und Misserfolg reduzierendes Unterrichten bis dato in der Literatur wie in der gesamten sonderpädagogischen Theorie meines Erachtens zu defizitär betrachtet und analysiert wurden.
Während die Lese-Rechtschreib-Schwäche einen bereits seit Jahren etablierten Forschungsgegenstand darstellt, rückten die Schwierigkeiten im Erlernen des Rechnens dagegen erst in den 80er Jahren in den Blickpunkt der Wissenschaftler und Schulpraktiker. Zwar widmete sich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit in den letzten Jahren immer mehr der Dyskalkulie, so dass bereits zahlreiche Befunde zu diagnostischen Möglichkeiten, Ursachen oder Therapiemöglichkeiten existieren, jedoch sind diese oft als uneinheitlich oder gar als kontrovers zu bewerten.
Als angehende Sonderpädagogin stellt jedoch gerade diese Thematik einen zentralen Aspekt meines späteren Beruflebens dar, was neben meinem persönlichen Interesse an der Thematik als zusätzliche Motivation, sich gerade diesem Themenfeld zu widmen, angesehen werden kann.
1.2 Inhaltliches Vorgehen
Zu Beginn dieser Arbeit wird der Terminus Dyskalkulie näher erläutert und verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zur Klärung der Terminologie herangezogen.
Im Anschluss an diese Begriffsklärung sollen mögliche Ursachen für die Entstehung einer Rechenschwäche vorgestellt werden. Dabei werden die Bereiche der individuumsbezogenen, soziokulturellen und familiären sowie der schulischen Ursachen näher thematisiert und mögliche komorbide Erkrankungen fokussiert.
Um die Bedeutung von Dyskalkulie in der heutigen Zeit zu betonen, folgt ein Exkurs zur Epidemiologie und zum Geschlechterverhältnis.
Im Kapitel der neuropsychologischen Grundlagen des Rechnens werden drei differente Zahlenverarbeitungsmodelle vorgestellt, um einen Einblick in zerebrale Prozesse während mathematischer Leistungen zu gewährleisten. Auf dieser Grundlage folgen Befunde zur Organisation von Rechenprozessen. Durch den Fortschritt der Technik und mit Hilfe bildgebender Verfahren sind konkrete Aussagen zu der Aktivierung und Beteiligung zerebraler Hirnareale bei mathematischern Prozessen möglich, welche in Kapitel 3.3. zusammengefasst werden.
Den Schwerpunkt der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Dyskalkulie bildet die Darstellung der mathematischen Entwicklung vom Kleinkindalter bis zum Ende der Grundschulzeit. Dabei sollen mathematische Grundbegriffe erläutert werden, die ungestörte mathematische Entwicklung des Kindes dargestellt werden und gleichzeitig mögliche Schwierigkeiten und zentrale Herausforderungen rechenschwacher Schüler fokussiert werden. Neben der Zahl, dem dekadischen Stellenwertsystem und dem Mengenverständnis wird der Erwerb des rechnerischen Denkens unter Heranziehung differenter Theorien erläutert. Die beiden Grundoperationen der Addition und Subtraktion stellen dabei den zentralen Schwerpunkt für diese Examensarbeit dar und finden daher besondere Berücksichtigung, indem sowohl Zählstrategien als auch heuristische Strategien zu ihrer Bewältigung näher erläutert werden.
Den Abschluss der theoretischen Auseinandersetzung bildet eine kurze Zusammenfassung der Kompetenzerwartungen am Ende der vierten Klasse der Lehrpläne des Landes Nordrhein – Westfalen der Grundschule.
Auf dieser theoretischen Grundlage folgt die Darstellung einer praktischen Fördereinheit mit einer rechenschwachen Grundschülerin.
1.3 Methodisches Vorgehen
Um die Probandin und ihre mathematischen Kompetenzen und Schwierigkeiten kennen zu lernen, erfolgt zunächst die Anamnese, welche in Kapitel 6 vorgestellt wird. Neben den Lebensumständen und dem schulischen Werdegang der Schülerin wird ihr Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten an Hand einer Verhaltensbeobachtung dargestellt. Abgeleitet aus einer Fehleranalyse des Klassenarbeitsheftes und Beobachtungen aus Einzelsituationen werden die mathematischen Kompetenzen, Strategien und Defizite zusammengefasst. Den Abschluss der Anamnese bildet die Auswertung eines Dyskalkulie-Fragebogens, welcher von der Klassenlehrerin der Probandin ausgefüllt wurde.
Um die Fragestellung, in wie weit es möglich ist, der Schülerin Strategien zur Bewältigung von Additions- und Subtraktionsaufgaben sowie Sicherheit im Umgang mit diesen Operationen zu vermitteln, zu überprüfen, werden zunächst zwei differente Tests zur Messung der mathematischen Leistung des Kindes durchgeführt. Dabei handelt es sich zum einen um den DEMAT 3+ und zum anderen um einen eigens für diese Förderung konzipierten Test . Die ermittelten Ergebnisse werden in Kapitel 8 dargestellt.
Auf der Grundlage der durch die Anamnese ermittelten Schwierigkeiten wurde in Absprache mit der Klassenlehrerin eine Fördereinheit mit dem Förderziel, Sicherheit bei Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 1000 zu vermitteln, konzipiert. Diese Konzeption lässt Freiraum für eventuelle Modifizierungen, um jede Förderstunde auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerin abstimmen zu können. Sie wird im neunten Kapitel vorgestellt.
Sowohl während als auch nach der Fördereinheit werden die oben erwähnten Tests erneut durchgeführt, deren Ergebnisse in Kapitel 10 dargestellt und verglichen werden.
Die Resultate und Ergebnisse dieser Studie werden weiterhin in die abschließende Kritik und Bewertung der anfänglich aufgestellten Fragestellung, in wie weit es möglich ist, der Schülerin Strategien zur Bewältigung von Additions- und Subtraktionsaufgaben sowie Sicherheit im Umgang mit diesen Operationen zu vermitteln, integriert.
2 Dyskalkulie
2.1 Terminologie
Der Terminus „Dyskalkulie“ leitet sich von dem griechischen Präfix dys, zu deutsch schlecht, und dem lateinischen Nomen calculus – die Rechnung ab (Born/ Oehler, 2005, S. 4).
In der Literatur werden zahlreiche unterschiedliche Termini synonym für das Phänomen Dyskalkulie verwendet, wie beispielsweise Rechenstörung, Rechenschwäche, Akalkulie, Mathematikschwäche, Arithmasthenie (griech. arithm = Zahl, Menge und asthnema = Schwäche (Metzler, 2002, S. 14), Rechenprobleme oder Dysmathematika . Diesen differenten Begrifflichkeiten liegen verschiedene und teilweise sogar konträre Definitionen zu Grunde, welche durch verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und unterschiedliche Erkenntnisinteressen begründet sind. Allerdings wird bei der genauen Betrachtung aller Bezeichnungen deutlich, dass sich die Probleme nur auf das Schulfach Mathematik beschränken. Weiterhin bringen alle Betitelungen, bis auf die der Mathematikschwäche und der Dysmathematika, spezielle Schwierigkeiten im Bereich der Arithmetik, also dem Rechnen mit Zahlen, zum Ausdruck.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll nun die Diskrepanzdefinition näher erläutert werden und kritisch dazu Stellung genommen werden, da es sich hierbei um eine in der Literatur weit verbreitete, jedoch auch sehr umstrittene Darstellungsweise von Dyskalkulie handelt.
2.1.1 Diskrepanzdefinition
Nach der zehnten Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD – 10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die Rechenstörung zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (F 81) gezählt ( Jacobs/ Petermann, 2005, S. 13).
„Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die abstrakten mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differenzial- und Integralrechnung benötigt werden.“ (Dilling/ Freyberger, 2001, S. 267)
Auch die vierte Revision des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM – IV – TR) legt für die Definition von Dyskalkulie ähnliche Kriterien wie die ICD – 10 fest. Die im Bereich Mathematik mittels standardisierten Tests individuell erfassten Leistungen liegen hier wesentlich unter denen, die auf Grund des Alters, der gemessenen Intelligenz und der altersmäßigen Bildung des betroffenen Schülers zu erwarten sind. Die Rechenstörung behindert hier die schulischen Leistungen sowie Alltagsaktivitäten, bei denen mathematische Fähigkeiten gefordert werden (Born / Oehler, 2005, S. 4).
Diese Definition wird weitgehendst in der Literatur vertreten und kann als Diskrepanzdefinition bezeichnet werden.
Hiernach wird Dyskalkulie als eine Teilleistungsstörung im mathematischen Bereich betrachtet. An dieser Stelle ist auf die differente Verwendung des Terminus Teilleistungsschwäche hinzuweisen. Während auf neuropsychologischer Ebene der Terminus Teilleistungsschwäche als Fachausdruck für eine Leistungsminderung in einem klar abgegrenzten Bereich der Wahrnehmung, der Bewegungssteuerung, beziehungsweise in der Verbindung dieser beiden Bereiche zu verstehen ist (Gaidoschik, 2003, S. 9) und somit der Kennzeichnung gestörter Elementarprozesse im Gehirn dient, wird dieser Terminus auf der pädagogisch – didaktischen Ebene als Abgrenzung zu anderen schulischen Bereichen und Fächern verwendet. Dies bedeutet: In den anderen Schulfächern ist der betroffene Schüler durchaus in der Lage, durchschnittliche bis gute Leistungen zu erzielen. Die Diskrepanz besteht somit in der durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Allgemeinintelligenz und den unterdurchschnittlichen Leistungen im mathematischen Bereich.
Doch eine solche Betrachtungsweise von Dysklakulie weist entscheidende Mängel auf und umfasst nicht alle Dimensionen dieses Phänomens. Gaidoschik (2001, S. 2) weist daraufhin, dass dieser Definitionsversuch dem Zusammenhang zwischen kindlichem Intellekt und kindlicher Psyche nicht gerecht wird. Ebenso kritisiert er die Bezeichnung Teilleistungsschwäche. Da es sich beim Rechnen – Können nicht selbst um eine basale Teilleistung handelt, kann bei einer Rechenschwäche nicht von einer Teilleistungsschwäche gesprochen werden (Gaidoschik, 2001, S. 10).
Aus ähnlichen Gründen führt Gerster an, dass eine solche Diskrepanzdefinition für eine wissenschaftliche Begriffsklärung unbrauchbar und für die Förderung der Kinder eher kontraproduktiv sei (Gerster, 2000, S. 1). Er plädiert dafür, dass der Begriff „rechenschwach“ lediglich eine Bezeichnung dafür sei, dass ein Kind im Rechnen schwach sei.
„Er darf nicht als Erklärung verstanden werden. Er soll auch nicht als Persönlichkeitskonstrukt (als Eigenschaft des Kindes allein) verstanden werden. Immer sind Bedingungen aus dem sozialen Umfeld (Familie, Schule) beteiligt.“ (Gerster, 2000, S. 2)
2.1.2 Dyskalkulie aus therapeutischer Sicht
Aus therapeutischer Sicht wird Dyskalkulie weder als ein ausschließlich mathematisches noch als ein isoliertes psychisches Problem verstanden (Brühl/ Bussebaum/ Hoffmann u. a., 2003, S. 15) Vielmehr muss der Betroffene in seiner Gesamtheit betrachtet und verstanden werden. Ein Kind, welches im Anfangsunterricht in Mathematik ständig die Erfahrung des Scheiterns macht, ist einem erheblichen psychischen Druck ausgesetzt. Unter diesem Druck kann das Selbstwertgefühl des Schülers erheblich leiden, so dass folglich auch in anderen schulischen Bereichen Schwierigkeiten auftreten. Diese weiteren Schwierigkeiten resultieren aus dem negativen Selbstbild des Kindes. „So kann ein Kind vom Mathematik-Versager zum generellen Schulversager werden.“ (Gaidoschik, 2001, S. 2) Der Teufelskreis schließt sich.
2.1.3 Fazit
Die mit Dysklakulie beschäftigten wissenschaftlichen Disziplinen konnten bisher keine einheitliche beziehungsweise allgemeingültige Definition zu diesem Sachverhalt liefern.
Die Diskrepanzdefinition ist in der Literatur noch sehr verbreitet, gilt allerdings in der sonderpädagogischen Forschung als überholt.
Die aktuelle Forschung widmet sich weniger, wie in früheren Legastheniediskussionen, ergebnislosen Theoriedebatten zur Terminologie, sondern im Vordergrund des Interesses steht das rechenschwache Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen. Im Sinne der von Dysklakulie betroffenen Schüler wurde
„ das Definitionsproblem zurückgestellt und [...] der mathematischen Frage nach a) den Ursachen der Rechenschwäche und b) den Möglichkeiten ihrer Erkennung und Behebung Platz gemacht. Das heißt, es werden alle Schüler einbezogen, die einer Förderung jenseits des Standardunterrichts bedürfen.“ (Lorenz, 1991, zit. nach Brühl/ Bussebaum/ Hoffmann u. a., 2003, S. 26)
2.2 Ursachen
Wie bereits durch die Definitionsdiskussion angedeutet, gibt es nicht die Rechenschwäche und folglich gibt es auch nicht die Ursache. Generell steht die Forschung zu den Ursachen einer Rechenschwäche noch am Anfang, und es konnten noch keine Faktoren im Sinne von Kausalitäten, die eine Rechenschwäche verursachen, identifiziert werden. Vielmehr sind bisweilen lediglich Ursachen als Möglichkeiten und Risikofaktoren für das Auftreten einer Rechenschwäche bekannt (Kaufmann, 2003, S. 29). Schipper (2003) weist darauf hin, dass neben den individuumsbezogenen Ursachen auch immer soziale und schulische Faktoren mit einbezogen werden müssen. Somit lassen sich drei große Ursachenfelder bei Rechenstörungen zusammenfassen: das Individuum, das schulische Umfeld und das soziokulturelle und familiäre Umfeld des betroffenen Kindes.
Nach dem heutigen Stand der Forschung wird eine Rechenschwäche also nicht monokausal verursacht, vielmehr ist sie auf ein Ursachengeflecht, welches durch verschiedene Wechselwirkungen der erläuterten Ursachenfelder bedingt ist, zurückzuführen.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen die am Ursachengeflecht beteiligten Faktoren näher erläutert werden.
2.2.1 Individuumsbezogene Ursachen
Generell können zu den individuumsbezogenen Ursachen einer Rechenschwäche drei weitere Subfaktoren gezählt werden. Hierbei handelt es sich um kongenitale, neuropsychologische und psychische Ursachen.
2.2.1.1 Kongenitale Faktoren
Kongenitale Faktoren als Ursache für eine Rechenschwäche werden vorwiegend im Bereich der Intelligenz und der Intelligenzstruktur angenommen (Grissemann/ Weber, 2000, S. 29). Neuere genetische Untersuchungen weisen darauf hin, dass Erbanlagen bei der Entwicklung und Herausbildung einzelner kognitiver Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen (Plomin / DeFries, 1999, S. 28). Einer aktuellen Studie von Shalev, Manor et al. (2001) zur Folge stellt die familiäre Häufung einen wesentlichen Risikofaktor für die Persistenz einer Rechenschwäche dar. Die Autoren fanden heraus, dass 66% der Mütter, 40% der Väter und 53% der Geschwister von Schülern mit einer Dyskalkulie ebenfalls von einer Rechenschwäche betroffen sind (Jacobs/ Petermann, 2005, S. 41).
2.2.1.2 Neuropsychologische Faktoren
Die neuropsychologischen Ursachen einer Rechenschwäche beschreiben im Allgemeinen Hirnleistungsschwächen, welche bereits seit vielen Jahren im Vordergrund des Forschungsinteresses stehen und welche für so genannte neurogene Rechenstörungen verantwortlich gemacht werden (Metzler, 2002, S. 36). Lange Zeit nahm man die Existenz eines Rechenzentrums im Gehirn an, welches in zahlreichen Studien versucht wurde, unterschiedlichen Hirnarealen zugeordnet zu werden. Beispielsweise vermuteten Lewandowsky und Stadelmann (1908) die Beherbergung des Rechenzentrums in der linken Hirnhemisphäre. Henschen (1919) hingegen schrieb das Rechenzentrum der dritten Windung des linken Frontallappens zu, und Goldstein (1948) proklamierte schließlich die These, dass sich das Rechenzentrum im parieto – occipitalen Bereich der dominanten Hirnhemisphäre befindet.
In der aktuellen Forschung wird ein im Hirn lokalisierbares zentrales Rechenzentrum, von welchem alle mathematischen Denkprozesse ausgehen, nicht mehr angenommen. Begründet wird diese Annahme durch die Beteiligung unterschiedlichster Einzelleistungen des Wahrnehmens und Denkens an mathematischen Prozessen, die zu einem höheren Ganzen zusammengefasst werden. Geller (1952) stellt zusammenfassend fest:
„Es erscheint aussichtslos, nach einem Rechenzentrum zu fahnden oder eine isolierte Rechenstörung bei Hirnschädigung zu erwarten. Das Rechnen ist ein Denkakt, der in seinen Voraussetzungen und sprachlich-schriftlichen Ausdrucksformen Wahrnehmung und Vorstellungen verschiedener Kreise zusammenfasst und umfasst. Zu akustischen fügen sich optische, räumliche und motorische Vorstellungen. Der Rechenakt ist auch in all diesen Kreisen verwundbar.“ (Geller, 1952, S. 35)
Seit den 60er Jahren gewann die Diagnose der minimalen cerebralen Dysfunktion (MCD) immer mehr an Bedeutung. MCD kann als Sammelbegriff für verschiedene Kombinationen von Störungen in basalen Teilleistungen, wie beispielsweise der Wahrnehmung, der Vorstellungsfähigkeit, der Sprache, des Gedächtnisses und der Kontrolle der Aufmerksamkeit betrachtet werden (Kaufmann, 2003, S. 31). Diese Diagnose als Ursache für eine Rechenschwäche wird allerdings heute stark angezweifelt und von verschiedenen Autoren kritisiert.
„Die Diagnose einer MCD wirft neben ihrer biologischen, klassifikatorisch-symptomatologischen und therapeutischen Problematik auch prognostische Probleme auf, als dass der Begriff der cerebralen Dysfunktion die jeweilige Störung als überdauernd und (relativ) therapieresistent erscheinen lässt.“ (Lorenz, 1984, S. 75)
Als weitere neuropsychologisch begründete Risikofaktoren für das Entstehen einer Dyskalkulie können Störungen im taktil-kinästhetischen Bereich, Störungen der auditiven Wahrnehmung, Speicherung und Serialität, visuelle Wahrnehmungsstörungen, Automatisierungsschwierigkeiten, graphomotorische Störungen sowie Intermodalitätsstörungen genannt werden.
Im Folgenden soll exemplarisch verdeutlicht werden, wie die oben genannten Störungen Einfluss auf Leistungen im mathematischen Bereich nehmen können.
Störungen im taktil-kinästhetischen Bereich verursachen häufig Schwierigkeiten in der Rechts-Links-Unterscheidung, welche wiederum verantwortlich sein können für Probleme beim Ordnen und Vergleichen von Zahlen. Ebenso können häufige Zifferninversionen auf taktil-kinästehtischen Störungen zurückgeführt werden.
Visuelle Wahrnehmungsstörungen erschweren die Figur-Grund-Unterscheidung und somit das Aussondern relevanter Reize. Ebenfalls können sie sich auf die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen, dem Erkennen von Größen- und Längenunterschieden oder der Mengenerfassung, welche wiederum für die 1-1-Zuordnung relevant ist, auswirken.
Intermodalitätsstörungen verhindern die Verknüpfung mehrerer Sinneskanäle, was beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Menge, Zahlwort und Ziffer führen kann (Kaufmann, 2003, S. 32f).
2.2.1.3 2.2.1.3 Psychische Faktoren
Als psychische Risikofaktoren für das Entstehen oder Unterstützen einer Rechenschwäche können zum einen kognitive Faktoren, wie Intelligenz , Strategieeinsatz, die Fähigkeit zur Informationsaufnahme und -verarbeitung, die Kapazität des Gedächtnisses und die Konzentrationsfähigkeit genannt werden. Zum anderen sind jedoch auch nicht-kognitive Faktoren wie Motivation, Einstellungen, Werte, Arbeitsverhalten, Schulangst, Selbstwertgefühl und eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von zentraler Bedeutung (Kaufmann, 2003, S. 34f). Schulz (1999) weist darauf hin, dass bei bestehenden Rechenschwierigkeiten nicht-kognitive Faktoren zu ihrer Verstärkung beitragen.
Als besonders relevant kristallisieren sich die eigenen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (self-efficacy) heraus. Die Gewissheit einer Person über die Fähigkeiten zu verfügen, die zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind, werden als Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bezeichnet. Untersuchungen von Pajares und Miller (1994) zufolge hat die Variabel Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Vergleich zu Ängstlichkeit, Geschlecht und Vorerfahrungen am stärksten die mathematischen Leistungen beeinflusst (Moser Opitz, 2007, S.60).
2.2.2 soziokulturelle und familiäre Ursachen
Als mögliche Variabeln soziokultureller und familiärer Ursachen werden beispielsweise mangelnde Leistungsmotivation, Arbeitshaltung, Ausdauer und sprachliche Schwierigkeiten gesehen (Grissemann/ Weber, 2000, S. 29). Des Weiteren können die Einstellungen und Werte der Eltern in Bezug auf schulische Belange sich auf das Kind auswirken und bereits vor Beginn der Schulzeit bestimmte Erwartungshaltungen hervorrufen. So können zum Beispiel Eltern, die in ihrer Kindheit Versagenserfahrungen im Kontext Schule gemacht haben und aus diesem Grund schulischen Angelegenheiten einen niedrigen Stellenwert zuschreiben, ihrem Kind diese Einstellung bewusst oder unterbewusst vermitteln, was sich auf die Motivation und Arbeitshaltung des Kindes auswirken kann.
In der aktuellen Forschung wird den vorschulischen Kenntnissen im nicht- numerischen und numerischen Bereich eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. Aktuelle Studien (Geary, 1994, Hengartner/ Röthlisberger, 1994) zeigen, dass das Leistungsbild der Schulanfänger sehr heterogen ist. Mangelnde vorschulische Erfahrungen können dazu führen, dass bereits im ersten Schuljahr der Anschluss zu den übrigen Schülern verloren wird. Als relevante Vorkenntnisse für den Anfangsunterricht im Fach Mathematik können räumliche Orientierung, Invarianz (Unveränderlichkeit von Größen), Seriation (Prozess des Anordnens einer Reihe von Objekten nach Ähnlichkeiten oder Unterschieden) und Klassifikation genannt werden.
Weiterhin spielen sprachliche Kompetenzen bei dem Erwerb von mathematischen Fähigkeiten eine relevante Rolle. Eine defizitäre sprachliche Entwicklung kann sich immens auf das mathematische Verständnis auswirken. Kaufmann (2003) weist darauf hin, dass gerade im arithmetischen Anfangsunterricht eine noch feinere Sprachkompetenz als im muttersprachlichen Unterricht von Nöten ist. Dies ist begründet durch die häufige Verwendung relationaler, komparativer und räumlich- zeitlich präpositionaler Bestimmungen sowie kausaler und ein- und ausschließender Relationen.
Gaidoschik (2003) macht darauf aufmerksam, dass Probleme im Umfeld des Kindes, wie beispielsweise Scheidung der Eltern, Leistungsdruck oder Vernachlässigung sich stark auf die Psyche des Kindes auswirken können und somit bestehende Lernschwierigkeiten verstärken können, jedoch diese kaum verursachen können.
2.2.3 schulische Ursachen
Unter schulischen Ursachen sind diejenigen Faktoren zu verstehen, welche erst durch die Schulsituation wirksam werden. In Wechselwirkung mit den bereits erläuterten Risikofaktoren können schulische Ursachen die Entstehung einer Rechenschwäche begünstigen und verstärken (Gaidoschik, 2003, S. 20). Hierzu zählt beispielsweise ein mehrfacher Lehrerwechsel, welcher im ungünstigsten Fall wiederum einen häufigen Methodenwechsel oder unterschiedliche Unterrichtsstile mit sich bringt und somit für Verunsicherungen, Resignation und/oder Abwehr auf Seiten des Schülers führen kann (Raschendorfer/ Zajicek, 2006, S. 25). Des Weiteren kann eine unkontinuierliche Beschulung oder unterrichtliche Qualitätsmängel zu Lücken in den Basisoperationen führen, was den weiteren mathematischen Wissenserwerb erheblich behindern kann. Grissemann/Weber (2000) machen drauf aufmerksam, dass ebenfalls eine vorschnell angestrebte Automatisierung in Form von Drillrechnen zu einer mangelnden operativen Flexibilität führen kann. Ein wenig handlungsbezogner Anfangsunterricht kann zu einem mechanisch-assoziativen Rechenverhalten der Schüler führen, so dass die Transferfähigkeit der Kinder nicht gefördert oder sogar behindert wird.
Abschließend ist festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um eindeutige Ursachen handelt, jedoch in Wechselwirkung mit entsprechenden weiteren Risikofaktoren können diese schulischen und unterrichtlichen Mängel im Einzelfall sehr wohl entscheidend sein.
2.3 Komorbiditäten
Bei vielen von Dyskalkulie betroffenen Schülern treten komorbide Störungen auf, welche bei der Therapie nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Jacobs/ Petermanns (2005) unterteilen diese Komorbiditäten in neuropsychologische Störungen und psychiatrische Begleiterkrankungen ein.
2.3.1 Komorbide neuropsychologische Störungen
Als komorbide neuropsychologische Störungen können Aufmerksamkeitsstörungen, visuell-räumliche Störungen, Gedächtnisstörungen und Lese-Rechtschreibstörungen genannt werden. Korrelationen zwischen diesen neuropsychologischen Störungen und einer Rechenschwäche wurden in zahlreichen Untersuchungen mit teilweise sehr großen Schwankungen bekannt gegeben. Auf die einzelnen Studien soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden (siehe hierzu Jansen/ Petermanns, 2005, S. 42f). Festzuhalten gilt, dass die Prävalenz dieser Störungen bei Kindern mit einer Rechenschwäche durchaus höher ist, als bei Kindern, die nicht unter einer Rechenschwäche leiden.
2.3.2 Komorbide psychiatrische Erkrankungen
Zu den komorbiden psychiatrischen Erkrankungen gehören vor allem internalisierende Störungen, wie beispielsweise Ängste und Depressionen. Externalisierende Störungen wie zum Beispiel agressives und deliquentes Verhalten sind weniger häufig zu beobachten (Jacobs/ Petermanns, 2005, S. 42 f). Oft entwickeln sich stark ausgeprägt, spezifische Mathematikängste, welche sich negativ auf die Leistungsentwicklung des Kindes auswirken (von Alster, 2003, S. 164).
2.3.3 Komorbide psychosomatische Erkrankungen
Oftmals sind bei betroffenen Schülern psychosomatische Begleitsymptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen im Zusammenhang mit Schulleistungsanforderungen zu beobachten.
In Folge aller dieser Komorbiditäten kann sich eine generelle Schulangst entwickeln, so dass von einem destruktiven Kreislauf gesprochen werden kann.
2.4 Epidemiologie
Die Prävalenzschätzungen von Dyskalkulie betroffenen Personen weisen eine sehr große Schwankung auf und sind wissenschaftlich nur ungenügend gesichert. Lorenz/ Radatz (1993) beispielsweise sprechen von ca. 6% extrem rechenschwacher Schüler und 15% mindestens förderbedürftiger Schüler. Petermann (1998) postuliert vergleichsweise geringe 2% Betroffene.
Bis vor wenigen Jahren ging man jedoch noch davon aus, dass Dyskalkulie eine eher seltene Störung sei und wohl nur 1% der Gesamtpopulation betreffe. Heutige Befunde weisen jedoch darauf hin, dass die Vorkommenshäufigkeit von Dykalkulie durchaus vergleichbar ist mit der der Lese-Rechtschreibschwäche (Landerl/ Kaufmann, 2008, S. 98).
Diese große Schwankungsbreite ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige standardisierte Testverfahren zur Verfügung stehen, und sich die angewandten Tests stark unterscheiden. Laut Angaben von Jacobs/ Petermann (2007) kann jedoch eine Prävalenz zwischen 5 und 7 % als sicher gelten.
2.5 Geschlechterverhältnis
In der aktuellen Forschung geht man von einem Geschlechterverhältnis bei Dyskalkulie von 3:2 aus, das heißt, auf drei betroffene Mädchen kommen zwei betroffene Jungen (Born/ Oehler, 2005, S. 5). Ebenfalls Lobeck (1996) erhielt in seiner Studie Ergebnisse von 40 % betroffenen Jungen und 60 % betroffenen Mädchen. Bei einer Dyskalkulie scheinen folglich im Gegensatz zur Lese-Rechtschreibschwäche Jungen nicht häufiger betroffenen zu sein als Mädchen, sondern umgekehrt.
Auch wenn diese Verhältnisangaben weitgehendst einstimmig der aktuellen Literatur zu entnehmen sind, postulieren einige Autoren wie beispielsweise Landerl und Kaufmann (2008), ein Geschlechterverhältnis von 1:1 und bezeichnen diese Tatsache als äußerst bemerkenswert, da bei etlichen anderen Entwicklungsstörungen (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder Lese-Rechtschreibschwäche) stets eine höhere Prävalenz für das männliche Geschlecht berichtet wurde.
3 Neuropsychologische Grundlagen des Rechnens
Die aktuellen Annahmen über die Organisation von Rechenprozessen basieren vor allem auf Läsionsstudien und Studien mit bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT). Aus diesen Annahmen wurden verschiedene Modelle zur Verarbeitung von Zahlen entwickelt. Sie unterscheiden sich vor allem durch die Anzahl der angenommenen Transkodierungsrouten der Zahleninformation und in der Form der semantischen Repräsentation. Innerhalb der Neuropsychologie wird der Terminus Repräsentation als isomorphe Abbildung verstanden, das bedeutet, dass etwas durch etwas anderes ersetzt wird. Hierbei wird die Repräsentation „entweder als Akt oder als Produkt des Aktes“ (Schweiter/ Aster von, 2005, S. 34) interpretiert.
Im Folgenden sollen das Single-Route-Modell von McCloskey, dessen modifizierte Form von Cipolotti und Butterworth sowie das Triple-Code-Modell nach Dehaene näher erläutert werden. Im Anschluss daran sollen Befunde zur Lokalisation von Rechenprozessen dargestellt werden.
3.1 Zahlenverarbeitungsmodelle
3.1.1 Das Single-Route-Modell
Das Single-Route-Model von McCloskey, Caramazza und Basili (1985) basiert auf der Vorstellung von funktionell unabhängigen Modulen, welche für die Zahlenverarbeitung und Rechenprozesse verantwortlich sind und kann als erstes auf neuropsychologischen Theorien und Patientenbefunden basierendes Rechenmodell bezeichnet werden. Bei dem Singel-Route-Modell wird zwischen den auffassenden und ausführenden Modulen unterschieden.
„Module sind umschriebene Funktionseinheiten, die eigenständig und unabhängig von den sonstigen Prozessen des Denkens für unterschiedliche kognitive Prozesse zuständig sind und in verschiedenen Regionen des Gehirns lokalisiert werden können.“ (Kaufmann, 2003, S.25f).
Die Funktion der auffassenden Module (Zahlenverständnis, Numeral Comprehension Mechanisms) besteht darin, eingehenden Zahleninformationen eine semantische Bedeutung zu geben, um sie für weitere kognitive Prozesse, wie beispielsweise das Rechnen, relevant zu machen. Dieser Vorgang wird von den Autoren des McCloskey-Modells als abstrakte, internale Repräsentation bezeichnet (Jacobs/ Petermanns, 2005, S. 15).
Die ausführenden Module (Zahlenproduktionsmodule, Numeral Production Mechanisms) sind dafür verantwortlich, dass diese semantische Repräsentation in vermittelbare Zahleninformationen übersetzt werden.
Sowohl die Zahlenverständnismodule als auch die Zahlenproduktionsmodule unterteilen sich in Komponenten für die Verarbeitung von Zahlen in Ziffernform (arabische Form, Beispiel 3020) und Wortform (verbale Produktion, Beispiel: dreitausendzwanzig). Die Wortform wiederum wird in gesprochener und geschriebener Wiedergabe unterteilt (Grube, 2006, S. 5f).
Neben diesem Zahlenverarbeitungssystem besteht ein Rechensystem, welches für das Verständnis von Rechenoperationen und mathematischen Zeichen verantwortlich ist und sich wiederum in eine Reihe von Teilkomponenten zerlegen lässt, wie beispielsweise arithmetische Prozeduren und arithmetisches Faktenwissen. Zu dem prozeduralem Wissen zählt das Wissen um Lösungsalgorithmen; unter arithmetischem Faktenwissen versteht man einfache Rechnungen, welche meist vom geübten Rechner direkt aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden können (Landerl/ Kaufmann, 2008, S. 24).
Das Rechen erfolgt demnach über die semantische Repräsentation innerhalb der Zahlenverständnismodule durch Hinzuziehen von mathematischem Faktenwissen und operativen Prozessen des Rechensystems, so dass die Zahlenproduktionsmodule in der Lage sind, den korrekten Output zu liefern.
Dieses Modell heißt Single-Route- Modell, da die semantische Repräsentationsform als einzige Vorrausetzung für die Zahlenproduktion und das Rechnen angenommen wird und somit nur ein Verarbeitungsweg vom Input zum Output von Nöten ist (Jacobs/ Petermann, 2005, S. 15f).
3.1.2 Das Multi-Route-Modell
Das Multi-Route-Modell kann als Modifizierung des Single-Route-Modells bezeichnet werden und wurde von Cipolotti und Butterworth (1995) geprägt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es im Gegensatz zum Single-Route-Modell nicht nur eine Transkodierungsroute, sondern zwei Routen annimmt. Die Autoren postulieren neben den semantischen auch asemantische Transkodierungsrouten, also nicht bedeutungserschließende Routen. Demnach kann eine Zahleninformation durch die auffassenden Module aufgenommen werden und ohne, dass ihr eine semantische Bedeutung beigemessen wird, kann diese durch die ausführenden Module als Output dargeboten werden. Als Beispiel kann eine arabische Zahl über die asemantische Route zum Transkodieren direkt in das Ausgabesystem für gesprochene Zahlen weitergeleitet werden, ohne dass dabei ein Verständnis der Zahl besteht, und ihre Mächtigkeit erfasst wird.
Einer aktuellen Einzelfallstudie von Butterworth, Cappelletti und Kopelman (2001) zufolge können asemantsische Transkodierungsrouten nicht ausgeschlossen werden und müssen in die Modellvorstellungen mit einbezogen werden.
3.1.3 Das Triple-Code-Modell
Wie der Name „Triple-Code-Modell“ bereits erahnen lässt, postuliert Dehaene (1992) in diesem Modell drei mentale, autonome Repräsentationsmodelle für Zahlen. Im Gegensatz zu den bereits erläuterten Modellen erfahren die zahlensemantischen Aspekte, wie beispielsweise Schätzen, Beurteilen von Zahl- und Mengenbeziehungen und Vergleichen bei Dehaene differenzierte Betrachtung. Des Weiteren geht Dehaene nicht von einer abstrakten Repräsentation als zentrales Verbindungsstück zwischen In- und Outputsystem und Rechensystem aus.
Die Module oder auch neuronale Verarbeitungsnetzwerke sind wechselseitig miteinander verknüpft, so dass Übersetzungsmöglichkeiten zwischen diesen Modulen stattfinden können. Jedes Modul hat seinen eigenen Ein- und Ausgang, so dass ein Zahlensymbol durch die Verschaltung eines Moduls in ein anderes überführt werden kann.
In jedem Modul werden Zahlen auf unterschiedliche Art und Weise repräsentiert. Somit ergeben sich folgende drei Module:
- die visuell-arabische Repräsentation (Visual Arabic Number Form)
- die auditiv-sprachliche Repräsentation (Auditory Verbal Word Frame)
- die analoge Repräsentation von Größen (Analog Magnitude Representation)
Im ersten Modul (Visual Arabic Number) sind die Zahlen ausschließlich visuell repräsentiert. Es ist für den Umgang von numerischen Operationen innerhalb des arabischen Notationssystem zuständig, wie beispielsweise dem Umgang mit mehrstelligen Zahlen. Der Input erfolg hier durch gelesene arabische Ziffern; der Output durch geschriebene arabische Ziffern.
Im zweiten Modul (Auditory verbal Word Frame) sind die Zahlen als hör- und alphabetisch lesbare Zahlenwörter repräsentiert. Die auditiv-sprachliche Repräsentation ist für die Steuerung des Abrufs von Faktenwissens, wie beispielsweise dem Einmaleins, für Fertigkeiten wie Zählprozesse und für Zählprozeduren verantwortlich. Der Input erfolgt entweder über ein geschriebenes Zahlwort oder über eine gehörte Zahl; der Output erfolgt über eine gesprochene Zahl oder ein geschriebenes Zahlwort.
Im Modul der analogen Repräsentation von Größen werden mengen - bzw. größenmäßige Bedeutungen einer Zahl erfasst. Hierbei handelt es sich um das eigentliche Zahlenverständnis im engeren Sinne, also um die Semantik der Zahl. Das Modul der analogen Repräsentation von Größen fungiert als Basis für Größenvergleiche von Zahlen und Mengen, für das unmittelbare Erfassen von Größen oder für Schätzungen und Überschlagsrechnungen. Die Zahl ist in diesem Modul als ein ungefährer Ort auf einem räumlich-konfigurierten Zahlenstrahl repräsentiert.
Die Existenz der analogen Repräsentation von Größen begründet Dehaene mit Ergebnissen aus zahlreichen neuropsychologischen Experimenten. Vor allem konnte er drei Effekte bei erwachsenen Patienten beobachten, die für die Existenz dieses Moduls sprechen. Dabei handelt es sich zunächst um den Distanzeffekt, der besagt, dass erwachsene Personen Zahlen umso schneller hinsichtlich ihrer Größe einschätzen können, je weiter diese Zahlen auseinander liegen. Der sogenannte Größeneffekt besagt, dass die Schwierigkeit, zwei Zahlen zu vergleichen, bei gleicher Distanz dieser Zahlen steigt, je größer diese Zahlen sind. Die These des räumlich-konfigurierten Zahlenstrahls der analogen Repräsentation von Größen basiert auf der Theorie des SNARC-Effekts (Spatial Numerical Association of Response Codes). Dehaene beobachte, dass erwachsene Testpersonen schneller mit der linken Hand durch Knopfdruck rückmeldeten, ob eine jeweilige Zahl gerade oder ungerade ist, wenn diese kleiner ist, als mit der rechten Hand; und umgekehrt rückmeldeten sie bei größeren Zahlen mit der rechten Hand schneller. Diese Ergebnisse stützen die These einer in Schreibrichtung ausgedehnten mentalen Zahlenrepräsentation, an welcher sich erwachsene Personen orientieren (Jacobs/ Petermann, 2005, S. 19f; Kaufamnn, 2003, S. 26f; Born/ Oehler, 2005, S. 35f).
Laut Dehaene sind bei komplexen Mathematikaufgaben mehrere Module gleichzeitig involviert, um die notwendigen Informationen auf den jeweiligen verschiedenen Ebenen zu verarbeiten.
Eine Rechenschwäche kommt nach diesem Modell durch mindestens ein gestörtes Modul zustande. Im Laufe der kindlichen Entwicklung differenzieren sich auch die Module allmählich. Dies geschieht in der aktiven handlungsbezogenen Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. Durch Schwierigkeiten im Bereich des rechnerischen Denkens könnte die Modulreifung behindert sein, was eine Störung der Module zur Folge haben könnte und mit verantwortlich für die Entstehung einer Rechenschwäche sein könnte.
3.2 Befunde zur Lokalisation von Rechenprozessen
Bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts steht das Interesse von zerebralen Hirnarealen, welche an Rechenprozessen beteiligt sind, im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses.
Schon im Jahre 1919 verwies Henschen auf die Beteiligung des parietalen Cortex bei der Zahlenverarbeitung. Auch Gerstmann (1940) wies in zahlreichen Studien an Patienten mit Hirnläsionen auf diesen Befund hin.
Die Neuropsychologie konnte durch den raschen Fortschritt der Technologie in den letzten Jahrzehnten enorm profitieren, so dass mittlerweile konkrete Aussagen zur Lokalisation von Rechenprozessen und beteiligten Hirnarealen möglich sind. Dies ist vor allem durch bildgebende Verfahren, wie beispielsweise der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) möglich, durch die die am Lösen einer Aufgabe beteiligten Hirnregionen visualisiert werden.
Die fMRT basiert auf Messungen der Sauerstoffsättigung des Blutes, während die Probanden bestimmte mathematische Aufgaben lösen. Diejenigen Hirnareale, welche beim Lösen der Aufgabe aktiviert werden, verbrauchen mehr Sauerstoff als inaktive Hirnregionen. Auf diese Weise ist es möglich, bestimmte Aktivierungen, gezielt konkreteren Hirnarealen zuzuordnen. (Landerl/ Kaufmann, 2008, S. 44f)
Durch diesen technischen Fortschritt und den Einsatz der bildgebenden Verfahren besteht die Möglichkeit, Henschens und Gestermanns Aussage, der parietale Cortex (linke, hintere Hirnregion) sei bei Rechenprozessen beteiligt , zu verfeinern. In der aktuellen Literatur gilt nun übereinstimmend die Intaktheit des Parietallappens als Voraussetzungen für gute Rechenleistungen.
Des Weiteren propagierten Dehaene und Cohen (1995) ein Diagramm der wichtigsten, an der Zahlenverarbeitung beteiligten zerebralen Areale, bei dem beide Hirnhemisphären arabische Ziffern verarbeiten können, jedoch nur die linke Hemisphäre Zugang zur sprachlichen Repräsentation von Ziffern und zum verbalen Gedächtnis für einfaches arithmetisches Faktenwissen hat (Jacobs/ Petermann, 2005, S. 24).
Diese Theorie konnte 1999 mit Hilfe der fMRT durch Dehaene, Spelke, Pinel, Stanescu und Tsivkin praktisch belegt werden.
Im Folgenden sollen exemplarisch einzelne mathematische Anforderungen bestimmten zerebralen Arealen zugeordnet werden.
Die verbale Repräsentation der Zahlenverarbeitung ist weitgehendst den linken frontalen inferioren Arealen zuzuordnen. Von diesem Bereich aus werden numerische Aufgaben, wie beispielsweise Zahlwörter verarbeiten, Zählen oder das Abrufen von Faktenwissen, bei einfachen Additions- und Multiplikationsaufgaben gesteuert.
Mathematische Anforderungen, wie zum Beispiel arabische Ziffern verarbeiten, Gleich-Ungleich-Relationen, Kopfrechnen mit mehrstelligen Zahlen oder Stellenwertrechnungen werden durch die visuelle Repräsentation bearbeitet und sind vor allem den bilateralen occipito-temporalen Arealen zuzuordnen.
Zahlenvergleiche, die Verarbeitung analoger Repräsentationen, Überschlagsrechnungen sowie Schätzungen werden den bilateralen parietalen inferioren Arealen zugeschrieben.
Diese Darstellung macht deutlich, dass bei Schätzungen und exakten Rechnungen unterschiedliche zerebrale Bereiche aktiviert sind.
„ Beim Schätzen ist vorrangig der parietale inferiore Lappen beidseitig, das Cerebellum, der präzentrale sowie der dorsolaterale präfontale Cortex involviert, beim exakten Rechnen hingegen ergab sich vornehmlich eine Aktivierung des linken inferioren präfrontalen Cortex und zusätzlich ein kleiner Focus im linken Gyrus angularis. “ (Jacobs/ Petermann, 2005, S. 25)
Die bereits erläuterten Befunde zur Lokalisation von Rechenprozessen beziehen sich auf Studien mit erwachsenen Probanden. FMRT-Studien bei Kindern sind schwierig durchzuführen. Aus diesem Grund liegen nur spärlich gesicherte Erkenntnisse und oft kontroverse Ergebnisse zur Lokalisation bei Kindern vor.
Jedoch konnte von Aster (2002) in einer Studie mit neun bis zwölf-jährigen Kindern keine parietale Aktivität beim Lösen von Schätzaufgaben nachweisen. Die Aktivität der Kinder bezog sich im Gegensatz zu erwachsenen Probanden sowohl bei Schätz- als auch bei exakten Rechenaufgaben hauptsächlich auf die linken fronto-temporalen und okzipitalen Netzwerke. Auf Grund dieser Ergebnisse schließt von Aster (2003) darauf, dass Kinder in diesem Alter noch nicht in der Lage sind, auf ein parietal verankertes Netzwerk, welches für die abstrakte mentale Zahlenlinie verantwortlich ist, beim Rechnen zurückzugreifen. Es wird folglich angenommen, dass die Stärke der zahlenspezifischen Aktivierungen im Parietallappen mit dem Alter zunimmt.
Als festzuhalten gilt, dass die bisher vorgestellten Modelle für Zahlenverarbeitungs- und Rechenprozesse nur begrenzt auf Kinder und Jugendliche zu übertragen sind, da sich bei Kindern und Erwachsenen unterschiedliche Aktivierungen zeigen und ungenügend empirische Befunde zur Lokalisation bei Kindern existieren. Die erläuterten Modelle stellen das bereits fertig ausgereifte Zahlenverarbeitungs- und Rechensystem dar. Auf Grund der mangelnden Erkenntnisse in Bezug auf Kinder bleibt die Frage, welche Schritte für Kinder nötig sind, um ein ausgereiftes Zahlenverarbeitungs- und Rechennetzwerk zu entwickeln, vorerst noch ungeklärt und steht im Fokus des zukünftigen Forschungsinteresses.
4 Mathematische Grundbegriffe und der Erwerb mathematischer Kompetenzen: zentrale Aspekte und mögliche Schwierigkeiten
Im folgenden Kapitel sollen wesentliche mathematische Grundbegriffe näher erläutert und definiert sowie die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen dargestellt werden. Es wird versucht, einen globalen Überblick über die ungestörte mathematische Entwicklung zu geben und gleichzeitig häufige Hürden und Schwierigkeiten dieser normalen Entwicklung bei Kindern mit einer Rechenschwäche aufzuzeigen.
4.1 Die Zahl
Die Frage nach der Entstehung bzw. der Entdeckung der Zahlen beschäftigte die Menschheit über viele Jahrhunderte hinweg. In der Antike wurde weitgehendst die Meinung vertreten, dass Zahlen schon immer existiert hätten, und dass diese von den Menschen entdeckt und genutzt wurden. Diese Ansicht dominierte bis ins 19. Jahrhundert. Pythagoras kann als Begründer dieser geschichtlich frühen und idealistischen Position genannt werden. Im Laufe des 19. Jahrhundert setzte sich jedoch „die These des Erfindens durch“ (Moser Opitz, 2001, S. 15), wobei die Zahl als Erfindung der Menschheit dient und nützlich ist, vergleichbar mit der Erfindung des Rades oder der Glühbirne. Im Gegensatz zur idealistischen Position wurde innerhalb der empiristischen Erkenntnistheorie die Zahl als Produkt einer auf ausschließlich sinnlichen Wahrnehmungen basierende Vorstellung betrachtet. Dabei fungiert die Zahl als kognitives Werkzeug. Vertreter dieser empiristischen Erkenntnistheorie sind unter anderen John Locke, David Hume und John Stuart Mill (Maier, 1990, S. 6).
4.1.1 Der Zahlbegriff
Für die Entwicklung arithmetischer Kompetenzen ist die Festigung und Systematisierung des Zahlbegriffsverständnisses im mathematischen Anfangsunterricht unerlässlich.
Der Terminus Zahlbegriff umfasst verschiedene Zahlaspekte (Ordinalzahl, Kardinalzahl, Operator, Maßzahl, Codierungsaspekt, Rechenaspekt) wovon der Ordinalzahl- und Kardinalzahlaspekt auf Grund seiner bedeutenden Rolle der mathematischen Entwicklung im Folgenden kurz erläutert werden sollen.
4.1.1.1 Ordinalzahlaspekt
Die Ordinalzahltheorie ist auf Dedekind und Peano zurückzuführen. „Natürliche Zahlen sind definiert als eine festgelegte arithmetische Progression, die bei Eins beginnend durch wiederholte Nachfolgerbildung jede natürliche Zahl bildet.“ (Kaufmann, 2003, S. 17)
Die Erfassung des Ordinalzahlaspektes beinhaltet die Fähigkeit, die Elemente nach „zunehmender und abnehmender Größe“ zu ordnen (Piaget, zit. nach Lobeck, 1996, S. 65). Es handelt sich um die Folge der natürlichen Zahlen, welche beim Zählen durchlaufen werden (Krauthause/Scherer, 2007, S.9).
4.1.1.2 Kardinalzahlaspekt
Im Gegensatz zur Ordinalzahltheorie steht bei der auf Frege und Russel basierenden Kardinalzahltheorie der Mengenaspekt im Fokus und nicht der Aspekt der Ordnung.
„Die Kardinalzahl wird als Klasse aller gleichmächtigen Mengen definiert, wobei die Gleichmächtigkeit über die umkehrbar eindeutige Zuordnung der Elemente einer Menge auf die Elemente der anderen Menge definiert wird.“ (Kaufmann, 2003, S. 17)
Gleiche Anzahl entspricht im Sinne der Mengenbezeichnung somit der gleichen Zahl und eine ungleiche Anzahl entspricht einer ungleichen Zahl (Moser Opitz, 2001, S. 17f).
Die Erfassung des Kardinalzahlaspektes setzt die Fähigkeit der Verknüpfung von Zahlwort bzw. Zahlsymbol mit einer bestimmten Menge voraus. Das kardinale Verständnis kann als Basis für die Zählentwicklung betrachtet werden, denn es wird gezählt, um anschließend eine Menge zu bestimmen (Resnick, 1989, S, 163).
4.2 Die Zählentwicklung
Das Zählen stellt eine komplexe Fähigkeit dar, welche differente Aspekte umfasst. Diese Aspekte werden im Verlauf der kindlichen Entwicklung zu einer vollständigen Zählkompetenz integriert (Moser Opitz, 2007, S. 82).
Verschiedenen Autoren, wie beispielsweise Moser Opitz, Padberg, Krauthausen und Scherer zufolge, beginnt die Entwicklung des Zählens bereits im zweiten Lebensjahr des Kindes und durchläuft verschiedene Stadien, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen.
Nach Fuson lassen sich hierbei fünf Niveaus zusammenfassen:
1. String level
Die Zahlwortreihe wird unstrukturiert als Ganzes eingesetzt. Die einzelnen Elemente (Zahlwörter) werden als zusammengehörige Einheit betrachtet und können nicht voneinander unterschieden werden.
2. unbreakable chain level
Die einzelnen Zahlwörter können nun explizit voneinander unterschieden werden, was dazu führt dass allmählich Elemente gezählt werden können. Jedoch ist das Kind noch nicht in der Lage, von einer bestimmten Zahl weiterzuzählen, so dass jeweils bei eins angefangen wird. Erste einfache Additionsaufgaben können gelöst werden.
3. breakable chain level
Die Kinder sind nun in der Lage von einer beliebigen Zahl aus weiterzuzählen. Ebenso wird das Rückwärtszählen zunehmend beherrscht. D,urch diese erworbenen Kompetenzen sind die Lernenden nun in der Lage einfache Additions- oder Subtraktionsaufgaben zählend zu lösen. Des Weiteren sind Aussagen über Größer- Kleinerbeziehungen möglich.
4. numerable chain level
Jedes Zahlwort wird als Einheit betrachtet. Nun sind die Kinder in der Lage, von jeder beliebigen Zahl weiterzuzählen.
5. bidirectional chain level
Auf der höchsten Niveaustufe sind die Schüler in der Lage, leicht und flexibel in jede Richtung von jeder beliebigen Zahl aus weiterzuzählen (Padberg, 2007, S. 10f).
Im weiteren Verlauf der Zählentwicklung stehen das Zählen in zweier oder dreier Schritten sowie das Zählen von Objekten im Vordergrund, wozu das kardinale Verständnis nötig ist.
Gerade das Zählen in Schritten setzt eine hohe Flexibilität und die sichere Repräsentation der Zahlenreihe voraus. Das Kind verfügt hierbei bereits über die Fähigkeit, Einheiten größer als Eins zusammenzufassen. Sicheres Zählen in Schritten wird als Basis für die Ablösung vom zählenden Rechnen betrachtet und gilt somit als zentrale Voraussetzung für arithmetische Prozesse (Moser Opitz, 2007, S. 84f).
4.2.1 Hürden beim Erwerb der Zählkompetenz
Die Zählkompetenz der Schüler wird als wichtige Voraussetzung für folgende arithmetische Leistungen und Kompetenzen betrachtet. Aus diesem Grund können Defizite, Schwierigkeiten oder Probleme beim Erwerb der Zahlwortreihe bereits auf das Entstehen einer Rechenschwäche hindeuten.
Zahlreiche Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen fehlenden oder defizitären Zählkompetenzen und mathematischen Lernschwierigkeiten hin (Moser Opitz, 2007, S. 86).
Ein mögliches auftretendes Problem beim Erwerb der Zählkompetenz kann zum einen eine fehlende Eins-zu-eins-Zuordnung sein, welche in diesem Fall für diverse Zählfehler verantwortlich ist. Das Kind muss zunächst verstehen, dass jedem gezählten Objekt genau ein Zahlwort zugeordnet wird. In einem weiteren Lernschritt muss es dann verinnerlichen, dass mit dem letztgenannten Zahlwort die Gesamtheit aller bis dahin gezählten Objekte benannt wird. Verfügt ein Kind über diese Grundlage der Anzahlbestimmung nicht, sind Probleme beim Zahlbegriffserwerb zu erwarten.
Als eine weitere Hürde beim Erwerb der Zählkompetenz kann das kardinale Verständnis betrachtet werden. Schüler mit einer sich entwickelnden Rechenschwäche verfügen meist über ein einseitig ordinales Zahlenverständnis, was eine defizitäre Zahlbegriffsentwicklung zur Folge haben kann. Ein einseitig ordinales Zahlenverständnis bedeutet, dass die Kinder eine bestimmte Zahl als Rangplatz betrachten und die verschiedenen Formen, in denen eine Zahl repräsentiert sein kann, nicht verstehen. Denn jede Zahl ist ebenfalls durch andere Zahlen auszudrücken. Beispielsweise ist die 6 ebenfalls als 3+3 oder 1+1+1+1+1+1 oder als 4+2 zu denken. Um über ein kardinales Verständnis der Zahlen zu verfügen, muss der Schüler solche Zahlenrepräsentationen präsent haben und die jeweilige Zahl stets im Zusammenhang zu anderen Zahlen betrachten. Nur dann ist er in der Lage, die jeweilige Zahl zu verstehen.
Über dieses Verständnis verfügen jedoch gerade Kinder mit sich entwickelnder Dyskalkulie häufig nicht. Schüler mit einem einseitigen ordinalen Zahlenverständnis verwechseln die Menge mit dem Rangplatz. Deutlich wird das beispielsweise beim Zählen bestimmter Objekte. Der fünfte Würfel innerhalb einer Reihe wird dann vom Schüler als „fünf“ bezeichnet. Das „fünf“ jedoch alle bisher angetippten Gegenstände bezeichnet, wird dem Kind nicht deutlich. Ebenso kann dieses Verfahren häufig beim zählenden Rechnen rechenschwacher Schüler beobachtet werden. Im Zahlenraum bis 10 werden dazu häufig die Finger als Hilfsmittel genutzt. Kinder mit einem einseitigen ordinalen Zahlenverständnis weisen jedem Finger ein Zahlwort zu, vergleichbar mit einer Namensgebung. Für diese Schüler stellt die Additionsaufgabe 2+3 eine Schwierigkeit dar, da bereits die „Finger mit dem Namen 1 und 2“ „verbraucht“ sind und bei dem zweiten Summanden nicht wieder genutzt werden können. Es wird deutlich, dass diese Schüler die Zahlen nicht als Repräsentationsform für Mengen verstehen.
Es zeigt sich, dass viele typische Fehler rechenschwacher Schüler auf ein ordinales Zahlenverständnis basieren. Aus diesem Grund ist es bei einer Dyskalkulieförderung von besonderer Bedeutung, das Zahlenverständnis als Basis für arithmetische Prozesse zu entwickeln und systematisch aufzubauen (Gaidoschik, 2003, S. 28f).
[...]
[1] Die Termini Dyskalkulie, Rechenschwäche und Rechenstörung werden auf Grund ihrer nicht eindeutigen Trennung in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet.
- Arbeit zitieren
- Linda Schmitz (Autor:in), 2009, Dyskalkulie und die neuropsychologischen Grundlagen des Rechnens. Förderung einer rechenschwachen Grundschülerin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154345
Kostenlos Autor werden










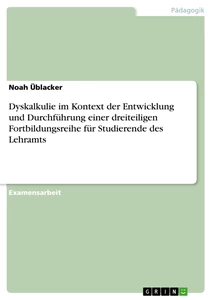









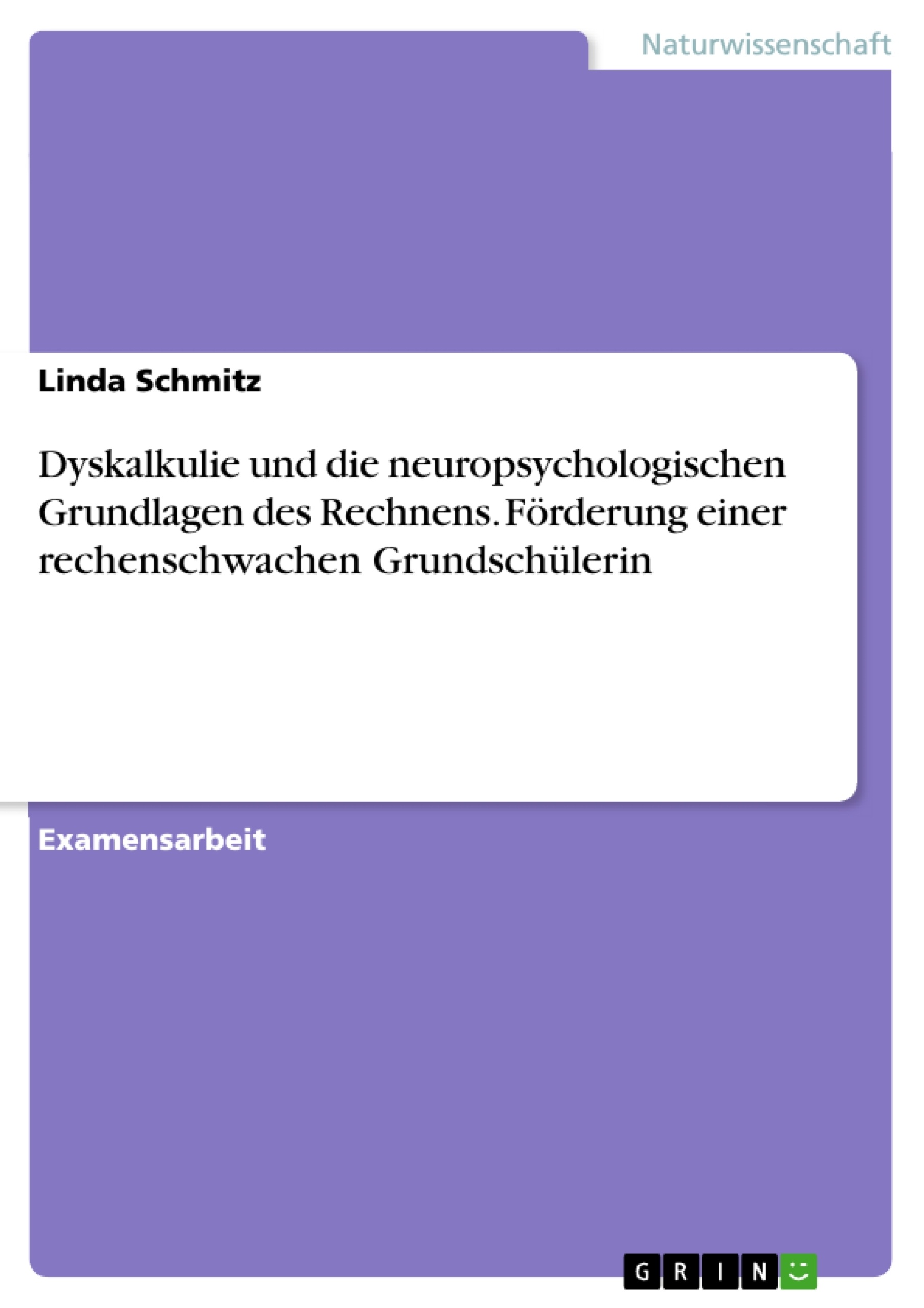

Kommentare