Leseprobe
Gliederung:
1 Einleitung
2 Begrifflichkeiten
2.1 Der Jugendbegriff
2.2 Der Gewaltbegriff
3 Stand der Forschung
3.1 Entwicklung der Jugendgewalt
3.1.1 Entwicklungen im Hellfeld
3.1.2 Entwicklungen im Dunkelfeld
3.2 Risikofaktoren
3.2.1 Gewalt in der Familie
3.2.2 Drogen und Gewalt
3.2.3 Unterschichtzugehörigkeit
3.2.4 Delinquente Freunde und Gruppengewalt
3.2.5 Lehrerreaktionen
3.2.6 Migrationshintergrund
4 Klassische Theorien abweichenden Verhaltens
4.1 Anomietheorien bei Durkheim, Merton u.a
4.2 Theorien der Subkultur
4.3 Theorien des differentiellen Lernens
4.4 Marxistische Theorien
5 Moderne Theorien abweichenden Verhaltens
5.1 Theorie der Selbstkontrolle
5.2 Rational Choice-Theorie
5.3 Routine Activity Approach
5.4 Broken-Windows-These
6 Forschungsleitende Hypothesen
7 Bivariate und multivariate Berechnungen
7.1 Beschreibung der Stichprobe
7.2 Über die logistische Regression
7.3 Berechnungen
7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
7.5 Modell-Fit
8 Zusammenfassung und Ausblick
9 Literatur
Einleitung
Vorliegende Arbeit widmet sich abweichendem Verhalten im Allgemeinen und Jugenddevianz bzw. Jugendgewalt im Besonderen. Jugendgewalt ist ein Phänomen, das in den Medien anscheinend allgegenwärtig ist. Besonders die privaten TV-Sender berichten häufiger und ausführlich über Kriminalität (vgl. Windzio/Kleimann 2006:193ff.). Spektakuläre Einzelvorfälle[1] erwecken den Eindruck, Jugendgewalt nehme stetig zu bzw. werde immer brutaler. Ganz anders lauten dazu die Ergebnisse aus der Literatur: Jugendgewalt habe im letzten Jahrzehnt stagniert oder sogar abgenommen und extreme Gewalt sei immer noch die Ausnahme.
Walter (2005:30) schildert, dass es bei der Problematisierung der Jugendkriminalität meist um einen Kriminalitätsanstieg gehe. Dies wird als Bedrohung der Gesellschaft begriffen. Walter (2005:30) zeichnet nach, dass in der öffentlichen Diskussion Jugendkriminalität oft als die typische Kriminalität schlechthin hingestellt wird. Leicht geraten die Proportionen aus dem Blick, denn die schlimmsten und größten sozialen Schäden würden nach wie vor von Erwachsenen hervorgerufen.
Die Schule soll laut Fuchs et al. (2001:10) nach der Familie ein kontrolliertes Hineinwachsen der jungen Generation in die Gesellschaft gewährleisten. Gegenüber Gewalt an so einem wichtigen Ort der Sozialisation sei die Gesellschaft daher relativ sensibel - zumindest solange es sich um Jugend- bzw. Schülergewalt handele. Viel zu wenig Beachtung fand bisher die Lehrergewalt gegen Schüler wie auch die Schülergewalt gegen Lehrer.
Die meisten Studien betrachten die Schularten Hauptschule, Realschule sowie Gymnasium. Selten werden explizit Berufsschulen untersucht. Vorliegende Arbeit widmet sich der Gewalt an beruflichen Schulen. Hier soll ein Beitrag zu Lücken im Forschungsstand geliefert werden.
Das Methodische Vorgehen stützt sich auf das vorhandene Datenmaterial von Schülerbefragungen an Münchner Berufsschulen im Zeitraum 2002 bis 2004. Die Zusammenhänge, die sich aus ersten bivariaten Untersuchungen ergaben, sollen einer multivariaten Betrachtung unterzogen werden.
Es handelt sich bei den Forschungsfragen um neun Hypothesen, die getestet werden sollen. Beispielsweise geht es um die Frage, ob eine erlittene Gewalt in der Familie die Gewaltanwendung bei Jugendlichen fördert (vgl. Kap. 6).
Methodisch kommt zur Anwendung die binäre logistische Regression. Hier hat sich zum Testen von Hypothesen insbesondere die Einschlussmethode bewährt, bei der alle unabhängigen Variablen gleichzeitig mit in die Analyse einbezogen werden.
Zur Vorgehensweise:
Zunächst sollen im zweiten Kapitel die Begrifflichkeiten dargelegt werden. Im nächsten Kapitel drei wird eine Übersicht über den Stand der Forschung geliefert. Zuerst geht es um die Entwicklung der Jugendgewalt sowohl im Hellfeld wie im Dunkelfeld. Anschließend werden Risikofaktoren, die abweichendes Verhalten fördern können, vorgestellt. Kapitel vier widmet sich klassischen Theorien abweichenden Verhaltens, während Kapitel fünf moderne Theorien behandelt. Darauf folgend werden im sechsten Kapitel die forschungsleitenden Hypothesen vorgestellt und von den Theorien abgeleitet. Kapitel sieben stellt die methodische Arbeit der vorliegenden Untersuchung dar. Es geht um die Beschreibung der Stichprobe, um Ausführungen zur logistischen Regression, die eigentlichen bivariaten und multivariaten Berechnungen, Schilderungen zum Modell-Fit sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse. In Kapitel acht schließlich erfolgen Zusammenfassung und Ausblick.
2 Begrifflichkeiten
Bevor es im Detail um das Thema Jugendgewalt geht, werden zunächst grundlegende Begriffe geklärt, die die Basis für die nachfolgenden Untersuchungen darstellen:
2.1 Der Jugendbegriff
Das Verhältnis moderner Gesellschaften zu ihrer Jugend war stets spannungsreich und ambivalent (Fuchs et al. 2001:16). Zum einen als potentielle Zukunft hochgelobt, zum andern stets als latente Gefahr gefürchtet. Dies zeige sich bereits am Begriff „Jugendlicher", mit dem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Nachwuchs der Arbeiterklasse etikettiert und stigmatisiert worden sei. Dabei schwang schon der Ruch des sich auch gewaltsam Widersetzenden mit. Ihnen unterstellte die bürgerliche Gesellschaft sozialistische Neigungen und damit staatsgefährdendes Verhalten.
Walter beschreibt, dass es im Mittelalter noch keine Jugend gab, da das Kindsein direkt ins Erwachsenensein mündete. Das 20. Jahrhundert könne man mit Sander als das „Jahrhundert der Jugend" beschreiben, da es den Jugendlichenstatus letztlich allen jungen Menschen eröffnet hat (Walter 2005:96f.).
Jugend wird mit bestimmten Zuschreibungen belegt. Damit verbinden sich gewisse Vorstellungen, wie Jugend sein soll. „Diese Vorstellungen oder Jugendimages sind Teil eines Gesellschaftsbildes und der darin umgesetzten Herrschaftsvorstellungen" (Fuchs et al. 2001:16.). Darauf gründen normative Erwartungen und Regelungen (etwa Jugendschutzgesetz), die den Rahmen für ein als angemessen definiertes jugendtypisches Verhalten bilden und ein asymmetrisches, hierarchisches Verhältnis zwischen der Erwachsenengesellschaft und ihrer Jugend definieren (ebd.).
Ideales Ziel einer jeden Erwachsenengesellschaft ist laut Fuchs et al. (2001:17) zu jeder Zeit der Erhalt der bestehenden sozialen Ordnung in der gewohnten Form. Dies wird gewährleistet durch die Sozialisation der nachfolgenden Generation im Sinne bestehender Normen und Werte.
Mit der Entwicklung der Industriegesellschaft wurde die Kontrolle der Jugend durch die Erwachsenengesellschaft schwieriger, da die Möglichkeiten für jugendliche Freiräume und damit eigenständigere Entscheidungen zunahmen (ebd.).
Gerade die eigenverantwortliche Verfügung über freie Zeit durch Jugendliche wurde sehr kritisch gesehen, da sie einen Verlust an gesellschaftlicher und familialer Kontrolle bedeutete (ebd.).
Im Kriegsführenden Kaiserreich war die Jugend in die Kriegsproduktion des 1. Weltkrieges integriert, wodurch sie einen Zugewinn an erwachsenentypischen Verhaltensweisen erlangte; dies waren die Integration in die Erwachsenenbereiche der Arbeitswelt (v.a. Schwerindustrie), das Verfügen über eigenes Geld, das Hineinwachsen in die Rolle des Familienernährers sowie die relativ autonome Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen (ebd.).
Im Kern ging der Streit darum, einen Abstand zwischen Jugend- und Erwachsenenstatus zu bewahren, indem Jugendliche von bestimmten Verhaltensweisen, die als erwachsen definiert wurden, ausgeschlossen bleiben sollten (wie bspw. der politischen Bildung, sexuellen Erfahrungen, Partnerschaften) (ebd.:18).
Die Jugendgesetzgebung der Weimarer Republik band die Kinder- und Jugendphase enger aneinander; dies wurde auch Grundlage der jungen Bundesrepublik.
„Durch die Verschärfung der Trennlinie zwischen Jugend- und Erwachsenenstatus reagierte die Erwachsenengesellschaft auf die als unangemessen empfundenen Freiräume, die die Jugend aufgrund der Integration in die Kriegsproduktion des ersten Weltkrieges erlangen konnte. (...) Der Spielraum an Optionen soll(te) begrenzt bleiben" (ebd.:18). Gesellschaftsweite Aufmerksamkeit erlangten die sogenannten Halbstarken durch Straßenschlachten mit der Polizei zwischen 1956 und 1958 vor allem in Berlin (Ost- und West-) und dem Ruhrgebiet.
Die späten 1960er Jahre brachten die Studentenunruhen und die Furcht der Erwachsenengesellschaft vor ihrer Jugend blühte erneut auf.
Walter (2005:102) schildert das soziologische Verständnis der Jugend: es gehe vor allem um die „Herstellungskomponente", die mit der Annahme von Jugend verknüpft sei. Um Jugend zu begreifen, müssten die dem Wandel unterliegenden Herstellungsprozesse analysiert werden. Es gebe die Jugend der Studenten (Studentenzeit), der Handwerksgesellen (Lehr- und Wanderjahre), nicht aber die Jugend schlechthin. Jugendzeiten würden durch die jeweilige Dauer der Schuljahre, des Wehrdienstes, durch längere oder kürzere Ausbildungszeiten u.a.m. gesellschaftlich festgelegt. Diese Determinanten seien wiederum kulturabhängig. Gegenwärtig erlebten wir verlängerte Ausbildungszeiten in Folge höherer Ansprüche (Benutzung elektronischer Geräte, Fremdsprachen, Auslandserfahrungen etc.), die die Dauer der Jugendphase ausdehnen könnten.
Tillmann stellt die Frage, womit eigentlich Forscher/innen ihre implizite Forderung begründen, die Lebenspraxis der Jugendlichen solle frei von körperlichen Auseinandersetzungen sein? Er fragt, ob das nicht vielleicht auch der Versuch sei, die Alltagskultur einer uns fremd gewordenen Jugendgeneration nach unseren akademischen Maßstäben „zivilisieren" zu wollen? (Tillmann 2004:25).
Schulz (2007:8) definiert den Jugendlichen aus juristischer Sicht: Das Jugendgerichtsgesetz definiere einen Jugendlichen als eine Person, die zur Zeit der Tat vierzehn aber noch nicht achtzehn[2]Jahre alt ist. Allerdings betont der Autor, dass auch auf Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) das Jugendstrafrecht[3]angewendet werden darf, sodass es eine starre und eindeutige Trennung zwischen den zwei Lebensphasen nicht gebe. Schulz betont allerdings, dass es keine international verbindliche Definition des Jugendzeitraumes gebe. Jugend lasse sich nicht als etwas Absolutes feststellen, das von sozialen Entwicklungen unabhängig ist. Vielmehr sei es ein historisch und kulturell verankertes Phänomen, dessen Definition dem Selbstverständnis der jeweiligen Erwachsenengeneration unterliege. Auch Schulz hält fest, dass sich der Jugendbegriff erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts etabliert habe. Zuvor sei diese Phase im menschlichen Lebenslauf nicht bekannt gewesen.
Schulz (2007:12) beschreibt die soziologischen Aspekte der Jugendphase: gemeinsam sei den soziologischen Jugendtheorien, dass das Jugendalter eine Phase des Übergangs zwischen Kindheit und Erwachsenenalter darstelle. Unterschiede bestehen jedoch in der Wertung und Erklärung dieser Lebensphase. Teilweise wird das Streben nach Verhaltenssicherheit als das Charakteristische der Jugendzeit gesehen. Teilweise aber wird der Wechsel der Orientierung von der primären Sozialisation (durch die Familie) hin zur sekundären Sozialisation (durch die Gleichaltrigengruppe/Peergroups) als das Wesentliche der Jugendzeit erachtet. Unter dem Eindruck der Jugendunruhen der 1960er Jahre wird die Jugend einerseits als Sozialisationsprodukt, andererseits auch als Schrittmacher und Faktor des sozialen Wandels betrachtet.
2.2 Der Gewaltbegriff
Bei Gewalt gestaltet sich eine einheitliche und allgemein gültige Definition als sehr schwierig. Der Grund ist, dass Gewalt eine soziale Konstruktion ist. Die Gewaltdefinition ist interessenabhängig und weist weite Ermessensspielräume auf (Fuchs et al. 2001:88).
Gewalt bedeutet für Fuchs et al. (ebd.) auf jeden Fall, dass mit einem Handeln Zwang angewendet wird (gegen Personen oder Sachen[4]). Gewalt stellt somit einen Moment der Macht dar, eine „Jedermanns-Handlungsressource", die zur Durchsetzung des eigenen Willens auch gegen Widerstand eingesetzt werden kann (ebd., vgl. Weber 1980).
„Was Gewalt ist, ist sehr wesentlich eine Frage der (inter-)subjektiven und kulturspezifischen Wahrnehmung" (ebd.:89). „Die Qualität einer Handlung als Gewalt besteht nicht unabhängig vom sozialen Kontext, sondern ergibt sich aus der Interpretation durch den bzw. die Handelnden selber und durch mittelbar sowie nicht beteiligte Dritte. Damit ist Gewalt eine soziale und kulturelle Konstruktion" (ebd.).
Wetzels et al. sehen Gewalt in Anlehnung an das Strafrecht als „die unmittelbar gegen Personen gerichtete und von Personen ausgeübte illegale, d.h. strafrechtlich relevante, physische, mit Schädigungsabsicht ausgeführte Drohung mit oder Anwendung von Gewalt" (Wetzels et al. 2001:51).
Gerade für die quantitative empirische Forschung sei ein verlässlicher Gewaltbegriff wichtig. Man kann zwischen einem weiten und engen Gewaltbegriff unterscheiden. Ein weiter Begriff erfasst mehr Handlungsformen, kann dazu beitragen die Gewaltwirklichkeit besser zu erfassen, steigert aber das Gewaltaufkommen bereits dadurch und birgt damit das Risiko, Gewalt zu überschätzen. Möglicherweise werden bei Schulgewalt unter Anwendung eines weiten Gewaltbegriffs Handlungen mit einbezogen, die von den Schülern nicht als Gewalt gesehen werden. Diese Gefahr besteht, da Erwachsene gewaltsensibilisierter sind als Jugendliche (ebd.:90). „Das Risiko der Überzeichnung von Trivialhandlungen zur Gewalt besteht durchaus und muss beachtet werden" (ebd., vgl. auch Autrata 2003:35f.).
Für die Beschränkung auf einen engen Gewaltbegriff spreche eine relativ gute Operationalisierbarkeit. Ein zu eng gefasster Gewaltbegriff, der sich auf physische Gewalt reduziert, hat aber den Nachteil, dass möglicherweise Handlungen, die in jeweiligen sozialen Kontexten als Gewalt erfahren werden, nicht betrachtet werden; der Forschungsgegenstand verengt sich. Gewalt wird unterfasst (ebd.:90f.). „Ein enger Gewaltbegriff bedeutet konkret, die subtileren Formen der psychischen und/oder verbalen Gewalt nicht mehr als Gewalt im eigentlichen Sinne zu betrachten (vgl. Heitmeyer 1992: 109)" (Fuchs et al. 2001:88, vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2006:63).
Viele Autoren lösten laut Krumm (2004:65) das Definitionsproblem, indem sie Gewalt ohne Erläuterung mit einer Serie von Fragen operationalisierten. Diese zeigten dann, dass sich fast alle Autoren an einem weiten Gewaltbegriff orientierten.
Nach Neidhardt (1997) und Popitz (1986) sei Gewalt eine „Machtaktion", die zur „absichtlichen körperlichen Verletzung anderer" führt (Fuchs et al. 2001:91). Soziologische Begriffsbildung könne nur idealtypisch erfolgen. Das heißt, es besteht das Risiko, ein zwar gut operationalisiertes Konstrukt erstellt zu haben, das dem Gewaltkonzept des Forschers entspricht, aber eventuell die Lebenswirklichkeit der Beteiligten nur ungenügend abdeckt (ebd.). Der enge Gewaltbegriff wäre im Sinne von Max Weber ein idealtypischer Grenzbegriff.
Weite Teile der quantitativen empirischen Forschung der 1990er Jahre arbeiten mit einem weiten Gewaltbegriff; so auch Fuchs et al. (2001:92). Gewalt besteht bei den Autoren aus vier Elementen:
- Physische Gewalt (Schädigung durch körperliches Einwirken gegen andere Schüler oder Lehrer)
- Psychische Gewalt (psychischer Druck, Nötigung, Erpressung)
- Verbale Gewalt (verbale Aggressivität, Beleidigen, Herabwürdigen, Beschimpfen)
- Gewalt gegen Sachen (Beschädigen oder Zerstören von Gegenständen)
Gewalt sei darüber hinaus soziales Handeln und mache für den Handelnden Sinn (ebd.:94). Gewalt kann sozial erlernt und durch positive Verstärkungen gefördert werden. Weil Gewalt sozial erlernbar ist und durch die Sozialisation vermittelt wird, kann sie auch über die Erfahrungen in der Familie sozial vererbt, d.h. über Generationen weitergegeben werden. Bereits Durkheim hatte festgestellt, dass Abweichung normal sei. Fuchs et al. stellen sich die Frage, bis zu welchem quantitativen Ausmaß Gewalt noch normal sei. Man könne davon ausgehen, dass es in jeder Gesellschaft ein gewisses Ausmaß an Devianz geben werde. Eine Größenordnung von 3% betrachten die Autoren als einen durchaus akzeptablen Wert (ebd.:99). In der polizeilichen Kriminalstatistik hätten in den letzten 50 Jahren die dort definierten Gewaltdelikte (Tötungen, Vergewaltigungen, Raub, Körperverletzung) niemals die Grenze von 2,5% aller Delikte überschritten. Dies war aber nicht immer so niedrig. Man kann von der Erkenntnis ausgehen, dass jede Gesellschaft und jede Zeit offenbar spezifische Abweichungs- und Gewaltbelastungen besitze. Man könne davon ausgehen, dass ein Ausmaß von weniger als 3% als normal und üblich, jedenfalls nicht zu hoch zu bezeichnen wäre (ebd., vgl. auch Walter 2005:28, 223).
Walter (ebd.:28) zeigt auf, dass ein „finaler Siegeszug" gegen die Kriminalität nicht erwartet wird, was darin zum Ausdruck kommt, dass die Justizbeamten zu Bediensteten auf Lebenszeit berufen werden.
Wenn man als interkulturellen Vergleich die USA heranzieht, dann erscheint das Gewaltmaß in Deutschland als ausgesprochen gering.
In manchen Kulturen können auch gewaltförmige Handlungen Jugendlicher eingefordert werden, bspw. die Verteidigung der Ehre eines Mädchens.
Gewalt ist ein jugendtypisches und passageres Phänomen, das verstärkt in der Altersgruppe der Jugendlichen (14-17 Jahre) auftritt (Fuchs et al. 2001:111; Wittenberg 2007:147; Marx 2001:24; Boers 2007:9; Boers/Walburg 2007:83f.)".
Zum vorübergehenden Charakter der Jugendgewalt halten Wetzels et al. (2001:60) fest: „In vielen Fällen delinquenten Verhaltens Jugendlicher in Gruppen handelt es sich nicht um persistente, sondern um vorübergehende delinquente Episoden, um eine Form des in einer Gruppe eingebetteten und dort verstärkten oppositionellen Verhaltens, das nach Durchlaufen der Statuspassage in das Erwachsenenalter nicht mehr nötig ist und aufgegeben wird".
An dieser Stelle wird auch die abhängige Variable „Jugendgewalt" näher spezifiziert. Dies bedeutet, dass als Jugendgewalt die Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen betrachtet werden, nicht jedoch verbale Gewalt. Letzterer Aspekt wird zu Gunsten einer genaueren Definition weggelassen. Mit Nunner-Winkler (2004) kann man argumentieren, dass verbale Gewalt immer auch vom Opfer abhängt, ob dieser sich beleidigen lässt oder die Attacke an sich „abprallen" lässt. „Der zentrale Unterscheid zwischen verbaler Aggression und physischer Gewalt lässt sich somit präzise bestimmen: Den Erfolg einer physischen Gewalthandlung kann der (starke) Täter alleine sichern, für das Gelingen psychischer Verletzungen hingegen ist ein (wie auch immer eingeengtes) Mitspielen des Opfers unerlässlich". Zudem sei das Messen körperlicher Gewalt gegen Personen viel genauer, da man dies klar und eindeutig feststellen kann; es reicht, die Gewaltauswirkung des Täters zu erheben und zu analysieren.
3 Stand der Forschung
3.1 Entwicklung der Jugendgewalt
Empirisch gesicherte Erkenntnisse über die Gewaltentwicklung an Schulen war bis Mitte der 1990er Jahre aus methodischen Gründen nicht möglich, da praktisch alle Untersuchungen Querschnittserhebungen waren. Eine methodische Hilfskonstruktion sei es gewesen, Lehrer und Schulleiter als Experten zu befragen (Fuchs et al. 2001:37).
3.2.1 Entwicklungen im Hellfeld
Wetzels et al. halten zum Hellfeld und speziell zu Gewaltdelikten zunächst fest: „Die Gewaltdelikte haben einen sehr geringen Anteil am Gesamtkriminalitätsaufkommen. In München handelte es sich 1988 bei 2,5% aller Verdachtsfälle um Gewaltdelikte, 1998 war dies bei 3,2%[5]der angezeigten Delikte der Fall. Dies deutet auch an, dass sich die Gewaltkriminalität von der allgemeinen Kriminalitätsentwicklung abgekoppelt hat. So ist für die Zeit von 1988 bis 1998 bei der Gewaltkriminalität ein Anstieg von 35,5% festzustellen" (Wetzels et al. 2001:21).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bundesweit sei festzustellen, dass sich die Opferbelastung durch Gewaltdelikte (i.e. gefährliche u. schwere Körperverletzung, Raub-, Sexual- sowie Tötungsdelikte) bei Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) in der Zeit seit 1984 mehr als verdreifacht habe (Wetzels et al. 2001:25, vgl. obige Grafik). Weiter heißt es: „Das polizeilich registrierte Risiko der Jugendlichen, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden, hat sich in München zwischen 1988 und 1998 um den Faktor 3,1 erhöht" (Wetzels et al. 2001:27).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Tatverdächtigenziffer der Heranwachsenden (18- bis unter 21 Jahre) sei in München zwischen 1984 und 1998 um 85,6% angestiegen. Bei den Jugendlichen sei demgegenüber in dieser Zeit ein wesentlich stärkerer Anstieg zu verzeichnen, der bei 263,9% liege. Bei beiden Altersgruppen sei der Höchststand jedoch bereits 1997 erreicht worden (Wetzels et al. 2001:36, siehe obige Grafik).
Zur Problematik der statistischen Trennung von deutschen und nichtdeutschen heißt es bei Wetzels et al. (2001:37): „Die Polizeiliche Kriminalstatistik ermöglicht zwar eine Differenzierung der Tatverdächtigen nach ihrer Staatsangehörigkeit insoweit, als dass deutsche und nichtdeutsche Tatverdächtige getrennt ausgewiesen werden können. Ein direkter Vergleich zwischen Deutschen und Nichtdeutschen ist jedoch unzulässig, da eine ganze Reihe von Verzerrungsfaktoren dazu führen, dass die TVZ der Nichtdeutschen artifiziell überhöht ausfällt. Hier wären beispielsweise die a priori unterschiedliche Altersstruktur, die unterschiedliche Wohnsituation und die schlechtere wirtschaftliche Lage zu nennen“.
Der enorme Anstieg der Jugendgewalt bis 1997 kann laut Wetzels et al. auch auf einen Wandel des Anzeigeverhaltens der Opfer und auf Veränderungen der Ermittlungsaktivitäten zurückgeführt werden. Mansel und Hurrelmann (1998) sprechen von einem „sich selbst verstärkenden Regelkreis medialer Problemkonstruktion und öffentlicher Sensibilisierung", was eine besonders starke Zunahme bestimmter Delikte suggerieren kann (Wetzels et al. 2001:41).
Als weitere Möglichkeit neben den oben genannten Statistiken der Polizei, die Gewaltentwicklung im Hellfeld zu untersuchen, verwenden Baier et al. (2009:92) die Daten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu sogenannten „Raufunfällen" an Schulen, bei denen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden musste (vgl. auch Fuchs et al. 2001:29). Es handele sich dabei um Hellfelddaten, bei denen das Anzeigeverhalten keine so zentrale Rolle spiele: die Meldungen werden nämlich durch die Schulleiter durchgeführt, um versicherungsrelevante Fälle zu berichten. Da eine solche Meldung eine versicherungsrechtliche Obliegenheit sei, deren Nichterfüllung für die betreffende Schule zu Schadenersatzansprüchen führen kann, sei zu vermuten, dass entsprechende Vorfälle seit 1993 nahezu lückenlos gemeldet worden seien. Die Daten über derartige Raufunfälle erscheinen Baier et al. damit als ein „valider Indikator zur Beurteilung der Entwicklung der Gewalt an Schulen".
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Häufigkeit derartiger Raufunfälle hat seit 1997 deutlich abgenommen (siehe obige Grafik). Die Gesamtzahl der Fälle ist zwischen 1997 und 2007 um 31,3% zurückgegangen. Ein guter Indikator möglicher qualitativer Veränderungen sei die Feststellung der Unfallkassen zur Entwicklung der Häufigkeit der Raufereien unter Schülern, die mit einer Fraktur bei einem der Beteiligten geendet hat. Die Daten zeigen laut Baier und anderen, dass von einer „Zunahme der Brutalität unter Schülern nicht die Rede sein kann". Im Gegenteil ging zwischen 1997 und 2007 die Zahl der Körperverletzungen mit Frakturen (z.B. Nasenbruch, Rippenbrüche) von 1,6 auf 0,9 pro 1.000 Schüler zurück. Dank dieser relativen Abnahme um 44% habe der Anteil der schulischen Raufunfälle mit Frakturen von 10,3% aller registrierten Vorfälle auf 8,3% abgenommen (vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2006:354, 390).
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bietet die einzige Möglichkeit, Entwicklung im Bereich der Kriminalität über lange Zeiträume zu betrachten. Die PKS dokumentiert alle der Polizei bekannt gewordenen Straftaten und die ermittelten Tatverdächtigen. Seit 1993 gibt es eine bundesweite Statistik. Baier et al. (2009:19) konzentrieren sich auf die Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ), d.h. die Zahl der Tatverdächtigen pro 100.000 Personen einer Altersgruppe.
Abbilduug 2.1: Entwicklung der Tatverdächtigenbelastungszakl für alle Delikte (links) und Gewaltdelikte (rechts) in der Bundesrepublik seit 1993 (in %; T\ BZ von 1993 = 100)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Baier et al. 2009:20
Für Jugendliche ergibt sich für 1993 eine Zahl von 6.279 von 100.000 Personen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die wegen mindestens eines kriminellen Verhaltens polizeilich registriert wurden; 1998 waren es 8.195, der höchste Wert für den betrachteten Zeitraum. Im Jahr 2007 liegt die TVBZ bei 7.614, was deutlich über dem Wert von 1993 liegt, aber ebenfalls deutlich unter dem Höchstwert von 1998.
Es wird deutlich, dass für Kinder der deutlichste Anstieg der TVBZ vorliegt. Zudem werden alle Altersgruppen - außer den Erwachsenen -seit den letzten 15 Jahren häufiger als Tatverdächtige in den Statistiken geführt (siehe obige Grafik).
Zu einer zurückhaltenden Bewertung der auf der PKS basierenden Anstiege der Jugendgewalt gelangen Baier et al. (2009:25), indem sie nicht die Tatverdächtigen, sondern die Statistiken der abgeurteilten und verurteilten analysieren (Abbildung unten).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Baier et al. 2009:25
Bis 1998 steigt sowohl die Belastungszahl, als auch die Abgeurteilten- und Verurteiltenzahl. Nach 1998 steigt hingegen vor allem die TVBZ an. Zur Abgeurteilten- und Verurteiltenzahl zeigt sich nur noch eine moderate Zunahme. Dies lege die Folgerung nahe, dass der Anstieg der TVBZ eher auf minderschwere Delikte zurückgehe, die dann im weiteren Verlauf der Strafverfolgung mit informellen Sanktionen und der Einstellung des Verfahrens geregelt werden. Die Ermittlungsverfahren werden bei einer seit 1998 nur gering steigenden Anzahl an Tatverdächtigen mit einem rechtskräftigen Urteil abgeschlossen. „Die Gerichte gleichen offenbar damit aus, dass ein beachtlicher Anteil der angezeigten Jugendgewalt nur geringe Tatschwere aufweist" (Baier et al. 2009:25, vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2006:399).
Zu diesem Sachverhalt passt auch unten stehende Grafik:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur Schilderung der verschiedenen Filterungsprozesse eines potentiellen Delikts siehe Bundesministerium der Justiz 2001:8ff..
Baier et al. (2009:42) schätzen, dass insgesamt 24% der Gewaltdelikte zur Anzeige kommen. Dabei gibt es jedoch größere regionale Unterschiede. So gebe es einige Städte und Landkreise mit Anzeigequoten von 35 bis 40% und höher und andere mit Quoten von 10 bis 15%. Daneben gibt es ein Stadt-Land-Gefälle: in Groß- und Mittelstädten sei die Anzeigebereitschaft ausgeprägter als in Landkreisen.
Walter (2005:223) stellt fest, dass die theoretische Bedeutung der Dunkelfeldforschung inzwischen weit über die Überlegungen zur Schichtabhängigkeit (vgl. Kap. 3.2.3) der registrierten Kriminalität hinausgehe. Die Fragestellungen zum Dunkelfeld thematisierten fast von selbst die Aussagekraft sowie Verzerrungsmomente der registrierten Kriminalität im Hellfeld (z.B. hinsichtlich einer höheren Kriminalität in Norddeutschland, die im Dunkelfeld nicht vorzufinden sei). Eine Konstanz oder Anstiege bei der registrierten Kriminalität könnten nunmehr nicht mehr ungeprüft als objektive Gefährdungsmomente begriffen werden. Stets bleibe zu klären, wie sie vor den Entwicklungen des Dunkelfelds ausfallen. Hinter rückläufigen Anzeigen kann eine Zunahme der betreffenden Taten stehen, während umgekehrt ein deutlicher Anstieg in der Kriminalstatistik lediglich auf eine Zunahme der Anzeigebereitschaft - etwa in Folge veränderter Versicherungsbedingungen - beruhen mag[6](vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2006:354). Es sei ein Bedarf an regelmäßigen Dunkelfelderhebungen entstanden, welche die Analyse von Trends ermöglichten. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, dass auch die Dunkelfeldforschung trotz inzwischen ausgefeilter Befragungsmethoden kein „Foto der Wirklichkeit" biete.
Schulz berichtet, dass auf Grund der hohen Abhängigkeit[7]der Polizei von Informationen und Anzeigen durch die Bevölkerung, die registrierte Kriminalität fast als direkte Funktion des Anzeigeverhaltens beschreiben lasse (Schulz 2007:20).
3.1.2 Entwicklungen im Dunkelfeld
Das Dunkelfeld wird von Walter (2005:220) begriffen als Anteil der nicht offiziell bekannt gewordenen Delikte, von der man die Aufklärungsquote abgrenzen kann. Letztere geht von den bekannt gewordenen Straftaten aus und benennt den Anteil, für den zumindest ein Tatverdächtiger ermittelt wurde. Die Zäsur zum Hellfeld liege also beim Prozess des BekanntWerdens oder der Registrierung eines Delikts. Die Dunkelfeldforschung beziehe sich auf die Erfassung von realen Verhaltensweisen, die kriminalisierbar gewesen wären. Die Hauptschwierigkeit sieht Walter (ebd.:221) darin, dass bei einer Dunkelfeldbefragung als Täterbefragung Amateure einen hypothetischen Registriervorgang, bei dem sie selbst die Beschuldigten sind, vornehmen müssten. Registriert werde damit nicht wie sonst seitens der Polizei, sondern über den Erhebungsbogen durch den jeweiligen Forscher. Das Unternehmen könne nur gelingen, wenn den Amateuren das rechtlich Relevante verständlich gemacht werden kann, die Befragten sich genügend erinnern und wahrheitsgemäß antworten (vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2001:14f.).
Bei der Erforschung der Jugendgewalt hat sich in der Praxis die Methode der Selbstauskünfte der Täter bewährt (vgl. Fuchs et al. 2001:27). Auch Fuchs et al. (2005) haben sich auf diese Weise dem Thema genähert; sie haben eine Trenduntersuchung der Jahre 1994 und 1999 im Jahr 2004 fortgesetzt. Diese Methode der Selbstberichte bietet vielerlei Vorteile hat aber auch Nachteile; zu letzterem gehört, dass es sicher eine gewisse Anzahl von Schülern gibt, die bei der Beantwortung der Fragen ihr eigenes Täterhandeln im Sinne einer sozialen Erwünschtheit versuchen werden herunterzuspielen. Andererseits kommt es vor, dass Teilnehmer sich in Szene setzen wollen und so kleinere Taten übertreiben werden (vgl. Fuchs et al. 2005:71). Diese Messfehler können laut Fuchs et al. kaum eingeschätzt werden. Nichtsdestotrotz gehen die Autoren davon aus, dass „die Qualität der Daten zur Häufigkeit der selbst ausgeübten Gewalt vergleichsweise hoch ist und die Informationen als valide Beschreibung der Situation an bayerischen Schulen im Frühjahr 2004 dienen können" (ebd. f.). Zur Validität von Selbstauskünften siehe Köllisch/Oberwittler (2004).
Die Autoren um Fuchs stellen fest, dass das Beschimpfen eines Schülers die am häufigsten vorkommende Gewalthandlung ist; dies hatten mehr als die Hälfte der Schüler im laufenden Schuljahr selten bis sehr oft getan. An zweiter Stelle folgt mit 45,6% das Item „mit der Clique laut über eine andere Clique herziehen", was ebenfalls eine verbale Gewaltform darstellt. An dritter Stelle steht ein Phänomen, das der physischen Gewalt gegen Mitschüler zuzurechnen ist: 36,9% haben einen Mitschüler selten bis sehr oft geschlagen, der sie zuvor provoziert hatte. Auf dem vierten Platz steht das Anmachen einer Mitschülerin, was rund 19% zugegeben haben, es im Schuljahr mindestens einmal gemacht zu haben.
Nach dieser Gegenüberstellung halten die Autoren fest: „Schwerwiegende Gewalthandlungen an bayerischen Schulen, die auch strafrechtlich zu ahnden wären, kommen so gut wie nicht vor" (Fuchs et al. 2005:73). Hier wäre zu nennen, dass lediglich 2,7% der Schüler einen anderen Schüler mit der Waffe bedroht hatten. Die Erpressung eines Mitschülers haben nur 2,5% der Befragten angegeben.
Im Vergleich der drei Erhebungszeitpunkte 1994, 1999 und 2004 stellen die Autoren fest, dass die Gewalthäufigkeit im Jahr 2004 geringer sei als 1999 und 1994. Bei den allermeisten Items sei eine monoton sinkende Gewalthäufigkeit zu verzeichnen; die höchste Gewaltbelastung fand 1994 statt, gefolgt von einem leichten Rückgang 1999 sowie nochmals geringeren Werten 2004 (Fuchs et al. 2005:77).
„Insgesamt gesehen überwiegt also der leichte Rückgang der Gewalthäufigkeit auf bereits niedrigem Niveau in den Vorjahren" (ebd:79).
Den Autoren zu Folge kann das Bild, das in den Medien über Jugendgewalt vermittelt wird (immer mehr Jugendgewalt, immer jüngere Täter) widerlegt werden. Die Rede von amerikanischen Verhältnissen an deutschen Schulen sei unzulässig, so Fuchs et al. (2001:31).
Später stellen Fuchs et al. fest: „(b)ei allen vier Gewaltformen[8]ist das Gewaltniveau sichtbar und statistisch signifikant unter dem Gewaltniveau der vorangegangenen Messzeitpunkte angesiedelt" (Fuchs et al. 2005:82).
Die Autoren stellen für Berufsschulen einen besonderen Rückgang der Gewalthäufigkeit fest: es geht um die sichtbare Reduktion der physischen Gewalt von 0,9 Indexpunkten 1994 auf 0,7 in 1999 bis auf 0,6 in 2004. Auch für die Gewalt gegen Sachen konstatieren Fuchs et al. einen „geradezu dramatische(n) Rückgang der Gewalthäufigkeiten an Berufsschulen": es handelt sich um 0,8 Punkte in 1994, 0,6 in 1999 sowie 0,4 Punkte in 2004.
Fuchs et al. halten fest: „Insgesamt lässt sich also feststellen, dass mit wenigen Ausnahmen das Gewaltniveau auf breiter Front und in allen Schularten zurückgegangen ist" (Fuchs et al. 2005:85).
Neben der oben vorgestellten Tätersicht kann man ergänzend auch die Opfersicht zur Analyse der Gewalt an Schulen heranziehen. Diese Betrachtungsweise sei „ein wichtiges Korrektiv zu den bereits diskutierten, mit Unter- und Übertreibungen behafteten Selbstauskünften zur eigenen Täterschaft" (ebd.:87). Man kann also von der Häufigkeit der Opferschaft auf die Häufigkeit des Auftretens von Gewalt schließen, sowie die „Täter-OpferKoinzidenz" ermitteln. Der Literatur nach seien viele Täter auch gleichzeitig Opfer von Gewalttaten. Es fällt den Autoren zu Folge jedoch auf, dass „die überwiegende Mehrzahl der Schüler kaum von derartigen Gewalthandlungen betroffen ist" (ebd.:87). „Bei sehr vielen der im Fragebogen vorgegebenen 19 Gewalthandlungen liegt der Anteil der Schüler, die angeben, niemals im laufenden Schuljahr davon betroffen gewesen zu sein, bei 90% oder mehr" (ebd.). Allerdings kommt das Beschimpftwerden relativ häufig vor: insgesamt 58,1% geben an selten bis sehr häufig beschimpft worden zu sein.
Schwere Formen physischer Gewalt komme auch aus Opfersicht selten vor: 96,6 berichten, dass sie im laufenden Schuljahr nie so geschlagen wurden, dass sie zum Arzt mussten (ebd.:90).
Auch psychische Gewalt wird selten berichtet: 2,4% seien mit einer Waffe bedroht worden; 3,2% geben an, dass mehrere Mitschüler sie gezwungen hätten, ihnen Geld oder wertvolle Kleidungsstücke zu überlassen.[9]
Fuchs et al. zu Folge bestätigen die Opferberichte die mäßigen Gewaltausprägungen aus den Täteraussagen. Interessanterweise für die vorliegende Arbeit konstatieren die Autoren, dass „die Indexwerte für Berufsschüler (.) fast so niedrig aus(fallen) wie die für die Gymnasiasten. Ferner heißt es: „Weiter können wir 2004 für alle Schularten sowohl bei der Gewalt gegen Sachen wie auch bei der psychischen und verbalen Gewalt jeweils einen signifikant geringeren Opferindexwert als 1994 und 1999 feststellen. Für die Gewalt gegen Personen lässt sich hingegen kein signifikantes Absinken konstatieren" (ebd.:95). Konkret bei den Berufsschulen bestehe ein relativ durchgängiger und auf alle vier Gewaltformen bezogener Rückgang.
Zum Alter der Opfer halten die Autoren fest: „Angesichts der geringen Deliktschwere, die wir hier im Rahmen der Gewalt an Schulen untersuchen, verwundert es nicht, dass das Maximum der Opferwerdung in der Regel bereits mit 13 Jahren erreicht wird und dann für alle vier Gewaltformen ein Rückgang der Häufigkeiten festzustellen ist. Allgemein gilt mit einigen kleinen Ausnahmen, dass die Opferhäufigkeiten 2004 für fast alle Altersjahrgänge unter den Werten von 1999 und 1994 liegen" (ebd.:96).
Baier et al. (2009:71) halten die zwei bekannten Aspekte fest, dass erstens Jungen gewalttätiger sind als Mädchen und zweitens Jugendliche mit Migrationshintergrund mehr Gewalt anwenden als deutsche (siehe folgende Grafik). Dabei fallen besonders die jungen Türken, die Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien, Nordafrikaner, Südeuropäer, Nordamerikaner und Südamerikaner auf. Am anderen Ende der Skala stehen die Deutschen und Asiaten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Baier et al. 2009:71
Als bedeutsame Ursache für die stärkere Gewalttätigkeit bei Migrantenjugendlichen führen Baier et al. die „Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen" an. Diese sind normative Orientierungen, deren kultureller Ursprung in historisch gewachsenen, sozialgeografischen Bedingungen bestimmter Herkunftsländer von Migranten liege. Besonders bei der innerfamiliären Sozialisation von Jungen werde darauf geachtet, dass sie auf den Erhalt der Ehre achten und diese ohne Zögern auch unter Gewaltanwendung verteidigen. Diese Normen würden ihrerseits selbst durch die Anwendung von Gewalt in der Erziehung vermittelt, sodass in Familien mit starken Männlichkeitsnormen tendenziell auch ein hohes Gewaltausmaß herrsche (Baier et al. 2009:71). Insbesondere Jugendliche aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien, sowie arabischen und nordafrikanischen Ländern weisen eine erhöhte Zustimmung zu Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen auf (vgl. auch Bundesministerium der Justiz 2006:425).
Fuchs et al. betonen den Unterschied zwischen der normalen und alterstypischen Jugendgewalt und die darüber hinausgehende massive Gewalt, die von einer kleinen Gruppe besonders auffälliger Schüler besteht, dem „kleinen, harten Kern". Diese kleine Gruppe sei überproportional am Gewaltaufkommen beteiligt.
Für die Zielgruppe vorliegender Arbeit halten Fuchs et al. fest: „Vor allem unter Berufsschülern ging die Zahl derer, die zum »kleinen harten Kern<< zu rechnen sind, zurück von 5,7% (55) 1994 bis auf knapp die Hälfte - 2,5% (28) - im Jahr 2004. (...) Der sinkende Anteil des kleinen harten Kerns am Gewaltvolumen geht in erheblichem Maße auf die Berufsschüler zurück" (ebd.:107).
Zusammenfassend halten die Autoren fest: „Da der kleine harte Kern von ca. 2% aller Schüler aber für grob ein Viertel aller Gewaltaktivitäten verantwortlich zeichnet, ist ihm besonderes Augenmerk in Forschung und Praxis zu widmen, zumal sich eine gewisse Vorverlagerung im Lebensalter zeigt" (ebd.:108, Herv. im Original).
Bezüglich der Methodik gibt es neben den Selbstberichten verschiedene Herangehensweisen (Fuchs et al. 2001:28). Bei einer mittelbaren Gewaltmessung werden Schulleiter, Lehrer und Schüler als Experten und Beobachter befragt. Nachteil hierbei ist, dass es sich nur um die subjektiven Betrachtungen handelt und keine Schlussfolgerungen zur Verbreitung solcher Handlungen zulässig sind. Daher sei diese Methode kein valides Instrument zur Erfassung der tatsächlichen Gewaltsituation. Ähnliches gilt für die Schüler, wenn diese zu ihren Beobachtungen über Gewalt unter Klassenkameraden befragt werden. Fuchs et al. zitieren Krumm (1997:73): „Wenn 15 Schüler von Gewalt berichten, kann es sich um einen Fall handeln".
Eine Problematik bei allen quantitativen Methoden, die mit verbalen Erhebungsverfahren arbeiten ist die Beschränktheit durch die (impliziten und nicht überprüfbaren) Realitätsdeutungen der Befragten (ebd.:30). Erhoben wird also nicht die objektive Wirklichkeit, sondern die subjektiven Deutungen der Akteure.
Der Königsweg der empirischen Sozialforschung sei laut Fuchs et al. (2001:30) das mulitmethodische Design (Triangulation).
Auch Baier et al. (2009:99) konstatieren für die Mehrheit der Jugendlichen eine positive Entwicklung der letzten zehn Jahre. Als einer der Hauptgründe nennen die Autoren Veränderungen in den Erziehungsgewohnheiten in Richtung weniger Gewalt in der Erziehung.
Baier et al. (2009:10) betonen, dass die Quote der Jugendlichen, die nach eigenen Angaben in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung mindestens eine Gewalttat begangen haben, in keinem der acht Städte zugenommen habe, sondern sie sei überwiegend sogar gesunken. Sie lag 1998/99 zwischen 17,3 und 24,9% und in den Jahren 2005-2008 zwischen 11,5 und 18,1%.
Auch bei den Mehrfachtätern (fünf und mehr Gewaltdelikte in den letzten zwölf Monaten) fallen die Ergebnisse entsprechend aus: 1998/99 Quoten zwischen 3,3 und 8,2%; 2005-2008 Quoten zwischen 3,0 und 5,0%. Nur in zwei der acht Städte sei ein leichter Anstieg der Mehrfachtäter festzustellen. Ein drastischer Anstieg der Jugendgewalt, wie teilweise in den Medien berichtet, kann nach den vorliegenden Befunden von Baier et al. nicht bestätigt werden.
Diese Befunde der Schülerbefragungen stimmen weitgehend mit den Daten der Versicherungen zur Häufigkeit von Gewalt überein: die sogenannten meldepflichtigen Raufunfälle, bei denen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, haben zwischen 1997 und 2007 pro 1.000 Schüler um 31,3% abgenommen.
Baier et al. (2009:10) machen vier Trends für das Sinken der Jugendgewalt verantwortlich. Zum einen habe die Akzeptanz von Gewalt bei Jugendlichen deutlich abgenommen. Zudem meinen Jugendliche 2005 bis 2008 weit häufiger, dass ihre Eltern, Lehrer und gleichaltrigen Freunde es missbilligen würden, wenn sie in einem Streit einen Mitschüler massiv schlagen würden. Zum zweiten sei die Bereitschaft bei den Jugendlichen angestiegen, selbst erlebte Gewalt zur Anzeige zu bringen. Damit hat sich aus Tätersicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, wegen Gewaltdelikten negativ sanktioniert zu werden. Zum dritten sei festzustellen, dass der Anteil der Jugendlichen, die in den letzten zwölf Monaten keine elterliche Gewalt erfahren haben, in allen acht Städten deutlich angestiegen sei. Viertens habe die Quote derer, die völlig gewaltfrei erzogen wurden, insbesondere in den Städten stark zugenommen, die vor zehn Jahren noch durch recht hohe Quoten von innerfamiliär geschlagenen Kindern aufgefallen waren.
Das Anzeigeverhalten der Gewaltopfer sei von einer Ausnahme abgesehen in den acht Städten im Vergleich der beiden Messzeitpunkte bei Körperverletzungsdelikten um 20 bis 50% erhöht. Diese zunehmende Verlagerung der Fälle vom Dunkelfeld ins polizeilich erfasste Hellfeld spreche dafür, dass der seit 1998 registrierte Anstieg der Jugendgewalt (+28,4%) in beachtlichem Ausmaß auf ein geändertes Anzeigeverhalten der Opfer zurückzuführen ist. Bei den Körperverletzungsdelikten übersteige die seit 1998 polizeilich registrierten Zunahmen mit einem Plus von 54% aber erheblich die Erhöhung der Anzeigebereitschaft der Städte. Dies spreche dafür, dass es in den letzten zehn Jahren zu einem realen Anstieg der Jugendgewalt gekommen sei (ebd.:11).
Walter (2005:223) geht von einer ubiquitären[10], weit verbreiteten Kriminalität im Dunkelfeld aus. Danach bedeute strafbares Verhalten bis zu einem gewissen Grade eine normale Erscheinung in industriellen Gesellschaften. Für die Jugendkriminalität habe dies eine besondere Bedeutung, weil bei ubiquitären Normverstößen, insofern sie gelegentlich bekannt werden, nicht mehr sinnvoll von „behandlungsbedürftigen Sozialisationsmängeln" ausgegangen werden könne. Wo die meisten straffällig werden, wo das „Regel-AusnahmeVerhältnis" umgekehrt sei, erscheine weniger der ubiquitäre Normverstoß als vielmehr die konsequente Normeinhaltung als erklärungsbedürftig. Boers/Walburg (2007:91) halten zur Allgegenwärtigkeit der Jugendgewalt lapidar fest: „Die Befragung bestätigt die Ubiquität leichterer bis mittelschwerer Delinquenz im Jugendalter" (vgl. auch Marx 2001:23). Hermann/Weninger (1999:759) sprechen vom Dunkelfeld im Dunkelfeld. „Wie Kriminalität wirklich aussieht weiß niemand" zitieren die Autoren Kerner (1994:924). Die große Diskrepanz von Täter- und Opferzahl weise auf Validitätsprobleme bei zumindest einem der beiden Messinstrumente hin (ebd.:764). Da es anzunehmen sei, dass in Umfragen verübte Straftaten häufiger verschwiegen würden als Opferwerdungen, würden Prävalenzraten in Abhängigkeit von der Deliktsart mehr oder weniger stark systematisch unterschätzt.
Im Folgenden widmen wir uns den Risikofaktoren, die Jugendgewalt begünstigen können.
3.2 Risikofaktoren
Die Literatur zur Jugendgewalt weist verschiedene Risikofaktoren aus, die Jugendgewalt verstärken können. Dazu zählt erlittene Gewalt in der Familie sowie Drogenmissbrauch. Die Unterschichtzugehörigkeit als Indikator für Gewalt wird dagegen kontrovers diskutiert (vgl. Mehlkop/Becker 2004). Deutlicher sind die Zusammenhänge zwischen delinquenten Freunden und der ausgeübten eigenen Gewalt. Auch wenn Lehrer wegschauen, wird Gewalt in der Schule begünstigt. Und schließlich zählt auch ein möglicher Migrationshintergrund zu den Gewalt begünstigenden Faktoren.
3.2.1 Gewalt in der Familie
Die Literatur weist auf einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Gewalterlebnissen der Schüler in der Familie und ihren eigenen Gewalthandlungen hin (Fuchs et al. 2005:109). Die Autoren machen auf einen direkt nachweisbaren Zusammenhang aufmerksam: „Gewalt in der Erziehung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewalt in der Schule kommt" (ebd.:110). Geschlagene Schüler hätten eine wesentlich positivere Einstellung zu Gewalt.
Die ökonomische Lage der Familie spiele dabei eine Rolle: durch eine ungünstige finanzielle Situation - Arbeitslosigkeit der Eltern - steigt den Autoren zu Folge das Maß an Gewaltanwendung in der Familie bzw. in der Erziehung. „Mangelt es an Kompetenzen zur gewaltlosen Konfliktbearbeitung und stehen nicht genügend soziale Netzwerkressourcen zur Verfügung, wird die Konfliktbearbeitung häufiger mit (körperlicher) Gewalt erfolgen" (ebd.: 110f.).
Auch Baier et al. (2009:55) betonen, dass Kinder aus Familien, die abhängig von staatlichen Leistungen sind, einem deutlich höherem Risiko elterlicher Übergriffe ausgesetzt seien. Dies gelte sowohl für die Kindheit wie für die Jugend und für Deutsche wie für Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Tillmann et al. rechnen Laut Fuchs et al. (2001:188) die Arbeitslosigkeit zu den konfliktbegünstigenden Strukturen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Gewalterfahrungen in der Familie steigt. Neben der ökonomischen Deprivation können aber auch die Verhaltensänderungen des Vaters (bspw. Gereiztheit) die Kinder belasten. Das Ausmaß familialer Gewalterfahrung nimmt mit der Verarmung zu.
In Familien, in denen der Vater arbeitslos ist und/oder wo die Familie auf Sozialhilfe angewiesen ist, seien die Raten elterlicher Gewalt gegen Jugendliche signifikant höher (Wetzels et al. 2001:235). Dabei fänden sich vor allem im Bereich der Misshandlung sowie der häufigen/schweren Züchtigung besonders erhöhte Raten für Jugendliche aus Familien in einer angespannten sozioökonomischen Lage (Wetzels et al. 2001:235).
Elterngewalt und die soziale Lage der Familie stehe in einem eindeutigen Zusammenhang: „Jugendliche aus Familien, die Sozialhilfe beziehen oder bei denen der Vater arbeitslos ist, berichten mit 29,6% signifikant häufiger, dass ihre Eltern untereinander gewalttätig waren. Im Vergleich dazu berichten die Jugendlichen aus Familien ohne väterliche Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfebezug nur zu 13,5% von derartigen Beobachtungen" (Wetzels et al. 2001:238).
Mit der sozialen Benachteiligung der Familien von Schülern aus den niedrigeren Bildungsstufen (vgl. Kap. 3.2.3) gehe ein erhöhtes Konfliktpotential unter den Eltern einher. Dies reduziere die Fähigkeiten von Eltern, einfühlsam und vor allem auch konsistent auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen und diese adäquat zu erziehen. Nach Mansel und Hurrelmann (1998) spiele die Inkonsistenz elterlichen Erziehungsverhaltens, das heißt dessen Nichtvorhersagbarkeit und Nichtbeeinflussbarkeit, eine wichtige Rolle für die Entstehung von Gewaltbereitschaft auf Seiten der Jugendlichen (Wetzels et al. 2001:240).
Die Gewaltanfälligkeit der Institution Familie ist strukturell bedingt und zwar durch ihre Privatheit (ebd.: 190). In diesem rechtlich geschützten Bereich mit seiner relativen Abgeschiedenheit kann sich Gewalt unbemerkt entwickeln und sich auch relativ lange halten.
Bei der Untersuchung von Gewalt im Elternhaus beschränken sich Fuchs et al. (2005) auf den engen Gewaltbegriff der körperlichen Gewalt.
Auch Schneider (1995; 1990; 1987) spreche sich bei der Untersuchung von Familiengewalt für einen engen Gewaltbegriff aus, der auf körperliche Gewalt beschränkt ist, weil dadurch Kausalzusammenhänge besser analysierbar seien (Fuchs et al. 2001:207). Diese begriffliche Begrenzung auf physische Gewalt finde sich auch in aktuellen Studien wie bspw. bei Pfeiffer et al. 1999 oder Wetzels 1997). Fuchs et al. (2001) haben sich nach der 1994er Welle auch bei der 1999er Erhebung für den engen Gewaltbegriff entschieden. Diese Vorgehensweise entspricht auch dem Vorgehen vorliegender Arbeit.
Deutsche Schüler machen seltener Erfahrungen mit Gewalt in der Familie als Nichtdeutsche: „Hier sind Differenzen bei den Durchschnittswerten bereits relativ deutlich sichtbar: Die Gewaltbelastung unter nichtdeutschen Schülern liegt fast um den Faktor 2 höher. Das gilt sowohl für Schüler als auch für Schülerinnen, trifft altersunabhängig zu, ist unabhängig von der Schulart (!) festzustellen und bleibt auch bei Kontrolle der ökonomischen Lage weitgehend bestehen" (Fuchs et al. 2005:132, vgl. auch Walter 2005:141).
Da aber ein Migrationshintergrund insgesamt nur mit 1,6% in das Modell eingehe, „bilden die festgestellten Unterschiede zwischen deutschen und nichtdeutschen Schülern bei weitem keinen wesentlichen Faktor für die Gewalt in der Familie" (Fuchs et al. 2005:136). Was die Erziehung betrifft, so bestehen durchgängig in allen Jahren hoch signifikante, aber sehr schwache Zusammenhänge zwischen der Gewaltaktivität und dem Erziehungsstil (ebd.: 136). Diejenigen, die hart, streng, manchmal ungerecht erzogen wurden, sind gewalttätiger; d.h. wer hart erzogen wurde, benimmt sich auch hart im schulischen Kontext.
„Die Gewalterfahrungen in der Familie wirken zwar nicht übermäßig stark, aber in dennoch beachtenswertem Ausmaß auf die aktive und passive Gewalterfahrung in der Schule ein, wobei der Effekt auf das Opfersein (meist) etwas stärker ausfällt als beim Täterstatus. Das bedeutet prinzipiell: Je häufiger die Kinder Opfer elterlicher Gewalt werden, desto häufiger fallen sie auch in der Schule durch Gewaltaktivitäten auf bzw. desto häufiger werden sie Opfer der Gewalt ihrer Mitschüler. Dies entspricht den bisherigen Ergebnissen der Gewaltforschung (vgl. u.a. Mansel 2001)" (ebd.: 139).
Bei der verbalen Gewalt ist dieser Effekt nur gering; verbale Gewalt kommt am häufigsten vor und findet unabhängig von der familialen Sozialisation statt. Hingegen am stärksten ausgeprägt sei der Effekt familialer Gewalt auf die schulische Gewalt bei der physischen und psychischen Form, sowohl für die Täter- wie Opferperspektive.
Die Effekte gelten für beide Geschlechter, wobei die Erklärungskraft beim Täterstatus bei den Schülern etwas ausgeprägter sei. D.h., die Gewalterfahrungen in der Familie wirken stärker auf das Gewalthandeln der Schüler - vermutlich deshalb, weil Schüler zu Hause mehr Gewalt erfahren als Schülerinnen (ebd.: 142).
Beim Opferstatus nimmt bei allen Gewaltformen die Bedeutung der familialen Gewalterfahrung mit dem Alter deutlich zu. Das Opfersein in der Schule wird umso mehr durch das Opfersein in der Familie bestimmt, je älter die Schüler werden. Der Opferstatus werde folglich zunehmend internalisiert (ebd.).
Haupt- und Berufsschüler benähmen sich gewaltfreudiger als Realschüler oder Gymnasiasten.
Schüler mit Migrationshintergrund sehen Gewalt durchgängig funktionaler und bewerten sie affektuell positiver als deutsche Schüler (ebd.:147).
Gewalt in der Familie sei die mit am weitesten verbreitete und gesellschaftlich am wenigsten kontrollierte Form von Gewalt, der ein Mensch in seinem Leben ausgesetzt sei (Fuchs et al. 2001:186). Sie sei oft eine unsichtbare Gewalt, die von der Umwelt nicht bemerkt, womöglich ignoriert oder gar toleriert wird.
Gewalt schafft Gewalt und frühe Gewalterfahrungen im Leben fördern spätere Gewaltanwendung. Je häufiger Jugendliche angaben, als Kind Opfer elterlicher Gewalt gewesen zu sein, desto häufiger treten sie im Jugendalter als aktive Gewalttäter in Erscheinung. Elterngewalt gegen die eigenen Kinder schafft zwar keinen Determinismus, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit für Jugendgewalt erheblich (ebd.:190).
Mehr Gewalt in der Familie - unter den Eltern oder gegen die Kinder - fördern die Gewaltanwendung in der Schule; die Kinder lernen Gewalt als etwas Alltägliches kennen, als Mittel zur Konfliktbewältigung und Selbstbehauptung (Fuchs et al. 2001:207). Wer bereits von seinen Eltern mehr physische Gewalt erlebt - was zum Alltäglichen werden kann - wird womöglich auch unempfindlicher gegenüber selbst erlittener Gewalt in der Schule (ebd.:212).
Elterngewalt wirkt laut Fuchs et al (2001:191) über die wahrgenommenen Elternnormen auf die Cliquennormen, da sich die Jugendlichen Cliquen wählen, deren Einstellung zu Gewalt ungefähr den normativen Überzeugungen entspricht.
Fuchs et al. räumen aber ein, dass sie die Geschwistergewalt - die möglicherweise häufigste Form innerfamiliärer Gewalt - nicht erfasst haben.
„Ein direkter Einfluss elterlicher Gewaltanwendung gegen ihre Kinder auf das Gewalthandeln der Kinder in der Schule lässt sich für bayerische Schüler zwar durchgängig und klar nachweisen, aber er ist (mit einer statistischen Erklärungskraft jeweils zwischen 2% und 4%) zunächst einmal nur sehr schwach ausgeprägt" (ebd.:214).
Fuchs et al. (2001:215) fassen zusammen: „Damit beweist sich erneut die Annahme des Gewalttransfers, hier vom sozialen Kontext >>Familie<< in den Kontext >>Schule<<".
Die gelernten Erfahrungen mit körperlicher Züchtigung tragen die Schüler dann in die Schule hinein. Wer physische Gewalt in der Familie erfährt, ist signifikant gewaltaktiver, wobei die Häufigkeit der Gewaltausübung tendenziell mit der Intensität der familialen Gewalt zunimmt (ebd.:216).
Der familiären Situation kommt auch laut Wetzels et al. eine zentrale Bedeutung zu. Die meiste Gewalt wird in und um die Familie erfahren und erlernt (Wetzels et al. 2001:55). Laut Wetzels et al. (2001:55) konnte gezeigt werden, „dass innerfamiliäre Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Delinquenz und Gewalt im Jugendalter führen".
Jugendliche, die in ihrer Kindheit Opfer von Gewalt waren, weisen deutlich höhere Viktimisierungsraten und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eigener Gewalttätigkeit auf (Wetzels et al. 2001:55).
„Im Vergleich zur Gewalt unter Jugendlichen werden die von Eltern ausgehenden Gewalttätigkeiten den Strafverfolgungsbehörden wesentlich seltener bekannt" (Wetzels et al. 2001:235). Weiter heißt es dazu: „Wir müssen insofern davon ausgehen, dass ca.
[...]
[1]Zuletzt ist das Ereignis an der S-Bahnhaltestelle München Solln zu nennen, wo zwei Jugendliche einen Mann, der sich schützend vor Kinder gestellt hat, zu Tode geprügelt haben. Ein weiterer Fall im September 2009 ist der Amoklauf eines 18-jährigen am Ansbacher Gymnasium, wo der Täter einen Lehrer und mehrere Schüler mit einer Axt verletzt hatte. Zu nennen wären auch die „U-Bahn-Schläger vom Arabellapark" in München, Spyridon L. und Serkan A. (vgl. Käppner 2009).
[2] Der Jugendliche tritt mit dem 18. Lebensjahr in die Volljährigkeit ein, womit die juristische Lebensphase des Jugendlichen abgeschlossen sei (Schulz 2007:13).
[3] „(...) wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand oder es sich nach der Art den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung gehandelt hat" (Schulz 2007:8f., 16ff.).
[4]Das auch dem Gewaltverständnis vorliegender Arbeit entspricht.
[5] Wir erinnern uns an die oben genannte Grenze von 3% oder weniger, die als normal für eine Gesellschaft angesehen werden kann.
[6]Zu den speziellen Problemen der PKS siehe Schulz 2007:22ff.
[7]Die Polizei erhalte tatsächlich in 90% aller in der PKS erfassten Fälle durch Anzeigen und Alarmierungen durch die Bevölkerung Kenntnis von dem entsprechenden Vorfall und nur in 10% der Fälle durch eigene Wahrnehmung (Schulz 2007:26).
[8]Verbale Gewalt, physische Gewalt, Gewalt gegen Sachen und psychische Gewalt.
[9]Diese zwei Items sind m.E. „komische" Operationalisierungen für psychische Gewalt - assoziiert man doch mit psychischer Gewalt mehr Aspekte wie Mobbing etc.
[10]Auch Wittenberg (2007:147) spricht von Ubiquität und Episodenhaftigkeit, und zwar im Zusammenhang von jugendlichen Ladendiebstählen.
- Arbeit zitieren
- Jácint Mekker (Autor:in), 2010, Jugenddevianz - Gewalt an Berufsschulen in München, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153452
Kostenlos Autor werden



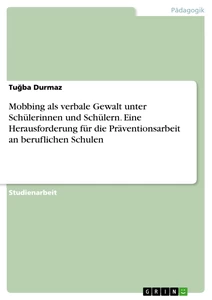


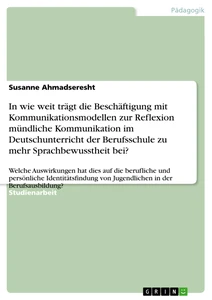








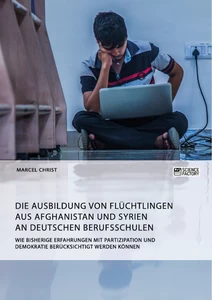






Kommentare