Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Kirche zwischen pastoraler Erststruktur und caritativer Zweitstruktur
2 Kirchliche Wohlfahrtsverbände zwischen freier Wohlfahrtspflege und Kirchenzugehörigkeit
3 Zu Anlage und Aufbau der Arbeit
1. Die notwendige Vernetzung von Diakonie und Gemeinde.
Theoretische Begründungen
1.1 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
aus der Sicht der Systemtheorie
1.1.1 Grundlinien der Systemtheorie Niklas Luhmanns
1.1.2 Kirche und Diakonie in der Systemtheorie
a) Kirche als Funktion der Religion für die Gesellschaft
b) Diakonie als Leistungen der Religion für die Umwelt
c) Theologie als Selbstreflexion des Religionssystems
1.1.3 Sicherung des Systemzusammenhalts durch Balance und Interaktion - die systemtheoretische Verhältnisbestimmung von Kirche, Diakonie und Theologie
1.1.4 Problematisierung der systemtheoretischen Argumentation
1.2 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
aus der Sicht der Praktischen Theologie
1.2.1 Der Dienst an Mensch und Gesellschaft – ein Wesenszug der Kirche und ihrer Pastoral nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
1.2.2 Der Stellenwert der Diakonie in der Pastoral nach dem Konzept der ‘Grundvollzüge’ der Kirche
1.2.2.1 Die Anerkennung von Diakonie als kirchlicher Grundvollzug - Die Entstehung des Grundvollzüge-Konzepts
1.2.2.2 Die Profilierung der Diakonie als kirchlicher Grundvollzug - Verschiedene Positionen zu Funktion und Stellenwert der Diakonie im Grundvollzüge-Konzept
a) Diakonie nach außen und Gemeinschaft nach innen (Rolf Zerfaß)
b) Gemeinschaft und Gemeinde als Urform von Diakonie (Hermann Steinkamp)
c) Der diakonische Charakter aller kirchlichen Vollzüge auf der Basis der Reich-Gottes-Praxis Jesu (Urs Eigenmann)
d) Der Vorrang der Diakonie durch die Notwendigkeit ihrer Unverzweckbarkeit (Herbert Haslinger)
e) Wechselseitige Verschränkung und Ideologiekritik von Verkündigung und Diakonie (Ottmar Fuchs)
Zusammenfassung: Einheit in der Verschiedenheit der Grundvollzüge-Konzeptionen
1.2.3 „Kirche der Armen“ als befreiungstheologisches Modell zur Integration von Diakonie und Gemeinde
1.2.4 Konsequenzen für das Verhältnis von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
1.3 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
aus der Sicht der Theorie Sozialer Arbeit
1.3.1 System und Lebenswelt als gesellschaftstheoretischer „Rahmen“ der Sozialen Arbeit bei Jürgen Habermas
1.3.1.1 Kommunikatives Handeln als Kontext der Lebenswelt nach Habermas
1.3.1.2 „Entkopplung von System und Lebenswelt“ als Verlust kommunikativer Rationalität
1.3.2 Soziale Arbeit zwischen System und Lebenswelt
1.3.2.1 Das Hilfe-Kontrolle-Theorem in der Sozialen Arbeit als Konkretisierung des System-Lebenswelt-Dualismus
Exkurs: Hilfe und Kontrolle in der Theorie Sozialer Arbeit
1.3.2.2 Soziale Arbeit: Von der Normalisierungsarbeit zur Integrationsagentur
1.3.3 Integrationsarbeit zwischen Lebensweltorientierung und Dienstleistung
1.3.3.1 Grundriß lebensweltorientierter Sozialer Arbeit nach Hans Thiersch
1.3.3.2 Grundriß Sozialer Arbeit als Dienstleistung
1.3.3.3 Komplementarität von Dienstleistungs- und Lebensweltorientierung
1.3.4 Kirchengemeinden und Diakonieverbände vor dem Hintergrund von Dienstleistung und Lebensweltorientierung
1.3.4.1 Gemeindeorientierung der Diakonieverbände als Moment einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
1.3.4.2 Diakonieverbände als Dienstleister für diakonisches Handeln in Kirchengemeinden
1.3.4.3 Diakonisierung als Konsequenz einer lebensweltorientierten Gemeindepastoral
1.3.4.4 Dienstleistung als Perspektive für die Gemeindepastoral der Hauptamtlichen
1.3.5. Kooperation und Vernetzung von Kirchengemeinden und Diakonieverbänden als Bestandteil einer lebenswelt- und dienstleistungsorientierten Diakonie und Pastoral
1.4 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
aus der Sicht der Zivilgesellschaft
1.4.1 Konzepte von Zivilgesellschaft und die Frage nach der Solidarität
1.4.1.1 Die diskursethisch begründete Zivilgesellschaftskonzeption von Jean Cohen / Andrew Arato
1.4.1.2 Solidarität als Kriterium der Zivilgesellschaft bei Günter Frankenberg
1.4.1.3 Zur Notwendigkeit einer subsidiären Solidarität für die Zivilgesellschaft
1.4.2 Der Ort von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden in der Zivilgesellschaft
1.4.2.1 Empowerment und Anwaltschaft für Benachteiligte als zivilgesellschaftliche Aufgabe der Kirche und ihrer Diakonie
1.4.2.2 Pluralität bringt frischen Wind! - Kirche mit und ohne zivilgesellschaftliche Sozialform
1.4.2.3 Kooperation belebt das Geschäft! - Die Konkurrenz von Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfe zivilgesellschaftlich aufgelöst
1.4.2.4 Resümee
1.4.3 Kooperation und Vernetzung von Kirchengemeinden und Diakonieverbänden als Bestandteil einer zivilgesellschaftlichen Verfaßtheit von Kirche und Diakonie
1.5 Plausibilität der Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
2. Die tatsächliche Kooperation von Mitarbeitern in Diakonieverbänden und Kirchengemeinden. Eine empirische Untersuchung
2.1 Methodologie und Vorgehensweise der Untersuchung
2.1.1 Bestimmung des Untersuchungsraumes und der zu befragenden Personen
2.1.2 Befragungsmethode, Entwicklung und Verwendung des Gesprächsleitfadens
2.1.3 Systematik der Interviewauswertung und -interpretation
2.2 Untersuchung des Kooperationsverhaltens auf Professionsdifferenzen zwischen den Mitarbeitern aus Pastoral- und Sozialberufen
2.2.1 Aspekte wechselseitiger Martyrisierung und Diakonisierung im professionellen Rollengeflecht
2.2.1.1 Zum Stellenwert diakonischer Arbeit in den Kirchengemeinden
2.2.1.2 Erwartungen Pastoraler Mitarbeiter an die Diakonieverbände und diakonische Kompetenz Pastoraler Mitarbeiter
2.2.1.3 Gemeindekompetenz von Diakoniemitarbeitern
2.2.1.4 Die wechselseitige Wahrnehmung der hauptamtlichen ‘Profis’
2.2.1.5 Die wechselseitige Botschaft von Diakonie- und Pastoralpersonal
2.2.2 Aspekte einer Organisiertheit der Interaktionsbereitschaft zwischen zwei ungleichen Kirchenstrukturen
2.2.2.1 Probleme struktureller Ungleichheiten zwischen den Kooperationspartnern
2.2.2.2 Feste Formen einer Kontaktinfrastruktur
2.2.2.3 Der unterschiedliche Umgang mit institutioneller Absicherung von Kooperation und Vernetzung
2.2.3 Aspekte einer lebensweltorientierten Dienstleistung für ehrenamtliches diakonisches Engagement
2.2.3.1 Unterschiedliche Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
2.2.3.2 Notwendigkeit und Problematik einer subsidiären Unterstützung Ehrenamtlicher
2.2.3.3 Sozialarbeiterische Erwartungen an Gemeinden und die Rolle ehrenamtlicher Hilfe
2.2.4 Aspekte einer Subsidiären Solidarität in der Diakonie der Kirchengemeinden
2.2.4.1 Randexistenz von Randgruppenarbeit - soziale Ausschlußmechanismen in Kirchengemeinden und Gemeindediakonie
2.2.4.2 Nicht-öffentliche und betroffenheitsbezogene diakonische Arbeit als subsidiäre Solidarität
2.2.4.3 Die tatsächliche Existenz einer gesellschaftsrelevanten subsidiären Solidarität in Kirchengemeinden
2.3 Resümee der Untersuchung: Professionsspezifische Probleme in der Kooperation zwischen Mitarbeitern in Diakonie und Gemeinde
a) Aspekte wechselseitiger Martyrisierung und Diakonisierung im professionellen Rollengeflecht
b) Aspekte einer Organisiertheit der Interaktionsbereitschaft zwischen zwei ungleichen Kirchenstrukturen
c) Aspekte einer lebensweltorientierten Dienstleistung für ehrenamtliches diakonisches Engagement
d) Aspekte einer Subsidiären Solidarität in der Diakonie der Kirchengemeinden
2.4. Konsequenzen der Untersuchung für eine kooperationsorientierte Aus- und Weiterbildung von Diakonie- und Pastoralpersonal
2.4.1 Möglichkeiten der Ausbildung von Gemeinde- und Kirchenkompetenz im Studium der Sozialen Arbeit
2.4.2 Möglichkeiten zur Ausbildung diakonischer Kompetenzen im Studium der Pastoralen Berufe
2.4.3 Möglichkeiten zur Vertiefung eines diakonischen Berufsprofils in der zweiten Bildungsphase der pastoralen Berufe
2.4.4 Möglichkeiten im Rahmen der Fortbildung pastoraler und sozialer Berufe
2.4.5 Resümee: Die Rolle von Aus- und Weiterbildung für eine professionelle Kooperation und Vernetzung
Resümee und Ausblick
Literaturverzeichnis
Leitfaden für Interviews (synoptische Darstellung)
Abstract
Kurzbeschreibung
Übersicht und Aufbau der Arbeit
Vorwort
Religion und Kirchen sind seit Jahrzehnten von Umbruchprozessen betroffen, welche bis in deren Zentren hineinreichen und diese selbst massiv verändern. Die rasanten gesellschaftlichen und technischen Fortschritte lassen religiöse Traditionen zunehmend in den Hintergrund treten bzw. verändern deren Funktion. Zugehörigkeiten und soziale Bindungen werden nicht mehr durch Traditionen herbeigeführt, sondern sind zu individuellen Gestaltungsräumen und -aufgaben geworden, womit eine Pluralisierung von Lebensentwürfen wie von Lebensdeutungen einhergeht. Die mit diesen Schlüsselbegriffen der Postmoderne skizzierten Umbrüche bieten Chancen wie Risiken, die es zu füllen bzw. zu bewältigen gilt. Religion und Kirchen finden in diesen Umbrüchen ihre Sonderstellungen relativiert und müssen sich als ein Angebot der Lebens- und Sinnbewältigung neben anderen wiedererkennen.
Die Kirchen haben auf diese Wandlungsprozesse und enormen Herausforderungen durchaus positiv reagiert. Etablierung und Ausbau neuer Seelsorgeformen sowie ein in Teilen geschärftes Bewusstsein für die eigenen Leistungsmöglichkeiten angesichts der Anforderungen und Nachfrage dürfen als Annahme der neuen Aufgaben verstanden werden. Gerade die Vielfalt kirchlicher Wirkorte hat wesentlich zugenommen: Von den traditionellen Formen der Pfarrgemeinden und kirchlichen Verbände, der Erstkommunionkatechesen und Andachten, der Wallfahrtsstätten und Klöster, der Besuchsdienste, den kirchlichen Krankenhäuser und Bahnhofsmissionen bis hin zu den jüngst sich ausformenden Seelsorgebereichen der City- oder Passantenpastoral, der Autobahnkirchen, der Kur-, Messe-, Flughafen- und Tourismusseelsorge, der Telefonseelsorge und kirchlichen Beratungsstellen, den Freiwilligen-Zentren oder Schülerorientierungstagen - das Feld scheint unüberschaubar umfangreich bzw. unüberschaubar differenziert geworden zu sein.
So erstaunlich, zeitgemäß und innovativ dies wirkt so deutlich werden an dieser Aufzählung, die letztlich nur einen kleinen Ausschnitt skizziert, auch die Problemzusammenhänge dieses Wandels der pastoralen Landschaft: Zum einen bleibt - obwohl bald nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil als überwunden gehofft - die Frage nach dem „Eigentlichen“ weiterhin virulent. Nach wie vor begegnet die Differenzierung von „Vorfeldarbeit und Kerngeschäft“, nach wie vor bezeichnet Kategorialseelsorge die „Sonderseelsorge“ im Verhältnis zur ‘normalen’ Gemeindepastoral, nach wie vor wird die Kirchenrepräsentanz von Pastoralen Mitarbeitern höher veranschlagt als die von sozialen und caritativen Berufen. Latente Festlegungen von Vor- und Nachrangigkeiten prägen unbewußt weithin die Vorgegebenheiten und Durchführungen des kirchlichen Wirkens. Zum anderen wird jüngst zunehmend der fehlende Überblick über das kirchliche Handeln beklagt und der Entwurf einer „Gesamtpastoral“, also einer übergreifenden Konzeption gefordert, in der die vielen Formen wieder zusammengeführt würden.[1] Beides hängt für meine Begriffe eng miteinander zusammen: Soll die Dualität von Vorfeld und „Eigentlichem“ wirklich aufgehoben werden, so muß die Gesamtheit kirchlichen Wirkens nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Praxis wieder stärker ins Blickfeld gerückt werden.
Der Pastoraltheologe Martin Lechner bescheinigt diesbezüglich der innerkirchlichen Realität „ein verhängnisvolles Defizit in Sachen ‘Vernetzung und Kooperation’“.[2] Die Herausforderung für das pastorale Wirken der Kirche in der Zukunft besteht infolgedessen darin, Eigenwertigkeit und gegenseitige Verwiesenheit der unterschiedlichen pastoralen Orte und Tätigkeiten miteinander in Einklang zu bringen. Miteinander vernetzte und kooperierende pastorale Orte werden aufgrund ihrer gegenseitigen Verwiesenheit und Bereichung Vor- und Nachrangigkeiten in den Hintergrund treten lassen und damit aufheben. Der Blick „über den eigenen Tellerrand“ dürfte allein noch nicht der Wahrnehmung des Ganzen gleichkommen, jedoch die Erfüllung eigener und übriger Aufgaben wesentlich verändern.[3] „Kooperation und Vernetzung“ könnte so zu einer Leitvokabel einer veränderten pastoralen Praxis werden, in der den vielfältigen und differenzierten pastoralen Angeboten im Rahmen eines größeren Ganzen Rechnung getragen wird.
Das flächendeckende Feld kirchlichen Wirkens, in dem diese Fragestellung und Problemkonstellation gewissermaßen schon Geschichte hat, stellt das Zusammenspiel von Gemeindepastoral und Caritasarbeit dar. Für diesen Beziehungszusammenhang scheint der Verlust des Gesamtblicks überdeutlich und die Wahrnehmung und Kennzeichnung desselben als „Schisma“, als Kirchenspaltung also, markiert denselben als dramatisch. Die auf beiden Seiten ausgereifte Organisationsstruktur, die Unterschiedlichkeit von Arbeitsweisen bis hinein in eine Konstellation dichotomer Berufsgruppen sowie die flächendeckende Präsenz beider Seiten bietet gerade dieses Feld ein komplexes Beziehungsgeflecht und dadurch eine spezielle Herausforderung für die Vorstellung einer Kooperation und Vernetzung beider Strukturen. Die bereits jahrzehntelangen Anstrengungen von Vertretern beider beteiligten Seiten und die flächenmäßig betrachtet vergleichsweise geringen Fortschritte machen deutlich, wie langwierig und tiefschürfend solche Veränderungsbemühungen sind bzw. sein müssen. Mitunter deshalb ist zu hoffen, daß die Kirche aus den Auseinandersetzungen in diesem Bereich für viele weitere Bereiche exemplarisch lernen kann, wie Kommunikation und Vernetzung in ihrem sozialen und pastoralen Engagement Wirklichkeit werden könnte. In diesem Horizont und in dieser Hoffnung ist die vorliegende Arbeit verfasst worden.
Einleitung
1 Kirche zwischen pastoraler Erststruktur und caritativer Zweitstruktur
In der Theologie stellte Anfang der siebziger Jahre die Rede von den „zwei leider so oft geschiedenen Schwestern Caritas und Pastoral“[4] zwar keine revolutionäre Feststellung mehr dar, markierte aber zugleich den Beginn eines Bewußtwerdungsprozesses, welcher eine sich vertiefende Kluft zwischen caritativer und pastoraler Arbeit der Kirche beobachtete und problematisierte. Der fortschreitende Verselbständigungsprozeß von Caritas und Pastoral veranlaßte knapp 20 Jahre später zu der Frage, ob denn inzwischen sogar „Caritas - eine ‘verlorene’ Dimension der Kirche?“ sei.[5]
Das Verhältnis zwischen Kirche und ihrer Diakonie oder Caritas gestaltet sich offenbar schwierig. Allerdings: Egal ob von Scheidung oder von Verlorenheit die Rede ist, beide setzen vormalige Zusammengehörigkeit voraus, und an dieser Stelle sind die beiden Zitate kritisch zu betrachten. Die Rolle von Diakonie in der Kirche ist nicht erst neuerdings in die Krise gekommen. Sie stellt sich vielmehr schon seit langer Zeit als ambivalent heraus, was ein kurzer geschichtlicher Aufriß zeigt:[6]
Bereits in den Ursprüngen der Kirche wechseln sich - etwa in der Apostelgeschichte - Berichte über eine enge Verflechtung ab mit Schilderungen über die Ausgliederung von Diakonie aus der Mitte des Gemeindelebens.[7] Die Sonderstellung der Diakonie in der Kirche wird damit bereits früh bezeugt. Sie zieht sich aber auch durch weitere Epochen der Kirchengeschichte hindurch. Im Mittelalter verlagerte sich die diakonische Arbeit der Kirche zunehmend in die Trägerschaft von Orden, so daß wiederum die kirchlichen Gemeinden wenig berührt wurden. Einen starken Impuls zur Erneuerung und Integration von Caritas in die Kirchengemeinden gab Vinzenz von Paul (1581-1660) in Frankreich mit der Schaffung von Caritasvereinen. Der Beginn der heutigen institutionalisierten Diakonie im 19. Jahrhundert (d.h. evangelischerseits die Gründung der Inneren Mission 1848 und katholischerseits des Caritasverbandes 1897) zeichnete sich selbst wiederum dadurch aus, daß er mit erheblicher Kritik an der verfaßten Kirche und ihrer pastoralen Arbeit verbunden war und damit in Distanz zu Kirche und Kirchengemeinden erfolgte. Wenn also heute das Auseinanderdriften von Kirche und ihrer Diakonie häufig den modernen Erfordernissen der Spezialisierung und Professionalisierung überantwortet oder gar angelastet wird, so muß ehrlicherweise korrigiert und darauf hingewiesen werden, daß die moderne Entwicklung hier auf entsprechenden Vorbedingungen beruht und insofern schon in einer gewissen ‘Tradition’ steht.
Aber trotzdem ist es eine besondere Situation, die sich unter den Bedingungen des bundesdeutschen Sozialstaates in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schließlich herausgebildet hat: Die Diakonie der Kirche positioniert sich in einer verbandlichen Organisationsform als wesentliche und unverzichtbare Stütze des Sozialstaates und der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft überhaupt, sie lockert aber zugleich ihre Verflechtung mit der verfaßten Kirchenstruktur. Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß die Rede von einer Teilung der Kirche in eine „gemeindliche Erststruktur“ (womit die amtskirchlich verfaßte Kirchen- und Gemeindestruktur gemeint ist) und in eine „diakonische und caritative Zweitstruktur“ (womit die kirchlichen Diakonieverbände bezeichnet werden) bereits zum praktisch-theologischen Allgemeingut gehört.
Damit haben die Kirchen in Deutschland mit ihren ‘Diakonieverbänden’ - wie ich sie im folgenden nennen werde[8] - gleichwohl eine wesentliche Grundstruktur zur Verfügung, mit der sie soziale Fragen und Aufgaben wahrnehmen, so daß auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht davon die Rede sein kann, die Kirchen würden sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen. Andererseits hat vor allem an der Kirchenbasis eine Delegation dieser Verantwortung an die professionalisierten Dienste stattgefunden, so daß Diakonie und Caritas im Bewußtsein von Kirchengemeinden überwiegend ein Rand- und Schattendasein führen.
Daß solchermaßen - überspitzt gesprochen - die Kirchengemeinden sich weitestgehend ihrer diakonischen Verantwortung ‘entledigt’ haben bzw. ihrer ‘enteignet’ wurden, wird heute in der Regel sowohl auf der Seite der Diakonieverbände als auch auf der Seite der Pastoral als wenig zukunftsfähige Perspektive eingeschätzt. Dabei artikulieren sich zugleich ein Interesse an der Identität der professionellen, institutionellen und kirchlichen Diakonie, ein Interesse an möglichst hilfreicher Unterstützung betroffener Menschen sowie ein Interesse an Aufbau und Leben kirchlicher Gemeinden. So formulieren die Kirchen in ihrem gemeinsamen Sozialwort als deren Selbstverpflichtung die Integration von Gemeinde und Diakonie als nach wie vor notwendige Grundentscheidung:
„Der diakonische und caritative Dienst an Menschen in Not gehört seit den Anfängen der Kirche zu ihren unveräußerlichen Kennzeichen und ist auch für die Zukunft verpflichtend. […] Von bleibender Bedeutung ist [dabei] die Ebene der Kirchen- und Pfarrgemeinden. Diakonische und caritative Arbeit darf sich nicht auf die professionalisierten Dienste beschränken und darf nicht einfach an sie abgegeben werden. Kirchengemeinden, kirchliche Gruppen und Verbände haben besondere Möglichkeiten, mit ihrer sozialen, diakonischen und caritativen Arbeit Impulse in die gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein zu vermitteln. […] Es ist wichtig, daß Kirchengemeinden und Verbände mit Hilfe solcher Aktivitäten die sie umgebende soziale Wirklichkeit wahrnehmen und den sozial Benachteiligten in ihrer eigenen Mitte Aufmerksamkeit schenken. Entscheidend wird sein, daß Christen und Gemeinden nicht bei einzelnen diakonischen Aktivitäten und Maßnahmen stehen bleiben. Es geht um eine ‘neue Bekehrung zur Diakonie’, in der die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen, die Hilfe nötig haben, zur Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Christen werden.“[9]
Will man die Erreichung des angedeuteten Zieles nicht dem Zufall überlassen, so ist es offensichtlich, daß es schließlich nicht nur bei der Feststellung oder Beteuerung von Notwendigkeiten, gar notwendigen Bekehrungen, bleiben kann. Vielmehr erfordert es eine Kehrtwende von einer versorgten Gemeinde nicht nur zu einer aktiven Gemeinde, sondern zu einer tatsächlich solidarischen und sorgenden Gemeinde. Gemeinde als Trägerin der Pastoral zu entwerfen und zu verwirklichen stellt hierzu einen wesentlichen ersten Schritt dar, welcher sich in den aktuellen Konzepten einer Kooperativen Pastoral vor allem auf die „aktive Gemeinde“ konzentriert. Ob die Kirchengemeinde damit auch bereits Trägerin der Sozialpastoral (also ihrer Diakonie oder Caritas) wird, ist fraglich. Dies zu konzipieren und zu realisieren ist ein notwendiger, aber zweiter Schritt, den zu gehen sich vermutlich nochmals ebenso schwierig gestaltet.
2 Kirchliche Wohlfahrtsverbände zwischen freier Wohlfahrtspflege und Kirchenzugehörigkeit
Auf Seiten der Wohlfahrtsverbändeforschung wird (sozusagen analog dazu) die Frage nach dem Proprium der einzelnen Verbände thematisiert. Der Titel einer Studie, welche der Relevanz der verbandsspezifischen Profile innerhalb der freien Wohlfahrtspflege nachgeht, pointiert und charakterisiert diese mit dem lapidaren und zugleich provokativen Ausspruch: „Wenn man die Ideologie wegläßt, machen wir alle das gleiche“.[10] Der zunehmende professionelle Standard Sozialer Arbeit und damit einhergehend die abnehmende Bedeutung idealistischer bzw. ideologischer Motivationen für die berufliche Tätigkeit in der Sozialen Arbeit führen demnach dazu, daß sich auf der operativen Ebene - d.h. des sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen, pflegerischen wie auch des administrativen und strategischen Handelns in den Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege - die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Wohlfahrtsverband augenscheinlich kaum mehr auswirkt. Die ursprünglich so bedeutsamen Wurzeln der einzelnen Wohlfahrtsverbände sei es in der Arbeiterbewegung, in der Selbsthilfebewegung oder in den beiden großen Kirchen scheinen zum antiquarischen Balast einer nach Modernität und Professionalität strebenden Sozialen Arbeit geworden zu sein.
Die aktuelle Entwicklung des Auftauchens privatwirtschaftlicher Träger und Dienstleister im sozialen wie v.a. im pflegerischen Bereich einerseits sowie andererseits der Prozeß der europäischen Einigung mit seinen Auswirkungen auch auf das deutsche Sozialstaatssystem scheinen die Erosion von (weltanschaulichen) Trägeridentitäten in der Sozialen Arbeit noch zu beschleunigen. Sind Wohlfahrtsverbände überhaupt noch ein zeitgemäßes Instrument zur Erfüllung sozialstaatlicher Aufgaben? Ist die Ko-Existenz und Konkurrenz mehrerer Wohlfahrtsverbände nicht eher hinderlich und müßte im Namen von betriebswirtschaftlicher Effektivitäts- und Effizienzsteigerung aufgegeben werden? Solche Fragen prägen durchaus die heutige Diskussionen über die Zukunft der freien Wohlfahrtspflege und ihrer Verbände in Deutschland.[11]
Gerade die kirchlichen Wohlfahrtsverbände unterliegen aber nach wie vor klar definierten Steuerungseinflüssen durch die verfaßten Kirchen, wie dies Berthold Broll in einer Analyse steuerungsrelevanter Bestimmungen nachgewiesen hat.[12] Insbesondere die Diskussionen und Streitigkeiten um die Art und Weise ‘katholischer’ Schwangerschaftskonfliktberatung in den vergangenen Jahren haben eindrücklich das Dilemma einer Sozialen Arbeit sichtbar gemacht, welche auf der einen Seite auf professionelle Standards verpflichtet und in sozialstaatliche Rahmenbedingungen eingelassen und auf der anderen Seite an kirchliche Normen gebunden und kirchlicher Steuerungsautorität unterstellt ist.
Wenn sich von daher eine Ablösung von weltanschaulichen Hintergründen und Bindungen für die Soziale Arbeit und insbesondere für deren notwendige Professionalität auf den ersten Blick als Vorteil darstellt, so beabsichtige ich in der vorliegenden Arbeit nicht weniger, als den gewagten Aufweis zu führen, daß dies keine zukunftsträchtige Perspektive ist. Dies bedeutet nun allerdings keineswegs, entgegen aller besseren Theorie und Praxis ein Ideal hochhalten zu wollen, das seinerseits sich bereits als veraltet erwiesen hätte. Vielmehr haben anerkannte Vertreter der neueren Sozialmanagement-Diskussion wie etwa Joachim Merchel darauf hingewiesen, daß die Wohlfahrtsverbände heute neben einer „Intensivierung betriebswirtschaftlicher Verfahrensweisen“ insbesondere auch vor der Anforderung stehen, „Bemühungen zur Restrukturierung ihres verbandlichen Profils unternehmen“ zu müssen[13] - letzteres selbstverständlich nicht entgegen, sondern vielmehr im Sinne verbandlicher Modernisierung. Ziel solcher Profilentwicklungen soll dabei eine Verbesserung der Wirkung des Verbandes sowohl nach außen, als auch nach innen auf die Motivation und Identifikation der haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeiter sein:
„Der Verband soll sich programmatisch und in seinem konkret erlebbaren Handeln von der Umwelt abheben und als besondere Institution identifizierbar werden.“[14]
Infolgedessen haben die einzelnen Wohlfahrtsverbände entsprechende Anstrengungen zur Herausbildung eines eigenen Leitbildes unternommen. Merchel betont dabei, daß in sozialpolitisch wie unternehmensstrategisch orientierten Angelegenheiten die Frage nach einem spezifischen Verbandsprofil tendenziell weniger bedeutsam sein dürfte, als in innengerichteten Fragen der Mitarbeitermotivation.[15] Wenn dies auf der verbandspolitischen Ebene auch kaum anzuzweifeln sein dürfte, so behaupte ich dennoch, daß insbesondere auf der Ebene sozialarbeiterischen oder pflegerischen Handelns - d.h. auf der Ebene der wesentlichen Leistungserbringung der Wohlfahrtsverbände - unterschiedliche Leitbilder zumindest in Einzelaspekten auch Unterschiede in der konkreten Praxis mit sich zu bringen vermögen, welche sich auch in ihrer Außenwirkung wiederum bemerkbar machen können.
Daraus leitet sich die These ab, welche ich zunächst theoretisch begründen und anschließend empirisch problematisieren möchte:
Die weltanschauliche Herkunft und Bindung stellt für die Wohlfahrtsverbände eine Ressource dar, deren strategische Nutzung diesen in den angedeuteten aktuellen Umbrüchen sozusagen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, aber welche diese in ihrem eigenen Interesse bislang zu wenig nutzen.
Diese These versuche ich am Beispiel der kirchlichen Wohlfahrtsverbände (im folgenden ‘Diakonieverbände’) darzulegen, da damit zugleich zwei forschungsstrategische Aspekte abgedeckt werden: Zum einen kann damit die Fragestellung vor einer allgemeinen Abstraktheit bewahrt und auf bestimmte Verbände hin konkretisiert werden; zum anderen vermag die Wahl der konfessionellen Verbände die große Mehrheit der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland einzubeziehen.
In den Leitbildern der kirchlichen Wohlfahrtsverbände - Deutscher Caritasverband und Diakonisches Werk - spielen (abgesehen von den selbstverständlichen fachlichen Standards Sozialer Arbeit) neben religiösen und theologischen Aussagen über Sinn und Deutung des eigenen Handelns („praktizierte Nächstenliebe“, „Weisung und Beispiel Jesu Christi“, „Reich Gottes“ im Leitbild des Deutschen Caritasverbandes[16]) auch Aussagen über den organisatorischen Zusammenhang mit der verfaßten Kirche eine gewichtige Rolle. Dabei kommen sowohl Aspekte der Selbstlegitimation aus und gegenüber den Kirchen zum Tragen, als auch Ansprüche gegenüber denselben. Dies spricht das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes folgendermaßen aus:
„Die verbandliche Caritas unterstützt, fördert und ergänzt … die Caritasarbeit von einzel nen, Gruppen, Gemeinschaften und Pfarrgemeinden … und stärkt deren Eigeninitiative.“
„Die Caritasarbeit in den Pfarrgemeinden ist Ausgangspunkt und Grundlage. Sie ist sowohl für das Leben der Gemeinden als auch für die verbandliche Caritasarbeit unverzichtbar.
„Deshalb pflegt die verbandliche Caritas mit den Pfarrgemeinden und mit den verschiedenen christlichen Gruppen und Vereinigungen vielfältige Formen der Zusammenarbeit.“[17]
Dieser gleichermaßen weltanschauliche wie organisationale Hintergrund der kirchlichen Wohlfahrtsverbände soll im Rahmen dieser Arbeit nun als Ressource für dieselben betrachtet werden. Dies entspricht der Einschätzung führender Wohlfahrtsverbände-Forscher, die gerade in den, die professionelle Leistungserbringung der sozialen Dienste übersteigenden, Anteilen ihrer Tätigkeit wie etwa ihres gesellschaftskritischen und sozialanwaltlichen Engagements oder ihrer Förderung informeller und ehrenamtlicher Hilfe einen wesentlichen Faktor ihrer öffentlichen Legitimation erkennen.[18] Insbesondere in der innerkirchlichen Öffentlichkeit darf dieses Potential für die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände als hoch veranschlagt werden, bedenkt man etwa allein die Wirkung jährlicher Caritas- oder Diakonie-Sonntage in den Kirchengemeinden mit ihrem inhaltlichen wie finanziellen Effekten. Gerade in der organisationalen wie professionellen Vernetzung mit den Kirchen und mit deren Gruppierungen, Gemeinschaften und Gemeinden - so die Hypothese dieser Arbeit - besteht für die kirchlichen Wohlfahrtsverbände ein bislang unzureichend ausgenutztes Potential, welches diese zu ihrem eigenen Vorteil stärker in Anspruch nehmen könnten.
3 Zu Anlage und Aufbau der Arbeit
Nachdem bislang die Fragestellung skizziert und der Horizont des Themas angerissen wurde, gilt es, die Vorgehensweise der Arbeit zu klären. Daß die Problematik zwar als solche hinlänglich bekannt, aber „in den strukturellen und pastoralen Gegebenheiten der Praxis jedoch … sich diese Neuorientierung noch lange nicht durchgesetzt (hat)“[19] stellt selbst wiederum ein Problem dar. Zwei Beobachtungen sollen dabei herangezogen werden, mithilfe derer die Herangehensweise an die vorliegende Untersuchung vorgezeichnet werden kann:
- Mir scheint, daß in den zahlreichen Publikationen zu diesem Themenkreis lange Zeit Versuche zur Verhältnisbestimmung von Caritas und Gemeinde weitgehend theologisch vorgingen und damit die ausschlaggebende Bezugsgröße der Sozialen Arbeit ignorierten.[20] Erst neuerdings nehmen Beiträge zu, in denen sozialwissenschaftliche und theologische Argumentationen als den beiden Bezugsgrößen von caritativer und pastoraler Arbeit ineinander greifen.[21]
- Mir scheint zudem, daß bislang kaum Versuche unternommen wurden, empirisch die existierenden Problemkonstellationen im Verhältnis von Caritas und Pastoral zu erforschen. Neben zahlreichen Einzelprojekten, in denen positive Erfahrungen zur Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen kirchlichen Gemeinden und Wohlfahrtsverbänden gesammelt wurden, ist der forschende Blick empirisch arbeitender wissenschaftlicher Untersuchungen ergänzend von zentraler Bedeutung, um auch die Wurzeln des Problems in Angriff nehmen zu können.
Aufgrund dieser Einschätzungen stellen sich mehrere Fragenkomplexe, die für die Behandlung des Themas „Diakonie und Pastoral“ bzw. „Diakonieverbände und Kirchengemeinden“ relevant sind:
1. Warum genau ist eine Integration von Diakonie und Gemeindepastoral sinnvoll? Wie ist sie plausibel zu machen? Was hat eine Integration von Diakonie und Gemeinde überhaupt zum Ziel?
2. Woran kranken heutige Versuche einer Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden? Welche Hindernisse gilt es zu beseitigen und welche Antworten sind erforderlich, um den Diakonieverbänden und Kirchengemeinden die Überwindung von Distanz und Differenz zu erleichtern?
Diese Fragen stellen die Grundlage der vorliegenden Arbeit dar:
Der erste Fragenkomplex bildet den Rahmen des ersten Kapitels. Darin geht es um die theoretische Begründung der notwendigen Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden. Aus unterschiedlichen Perspektiven heraus soll darin der Aufweis der Plausibilität des erhobenen Anspruchs erbracht werden. Dabei ist wichtig, daß diese Begründung nicht nur kirchenintern und theologisch verläuft, sondern auch auf die wissenschaftliche Bezugsgröße der sozial-caritativen Arbeit aufbaut. Insofern Diakonie auch als Verbindungsglied zwischen Kirche und Gesellschaft verstanden wird, gilt es zudem aus gesellschaftlicher Perspektive dieses Anliegen als sinnvoll und wichtig darzulegen. Grundlegend für all dies ist, daß auch im Zusammenhang organisations-systemischer Funktionslogik eine Begründung des Vernetzungsanspruchs als möglich und sinnvoll erscheint. Dabei laufen Begründung und die Darlegung der damit zu erzielenden Gewinne Hand in Hand, so daß die Integration und Vernetzung von Diakonie und Pastoral bzw. von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden nicht als bloßer Selbstzweck verfolgt wird, sondern daß wesentliche Orientierungspunkte und Zielperspektiven eines solchen Prozesses benannt werden und insofern zur Begründung des Anliegens entscheidend beitragen.
Der zweite Fragenbereich leitet zum zweiten Kapitel über: Wenn eine Kooperation und Vernetzung von Kirchengemeinden und Diakonieverbänden als grundsätzlich sinnvoll und anzustreben herausgestellt worden ist, so kommt man nicht umhin, danach zu forschen, worin die konkreten Schwierigkeiten derselben zu suchen sind. Es steht dabei nicht im Interesse, die historische Entwicklung zu wiederholen und zu sagen, warum die Lage so ist wie sie ist. Vielmehr geht es darum, empirisch die aktuellen Problemkonstellationen herauszuarbeiten, um sagen zu können, warum die Lage so bleibt wie sie ist - zumindest wenn man nicht aktiv dagegensteuert. Dabei wird die Fragestellung und damit das Forschungsgebiet darauf zuzuspitzen sein, inwiefern hauptamtliches Personal eine wesentliche Rolle in den Kooperationsbeziehungen und der Vernetzung zwischen Diakonieverbänden und Kirchengemeinden spielen. Insbesondere wird dabei das Augenmerk darauf zu richten sein, inwiefern die unterschiedlichen Berufe der beteiligten Mitarbeiter sich hinderlich für die Verwirklichung von Kooperation auswirken. Dabei handelt es sich nicht nur um die Analyse von Problemen und Schwierigkeiten, vielmehr gehen daraus bereits Überlegungen zur Problembewältigung hervor. Als solche Konsequenzen gilt es nach Möglichkeiten für eine Annäherung von Diakonie- und Pastoralpersonal Ausschau zu halten. Insofern Hindernisse für Kooperation und Vernetzung im beruflichen Handeln von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begründet liegen, bietet sich an, Aus- und Weiterbildungsfragen der beteiligten Berufsgruppen in Augenschein zu nehmen und hierfür praktische Konsequenzen zu skizzieren.
Mit den hier vorgelegten theoretischen wie empirischen Untersuchungen soll ein Beitrag zu einer weitergehenden Vernetzung und Kooperation im sozialen Engagement der Kirchen geleistet werden. Sie verstehen sich als Impulse für die theoretische Diskussion in den Disziplinen der Praktischen Theologie, Caritaswissenschaften und Sozialen Arbeit. Vornehmlich aber beabsichtigen sie, der Weiterentwicklung caritativer wie pastoraler Praxis in den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden und Kirchengemeinden zu dienen.
Zum Abschluß der Einleitung seien noch zwei begriffliche Hinweise gegeben:
- Ich verwende in dieser Arbeit den Begriff „Diakonieverband / Diakonieverbände“ als Oberbegriff für den Caritasverband und das Diakonische Werk einschließlich der jeweiligen Untergliederungen. Dieser Begriff erscheint mir leserlicher als die Formulierung „kirchlicher Wohlfahrtsverband“ - insbesondere bei gehäufter Verwendung. Darüber hinaus vermag „Diakonieverband“ neben kirchlicher Zugehörigkeit auch deutlicher Identität zum Ausdruck zu bringen sowie den konfessionsübergreifenden Charakter vorliegender Untersuchungen zu artikulieren.
- Hinsichtlich der Verwendung einer inklusiven Sprache gestehe ich eine gewisse Ratlosigkeit und habe mich um der besseren Lesbarkeit gegen inklusive Formulierungen entschieden. Speziell in der empirischen Untersuchung erfolgt eine Häufung des Begriffs Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen - wiederholt auch in der Kombination von pastoralen Mitarbeitern/-innen und Mitarbeitern/-innen von Diakonieverbänden, die mit inklusiver Sprache leider nicht mehr sinnvoll aufzufangen ist. Eine ersatzweise Verwendung des Begriffs „Personal“ kommt wegen des fehlenden Aspekts des handelnden Subjekts nur stellenweise in Frage. Ich bin mir bewußt, daß dies immer wieder eine Verkürzung bedeutet, und versichere, daß das jeweils andere Geschlecht ebenfalls mitgedacht ist und bitte die Leser/-innen ebenfalls darum.
1. Die notwendige Vernetzung von Diakonie und Gemeinde. Theoretische Begründungen
Die weitgehende Trennung zwischen Kirchenstruktur und Diakonieverbänden besitzt zwar nachvollziehbare Ursachen, sie ist jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht als Idealsituation anzusehen. Die vorliegende Arbeit geht von dieser Feststellung aus. Um die Problematik dieser Situation anzudeuten, kann auf eine (etwa folgendermaßen lautende) programmatische Formulierung eines Interviewpartners zurückgegriffen werden:
Diakonie und Caritas sind für die Kirchen der Schlüssel, um an die Menschen heranzukommen; und umgekehrt sind für die Menschen Diakonie und Caritas der Schlüssel, um an die Kirche heranzukommen.[22]
Sollte dieser Sachverhalt richtig sein, so kann eine Trennung zwischen kirchlicher „Erst- und Zweitstruktur“ für die Kirche keine dauerhafte Lösung darstellen. Einschlägige empirische kirchensoziologische Studien stützen diesen Befund: So formuliert Herbert Haslinger im Anschluß an seine Auswertung von unterschiedlichen solchen Untersuchungen unter anderem folgende Thesen, welche die Bedeutung der Diakonie für die Kirche und für deren Auftreten in der Öffentlichkeit einer modernen Gesellschaft deutlich unterstreichen:
„Die Diakonie ist eines von mehreren Praxisfeldern der Kirche, bei denen sogar ein umfangreicheres oder intensiveres Engagement erwartet wird. Die Erwartung der Verstärkung des Engagements wird aber bei der Diakonie nachdrücklicher ausgesprochen als bei anderen Aufgabenfeldern der Kirche.
Vergleicht man die Erwartungshaltungen von Kirchennahen und Kirchenfernen hinsichtlich der verschiedenen Praxisformen der Kirche, so stellt sich heraus, daß die Akzeptanz des diakonischen Engagements bzw. der Bedarf daran bei den Kirchenfernen überproportional hoch ist. Die Diakonie verschafft der Kirche bei den Kirchenfernen und nicht kirchlich Gebundenen eine Restplausibilität.“[23]
Diakonie kann insofern verstanden werden als ein bedeutendes Bindeglied zwischen Kirche und Gesellschaft, zwischen Menschen und Kirche. Diese Funktion ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da in der heutigen modernen und komplexen sozialen Wirklichkeit einerseits auf Seiten der Kirche eine Entfremdung von der Lebenswelt der Menschen zu beobachten ist und andererseits seitens der Gesellschaft eine Entfremdung gegenüber der Kirche und insbesondere ihren - für viele abgrenzend wirkenden - Sonderformen. Von dieser Scharnierfunktion der Diakonie her gedacht muß die in Deutschland überdeutlich hervortretende, da ‘institutionalisierte’ Auseinanderentwicklung oder gar Entkopplung von Kirche und Diakonie(-verbänden) tatsächlich als „Fehlentwicklung“ bewertet werden, als „Ergebnis eines ‘Reduktionismus’ in der Pastoral, dem Kirchenbild, im Gesellschaftsbezug“.[24]
Die Verhältnisbestimmung von Diakonieverbänden und Kirche / Kirchengemeinden - also die Frage ihrer Trennung oder Vernetzung - kann andererseits auch als eine der Urfragen der beiden Diakonieverbände verstanden werden. Weder die Gründung der „Inneren Mission“ 1848 durch den evangelischen Pastor Johann Hinrich Wichern noch die Gründung des „Charitasverband[es] für das katholische Deutschland“ 1897 durch den katholischen Pfarrer Lorenz Werthmann können - obwohl sie auf Initiative von Kirchenmännern erfolgte - als Amtshandlungen von Kirchenleitungen eingeordnet werden. In beiden Fällen bringen sie eine erhebliche Kritik an der verfaßten Kirche und ihrer pastoralen Arbeit zum Ausdruck - insofern es nämlich diesen in aller Regel caritativ-diakonischer Initiative und Verantwortung ermangelte.[25] Diese Grundproblematik und Grundstruktur ist auch durch deren Gründung und deren Wachstumsprozeß nicht aufgehoben worden. Johannes Falterbaum faßt daher das Verhältnis von Diakonieverbänden und verfaßter Kirche folgendermaßen zusammen:
„Auf der Grundlage einer weitgehenden Selbständigkeit und großen Vielfalt der einzelnen Werke wurde je nach Bedarf und konkreter Aufgabe Nähe oder Distanz zur Kirche bzw. der christlichen Gemeinde gesucht.“[26]
Die historische Entwicklung hat dabei zwar dazu geführt, daß auf der rechtlichen (Steuerungs-)Ebene eine mehr oder weniger starke Einbindung der Diakonieverbände in die Strukturen der verfaßten Kirchen erfolgte, während auf der Handlungsebene dies weiterhin eine offene Frage geblieben ist.[27]
Folgt man der Position Falterbaums, so ist die Antwort auf diese offene Frage allerdings „allein nach kircheninternem Recht und damit letztlich theologischer Argumentation zu beurteilen“[28]. Wenn zwar die Einbeziehung von theologischer Argumentation unstrittig ist, so muß es durchaus mit Skepsis beurteilt werden, dieser das Feld zu überlassen. So fällt auf, daß Falterbaum in seiner auf Struktur- und Rechtsfragen der beiden Diakonieverbände konzentrierten Studie schließlich im Ausblick auf die Vernetzung der Diakonieverbände mit der Gemeindeebene unversehens auf eine gemeindetheologische Argumentationsschiene gerät und dabei die Perspektive der Diakonieverbände in ihrer Gestalt als professionelle soziale Dienstleistungsunternehmen gänzlich aus dem Blick verliert.[29]
Nimmt man diese Kritik ernst so hat dies Konsequenzen für die hier vorgelegte Untersuchung; eine kritisch- konstruktive, theoriegeleitete Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Diakonieverbänden und kirchlichen Gemeinden wird die angedeutete Bindegliedfunktion aufgreifen und konkretisieren müssen. Die folgende theoretische Grundlegung zielt daher auf eine Plausibilisierung und Begründung einer weitergehenden Kooperation und Vernetzung. Im Sinne der genannten Kritikpunkte ist es dabei unumgänglich, die aus unterschiedlichen Perspektiven heraus durchzubuchstabieren, da der Versuch, dies nur aus einer übergreifenden Perspektive zu leisten der Komplexität der Konstellation zwischen Diakonieverbänden und Kirchengemeiden kaum gerecht werden kann und in der grundsätzlichen Gefahr steht, sich wiederum nur auf eine Teilperspektive zu reduzieren. Ausgehend von der genannten Konstellation von Diakonie als Bindeglied zwischen Kirche und Gesellschaft erscheint es daher sinnvoll, diese Fragestellung sowohl von einer kirchenbezogenen, als auch von einer gesellschaftsbezogenen Perspektive her zu untersuchen. Neben einer spezifisch theologischen, kirchenbezogenen Argumentation muß es aber auch darum gehen, eine vor allem für die Diakonieverbände relevante Argumentation vorzulegen, da nur so die Vorstellung einer ebenbürtigen Kooperationsbeziehung angezielt werden kann. Allen voran muß zudem die Grundüberlegung angestellt werden, ob prinzipiell und unabhängig von diesen speziellen Perspektiven derartige Kooperation und Vernetzung denkbar und vorstellbar sein kann. So ergeben sich für die theoretische Argumentation folgende Stränge, die es zu verfolgen gilt:
- Es bedarf einer grundsätzlichen Klärung des Verhältnisses von Diakonieverbänden und Kirchen, die das Auseinanderdriften beider nicht nur historisch, sondern theoretisch beschreibt. Dies tut die Systemtheorie, indem sie Diakonie und Kirche in ihre Kategorien von Systemen und Subsystemen, von funktionaler Differenzierung und Spezialisierung fasst. Die Heranziehung der Systemtheorie für unsere Fragestellung ermöglicht es zunächst, das Auseinanderdriften von Diakonieverbänden und Kirchen besser zu verstehen. Jedoch erfüllt die Verwendung dieser Theorie nicht nur einen solcherart heuristischen Zweck, sondern dient auch der grundlegenden und insofern zentralen theoretischen Begründung für das hier verfolgte Anliegen. Von Bedeutung ist in diesem Kontext vor allem die Frage, ob der systemtheoretisch beschriebene Prozeß der Ausdifferenzierung des Religionssystems zwangsläufig zu einer Abkopplung der Diakonie führen muß - oder ob im Rahmen dieser Entwicklung auch Momente einer Integration und Korrelation der sich verselbständigenden Systeme gerade auch aus systemtheoretischer Sichtweise heraus erforderlich werden und wie sich diese gestalten.
- Es bedarf sodann einer kirchenbezogenen Begründung, in der diejenige Handlungswissenschaft zum Tragen kommt, die kirchliches Handeln im konkreten wesentlich mitbestimmt und in der es vorrangig um die Fragestellung der Grundfunktionen und Praxisbereiche der Kirche geht. Im Gegensatz zu anderen denkbaren theologischen Begründungsmöglichkeiten für die Zusammengehörigkeit von Kirche und Diakonie - etwa im Rückgriff auf Bibel, kirchliche Dokumente oder gar Dogmen - fällt damit die Wahl auf systematische praktisch-theologische Konzeptionen, die - obwohl nicht mit kirchenamtlicher Legitimität ausgestattet - als eine Art theologische Organisationslehre verstanden werden können. Diese bezieht sich damit offenkundig auf die aktuelle Situation der Kirche in Deutschland und der Diakonieverbände, die als Wohlfahrtsverbände im Sozialstaat ebenfalls einen deutschen Sonderfall darstellen. Das heißt, daß hiermit die konkreten gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge aufgegriffen werden können, wozu andere Zugangsweisen kaum in vergleichbarem Maße in der Lage sein dürften.
- Gleichermaßen bedarf es auch einer fachspezifischen Begründung im Rahmen derjenigen Handlungswissenschaft, die die konkrete Arbeit in den Diakonieverbänden wesentlich bestimmt. Insofern auch die gesundheits- und pflegedienstlichen Aufgaben der Diakonieverbände in den umfassenderen Horizont des Sozialwesens und Sozialstaates eingebettet sind und weil diese für die vorliegende Untersuchung insbesondere in ihrer sozialen Funktion relevant sind, stellt hier die Theorie der Sozialen Arbeit den entsprechenden Hintergrund dar. Auf der Basis der theoretischen Beschreibung von Gesellschaft als System und Lebenswelt wird Soziale Arbeit als Integrationsagentur innerhalb der Entkopplung und Kolonialisierung von System und Lebenswelt bestimmt. Im Kontext einer so verstandenen Sozialen Arbeit kann der Kooperation und Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden ein zentraler Stellenwert eingeräumt werden.
- Für eine erforderliche gesellschaftsbezogene Begründung bieten schließlich Konzepte einer Zivilgesellschaft interessante Anknüpfungspunkte. Basierend auf einer zivilgesellschaftlichen Gesellschaftstheorie wird daher in einer kritisch-weiterdenkenden Ausein andersetzung die Notwendigkeit einer ‘subsidiären Solidarität’ für den Bestand des Gemeinwesens begründet. Aus dieser läßt sich dann zunächst die Relation von Kirche und Gesellschaft im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Aufgabe der Kirche bestimmen. Daran anschließend wird sowohl der Vernetzungsanspruch als wichtiger Bestandteil einer zivilgesellschaftlichen Verfaßtheit von Diakonieverbänden wie Kirchen abgeleitet, als auch die Notwendigkeit desselben für die Zivilgesellschaft selbst herausgearbeitet.
Diese Aufgliederung in systemtheoretische, kirchenbezogene, sozialarbeitsbezogene und zivilgesellschaftsbezogene Argumentation darf jedoch nicht dazu verleiten, wiederum nur separierte Zugangswege einer Problemlösung aufzuweisen, welche die beklagte Entkopplung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden lediglich auf der Ebene der theoretischen Argumentation verdoppelte. Wenn auch die genannten Argumentationsstränge je eigene Ebenen und Fragestellungen innerhalb des Themenbereichs ansprechen, so gilt es doch, Querverweise und Zusammenhänge wahrzunehmen und aufzugreifen und für das verfolgte Anliegen einer weitergehenden Vernetzung fruchtbar zu machen .
1.1 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden aus der Sicht der Systemtheorie
Am Beginn der theoretisch-argumentativen Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Diakonieverbänden und Kirchengemeinden soll also nicht die theologische Herangehensweise stehen, sondern eine sozialwissenschaftliche bzw. näherhin die systemtheoretische. Das mag verwundern, hat aber seinen guten Grund: Theologische Argumentationen neigen zu einer eher normativ-konzeptionellen Ausrichtung, die vor allem das ob einer Vernetzung thematisiert. Eine speziell praktisch-theologische Argumentation tendiert dagegen dahin, bereits wieder das zu realisierende wie der Beziehung zwischen Diakonie und Kirche zu entwerfen. Ähnliches gilt auch für eine sozialarbeitstheoretische Herangehensweise, was sich in beiden Fällen aus deren Charakter als Handlungswissenschaften herleitet. Mit der Formulierung dieser angestrebten (idealen) Beziehung wird insofern allerdings wiederum normativ gearbeitet und jegliche Analysen und Situationsbeschreibungen würden dann unter der so vorgegebenen Prämisse entstehen.
Ein spezifisch deskriptiver und analytischer Zugang muß diesen ebenfalls nötigen Blickrichtungen folglich vorausgehen und dem entsprechend auf einer anderen Ebene gesucht werden. Mit Hilfe der Soziologie können Erklärungen gefunden werden, die sich auf einer allgemeinen und abstrakten Ebene bewegen, eine umfassende Erklärung des gesellschaftlichen „Systems“ zu liefern beabsichtigen und in diesem Rahmen auch die gewordene Konstellation zwischen Diakonie und Kirche verstehbar und hinterfragbar machen. Obgleich allerdings das Verhältnis zwischen Religion und Soziologie eher kritisch, also von gegenseitiger Skepsis und Vorsicht geprägt zu sein scheint[30], wäre es vermessen, auf die sachdienlichen externen Anregungen der Soziologie verzichten zu wollen.
Als einer der wichtigsten Impulsgeber im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts kann gewiß der Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann gelten. Während Luhmann selbst seinen Beitrag als wenig angenommenes Gesprächsangebot an die Theologie wahrgenommen sah, haben seine religionssoziologischen Arbeiten in ungeahnter Weise den Widerspruch theologischer Kreise und Kirchenvertreter herausgefordert. So spricht etwa ein häufig rezipierter Sammelband der theologischen Auseinandersetzung mit Luhmann bereits einleitend von einer „von Luhmanns Theorie ausgehende[n] Gefahr für Theologie und Kirche“, womit auf Luhmanns Überlegungen zur internen Ausdifferenzierung des Religionssystems Bezug genommen wird.[31] Solche pessimistischen Auffassungen resultieren m.E. zumeist aus einer Verwechselung von Normativität und Deskriptivität, zu der Luhmanns Theorie allerdings ihrerseits beiträgt. So weist etwa der Diakonietheologe Herbert Haslinger am Beispiel des luhmannschen Diakonie- und Seelsorgebegriffs nach, „daß er [Luhmann; MR] - durchaus zutreffende - Beobachtungen der Praxis in den Rang normierender Vorgaben erhebt“[32]. Infolgedessen kann m.E. die Auseinandersetzung mit Luhmanns Analysen nur dann gelingen, wenn der beschreibende Charakter seiner Analysen anerkannt wird und seine normativen Implikationen herausgefiltert und sauber abgetrennt werden. Die von Luhmann beschriebenen grundlegenden Problemstellungen lassen es nämlich durchaus zu, präskriptive Schlußfolgerungen zu ziehen. Dabei muß aber der Gefahr entgangen werden, in irgendeiner Weise automatisch - etwa einer normativen Kraft des Faktischen folgend - die Analyse zur wünschenswerten und anzustrebenden Realität zu erheben - eine Gefahr, der neben zahlreichen Luhmann-Rezipienten möglicherweise Luhmann selbst streckenweise erlegen zu sein scheint.
Die Auswahl gerade der luhmannschen Systemtheorie als Referenz für die hier verfolgte Fragestellung des Verhältnisses von Kirche und ihrer Diakonie muß dabei offengelegt werden: Die Tatsache, dass Luhmann seine allgemeine soziologische Theorie zudem religionssoziologisch ausbuchstabiert hat (wie er dies im Übrigen auch bezüglich der meisten anderen gesellschaftlichen Teilsysteme wie Recht, Wirtschaft, Kunst, Politik, Wissenschaft, Erziehung etc. getan hat), hat hier mehr als nur heuristische Bedeutung[33]. Sie bietet die einzigartige Möglichkeit, im Horizont einer umfassenden soziologischen Theorie kirchensoziologische Fragestellungen anzugehen und nicht für diese wiederum eine eigene Hermeneutik zu beanspruchen und sie somit (in guter neuscholastischer Tradition) erneut aus den sonstigen gesellschaftlichen Abläufen und Zusammenhängen herausheben und ihr einen Sonderstatus zuschreiben zu wollen. Daß hierbei Luhmanns Analyse speziell die Frage der Ausdifferenzierung von Kirche, Diakonie und Theologie thematisiert und deren gegenseitige Zuordnung in den Blick nimmt, verweist darauf, daß Luhmann den Puls kirchenorganisatorischer Problemstellungen getroffen hat.[34] Solches muß von einer sich damit beschäftigenden Arbeit aufgegriffen werden. Des weiteren verweist Dierk Starnitzke in seiner umfangreichen diakoniewissenschaftlichen Luhmann-Rezeption auch darauf, dass der universale Anspruch des luhmannschen Theorieprogramms sowie die Kompatibilität der luhmannschen Diakoniebegriffs mit den diakonisch-theologischen Diskussionen eine Auseinandersetzung nahe legen.[35]
Bevor sich jedoch auf diese Weise systemtheoretisch die Fragestellung einer Vernetzung von Kirche und Diakonie diskutieren und beantworten läßt, sollen zunächst einführend einige hier notwendige Grundlinien der Systemtheorie Niklas Luhmanns dargestellt werden, woraufhin die systemtheoretische Analyse des Religionssystems und seiner inneren Strukturen erfolgen kann.
1.1.1 Grundlinien der Systemtheorie Niklas Luhmanns
Grundthema jeglicher soziologischen Theoriebildung ist die Erklärung der sozialen Wirklichkeit angefangen beim sozialen Handeln des Individuums über die Analyse von Gruppen und Institutionen bis hin zur Erklärung der Gesellschaft als ganzer. Soziologische Theorien werden je nach Fokus daher zunächst in mikrosoziologische Theorieansätze (Handlungstheorien) und in makrosoziologische Theorieansätze (Gesellschaftstheorien) unterteilt. Systemtheorien hingegen können als Versuche gelten, die beiden Bereiche miteinander zu verbinden, weshalb Niklas Luhmann für seine Theorie auch universalen Erklärungscharakter beansprucht. Die strukturell-funktionale Systemtheorie von Luhmanns „Vorgänger“ Talcott Parsons ging dabei davon aus, daß sich die Gesamtheit des Systems in Teilsysteme unterteilt bzw. strukturiert. Wesentlich für Parsons war die Feststellung der Existenz solcher Strukturen, an die er die Frage anschloss, wie diese Strukturen funktionieren mussten, um Systemstabilität bzw. gesellschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Im Horizont dieser Notwendigkeit ging Parsons davon aus, daß diese Stabilität durch eine vollständige Integration der Systemteile in ein Systemganzes bei völligem Fehlen dysfunktionaler Elemente wie Konflikten oder Spannungen zu erreichen war.[36]
In Auseinandersetzung mit diesem strukturell-funktionalen systemtheoretischen Ansatz entwickelt Luhmann seine eigene Theorie: Im Unterschied zu Parsons steht für Luhmann nicht die Frage der Strukturierung am Anfang seiner Überlegungen, sondern das Problem der Komplexität, so daß sein Theorieprogramm auch als ‘Theorie komplexer sozialer Systeme’ bezeichnet wird. Moderne Gesellschaften zeichnen sich für Luhmann nämlich vor allem dadurch aus, „daß es stets mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns gibt, als aktualisiert werden können“.[37] Diese „Überfülle des Möglichen“ nennt Luhmann Komplexität[38] ; sie stellt für den Menschen insofern ein Problem dar, als daß sie von ihm Orientierung, Auswahl und Entscheidung verlangt. Der Mensch muß die gegebene Komplexität reduzieren, damit die Welt und die Gesellschaft für ihn einsichtig, überschaubar und handhabbar wird.[39] Dies ist umso bedeutender, als Komplexität und funktionale Differenzierung (als die zentralen Merkmale moderner Gesellschaften) auf den ersten Blick auseinanderdriftende und nicht integrationsorientierte Prozesse darstellen. Da aufgrund dessen eine orientierungsstiftende Instanz, die Integration gewährleisten würde, ebenfalls nicht mehr vorhanden ist, ist die Möglichkeit von Systemintegration in der modernen Gesellschaft überhaupt fragwürdig geworden.[40]
Die Komplexität der Welt und die Aufgabe, sie zu reduzieren, hängen eng mit dem Prozeß funktionaler Differenzierung zusammen: Funktionale Differenzierung bezeichnet einen Strukturierungsprozeß der Gesellschaft, der die Unüberschaubarkeit der Welt (‘Komplexität’) überschaubarer macht (‘reduziert’). Zentrales Prinzip dieser Strukturbildung ist für Luhmann die Ausbildung von Systemen für bestimmte Funktionen, die sich von ihrer Umwelt abheben.[41] So entstehen durch Aufgabenteilung (‘funktionale Differenzierung’) innerhalb des Gesellschaftssystems Teilsysteme wie Wirtschaft, Politik, Recht oder eben auch Religion, wobei sich der Prozeß auch innerhalb der einzelnen Teilsysteme in weitergehender Ausdifferenzierung und Spezialisierung fortsetzt. Prinzip dieses Systembildungsprozesses ist, daß es für jedes Teilsystem eine Differenz zwischen innen und außen, zwischen System und Nicht-System, zwischen System und Umwelt gibt. Durch diese Differenz zwischen System und Umwelt - genauer durch die Bildung von Systemgrenzen - findet Stabilisierung statt; und diese ist es, die die Welt strukturiert, überschaubar und bestimmbar macht, d.h. deren Komplexität reduziert. Dabei sind die Systeme als solche, d.h. als Ausschnitt aus der Umwelt, weniger komplex als die Gesamtheit der Umwelt. Allerdings führt die zunehmende interne funktionale Differenzierung und Systembildung zu einer ständigen Erhöhung der Systemkomplexität. Zugleich geschieht damit Wahrnehmung von Umwelt aus dem System heraus nur noch selektiv, d.h. mit Blick auf eine systemrelevante Umwelt, was wiederum bedeutet, daß dadurch auch die Umweltkomplexität weiter reduziert werden kann.[42] Nur aus dieser Sicht kann eine Wahrnehmung des Gesamtsystems erfolgen.[43]
In einer zweiten Phase seiner Theorieproduktion werden diese allgemeinen Grundlagen der Systemtheorie vom Autor nochmals grundlegend weiterentwickelt. Der eben ausgeführte Aspekt, daß Umweltwahrnehmung nur aus dem System heraus möglich ist, wird nun zu einem wesentlichen Kriterium, das allen Systemoperationen und der Systembildung insgesamt zugrunde liegt. Mit dem Begriff der ‘Autopoiesis’ kennzeichnet Luhmann, daß die Ausdifferenzierung des Systems aus der Umwelt nicht von der Umwelt (sog. Fremdreferenz), sondern allein durch das System selbst (sog. Selbstreferenz, griech. Autopoiesis) vollzogen werden kann. Die System-Umwelt-Differenz als Prinzip der Systembildung, welche für die erste Periode der luhmannschen Systemtheorie entscheidend ist, wird dadurch zwar nicht aufgegeben, tritt aber durch diese fundamentale Modifizierung zunehmend in den Hintergrund. Für Luhmann bedeutet die Selbstreferentialität von Systemen „zunächst nur in einem ganz allgemeinen Sinne: Es gibt Systeme mit der Fähigkeit, Beziehungen zu sich selbst herzustellen und diese Beziehungen zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt.“[44]
Unter der Einbeziehung des Theorems der Autopoiesis und unter Wiederaufnahme der früheren Theorie zur Komplexitätsreduktion durch die Ausdifferenzierung von Systemen, werden beide Theoriephasen von Luhmann folgendermaßen zusammengefaßt:
„Die Welt verliert ihren Charakter des Haltgebenden (periéchon) und wird durch die Differenz von System und Umwelt markiert, wobei Umwelt das von jedem System aus Verschiedene, Unbekannte ist, für das sich keine gemeinsamen Wesenszüge mehr ausmachen lassen. (…) Denn nur das System kann Unterscheidungen treffen, nur das System kann deshalb beobachten, während die Umwelt nur ist, wie sie ist.“[45]
Während Luhmann in seiner ersten Theoriephase die Abgrenzung von der Umwelt zwar als systembildend betrachtet, das System aber zugleich die Kommunikation mit seiner Umwelt funktional ausdifferenziert, verändert sich seine Sichtweise nach der autopoietischen Wende insofern nun gilt:
„Selbstreferentielle Systeme haben also auf der Ebene ihrer internen Systemabläufe keine Möglichkeit, in direkten Kontakt mit ihrer Umwelt zu treten oder auch nur Umwelteinflüsse wahrzunehmen.“[46]
Dabei erfolgt in der Systemtheorie ein Übergang von offenen Systemen zu einer selbstreferentiellen Geschlossenheit von Systemoperationen: Die Selbstreferentialität der Operationen und Kommunikationen im System bringt die Abgrenzung von der Umwelt hervor und verstärkt damit die Geschlossenheit des Systems selbst. Diese Geschlossenheit wird aber von Luhmann als Offenheit beschrieben, insofern nämlich gerade und ausschließlich aufgrund der Abgrenzung von der Umwelt die Selbstwahrnehmung als System und infolgedessen die Ausbildung einer systemspezifischen Umweltwahrnehmung erfolgen kann.[47] Das heißt: Systeme haben keine Möglichkeit zu direktem Umweltkontakt, aber durchaus eine Sensibilität, mithilfe interner (und nur solcher) Operationen auf die Umwelt zu reagieren.[48]
Dabei ist wichtig zu erkennen, daß Systeme nicht statischen Charakter haben, sondern daß es vielmehr für den Bestand von Systemen erforderlich ist, daß diese sich kontinuierlich selbst reproduzieren, sich von ihrer Umwelt abgrenzen und nur dadurch Systemidentität ausbilden. Die Existenz sozialer Systeme wird insofern dynamisiert, wodurch auch die Möglichkeit der Gestaltbarkeit sozialer Systeme deutlicher hervortritt. Wesentlich ist dabei die Fokussierung des Systems selbst als Träger und Ort dieser Systemreproduktion und die Ablehnung einer umweltbedingten und somit fremdreferentiellen Reproduktion von Systemen.
Insgesamt kann also festgehalten werden: Die wachsende Fülle von Möglichkeiten liegt einerseits in der Ausdifferenzierung von Systemen und damit in der Systembildung begründet, andererseits ist die Systembildung selbst wiederum ein Instrumentarium zur Ordnung, Orientierung und Beherrschung der Komplexität. Folge des Differenzierungsprozesses ist eine wachsende Autonomie der einzelnen Teilsysteme, welche ausschließlich von diesen selbst hergestellt und bewahrt wird. Dies hat meines Erachtens auf die Frage der gesamtsystemischen Integration Auswirkungen: einerseits muß wechselseitige Integration die Autonomie des jeweiligen funktional spezialisierten Teilsystems wahren, andererseits muß sich die Autonomie gerade in der Wahrnehmung der eigenen Funktion im Zusammenspiel mit anderen Teilsystemen zeigen und erweisen. Letztlich ist somit funktionale Differenzierung wiederum auf Integration angelegt und von ihr abhängig.
1.1.2 Kirche und Diakonie in der Systemtheorie
Auf diesen Grundlagen gilt es nun, die Rolle von Kirche und Diakonie in der luhmannschen Systemtheorie herauszuarbeiten. Dies kann weitgehend anhand der Beschreibung von Luhmann selbst in seinem ersten religionssoziologischen Hauptwerk Funktion der Religion geschehen, welches seinerseits zur ersten Phase seiner Theorieproduktion zählt und dem somit die Selbstreferentialität als Modus der Systembildung noch nicht zugrunde liegt.
Luhmanns Ausführungen gehen dabei von folgender Feststellung aus, die für seine religionssoziologischen Beiträge von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist:
„Die gesellschaftsinterne Ausdifferenzierung [des Religionssystems, MR] heißt also keineswegs,. daß die Religion sich in die Kirche zurückzieht und sich fürderhin nur mit sich selbst beschäftigt.“[49]
Ansatzpunkt für das Verständnis von Religion, und damit auch von Kirche und Diakonie, hier ist dem entsprechend die Frage der Integration des Teilsystems Religion sowohl in das Gesamtsystem Gesellschaft wie auch mit der Umwelt, d.h. mit anderen Teilsystemen. Wie alle Teilsysteme der Gesellschaft hat auch die Religion ihre Funktion zunächst in zwei Richtungen zu erfüllen: Zum einen besitzt sie eine Funktion für die Bestandssicherung des Gesamtsystems Gesellschaft, zum anderen stellt sie ihre Spezialisierung für andere Teilsysteme zur Verfügung, die dadurch von entsprechenden Aufgaben entlastet werden.[50] Luhmann unterscheidet allerdings grundsätzlich drei Systemreferenzen: erstens die Beziehung des Systems zum Gesamtsystem, die „Funktion“, zweitens die Beziehung des Systems zu Systemen der eigenen Umwelt, die „Leistung“ und drittens die Beziehung des Systems zu sich selbst, die „Reflexion“.[51] Diesen drei Systemreferenzen gemäß bildet das System je funktional zuständige Teilsysteme aus, die angewandt auf das Religionssystem „Kirche“, „Diakonie“ und „Theologie“ heißen.
a) Kirche als Funktion der Religion für die Gesellschaft
Mit dem Begriff Kirche bezeichnet Luhmann die Funktion des Religionssystems für das Gesamtsystem Gesellschaft. Diese besteht in ‘geistlicher Kommunikation’[52] - gemeint ist damit, daß durch religiöse Sprache und Symbolbildung (insbesondere die Rede von „Gott“) bislang Unerklärliches erklärt oder wenigstens erklärbar gemacht wird und damit eine Vorstellung davon möglich wird, - mit den Begriffen Luhmanns ausgedrückt - daß Religion die unbestimmbare Komplexität in bestimmbare oder bestimmte zu verwandeln vermag.[53] Gleichzeitig ist es aber das Problem der Religion, daß sie den umgekehrten Prozeß ebenfalls zu integrieren hat, nämlich das Bestimmte in einem gewissen Grad weiterhin unbestimmbar, d.h. offen und interpretierbar, zu halten und gerade keine endgültigen Bestimmungen zu liefern.[54] Diese „Kontingenzbewältigung“[55] ermöglicht oder bewirkt damit die Konstitution von „Sinn“ für das Gesamtsystem. Es handelt sich um den „religiösen Kernbereich“ der Religion, dem demnach ein „funktionaler Primat“ zukommt.[56]
b) Diakonie als Leistungen der Religion für die Umwelt
Unter Diakonie versteht Luhmann die „Leistungen des Religionssystems, die anderen gesellschaftlichen Teilsystemen sowie personalen Systemen [d.h. Menschen, MR] zugute kommen“.[57] Es sind Leistungen, die sich von der Funktion als solcher insofern unterscheiden, als daß „die empfangenden Systeme nicht mit dem gesellschaftlichen System identisch sind“. Damit ist zwar die gesamtgesellschaftliche Funktion vorausgesetzt, zugleich aber auch außen vorgelassen, da die Diakonie als Leistung gegenüber anderen Systemen in der Umwelt auf deren ungelöste Probleme einzugehen hat. Insofern nimmt das Religionssystem „Zuständigkeiten für ‘Restprobleme’ oder Personbelastungen und Schicksale in Anspruch …, die in anderen Funktionssystemen erzeugt, aber nicht behandelt werden.“ Charakteristisch ist dabei, „daß sozialstrukturelle Probleme in personalisierter Form, also an Personen wahrgenommen werden“, was auch heißt, daß sie eben „nicht als sozial strukturelle Probleme wahrgenommen werden“. Gerade der Begriff „Seelsorge“, mit dem Luhmann die Leistungen für individuelle (nicht sozialstrukturelle) Problemlagen der personalen Systeme bezeichnet, macht die personalisierte Form der Problembearbeitung deutlich. Seelsorge steht bei Luhmann daher neben der Diakonie (beide zusammen faßt er als „Dienst“)[58], könnte aber als Leistung für andere Systeme auch als Teil der Diakonie verstanden werden, bzw. umgekehrt könnte wegen der faktischen Personalisierung in der Problembearbeitung auch die Diakonie als Teil der Seelsorge angesehen werden[59].
c) Theologie als Selbstreflexion des Religionssystems
Die Theologie erfüllt in diesem Kontext die Aufgabe der Selbstreflexion des Religionssystems, also der Rückbesinnung auf die systemspezifische Identität. Luhmann entwirft Theologie als „Systembetreuungswissenschaft“[60], die die interne Differenzierung des Religionssystems in Funktion, Leistung und Reflexion reflektiert. Sie wäre demnach „Reflexion des Verhältnisses von Kirche, Diakonie und Theologie im funktional ausdifferenzierten Religionssystem der modernen Gesellschaft“. Dieser Anspruch Luhmanns an die theologische Reflexion ist deshalb wegweisend für eine verstärkte Integration der Diakonie in die Theologie, angesichts der Tatsache, daß - wie Luhmann zutreffend feststellt - die Theologie eine größere Nähe zur Kirche, ihrer ‘geistlichen Kommunikation’ und ihrer ‘Funktion der Kontingenzbewältigung’ entwickelt hat, als zur Diakonie, die durch ihren engeren Kontakt zur gesellschaftlichen Umwelt auch stärker in die gesellschaftliche Dynamik und Pluralität verwickelt bzw. dieser unterworfen ist.
1.1.3 Sicherung des Systemzusammenhalts durch Balance und Interaktion - die systemtheoretische Verhältnisbestimmung von Kirche, Diakonie und Theologie
Daraus ergibt sich die Frage nach der Integration der drei Systemreferenzen. Diese Integration wird in der modernen ausdifferenzierten Gesellschaft durch den Begriff der „Säkularisierung“ umrissen, unter dem Luhmann „die gesellschaftstrukturelle Relevanz der Privatisierung religiösen Entscheidens“[61] versteht; er bezeichnet damit im Blick auf das Religionssystem die Folgen „ein(es) primär funktional differenzierte(n) System(s), in dem jeder Funktionsbereich höhere Eigenständigkeit und Autonomie gewinnt, aber auch abhängiger wird davon, daß und wie die anderen Funktionen erfüllt werden“[62]. Die durch die Säkularisierung sich daher weiter verstärkende Differenzierung von Kirche, Diakonie und Theologie führt deshalb zu Konkurrenz und Konflikten zwischen den Teilsystemen des Religionssystems.
Aufgrund der Privatisierung des Entscheidens kommt das Funktionssystem der geistlichen Kommunikation in eine Krisensituation, so daß dem Leistungssystem Diakonie ausgleichendermaßen eine höhere Plausibilität zugesprochen wird. Dabei führen die jeweiligen Primärorientierungen einerseits zu unterschiedlichen Eigenproblemen, andererseits aber vor allem zur aufgabenspezifischen Notwendigkeit, sich den entsprechenden Erfordernissen und Fremderwartungen von der Gesellschaft her zu unterstellen, was die Diakonie als Leistung gegenüber der gesellschaftlichen Umwelt in besonderem Maße betrifft.[63] Schließlich entsteht daraus ein „Relationierungsproblem“[64] zwischen den einzelnen Bereichen im differenzierten Religionssystem, d.h. genau das Problem, wie die drei Funktionsbereiche aufeinanderbezogen (‘miteinander integriert’) bleiben. Angesichts dessen hält Luhmann die „Balancierung“ zwischen Funktion, Leistung und Reflexion für erforderlich. Zwar mache die Komplexität des Systems individuelle Schwerpunktsetzungen in einem der drei Bereiche notwendig, allerdings so daß keine gegenseitigen Grenzüberschreitungen stattfinden: die Theologie ist nicht für diakonische Aufgaben zuständig, noch die Diakonie für gesamtgesellschaftliche Sinnfragen, etc. Entscheidend ist dabei jedoch, daß die „Interdependenzen des Systems“ dadurch nicht bedenklich „gestört“ werden, da sonst soziale Konflikte sowie Orientierungs- und Motivationsprobleme produziert würden.[65]
Aus dieser Problemanalyse Luhmanns leitet sich damit umgekehrt ab, daß diese Interdependenzen immer wieder hergestellt oder regeneriert werden müssen, also Integration erforderlich ist. Funktionale Innendifferenzierung des Religionssystems ist damit zwar unerläßlich, darf jedoch nicht zu einem beliebigen Auseinanderdriften oder gar zur Abspaltung der jeweiligen Teilfunktionen führen.[66] Gerade in der Balance zwischen Eigenständigkeit und Kooperation besteht demnach aus systemtheoretischer Perspektive die Aufgabe einer kontinuierlichen Verhältnisbestimmung und Kooperation zwischen den beiden Strukturen des Religionssystems: der Diakonie und der Kirche.
Geht es allerdings nicht nur um eine abstrakte Verhältnisbestimmung, sondern auch um die Art und Weise der praktischen Realisierung, können allgemeine Aussagen Luhmanns über Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen herangezogen werden. Demnach bedarf es nach Luhmann nämlich nicht nur der Kooperation oder Interaktion als solcher, noch reicht eine bloße Kooperationsfähigkeit aus; sondern es ist insbesondere eine „Organisiertheit der Interaktionsbereitschaft“ erforderlich.[67] Diese stellt eine typisch innersystemische - und zugleich selbstreferentielle und daher die alleinig mögliche - Reaktionsebene des Systems auf seine Umwelt bzw. des Teilsystems auf andere Teilsysteme dar, denn das Einzelsystem kann ja keinem anderen System die Interaktion verordnen oder aufzwingen. Zugleich stellt sich eine solche organisierte Interaktionsbereitschaft als Voraussetzung für die Planbarkeit und Steuerung von Kooperationsprozessen dar, ohne daß dadurch ein Organisationsgrad von Interaktion erforderlich wäre, der selbst wieder zur Systembildung führen würde und der zugleich die Chancen nicht-organisierter Interaktion ausschließen würde. ‘Organisiertheit der Interaktionsbereitschaft’ könnte im vorliegenden Zusammenhang demnach als Grundlage eines Steuerungsmechanismus eigener Art angesehen werden, welcher eine kontinuierliche und regelmäßige Kooperation ermöglicht, durch die die inneren Interdependenzen des Religionssystems operationalisiert werden, und welcher damit dessen Stabilität zu gewährleisten vermag.[68]
Für die hier verfolgte Frage der Verhältnisbestimmung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden können aus dieser theoretisch-abstrakten Argumentation m.E. die folgenden konkreten Aspekte abgeleitet werden: Einerseits gilt es, die Ausdifferenzierung und funktionale Spezialisierung der Diakonie in ihrer wohlfahrtsverbandlichen Organisationsform grundsätzlich anzuerkennen und gleichermaßen ist dabei auch nach der funktionalen Spezialisierung von Kirchengemeinden zu fragen. Andererseits ist es aber auch notwendig, sowohl die Diakonie immer wieder auf die Kirchenstruktur zurückzuverweisen, als auch die Kirchenstruktur auf die Struktur der Diakonieverbände zurückzubinden[69] - zumindest sofern die gemeinsame Zugehörigkeit zum Religionssystem gewahrt bleiben soll. Kirchengemeinden und Diakonieverbände als die beiden zentralen Grundexistenzweisen des Funktions- und des Leistungssystems der Religion müssen daher kontinuierlich miteinander in Kooperation treten, was voraussetzt, daß sie zunächst entsprechende Kooperationsstrukturen entwickeln müssen. Bei solchen muß es sich dann vornehmlich um eine ‘organisierte Kooperationsbereitschaft’ handeln, d.h. konkret, daß die Herausbildung eines dafür zuständigen Aufgabenfeldes (wie beispielsweise das ‘Referat Gemeindecaritas’ in den meisten Diözesan- bzw. Kreiscaritasverbänden) allein nicht ausreichend ist, sondern daß es sich gerade auch um eine Querschnittsaufgabe aller Bereiche handelt im Sinne einer grundsätzlichen Gemeindeorientierung der Fachdienste. Dasselbe ist analog auf die kirchlichen Gemeinden zu übertragen, denen diese Grundstruktur einer ‘organisierten Kooperationsbereitschaft’ insofern entgegenkommt, als sich für die Gemeinden die Frage der Zusammenarbeit mit den Diakonieverbänden häufig aus kleineren Möglichkeiten und Fragen im Alltag und seltener von ausgesprochenen Kooperationsprojekten her stellt. Kooperation (gar institutionalisierte Kooperation) ordnet sich damit grundsätzlich der konkreten pastoralen oder diakonischen Arbeit in den Gemeinden unter, so daß es also auch hier vorrangig um die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft der Gemeinden insgesamt, ihrer ehrenamtlichen und insbesondere aller ihrer hauptamtlichen Pastoralen Mitarbeiter geht.
Die gegenseitige Verweisung theoretisch zu reflektieren sowie auch in ihrer praktischen Verwirklichung zu erforschen und voranzubringen, ist Aufgabe der Theologie, womit sich auch das Selbstverständnis der vorliegenden Arbeit als authentisch theologische Arbeit beschreiben läßt, obwohl deren Arbeitsweise zugleich weitgehend sozialwissenschaftlichen Mustern folgt. Diese Verweisung geschieht dabei nicht entgegen, sondern gerade aufgrund der jeweiligen Autonomie und Spezialisierung von Diakonie und Kirche - nicht zum Selbstzweck, sondern aus dem Interesse an der Stabilität des Religionssystems insgesamt - und schließlich nicht als Vermischung der jeweiligen Aufgabenbereiche, sondern gerade als sachgerechte Wahrnehmung einer zugleich geistlichen als auch sozialen Kontingenzbewältigung und damit Sinnkonstitution. An letzterem wird deutlich, daß Diakonie auch eine Sinnfunktion für das Gesamtsystem und Kirche auch Leistungen für die Umwelt des Religionssystems bereitstellen.[70]
1.1.4 Problematisierung der systemtheoretischen Argumentation
Gerade diese Behauptung führt allerdings dazu, Luhmanns Konzeption kritisch zu hinterfragen. Zwar spricht er von der Bedeutung der Ausgewogenheit unter den drei Teilsystemen, jedoch ist in seiner Begrifflichkeit von Funktion und (Transfer-)Leistung ein Gefälle impliziert, das die Funktion als das „eigentliche“, als die „identitätskonstitutive Funktion“[71] versteht, der ein „funktionaler Primat“[72] zukommt. Damit wird der Diakonie gerade dieser Stellenwert abgesprochen, was in zweifacher Hinsicht zu kritisieren ist: In Politik und gesellschaftlicher Öffentlichkeit wird die Diakonie nicht nur im Blick auf einzelne Teilsysteme, sondern allgemein als vorrangig eingeordnet; die diakonische „Leistung“ ist oft der Grund, weshalb der Religion Legitimität und öffentliche Anerkennung gezollt wird. Andererseits definieren Theologen gerade auch die Kirche als solche als Diakonie an der Gesellschaft. Darüber hinaus muß nach Haslinger der Primat der Funktion nicht als zwingende Konsequenz der luhmannschen Systemtheorie angesehen werden[73], weshalb er Luhmann vorwirft, er erhebe „Beobachtungen der Praxis in den Rang normierender Vorgaben“[74]. Insofern bleiben die Aussagen über einen Vorrang auch analytisch umstritten, wenn auch darauf zu achten ist, daß die Behauptung eines Primats der Diakonie seitens der Praktischen Theologie in der Regel konzeptionell und damit kontrafaktisch ist.
Des weiteren weist die systemtheoretische Argumentation der Diakonie im Grunde eine systemstabilisierende Rolle zu, so daß deren sozialintegrativer und sozialkritischer Anspruch konterkariert wird. Die Frage ist daher, inwiefern die Systemtheorie wirklich für eine Begründung der Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchenstruktur hilfreich ist und inwiefern nicht. Das grundsätzliche Problem einer systemtheoretischen Begründung der Integration liegt dabei in dem statischen Charakter des Begriffs System. Dies liegt wesentlich darin begründet, daß für Luhmann die System-Umwelt-Differenz „das konstituierende Denkschema jeder Art von Systemtheorie“[75] darstellt und damit die jeglicher gesellschaftlichen Systembildung zugrundeliegende Interaktion von Menschen diesem Paradigma de facto untergeordnet wird.[76] Interaktion wird von Luhmann sehr eng auf der Ebene „wechselseitiger Wahrnehmung unter Anwesenden“ verstanden, wovon er lediglich die Gesellschaft als umfassendes und die Organisation als mitgliedschaftsbezogenes und formalisiertes Sozialsystem abgrenzt.[77] Somit gerät in der systemtheoretischen Sichtweise Luhmanns aus dem Blick, daß die Integration unterschiedlicher Teilsysteme eines Systems, beispielsweise der Diakonieverbände und der Kirchengemeinden, sowie deren Kooperation und Vernetzung nicht allein durch systemische Vorgänge, sondern eben wesentlich auch durch die Interaktion und Kooperation der in den beteiligten Sozialsystemen agierenden und interagierenden Menschen realisiert wird.[78] Das bedeutet, daß die Personen und ihre Interaktionen stärker als das tragende Fundament in der Bildung und Vernetzung von Sozialsystemen größerer wie kleinerer Reichweite anerkannt werden müssen. Wenn auch auf der Basis der Systemtheorie entsprechende systemsteuernde Mechanismen zwischen den unterschiedlichen Subsystemen des Religionssystems - beispielsweise zwischen Kirchenstruktur und Diakonieverbänden - zum Tragen kommen, so bleibt auch hier festzuhalten, daß diese sich weitgehend auf institutionalisierte, verrechtlichte und dementsprechend bürokratisierte und formalisierte Akte beschränken.[79] Die Konkretisierung und Realisierung der Frage nach der Vernetzung von Kirchengemeinden und Diakonieverbänden bleibt damit allerdings letztlich unbeantwortet. Dennoch bleibt festzuhalten, daß solche Vernetzung sich systemtheoretisch als erforderlich erwiesen hat und mit dem Konzept der ‘organisierten Kooperationsbereitschaft’ als operationalisierbar vorgestellt wurde, was trotz aller Kritik die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dieser Frage aus systemtheoretischer Perspektive unterstreicht..
Unter Aufnahme dieser Kritikpunkte muß in den weiteren Argumentationssträngen darauf geachtet werden, daß abstrakte und statische Sichtweisen vermieden werden und stattdessen die Bezüge zwischen Gemeinden und Diakonieverbänden gerade von der inter-aktiven und dynamischen Beteiligung von Menschen her zu entwerfen versucht werden. Dies wird mitunter dadurch erreicht, dass die folgenden pastoraltheologischen und sozialarbeitstheoretischen Begründungsversuche auch in ihrer handlungswissenschaftlichen Komponente zum Tragen kommen. Beide Perspektiven werden hier verstanden als die den ausgebildeten hauptberuflichen Mitarbeitern in Gemeindepastoral und diakonieverbandlicher Sozialarbeit zugrundeliegenden Korrespondenzwissenschaften, von denen her sie ihr berufliches Handeln leiten lassen und fortentwickeln. Auch auf diesem Hintergrund betrachtet nehmen die folgenden Überlegungen die in diesem Feld handelnden Personen in ihrer Relevanz für Kooperation und Vernetzung ernst.
1.2 Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
aus der Sicht der Praktischen Theologie
Die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Gesellschaft und in deren Rahmen auch nach der Rolle der Diakonie innerhalb der Kirche und ihrer pastoralen Arbeit stellt sich jenseits systemtheoretischer Herangehensweisen wesentlich aus der Perspektive der Kirche selbst. Nicht mehr als mächtige Zentralinstanz neben dem Staat, sondern als ein Bestandteil neben anderen findet sich die Kirche in der modernen Gesellschaft vor, und es ist an erster Stelle ihr eigenes Interesse, sich in dieser Gesellschaft zu plazieren. Kirche und Theologie haben sich dieser Aufgabe gestellt und ein Selbstverständnis entwickelt, dem aus theologischer und kirchenbezogener Sichtweise eine Verhältnisbestimmung zur und Verortung in der modernen Gesellschaft wesentlich innewohnt. Verstehbar im Sinne einer theologischen Organisationslehre der Kirche hat vor allem die Praktische Theologie Konzepte entwickelt, die die Diakonie als Bestandteil dieser gesellschaftlichen Verortung einerseits, andererseits aber auch allgemeiner als Bestandteil des Selbstverständnisses der Kirche als solchem sehen und aufgrund dessen deren Stellenwert und Funktion in der Gesamtheit kirchlichen Selbstvollzuges und Selbstverständnisses thematisieren. Drei unterschiedliche, aber nicht voneinander unabhängige Konzeptionen sind für die weitere und eingehendere Auseinandersetzung mit unserer Fragestellung besonders hervorzuheben: zunächst grundlegend die Begründung des Gesellschaftsbezuges als wesentlichem Bestandteil des Kirchenverständisses des Zweiten Vatikanischen Konzils, sodann die Frage nach dem Stellenwert der Diakonie im Rahmen kirchlicher Pastoralarbeit anhand verschiedener Entwürfe des Konzepts der ‘Grundvollzüge der Kirche’, und schließlich der Blick auf das lateinamerikanische Modell ‘Kirche der Armen’, mithilfe dessen im Zusammenhang eines anderen sozio-religiösen Kontextes die Perspektive erweitert werden soll. Die Auseinandersetzung mit diesen theologischen und ekklesiologischen Konzeptionen dient dazu, Konturen des Verhältnisses zwischen Kirchengemeinden und Diakonieverbänden vorzuzeichnen, welche einerseits deren Vernetzung grundsätzlich begründen und zugleich Kriterien für deren Gestaltung beschreiben.
1.2.1 Der Dienst an Mensch und Gesellschaft – ein Wesenszug der Kirche
und ihrer Pastoral nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
In der katholischen Kirche und Theologie hat das 2. Vatikanische Konzil (1962-65) genau diese Frage des Verhältnisses von Kirche und Gesellschaft aufgegriffen und damit entscheidende Neuanstöße für die gesellschaftliche Rolle der Kirche gegeben. Bis dato herrschte in der katholischen Ekklesiologie das Verständnis von Kirche als einer „societas perfecta“ vor, also einer ‘vollkommenen Gesellschaft’ übernatürlichen Wesens, die sich als von Gott beauftragte vollkommene Heilsanstalt gerade durch ihre Unterschiedenheit von Welt und Gesellschaft sowie ihre Unabhängigkeit vom Staat auszeichnete und sich in Opposition diesen gegenüber definierte. Dies führte faktisch zu einer Verabsolutierung der eigenen Gestalt, einer weitgehenden Abschottung von den Errungenschaften der modernen Welt sowie einer ghettohaften Abkapselung.[80] Diese lehramtlich deutlich formulierten dogmatischen Positionen konkretisierten sich im deutschen Katholizismus in der Besonderheit der Herausbildung eines „katholischen Milieus“, womit „ein abgrenzender und ausgrenzender katholisch-konfessioneller Gruppenzusammenhang mit einem gewissen Wir-Gefühl gemeint [ist], der über eine eigene ‘Welt-Anschauung’, eigene Institutionen und eigene Alltagsrituale verfügt.“[81] Die Pluralisierungsphänomene der Moderne wurden also dadurch bewältigt, daß der Lebensalltag der Gläubigen mittels katholischer Strukturen, Organisationen und Institutionen derart überzogen wurde, daß die Berührung mit einem Außerhalb („der Welt“) auf ein Minimum reduziert wurde. Die Zuspitzung der Milieubildung und das Ereignis des 1. Vatikanischen Konzils (1869/70) liegen dabei inhaltlich und zeitlich eng beieinander; ihre strukturbildende Wirkung reicht bis in die deutsche Nachkriegszeit hinein, die sich erst in den 1960ern zum Problem wandelte und einem tiefgreifenden Auflösungsprozeß weichen musste.[82]
Angesichts dieses häufig als dramatisch charakterisierten Umbruchs stellte sich die Kirche im 2. Vatikanischen Konzil nun gerade dieser Herausforderung, die Abschottung aufzubrechen und das Verhältnis der Kirche zur modernen Welt neu zu bestimmen. So jedenfalls hatte es Papst Johannes XXIII. dem Konzil mit den Themen des ‘aggiornamento’ (der Öffnung der Kirche zur Welt von heute) sowie der Wahrnehmung der ‘Zeichen der Zeit’ bereits bei der Einberufung thematisch vorgegeben.[83] Das Konzil sollte ein „pastorales Konzil“ sein, es „wollte ein Konzil der Sorge der Kirche um die Menschen selbst sein“.[84]
Dieses pastorale Anliegen wird vor allem in der jüngeren Konzilsforschung hervorgehoben und untersucht: Für Elmar Klinger ist die Herausarbeitung der Hermeneutik des Konzils für eine zutreffende und wirksame Rezeption der Konzils von grundlegender Bedeutung. Dieser hermeneutische Schlüssel zum Verständnis des Konzils ist in der Pastoralkonstitution bzw. näherhin in deren Pastoral- und Kirchenverständnis zu finden[85], wird allerdings der Kirchenversammlung bereits in der Eröffnungsansprache Johannes XXIII. programmatisch vorgegeben. Darin verlangt der Papst „einen Sprung nach vorn in dogmatischer Durchdringung“[86] wiewohl er das Anliegen des Konzils bereits als pastorales formuliert hat, so daß das pastorale Thema des Konzils zugleich dessen dogmatischer Auftrag wurde. Diese Vorgabe wird von Kardinal Suenens in einen Umsetzungsplan für das Konzil überführt, in welchem dieser die Kirche als eine polare Wirklichkeit begreift, in der sich innen und außen bedingen: „Es gibt ihr Innen nicht ohne dessen Außen, und ihr Außen muß das Außen dieses Innersten sein“[87] – Identität und Auftrag der Kirche sind auf engste miteinander verwoben.
Den Weg dazu ebnet der Konzilsberater Karl Rahner, der in einem wichtigen Entwurf zur Offenbarungskonstitution des Konzils eine dogmatische Begründung für die Einheit von Dogmatik und Pastoral anbietet, indem er das pastorale Verkündigungswirken der Apostel mit dem dogmatischen Begriff der Tradition identifiziert. Im Wesen der Offenbarung selbst ist folglich die Verknüpfung von Dogmatik und Pastoral, von Identität und Auftrag, grundgelegt, wodurch Rahner insbesondere den Auftrag des Papstes an die Tradition der kirchlichen Lehre anschlussfähig macht.[88]
Aufgrund dieser ‘Vorarbeiten’ konnte das Projekt eines wesentlichen Fortschritts in Lehre und Wirken der Kirche nun seinen Lauf nehmen: „Das Konzil … verfährt dogmatisch und pastoral. Es will dogmatische Fragen pastoral und pastorale Fragen dogmatisch verstehen.“[89] – in dieser „gegenseitigen Durchdringung von Dogmatik und Pastoral“[90] sieht Klinger das hermeneutische Prinzip des Konzils zusammengefasst, welches in der Pastoralkonstitution ausgeführt werde. Daher stelle die Pastoralkonstitution „ein fundamentaltheologisches Programm“ und damit auf jeden Fall „keine pastoraltheologische Handreichung“ dar.[91]
In diesem Zusammenhang entwickelt das Konzil auch einen neuen Pastoralbegriff, dessen Ausdrücklichkeit an ungewohnter Stelle zu finden ist. Insbesondere auch Ergebnis der kontroversen Konzilsdebatten um die Textentstehung der Pastoralkonstitution, erfolgt diese Klärung mittels einer amtlichen Fußnote, die die Konzilsväter dem Titel der Pastoralkonstitution hinzufügen. Dort heißt es, die Konstitution „wird ‘pastoral’ genannt, weil sie, gestützt auf Prinzipien der Lehre [Dogmatik, MR], das Verhältnis der Kirche zur Welt und zu den Menschen von heute darzustellen beabsichtigt.“ Der Begriff „Pastoral“ benennt insofern exakt das Verhältnis von Kirche und Welt – bzw. handlungstheoretisch formuliert: das Wirken der Kirche in der Welt. Im Vergleich zu den vorkonziliaren Positionen ist dabei entscheidend, daß Pastoral nach dem Verständnis des Konzils „nicht mehr nur die herkömmliche Betreuung von Laien durch Priester, sondern das Verhältnis der Kirche überhaupt zur Welt im ganzen“ bezeichnet.[92]
In Anbetracht dieser zentralen Rolle des Außen der Kirche für ihre Identität wie für ihren Selbstvollzug ist es zudem von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, daß das Konzil in der Pastoralkonstitution die Kirche „in der Welt von heute“ ansiedelt, d.h. daß die Kirche an der Welt teilnimmt und deren Teil ist[93] – ihr also nicht mehr abgegrenzt gegenübersteht, wie es die vorkonziliaren Dokumente lehrten und wie es das katholische Milieu verkörperte. Stattdessen bekennt sich die Pastoralkonstitution dazu, daß sich „diese Gemeinschaft [die Kirche] … mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden (erfährt).“[94] Adressatenschaft und Auftrag des Konzils und auch des kirchlichen Wirkens werden von der Konstitution klar benannt: „Vor seinen [des Konzils, MR] Augen steht also die Welt der Menschen, das heißt die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in der sie lebt; … bestimmt, umgestaltet zu werden nach Gottes Heilsratschluß …“.[95]
Diese Aussagen des Konzils in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute (sozusagen der Selbstvergewisserung ihres Außenauftrags) korrespondiert mit den Aussagen der Dogmatischen Konstitution über die Kirche (sozusagen der Selbstvergewisserung ihrer Identität), welche im Feld der Ekklesiologie der hier dargelegten Konzilshermeneutik den Weg bereitet hat. Hier versteht sich die Kirche dogmatisch als „Sakrament der Völker“ und bringt damit zum Ausdruck, daß die Kirche „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“[96] zu sein beansprucht. Gemeint ist damit, daß die Bezogenheit der Kirche auf die Welt, insofern sie diese auf Gott ausrichten soll, für die Kirche konstitutiv und wesentlich ist.
Es geht der Kirche also gerade nicht mehr darum, übernatürlicher Gegenpol zur Gesellschaft zu sein. Vielmehr sind Innen und Außen für die Kirche keine getrennten Größen mehr; und gerade in der Brücke zwischen Innen und Außen, zwischen Innenleben und Weltauftrag, zwischen ‘Sammlung’ und ‘Sendung’ besteht die Identität der Kirche. Die Pastoral als „Brückenbau“ wird somit zur „neue(n) Konstitutionsgröße der Kirche“, zu ihrer neuen Existenzweise in der modernen Welt.[97]
1.2.2 Der Stellenwert der Diakonie in der Pastoral nach dem Konzept der ‘Grundvollzüge’ der Kirche
In unmittelbarer Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde es also erforderlich, dieses neue Pastoralverständnis in ihrem Inhalt und ihrer Struktur genauer zu bestimmen. Diese Neubestimmung verdichtet sich in der Rede von den ‘Grundvollzügen’ oder ‘Wesensfunktionen’ der Kirche, welche sich zu einem neuen Theorem in der deutschsprachigen katholischen Ekklesiologie und Pastoraltheologie entwickelt: Neben dem Verkündigungsdienst des Evangeliums („Martyria“) und der gottesdienstlichen Feier („Liturgie“) wird nun auch der Sozialdienst an den Menschen inner- und außerhalb der Kirche („Diakonie“) zum identitätsrelevanten Merkmal der Kirche. „Gemeinschaft“ („Koinonia“) wird darüber hinaus als die integrierende Klammer und der Vollzugsraum der drei Dienste im Sinne eines vierten Wesensmerkmals angeführt.
Aus heutiger Sicht ist die Entstehung des Grundvollzüge-Konzepts im allgemeinen und speziell die Rede von Diakonie als Grundvollzug der Kirche nicht nur als ein innerkirchliches Phänomen im Anschluß an das Konzil zu bewerten. Vielmehr stellen sie auch eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen dar, welche es erforderlich machen, Rolle, Funktion und Ort der Kirche in der modernen Gesellschaft zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist dann vor allem auch die neue Betonung des Stellenwerts der Diakonie in der Kirche einzuordnen.[98] Als vor allem normatives Konzept wird seine Bedeutung dementsprechend unter anderem darin gesehen, die Kirche in ihrem Ringen um gesellschaftliches Überleben legitimieren zu helfen.[99]
Von seinem Ursprung her ist das Grundvollzüge-Konzept zunächst einmal der Versuch einer Strukturierung der kirchlichen (Gemeinde-) Praxis, der jedoch mit der Thematisierung identitätsrelevanter Praxisformen („Wesensfunktionen“) nicht auf eine rein praktische Frage beschränkt bleibt, sondern auch in den systematisch-ekklesiologischen Bereich hineinragt. Insofern hat seit den 1990er Jahren die Unterscheidung der kirchlichen Grundvollzüge auch in die systematischen Ekklesiologien Eingang gefunden[100] - jedoch ohne eingehendere Problematisierung. Demgegenüber hat das Konzept in der Praktischen Theologie etwa ab Mitte der 1980er Jahre eine lebhafte Auseinandersetzung erlebt. Diese entzündete sich an den Fragen nach dem Verhältnis der Grundvollzüge zueinander, nach deren Gleichrangigkeit oder der Bevorzugung einzelner, sowie der Identifizierung und Definition der einzelnen Grundvollzüge und damit deren Anzahl. Dabei war insbesondere die Verortung der Diakonie immer wieder strittig, so daß in der Diskussion zunehmend auch ein Interesse an der kirchenpraktischen Aufwertung der Diakonie zum Tragen kam. Im folgenden soll es daher darum gehen, die wichtigsten Positionen und Diskussionen um diese Problematik nachzuzeichnen und damit eine Profilierung von Funktion und Stellenwert der Diakonie in der kirchlichen Pastoral zu gewinnen. Zuvor allerdings wird auf die anfänglichen Entwürfe eingegangen, welche überhaupt erst zur ausdrücklichen Anerkennung von Diakonie als kirchlichem Grundvollzug geführt haben.
1.2.2.1 Die Anerkennung von Diakonie als kirchlicher Grundvollzug - Die Entstehung des Grundvollzüge-Konzepts
Zunächst war es insbesondere Karl Rahner, der in der Konzeption des von ihm mitherausgegebenen „Handbuch der Pastoraltheologie“ (1964-72)[102] das Konzept der Grundvollzüge verwendet und ihm damit eine große Öffentlichkeit verschafft[101][103]. Rahner unterscheidet zwar zunächst sechs Grundvollzüge, die er dann allerdings in den drei Gruppen „Wortverkündigung - Eucharistie - Leben der Liebe“ zusammenfaßt, womit er quasi die Diakonie als Thema in der katholischen Pastoraltheologie einführt. Dabei betont Rahner zwar den Zusammenhang und die gegenseitige Bedingtheit der Grundvollzüge, jedoch verbleibt er bei einer Beschreibung der kirchlichen Praxis, der er noch keine theologische Fundierung verleiht.
Dies geschieht 1965 bei Ferdinand Klostermann, der die Trias „Verkündigung des Wortes, Kult und Bruderliebe“ um das „Prinzip Gemeinde“[104] erweitert und dem Grundvollzüge-Konzept den Charakter einer „theologisch normierende(n) Nennung der für eine christliche Gemeinde konstitutiven Elemente“[105] verleiht. Bei Klostermann wird also die Diakonie nicht nur pragmatisch, sondern theologisch fundiert als Wesensmerkmal der Kirche verstanden, wobei sie allerdings tendenziell auf die Gemeindemitglieder begrenzt bleibt.
Ähnlich wie Klostermann versteht auch Wilhelm Zauner die drei Grundvollzüge als Voraussetzung für eine authentische christliche Gemeinde. Zauners Ansatz hebt sich insofern von den vorigen ab, als er eine Integration und gegenseitige Bedingtheit der drei Grundvollzüge fordert, um auch innerhalb des Grundvollzüge-Konzepts eine Marginalisierung der Diakonie zu überwinden. Dabei gelten für ihn die Grundvollzüge als untereinander gleichberechtigt.
Auch Karl Lehmann teilt die Einteilung der drei Grundvollzüge, wobei ihm die Diakonie („Bruderdienst“) als Teil der Identität der christlichen Gemeinde wichtig ist. Die beabsichtigte Integration bringt Lehmann auf die Formel von der „Gleichursprünglichkeit und gegenseitige(n) Vollendung der Grundfunktionen“.[106] Dabei sieht er die drei Grundvollzüge als ein notwendiges Kriterium für die Verwirklichung einer christlichen Gemeinde, hält das Konzept aber auch gleichzeitig für einen Freiraum für die Gemeinden, je nach den situativen Erfordernissen eigene Schwerpunkte zu setzen. Grundsätzlich geht er aber von deren Gleichberechtigung aus.
1.2.2.2 Die Profilierung der Diakonie als kirchlicher Grundvollzug - Verschiedene Positionen zu Funktion und Stellenwert der Diakonie im Grundvollzüge-Konzept
Von dem bislang sich durchsetzenden Konzept der drei Grundvollzüge Martyria - Liturgia -Diakonia setzen sich die Pastoraltheologen Rolf Zerfaß, Hermann Steinkamp, Urs Eigenmann, Herbert Haslinger und Ottmar Fuchs ab, indem sie sich z.T. einschlägig um eine genauere Profilierung der Diakonie in diesem Konzept bemühen und indem sie je eigenständige Bestimmungen der inhaltlichen Kontur und des Verhältnisses der Grundvollzüge untereinander vornehmen.[107] Mithilfe dieser Konzepte, die in ihrer Eigenständigkeit anerkannt und damit sinnvollerweise nicht von den jeweiligen Autoren abgetrennt werden sollten, können dementsprechend die Bezüge von Diakonie zu Gemeinde (R. Zerfaß, H. Steinkamp), zur Gesamtheit der Grundvollzüge (U. Eigenmann, H. Haslinger) sowie zur Verkündigung (O. Fuchs) in ihrer speziellen Akzentuierung herausgearbeitet werden.
a) Diakonie nach außen und Gemeinschaft nach innen (Rolf Zerfaß)
Rolf Zerfaß[108] kritisiert zunächst Unklarheiten im Verständnis von Diakonie und differenziert erstmals zwischen der „binnenkirchlichen Brüderlichkeit“[109] und der Zuwendung zu Menschen in Not allgemein. Es geht ihm dabei darum, die Zuwendung zum Notleidenden aus dem Verdacht herauszulösen, daß sie nur dem Gemeindemitglied zukomme oder nur auf Integration des Betroffenen als Gemeindemitglied ausgerichtet sei.[110] Die binnenkirchliche Brüderlichkeit bezeichnet Zerfaß in Rückgriff auf das Neue Testament mit dem Begriff Koinonia (Gemeinschaft) und qualifiziert sie als eigenen Grundvollzug, wobei diese die Liturgie in sich enthält, so daß Zerfaß wiederum mit drei Grundvollzügen argumentiert, nämlich Martyria, Koinonia und Diakonia. Die Auflösung der Liturgia in der Koinonia wird aus exegetischer Perspektive auch von Joachim Gnilka unterstützt, da Koinonia im Gegensatz zu Liturgia einen neutestamentlichen Begriff darstellt und da er die doppelte sakramentale Struktur von Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft der Gemeindemitglieder untereinander deutlicher zum Ausdruck bringe.[111]
Wichtig für das Verständnis von Zerfaß’ Ansatz ist, daß er die drei Grundvollzüge nicht als eine „sektorale Gliederung als Handlungs felder“ versteht, sondern als „eine dimensionale Gliederung als Koordinaten eines Handlungs raumes“.[112] Es geht also nicht darum, einzelne pastorale Aufgaben oder Tätigkeiten einem der drei Grundvollzüge zuzuordnen, sondern in den jeweiligen Aufgaben und Tätigkeiten deren jeweilige diakonische, verkündigende bzw. gemeinschaftliche Dimension auszumachen. Allerdings versucht er dennoch, die Grundvollzüge durch offenkundige Praxisbereiche zu kennzeichnen.
Die Bedeutung des Grundvollzüge-Konzepts bei Zerfaß liegt darin, daß die Diakonie ein spezifisches Profil gewinnt und damit die Sorge um jegliche Notleidenden unabhängig vom Gemeindebezug als Identitätsmerkmal der christlichen Gemeinde radikalisiert wird.[113]
b) Gemeinschaft und Gemeinde als Urform von Diakonie (Hermann Steinkamh6)
Eine Konzentration auf die Verknüpfung von Gemeinde und der Sorge um Notleidende stellt die Konzeption Hermann Steinkamps dar. Zunächst ist sie jedoch weitgehend ein Ausbruch aus dem traditionellen Grundvollzüge-Konzept. Er problematisiert, daß „die ständige Wiederholung der Trias und die Behauptung ihrer Gleichwertigkeit und jeweiligen Unverzichtbarkeit eher wie eine Beschwörung“[114] klinge, und unterstellt, daß es sich dabei weniger „um eine - auch empirisch - theoriefähige Aussage“, sondern vielmehr „um einen Versuch, kontrafaktisch, das heißt gegen eine andere ‘schlechtere’ Praxis ein Ideal hochzuhalten“ handele.[115] Wohlwissend um die Problematik eines theoretischen Konstrukts versucht Steinkamp dennoch ein Konzept zu entwickeln, für dessen Ausgangspunkt er das Gemeindemodell der Basisgemeinden und deren Option für die Armen in Anlehnung an Leonardo Boff wählt:
- ‘Basis’ als soziologische Kategorie meint die Armen als das „unten“ in der Gesellschaftsstruktur. Basisgemeinde impliziert daher per se eine Option für die Armen, so daß die Basisgemeinden „in sich Diakonie“[116] sind.
- ‘Basisgemeinde’ als pastoraler Begriff bringt zum Ausdruck, daß es sich um eine „kleine Gemeinschaft“ - so der in Afrika gebräuchlichere Begriff - handelt, deren Struktur authentische Gemeinschaftserfahrungen ermöglicht. Angesichts der Grunderfahrung gesellschaftlicher Anonymität bedeutet dies, daß „das ‘personale Angebot’ einer Basisgruppe, einer Basisgemeinde, … Diakonie ist“.[117]
- ‘Basis’ wird assoziiert mit der Praxis der Alphabetisierung und Bewußtseinsbildung, welche in ihrer politischen Dimension Dienst an den ‘Sprachlosen’ sind und insofern diakonische Qualität haben.[118]
In der Auseinandersetzung mit hiesigen Kirchengemeindestrukturen kritisiert Steinkamp daher nicht so sehr die ‘Diakonievergessenheit kirchlicher Gemeinden’, sondern vielmehr deren ‘Koinonia-Defizit’: Allein schon aus soziologischer Sicht ist die Chance zur Vermittlung von „Koinonia-Erfahrungen“ in hiesigen Pfarreien „minimal“. Koinonia wirkt insofern auch nicht mehr als „integrierende Klammer“ oder als „integrative Funktion dimensional ‘in’ den drei anderen“ Grundfunktionen Liturgie, Verkündigung und Diakonie.[119] Aufgrund dieser potentiell integrativen Funktion allerdings betont Steinkamp den „Primat der Koinonia“[120] - wobei für ihn Koinonia und Diakonia untrennbar zusammengehören und die beiden Grundvollzüge der Kirche ausmachen:
„Nicht mehr die herabneigende Geste des Besitzenden der sich dem Armen zuwendet, ist das Symbol der Diakonie, sondern der Akt der Solidarisierung ! Koinonia als neue Bezeichnung für das, was bisher Diakonie hieß? … Ist die ‘alte’ Diakonie nicht in einem Verständnis von Koinonia ‘aufgehoben’, in dem das ‘Teilen’ das ‘Helfen’ überflüssig macht?“ – „Wo in der diakonischen Praxis der Gemeinde Geben und Nehmen in einem so tiefen Sinn erfahrbar wird, … wird Solidarität gelernt und Koinonia als Urform der Diakonie erfahren.“[121]
Für Steinkamp kommt also der Koinonia nur dann ein Primat zu, insofern sie die ‘Urform der Diakonie’ ist und damit „die Koinoniahaftigkeit der Basisgemeinden … ihre Diakonie“[122] darstellt.
c) Der diakonische Charakter aller kirchlichen Vollzüge auf der Basis der Reich-Gottes-Praxis Jesu (Urs Eigenmann)
Urs Eigenmann[123] richtet seine Argumentation bibeltheologisch aus und geht von der Gemeindebeschreibung in der Apostelgeschichte aus (Apg 2, 42-47). Seine Einteilung in vier Grundvollzüge bringt nochmals neue Aspekte in die Diskussion: Koinonia als Aufbau von Gemeinschaft und Gemeinde - Liturgie und Verkündigung als symbolischer Ausdruck des Glaubens - Katechese und Bildung als Reflexion des Glaubens - Diakonie als Einsatz für ein erfülltes Leben aller Menschen.[124] Auffallend ist die Kombination von Liturgie und Verkündigung als Symbolisierung des Glaubens sowie die Hinzunahme der Glaubensreflexion in Katechese und Bildung.
Von Bedeutung ist bei Eigenmann die inhaltliche Profilierung der einzelnen Grundvollzüge, indem er sie nämlich alle konsequent theologisch von der Reich-Gottes-Praxis und -Botschaft Jesu als „verbindlichem Maßstab“[125] und damit von einer diakonischen Perspektive her bestimmt[126]: So ist Gemeinschaftsstiftung gerade Integration benachteiligter Menschen; die Symbolisierung der Glaubens stützt sich auf die ‘Vergegenwärtigung der Reich-Gottes-Praxis Jesu’ und insofern auf dessen solidarisches Wirken zugunsten der Benachteiligten; Katechese und Bildung sind die notwendige Bewußtseinsbildung, daß die Reich-Gottes-Botschaft Jesu eine klare Option für benachteiligte Menschen zum Gegenstand hat; Diakonie schließlich ist die konkrete und tätige Zuwendung zu den Armen und Benachteiligten.[127] In Anlehnung an Ottmar Fuchs[128] ist die Diakonie für Eigenmann folglich nicht nur ein Grundvollzug unter anderen, sondern der schlechthin identitätsstiftende Grundvollzug für die christliche Gemeinde wie auch für die anderen Grundvollzüge. Der Diakonie kommt somit ein prinzipieller Primat unter den Grundvollzügen zu, derart, daß „sich auch die anderen Grundvollzüge als in sich diakonisch erweisen müssen, um authentisch christlich zu sein“.[129] Im Zusammenhang mit dieser Priorität und Identitätsfunktion der Diakonie spricht Eigenmann innerhalb seiner vier Grundvollzüge aber auch von einer „Achse Koinonie-Diakonie“, insofern Liturgie / Verkündigung und Bildung / Katechese nicht Selbstzweck sind, sondern sich der Achse Koinonie-Diakonie zu- und unterzuordnen haben.[130] Dabei betont er aufgrund der alleinigen Eindeutigkeit die praktische Realisierung von Diakonie und Koinonie als vorrangig und entscheidend.[131] Mit dieser „Achse“ ergibt sich ein Berührungspunkt mit der Konzeption von Hermann Steinkamp.
d) Der Vorrang der Diakonie durch die Notwendigkeit ihrer Unverzweckbarkeit (Herbert Haslinger)
Auch Herbert Haslinger[132] leitet aus seiner Forderung nach diakonischen Gemeinden einen Primat der Diakonie ab, wobei er allen vier gängigen Grundvollzügen aufgrund ihrer Verankerung in neutestamentlichen Motiven gemeindekonstitutive Bedeutung zuspricht. Dabei versteht er die Grundvollzüge nicht als Praxisfelder, sondern als Praxisdimensionen, die sich gegenseitig überschneiden und die sowohl in „konzentriert-expliziten“ als auch „diffus-impliziten Formen“[133] vorkommen.
Den Vorrang der Diakonie begründet Haslinger damit, daß
„es zwar für Liturgie, Koinonia und Verkündigung keine diakoniefreien Räume gibt, umgekehrt aber für die Diakonie Situationen angenommen werden, die vom Anspruch der Liturgie, der Gemeinschaftsbildung oder der Verkündigung nicht belegt sind“[134],
d.h. daß Diakonie sich nicht auf die drei anderen Grundvollzüge zurückbeziehen muß, jedoch umgekehrt diese drei diakonische Qualität aufweisen müssen, insofern sie „von den Menschen, mit Vorrang von den notleidenden, nicht als unterdrückend-entwürdigend, sondern als heilend-befreiend erfahren werden“.[135] Die damit verbundene „Vereinseitigung“ ist von Haslinger beabsichtigt, was sich für ihn dadurch rechtfertigt, daß Glaube und Glaubenspraxis erst in der Diakonie als glaubwürdig und authentisch christlich anerkannt werden. Dies begründet sich darin, daß bei Jesus selbst seine Reich-Gottes-Verkündigung, sein Feiern, seine Gemeinschaftsbildungen und sein heilendes Tun jeweils den notleidenden, ausgestoßenen oder entrechteten Menschen in den Mittelpunkt stellten und damit in sich diakonisch strukturiert waren, so daß diese diakonische Struktur auch für christliche Gemeinden unabdingbar ist. Darüber hinaus ist - von der Diakonie selbst her betrachtet - nur durch den Primat authentische Diakonie möglich, da nach Haslingers Verständnis sich die Diakonie als „Verantwortung für den Anderen“ im „Angesicht des Anderen“ (und in der verantwortlichen Begegnung mit dem Anderen auch als Begegnung mit Gott) definiert.[136] Diakonie zu verzwecken, indem sie als defizitär angesehen und erst aufgrund der Ergänzung durch andere Grundvollzüge als christlich und vollständig anerkannt würde, bedeutete demnach gerade einen Verrat an der Verantwortung gegenüber dem Anderen und damit auch an der Verantwortung gegenüber Gott.[137]
Diese Primatszuschreibung ist für Haslinger allerdings nur auf einer qualitativen Ebene sinnvoll, wenn also Diakonie als Querschnittsdimension aller kirchlichen Praxisvollzüge verstanden wird. Als nur quantitativ abgrenzbares Handlungsfeld wäre sie sinnlos, weil sich damit unterschiedliche Primatsansprüche konterkarieren und somit auf das Anliegen einer Qualifikation der Gesamtpastoral kontraproduktiv auswirken würden. Dies kann nur dadurch umgangen werden, daß nicht eine Verdrängung, sondern eine Prägung der Grundvollzüge und damit der kirchlichen Praxis in ihrer Gesamtheit durch die Diakonie erfolgt.[138]
e) Wechselseitige Verschränkung und Ideologiekritik von Verkündigung und Diakonie (Ottmar Fuchs)
Auch die Konzeption von Ottmar Fuchs hebt sich von den anfänglichen und sonstigen Konzepten deutlich ab, indem er das Zueinander der Grundvollzüge erheblich differenzierter beschreibt und problematisiert, als dies bislang der Fall war, und infolgedessen auch vom Prinzip der Gleichrangigkeit der Grundvollzüge endgültig Abschied nimmt und konzeptionell zwei Ebenen unterscheidet.
Fuchs geht in seiner Argumentation von der Evangelisierung aus[139], woraus sich zunächst ergibt, daß „die Martyria und Diakonia … in einer anderen Weise christologische Qualitäten der Evangelisierung als die Koinonia“[140] bezeichnen, insofern sie „inhaltlich und praktisch zusammen so eindeutig von Jesus Christus her definiert sind, daß sie keinem Ambivalenzverdacht ausgesetzt“[141] sind. Nur Verkündigung und Diakonie sind „Wesensvollzüge“, da nur sie als solche und nicht aufgrund eines Rückbezugs auf andere Selbstvollzüge kirchliche Identität begründen. Darin liegt genau der Unterschied zu Koinonia und Liturgie, insofern nämlich beide nicht automatisch das Anliegen Jesu transportieren und von daher ambivalent sind: Gemeinschaftsbildung kann in jedwedem Interesse - und damit auch entgegen der Intention des christlichen Glaubens - geschehen; und Kulthandlungen entsprechen ebenfalls nicht von selbst dem Anliegen Jesu, wie es dessen eigene Kultkritik und Tempelreinigung klar belegen. Koinonia und Liturgia sind demnach nur dann kirchliche Selbstvollzüge, wenn sie ihre Ambivalenz überwinden, indem sie auf Diakonia und Martyria als „nicht mehr hintergehbare Grunddimensionen“[142] zurückgeführt und inhaltlich gefüllt werden.
Vor diesem Hintergrund der Zweistufigkeit der Grundvollzüge - womit keinem der Charakter als Grundvollzug abgesprochen werden soll - ergibt sich dann die Frage der Verhältnisbestimmung der Grundvollzüge auf unterschiedlichen Ebenen: die Beziehung zwischen den beiden primären Grundvollzügen Verkündigung und Diakonie sowie das Verhältnis der Koinonia gegenüber diesen beiden.[143]
Diakonie und Verkündigung stellen zwei sich überlappende Bereich dar, die jeweils eigenständige Teilmengen als auch eine Schnittmenge besitzen. Der Überschneidungsbereich umfaßt diejenigen Vollzüge, in welchen beide Dimensionen miteinander artikuliert und zueinander bzw. aufeinanderhin bezogen und damit explizit ausgesprochen werden. Es sind dies beispielsweise: wenn in der Verkündigung die Diakonie zu Wort kommt oder wenn Caritaspersonal seine christlichen Motivationen bespricht. Die eigenständigen Bereiche sind diejenigen, in denen diese explizite Bezugnahme nicht stattfindet, in denen „der jeweils andere Bereich zwar notwendig, aber nur implizit im Aggregatzustand seiner Andersheit enthalten“ ist.[144] Dabei geht es nicht darum, daß die Eigenständigkeit eine Ignoranz bezüglich des jeweils anderen zum Ausdruck bringt. Vielmehr bedarf es des wechselseitigen Kontaktes und Austausches, durch den „sie sich gegenseitig und ineinander entdecken und schätzen lernen“.[145] Dadurch ist ermöglicht und legitimiert, daß nicht jeder Einzelne und jede Gemeinschaft beide Bereiche selbst und umfassend abdecken müssen, sondern daß sowohl den individuellen als auch den kollektiven Begabungen („Charismen“) Rechnung getragen werden darf - ja muß. Gerade dadurch, daß Fuchs beide - Diakonie und Verkündigung - als „aufeinander bezogen, und zwar ungetrennt und unvermischt in einer relationalen (nicht identischen) Einheit“[146] bestimmt, kann die jeweils eine gegenüber der anderen Kritik anbringen und damit ideologiekritische Funktion übernehmen. Durch die Differenz beider sind sie sich gegenseitig Ergänzung und Korrektur zugleich.[147] Speziell die Diakonie bringt dabei ein entgrenzendes Moment ein, indem sie nämlich nach innen inhaltliche Verengung aufbricht und nach außen Solidarisierung mit der Gemeindeumwelt einfordert: sie „provoziert … damit eine permanente Entideologisierung des Glaubens und Entorganisierung institutioneller Grenzen“.[148]
Damit kommt die Rolle der Koinonia grundsätzlich ins Spiel: Die Zusammengehörigkeit von Diakonie und Verkündigung ist nur über die Gemeinschaft realisierbar, sie ist der Ort oder die Sozialform, in der beide Wesensvollzüge „beieinanderbleiben“ können. Zwischen Martyria / Diakonia und Koinonia ergibt sich also eine mehrfache gegenseitige Verknüpfung: Die kirchliche Gemeinschaft ist notwendig für eine authentische Diakonie und Verkündigung, insofern christlich gelebte Gemeinschaft Entmündigung durch Herrschaftswissen und Objekt-Betreuung in der Verkündigung und Diakonie zu verhindern ermöglicht; damit die Koinonia dies erfüllen kann ist aber wiederum nötig, daß sie sich inhaltlich und strukturell von Diakonie und Verkündigung her definiert. Dabei macht die Diakonie, wenn (und nur wenn) sie sich immer wieder in der Koinonia „einklagt“, diese Koinonia zur Grundlage einer ‘Diakonie für die Welt’ und dadurch die Kirche zu einer „Kirche für andere“, weswegen der Diakonie eine „prinzipielle Priorität“ und „nicht nur … eine ‘situative Prävalenz … unter bestimmten Bedingungen der Gemeindewirklichkeit’“ zukommt.[149]
In der Revision des bislang beschriebenen Konzepts anerkennt Fuchs, daß die Koinonia nicht nur in ihrem Dienstcharakter gegenüber den beiden primären Grundvollzügen, sondern als Lern- und Vollzugsort von Glauben und christlichem Handeln auch eigenständiger Grundvollzug der Kirche ist.[150] Den ausdrücklichen Einbezug der Liturgie sieht er dann auch deshalb für angemessen, weil sie jene „Symboldramatik, die die ‘normale’ Koinonia nicht besitzt“, eben besitzt und weil sie damit in spezifischer Weise neben der Gemeinschaft der Menschen untereinander auch deren Gemeinschaft mit Gott hervorhebt.[151]
Insgesamt ist mit der Unterscheidung von (auf nichts anderes zurückverweisbaren, unmittelbar identitätsstiftenden) Wesens- und (notwendigerweise zurückzuverweisenden, mittelbar identitätsstiftenden) Handlungsvollzügen dem Spannungsfeld zwischen Grundvollzügen als Handlungsfelder und als Handlungsdimensionen Rechnung getragen worden, ohne die Verflechtung von Handlungsfeldern und -dimensionen außer acht zu lassen. Gleichzeitig gelingt es dabei, die tendenziell kontrafaktischen Primatszuschreibungen für die Diakonie zu relativieren[152] und in ein Gesamtkonzept zu integrieren, das sowohl die Tatsachen als auch einen tatsachenkritischen Alternativentwurf integriert. Dies wird erreicht aufgrund der systematischen Tiefe der Reflexion sowie ihrer ständigen Rückkopplung auf die realen Gegebenheiten der kirchlichen Selbstverwirklichung in Pastoral und Diakonie.
Zusammenfassung: Einheit in der Verschiedenheit der Grundvollzüge-Konzeptionen
Obwohl die dargestellten Entwürfe sehr unterschiedlich sind, stellen sie sich bei genauerer Betrachtung als gar nicht so widersprüchlich heraus. Den Versuch einer entsprechenden Konsensbildung hat neuerdings Ottmar Fuchs unternommen. Dabei geht er auf dem Hintergrund seiner eigenen Konzeption von einer fundamentalen Unterscheidung in transzendentale Seins- bzw. Wesensvollzüge und kategoriale Handlungs- bzw. Praxisvollzüge aus: unter letzteren siedelt er alle vier traditionellen Grundvollzüge Verkündigung, Diakonie, Liturgie und Gemeinschaft an, die allerdings auf nur zwei Wesensvollzüge zurückgeführt werden müssen - nämlich auf Martyria und Diakonia.[153] Diese ‘Zurückführung’ ist im Grunde das, was Haslinger und Eigenmann Prägekraft bzw. Qualifizierung nennen, allerdings auf übergeordneter Ebene nur der Diakonie, nicht aber auch der Verkündigung zugewiesen hatten. Bei beiden gilt die diakonische Strukturierung allerdings auch dem Praxisfeld Diakonie, so daß auch hier - allerdings implizit - Diakonie sowohl als Wesens- wie auch als Praxisvollzug verstanden wird.
1.2.3 „Kirche der Armen“ als befreiungstheologisches Modell zur Integration von Diakonie und Gemeinde
Einen anderen Weg der Umsetzung der neuen Weltbezogenheit des Konzils hat die lateinamerikanische Kirche in ihrer befreiungsorientierten Theologie und Pastoral eingeschlagen. Bereits auf dem Konzil hatte der Bologneser Kardinal Lercaro betont, daß das Thema der Öffnung zur Welt nur in der Perspektive der Armen angemessen zu behandeln sei, womit er das Anliegen Papst Johannes’ XXIII. von der Kirche der Armen aufgegriffen hatte.[154] Wenn auch die „Kirche der Armen“ dessen ungeachtet nicht zum Zentralthema des Konzils geworden ist, so hat das Anliegen dennoch in verschiedenen Dokumenten seinen Widerhall gefunden. Nach Gaudium et Spes gilt die Solidarität der Kirche vorrangig den Armen und Benachteiligten[155], und auch Lumen Gentium weist der Armut eine grundlegende Bedeutung für die Kirche zu: In den Armen begegnet die Kirche ihrem Gründer Jesus Christus, dessen Zuwendung zu den Armen sie selbst fortzuführen beauftragt ist[156]. Demnach bezeichnet die Kirche für sich selbst einen Weg der Armut und einen Dienst an den Armen als wesentlich. Dieses Verständnis durchdringt jedoch keineswegs die Gesamtheit der Konzilstexte[157], so daß offen bleibt, inwiefern die Solidarität mit den Armen und der diakonische Dienst an ihnen wirklich zur Wesensdimension der Kirche geworden sind.
Erst die Zweite Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Medellín 1968, die sich die Umsetzung des Konzils für Lateinamerika zur Aufgabe gemacht hatte, macht die Frage der Kirche der Armen zu ihrem Zentralthema. Dies geschieht auf der Grundlage dessen, daß in Lateinamerika die Öffnung zur Welt notgedrungen die Öffnung zu einer Welt der Armut bedeutet. Das Schlußdokument von Medellín wählt in der Analyse der sozialen Wirklichkeit Lateinamerikas ganz klar diejenige Realität aus, die von Armut und Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist, und macht sie zum Strukturierungsprinzip seiner gesamten Überlegungen.[158] Dies setzt sich bis in die Selbstreflexion der Kirche Lateinamerikas fort, deren Selbstverständnis unter dem Titel „Armut der Kirche“ behandelt wird. In dessen Mitte wird „die Kirche als Zeichen dieser Armut unter den Menschen“ zurückgebunden an Jesu Liebe zu den Armen, sein Arm-Sein und seine Befreiungsbotschaft für die Armen.[159]
Wie die spätere befreiungstheologische Ekklesiologie herausarbeitet, geht es dabei um eine doppelte Bezogenheit der Kirche auf die Welt und auf die Offenbarung in Jesus Christus[160], die hier in ganz spezifischer Weise konkretisiert werden als Welt der Armut und als Offenbarung Gottes in den Armen als den Repräsentanten des armen Jesus Christus[161]. Insofern ist die Kirche der Armen zunächst situationsbezogen für die Dritte Welt, aufgrund der weltweiten Verflechtungen aber auch für die Gesamtkirche, diejenige Kirchengestalt, die dem Heilsplan Gottes in der gegenwärtigen Geschichte gerecht werden kann:[162]
„Nur in der Selbstentäußerung, in der Selbsthingabe an den bedürftigen Menschen bis zum Tod … kann die Kirche den Anspruch erheben, geschichtliches Sakrament der Erlösung in Christus zu sein.“[163]
Daher „verwirklicht sich die Arme Kirche und die Kirche der Armen nicht in einem ethischen Verhalten der ‘Hilfe’ für den Armen, noch der ‘Option’ für den Armen, die von einer Minderheit einer Kirche gemacht werden, die zufrieden und angepaßt sein könnte und sich menschenfreundlich zum Armen herabläßt.“[164]
Wesentlich ist vielmehr, daß in direktem Zusammenhang mit der sozialen Wirklichkeit das pastorale Handeln und die theologische Substanz der Kirche aufs engste miteinander verknüpft werden.[165] Die Option für die Armen und die Rede von der Kirche der Armen bedeuten damit
„nicht nur, daß man die sozialen Aspekte ihres Sendungsauftrags betont, sondern in erster Linie, daß man sich auf ihr eigentliches Wesen als Zeichen des Reiches Gottes bezieht“.[166]
Daher wird die Option für die Armen auch bezeichnet als „ein wesentliches und konstitutives Charakteristikum des Geheimnisses der Kirche“[167], als „eine Art übernatürliches und geschichtliches Existential, welches das ganze Sein und Tun der Kirche umfaßt“[168].
Die Armen sind also nicht bloßes Betreuungsobjekt kirchlichen Handelns, sondern deren handelndes „Hauptsubjekt“[169], zumal sie ja faktisch die Kirchen der Dritten Welt und damit die Weltkirche mehrheitlich konstituieren. Die Armen sind daher „Strukturierungs-, Organisations- und Sendungsprinzip“[170] der Kirche und aufgrund dieser Kombination sind sie „erste Empfänger des Reiches Gottes“ und seiner Gerechtigkeit sowie „bevorzugte Träger seiner sakramentalen Verwirklichung“[171].
Es ist offensichtlich, daß in dieser befreiungstheologischen Vorgehensweise die Frage der diakonischen Natur der Kirche in einer ganz anderen Art und Weise behandelt wird. Interessant daran ist im Vergleich zu dem im deutschen Sprachraum diskutierten Grundvollzüge-Konzept, wie es die Frage angeht. Das Grundvollzüge-Konzept geht von einer Beschreibung kirchlicher Praxisfelder aus, die dann z.T. ekklesiologisch-normativ transformiert wird, wobei allerdings gerade entgegen der normativen Kraft des Faktischen (‘kontrafaktisch’) dann das rechte Verständnis der Grundvollzüge, vor allem der Diakonie, und ihrer wechselseitigen Bezogenheit definiert wird. Das Konzept „Kirche der Armen“ dagegen entspringt sowohl der sozialen Situation als auch einer christologischen (d.h. gläubigen) Reflexion, aus deren Zusammentreffen und deren gegenseitiger Durchdringung dann eine Ekklesiologie entwickelt wird, in der der Diakonie ein entscheidender Platz zukommt und von der aus sich dann wiederum kirchliches Handeln praktisch-normativ inspiriert.
Es erscheint angebracht, am Konzept der Kirche der Armen zwei m.E. wichtige und positive Merkmale herauszuheben:
1. die enge Verknüpfung mit der sozialen Wirklichkeit, die einer eher binnenorientierten Perspektive des Grundvollzüge-Konzepts gegenübersteht. Diese Feststellung konkretisiert Elmar Klingers Vorwurf einer unzureichenden bzw. sogar unterbliebenen Rezeption der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes und ihres Pastoralverständnisses in der deutschen Kirche und Theologie sowie dessen für ihn vorbildliche Umsetzung in der lateinamerikanischen Kirche und der Theologie der Befreiung.[172]
2. die enge Verkoppelung von Pastoral- und Kirchenverständnis mit deren Trägern - nämlich den Menschen und den armen Menschen, die sich dem eher apersonalen und subjektlosen Charakter des Grundvollzüge-Konzepts entgegenstellt. Der Zuwendung zur Lebenssituation der Menschen durch das 2. Vatikanische Konzil ist demnach wiederum im lateinamerikanischen Ansatz deutlicher Rechnung getragen als im Konzept der Grundvollzüge.
1.2.4 Konsequenzen für das Verhältnis von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden
In der Gesamtschau der dargestellten Positionen und Modelle zeigt sich eine Vielfalt von Aspekten Problemstellungen und Begriffsebenen, die es nun gilt, für das hier verfolgte Anliegen der Vernetzung von Diakonieverbänden und Kirchengemeinden genauer auszuwerten und fruchtbar zu machen. Dabei geht es nicht darum, die verschiedenen Ansätze gegeneinander abzuwägen und zu diskutieren. Der Sinn der vorangegangen ausführlichen Darstellung und eingehenden Auseinandersetzung hat sich nun vielmehr gerade darin zu erweisen, die unterschiedlichen Aspekte im Blick auf die Verhältnisbestimmung von Kirchengemeinden und Diakonieverbänden, von kirchlicher „Erst- und Zweitstruktur“[173] zusammenzubringen und zu systematisieren. Dabei wird der Schwerpunkt allerdings auf die Auswertung der verschiedenen Grundvollzüge-Modelle zu legen sein, da sie der Fragestellung wegen derselben Verortung im kirchlichen System Deutschlands eindeutig näher liegen. Das Modell ‘Kirche der Armen’, wird dabei insbesondere in den herausgearbeiteten Differenzen zum Grundvollzüge-Konzept zu berücksichtigen sein.
[...]
[1] Dieses Anliegen wird wiederholt von Rainer Bucher vorgetragen. Vgl. Bucher, R.: Kirchenbildung in der Moderne (1998), S. 233; Bucher, R.: Desintegrationstendenzen der Kirche (2001). - In dieselbe Richtung zielt auch Ebertz, M.N.: Kirche im Gegenwind (1998), S. 140-145.
[2] Lechner, M:: Vorfeld oder ‘Kerngeschäft’? (2001), S. 10.
[3] Insofern ist Rainer Bucher zuzustimmen, wenn er die Beseitigung von Kooperationsproblemen hinsichtlich der Entwicklung einer Gesamtpastoral für nicht zielführend hält. Vgl. Bucher, R.: Kirchenbildung in der Moderne, S. 233 Anm. 51. Andererseits darf diese in ihrer Funktion als Wegbereiterin für eine Praxis von Gesamtpastoral aber auch nicht unterschätzt werden.
[4] Lehmann, K.: Caritas der Gemeinde (1974), S. 67 - Grundsatzreferat auf der Vertreterversammlung des Deutschen Caritasverbandes 1973.
[5] Vgl. Schüller, H.: Caritas - eine ‘verlorene’ Dimension der Gemeinde? (1993). Der Autor war damals Präsident der österreichischen Caritas.
[6] Zum folgenden Abschnitt vgl. Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit (1994), S. 198-210.
[7] Vgl. etwa Apostelgeschichte 2, 43-47; 4, 32-37 mit Apostelgeschichte 6,1-7.
[8] Nähere Erläuterungen zum Begriff Diakonieverband siehe. S. 20.
[9] Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Nr. 250.
[10] Frank, G. / Reis, C. / Wolf, M.: „Wenn man die Ideologie wegläßt, machen wir alle das gleiche“ (1994)
[11] Zu dieser Diskussion vgl. etwa: Boeßenecker, K.-H.: Marktorientierung in der Sozialen Arbeit ohne Alternative? (1999); Wohlfahrt, N.: Zwischen Ökonomisierung und verbandlicher Erneuerung (1999); Klug, W.: Die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege: Marktwirtschaft und Bewahrung der Identität (1997).
[12] Broll, B.: Steuerung kirchlicher Wohlfahrtspflege durch die verfaßten Kirchen (1999).
[13] Merchel, J.: Wohlfahrtsverbände auf dem Weg zum Versorgungsbetrieb? (1996), S. 297f.
[14] Merchel, J.: Wohlfahrtsverbände auf dem Weg zum Versorgungsbetrieb?, S. 298.
[15] Merchel, J.: Wohlfahrtsverbände auf dem Weg zum Versorgungsbetrieb?, S. 299.
[16] Deutscher Caritasverband: Leitbild (1997), S. 344-354.
[17] Deutscher Caritasverband: Leitbild, S. 350.
[18] Vgl. Merchel, J.: Wohlfahrtsverbände auf dem Weg zum Versorgungsbetrieb?, S. 308f; Öhlschläger, R.: Freie Wohlfahrtspflege im Aufbruch (1995), S. 15-17.
[19] Lechner, M.: Vorfeld oder ‘Kerngeschäft’?, S. 11.
[20] Vgl. hierzu zusammenfassend die von Matthias Mitzscherlich unternommene Analyse der beiden Caritas-Publikationsreihen caritas, Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes sowie Caritas, Zeitschrift für Caritasarbeit und Caritaswissenschaft. Der Autor nimmt hier die caritasverbandliche Rezeption der theologischen Rede von Caritas als Wesensdimension von Kirche unter die Lupe, wobei bereits der Blick in das Verzeichnis der hierzu veröffentlichten Beiträge deutlich macht, daß mit überwältigender Mehrheit Theologen und theologische Themen zu Wort kommen, während nur tendenziell zwei Beiträge auf einen sozialarbeitstheoretischen Hintergrund schließen lassen. Vgl. Mitzscherlich, M.: Caritas als Wesensdimension und Grundfunktion der Kirche (1997).
[21] Als aktuelles Beispiel ist hier Martin Pott’s Untersuchung zur „Kundenorientierung in Pastoral und Caritas“ hervorzuheben, dem es m.E. ganz gut gelingt, sich in theologischen wie sozialarbeitstheoretischen Debatten zu verorten und damit für beide Partner weiterführende Aussagen erzielt. Vgl. Pott, M.: Kundenorientierung in Pastoral und Caritas? (2001):
[22] Vgl. Interview B 149-151.
[23] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft (1996), S. 209.
[24] Vgl. Fuchs, O.: Heilen und befreien (1990), S. 139.
[25] Vgl. hierzu ausführlich Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit (1994), S. 198-210.
[26] Falterbaum, J.: Caritas und Diakonie (2000), S. 15.
[27] Der Frage der rechtlichen Beziehung widmen sich eingehend die Studien von Broll, B.: Steuerung kirchlicher Wohlfahrtspflege durch die verfaßten Kirchen (1999); sowie von Falterbaum, J.: Caritas und Diakonie. Struktur- und Rechtsfragen (2000).
[28] Falterbaum, J.: Caritas und Diakonie, S. 7.
[29] Vgl. Falterbaum, J.: Caritas und Diakonie, S. 164-167.
[30] Vgl. Gabriel, K.: Neue Nüchternheit. Wo steht die Religionssoziologie in Deutschland? (2000), S. 581ff.
[31] Vgl. Welker, M. (Hg.): Theologie und funktionale Systemtheorie (1985), S. 13.
[32] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft (1996), S. 240.
[33] Entgegen der Auffassung von Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 239f
[34] Vgl. insbesondere die in Kap. 1.2.2 aufgegriffenen Diskussionen.
[35] Vgl. Starnitzke, D.: Diakonie als soziales System (1996), S. 121. - Demgegenüber problematisiert Hermann Steinkamp den Diakoniebegriff Luhmanns wegen der diametralen Zuordnung von Diakonie als Leistung für gesellschaftliche und Seelsorge als Leistung für personale Systeme und markiert diesen daher als „inkonsistent“ (sh. unten Anm. 59), in anderem Kontext deutet er ihn allerdings wieder als „theoretisch präziser als der gängige theologische Begriff“. Vgl. Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit (1994), S. 178 (Anm. 77) sowie S. 223 (Anm. 109).
[36] Vgl. Art. Soziologische Theorien, in: Schäfers, B. (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie (41995), S. 313-323, insb. 313, 315f, 320.
[37] Luhmann, N.: Sinn als Grundbegriff der Soziologie (1971), S. 32.
[38] Ebd. S. 32.
[39] Vgl. Treibel, A.: Einführung in soziologische Theorien (1993), S. 23.
[40] Vgl. Weiss, H.: Soziologische Theorien der Gegenwart (1993), S. 42.
[41] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion (1977), S. 13, 73.
[42] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 13-20, 34f, vgl. auch Treibel, A.: Einführung in soziologische Theorien, S. 28f.
[43] Luhmann, N: Die Ausdifferenzierung der Religion (1989), S. 266.
[44] Luhmann, N.: Soziale Systeme (1984), S. 31.
[45] Luhmann, N.: Die Religion der Gesellschaft (2000), S. 288.
[46] Starnitzke, D.: Diakonie als soziales System, S. 127.
[47] Vgl. Luhmann, N.: Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen 1986, S. 46 – zitiert nach Starnitzke, D.: Diakonie als soziales System, S. 127.
[48] Vgl. Starnitzke, D.: Diakonie als soziales System, S. 127.
[49] Luhmann, N.: Die Ausdifferenzierung der Religion, S. 262.
[50] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 50.
[51] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 55f. Anzumerken ist, daß die Begrifflichkeit bei Luhmann nicht einheitlich ist. So spricht er auf S. 50 von „mindestens zwei Systemreferenzen“ und erwähnt diejenigen für das Gesamtsystem und diejenige für das Teilsystem, gemeint ist wohl die für die Umwelt. Auf S. 54f unterscheidet er dann „drei Typen von Systembeziehungen“, nämlich die zum Gesamtsystem, die zu Systemen der systeminternen Umwelt und die zu sich selbst, die er dann auf S. 56 als Funktion, Leistung und Reflexion bezeichnet. Diese Unterscheidung führt er dann grundsätzlich fort und kommt auf S. 261ff erneut darauf zurück. Da die beiden Unterscheidungen einander nicht widersprechen ist eine Entscheidung nicht erforderlich und wird im weiteren mit der Differenzierung in Funktion, Leistung und Reflexion gearbeitet, da sie für das Religionssystem die Wirklichkeit wohl angemessener wiedergibt.
[52] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 56.
[53] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 20, 33.
[54] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 36f.
[55] Vgl. Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft (1996), S. 229-231, vgl. Mette, N.: Kirchliches Handeln als „Kontingenzbewältigungspraxis“?(1978), Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 182: „Verarbeitung von Kontingenzen“.
[56] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 57.
[57] Alle Zitate dieses Abschnittes: Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 57-58.
[58] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 58.
[59] Entgegen Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 58. Vgl. auch die Kritik von Steinkamp, H.: Diakonie - Kennzeichen der Gemeinde (1985), S. 19f (Anm. 6), der von der „Inkonsistenz“ des luhmannschen Diakoniebegriffs spricht. Das Problem liegt im Grunde darin, daß Luhmanns Grenzziehungen zwischen Diakonie und Kirche / Leistung und Funktion mit größeren Überschneidungsbereichen zu rechnen haben. Gerade „Seelsorge“, die Luhmann als „Leistung“ versteht, muß wohl beiden Bereichen, der Sorge um den einzelnen Menschen und damit der Diakonie, sowie der geistlichen Kommunikation und Kontingenzbewältigungspraxis und damit der Kirche, zugerechnet werden. Die Problematik liegt dabei darin, daß der Seelsorgebegriff (der im katholischen Bereich heute weitgehend vom Begriff „Pastoral“ abgelöst wurde) nicht nur die Individualseelsorge als einen Nebenbereich bezeichnet, sondern im Grunde für die Gesamtheit kirchlicher Tätigkeit verwendet wird.
[60] Alle Zitate dieses Abschnittes: Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 266-268.
[61] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 232 (Hervorhebungen im Original).
[62] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 255.
[63] Vgl. Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 59, 268.
[64] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 268.
[65] Vgl. zum vorhergehenden insgesamt: Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 270.
[66] Diese Konsequenz läßt sich insbesondere in der ersten Phase von Luhmanns Systemtheorie ableiten, ist aber auch nach der „autopoietischen Wende“ nicht ausgeschlossen.
[67] Luhmann, N.: Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen (1972), S. 265.
[68] Vgl. dazu Luhmann, N.: Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, S. 275f.
[69] Etwa im Sinne der (theologisch begründeten) Forderung Moltmanns nach der „Diakonisierung der Gemeinde und Gemeindewerdung der Diakonie“. Vgl. Moltmann, J.: Diakonie im Horizont des Reiches Gottes (1984), S. 36.
[70] Vgl. Anm. 59.
[71] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 233.
[72] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 57.
[73] Vgl. Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 242: „Es wäre hingegen gerade im Rahmen des systemtheoretischen Grundaxioms, der Reduktion von Komplexität, theoretisch auch denkbar, die diakonische Tätigkeit der Kirche als deren primäre Funktion und somit als Verwirklichungsort des spezifisch Religiösen zu behaupten.“
[74] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 240. Dazu ist anzumerken, daß Luhmann nicht absichtlich normativ vorgeht; allerdings stellt Luhmann zu wenig heraus, daß es sich um (nur) gegenwartsbezogene Analysen handelt, was dazu führt, daß sie aufgrund des der Systemtheorie anhaftenden statischen Charakters dann als überzeitliche und damit normative Feststellungen erscheinen.
[75] Luhmann, N.: Funktion der Religion, S. 73.
[76] So werden Personen als „personale Systeme“ selbst wiederum als Umwelt eines sozialen Systems und nicht als dessen Teil (Subsystem) betrachtet. Soziale und personale Systeme erscheinen daher als getrennt, wobei die personalen Systeme den sozialen zwar in ihrem Sinnbezug ähnlich sind, gegenüber ihnen aber auch nachrangig behandelt werden. Vgl. Treibel, A.: Einführung in soziologische Theorien, S. 29-31.
[77] Vgl. Luhmann, N.: Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, S. 247-248.
[78] Dies wird zwar bei Luhmann, N.: Die Organisierbarkeit von Religionen und Kirchen, S. 275 thematisiert, jedoch handelt es sich nicht um eine durchgängige Perspektive seiner Argumentation.
[79] Vgl. dazu Broll, B.: Steuerung kirchlicher Wohlfahrtspflege durch die verfaßten Kirchen (1999), S. 347-370.
[80] Vgl. Wiedenhofer, S.: Ekklesiologie (1992), S. 86-88.
[81] Gabriel, K.: Christentum zwischen Tradition und Postmoderne (41994), S.96.
[82] Vgl. Gabriel, K.: Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, S. 124-127.
[83] Vgl. dazu Gutiérrez, G.: Das Konzil und die Kirche in der Welt der Armut (1997), S. 160.
[84] Rahner, K. / Vorgrimler, H.: Kleines Konzilskompendium (1974), S. 26.
[85] Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes (1990), S. 102.
[86] Zitiert nach Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 82.
[87] Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 90.
[88] Vgl. Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 91-94.
[89] Klinger, E.: Das Aggiornamento der Pastoralkonstitution (1996), S. 173 .
[90] Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 102.
[91] Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 69.
[92] Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes, S. 100.
[93] H.-J. Sander schreibt über den schließlich ausschlaggebenden Vorentwurf zur Pastoralkonstitution: „Die Kirche ist in der Welt nicht nur wirksam präsent (1. Fassung), oder aktiv präsent (Mecheln [= 2. Fassung, MR]), sondern sie partizipiert an der Welt, nimmt an ihrem Schicksal teil …“ Sander, H.-J.: Die Zeichen der Zeit (1997), S. 92, Hervorhebung im Original.
[94] Zweites Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, 1 – zu beachten ist die doppelte Verstärkung der Verbundenheit durch „engstens“ und „wirklich“.
[95] Zweites Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, 2
[96] Zweites Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, 1.
[97] Vgl. Sander, H.-J.: Die Zeichen der Zeit, S. 94.
[98] Vgl. Manderscheid, M.: [Diskussionsbeitrag] (1985), S. 12.
[99] Vgl. Steinkamp, H.: [Diskussionsbeitrag] (1985), S. 46.
[100] Vgl. Mitzscherlich, M.: Caritas als Wesensdimension (1997), S. 67-84.
[101] Vgl. dazu Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft (1996), S. 338-343, worauf sich die folgende Zusammenfassung bezieht.
[102] Arnold, F.X. / Rahner, K. / u.a. (Hg.): Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, 5 Bde., (1964-72).
[103] Vgl. Rahner, K.: Theologische und pastoraltheologische Vorüberlegung (1964).
[104] Klostermann, F.: Prinzip Gemeinde (1965).
[105] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 340.
[106] Lehmann, K.: Gemeinde (1982), S. 31, zum folgenden vgl. ebd. S. 29-33.
[107] Die Reihenfolge der verschiedenen Positionen folgt inhaltlichen, nicht chronologischen Gesichtspunkten.
[108] Vgl. Zerfaß, R.: [Diskussionsbeitrag] (1985), S. 33-40.
[109] Zerfaß, R.: [Diskussionsbeitrag], S. 34.
[110] Vgl hierzu auch Zerfaß, R.: Der Beitrag des Caritasverbandes (1987), S. 22-24, insb. S. 22.
[111] Vgl. Gnilka, J.: [Diskussionsbeitrag] (1985), S. 41f.
[112] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 344f. Vgl. Zerfaß, R.: [Diskussionsbeitrag], S. 37.
[113] In einer späteren Phase revidiert Rolf Zerfaß dieses Konzept und ergänzt es um die Liturgie als vierten Grundvollzug. „Martyria und Diakonia werden dabei als die zwei Dimensionen des eher extrovertierten Sendungsauftrags der Kirche identifiziert, denen Koinonia und Leiturgia als zentrierende Dimensionen der Sammlung innerhalb der Gemeinde entsprechen.“ (Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 346) Dabei soll diesem Innen-Außen-Schema allerdings kein Wertungscharakter zukommen. Vgl. dazu Zerfaß, R.: Lebensnerv Caritas (1992), S. 82-95.
[114] Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit (1994), S. 160 (Hervorhebung im Original).
[115] Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 160 (Hervorhebung nicht im Original).
[116] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 348.
[117] Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 245.
[118] Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 243f.
[119] Vgl. zum gesamten Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 249.
[120] Steinkamp, H.: Diakonie in der Kirche der Reichen (1988), S. 299.
[121] Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 245; 255 (kursive Hervorhebungen nicht im Original).
[122] Steinkamp, H.: Diakonie in der Kirche der Reichen, S. 300.
[123] Vgl. Eigenmann, U.: Am Rand die Mitte suchen (1990), sowie Eigenmann, U.: Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit (1998).
[124] Eigenmann, U.: Am Rand die Mitte suchen, S. 69f.
[125] Vgl. Eigenmann, U.: Am Rand die Mitte suchen, S. 42, 118, sowie Eigenmann, U.: Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, S. 169.
[126] Damit kommt gerade dieser Reich-Gottes-Praxis und -Botschaft Jesu eine ideologiekritische und korrigierende Funktion zu. Im Gegensatz dazu ergibt sich für O. Fuchs diese Funktion aus der Differenz und Zusammengehörigkeit von Martyria und Diakonia (s.u.).
[127] Vgl. Eigenmann, U.: Am Rand die Mitte suchen, S. 71-116, sowie Eigenmann, U.: Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, S. 169-182.
[128] Vgl. Fuchs, O.: Kirche für andere (1988). In der Fortentwicklung seines Konzepts hat Fuchs allerdings von diesem Primat Abstand genommen.
[129] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 354 (Hervorhebung im Original).
[130] Eigenmann, U.: Am Rand die Mitte suchen, S. 118.
[131] Eigenmann, U.: Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, S. 182.
[132] Vgl. zum gesamten Abschnitt Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 749-755.
[133] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 747.
[134] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 749 (Hervorhebungen im Original).
[135] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 749.
[136] Haslinger entwirft dieses Konzept in Auseinandersetzung mit Emmanuel Lévinas. Vgl. dazu das Kapitel „Verantwortung für den Anderen - eine Philosophie (und Theologie) der Diakonie (Emmanuel Lévinas)“, in: Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 534-618, als deren „Quintessenz“ er die Diakonie begreift (Ebd., S. 594-602).
[137] Vgl. Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 752.
[138] Haslinger, H.: Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft, S. 755.
[139] Eine ausführliche Grundlegung seiner Konzeption im Evangelisierungsparadigma findet sich in Fuchs, O.: „Umstürzlerische Bemerkungen“ (1984), insb. S. 19-26.
[140] Fuchs, O.: Heilen und befreien (1990), S. 103.
[141] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 210 (Hervorhebung im Original).
[142] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 209.
[143] In seiner ursprünglichen Konzeption geht Fuchs - basierend auf der genannten Differenz - von Martyria, Diakonia und Koinonia aus (Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 103-112, ursprünglich veröffentlicht in: Fuchs, O.: „Umstürzlerische“ Bemerkungen, S. 34-38). Aufgrund der damit ausgelösten Diskussion sieht er sich genötigt, Koinonia und vor allem Liturgie als Grundvollzüge explizit zu integrieren, was er dann im Rahmen seines Grundanliegens vornimmt (vgl. Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 209-223). In der folgenden Darstellung wird ein Schwerpunkt auf die ursprüngliche Konzeption gelegt.
[144] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 106.
[145] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 107.
[146] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 109.
[147] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 109.
[148] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 130.
[149] Fuchs, O.: Kirche für andere, S. 285f. - Später vertritt Fuchs allerdings die Priorität der Diakonie nicht mehr.
[150] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 216. Meines Erachtens handelt es sich nicht um eine Modifizierung des Konzepts. Vielmehr wird mit deren „expliziten Aufnahme in die kirchlichen Grundvollzüge“ (ebd.) im Grunde nur noch stärker betont wird, daß Diakonie und Verkündigung nicht auf eine individuelle Angelegenheit reduziert werden dürfen, gerade weil der Gemeinschaftscharakter für die Kirche konstitutiv ist.
[151] Fuchs, O.: Heilen und befreien, S. 212; 213.
[152] Dies in Bezug auf Steinkamp (s.o.), dessen enge Verbindung von Koinonia und Diakonia in den Basisgemeinden der ‘Kirche der Armen’ (s.u.) - und nur dort - zwar richtig ist, jedoch die Verkündigung als Grundvollzug in seiner Argumentation relativ ausblendet, - sowie in Bezug auf Eigenmann (s.o.), dessen Betonung, die Grundvollzüge müßten in sich diakonisch sein um authentisch christlich zu sein, ebenfalls zu sehr von den realen Gegebenheiten absieht und zu übersehen scheint, daß die Reich-Gottes-Botschaft Jesu nicht nur diakonisch ist, sondern eben auch „Botschaft“, also Martyria.
[153] Vgl. Fuchs, O.: Martyria und Diakonia: Identität christlicher Praxis (1999), S. 178-183, im besonderen Anm. 6, sowie Karrer, L.: Grundvollzüge christlicher Praxis (2000), insbesondere S. 385-394.
[154] Vgl. dazu Gutiérrez, G.: Das Konzil und die Kirche in der Welt der Armut, S. 169-173; Chenu, M.-D.: „Kirche der Armen“ (1977).
[155] Zweites Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, 1.
[156] Zweites Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen gentium, 8.
[157] Gegen Parra, A.: La Iglesia (1997), S. 104.
[158] Vgl. dazu insbesondere Medellín: Dokumente ‘Gerechtigkeit’ und ‘Frieden’.
[159] Medellín: Dokument ‘Armut der Kirche’, 7.
[160] Ellacuría, I.: Die Kirche der Armen (1996), S. 767.
[161] Vgl. Sobrino, J.: Gemeinschaft, Konflikt und Solidarität in der Kirche (1996), S. 860f.
[162] Sobrino, J.: Gemeinschaft, Konflikt und Solidarität in der Kirche, S. 861. Vgl. auch Wiedenhofer, S.: Die Kirche der Armen (1992), S. 90f.
[163] Ellacuría, I.: Die Kirche der Armen, S. 768.
[164] Parra, A.: Hacer Iglesia desde la realidad de América Latina (1988), S. 132.
[165] Wiedenhofer, S.: Die Kirche der Armen, S. 78.
[166] Gutiérrez, G.: Die Armen und die Grundoption (1996), S. 310.
[167] Parra, A.: Hacer Iglesia desde la realidad de América Latina, S. 131.
[168] Sobrino, J.: Gemeinschaft, Konflikt und Solidarität in der Kirche, S. 861.
[169] Ellacuría, I.: Die Kirche der Armen, S. 781.
[170] Scannone, J.C.: Weisheit und Befreiung (1992), S. 132; Wiedenhofer, S.: Die Kirche der Armen, S. 86.
[171] Scannone, J.C.: Weisheit und Befreiung, S. 132.
[172] Vgl. Klinger, E.: Das Aggiornamento, S. 171 und 186, sowie die Studie: Klinger, E.: Armut – Eine Herausforderung Gottes.
[173] Vgl. Steinkamp, H.: Solidarität und Parteilichkeit, S. 198.
- Arbeit zitieren
- Markus Raschke (Autor:in), 2001, Kooperation und Vernetzung von Kirchengemeinden und kirchlichen Wohlfahrtsverbänden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15296
Kostenlos Autor werden









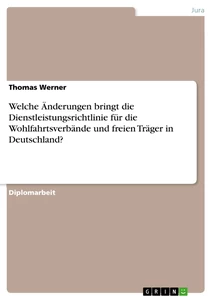








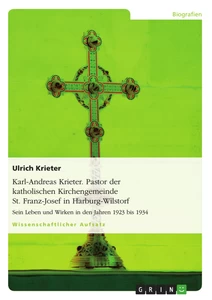
![Titel: Die Chronik der Kirchengemeinde St. Maria-St. Josef zu Hamburg-Harburg [Band 1 - Teil 3]](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/346573/medium.webp)
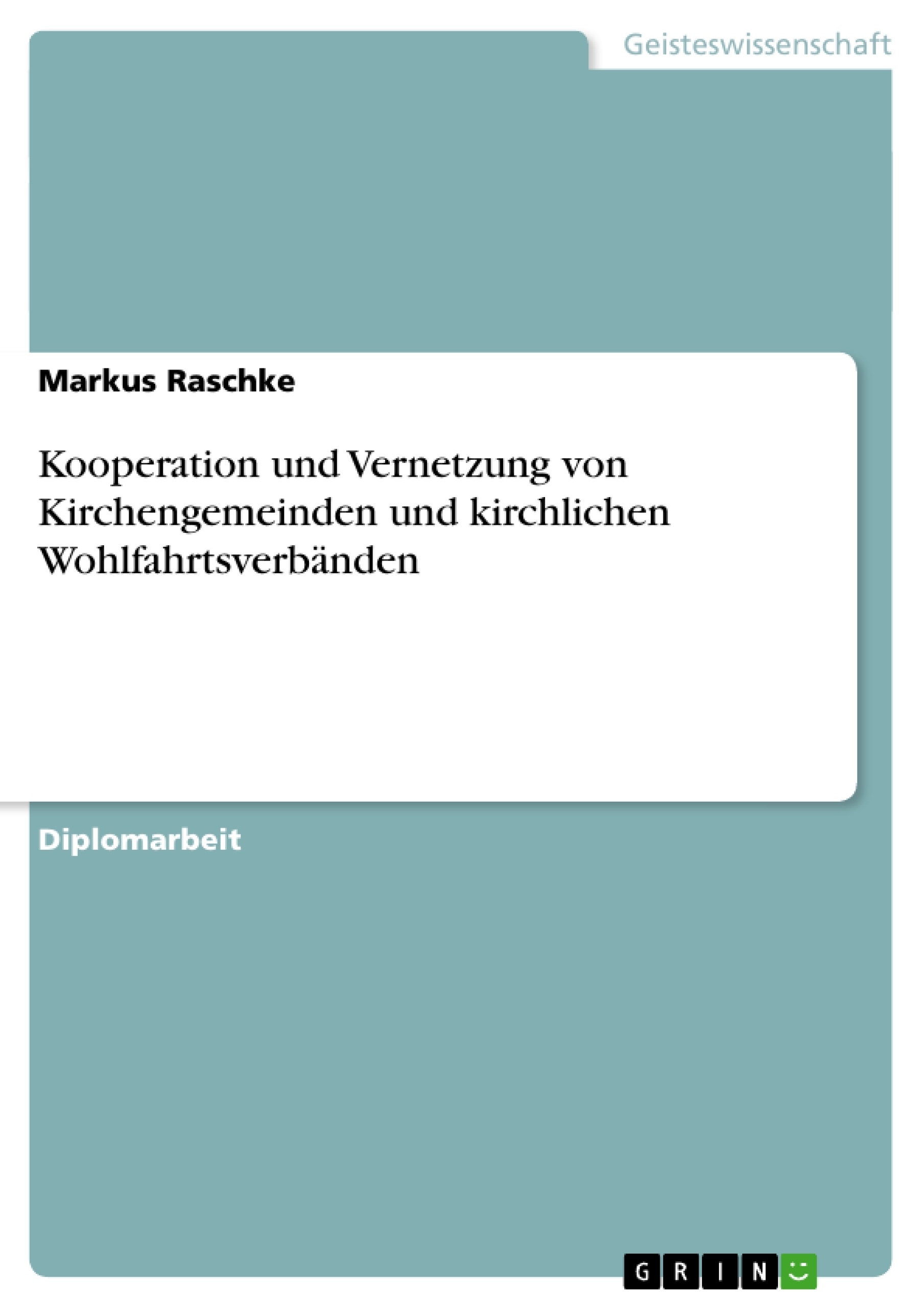

Kommentare