Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Problemstellung
1.1 Zu den Interviews
2. Geistige Behinderung
2.1 Suche nach einem neuen Begriff
2.2 Sichtweisen und Einstellungen
3. Partizipation für Menschen mit Lernschwierigkeiten
3.1 Der Begriff Partizipation
3.1.1 Ebenen der Partizipation
3.1.2 Gesetzliche Verankerung - Gleichstellungsgesetze
3.2 Lebensqualität als Leitbegriff für Partizipationsprozesse
3.2.1 Subjektives Wohlbefinden
3.3 Partizipation in Wohneinrichtungen
3.4 Spannungsfeld Partizipation
3.5 Voraussetzungen für Partizipation
3.5.1 Barrierefreiheit
3.5.2 Geschichte der Barrierefreiheit
3.5.3 Von der Barrierefreiheit zum „Design für alle“
3.6 Selbstbestimmung
3.7 Empowerment
3.8 Zusammenfassung
4. Kommunikation als Informationsaustausch
4.1 Sprache und Verstehen
4.2 Kommunikationstheorien
4.3 Theorien der Verständlichkeit und Lesbarkeit
4.3.1 Zur Vorgeschichte
4.3.2 Lesbarkeit
4.3.3 Verständlichkeit
4.4 Bedeutung der Semantik
4.5 Lesen und Verstehen unter erschwerten Bedingungen
5. Konzept der „Leichten Sprache“
5.1 Begriffsklärung
5.2 Ursprung und Verbreitung
5.3 Aktueller Wissensstand
5.4 Kriterien „Leichter Sprache“
5.4.1 Lesermerkmale
5.4.2 Inhalt
5.4.3 Textgestaltung
6. Praktische Umsetzung
6.1 Schritte zur Erstellung eines leicht lesbaren Dokumentes
6.2 Der Formulierungs- und Übersetzungsprozess
6.3 Öffentlichkeitsarbeit
6.4 Eingang in gesetzliche Regelungen
6.5 Schwierigkeiten und Grenzen der Umsetzung
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung und Problemstellung
„ Er [der Artikel] befa ß t [sic!] sich mit der Frage, welche Perspektiven eine Ü berwindung des bis heute weitgehend dominanten Verst ä ndnisses von Behinderung als ein quasi-nat ü rliches, medizinisches diagnostizierbares Kompetenzdefizit von Akteuren durch einen sozialkonstruktivistischen Zugang insbesondere im Hinblick auf soziale Ungleichheit er ö ffnet. “ (Zitat aus einem Schreiben Professor Schröders1 an Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland 1999).
Aus Sicht von „Mensch zuerst“ kann dies als ein Beispiel für „schwere Sprache“ herangezogen werden. „Mensch zuerst“ benutzt den Begriff „schwere Sprache“ und meint damit lange verschachtelte Sätze, die Verwendung von unerklärten Fremdwörtern oder eine unübersichtliche Gestaltung von Dokumenten (vgl. Ströbl 2006, S. 45). Während für einen Großteil der Menschen der Zugang zu schriftsprachlichen Informationen zu einer selbstverständlichen Handlung gehört, ist für Menschen mit Lese- und Verständnisproblemen (z.B. kognitive Beeinträchtigungen, ältere Menschen, Analphabeten oder Menschen mit einer Hörschädigung) das Verstehen der alltäglichen Schriftsprache erschwert.
Die deutsche Behördensprache ist meist alles andere als leicht zu verstehen und jedes Formular, das ausgefüllt werden muss, ist eine Herausforderung. Für leseschwache Menschen ist dies meist ohne Hilfe unmöglich.
Die Forderung von „Mensch zuerst“ gemeinsam mit dem Netzwerk „Leichte Sprache“, alle wichtigen Informationen solle es auch zusätzlich in „Leichter Sprache“ geben, ist unter anderem im Jahr 2009 ein Motto des europäischen Protesttages zur Gleichstellung behinderter Menschen. Viele Personengruppen sind auf eine leicht verständliche Sprache angewiesen, um nicht von Ausgrenzung bedroht zu sein. Nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten profitieren von einer Barrierefreiheit im schriftsprachlichen Bereich.
Alle kennen das: Täglich bekommen wir eine Fülle von Informationen aus Bereichen, wie zum Beispiel Hochschulen, Beruf, Politik, Printmedien, Technik, Recht, Protokolle oder Broschüren. Jeden Tag sind wir gefordert, uns mit Texten, Reden und Informationen auseinanderzusetzen. Allerdings wird beim Gestalten von Texten selten auf Verständlichkeit geachtet und dieser Tatbestand erschwert es komplizierte Sachverhalte auf diesen Gebieten zu verstehen.
„ Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe! “ (Illgner 2007, S. 7).
Den Autoren ist es meist wichtiger, ihre Texte juristisch und technisch auf einem hohen Niveau zu gestalten, so dass die Verständlichkeit auf der Strecke bleibt (vgl. Wagner et al. 2004, S. 207). Dies bringt oft Nachteile für die betroffene Person2 mit sich und hat somit negative Konsequenzen. Des Weiteren stoßen wir bei der Programmierung von technischen Geräten oft auf sprachliche und inhaltliche Barrieren. Um nicht aufzugeben und den dadurch entstehenden Nachteilen zu entgehen, sind wir auf Hilfe anderer Personen angewiesen. In diesem Fall ist die Unterstützung von Fachleuten für eine Verständnisoptimierung unabdingbar.
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in der Regel auf Informationsquellen, die ihnen im unmittelbaren Umfeld zur Verfügung gestellt werden, angewiesen. In Wohneinrichtungen bezieht sich der Zugang zu schriftlichen Informationen oftmals auf das Lesen von Speiseplänen, Tagesstrukturplänen oder die Bekanntgabe von Veranstaltungen innerhalb der Einrichtung. In meiner Tätigkeit als Fachkraft in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Lernschwierigkeiten stoße ich oft auf kompliziert gestaltete Informationen für diesen Personenkreis. In der Regel hinterfragen Bewohner und Bewohnerinnen die unverständlichen Materialen kaum. Dadurch entwickeln sich ein Informationsdefizit im Alltag und eine gewisse Abhängigkeit von den Fachkräften.
Fachkräfte sollten dann in der Lage sein, Informationen in „leichter Sprache“ auf die Nutzergruppe abzustimmen und wertneutral zu vermitteln. Für viele Fachkräfte ist es schwierig, schriftliche Informationen so aufzubereiten, dass sie für Bewohner und Bewohnerinnen lesbar und verständlich sind.
Mit betroffenen Personen sollen jene Personengruppen bezeichnet werden, die durch schwer verständliche Sprache benachteiligt sind, wie z.B. Menschen mit Lernschwierigkeiten, Analphabetinnen und Analphabeten oder Migrantinnen und Migranten.
In meinem Studium ist mir das Konzept der „Leichten Sprache“ bislang kaum begegnet. Die Idee, mich in meiner Diplomarbeit diesem Thema zu widmen, hatte ich während meines Praktikums beim Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland.
„Mensch zuerst“ vertritt ca. 300 Menschen mit Lernschwierigkeiten und ca. 20 Selbstvertretungsgruppen in Deutschland. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins setzen sich seit Jahren für Selbstbestimmung und Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten ein. Sie alle haben eine Geschichte im System der Behindertenhilfe, mit der sie sich auseinandergesetzt haben. Als Betroffene haben sie eine Idee davon, was an der Lage für Menschen mit Lernschwierigkeiten verbessert werden muss. Sie fordern, die von ihnen entwickelten Standards der „Leichten Sprache“ in die Gesetze zur Barrierefreiheit aufzunehmen. Des Weiteren lehnen sie den Begriff „geistige Behinderung“ ab und fordern die Bezeichnung „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ für sich ein.
Während der Literaturrecherche für meine Arbeit ist mir aufgefallen, dass das Thema „Leichte Sprache“ bislang in der Literatur kaum Beachtung gefunden hat und mit der Lese - und Verständnisproblematik für Menschen mit Lernschwierigkeiten wenig in Verbindung gebracht wird.
Mir war relativ unklar, ob dieser Themenschwerpunkt auf der Basis der vorhandenen Literatur bearbeitet werden kann. Nach intensiven Recherchen und Gesprächen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der „Selbst-Bestimmt- Leben-Bewegung“ entschied ich mich aufgrund der Brisanz des Themas für eine Bearbeitung des Konzeptes. Die Sichtung der Literatur erforderte viel Zeit, da ich auf Kontakte zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Selbsthilfeinitiativen, dem Büro für „Leichte Sprache“ in Bremen und Kontakten zu Menschen, die in irgendeiner Weise mit dem Konzept in Berührung gekommen sind, angewiesen war.
Vielfach handelt es um Aufsätze, Literatur aus der Verständlichkeits- und Lesbarkeitsforschung, Geistigbehindertenpädagogik und Sprachbehindertenpädagogik sowie Online-Kontakte.
In der Sprachbehindertenpädagogik konnte ich zum Thema „Leichte Sprache“ keine Literatur ausfindig machen und stieß somit auf eine Forschungslücke in diesem Bereich. Die Autoren beziehen sich im Kontext Sprache kaum auf Menschen mit Lernschwierigkeiten und gehen in der Regel von einer „normalen“ Sprachentwicklungskompetenz aus. In der Literatur der Geistigbehinderten- pädagogik taucht das Konzept „Leichte Sprache“ indirekt im Zusammenhang mit der Lebensqualitätsforschung auf. Methoden zur Erhebung der Lebensqualität von Menschen mit Lernschwierigkeiten erfordern eine inhaltlich-sprachliche Einfachheit des Erhebungsinstrumentes.
Meine Ausführungen konzentrieren sich auf die Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland und darauf inwieweit das Konzept „Leichte Sprache“ eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen kann.
Ich nähere mich dem Thema folgendermaßen:
Der einleitende Teil beinhaltet eine Beschreibung der Herangehensweise in Bezug auf die durchgeführten Interviews.
Im zweiten Teil meiner Arbeit möchte ich die Diskussion um den Begriff „geistige Behinderung“ aufgreifen. Selbstvertretungsgruppen fordern die Abschaffung für sie diskriminierender Begrifflichkeiten. Der Suche nach neuen Begriffen unter dem Aspekt der Einbeziehung von Menschen mit Behinderung, soll in diesem Kapitel nachgegangen werden.
Ich stelle dar, wie sich das Modell von Behinderung gewandelt hat und dies einen Einfluss auf das gesellschaftliche Bild gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten haben kann.
Im dritten Teil soll zunächst der Partizipationsbegriff beleuchtet werden. Hier geht es um rechtliche Grundlagen für eine barrierefreie Kommunikation und Information, die eine Teilhabe implizieren sollen. Das im Jahre 2002 verabschiedete Behindertengleichstellungsgesetz soll den Hintergrund meiner Ausführungen darstellen. Die „Leichte Sprache“ ist noch nicht im Gesetz zur Barrierefreiheit verankert. Dies wird von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ein Recht auf Teilhabe gefordert. Wahlmöglichkeiten hinsichtlich einer barrierefreien Kommunikation und Information zu haben erhöht Lebensqualität und ist somit Voraussetzung für eine gelungene Partizipation.
Da Partizipation eine breite Anwendung in vielen gesellschaftlichen Bereichen findet, soll die Aufmerksamkeit der Teilhabe dem häuslichen Bereich gelten. Als Voraussetzung für Partizipationsprozesse soll der Begriff Barrierefreiheit hin zu einem „Design für alle“ beleuchtet werden.
Selbstbestimmung und Empowerment spielen bei der Forderung nach einer „Leichten Sprache“ eine wesentliche Rolle. „Wenn man selbst bestimmen will, muss man sich überlegen, was man überhaupt will.“ (Wir vertreten uns selbst! 1997, S. 11).
Innerhalb der Betrachtung des Lese - und Spracherwerbs und seiner notwendigen Kompetenzen gehe ich im vierten Teil auf das Themengebiet der „Kommunikation“ ein. Die Grundlagen der menschlichen Kommunikation nach Schulz von Thun und Watzlawick et al. bilden den Ausgangspunkt jeglicher Kommunikation und Interaktion.
Die Kommunikation erfolgt auch über Schriftsprache und wirkt sich unmittelbar auf die Persönlichkeitsentwicklung in unserem (Alltags-) Leben aus. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten stellt der Schriftspracherwerb bzw. das Lesenlernen eine Herausforderung dar. Sie nähern sich dem Lesen von Buchstabenschrift und deren Bedeutungserschließung aufgrund von Lernschwächen langsamer, als Menschen ohne kognitive Einschränkungen.
Im fünften Teil werde ich das Konzept der „Leichten Sprache“ vorstellen. Ich konnte keine Hinweise in der Literatur finden, ob ein Unterschied zwischen dem Konzept der „Leichten Lesbarkeit“ und der „Leichten Sprache“ besteht. Das Konzept der „Leichten Sprache“ beinhaltet ein Verfahren, leicht lesbare Dokumente zu erstellen. Die Verwendung einer „Leichten Sprache“ bezieht auch die gesprochene Sprache mit ein. Leicht lesbare Dokumente und die Verwendung einer „Leichten Sprache“ weisen gemeinsame Merkmale auf. Deshalb verwende ich die Begriffe „Leichte Lesbarkeit“ und „Leichte Sprache“ synonym.
Zunächst wird es notwendig sein, den aktuellen Stand der Forschung zu beschreiben, um meine Hypothesen zu formulieren.
Im letzten Teil meiner Arbeit diskutiere ich die praktische Umsetzung, durch die sich meines Erachtens die zuvor beschriebene Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten verbessern ließe, und möglichen Schwierigkeiten und Grenzen bei ihrer Umsetzung.
Geleitet werden meine Ausführungen durch folgende Thesen:
- Eine Veränderung des Verständnisses von Behinderung kann durch einen Begriffswandel bewirkt werden.
- Der Zugang zu Informationen ist eine Voraussetzung für Lebensqualität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sprache kann eine Barriere sein.
- Sprach - und Leseerwerb ist von Fähigkeiten der Nutzer- und Nutzerinnengruppe abhängig. Somit ist die Zugänglichkeit von schriftsprachlichen Informationen zielgruppenorientiert (Anpassung an die Kompetenz des Lesers) zu gestalten.
- Die „Leichte Sprache“ fungiert als integrierendes Instrument zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.
Um die Forderung von „Mensch zuerst“ ernst zu nehmen, verwende ich in meiner Arbeit den geforderten Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“. „Mensch zuerst“ spricht von Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf, während umgangssprachlich von den „weniger fitten“ die Rede ist. Für sie muss wiederum nach anderen Lösungen und Ansätzen gesucht werden (vgl. Göthling 2006, S. 560). Die Vorschläge von „Mensch zuerst“ sollen in dieser Arbeit Beachtung finden.
In meinen weiteren Ausführungen benutze ich den Begriff „Fachkräfte“, wobei ich hier pädagogische Fachkräfte meine.
Die Begriffe „schwere Sprache“ und „Leichte Sprache“ habe ich in meiner Arbeit in Anführungszeichen gesetzt, weil ein definiertes Konzept dahinter steht. Für jeden Leser und jede Leserin sind die Begrifflichkeiten „leicht“ und „schwer“ unterschiedlich definierbar, subjektiv geprägt und mit variierenden Sinngehalten gefüllt.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ich in Bezug auf die Nutzung der weiblichen und männlichen Form, grundsätzlich den Anspruch an den Leser habe, z.B. bei der Personengruppe „Bewohner und Bewohnerin“ in der Regel die doppelte Ausführung zu lesen, da gleich viele Personen der Zielgruppen betroffen sind.
1.1 Zu den Interviews
Für meine Diplomarbeit habe ich insgesamt zwei Interviews geführt. Durch mein vorheriges Praktikum konnte ich zwei Mitarbeiter von „Mensch zuerst“ für meine Diplomarbeit befragen. Ihre Aussagen sollen den Standpunkt von Menschen mit Lernschwierigkeiten einbringen. Aufgrund der geringen Anzahl der Befragungen, ist mir bewusst, dass dies keine repräsentative Darstellung sein kann. Ich entwickelte Fragen in Anlehnung an die Standards für „Leichte Sprache“, um zu den verschiedenen Themen, die ich bearbeiten wollte, Auskunft zu erhalten. Ich möchte den Stand der Diskussion anhand des Konzeptes „Leichte Sprache“ erläutern.
Beide Teilnehmer sind Angestellte von „Mensch zuerst“ und Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie bezeichnen sich als Experten in eigener Sache. Ihre Arbeiten umfassen unter anderem die Aufklärung zum Thema „Leichte Sprache“ und die damit verbundene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie prüfen Texte in „Leichter Sprache“ und sind an der Weiterentwicklung der Standards für „Leichte Sprache“ beteiligt. Somit können sie ihren Standpunkt zum Konzept vertreten.
Es ging mir bei der Bearbeitung der Interviews nicht um die Personen und ihren Hintergrund, sondern um ihre Gedanken und Informationen, Einstellungen und Meinungen zum diesem Thema. Beide Mitarbeiter waren schon oft als Gastreferenten in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Organisationen des öffentlichen Lebens z.B. Ämter, Behörden oder auch Hochschulen, um ihren Standpunkt zum Thema „Leichte Sprache“ darzulegen.
Ich habe beide Interviews vollständig ins Hochdeutsche transkribiert. Die Zitate habe ich nach inhaltlichen Gesichtspunkten in meine Arbeit eingeordnet, wo sie die Meinung von „Mensch zuerst“ darstellen.
Beide Befragungen wurden in den Büroräumen von „Mensch zuerst“ in Kassel durchgeführt und in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen integriert.
Vorab habe ich mir Gedanken gemacht, wie Befragungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten gestaltet werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Bislang liegen Untersuchungen vor, in denen die Ermittlung der Sichtweisen von Menschen mit Lernschwierigkeiten als problematisch bis unmöglich beurteilt werden (vgl. Hagen 2001, S. 103). Einzelne Studien zur Erhebung der Lebensqualität zeigen jedoch, wie Perspektiven der Bertoffenen ermittelt werden können.
Die Befragungen der zwei Mitarbeiter von „Mensch zuerst“ wiesen meines Erachtens ein anderes Sprachniveau auf, als ich es von Menschen mit Lernschwierigkeiten gewohnt war. Sie benutzen durchaus Fremdwörter, welche sie aber als „schwere“ Wörter bezeichnen. Dies kann mit ihren zunehmenden Lernerfahrungen und den dadurch verbundenen Zuwachs an Selbstvertrauen während ihrer Arbeit bei „Mensch zuerst“ zu tun haben.
Das Konzept der „Leichten Sprache“ kann ein hilfreicher Ansatz bei der Gestaltung der Befragungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten sein.
2. Geistige Behinderung
2.1 Suche nach einem neuen Begriff
„Jeder Mensch ist doch verschieden, und wenn ich vielleicht das eine nicht gut kann, dann kann ich das andere vielleicht umso besser“ (Göthling 2006, S. 560). Stefan Göthling ist ein Mensch mit Lernschwierigkeiten und arbeitet als Geschäftsführer beim „Mensch zuerst“ in Kassel. Die Kampagnen der Selbsthilfeorganisation „Mensch zuerst“ nehmen seit Anfang 90er Jahren einen großen Einfluss auf die Veränderung des Begriffes.
Den Geist könne man nicht bemessen und niemand hat das Recht, den Geist eines anderen Menschen einzuschätzen (vgl. Göthling 2006, S. 560). Mit dem Slogan ‚Etiketten sind für Dosen - nicht für Menschen‘ wandte sich „Mensch zuerst“ an die Politik und versuchte somit, eine Veränderung ihres Selbstbildes in der Öffentlichkeit zu erreichen.
Mitte der 90er Jahre begannen Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrem ersten Projekt „Wir vertreten uns selbst!“ sich für Gleichstellung zu engagieren und die für sie diskriminierende Bezeichnung „geistige Behinderung“ abzulehnen. Auf einer der ersten Tagungen der People First Bewegung 1974 in Oregon machte eine Teilnehmerin ihren Missmut deutlich:
„ Wir haben genug davon, als erstes immer als eingeschr ä nkt oder als geistig behindert gesehen zu werden. Wir wollen zuerst als Menschen gesehen werden. Niemand hat das Recht zu behaupten, ob wir gut oder nicht gut denken k ö nnen. Und was hat Denken mit dem Geist zu tun? “ (vgl. Ströbl 2006, S. 41).
Ein Mitglied des Netzwerkes beschreibt die Bezeichnung „geistige Behinderung“ aus subjektiver Sicht wie folgt:
„ Ich will nicht geistig behindert genannt werden! Wir sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Eigentlich kann man sagen, wir sind Menschen mit unterschiedlichen F ä higkeiten. Ganz einfach egal, was wir darstellen “ (Wir vertreten uns selbst! 2002, S. 5).
Die Diskussion um den Begriff ‚geistige Behinderung‘ wurde 1958 vom Selbsthilfeverein „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ in Marburg in Gang gesetzt. Mit der Bezeichnung „geistig behindert“ forderte die Elternvereinigung das Anderssein und die intellektuelle Beeinträchtigung ihrer Kinder als eine Aufwertung zu beschreiben (vgl. Fornefeld 2004, S. 45). Im Vordergrund bei der Entstehung des Begriffes stand die intellektuelle Beeinträchtigung. Der Begriff ist an den englischen Sprachgebrauch „mental retardation“ oder „mental handicap“ angelehnt (ebd.). Die Begriffe „Schwachsinn‘, „Blödsinn“ und „Idiotie“ sollten somit ersetzt werden und anderen Behinderungen sprachlich zugeordnet werden (vgl. Kulig et al. 2006, S. 116). Josef Ströbl ein Mitarbeiter von „Mensch zuerst“ mit Lernschwierigkeiten betont:
„ Fr ü her hat man uns viele Namen gegeben: Irre, Idioten, Geisteskranke oder Schwachsinnige. Diese W ö rter sind sehr schlimm. Sie machen uns schlecht. Sp ä ter hat man uns den Namen „ geistig Behinderte “ gegeben. Man hat gemeint, der Name ist besser als die anderen W ö rter “ (Ströbl 2006, S. 43).
Trotz des Paradigmenwechsels in der Behindertenarbeit und Politik - weg von der entmündigenden, aussondernden und oftmals diskriminierenden Fürsorge für Behinderte, hin zu zur Ermächtigung zum eigenverantwortlichen Management der eigenen Angelegenheiten ist es noch nicht zu einer Neufassung des Begriffes ‚geistige Behinderung‘ gekommen (vgl. Miles-Paul 2006, S. 32). Ein Perspektivenwechsel ist in der Definition der ICIDH3 im Ansatz zu erkennen. Behinderung wird im Jahre 1980 noch als Störung, Schädigung und Substanzverlust beschrieben, während 1999 die sozialen Kompetenzen und Teilhabe am Leben der Gesellschaft schon im Vordergrund stehen (vgl. Fornefeld 2004, S. 49).
Dreher stellt die These auf, dass ‚Geschädigtsein‘ und ‚Behindertsein‘ von außen geschaffene Konstrukte sind und nichts mit dem Erleben von Menschen mit Behinderung zu tun haben (vgl. Dreher 2000, S. 9f). Ein Außenstehender kann nicht die Wirklichkeit eines Anderen beschreiben und über ihn und seine Fähigkeiten eine Aussage treffen (ebd.).
Es hängt davon ab, aus welcher Profession heraus und mit welcher Intention der Begriff beschrieben wird (vgl. Fornefeld 2004, S. 46).
Lindmeier & Lindmeier geben eine Vielzahl von unterschiedlich verwendeten Begriffen in Europa an. Am geläufigsten sind „geistige Behinderung, intellektuelle Behinderung, geistige Entwicklungsverzögerung, Lernbehinderung, Lernbeeinträchtigung, Lernschwierigkeiten und intellektuelle Schwierigkeiten“ (Lindmeier/Lindmeier 2006, S. 95).
Im wissenschaftlichen Kontext versucht sich der Begriff „geistige Behinderung“ aus verschiedenen Sichtweisen und Ansätzen zu definieren. Der sozialwissenschaftliche Ansatz beschreibt die gesellschaftlichen Bedingungen, der pädagogische Ansatz beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Erziehung und der medizinisch-biologische Ansatz konzentriert sich auf organisch-genetische Abweichungen (vgl. Fornefeld 2004, S. 46). Während der medizinische Ansatz von Behinderung den äußeren Einfluss von Institutionen z.B. Werkstätten oder Wohneinrichtungen auf den Menschen mit seiner Diagnose Behinderung ausrichtet, bezieht sich das soziale Modell von Behinderung auf den Menschen, der durch diese Faktoren behindert wird (vgl. Göbel 2008).
Intelligenzquotienten sind bislang eine grobe Orientierungshilfe bei der Abgrenzung von verschiedenen Stufen der kognitiven Beeinträchtigungen gewesen. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft geben sie keine Auskunft über bestimmte Lernansprüche und darüber wie Intelligenzminderungen entstanden sind (vgl. Mühl 2006, S, 131). Für eine Abgrenzung zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung wird ein IQ-Wert 50-55 oder 55-60 angegeben (vgl. Wilken 2001, S. 103). Die Intelligenzdiagnostik fungierte bislang als Selektionsmittel für die Platzierung in verschiedene Schultypen, um eine Zuschreibung von Merkmalen zu erreichen und spezielle Förderbedürfnisse zu beschreiben. Diese Einteilung wird seit geraumer Zeit kritisch betrachtet, weil soziale Anpassungsleistungen nicht berücksichtigt werden (vgl. Kulig et. al. 2006, S. 121). Betroffenen-Initiativen wehren sich gegen eine solche negative Etikettierung von Menschen und lehnen eine Intelligenzdiagnostik ab. Stefan Göthling (Geschäftsführer von „Mensch zuerst“) bezeichnet es als ein Ziel und zugleich eine Aufgabe, den diskriminierenden Begriff „Menschen mit geistiger Behinderung“ abzuschaffen. „Wir vom Netzwerk People First Deutschland e.V. finden, dass die Wörter „geistig behindert uns auch schlecht machen. Sie passen nicht dazu, wie wir uns sehen“ (Ströbl 2006, S. 43). „Mensch zuerst“ verwendet den Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“, weil sie Schwierigkeiten beim Lernen haben (vgl. Göthling 2006, S. 560).
„ Anders ausgedr ü ckt hatten viele von uns Schwierigkeiten, das zu machen, was von uns verlangt wurde. Wobei man uns dabei sehr h ä ufig zu wenige M ö glichkeiten geboten hat, um nach anderen L ö sungen zu suchen. Wenn man dann sein Ziel nicht immer so wie andere erreichen konnte, wurde man eben als „ geistig behindert “ bezeichnet “ (Göthling 2006, S. 560).
Göthling bezeichnet die Verwendung des Begriffes ‚geistige Behinderung‘ als ein diskriminierendes Schubladendenken.
Ein betroffener Mitarbeiter der „People First Bewegung“ beschreibt in einer Diskussion zwischen Menschen mit Lernschwierigkeiten seine Sichtweise folgendermaßen:
"Irgendwelche haben eben mal aufgestellt so hoch ist die Me ß latte. [sic!] Wenn wir uns danach richten, also ne. Wenn wir in eine Ecke geschoben werden oder schieben lassen, das ist das Gef ä hrliche. Da bin ich ziemlich b ö se dann. Der eine ist eben so, der andere so" (Wir vertreten uns selbst! 2002).
Klauß wiederum befürchtet Nachteile für die Betroffenen, wenn der Begriff aufgegeben wird. „Wenn die Betroffenen begrifflich nicht mehr ausgegrenzt werden, dann bedeutet dies eine Nivellierung ihrer Lebenschancen, die Solidarität kann versiegen und sozialrechtliche Ansprüche sind schwieriger zu begründen. „Wenn sich der Status der Betroffenen nicht verändere, dann sei das Bemühen nach der Suche nach einem neuen Begriff problematisch“ (Klauß 2008, S. 196). Kulig et al. sehen ebenfalls Schwierigkeiten eines Begriffswandels. „Ein neuer Begriff hätte vermutlich bald einen ebenso stigmatisierenden Charakter wie der bisherige, weil die mit dem bisherigen Begriff verbundenen Konnotationen auf diesen übertragen würden“ (Kulig et al 2006, S. 118).
Klauß nimmt jedoch die Forderungen der Betroffenen bei der Suche nach einem neuen Begriff ernst und ist der Auffassung, im Umgang mit ihnen den geforderten Begriff zu verwenden. Er plädiert allerdings für das Aufrechterhalten des Begriffes in der Wissenschaft und in rechtlichen Zusammenhängen. Problematisch bei einer Veränderung des Begriffes wäre die Zuordnung des Bedarfes und die Entscheidung über spezielle Hilfen (ebd.).
Die Behinderung als eine biologische Tatsache anzuerkennen, ist eine Voraussetzung für die Akzeptanz des Andersseins. Einen frühkindlichen Hirnschaden oder Autismus muss als ein biologischer Fakt angesehen werden. Sich dessen Entwicklungsvoraussetzungen bewusst zu machen, ist eine Grundlage für ein akzeptierendes Menschenbild (vgl. Wessels 2003, S.37; siehe auch Jantzen 1997).
"Man kann seine Behinderung schon akzeptieren. Wir k ö nnen manchen Sachen halt nicht so gut. Und nicht so schnell aufnehmen und begreifen, was auf einen einflie ß t. Unser Tempo ist verlangsamt, wir brauchen mehr Zeit dazu" (Wir vertreten uns selbst! 2002).
Wenn die kognitive Beeinträchtigung nicht im Vordergrund steht, was die Betrachtung des Begriffes „geistige Behinderung“ erweitert, können andere Fähigkeiten in den Vordergrund treten. Diese gilt es zu entdecken.
Fakt ist, eine Begrifflichkeit darf kein Grund für ein behindertes Leben in der Gesellschaft darstellen. Allerdings sollte ein Begriffswandel nicht als der alleinige Lösungswegweg betrachtet werden.
Neue Begriffe müssen auch im sozialrechtlichen Kontext Berücksichtigung zur Gewährung von Unterstützung und finanziellen Hilfen finden. Die Begriffsdiskussion muss interdisziplinär kommuniziert werden, um dann gemeinsam einen neuen Konsens zu finden. Dennoch soll der Forderung von Selbsthilfeorganisationen Einschub gewährt werden, um eine willentliche Diskriminierung zu vermeiden. Die Verwendung diskriminierender Begriffe kann Vorurteile verstärken und dies sollte nicht im Interesse der Geistigbehindertenpädagogik sein.
Behinderung wird immer an den individuellen Lebensbedingungen und sozialen Kontexten festgemacht. Das Individuum wird somit von den Normvorstellungen und Reaktionsweisen behindert. Somit gestaltet sich eine Definition schwierig. Die Wurzeln dieser Umgangsweise haben mit dem zugrunde liegenden Menschenbild von Behinderung zu tun. „Jeder Mensch besitzt eine Welt, die für den Anderen immer nur begrenzt erfassbar ist (vgl. Fornefeld 2004, S. 79).
2.2 Sichtweisen und Einstellungen
Durch den niedrigen sozialen Status und Benachteiligungen in der Gesellschaft werden Menschen mit Lernschwierigkeiten oft als Personengruppe negativ eingeschätzt (vgl. Mühl 2000, S. 28). Untersuchungen aus dem Jahre 1970/71 von Harrelson et al. in Deutschland haben bestätigt, dass in der Bevölkerung große Vorurteile gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten bestehen. Für einen Großteil der 1000 befragten Personen war die geistige Behinderung die schwerste Behinderung, die einen treffen kann (vgl. Mühl 2000, S.28). Eine ablehnende Haltung, ein hohes Maß an sozialer Distanz, Gefühle wie Angst, Abscheu und Ekel waren Ergebnisse der Untersuchung. Zwei Drittel sprachen sich für eine Unterbringung in einem Heim aus und sahen ein frühes Sterben dieser Personengruppe nicht als Problem. Es stellte sich heraus, dass die Befragten kaum informiert waren, was das Leben von Menschen mit Behinderung betrifft (ebd.).
Wolfensberger (1972) beschreibt aus geschichtlicher Perspektive verschiedene Rollen gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten, die mit verschiedenen Einstellungen verbunden sind (vgl. Wendeler 1993, S. 44). Begriffe wie das ewige Kind, Kranker, Bedrohung, Mitleid, Lächerlichkeit prägten die Haltung und Einstellungen gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten (ebd., S. 45f). Wolfensberger beschäftigte sich mit der Frage, ob eine Etikettierung bestimmter Personengruppen eine soziale Integration verhindere (vgl. Wendeler 1992, S. 50). Die sehr wenigen deutschsprachigen Untersuchungen ergaben, dass Etikettierungen Auswirkungen auf die Einstellungen gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten haben. Durch etikettierende Begriffe werden pauschale Urteile gefestigt, auch wenn die Erfahrungen teilweise widersprechen (vgl. Wendeler 1992, S. 52).
Klauß konnte 1996 in einer Replikationsstudie ermitteln, dass sich Vorurteile in den letzten Jahrzehnten abgeschwächt haben, aber noch lange nicht abgebaut sind (vgl. Mühl 2000, S. 29). Zunehmendes Wissen über Menschen mit Lernschwierigkeiten, eine tolerantere Nachbarschaft und einen vermehrten Kontakt haben zum Abbau von Vorurteilen geführt.
Im Rahmen der Kontakthypothese haben Untersuchungen ergeben, dass sich positive Begegnungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen eignen, um eine soziale Distanz zu verringern (vgl. Mühl 2000, S. 32). Es kommt nicht auf die Häufigkeit des Kontaktes an, sondern auf die Art und die innere Haltung während des Kontaktes (ebd.).
Das Bild von einem Menschen mit Lernschwierigkeiten hat Einfluss darauf, welche Fähigkeiten, welches Sozialverhalten und welche Entwicklung- und Bildungschancen ihnen zugesprochen werden (vgl. Dederich 2006, S. 547). Die Lernbedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten in Sondereinrichtungen befriedigen zu wollen und sie vom ersten Bildungsweg fernzuhalten zeigt, wie Stigmatisierung ausgegrenzter Personengruppen sich im sozialen Handeln der Mehrheitsgesellschaft reproduziert.
„Es ist das Menschenbild in unseren Köpfen, das die gesellschaftliche Praxis hervorbringt, die ihrerseits wiederum das Menschenbild konstituiert wie modifiziert“ (Feuser 1996, S. 2).
Wie Menschen mit Lernschwierigkeiten sich gegen die Vorurteile wehren und für sich eine selbstbestimmte und emanzipierte Lebensumwelt einfordern, zeigen die Selbsthilfebestrebungen der letzten 15 Jahre.
Das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen ist längst keine Utopie mehr. Die Verwendung diskriminierender Begriffe kann Vorurteile gegenüber den Betroffenen verstärken. Menschen mit Lernschwierigkeiten sagen, die Bezeichnung „geistig behindert“ mache sie schlecht. Sie passt nicht dazu, wie sie sich selbst sehen (vgl. Ströbl 2006, S. 43). Das Einfordern neuer Begriffe von Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein Grund des sich verändernden gesellschaftlichen Bildes von behinderten Menschen. Das Bedürfnis nach Bildung und einer sich dadurch erschließenden emanzipierten Lebenswelt, schafft einen Zugang zu Kultur und Umwelt.
Menschen mit Lernschwierigkeiten als gleichberechtigte Kommunikationspartner anzusehen und ihr Leben nicht an dem von Menschen ohne Behinderung zu messen, ist eine Voraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
3. Partizipation für Menschen mit Lernschwierigkeiten
3.1 Der Begriff Partizipation
Unter Partizipation wird eine Mitwirkung an politischen Ereignissen und Entscheidungen verstanden (vgl. Pluto 2007, S. 16). Für Menschen mit Behinderung verwendet der Gesetzgeber den Begriff Teilhabe. Im folgenden Kapitel sollen beide Begriffe synonym verwendet werden.
Um der Zielsetzung des Konzepts Lebensqualität gerecht zu werden, muss eine Beteiligungskultur geschaffen werden, die deren Kompetenz, Ressourcen und individuelles Handeln fördern. Der Begriff „Lebensqualität“ wird seit Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit Normalisierung und Integration zunehmend diskutiert. Das Lebensqualitätskonzept hat sich das Ziel gesetzt, den Zugang zur Situation von Menschen mit Behinderung zu öffnen sowie die Auswirkungen des
Perspektivenwechsels auf diese Personengruppe zu fokussieren. Beck (2001) ist der Auffassung, eine umfassende empirische Lebenslagenforschung ermöglicht eine Beschreibung realer Partizipationschancen (vgl. Schäfers 2008, S. 59). Auf eine genaue Beschreibung des Konzeptes der Lebensqualität wird im Abschnitt
3.2 genauer eingegangen.
Partizipation ist möglich, wenn ein Zugang zu Informationen, Kultur, Gesetzen oder Politik gewährleistet ist. „Nur informierte Bürgerinnen und Bürger können die Entscheidungen beeinflussen und kontrollieren, die ihr Leben und das ihrer Familie bestimmen“ (Freyhoff et al 1998, S. 5).
Durch Informationen und Aufklärung werden Menschen gestärkt. Sie erweitern ihr Wissen, tauschen sich aus und werden zu einer mündigen Persönlichkeit. „Zwischen den ‚Reichen an Informationen‘ und den ‚Armen an Informationen‘ wird eine Barriere geschaffen, die es Menschen schwer macht, gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger zu sein und uneingeschränkt an der Gemeinschaft teilzunehmen“ (Freyhoff 1998, S. 7).
Der Begriff Partizipation kommt aus dem Lateinischen „partizipare“ und heißt im wörtlichen Sinne Teilnahme und Teilhabe (vgl. Pluto 2007, S. 16). Partizipation geht über den politischen Bereich hinaus wird als „Mittel der Erweiterung von traditionellen Teilhaberechten an Entscheidungen im politisch-gesellschaftlichen Raum“ angegeben (ebd., S. 17). Durch diese Ausbreitung erweitert sich somit das Spektrum möglicher Partizipationsformen (ebd., S. 16).
Die Weltgesundheitsorganisation bezieht Partizipation in folgende Lebensbereiche ein:
- „Learning and appelying knowledge
- General task and demands
- Communication
- Mobility
- Self-care
- Domestic life
- Interpersonal interactions and relationschips
- Major life areas
- Communitiy, social and civic life” (WHO 2001, S. 14; vgl. Wansing 2005, S. 137).
Das traditionelle Behindertensystem wird somit abgelöst und soll sich an individueller Unterstützung und Teilhabe orientieren.
Die Frage ist, wie die Entscheidungsmöglichkeiten auf der Basis der Interessen und Bedürfnisse der Individuen getragen werden können (vgl. Pluto 2007, S. 16). Partizipation wird mit dem Begriff Beteiligung gleichgesetzt und soll eine Teilhabe von Individuen und Gruppen ermöglichen (ebd., S. 17). Es ist schwierig, den Begriff eindeutig zu definieren, da er in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird. Es öffnet sich ein Spannungsfeld auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn es darum geht, Individuen mit einbeziehen, um sie trotzdem wieder auszuschließen. Die Politik will die Bürger an Entscheidungsprozessen teilhaben lassen, nutzt dies aber als eine Art Kontrollinstrument. Keupp (1992) spricht von einem grundlegenden Spannungsfeld zwischen der Gefahr der Abrichtung der Subjekte und dem Potenzial der sozialen Erneuerung durch eine kritische Distanz zu Macht (vgl. Pluto 2007, S. 44). In der Arbeitswelt bezieht sich der Begriff Partizipation nicht allein darauf, Arbeitnehmer einzubeziehen. In Zeiten befristeter Arbeitsverträge und Massenentlassungen wird eine Beteiligung im Sinne des Einbringens maximaler individueller Leistung gefordert, geht aber mit einer Risikoverschiebung auf den Einzelnen einher (vgl. Pluto 2007, S. 44).
Partizipation wird einerseits als ein Mittel zum Zweck der Integration und somit als ein Erziehungsmittel zu systemgerechter Sozialisation verstanden (ebd.). Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben und Verantwortung übernehmen, müssen sich aber dessen bewusst werden, dass Teilhabe auch Grenzen hat (vgl. Wir vertreten uns selbst! 1997, S. 10). Die Reichweite bestehender Möglichkeiten muss hierbei beleuchtet werden. Partizipation schließt auch mit ein, mehr Wahlmöglichkeiten zu haben. Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen besser darüber informiert werden, wie sie ihre Wohnsituation, ihre Arbeitsverhältnisse und ihre Freizeit aktiv mitgestalten können. Auf der internationalen Fachtagung „Wir wollen - wir lernen - wir können!“ 2007 in Köln fordern Menschen mit Behinderung für sich mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein.
Menschen mit Lernschwierigkeiten haben bereits Erfahrungen in Mitwirkungsstrukturen gemacht. Sie arbeiten in Heimbeiräten und Werkstatträten und vertreten dort die Interessen der Bewohner und Bewohnerinnen, Kollegen und Kolleginnen.
„Teilhabe heißt zur Rede stehen und Teil der Kommunikation zu sein, in Mimik, Gestik, Sprache, Schrift, Bild oder Ton, Medien, Übertragungs- oder Speichertechniken zur ‚Sprache‘ kommen“ (Wacker 2005, S. 338). Die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein Ziel von Inklusion und wird von Behindertenorganisation als eine Ressource aufgefasst. Träger der Behindertenhilfe betreiben Lobbyarbeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die gemeinsame Gestaltung sollte mehr in den Mittelpunkt rücken.
„Die Lebensqualität in einer Gesellschaft bemisst sich auch an der Möglichkeit, ein sinnvolles Leben vor aller Zumessung von Kriterien wie Leistung und Nützlichkeit führen zu können, an dem Grad an vorgefundenen Partizipationsmöglichkeiten und solidarischem Handeln“ (Beck 1996, S. 40). Wenn die Partizipationsmöglichkeiten behinderter Menschen gefördert werden, wirkt sich dies auf eine verbesserte Lebensqualität aus.
Ohne eine Beteiligungskultur der Betroffenen wird es schwierig sein, Teilhabe zu unterstützen. Menschen mit Lernschwierigkeiten können neue Bildungsbedürfnisse für sich einfordern, die darauf abzielen, neue Erkenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern. Die Ressourcen des Einzelnen zu entdecken, kann mit Hilfe der Assistenzpersonen Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung anregen (vgl. Lucia 2008, S. 168). Den Betroffenen als ein informationsbedürftiges Subjekt anzuerkennen, ist hierbei eine wichtige Grundlage für Partizipationsprozesse.
Behindernde Strukturen können durch Teilhabe verändert werden und sollen am Beispiel des Vereines „Lebenshilfe“ durch die verschiedene Ebenen der Teilhabe deutlich gemacht werden.
Im Jahr 2005 wurde eine Umfrage in der „Lebenshilfe Baden-Württemberg“ zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Vereinsarbeit durchgeführt. Die Umfrage ergab, dass bei 70 % Rückmeldung, 37 % der Menschen mit Behinderungen in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten. Der Anteil der Vorstandsmitglieder mit Behinderung liegt bei 35 %. 3,8 % arbeiten in Orts - und Kreisvereinigungen (vgl. Lucia 2008, S. 170). Dies zeigt, dass die Teilhabe ein wichtiges Thema für Menschen mit Behinderung ist. Um eine Mitwirkung, hier am Beispiel der Mitarbeit in der „Lebenshilfe“, zu stärken, empfiehlt sich die Schaffung von drei Möglichkeitsräumen, die parallel zu einander stehen (vgl. Lucia 2008, S. 170). Diese Ebenen bieten eine Lernumgebung, für die sich eine Person selbstverantwortlich entscheiden kann.
3.1.1 Ebenen der Partizipation
Mitmachen - die offene Mitwirkungsform
Das Mitmachen soll zum Handeln motivieren und hat einen offenen und niedrigschwelligen Zugang. Es geht hier um das aktive Handeln, welches durch einen direkten Erfolg belohnt wird. Die Arbeit findet in Arbeitsgruppen zu bestimmten Tätigkeitsfeldern statt wie zum Beispiel das Organisieren von Feierlichkeiten oder Flohmärkten. In diese offene Mitwirkungsform sollen auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf einbezogen werden.
Das Ziel ist immer die Aktion und liegt in naher Zukunft. Das Ergebnis wird gemeinsam erfahrbar und somit zu einem Erfolgserlebnis. Der Lernprozess wird verbalisiert und auf der Ebene des Empowerments gestärkt (vgl. Lucia 2008, S. 170).
Mitgestalten - die formal definierte Mitwirkungsform
Die Arbeitsweise ist im Gegensatz zur offenen Mitwirkungsform verbindlicher. Die Organisationsform ist formal definiert. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Gruppenmitgliedern und eine festgelegt Amtszeit. Der Zugang erfolgt durch die Mitgliedschaft im Verein und durch die Wahl in den Vorstand. Dies können ein Beirat oder ein Vorstand einer Selbstvertretungsgruppe sein.
Diese Form der Mitgestaltung ist auf eine Interessenvertretung und Meinungsbildung ausgelegt und bietet informelle Lerngelegenheiten. Es können auch beratende Personen hinzukommen. Diese können Rückmeldung und Argumentationshilfen geben und gleichzeitig Informationsvermittler sein. Die Aufträge der offenen und formal definierten Mitwirkungsform überschneiden sich. Wichtig ist ein regelmäßiger Austausch (vgl. Lucia 2008, S. 172).
Mitbestimmen - inklusive Teilhabe
Hier machen die Mitglieder eines Vereins oder Bewohner und Bewohnerinnen in einer Einrichtung aktiv von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Sie können die Zukunftsorientierung und die politische Zielrichtung - hier am Beispiel der „Lebenshilfe“ - mitbestimmen. Menschen mit Behinderungen können sich als Kandidaten aufstellen lassen. Das Votum der Mitgliederversammlung entscheidet über die Zusammensetzung des Vorstandes. In der „Lebenshilfe“ hat sich die Mitarbeit von mindestens zwei behinderten Menschen im Vorstand bewährt. Menschen mit Behinderung in Gremien oder im Vorstand können auch per Satzung quotiert werden (vgl. Lucia 2008, S. 172).
3.1.2 Gesetzliche Verankerung - Gleichstellungsgesetze
Barrierefreiheit hat seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen im April 2002 nicht mehr nur zum Ziel, auf bauliche Veränderungen oder technische Gebrauchsgegenstände zu achten. Barrierefreiheit soll sich auch auf Systeme der Informationsverarbeitung und Kommunikationseinrichtungen beziehen (vgl. Kohte 2004, S. 27). Das barrierefreie Gestalten von Informationen und Kommunikation fordert einen Abbau von Sinnesbarrieren. Schlenker-Schulte führt in diesem Zusammenhang das Mehr-Sinne-Prinzip an. Die Intaktheit der Sinne ermöglicht uns Kommunikation. Wenn ein Sinn versagt, so muss ein anderer Sinn bei der Suche nach Informationen unterstützen (vgl. Schlenker-Schulte 2004, S. 13). Die Sinne Sehen, Riechen, Schmecken, Spüren, Tasten, Sehen und Hören informieren uns über unsere Umwelt. Die Chance, eine Teilhabe durch barrierefreie Information und Kommunikation zu erreichen, setzt jedoch nicht nur den Abbau von Sinnesbarrieren voraus, sondern auch Barrieren im Sprachgebrauch. Der Fokus bei Menschen mit Lernschwierigkeiten liegt in der barrierefreien Gestaltung von Information und Kommunikation auf dem Abbau von sprachlichen Barrieren. Damit ist eine einfache Gestaltung von Informationen in Textform und auch im verbalen Sprachgebrauch gemeint.
Im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen wird Barrierefreiheit wie folgt definiert:
„ Barrierefrei sind [ … ] Kommunikationseinrichtungen, wenn sie f ü r behinderte Menschen in der allgemein ü blichen Weise ohne besondere Erschwernis und grunds ä tzlich ohne fremde Hilfe zug ä nglich und nutzbar sind “ (Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) § 4, Artikel 1, Abschnitt 1).
„Das Ziel des Gleichstellungsgesetzes soll die Benachteiligung von behinderten Menschen beseitigen und verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben der Gesellschaft gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen“ (Stascheit 2007, S. 1279). Im September 1994 fand ein Kongress in Duisburg mit dem Thema „Ich weiß doch selbst, was ich will! - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung“ statt. Menschen mit Lernschwierigkeiten sprachen auf dem Kongress über Selbstbestimmung. Ein wichtiges Kriterium für Selbstbestimmung ist für sie, Wahlmöglichkeiten zu haben. „Wenn man selbstbestimmen will, muss man genug Informationen bekommen und sich selbst suchen, um eine Wahl treffen zu können.“ (Wir vertreten uns selbst! 1997, S. 3). Um an Informationen zu gelangen, müssen diese in erster Linie zugänglich gemacht werden. Zugänglichkeit meint, Informationen entsprechend der Zielgruppe einfach und verständlich zu gestalten. Information verständlich zu gestalten, bedeutet nicht nur, eine einfache Sprache zu verwenden, sondern die Komplexität des Inhaltes auch so verständlich zu machen, dass ein Verstehen möglich ist.
„ Damit ich verstehe, um was es geht, wenn ich einen Antrag oder wenn ich Post krieg, muss ich ja wissen, um was es geht. Ist f ü r mich wichtig. Wenn ‘ s deutlich geschrieben ist und das “ (Anita Kühnel I 2, S. 1)
Frau Kühnel ist beim Lesen ihrer Post oder von Anträgen häufig auf Unterstützung fremder Personen angewiesen, was ihr ein Stück Selbstbestimmung nimmt.
Die barrierefreie Zugänglichkeit von Kommunikationseinrichtungen im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, „[…] ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind„, weist auf einen gesetzlichen Anspruch für Menschen mit Lernschwierigkeiten, den schriftsprachlichen Bereich barrierefrei zu gestalten.
Josef Ströbl weist auf die Notwendigkeit hin, den Anspruch von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf eine „Leichte Sprache“ gesetzlich zu regeln. „Gehörlose Menschen haben bei öffentlichen Einrichtungen zum Beispiel bei Ämtern und Gerichten, das Recht auf Gebärdensprachdolmetscher. Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen bei allen öffentlichen Einrichtungen, besonders bei Ämtern und Gerichten, auch ein Recht auf Unterstützung haben und Unterstützung bekommen, zum Beispiel in leichter Sprache“ (Ströbl 2006, S. 44). Das Recht auf einen barrierefreien Zugang zu Informationen findet sich in den Artikeln der UN-Konvention - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wieder.
In Artikel 2 heißt es:
„Im Sinne des Übereinkommens schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung, […] Großdruck, leicht zugängliche Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein; […] bedeutet "universelles Design" ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. "Universelles Design" schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus“ (UN- Konvention 2008, S. 5).
Weiterhin heißt es in Artikel 9:
„Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit
Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten“ (UN- Konvention 2008, S. 10).
3.2 Lebensqualität als Leitbegriff für Partizipationsprozesse
Der Perspektivenwechsel in der Behindertenhilfe „von der Versorgung zur Unterstützung“ lassen den Einzelnen als verantwortlichen Regisseur seines Lebens hervortreten (vgl. Schäfers 2008, S. 60). Zur Lebensqualität gehört es, selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft teilzunehmen. Das Wissen um die Lebenslagen, Bedarfe der Zielgruppen und Unterstützungsmaßnahmen sind erforderlich, um Lebensqualität zu ermöglichen. Für die Weiterentwicklung des Unterstützungssystems und die Organisation der Hilfen ist das Lebensqualitätskonzept ein wegweisendes Mittel, um Partizipations- und Wahlmöglichkeiten zu evaluieren.
„In einem modernen sozialpolitischen Konzept, sind es nicht mehr die ‚Behinderten‘, für die ein pauschales Angebot zu machen ist, sondern einzelne, höchst verschiedene Individuen, die für sich die Chance zu einer selbstbestimmten Lebensführung einfordern“ (Schädler 2002, S. 172).
Das Konzept der Lebensqualität bietet eine Kategorie, um die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu erfassen und Bedarfslücken zu identifizieren. Der Begriff „Lebensqualität“ wird seit Anfang der 90er Jahren zunehmend in der Heil- und Sonderpädagogik diskutiert. Die aktuellen Leitideen der Behindertenhilfe wie Normalisierung, Integration/Inklusion, Partizipation, Selbstbestimmung und Empowerment haben die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen beeinflusst. Sie zeigen den Ausdruck des Wandels von einer Defizitorientierung hin zu einer Sichtweise, die sich an den jeweiligen individuellen Potenzialen eines Menschen mit Behinderung orientieren soll. Die Lebensqualität ist durch den Wandel in der Arbeit mit behinderten Menschen zu einer Zielperspektive geworden.
Zapf (1984) verbindet Lebensqualität mit guten Lebensbedingungen, die mit einem positiven Wohlbefinden einhergehen (vgl. Schäfers 2008, S. 26). Speck plädiert im Zusammenhang mit dem Begriff „Lebensqualität“ für die Bewertung der Lebensqualität und die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen. „Lebensqualität ist demnach nicht einfach durch bestimmt generelle Maßnahmen und Standards gesichert, […] sondern hängt zugleich davon ab, wie Pläne und organisatorische Maßnahmen im Einzelfall umgesetzt werden, und wie sie vom einzelnen Hilfenehmenden wahrgenommen und bewertet werden“ (Speck 1993, S. 84).
Monika Seifert hat 2003 in einer Lebensqualität-Studie die objektiven und subjektiven Lebensbedingungen von Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf in einer Wohneinrichtung untersucht. Den theoretischen Rahmen für die Untersuchung bildete ein mehrdimensionales Konzept von Lebensqualität, welches eine differenzierte Betrachtung des subjektiven Wohlbefindens in fünf Bereichen in den Blick fasst.
Als ein Ergebnis dieser Studie kam heraus, dass die Abhängigkeit von institutionellen Rahmenbedingungen Partizipationsmöglichkeiten erschwert und oft nicht dem lebenslangen Bildungsanspruch von Menschen mit Behinderung entspricht. Um einen Anspruch zu erheben, müssen Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Rechte kennen und sie artikulieren können. Dafür müssen ihnen Wahlmöglichkeiten in Form von auf sie angepassten verständlichen Informationen eröffnet werden. Hier stellt die Erfassung der Lebensqualität ein bedeutendes Instrument dar, um den Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Beck sieht den Begriff „Lebensqualität als eine übergeordnete Zielsetzung im Zusammenhang mit Normalisierungs - und Integrationsbemühungen (vgl. Dworschak 2004, S. 40). Lebensqualität ist ein komplexes, mehrdimensionales, offenes und relatives Arbeitskonzept. Es bedarf einer theoretischen und empirischen, normativen und lebensweltlichen Begründung (ebd.). Im Mittelpunkt steht der Mensch als sein eigener Akteur.
Beck (1998) betrachtet Lebensqualität als einen Prozess der Bedürfnisbefriedigung in unterschiedlichen Lebensbereichen und dessen subjektive Wahrnehmung. Für die Realisierung von Bedürfnissen ist die Teilhabe an Interaktions-, Kommunikations- und Austauschprozessen mit der sozialen und materiellen Umwelt eine Voraussetzung (vgl. Dworschak 2004, S. 41). Lebensqualität umfasst subjektive und objektive Dimensionen. Mit objektiven Dimensionen sind materielle Grundlagen, die eine Sicherung der Grundbedürfnisse wie z.B. Nahrung, Wohnung, Schutz und Sicherheit gemeint. Die subjektiven Dimensionen charakterisieren Zufriedenheit und individuelles Wohlbefinden (vgl. Dworschak 2004, S. 41).
Die subjektiven Lebensbedingungen sagen laut Seifert mehr über die Zufriedenheit des einzelnen aus als die objektiven Bedingungen. Diese sind aber eine wichtige Voraussetzung für eine gute Lebensqualität (vgl. Seifert 2003, S. 5).
Die wohnbezogenen Dienste der Behindertenhilfe sollen sich nicht nur auf die Bewältigung des Alltages beziehen, sondern auch auf einen lebenslangen Bildungsanspruch von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dazu gehört ein Recht auf Informationen, welche in einer für sie verständlichen Weise aufbereitet werden müssen, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Unsere Sprache ist ein sensibler Gradmesser für die Einlösung der Forderung nach einem partnerbezogenen Dialog zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen und der Achtung des Personenwertes von Behinderten“ (Bleideck 1994, S. 425).
3.2.1 Subjektives Wohlbefinden
Welche subjektiven Indikatoren mit dem Konzept der Lebensqualität einhergehen und wie diese auf Partizipationsprozesse Einfluss haben, möchte ich im Folgenden erläutern.
Lebensqualität beinhaltet nicht nur objektive Lebensbedingungen, sondern auch die subjektive Sichtweise, die Bewertung und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung (vgl. Wansing 2005, S. 134). Bei der subjektiven Lebensperspektive geht es um die Schaffung von Wahlmöglichkeiten und um die Kontrolle von Menschen mit Behinderung über das eigene Leben.
„[…] a form of personal empowerment that allows them to have control in life and service decisions and examination of sources of control in the environment” (Shalock et al. 2002, S. 458).
Das Konzept der Lebensqualität bietet einen Betrachtungsrahmen für die Untersuchung von Hilfen auf die Lebenslagen behinderter Menschen. Zapf (1984) versteht unter subjektivem Wohlbefinden, die von den Betroffenen abgegebenen Einschätzungen über spezifische Lebensbedingungen und über das Leben (vgl. Schäfers 2008, S. 38).
Seifert betrachtet subjektives Wohlbefinden als ein offenes, zu ergänzendes Konzept, welches mit fünf in Wechselbeziehung stehenden Bereichen agiert (vgl. Seifert 2003, S. 6).
Zu den fünf Bereichen gehören das physische, soziale, materielle, aktivitätsbezogene und das emotionale Wohlbefinden (ebd., S. 6 f). Eine zentrale Bedeutung in Verbindung mit Partizipationschancen kommt dem sozialen und aktivitätsbezogenen Wohlbefinden zu. Kommunikation, Interaktion und der Dialog sind wichtige Komponenten des sozialen Wohlbefindens. Die Interaktion mit dem Gegenüber dient zur Persönlichkeitsbildung (ebd.). Die Nutzung einer „leichten Sprache“ kann als eine individuelle Ausdrucksform für das soziale Wohlbefinden sinnvoll sein. In einem barrierefreien Dialog kommen den Interaktionspartnern Wertschätzung und Anerkennung zu. Katzenbach (2004) sieht die fehlende Anerkennung als ein „Problem der Selbstbestimmung“. Die demütigende Erfahrung, nicht als gleichwertiger Interaktionspartner wahrgenommen zu werden, behindert das Individuum (vgl. Ackermann 2008, S. 56).
Zum aktivitätsbezogenen Wohlbefinden gehören laut Seifert Stichworte wie Selbstbestimmung, Mitwirkung, Wahlmöglichkeiten und Eigenaktivität. Die Aktivitäten im Bereich Wohnen sind in Verbindung mit Möglichkeiten der Partizipation an subjektiv bedeutsamen Interaktionen und Situationen zu betrachten. Leitprinzipien wie Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung sind im Bereich des aktivitätsbezogenen Wohlbefindens von besonderer Bedeutung (vgl. Seifert 2003, S. 6).
[...]
1 Name geändert.
2 Mit betroffenen Personen sollen jene Personengruppen bezeichnet werden, die durch schwer verständliche Sprache benachteiligt sind, wie z.B. Menschen mit Lernschwierigkeiten, Analphabetinnen und Analphabeten oder Migrantinnen und Migranten.
3 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps.
- Arbeit zitieren
- Nadine Rüstow (Autor:in), 2009, Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Einführung der „Leichten Sprache“ zur Barrierefreiheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152449
Kostenlos Autor werden





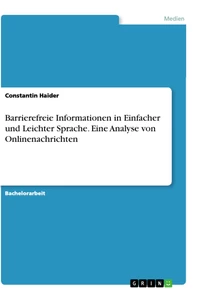


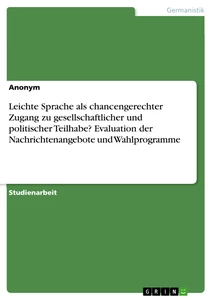













Kommentare