Leseprobe
Zum Problem des „jüdischen Selbsthasses”
Als ich einem jüdischen Arbeitskollegen in meinem Nebenjob von meiner Beschäftigung mit dem Thema dieser Arbeit erzählte, reagierte dieser zunächst mit Skepsis und begründete sie mit der Befürchtung, ein Schlagwort wie „jüdischer Selbsthass“ könne schnell zu einer beliebten Erklärung werde, mit der ein Jude einem anderen Juden vorwerfen könne, warum sich dieser nicht richtig und angemessen zu seiner jüdischen Identität verhalte. Mein Kollege wies mich auf Gershom Scholem hin, der die Vorstellung abgelehnt habe, ein solches begriffliches Konzept wie den spezifisch jüdischen Selbsthass einzuführen, um individuelle Neurosen einzelner Juden zu beschreiben. Andererseits verwenden viele jüdische Autoren selbst den Terminus „jüdischer Selbsthass“ beziehungsweise „jüdischer Antisemitismus“.
Am Anfang dieser Arbeit steht meine Beschäftigung mit Nietzsches höchst interessanter völkerpsychologischen Beschreibung des Judentums, genauer gesagt die Frage nach der jüdischen Rezeption von Nietzsches Schriften. Wie stehen die Juden Nietzsche gegenüber, als sie seinen Schriften begegnen? Unter Nietzsches Bewunderern finden sich in der damaligen Zeit erstaunlich viele kulturell angepasste Juden, darunter auch Theodor Lessing (1872 - 1933), ein Publizist mit leidenschaftlichem Hang zur Kontroverse. Dieser widmet dem Thema des jüdischen Selbsthasses 1930 einen gleichnamigen Essay mit einer biographischpsychologischen Untersuchung von sechs typischen jüdischen Lebensläufen. Lessings Buch ist im Stil eines emphatischen Essays verfasst, aus dem allerdings unzweifelhaft eine tiefe Philantropie spricht. Mir wurde beim Lesen klar, dass Lessings Selbsthass-Analyse nicht ohne die tieferliegende soziale und psychologische Situation der von ihm beschriebenen Juden zu verstehen ist. Die vorliegende Arbeit soll der Versuch sein, diese Situation zu ergründen und sich vor diesem Hintergrund mit ausgewählten Schriften von Lessing, Otto Weininger und Sigmund Freud auseinanderzusetzen.
Um dem Begriff des jüdischen Selbsthasses auf die Spur zu kommen, werde ich zunächst danach fragen, in welchen kulturellen und sozialen Umständen sich dieses Phänomen zu entwickeln scheint. Dazu werde ich die Situation der von Jacob Golomb als „Grenzjuden“ beszeichneten, kulturell angepassten aber sozial weiterhin marginalisierten jüdischen Intelligenz beschreiben. Anschließend werde ich mit Sander Gilman argumentieren, dass der jüdische Selbsthass eng mit der Vorstellung einer spezifischen „verborgenen Sprache“ der Juden verknüpft ist, die sowohl Ursache ihrer kulturellen und sozialen Marginalisierung als auch ihres Hanges zur Selbstkritik ist.
Ich werde am Beispiel von Theodor Lessing, Otto Weininger und Sigmund Freud untersuchen, inwiefern ihre Schriften als symptomatisch für das Phänomen des jüdischen Selbsthasses bezeichnet werden können. Ich bin der Meinung, dass die Annäherung an dieses Thema dabei auch biographische Betrachtungen einbeziehen muss, auch wenn die Biographie heute von vielen Sozialwissenschaftlern als zu vernachlässigbares literarisches Genre angesehen wird, das keinem ernsthaften wissenschaftlichen Anspruch genügt. Ich werde dagegen zu zeigen versuchen, dass ein schwer zu fassender Begriff wie der Selbsthass durchaus erhellt wird, wenn das Werk von Autoren vor dem Hintergrund ihrer Biographie gelesen wird.
Die Situation der deutschsprachigen Juden um die Jahrhundertwende
Jacob Golomb benutzt den Begriff „Grenzjuden“, um zu veranschaulichen, dass die jüdische Intelligenz an der Schwelle zum 20. Jahrhundert gewissermaßen vor der Grenze der gesellschaftlichen Integration steht, diese aber nicht überwinden kann und trotz vielfältigen Assimilationsanstrengungen weiterhin sozial marginalisiert bleibt. In seinem Aufsatz „Nietzsche und die „Grenzjuden““ argumentiert Golomb, warum Nietzsche ein Denker war, der besonders in Kreisen der jüdischen Intelligenz eine überaus leidenschaftliche Begeisterung zu entfachen vermochte. Es war Golomb zufolge die Identitätskrise der kulturell angepassten aber sozial marginalisierten Juden, welche die Faszination für Nietzsche bedingte. Golomb beschreibt diese enthusiastische Nietzsche-Rezeption und das leidenschaftliche Interesse als ein direkt mit der sozialen Marginalität der Juden verknüpftes Phänomen: „Ihre Marginalität und ihr aus dieser Marginalität erwachsendes Bedürfnis nach persönlicher Authentizität ließen sie in Nietzsche einen Geistesverwandten erkennen, und das trug zu der unwiderstehlichen Anziehung bei, die seine Schriften für diese Juden hatten. [...] Sie lasen Nietsche nicht nur, sondern »erlebten« ihn leidenschaftlich - wie Thomas Mann es ausdrückte. Nietzsche diagnostizierte die Qualen, die die Grenzjuden durchlitten, und beschrieb Möglichkeiten, sie zu lindern“ (Golomb 1998: 165).
Der Begriff des jüdischen Selbsthasses ist ohne diese besonderen Qualen, unter denen die Grenzjuden litten, nicht zu verstehen. Diese Qualen bestehen im Kern darin, dass die Juden im Alltag der Diaspora ihre Religion und Tradition verloren hatten und doch nicht völlig von der säkularisierten deutschen oder österreichischen Gesellschaft angenommen wurden. Für die Mehrheit stellten die kulturell angepassten Juden weiterhin Außenstehende dar. Ihre Identität ist daher einem Zwiespalt zwischen Vergessen und Anpassung unterworfen. Golomb schreibt: „Sie alle waren Grenzjuden, in dem Sinne, daß sie ihrer Religion und Tradition verlustig gegangen waren, aber doch nicht vollständig in der säkularisierten deutschen oder österreichischen Gesellschaft aufgingen. [...] Diesen Menschen mangelte es auf tragische Weise an einer Identität: Sie lehntenjede Gemeinsamkeit mit derjüdischen Gemeinschaft ab, waren aber nichtsdestoweniger ihren nichtjüdischen Zeitgenossen unwillkommen“ (Golomb 1998: 166). Die traumatische Wahrheit für diese Juden bestand darin, dass es für einen Juden, der im öffentlichen oder intellektuellen Leben stand, nicht möglich war, seine Herkunft als Jude zu verleugnen. Golomb beschreibt, wie sich viele Juden aus dieser verlorenen Identität heraus darum bemühen, eine neue Identität im Engagement für verschiedene ideologische oder politische Projekte suchen, sei es wie im Falle von Ernst Bloch, Kurt Tucholsky und Ernst Toller in der Identifizierung mit dem Sozialismus oder wie im Falle von Martin Buber, Gershom Scholem oder Max Nordau im zionistischen Engagement.
Golombs Interesse gilt vor Allem einer dritten Gruppe von Juden, nämlich jenen, die gänzlich auf die Suche nach einer neuen vorgefertigten Identität verzichteten. Aus ihnen rekrutierten sich auch die glühendsten Nietzsche-Verehrer unter den Juden: „Nietzsche lehrte sie, daß nach dem Tode Gottes alle im 19. Jahrhundert entstandenen ideologischen und politischen »Ismen« nur noch schemenhafte Relikte waren. [...] Nietzsches inspirierende Forderung, ein wahrhaft freier Geist zu werden und nach persönlicher Authentizität zu suchen, machte ihn für die Grenzjuden attraktiv“ (Golomb 1998: 166f.)
Jacob Golomb beschreibt, wie viele Grenzjuden sich wieder vom Einfluss Nietzsches auf ihr Denken zu befreien versuchten, nachdem sie annahmen, nun doch eine Bestimmung im Leben gefunden zu haben. Sowohl Martin Buber als auch Ernst Toller und Alfred Döblin hörten auf, sich mit Nietzsche zu beschäftigen, als sie ihre Energien in neue Projekte wie Sozialismus oder Zionismus investierten. Lediglich Menschen wie Stefan Zweig, die sich Golomb zufolge niemals für eine festgelegte Identität entscheiden konnten, blieben Zeit ihres Lebens von Nietzsches Ideen fasziniert. Golomb hat dabei sehr deutlich herausgearbeitet, warum die Grenzjuden in Nietzsche eine Art Propheten sahen. Nietzsches Abrechnung mit allen religiösen, moralischen und kulturellen Sicherheiten und seine Forderung nach radikaler Selbstverwirklichung, der alles Dasein unterworfen ist, trifft genau den empfindlichen Nerv der eigenen kulturellen und religiösen Heimatlosigkeit vieler Juden. Ihre prekäre Position zwischen vergessener Tradition und gescheiterter Assimilation in der Diaspora macht aus Nietzsches Forderung, ein radikal ästhetisches Dasein jenseits fester moralischer Gegebenheiten zu führen, macht ihn zum intellektuellen Anziehungspunkt der deutschsprachigen Juden, die verzweifelt versuchen, ihre eigene Marginalität jenseits vorgefertigter Identifikationsmodelle zu bejahen.
Zur Psychologie des Selbsthasses
Entscheidend für das Verständnis des Selbsthasses ist derjüdische Identitätskonflikt kulturell assimilierter Juden, der am Anfang der emphatischen Begeisterung für Nietzsches Denken des radikalen Selbstentwurfs steht. Nietzsches „Existentialismus avant la lettre“ scheint für die Grenzjuden eine besondere Anziehung besessen zu haben. Von Bedeutung für das hier verhandelte Thema ist, dass diese Anziehung aus dem Dilemma des kulturell assimilierten Außenseiters in der deutschen Gesellschaft resultiert. Der „Andere“ kann seine Identität weder in einer Tradition noch in sozialer Wertschätzung durch die Gesellschaft, in der er lebt, ausbilden kann. Mit Axel Honneths Theorie der Anerkennung lässt sich argumentieren, dass verweigerte Anerkennung in intersubjektiven Beziehungen zur Unmöglichkeit führt, ein positives Verhältnis zu sich selbst und somit eine „intakte Identität“ zu entwickeln. Um nachzuzeichnen, wie dieses Dilemma mangelnder Anerkennung im Fall der marginalisierten Juden zum Selbsthaß führt, beziehe ich mich auf Sander Gilmans Studie „Jüdischer Selbsthaß“, in der er in sehr überzeugender Weise argumentiert, wie sehr Fremd- und Selbstprojektion „des Juden“ auf fatale Weise miteinander verwoben sind.
Gilman gelingt es im Bezug auf das psychoanalytische Konzept der „Übertragung“ zu zeigen, dass Selbsthass vor allem dadurch entsteht, dass die Projektion der kulturellen Mehrheit hinsichtlich der Eigenschaften der „Anderen“ von dieser kulturellen Minderheit internalisiert wird und somit eine Fremdprojektion als phantasmatisches Bild der eigenen Persönlichkeit übernommen wird. Das scheinbar verlockende Angebot der kulturellen Majorität an „die Anderen“ lautet dabei: „Werde wie wir, höre auf dich von uns zu unterscheiden, und du wirst zu uns gehören“ (Gilman 1998: 12). Um diesen Status zu erreichen, muss der Außenseiter zunächst tatsächlich die Eigenschaften in sich bekämpfen, die er nach der Projektion der Mehrheit zufolge in sich trägt. Dieser Überzeugung der Mehrheit hinsichtlich seiner „schlechten“ Merkmale wird nun langsam zu seinem eigenen Glauben: Der Assimilationsdruck und der starke Wunsch nach Anerkennung der eigenen Identität führen dazu, dass der Außenseiter selbst davon überzeugt ist, dass in ihm eine „schlechte“ Seite existiert, die er bekämpfen muss, um von der Mehrheit als zugehörig akzeptiert zu werden. Gilman beschreibt die Machtstrukturen, die diesem Prozess zugrunde liegen: „Die privilegierte Gruppe, jene Gruppe, die der Außenseiter als Maßstab für seine eigene Identität betrachtet, wünscht tatsächlich, den Außenseiter zu integrieren und so das Sinnbild ihres eigenen, potentiellen Machtverlusts zu beseitigen. Zugleich aber will sie den Außenseiter außen vor halten, um sich ihre Macht durch die Existenz des Ohnmächtigen immer wieder zu bestätigen“ (Gilma 1998: 13). Gilman präzisiert hinsichtlich der psychologischen Effekte dieses asymmetrischen Machtgefüges: „Die von der Gesellschaft als »anders« Erikettierten befinden sich in einem klassischen double blind. Jeder Mensch, konfrontiert mit solch widersprüchlichen Signalen, verdrängt diesen Konflikt, indem er den Widerspruch verinnerlicht, ihn für einen Widerspruch innerhalb seines eigenen Wesens hält - denn das Vorbild, dem er ja nacheifert, darf natürlich keinen Makel haben“ (Gilman 1998: 13).
Dieser nicht auflösbare psychische Widerspruch bildet die Grundlage, auf der der Selbsthass in Form einer Negativprojektion auf die eigene Identität gedeiht. Die Gruppe, die den Anderen als „andersartig“ definiert findet in ihm eine externalisierte Projektionsfläche für die eigene Angst vor dem Machtverlust. Der fatale Kreislauf der Projektion schließt sich, weil die Anderen diese Projektion der Andersartigkeit annehmen und sie zum Wertmaßstab dafür machen, was für sie erstrebenswert ist und was es zu verachten gilt. In einer furiosen Passage gelingt es Gilman, den Selbsthass als internalisierte Projektion zu erklären (Gilman 1998: 14f.). Die Ablehnung der „Anderen“ durch die Machtgruppe setzt einen psychologischen Mechanismus der Selbstbeobachtung in Gang, der stets danach fragt, was den Grund der Ablehnung ausmacht, also was am Anderen „anders“ und somit nicht nur für die Mehrheit sonden auch für das eigene Selbstbild nicht länger annehmbar ist. Es folgt ein Ausschluss dieser negativen Eigenschaften aus der eigenen Ich-Identität und wiederum eine externalisierte Projektion auf einen verachtenswerten imaginären Anderen: „Um seine »Andersartigkeit« nach außen projizieren zu können, sondert er einen Teilbereich der Kategorie aus, in die er eingeteilt wurde. Er betrachtet nun diesen Teilbereich (der aber alle Merkmale aufweist, welche die Machtgruppe auf die Außenseiter projiziert hatte) als die Essenz der Andersartigkeit und trennt ihn von seiner Selbstdefinition“ (Gilman 1998: 14). Das in psychologischer Hinsicht fatale dieses Prozesses der doppelten Übertragung ist die Tatsache, dass die Juden damit die Fremdzuschreibung negativer Eigenschaften zu ihren eigenen Maßstäben machen, was an ihrer Identität und Herkunft verachtenswert ist und welches makellose Idealbild es anzustreben gilt.
Entscheidend ist zudem, dass es nicht gelingen kann, sich von diesem externalisierten Ich zu distanzieren, dass exemplarisch alle schlechten Eigenschaften „des Juden“ in sich vereint.
Aus der Differenz von angestrebtem Ideal-Ich und intensiv verachteten
Persönlichkeitsmerkmalen folgt eine Persönlichkeitsspaltung, die schließlich zum Selbsthass führt. Auch wenn man sich, so Gilman, mit großem Aufwand von einem eigenen Teil der Persönlichkeit distanziert, so spürt man doch ständig eine imaginäre Stimme der Machtgruppe, die spricht: „Du kannst dich nicht verstecken, ich erkenne auch in dir den Anderen!“ (Gilman 1998: 14). Gilmans Hauptthese besteht nun darin, dass es die Vorstellung einer „verborgenen Sprache“ der Juden ist, die das Wesen ihrer Andersartigkeit im Kern ausmacht. Diese Sprache steht exemplarisch für ihre Furcht vor dem einen Merkmal, das unaustilgbar jüdisch bleibt und durch keine Assimilationsanstrengung zu überwinden ist. Gilmans psychologischer Erklärung folgend ist es deshalb auch das Merkmal, dem die heftigsten Versuche gelten, es von der eigenen Persönlichkeit abzuspalten. Dies geschieht, indem es auf eine andere Gruppe von Juden projiziert wird.
Für die kulturell assimilierten Westjuden war diese Gruppe häufig das Bild der „mauschelnden”, schlecht angepassten Ostjuden. Es lässt sich nicht leugnen, dass jüdischer Selbsthass besonders dort auftritt, wo assimiliertes Westjudentum auf fremdartiges Ostjudentum trifft, nämlich im Westeuropa der Jahrhundertwende - besonders in Deutschland und Österreich. Dies ist eine Situation des Zusammentreffens von zwei jüdischen Kulturen, die sich noch verstärkt, als die russischen Pogrome der 1880er und 1890er Jahre zu verstärkten Wanderungsbewegungen der osteuropäischen Juden nach Westeuropa führen. Der Historiker Jens Malte Fischer schreibt über dieses Zusammentreffen der Westjuden mit dem als fremdartig empfundenen osteuropäischen Judentum: „Der westeuropäische Jude wollte durch einen Fremden, der aus Lodz oder Brody kam, nicht an den eigenen Großvater erinnert werden, der aus Posen oder Kattowitz gekommen war. Der vielseitig gefährdete jüdische Kleinbürger, der es gerade »geschafft« hatte oder gerade zu schaffen glaubte, in die westeuropäische Bourgeoisie einzutreten, wie auch der erfolgreich assimilierte jüdische Großbürger - sie beide konnten durch den Vetter aus Lodz, der jiddisch sprach und in Kleidung und Haartracht, ganz zu schweigen von den religiösen Gebräuchen, abstach, doch erheblich verunsichert werden“ (Fischer 1989: 142).
Das als „anders“ wahrgenommene Ostjudentum wird für viele kulturell angepasste Westjuden nicht nur verunsichernd, sondern zur imaginären Negativprojektion des „schlechten Juden“, der sich in der Gesellschaft nicht gesittet zu verhalten weiß und in modernen Gesellschaften keine Kompetenz im sozialen Umgang besitzt. Kurz: Er beherrscht den kulturellen Kodex der Anpassung nicht. In Arthur Schnitzlers Roman „Der Weg ins Freie“ findet sich dafür eine treffende Umschreibung.
[...]
- Arbeit zitieren
- Christian Müller (Autor:in), 2010, Der Diskurs über jüdische Identität zur Zeit der Wiener Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152440
Kostenlos Autor werden















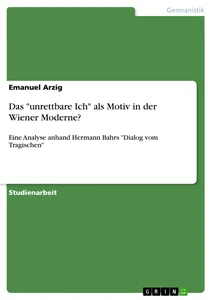






Kommentare