Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1. Aspekte der Milieuforschung
2. Weiblichkeit, Geschlechterstereotype und soziale Milieus
3. Methodologische und methodische Voraussetzungen der Studie
4. Empirischer Teil - Interviews
4.1 Einstiegsfragen zum Begriff Weiblichkeit
4.2 Einige Aspekte zum Themenkreis „Frausein“
4.3 Arbeit und Produktivität
4.4 Haushalt, Haushaltsführung und Arbeitsteilung
4.5 Führungsrollen in den einzelnen Berufssparten
4.6 Freizeitgestaltung
4.7 Materielle Sicherheit
4.8 Beziehungen
4.9 Paarbeziehungen, Partnerschaft, Ehe
4.10 Beziehung zu den eigenen Kindern
4.11 Erziehung zur Weiblichkeit
4.12 Körperlichkeit
4.13 Werte und Grundprinzipien
4.14 Ziele und Wünsche
5. Theoretische Reflexion der empirischen Ergebnisse
6. Resümee und Ausblick
Literaturverzeichnis
Danksagung
Für das Gelingen dieser Diplomarbeit bin ich vielen Menschen aufrichtig dankbar:
Meiner Betreuerin Univ. Prof. Dr. Maria Andrea Wolf für ihre Geduld und für die vielen wertvollen Anregungen. Sie hat es hervorragend verstanden, mich durch verschiedene „Stillstände“ zu manövrieren. Sehr wertvoll war für mich ihre feine Art, durch positive Ermunterungen und neue Lösungsansätze weiter zu helfen.
Dankbar bin ich allen Frauen, die den Mut hatten, sich einem Interview zu stellen. Ohne diese Frauen wäre die vorliegende Arbeit nicht entstanden.
Danken möchte ich auch einigen Freunden und Bekannten aber auch Familienmitgliedern, die immer wieder bereit waren, mit mir über die Arbeit zu diskutieren. Ohne sie wäre ich mir bei den Zweifeln, die durch die Arbeit hervorgerufen wurden, sehr einsam vorgekommen.
Einleitung
In der wissenschaftlichen Literatur erschienen in den letzten fünfzig Jahren nicht allzu viele Arbeiten, welche milieuspezifische Konzepte von Weiblichkeit zum Thema machten. Obwohl der Begriff „Weiblichkeit“ allgegenwärtig ist, wird er in den verschiedensten Zusammenhängen sehr unterschiedlich gefüllt und gebraucht. Es wird im positiven wie im negativen Sinne darauf Bezug genommen.
In der vorliegenden Arbeit kommen Frauen verschiedener Milieus in qualitativen Interviews zu Wort. Während und nach der Auswertung der Interviews wird ständig versucht, einen Bezug zum derzeitigen Forschungsstand herzustellen.
Ein wichtiger Impuls für meine Diplomarbeit kommt von Robert W. Connells Buch „Der gemachte Mann; Konstruktion und Krise von Männlichkeit“ (1995). In diesem Buch versucht der australische Erziehungswissenschaftler zu zeigen, wie verschiedene Formen von Männlichkeiten gesellschaftlich hervorgebracht werden. Er arbeitet mit Hilfe von Interviews heraus, wie Männer aus verschiedenen Milieus mit der Vielfalt verschiedener Männlichkeitstypen umgehen, und welche Krisen sie dabei haben. Der Anlass seiner Arbeit ist die Kritik an den Sozial- und Kulturwissenschaften, die relativ unreflektiert von einem Menschenbild ausgehen, das weiße, reiche, heterosexuelle Männlichkeit als allgemeinen Standard betrachtet. Connell arbeitet besonders die drei Strukturen Macht, Arbeitsteilung und emotionale Bindungen heraus.
Ich möchte in der vorliegenden Arbeit untersuchen, was Weiblichkeit in drei ausgewählten österreichischen Milieus kennzeichnet. Alle Fragestellungen nähern sich auf unterschiedliche Weise den Leitgedanken, wie Weiblichkeit in einem Milieu bestimmt wird und was Weiblichkeit im jeweiligen Milieu ausmacht. Von besonderem Interesse ist, wie „Frau sein“ im definierten Milieu gelebt wird.
Die Selbstdefinition von Weiblichkeit der verschiedenen Milieus wurde als wichtiges Kriterium festgelegt, wobei davon ausgegangen wurde, dass es Unterschiede gibt!
Der ausgeübte Beruf und damit auch die Bildung wurden als Kriterien für die Auswahl der Interviewpartnerinnen herangezogen.
Beabsichtigt war weiters, durch gezielte Fragen die verschiedenen Lebensbereiche und Grundeinstellungen zu beleuchten und weibliche Verhaltensweisen zu beschreiben. Durch Vergleich der Aussagen wurden Ähnlichkeiten und Unterschiede beschrieben.
Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung beginnt die Arbeit mit einem Kurzabriss zur Milieuforschung. Es folgen Ausführungen zum Begriff „Weiblichkeit“ unter Berücksichtigung der Geschlechtsstereotype und der sozialen Milieus. Im dritten Abschnitt werden die methodologischen und methodischen Voraussetzungen behandelt. Besonders die Überlegungen zur Auswahl der interviewten Frauen und zur Interviewführung werden hier ausführlich dargestellt.
Im empirischen Teil, dem Kernbereich dieser Arbeit, werden die Interviews und deren Auswertung ausgeführt. Daran anschließend folgen theoretische Reflexionen der empirischen Ergebnisse sowie vergleichende Betrachtungen zu Weiblichkeitskonzepten.
Resümee und Ausblick bilden den Abschluss dieser Diplomarbeit.
1. Aspekte der Milieuforschung
Die Beschäftigung mit der Milieuforschung ist für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung, als dass sie den theoretischen Bezugspunkt für die Interviews darstellt. Die Kategorisierung der befragten Frauen sollte dabei helfen, die einzelnen Gruppen besser zu verstehen und die Fragen angepasster zu formulieren. Meine anfängliche Überlegung war, dass das Milieu, aus dem die Befragten stammen, einen großen Einfluss auf die Weise, wie sie Weiblichkeit leben und vor allem beschreiben, hat.
1.1 Milieu - Auswahl von Definitionen und Verwendung dieses Begriffes
Der Begriff „Milieu“ wird nicht einheitlich definiert. Die nachstehenden Definitionen, die keineswegs vollständig sind, verdeutlichen das. Unter dem Begriff Milieu versteht der Soziologe Peter Hartmann Gruppen von Personen, die unter ähnlichen sozio-ökonomischen und demographischen Bedingungen ähnliche Lebensstile entwickelt haben. (vgl. Hartmann in: Endruweit, 2002, 317)
Eine andere Definition stammt von dem Soziologen Stefan Hradil: „Gruppen Gleichgesinnter, die gemeinsame Werthaltungen und Mentalitäten aufweisen und auch die Art gemeinsam haben, ihre Beziehungen zu Menschen einzurichten und ihre Umwelt in ähnlicher Weise zu sehen und zu gestalten.“ (Hradil in: Burzan, 2007,103)
1.2 Lebensstil - Darstellungsmöglichkeiten
Innerhalb der Milieuforschung wird der Begriff Lebensstil immer wieder erwähnt. Durch die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaften ist der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Milieu nicht mehr so einfach darzustellen. Hier setzt die Lebensstilforschung an.
Der Begriff Lebensstil wurde erstmals bekannt durch Max Webers (1864 - 1920) „style of life“. Er sah den Lebensstil als ein charakteristisches Merkmal eines Standes an, der eine typische Lebensführung, bestimmte Werte, typische Formen des Handelns usw. hat. Bei Weber basiert der Stand vor allem auf sozialem Prestige und Ehre. Der Lebensstil drückt die Zugehörigkeit zu einer Gruppe aus. Damit verbunden sind soziale Anerkennung und die Möglichkeit, diese nach außen zu zeigen. Wie der amerikanische Ökonom und Soziologe Thorstein Veblen 1899 beschreibt, hat der Lebensstil die Funktion, soziale Anerkennung über verschiedene äußerliche Handlungen, wie Konsum oder Freizeitgestaltung, zu erlangen und sich besonders nach unten abzugrenzen. (vgl. Burzan, 2007, 89f)
In Deutschland wurde die Lebensstilforschung dazu verwendet, um den Rückgang des parteigebundenen Wahlverhaltens zu erklären. Die übliche Einteilung der 60er Jahre in Schichten (basierend auf Beruf, Einkommen und Schulbildung), ließ keine Prognosen mehr zu. Große Teile der Bevölkerung wurden automatisch ausgeschlossen, da sie nicht erwerbstätig waren. Dies betraf besonders Frauen, junge in Ausbildung stehende Menschen und PensionistInnen. Hausfrauen und Kinder übernahmen bei dieser Klassifizierung automatisch den Status des Familienvaters. Frauen erlangen aber inzwischen immer höhere Bildungsniveaus und werden laut Richter in Zukunft über höhere Bildungstitel als Männer verfügen, da bereits jetzt mehr Frauen als Männer universitäre Studien beginnen. (vgl. Richter, 2006, 96)
In einem zweiten Bereich wurden Veränderungen auch im Erziehungsbereich sichtbar. Man ging davon aus, dass die Mittelschichten eher demokratisch erziehen, die Ober- und Unterschichten dagegen eher autoritär. In den 70er Jahren löste sich diese Linearität auf und die Zugehörigkeit zu einer Schicht konnte das Erziehungsverhalten nicht mehr vorgeben (ebda.).
Wie bei dem Begriff „Milieu“ gibt es auch von dem Begriff „Lebensstil“ keine einheitliche Definition.
Das Wörterbuch der Soziologie definiert Lebensstil als „Ausdrucksform der alltäglichen Daseinsgestaltung in ganzheitlich-umfassender Weise“ (Hillmann, 1994, 477)
Der Soziologe Stefan Hradil nennt das „Verhalten, vor allem im Konsum-, Freizeit- und sozialen Bereich [den] kleinsten gemeinsamen Nenner von Lebensstilkonzepten“. (Hradil in Burzan, 2007, 92)
Lebensstil wird vom Soziologen Rudolf Richter als Orientierungsrahmen gesehen, als Summe von sozialen Handlungen, die quer durch alle Bereiche des Lebens wiederum das Verhalten steuern, wie z. B. Freizeitgestaltung, politisches Interesse, welche Einstellung man zur Arbeit hat, oder ob man gerne zu Hause kocht. (vgl. Richter, 2006, 31f)
Eine wichtige Funktion des Lebensstils ist die Handlungsorientierung. Dies sichert Routine, womit ständige Grundsatzentscheidungen über Verhaltens- weisen entfallen. Außerdem kann man mit einem Lebensstil mehr oder weniger stark die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe zeigen, und damit verbunden auch die Abgrenzung zu anderen Gruppen. Dadurch wird nicht nur die soziale, sondern auch die persönliche Identität gestärkt. (vgl. Burzan, 2007, 92)
Lebensstilmodelle beanspruchen folgende Vorteile gegenüber den älteren Klassenmodellen:
- Es geht bei den Lebensstilmodellen nicht nur um objektive Merkmale wie Einkommen, sondern vor allem auch um kulturelle und symbolische Faktoren. Wichtig ist, wie sich eine Person verhält, wie sie mit Ressourcen umgeht. Die gestiegenen Wahlfreiheiten sollen mehr berücksichtigt werden. Insgesamt geht es um eine ganzheitlichere Sicht und darum, ein möglichst lebensnahes Modell zu erstellen, das die Makroebene der Struktur und die Mikroebene der Handlung verknüpft. (vgl. Burzan, 2007, 93)
- Lebensstile werden wegen der vielfältigen Faktoren nicht nur vertikal hierarchisch strukturiert, sondern auch horizontal. Menschen mit gleichen vertikalen Merkmalen (wie z. B. Qualifikation) können durch unterschiedliche horizontale Merkmale (wie z. B. Alter) verschiedene Lebensstile haben.
- Klassen standen sich je nach Konzept feindlich gegenüber (z. B. Marx). Dies ist bei den Lebensstilen nicht der Fall, die Relationen sind verschieden.
Heutige Lebensstilansätze sind besonders von der Marktforschung geprägt, deren Interesse vor allem die Analyse von Kaufverhalten ist, um adäquate Werbeangebote anbieten zu können.
Für die Soziologie stellen sich besonders folgende Fragen: Was kennzeichnet einen Lebensstil? Durch welche Merkmale werden Lebensstile eingeordnet und abgegrenzt? Welche Chancen sind mit einem Lebensstil verbunden? Besonders wichtig ist auch die Frage, wie sich ein Lebensstil weiterentwickelt. Der Anspruch der verschiedenen Lebensstilmodelle ist es, soziale Ungleich- heiten genauer analysieren zu können als die alten Klassen- und Schicht- modelle. (vgl. Burzan, 2007, 91)
Es gibt zwei Hauptströmungen innerhalb der Lebensstilforschung.
1) Strukturierungsmodelle: Die Lebensstilgruppen sind durch vertikale und horizontale Merkmale geprägt. Hierzu gehören auch die Arbeiten von P. Bourdieu, auf den ich später noch näher eingehen möchte.
2) Entstrukturierungsmodelle: Hier geht es nicht um strukturelle Kriterien, sondern die Menschen handeln relativ losgelöst von Strukturen nach eigenen Präferenzen. Es gibt allerdings keine völlige Entstrukturierung zwischen sozialen Lagen und dem Handeln der Menschen. Lebensstil wird dabei selbst zum erklärenden Merkmal, bekommt eine eigene Autonomie und steht nicht in Abhängigkeit zu strukturellen Merkmalen. Umgekehrt sind die strukturellen Merkmale abhängig vom Lebensstil. (vgl. Burzan, 2007, 94)
1.3 Lebensstile und Milieus im Vergleich
Zwischen Lebensstil- und Milieukonzepten bestehen einige Gemeinsamkeiten, somit ist eine scharfe Abgrenzung weder möglich noch sinnvoll. Als Gemeinsamkeiten lassen sich nachstehende Punkte erkennen:
- beide dienen als Alternative zu den traditionellen Klassen- und Schichtkonzepten;
- dem Handeln, den Entscheidungen und der Lebensweise der Personen werden relativ große Bedeutung beigemessen;
- Realitätsnähe wird angestrebt durch mehrere integrierte Dimensionen in Kombination mit „objektiven“ Lebensbedingungen und
- beide Konzepte ergänzen sich teilweise, da Milieus auch durch bestimmte Lebensstile charakterisiert werden.
Bei der Betrachtung der Unterschiede wird aber klar, dass Milieu- und Lebensstilkonzepte nicht als Synonyme verwendet werden können. Obwohl es keine klare Abgrenzung zwischen Lebensstil- und Milieukonzepten gibt, hebt sich das Lebensstilkonzept klar ab, weil das Verhalten von Menschen als wichtiger Parameter bei den Klassifizierungen sozialer Gruppen erkennbar ist. Milieumodelle erklären nur sehr wenig, wie die Lebensstile entstehen oder wie sie sich entwickeln.
Die Forschung geht davon aus, dass Personen zumindest teilweise ihre Handlungen frei wählen und sich expressiv ausdrücken können. Bei den Milieukonzepten geht es eher um die Nutzung der Bedingungen des Milieus. Die Wahlfreiheiten sind also etwas begrenzter. Milieukonzepte versuchen sich mehr an „objektiven“ Gegebenheiten zu orientieren als Lebensstilkonzepte. (vgl. Burzan, 2007, 104f)
1.4 Überblick über die Sinusmilieus
In den siebziger Jahren entstanden durch den Einsatz von Computern multivariable Analyseverfahren (mehr als zwei Merkmale werden gleichzeitig betrachtet). Viele verschiedene Verhaltensmerkmale und Einstellungen konnten aus Befragungen (oder durch Sekundäranalyse früherer Befragungen) an- alysiert und in Clustern zusammengefasst werden. So entstanden Milieu- Landkarten.
Sehr bekannt sind die sogenannten Sinus-Milieus. Sie wurden von der Markt- und Medienforschung des Heidelberger Milieu- und Trendforschungsinstitutes Sinus Sociovision entwickelt. Seit 1979 teilt dieses Modell die deutsche Bevölkerung in verschiedene Milieus ein. Das geschah anfangs mit qualitativen Erhebungsmethoden, fundiert durch eine sehr große Stichprobe. Inzwischen gibt es als Milieuindikator ca. 45 Wertitems und eine spezielle Zuordnungsregel. Da es regionale Unterschiede gibt, wurden für verschiedene Länder auch verschiedene Milieu-Landkarten entwickelt. So gibt es in Österreich zum Beispiel ein spezielles ländliches Milieu, das in anderen Ländern in dieser Form nicht aufscheint.
Abgebildet werden die Milieus in einer Grafik, in der die horizontale Achse die Grundorientierung darstellt. A steht für die traditionellen Werte (wie Pflicht- erfüllung und Ordnung), B für Werte der Modernisierung (wie Individualisierung, Selbstverwirklichung und Genuss) und C für Werte der Neuorientierung (wie Multi-Optionalität, Experimentierfreude oder Leben in Paradoxien).
Die vertikale Achse beschreibt die soziale Lage und ist eine klassische Dreiteilung von Ober-, Mittel- und Unterschicht. Zwischen diesen 2 Achsen entstehen kartoffelähnliche Cluster, die sich zum Teil auch überschneiden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Sinus-Milieus Österreich
Seitdem wurden sowohl Veränderungen in Bezug auf die Milieugröße als auch in der Konstellation der Milieus untersucht. So haben sich zum Beispiel die Arbeitermilieus in Deutschland verkleinert, aber es haben sich auch neue Milieus gebildet. Auch die Verfahren der Milieuzuordnung wurden verbessert. (vgl. Burzan, 2007, 106)
Der Nachteil des Systems ist, dass eine für alle Lebensbereiche gültige Typologie sehr allgemein ist. Der Vorteil ist aber, dass sich allgemeine Typologien an verschiedene Unternehmen verkaufen lassen. Es gibt für die Sinus-Milieus keine Validitätskonzepte, weshalb man sie sehr vorsichtig beurteilen sollte.
Das Institut Sinus Sociovision gibt an, dass in ihrem Modell im Unterschied zu anderen Lifestyle-Typologien „eher die Tiefenstrukturen sozialer Differenzier- ung“ beschrieben werden. Es werden einerseits Bereiche wie Arbeit, Freizeit, Familie, Geld, Konsum, Medien usw. erfasst, und andererseits Werte- orientierungen, Alltagseinstellungen, Wunschvorstellungen, Ängste und Zu- kunftserwartungen mit eingebunden. (vgl. Sinus Sociovision, 2009, 6f)
Der Soziologe Rudolf Richter erläutert dazu, dass es sich bei Lebensstilanalysen nur um Beschreibungen der Milieus handelt, nicht wie manchmal falsch interpretiert und verwendet um irgendwelche Erklärungen. Eine möglichst umfangreiche Beschreibung der Lebensstile ist deshalb wichtig. (vgl. Richter, 2006, 150) „Die ungeheure Vielfalt, die unverbindlichen Grenzen, das Fehlen sozialmoralischer Milieus als Orientierungshilfe legt den Schluss nahe, das Individuum könne frei wählen, kollektive, subkulturelle Bindungen seien nebensächlich geworden. Tatsächlich sind die strukturellen Ungleichheiten keineswegs verschwunden.“ (Richter, 2006, 17)
1.5 Beschreibung einiger Sinusmilieus hinsichtlich der Interviews
Die Kurzdarstellung einiger Bereiche der Sinusmilieus dient dazu, die Berufe der interviewten Frauen zuzuordnen. Mit dem mittleren B-Bereich lassen sich die Berufe gut erfassen.
B3 Konsumorientierte Arbeiter (10%)
„Die stark materialistisch geprägte Unterschicht: Anschluss halten an die Konsum-Standards der breiten Mitte als Kompensationsversuch sozialer Benachteiligung“ (vgl. Sinus Sociovision, 2009, 15)
Das Alter ist in diesem Milieu breit gestreut bis ca. 60 Jahre. Die Bildung besteht meist aus Hauptschulabschluss mit oder ohne Berufsausbildung. Demnach gibt es in diesem Milieu hauptsächlich ArbeiterInnen und FacharbeiterInnen und insgesamt gehören sie zur unteren Einkommensklasse. Konsumorientierte ArbeiterInnen sind häufig von sozialen Benachteiligungen wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder unvollständigen Familien betroffen. In der Freizeit bevorzugen diese Menschen Ablenkung, Action und Spaß. Prestigeträchtiger Konsum ist wichtig (z.B.: Unterhaltungselektronik, Auto, Modeschmuck). (vgl. Sinus Sociovision, 2002, 1)
Die befragten Friseurinnen entsprechen ihrer Lebensstilisierung. Sie beurteilen sich (außer der Salonbesitzerin) als unterbezahlt und können sich schwer vorstellen, mit ihrem Einkommen eine Familie erhalten zu können. Als Möglichkeit das zu schaffen, sehen sie einen „Jobwechsel“, wobei aber in einem Familienverband das Einkommen des Mannes als Basis gesehen wird. Freizeit wird als Interaktion mit ihrer sozialen Schicht betrachtet, Sport und Spaß spielen bei den jungen Friseurinnen eine große Rolle. Bei den Wünschen dominieren Konsumgüter, wie ein besseres Auto, aber auch bessere Wohnverhältnisse.
B2 Bürgerliche Mitte (19%)
„Der statusorientierte moderne Mainstream; Streben nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen“ (ebda.)
Der Altersschwerpunkt der bürgerlichen Mitte liegt zwischen 30 und 50 Jahren und es handelt sich oft um Mehr-Personen-Haushalte. Typisch sind qualifizierte mittlere Bildungsabschlüsse und mittlere Einkommensklassen. Die Menschen arbeiten als einfache bis mittlere Angestellte und Beamte, oder als Fach- arbeiter. Außerdem ist die bürgerliche Mitte ein kinderfreundliches Milieu. Dementsprechend beschäftigen sich die Personen dieses Milieus intensiv mit ihren Kindern. Lebensziel ist es, in gut gesicherten, harmonischen Ver- hältnissen mit angemessenem Wohlstand zu leben. Die Position in der Mitte der Gesellschaft ist dabei wichtig. (vgl. Sinus Sociovision, 2003, 1)
Die Lehrerinnen C. und G. können in diese modernisierte „Mittlere Mittelschicht“ gut eingeordnet werden. Obwohl sie vom Bildungsniveau eher über den mittleren Bildungsabschlüssen liegen, sind HauptschullehrerInnen in Tirol nach einigen Jahren Wartezeit nach der Pragmatisierung ihres Dienstverhältnisses BeamtInnen und in der Regel auch unkündbar. Der Beruf verlangt nach Kinderfreundlichkeit, was nicht zwangsläufig auch im privaten Bereich ausgelebt werden muss. Von den Lehrerinnen hat nur eine eigene Kinder. Die Lebensumstände wirken harmonisch, der Wohlstand scheint gesichert. Lehrerin G. gibt auch im Interview an, dass sich ihre Familie bei kleineren An- schaffungen nicht lange Gedanken machen müsse, ob das leistbar sei. Bei größeren Investitionen, wie z. B. Renovierungen am Haus, müsste längere Zeit gespart werden.
Auch auf Ärztin D. passen einige Kriterien der „Bürgerlichen Mitte“ gut. Sie ist in einem beamteten Besoldungsstatus und pragmatisiert. Ihre materiellen Ansprüche kann sie gut befriedigen, meint aber im Interview, dass sie bei Weitem nicht so viel verdiene wie ihre frei praktizierenden KollegInnen. Eigene Kinder hat sie nicht, sie scheint aber trotzdem eine sehr kinderfreundliche Einstellung zu haben. Der Ausbildungsgrad passt nicht zu B2, aber ihr Lebensstil weist trotzdem starke Ähnlichkeiten mit dieser Gruppe auf.
B12 Postmaterielle (9%)
„Das aufgeklärte Nach-68er-Milieu: Liberale Grundhaltung, postmaterielle Werte und intellektuelle Interessen“ (ebda.)
Das Altersspektrum dieses Milieus ist sehr breit gefächert, von Anfang 20 bis zur Generation der „jungen Alten“. Die Haushalte sind häufig größer und mit Kindern. Die Postmateriellen haben hohe bis höchste Formalbildung, also Matura und Studium. Sie arbeiten als qualifizierte und leitende Angestellte und Beamte, als Freiberufler, oder studieren noch. Dementsprechend ist ihr Einkommensniveau hoch und sie wollen Erfolg im Beruf - aber nicht um jeden Preis. Die Entfaltung der individuellen Bedürfnisse und das Schaffen von Freiräumen für sich und Zeitsouveränität sind besonders wichtig. In der Freizeit interessieren sich die Personen dieses Milieus für Literatur, Kunst, Kultur und Weiterbildung.
Die Einstellung der Postmateriellen ist tolerant und kosmopolitisch, umwelt- und gesundheitsbewusst. Sie definieren sich mehr über Intellekt und Kreativität als über Besitz und Konsum. (vgl. Sinus Sociovison, 2002, 2)
Die Ärztinnen A. und B. entsprechen in ihrer Lebensstilisierung gut den „Postmateriellen“. Sie passen in die oben erwähnten Bildungswege, und tendieren sehr stark dazu, sich Freiräume zu schaffen. Die Freizeitgestaltung entspricht ebenfalls der Beschreibung, genau wie die Einstellung beruflichen Erfolg nicht um jeden Preis erfahren zu wollen. Sie sind weniger konsumorientiert und betonen an verschiedenen Stellen der Interviews, dass ihnen das Ausleben ihrer Kreativität wichtig sei.
1.6 Der Habitus - Bindeglied zwischen sozialem Raum und Lebensstil
Der Soziologe Pierre Bourdieu differenziert genauer und hat zusätzlich zum Begriff Lebensstil, den Begriff des Habitus besonders ausgearbeitet. Der Habitus ist ein System stabiler Handlungsdispositionen. Er entwickelt sich von Geburt an und ist stark von der Familie und der sozialen Umgebung abhängig. Man erkennt den Habitus am Lebensstil einer Person. Wer den „richtigen“ Habitus hat, der kann sich in seinem Milieu leicht bewegen und es erhalten.
Bourdieus Modell ist an dieser Stelle interessant, da es sowohl die Klassenmodelle als auch die Lebensstilkonzepte verbindet.
Die erste Ebene ist der Raum mit seinen objektiven sozialen Positionen. Bestimmt werden diese unterschiedlichen Positionen vor allem über den Begriff des Kapitals. Den Menschen steht sowohl ökonomisches als auch soziales und kulturelles Kapital zur Verfügung. Wichtig sind hierbei die Art des Kapitals, die Gesamtmenge und auch die Kombination der Kapitalarten.
Ökonomisches Kapital ist zwar die wichtigste Kapitalart, aber auch die anderen zwei sind relevant für die soziale Lage. Ökonomisches Kapital besteht aus dem Geld, das man verdient, erbt oder sonst erwirbt.
Soziales Kapital sind Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit einer Gruppe beruhen, und die sich im Kampf um eine bessere Position einsetzen lassen. Ein Beispiel wären Absolventen einer exklusiven Schule, die ein Netzwerk von Beziehungen haben. Dieses Kapital ist einerseits von der familiären Herkunft abhängig, andererseits müssen die Beziehungen regelmäßig gepflegt werden.
Kulturelles Kapital zeigt sich in der Umgangsweise mit Kultur und Kulturgütern wie Büchern, Bildern, Bildungstitel u. v. a. m. Das kulturelle Kapital besteht wiederum aus drei Untergruppen:
- Inkorporiertes Kulturkapital: Gemeint ist Bildung und Wissen, und zwar nicht nur schulisches Wissen, sondern auch solches, das man sich über die Erziehung in der Familie aneignet - also besonders verinnerlichtes (engl. incorporation) Wissen. Um dieses Wissen zu erwerben, braucht es Zeit und es kann nicht schnell gekauft oder verschenkt werden. Die erste Aneignung des inkorporierten Kulturkapitals ist besonders prägend (z. B. die Sprech- weise).
- Objektiviertes Kulturkapital: Hier handelt es sich um kulturelle Güter, die man besitzt, wie z. B. Bücher, Gemälde oder Instrumente. Dieses Kapital ist leichter auf andere übertragbar, bringt aber nur etwas, wenn man es auch anwendet und strategisch einsetzt.
- Institutionalisiertes Kulturkapital: Hierbei geht es um über Bildungseinrichtungen erworbene Titel, die institutionell anerkannt sind. Sie haben einen relativ dauerhaften und rechtlich garantierten Wert und sollen eine gewisse Übertragbarkeit in ökonomisches Kapital sichern. Das kann sich mit der Zeit ändern, wie man zum Beispiel am Wert der Reifeprüfung sieht. (vgl. Bourdieu in Baumgart, 2000, 217f)
Um die soziale Position einer Person zu bestimmen, reicht es nicht, die verschiedenen Kapitalarten zusammenzuzählen. Bourdieu konstruiert Klassen „durch die Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen“. (Bourdieu in: Burzan, 2007, 129)
Weiters ist die Position eines Menschen abhängig von einem Zeitfaktor und der sozialen Laufbahn. Die Kombination der Kapitalarten wird also im Zeitverlauf betrachtet. Besonders relevant ist dabei, ob es sich um „Aufsteiger“ oder „Absteiger“ handelt. (ebda.) Das System ist außerdem beweglich, da jede Gruppe ständig in einem Kampf verwickelt ist, ihre Stellung im sozialen Raum zu ihren Gunsten zu verändern.
Veranschaulichen möchte ich das kurz am Beispiel meiner Interview- partnerinnen: Die Friseurinnen haben wenig kulturelles Kapital im objektiv und institutionalisierendenden Zustand und lediglich milieuspezifisch inkorporiertes kulturelles Kapital. Im Vergleich dazu haben die Ärztinnen eine ganze Menge kulturelles und ökonomisches Kapital, das sie vorwiegend über lange Bildungswege akkumuliert haben, zumal einige aus bildungsfernen Herkunftsfamilien kommen.
Die zweite Ebene ist der Lebensstil. Menschen können ihn nicht individuell frei wählen, denn er ist sehr stark von der Klassenzugehörigkeit geprägt. Die erklärende Verbindung zwischen der Ebene des sozialen Raumes und der Ebene des Lebensstiles ist der Habitus. Er zeigt sich in einer Grundhaltung gegenüber der Welt und umfasst bestimmte kollektive Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Diese sind den Menschen nur zu einem kleinen Teil bewusst. Der Habitus wird von Geburt an in aktiver Interaktion mit anderen Menschen eines jeweiligen Milieus erworben. Er ist nicht angeboren. Die Fülle der Erfahrungen wird zu einem komplexen Wissen verarbeitet und immer wieder verändert. Der Habitus besitzt aber auch eine gewisse Stabilität, die dadurch entsteht, dass er nur neue Dinge aufnehmen und einbauen kann, für die er „eine Art >Ankopplungsstelle<“ hat. Es wird also nicht ständig alles aufgenommen, was da ist. (vgl. Krais, 2002, 63f)
Personen einer Klasse haben wesentliche Elemente des Habitus mit ihren Klassengenossen gemeinsam. Dies zeigt sich besonders am äußeren Er- scheinungsbild, in den Moralvorstellungen, im ästhetischen Empfinden und am Umgang mit Kultur. Man könnte den Habitus auch als ein System von Grenzen sehen. Innerhalb dieser Grenzen können Menschen handeln und frei wählen, Dinge außerhalb des Habitus sind für sie aber einfach undenkbar und unmöglich.
Besonders gut zu sehen ist das in meinen Interviews beim Thema Freizeit. Für die Friseurinnen gibt es eigentlich nur Sport in der Freizeit. Bei den anderen zwei Berufsgruppen kamen ganz andere Freizeitbeschäftigungen zur Sprache, wie das Reisen, Freundinnen zum Essen einzuladen, Lesen, Kino oder Theater und dergleichen.
Eine Lehrerin und eine Ärztin nannten zum Beispiel als unerfüllte Freizeitwünsche das Lernen von Fremdsprachen. Theoretisch könnte auch eine Friseurin eine Fremdsprache erlernen wollen - das wäre auch mit einem knappen finanziellen Rahmen möglich, liegt aber außerhalb ihrer Habitus- grenze.
Innerhalb des Habitus können die Frauen frei wählen, was sich für mich gut an folgendem Beispiel nachvollziehen lässt: Zwei Friseurinnen betreiben eher ausgefallene „untypische“ Sportarten, aber es liegt durchaus innerhalb deren Habitus Sport zu betreiben.
Der Habitus umfasst also auch den persönlichen Geschmack. Genauer gesagt kann man vom Geschmack einer Person auf ihren Habitus schließen.
In den unteren Klassen herrscht Kampf um die Existenz und daher haben diese Menschen einen sogenannten Notwendigkeitsgeschmack, während sich die oberen Klassen einen Luxusgeschmack leisten können, der weit weg von Notwendigkeit ist. Außerdem definieren die herrschenden Klassen, welcher Geschmack legitim ist, was auch die Funktion hat, den Abstand zu den anderen sozialen Gruppen aufrechtzuerhalten. (vgl. Krais/Gebauer, 2002, 38ff)
Die Bürger und besonders die Kleinbürger grenzen sich von den unteren Schichten eher ab, und bemühen sich an die oberen Schichten anzupassen und diesen nachzueifern. Auffällig ist dabei, dass die typischen Kleinbürger sich von außen sehen, sich genau kontrollieren und ständig korrigieren. Weiters ist ein gewisser Bildungseifer typisch für diese Gruppe. Ihnen fehlt aber die lässige Selbstsicherheit der herrschenden Klassen. Die unteren Schichten sind dagegen ungezwungener. Der populäre Geschmack oder Notwendigkeitsgeschmack orientiert sich am Praktischen. (ebda.)
Besonders stark sichtbar wird dies in Bezug auf die Zukunft. Die Aufmerksamkeit der unteren Klassen richtet sich eher auf das Hier und Jetzt. Es ist wichtig, „günstige Augenblicke auszunutzen und die Zeit zu nehmen, wie sie kommt“. (vgl. Krais/Gebauer, 2002, 42) Daraus ergibt sich auch eine gewisse Solidarität zu Gleichgesinnten. Bei den Kleinbürgern herrscht eher ein „bescheidener Geschmack“ vor, und sie leben viel mehr auf die Zukunft ausgerichtet. Es geht um die eigene Zukunft oder die Zukunft der Kinder. Die Kleinbürger sind bereit, momentanes Verlangen den Zukunftswünschen unter- zuordnen. (ebda.)
Der Habitus ist die Verbindung zwischen Klassenlage und Lebensführung. Jede Gruppe bemüht sich ihre Stellung im sozialen Raum zu verbessern. Je nachdem, in welche Verhältnisse jemand geboren wird, bildet sich ein Habitus, in dem diese frühesten Erfahrungen die Basis sind. Im Habitus wirkt also die Vergangenheit weiter, er bringt Orientierung und Handlungsweisen hervor, die so wirken, dass der Mensch in seiner Klasse bleibt. Die Verhaltensweisen der jeweiligen Klasse werden somit reproduziert.
Mittelschichten sind durch das Streben nach sozialem Aufstieg geprägt. Der individuelle Aufstieg verläuft aber fast immer in einem bestimmten Rahmen des Aufstiegs der ganzen Klasse. Für diesen Aufstieg müssen die Mittelklassen, die relativ wenig ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital haben, andere Hilfsmittel benutzen. Solche Mittel sind die Fähigkeit zur Askese, Opfer, Verzicht, Entsagung, Eifer und Dankbarkeit. Der Habitus ist nicht einfach zu wechseln, nur weil sich zum Beispiel die Lebensverhältnisse ändern. Man kann ihn nur langsam weiterentwickeln. (vgl. Krais, 2002, 43-45)
1.7 Der geschlechtsspezifische Habitus
Bourdieu zeigt, wie Menschen in ihrem Denken und Handeln das Geschlechterverhältnis reproduzieren, verändern und weiterentwickeln.
Der Habitus ist die Verbindung zwischen der sozialen Struktur der Zweigeschlechtlichkeit und dem Handeln der Menschen. Jeder Mensch ent- wickelt von Geburt an einen geschlechtstypischen Habitus. Wir sehen die Welt daher als weiblich und männlich, als polaren Gegensatz und nicht, wie man annehmen könnte, als Gegensatz mit Abstufungen. Durch den Habitus handeln wir auch geschlechtstypisch. Ständig unterscheiden wir, vereinfachen und schließen Uneindeutigkeiten aus, um eine geschlechtliche Identität herzustel- len. (vgl. Krais, 2002, 48f) Bourdieu vergleicht den Prozess, in dem ein geschlechtsspezifischer Habitus erworben wird, „als ständige Orientierung von Handlungen, Signalen, Wahrnehmungen und so weiter an einem binären Code“. (Krais, 2002, 50) Dabei werden sowohl Männer als auch Frauen in ihren Möglichkeiten begrenzt.
Geschlecht ist eines der grundlegenden Elemente der sozialen Identität eines Menschen. Da das Geschlecht eng mit dem Körper verknüpft ist und eine körperliche Grundlage hat, werden geschlechtstypische, kulturelle Muster als natürlich wahrgenommen. Das Gegenstück dazu wären soziale Klassen, die nicht durch Körpermerkmale definiert werden. Diese würden aber nicht als natürlich empfunden.
Die Wahrnehmung von Zweigeschlechtlichkeit formt aber auch den Körper, den körperlichen Ausdruck und die Gewohnheiten. Durch diese körperliche Verknüpfung ist die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern besonders fest verankert, und es wird vergessen, dass sie von Menschen produziert und reproduziert wird. (ebda.)
Männliche Herrschaft und symbolische Gewalt
Herrschaft und Macht funktionieren, wie Bourdieu in seinem Buch „Die männliche Herrschaft“ beschreibt, in unserer Gesellschaft mit Hilfe von „symbolischer Gewalt“, auch „sanfte Gewalt“ genannt. Oft wird sie nicht als Gewalt erkannt, da sie sehr subtil und verdeckt ist. Symbolische Gewalt und Herrschaft werden in unmittelbaren Interaktionen hergestellt und reproduziert und meist nicht erkannt. Sie sind im Habitus der Herrschenden und der Beherrschten verankert. Nur wenn beide, die Herrschenden und die Beherrschten, dafür empfänglich sind, kann sie wirken.
Auch Menschen, die diese Art von Herrschaft nicht bemerken, sind empfänglich. Die Beherrschten übernehmen großteils die herrschende Sicht der Welt und übernehmen damit auch ein Selbstbild, das davon geprägt ist. (vgl. Krais, 2002, 52f)
In unserer Gesellschaft ist unbewusst im Habitus der Männer die Disposition zum Herrschen und bei den Frauen zum beherrscht werden verankert. Die Ungleichheit scheint einfach in der "Natur der Dinge" zu liegen. Sie wirkt selbstverständlich und ist deshalb gut abgesichert und bedarf keiner Recht fertigung. So wird sie auch immer wieder reproduziert und überdauert viele Veränderungen, da sich am System selber wenig ändert.
Ein gutes Beispiel dafür liefert die Oberärztin D. Sie gibt an, dass es Männern sehr viel leichter falle, Arbeiten zu delegieren. Dieses Verhalten wird an ihrem Arbeitsplatz von den Frauen vielfach akzeptiert. Das Originalzitat verdeutlicht das sehr anschaulich: „Ein Mann, der delegiert mehr. Und das wird akzeptiert, das ist ein Mann, der delegiert. So. Und bei mir, ich habe delegiert: „Ja, aber da müssen Sie schon schauen. Sie sind doch Stationsärztin, und Sie müssen doch schauen, dass das alles passt.“ Das sind Unterschiede am Arbeitsplatz.
Ein sehr subtiles Beispiel, bei dem man nicht sofort an sanfte Gewalt denkt, beschreibt Bourdieu folgendermaßen: „So stellt man etwa fest, dass die Frauen in Frankreich mit großer Mehrheit erklären, dass sie sich einen Mann wünschen, der älter und, damit völlig übereinstimmend, größer ist als sie selbst, und dass zwei Drittel von ihnen einen kleineren Mann ausdrücklich ablehnen.“ (Bourdieu, 2005, 66) Nach allgemein geteilten Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata muss der Mann zumindest dem Anschein nach und nach außen, die herrschende Position innehaben. Alter und Größe sind die verlässlichsten Anzeichen dafür. (vgl. Bourdieu, 2005, 68)
1.8 Milieuforschung und Geschlechterforschung
In den sozialwissenschaftlichen Diskussionen wurden die Theorien zur Geschlechterforschung sowie die Milieutheorien lange Zeit vorwiegend getrennt bearbeitet. In den Milieustudien wurden die Einflüsse und Folgen der Geschlechterverhältnisse großteils ausgeklammert. Es wurde so getan, als wäre das Verhältnis der Geschlechter unabhängig von den jeweiligen Milieus immer schon da gewesen. In neuerer Zeit entstanden Ansätze, die versuchen, beide Theoriestränge zu verbinden. Meist gibt es dabei eine dominierende Variable, also entweder Geschlecht oder Milieu. Die zweite Variable wird danach innerhalb der ersten aufgegliedert. (vgl. Koppetsch 109)
Da soziale Felder und Institutionen stark mit der Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit verwoben sind, können Männer und Frauen nicht mehr als homogene Begriffseinheiten angenommen werden. Stattdessen gibt es je nach Kontext unterschiedliche Typen von „Weiblichkeiten“ und „Männlichkeiten“. (vgl. Koppetsch in: Weiß, 2001, 111f)
Genau an diesem Punkt setzt auch meine empirische Forschung mit der Frage an: Welche Weiblichkeitsformen finden wir in verschiedenen österreichischen Milieus?
Unternehmen und Organisationen sind, um funktionieren zu können, auf die Aufteilung von beruflichen Tätigkeiten nach Geschlecht angewiesen. Die Gründe dafür wurden lange Zeit entweder außerhalb der beruflichen Organisationen, wie zum Beispiel in unterschiedlichen Qualifikationen und Erwerbsbiografien, oder in den unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen von Männern und Frauen gesucht. Allerdings sind Organisationen keine geschlechtsneutralen Apparate, die erst nachträglich mit weiblichen und männlichen Personen besetzt werden. Ganz im Gegenteil, sie benutzen die Geschlechterdifferenz als Ressource und Legitimation für ihre Werte, Normen und kulturellen Muster. (ebda.)
Die Konstruktionen von Weiblichkeit sind also sowohl von Lebensstilen und sozialen Lagen abhängig, als auch von der institutionellen Einbindung in Familie und Beruf. Deshalb reicht es nicht, Geschlecht als eine Variable innerhalb der Milieuforschung hinzuzufügen. Vielmehr ist das jeweilige Ge- schlechterverhältnis ein definierender Aspekt für jedes Milieu und dient dazu, diese deutlich voneinander abzugrenzen sowie die Struktur im Klassensystem zu verbessern oder wahren.
Geschlechterverhältnisse sind ein wichtiger Faktor um milieuspezifische Lebensstile zu reproduzieren. Besonders gut zu sehen ist dies an Milieus, die von neueren Dienstleistungsberufen geprägt sind. Sie konnten ihre soziale Position durch die Modernisierung im Geschlechterverhältnis verbessern. Durch die Aufwertung der Stellung der Frau steht dem Haushalt insgesamt mehr kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital zur Verfügung.
Für eine Frau aus der Elite gehört es zum Beispiel zu ihren Aufgaben, die sozialen Beziehungen zu pflegen. Sie schafft damit für ihren Mann bessere Voraussetzungen zu beruflichem Aufstieg und Erfolg. (ebda.) Der Erziehungswissenschaftler Robert W. Connell beschreibt das Geschlechterverhältnis als „linking concept“, mit dem die Privatsphäre und die berufliche Sphäre kulturell aufeinander abgestimmt werden.
2. Weiblichkeit, Geschlechterstereotype und soziale Milieus
2.1 Der Begriff Weiblichkeit
Die folgenden Ausführungen dienen der Begriffserklärung und kurzen Einleitung zum Begriff „Weiblichkeit“.
Das Wort Weiblichkeit gibt es in schriftlich überlieferter Form seit dem 15. Jahrhundert und kommt von dem spätmittelhochdeutschen Wort „Wîplicheit“ oder auch der „Wypphait“. Nach dem Deutschen Wörterbuch von Grimm bedeutet es „Charakter, Eigenschaft als Frau“. (vgl. Grimm, 2007)
Der Begriff Weiblichkeit wurde viele Jahrhunderte lang geprägt von Zuschreibungen wie Anmut, Schönheit, Güte, Schamhaftigkeit, Schwäche, Bescheidenheit, Passivität, Affektivität usw. Diese wurden als natürlich angesehen, als gottgegeben, oder als angeboren, und durch Anatomie und Psyche bestimmt. In der Geschlechterforschung wird Weiblichkeit als gesellschaftlich und kulturell geschaffenes Konstrukt nachgezeichnet. (vgl. Kroll, 2002, 399) Dabei herrschen zum Teil auch unvereinbare theoretische Konzepte vor, wie zum Beispiel unterschiedliche konstruktivistische oder differenztheoretische Ansätze. Einig sind sich diese Ansätze darin, dass Weiblichkeit nicht nur naturgegeben ist, sondern vielmehr auch kulturell erzeugt und konstruiert wird.
2.2 Geschlechterstereotype
Unter anderem habe ich die Frauen in meinen Interviews nach Geschlechterstereotype gefragt, aber auch nach den Folgen, was passiere, wenn diese Erwartungen der Umwelt nicht eingehalten würden. Deshalb möchte ich in diesem Kapitel kurz auf das Thema Geschlechterstereotype eingehen.
Geschlechterstereotype enthalten sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Männern und Frauen. Einerseits gehören sie zum individuellen Wissen von Menschen, andererseits tragen sie zu einem gemeinsamen kulturell geteilten Verständnis bei.
Geschlechterstereotype haben sowohl deskriptive als auch präskriptive Komponenten. Erstere beziehen sich auf Annahmen, wie Frauen und Männer sind. Den Menschen werden also allein aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit Merkmale zugeschrieben. Für Frauen sind typische Merkmale Emotionalität, Verständnis und soziale Fähigkeiten. Männliche Merkmale sind Unabhängigkeit, Dominanz und Zielstrebigkeit. Werden diese Annahmen verletzt, entsteht Überraschung. Die präskriptiven Merkmale beziehen sich darauf, wie Männer und Frauen sein sollten. Frauen sollen zum Beispiel verständnisvoll sein. Werden präskriptive Annahmen verletzt, dann resultiert das in Ablehnung. (vgl. Eckes in: Becker, 2004, 165f)
Geschlechtsstereotypes Wissen wird schon sehr früh in der Kindheit erworben und ist ein lebenslanger Lernprozess. Der Prozess der Anwendung auf eine Person läuft vor allem im ersten Moment meist automatisch ab. Kleinkinder lernen in den ersten sechs Monaten männliche und weibliche Stimmen zu unterscheiden und mit ca. 12 Monaten nehmen sie Menschen geschlechtsdifferenziert wahr. Bis zum Anfang des Schulalters wird das bewusste und kommunizierbare Wissen über Geschlechterstereotype aufgebaut. Daran sieht man, dass diese sehr wichtig als Orientierung sind, sonst würden Kinder sie nicht so früh lernen.
Inhalte solcher Geschlechtsstereotype können mit Fragebögen und Eigenschaftslisten erfasst werden. Merkmalsbündel, die häufiger mit Frauen als mit Männern in Verbindung gebracht werden, sind Wärme und Expressivität oder Gemeinschaftsorientierung. Aufgabenbezogene Kompetenz und Selbstbehauptung werden eher mit Männern verbunden. Interessant ist, dass Geschlechterstereotype je nach Kultur sehr unterschiedlich sind, dass sie aber zeitlich gesehen extrem dauerhaft sind.
Stereotype über die allgemeinen Kategorien Frauen und Männer, genannt Globalstereotype, sind zu weit und unscharf gefasst und werden deshalb in Unterkategorien oder sogenannte Substereotype unterteilt. Diese Substereotype können auch im Gegensatz zu Globalstereotypen stehen. Zum Beispiel gibt es bei den Frauentypen das Substereotyp der Karrierefrau oder der Emanze. Diese gegensätzlichen Substereotype ändern aber nichts am Globalstereotyp. Die Möglichkeit einer Ausnahme lässt dieses eher unverändert und macht es besonders beständig. (ebda.)
Männliche und weibliche Stereotype können einerseits in Bezug zueinander betrachtet werden, da die eine Kategorie immer einen Bezug zur anderen hat. Andererseits ist die Frage, was Frauen verbindet oder unterscheidet sehr aufschlussreich, wenn man Ungleichheitslagen und asymmetrische Macht- verhältnisse, die trotz vieler historischer Veränderungen bestehen, untersuchen möchte. Die Kategorie „Frauen“ ist in vielen Untersuchungen zu unscharf gefasst, da zum Beispiel weiße Frauen aus der Mittelschicht mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind als schwarze Frauen aus der Unterschicht. Trotzdem kämpfen beide mit männlichen Herrschaftsstrukturen. So gesehen können Untersuchungen, in denen Frauen verschiedener Milieus und deren Lebensstile verglichen werden, sehr interessant sein und einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarmachung von Strukturen leisten. (vgl. Knapp in: Vogel, 2005, 113f)
3. Methodologische und methodische Voraussetzungen der Studie
3.1 Grounded Theory
Entwickelt wurde diese qualitative Forschungsmethode von den Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss. Der Name Grounded Theory heißt einfach „gegenstandsverankerte Theorie“, weshalb im deutschsprachigen Raum manchmal auch die Bezeichnung „gegenstandsbezogene Theoriebildung“ verwendet wird. Im Gegensatz zu den Grand Theories soll nicht am Anfang eine Theorie stehen, die dann bewiesen wird, sondern der Untersuchungs- bereich. (vgl. Strauss/Corbin, 1996, 8f) Der Forschungsprozess beginnt bei dem Alltagswissen der Forschenden. Danach werden Daten erhoben. In meiner Arbeit sind das vor allem die Interviews.
Die ersten Interviews werden transkribiert und auch analysiert, bevor mit den nächsten Interviews und Forschungen fortgesetzt wird. Diese ersten Analysen sollen, wenn möglich die weiteren Interviews beeinflussen.
Bei meiner Studie wurden die ersten Interviews grob analysiert und die folgenden Interviews weiterentwickelt.
Den Daten werden Schlüsselbegriffe zugeordnet, die in Kategorien zusammengefasst werden. Erst im nächsten Schritt werden die Daten analysiert und untereinander verglichen. Dabei wird mit Kontrastminimierung und Kontrastmaximierung gearbeitet. Es werden also Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Auch Phasen der Reflexion spielen eine wichtige Rolle, in denen die ForscherInnen sowohl die Kategorien als auch die Notizen, die sie während der Feldforschung gemacht haben, reflektieren.
Die Konzepte werden verknüpft und schließlich sollen Kernkategorien entstehen, an denen entlang sich Theorien bilden. Nun werden die Kategorien auf ein abstraktes Niveau angehoben. Ziel ist es auch eine theoretische Sättigung zu erreichen, d. h., auch wenn mehr Daten erhoben würden, entstünden keine neuen Erkenntnisse mehr. Ich denke, dieser Schritt ist im Rahmen meiner Diplomarbeit nicht möglich.
Bei der Theoriebildung geht es darum, alle Daten abzudecken, es sollen also keine Daten übrig bleiben, die nicht in die Theorie passen. Außerdem werden an die Theorie folgende Ansprüche gestellt: Sie muss zu den Daten passen, allgemein verständlich sein und auf möglichst viele Situationen passen. Auch das wird bei meiner Arbeit nur zum Teil möglich sein.
Insgesamt werden die Daten aber hauptsächlich beschrieben und relativ wenig interpretiert - nur beim Konzeptualisieren und Ordnen, was allerdings auch schon eine Art Interpretation darstellt. (vgl. Strauss/Corbin, 1996, 14)
Im praktischen Teil meiner Diplomarbeit wurden meine Daten, die hauptsächlich durch die Transkription der Interviews zustande kamen, ergänzt durch einige Beobachtungen in Themen und zum Teil Kategorien geordnet und beschrieben. Passende Theorien wurden zum Großteil nach der Transkription der Interviews als Ergänzung und zum Vergleichen gesucht.
Die aus der Forschung resultierende Theorie wird immer als vorläufig gesehen und kann deshalb ausgeweitet oder überarbeitet werden. Dadurch ist die Methode der Grounded Theorie sehr offen und flexibel.
3.2 Überlegungen zur Interviewführung
Als Vorbereitung für die Interviews habe ich nach Vorbildern gesucht und mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen. Gruppeninterviews wurden von verschiedenen Forschern, die Sozialstruktur- und Geschlechterforschung verbinden, verwendet. Die SoziologInnen Behnke, Loos und Meuser haben so genannte natürliche Gruppen, die verschiedene Altersstufen und soziale Milieus umfassen, wie z.B. Stammtischrunden, genommen und sehr offene Einstiegsfragen gestellt, wie zum Beispiel: „Was heißt es für Sie/euch ein Mann zu sein?“ Die Gruppen hatten dadurch die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. (vgl. Behnke, Loos, Meuser in: Bohnsack, 1998, 227)
Diese Idee hat mir sehr gut gefallen. Das Verfahren ist bei Frauen aber sehr schwierig, weil es wenige natürliche Frauengruppen gibt. Daher habe ich mich für Einzelinterviews entschieden - genauer gesagt für Leitfadeninterviews. Diese Form der Interviews hatte für mich den Vorteil, dass ich einerseits vorher Fragen festlegen konnte, und andererseits während der Interviews flexibel genug war, um auch etwas von den Fragen abweichen zu können, genauer nachzufragen, oder die Reihenfolge abzuändern.
Als Nächstes wurden die Interviewpersonen ausgewählt. Als Basis diente das Konzept der Sinus-Milieus. Die drei gewählten Berufsgruppen sollten drei Milieus abdecken. So entschied ich mich für Friseurinnen, Lehrerinnen und Ärztinnen, da sie drei typische Milieus mit unterschiedlichen Ausbildungsgraden repräsentieren.
Nun wurden Themenbereiche erarbeitet. Möglichst breit gefächerte Fragen zu Einstellungen der verschiedensten Lebensbereiche, in denen sich Weiblichkeit ausdrücken könnte, erschien mir am sinnvollsten. Ich begann mit offenen Einstiegsfragen, wie etwa: „Was bedeutet Weiblichkeit für Sie?“ oder „Was empfinden Sie als besonders weiblich oder unweiblich?“ Daran anschließend stellte ich Fragen zur Sozialisation der Frauen und Fragen zu Themen wie Arbeit, Freizeit, Haushalt, Beziehungen, Umgang mit dem Körper und allgemeine Werte.
Besonders die Fragen zum Thema Weiblichkeit und die sehr allgemein gestellten Fragen nach Grundprinzipien und Werten der Frauen fielen den meisten Interviewpartnerinnen eher schwer.
Die Interviews wurden anschließend transkribiert und in das qualitative Datenanalyseprogramm MAXQDA eingelesen. Damit konnte ich die Daten ordnen und später zusammenfassen.
3.3 Planung und Verlauf der Interviews
Die ersten zwei Friseurinnen vermittelte mir ein Bekannter. Von den zwei Frauen leitet die eine seit Jahren ihren eigenen Salon, die andere arbeitet bei ihr als Angestellte. Beide haben meinen Vorstellungen von dem Milieu der Konsumorientierten Arbeiterinnen (siehe Sinusmilieus) entsprochen. Die Interviews waren für mich schwierig zu führen. Während der Interviews hatte ich plötzlich das Gefühl, dass viele meiner Fragen nicht passen würden und bei den befragten Frauen kein erwartetes Echo hervorriefen - zum Beispiel die Fragen nach Arbeitsteilung im Haushalt, nach Freizeitwünschen oder nach weiteren Zielen im Leben. Für mich, aus einem anderen Milieu kommend, sprachen sie in einem eigenen Jargon, bei dem ich mir nicht immer sicher war, ob ich ihn richtig verstehen würde. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie manche meiner Fragen gar nicht „richtig“ verstanden hatten, da ihre Antworten einfach nicht zu den Fragen passten und unzusammenhängend waren. Die Antworten waren meist sehr kurz und wurden so formuliert, als ob es keine andere Möglichkeit gäbe, die Antwort also so ausfallen müsste. Für mich ergab sich das Dilemma, wie viel ich jeweils nachfragen sollte - eine Gratwanderung, bei der ich mit mehr Fragen vielleicht mehr Antworten hätte bekommen können, oder nur einen Rückzug erreicht hätte, da ich für die Befragten wieder nur Selbstverständlichkeiten abgefragt hätte.
Weitere Friseurinnen zu finden, wurde dann richtig schwierig. Sowohl am Telefon als auch bei persönlichen Anfragen erhielt ich nur Absagen und zum Teil sogar beleidigende Angriffe. Die Begründungen waren meist: „Ich hab ja keine Ahnung.“, „Ich doch nicht, ich kann so etwas nicht. Können Sie nicht die da drüben nehmen?“ oder „Ich habe für so etwas keine Zeit“. Auch das Angebot von 20 Euro pro Interview bewirkte nichts, der Betrag war wohl zu wenig attraktiv. Nach zwei Wochen des Suchens und Fragens fand ich einen alternativ wirkenden Friseursalon (lockere Atmosphäre, keine „überstylten“ Friseurinnen), in dem die Frauen deutlich anders eingestellt waren. Sofort entwickelte sich eine Diskussion über gesellschaftliche Probleme und die Schwierigkeit für die Chefin „normale, gescheite und psychisch gesunde“ Angestellte zu finden. Aus diesem Friseursalon habe ich dann auch zwei junge Angestellte interviewt. Ich war mir allerdings unsicher, ob sie dem typischen „Friseurinnen-Milieu“ entsprechen, oder ob sie schon zu alternativ wären. Inzwischen denke ich, dass beide eher ungewöhnliche Hobbys haben, dass sie von den Werten und Grundeinstellungen aber in diese Milieugruppe passen. In jenen Punkten, wo sie sich vielleicht vom Idealtypus unterscheiden, sprachen sie dennoch gut die Probleme in diesem Milieu an, bzw. wurden durch den Kontrast die Regeln des Milieus für mich eher noch klarer.
Die Interviews mit diesen zwei Friseurinnen waren einerseits leichter für mich, da sie sich sehr weltoffen und interessiert gaben, andererseits waren die Antworten über das Thema Weiblichkeit noch kürzer und auch nachfragen hat nicht viel geholfen. Die zwei Frauen hatten sich noch kaum Gedanken über Weiblichkeit gemacht. Ihrer Meinung nach macht es für sie wenig Unterschied, welches Geschlecht sie haben. Tendenziell wollen sie aber lieber etwas maskuliner sein, was für die Eine mehr Muskeln bedeutet und für die Andere mehr Mut beim Sport.
Die Interviews mit den Ärztinnen und Lehrerinnen fielen mir deutlich leichter. Die meisten wurden mir von Bekannten vermittelt. Meine Fragen machten Sinn und hinterher ergaben sich oft noch spannende Diskussionen. Die Frauen redeten von sich aus viel und erzählten eine Menge kurzer Geschichten zu den jeweiligen Themen.
3.4 Kurzbeschreibung der interviewten Frauen Ärztinnen
Oberärztin D., 54
D. lebt alleine und widmet sich ganz ihrem Beruf. In ihrem ersten Beruf Lehrerin, hat sie einige Jahre gearbeitet und dann erst das Medizinstudium begonnen. Fast vom Beginn ihrer Facharzttätigkeit an, war sie wegen Personalmangels Stationsleiterin und Oberärztin.
Ärztin A., 35
A. arbeitet gerne als Ärztin und hat einen Lebenspartner, mit dem sie zusammenziehen und Kinder bekommen möchte.
Ärztin B., 29.
B. macht gerade ihren Turnus und ist sich noch nicht ganz sicher, in welchem Bereich sie schließlich arbeiten möchte. Prinzipiell macht ihr die Arbeit Freude. Sie lebt mit ihrem Lebenspartner zusammen.
Lehrerinnen
Schulleiterin G., 50
G. arbeitet sehr gerne als Schulleiterin und war vorher lange Zeit an derselben Schule als Lehrerin tätig. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei erwachsenen Kindern zusammen und beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Haushalt.
Hauptschullehrerin E., 37
E. arbeitet momentan sehr gerne als Hauptschullehrerin. Sie hat sich systematisch von der Tätigkeit als Kindergärtnerin, Sonderschul- und Volksschullehrerin zur Hauptschullehrerin weitergebildet. Sie möchte den Beruf machen, solange sie Herausforderungen hat. E. lebt alleine.
Hauptschullehrerin C., 25
C. wirkt eher etwas unsicher. Sie lebt noch daheim bei ihrer Familie, würde aber gerne mit ihrem Freund zusammenziehen. Sie arbeitet gerne als Lehrerin, wirkt aber nicht ganz so überzeugt wie die anderen zwei interviewten Lehrerinnen.
Friseurinnen
Friseurchefin M., 54
M. hat einen eigenen Friseursalon, tritt sehr selbstbewusst auf und teilte auch gleich ihre Angestellte zu einem Interview ein. Der Friseurberuf war von Kind an ihr Traumberuf. Sie wirkt zufrieden damit. M. lebt alleine.
Friseurin F., 31
F. ist Vollzeitangestellte, lebt in einer Ehe und führt nebenbei einen Haushalt mit 3 kleinen Kindern. Auch sie wollte immer schon Friseurin sein, und macht ihren Beruf gerne. Mit ihrem restlichen Leben scheint sie ebenfalls zufrieden zu sein.
Friseurin H., 23
H. dagegen wirkt nicht so zufrieden, sondern eher unruhig und auf der Suche. Sie macht zwar die Arbeit gerne, kann sich aber auch irgendeinen anderen Job vorstellen, da man als Friseurin zu wenig verdiene. Sie bewundert Kolleginnen, die sich selbstständig gemacht haben, kann sich das für sich aber nicht vorstellen. H. lebt im Moment bei den Großeltern.
Friseurin K., 21.
K. scheint ein eher lebensfroher, sorgloser Typ zu sein. Sie arbeitet gerne in ihrem Beruf, klagt aber auch, dass man davon auf Dauer nicht leben könne. K. wohnt noch zuhause.
Bildungsgrad der einzelnen Berufsgruppen
Die Friseurinnen stehen für Hauptschulabschluss, duale Berufsausbildung in Betrieben mit begleitender Berufsschule. Die Lehrerinnen benötigten eine Reifeprüfung und ein Studium an der Pädagogischen Akademie. Regelmäßige berufsbegleitende Fortbildungen sind Pflicht aber auch Anliegen der befragten Lehrerinnen. Die Ärztinnen haben nach dem Universitätsstudium weitere Ausbildungen im medizinischen Bereich absolviert. Ständige Weiterbildung ist in diesem Berufsfeld eine Selbstverständlichkeit.
4. Empirischer Teil - Interviews
4.1 Einstiegsfragen zum Begriff Weiblichkeit
Die Einstiegsfrage an die Frauen lautete: „Was ist Weiblichkeit für Sie?“
Diese Frage löste bei allen interviewten Frauen Nachdenklichkeit, aber auch Ratlosigkeit aus.
Die Antwort der Friseurin H. verdeutlicht das sehr anschaulich: „Weiblichkeit? Was ist Weiblichkeit? Das ist eine gute Frage. Ich finde, Weiblichkeit kann man gar nicht so genau definieren. Weiblichkeit, vielleicht etwas Mütterliches oder etwas Einfühlendes ist für mich eher Weiblichkeit.“
Durch weitere Fragen wie „Was bedeutet es momentan für Sie Frau zu sein?“, „Was gilt in Ihrem Umfeld als weiblich?“, „Was ist besonders unweiblich?“, „Was würde passieren, wenn Sie diesem Weiblichkeitsbild nicht entsprächen?“ konnte ich diese „Sprachlosigkeit“ teilweise aufbrechen.
Interessant finde ich, dass die meisten Befragten im Laufe des Gespräches, also bei anderen Fragen, auf den Begriff „Weiblichkeit“ zurückkamen und Nachträge zur Beantwortung lieferten. Es macht also wenig Sinn, diese Interviewfragen einzeln zu analysieren. Ich fasse sie zusammen und analysiere sie in Hinblick auf mögliche Kategorien.
Schwierigkeiten mit dem Begriff Weiblichkeit
Die Friseurinnen versuchen erst gar nicht, eine Definition zu finden, sondern versuchen mit anderen Begriffen, wie „Mütterlichkeit“, „Einfühlsamkeit“ oder „gewisse Rundungen“, die sie wie Synonyme behandeln, eine Antwort zu finden.
Die Ärztinnen und Lehrerinnen beginnen sehr ähnlich, indem sie, wie die nachfolgende Antwort einer Ärztin verdeutlicht, erklären: „Weiblichkeit ist einmal - anatomische Voraussetzungen, die den Unterschied zum Mann ausmachen.“
Sprachlich gesehen bewegen sie sich völlig von Weiblichkeit weg und nehmen Bezug zu den Begriffen Frau und Mann, die bei allen Antworten in einem biologisch orientierten Kontext verwendet werden. Besonders gut lässt sich das bei diesem Zitat, das von der Lehrerin C. stammt, nachvollziehen: „Weiblichkeit […] einfach die evolutionsbedingten Unterschiede, Frau - Mann, einfach ge- schlechtsspezifische Unterschiede, die sekundären Geschlechtsmerkmale. Das zeichnet für mich eine Frau aus, oder zeigt für mich Weiblichkeit.“
Physische Mutter - Mutterrolle
Außer einer Ärztin beziehen alle Befragten die Mutterschaft beim Fragenkomplex „Weiblichkeit“ mit ein. Es wird sowohl die Funktion der Reproduktionsfähigkeit einer Frau, aber auch die Rolle der Frau als Mutter angesprochen. Der Bogen von der Mutter zur Weiblichkeit wird aber nur von einer Ärztin ganz klar vollzogen, wenn sie meint: „Weiblichkeit ist auch verbunden mit dem Thema Mutter […], ich werde mich wahrscheinlich in diesem Leben auf der Welt nur dann weiblich fühlen, wenn ich einmal die Erfahrung mache eine Mutter zu sein.“
Mütterlichkeit
Das Adjektiv „mütterlich“ wird von den Befragten vor allem verwendet, wenn sie ausdrücken möchten, wie sich Weiblichkeit verwirklicht. Bezüge werden hauptsächlich mit beruflichen Tätigkeiten hergestellt.
Eine befragte Ärztin versteht unter „Mütterlichkeit“ die besondere Betreuung von PatientInnen, die es einfach brauchen, ein bisschen „bemuttert“ zu werden.
Eine Lehrerin bezieht es auf ihr Berufsfeld und meint: „[…] Weiblichkeit im Umgang mit den Schülern, dass Frauen einfach eher versuchen auf die Kinder erzieherisch einzuwirken - das Mütterliche vielleicht, das Zureden, Verständnis haben […]." In beiden Fällen wird Mütterlichkeit als Ausformung von Weiblichkeit als besondere Form beruflichen Engagements gewertet.
Weibliche Energien, Gefühle, emotionale Aspekte
Sehr vage wird Weiblichkeit auch mit weiblicher Kraft, weiblicher Power und weiblichem Prinzip umschrieben. Intuition und „Bauchentscheidungen“ werden ebenso wie Natur- und Erdverbundenheit und formgebende Kraft als weibliche Attribute empfunden.
Weibliche Handlungsweisen
Die Ärztin B. gebraucht ein Bild, um zu illustrieren, wie sich weibliche Power in Handlungen verwirklichen kann. „[…] eine Frau, die auf den Tisch hauen kann, die irgendwie weiß, was sie will, […], aber auch gleichzeitig unglaublich sensibel ist und wahrnimmt, was in ihrer Umgebung passiert.“
Eine interessante Gegenüberstellung von weiblichen und männlichen Handlungsweisen findet man bei der Friseurin K.: „[…] vom Denken her, vom Mut her, vom Trauen her, kommt mir vor, dass wir Frauen einfach viel zu viel nachdenken darüber. Und einfach davor schon, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren […]. Das ist halt da bei Männern nicht so, die sind einfach mutiger, denken auch nicht so viel nach über die Konsequenzen.“
In Ansätzen gibt es einige Bemerkungen bei den anderen Interviewten, die in eine ähnliche Richtung weisen: Frauen denken mehr an mögliche Auswirkungen, bevor sie handeln als Männer. Sehr ähnlich bringt es eine Lehrerin auf den Punkt, wenn sie feststellt: „Männer überschätzen sich eher, Frauen unterschätzen sich eher.“
Unweiblichkeit
Auf die Gegenfrage: „Was ist unweiblich?“ prangert Friseurin H. spontan eine Verhaltensweise an: „Unweiblich, das sind für mich Menschen, die sich einfach nicht beherrschen können. Vor allem die, die gleich ausrasten und gleich zuschlagen.“
Von einer anderen Friseurin werden auch Mädchen, die sich schwarz schminken, sich schwarz kleiden als unweiblich bezeichnet. Sie sieht darin aber in erster Linie pubertäre Verhaltensweisen.
Für Ärztin D. wirken alkoholisierte Frauen unweiblich und abstoßend.
Das gilt auch für Lehrerin E.: „Was mich eher abstößt an Frauen, aber genau so an Männern, ist, betrunken in der Öffentlichkeit zu sein und dadurch auch auffällig oder besser gesagt ausfällig zu werden. Also das würde ich als unweiblich bezeichnen.“
Obwohl sie Alkoholisierung und besonders die daraus resultierenden Auffälligkeiten bei beiden Geschlechtern ablehnt, präzisiert sie doch eindeutig und definiert diese als unweiblich.
Unweiblich kann auch die Sprache sein, meint eine andere Lehrerin. „Wir Frauen tun eher umschreiben, also sehr oft ein bisschen umschreiben und so mehr Möglichkeiten offen lassen.“
Sie vergleicht kurz mit der Ausdrucksweise von Männern und kommt zu dem Schluss, dass Männer sich dagegen kurz und bündig ausdrücken würden. Auch sich unbedingt überall durchsetzen und keine Kompromisse eingehen wollen wird als unweiblich empfunden.
4.2 Einige Aspekte zum Themenkreis „Frausein“
Die Auswertung der Frage „Was bedeutet es momentan für Sie Frau zu sein?“ lässt sich am besten mit einzelnen Kategorien darstellen.
Selbstreflexion zum „Frausein“
Fünf der befragten Frauen antworten, dass sie froh seien, eine Frau zu sein. Zusammengefasst: 70 Prozent der Frauen bejahen ihr „Frausein“.
Die zwei jungen Friseurinnen dagegen können mit dem „Frausein“ wenig anfangen. Für die eine bedeutet es gar nichts, beide meinten aber an anderen Stellen, dass sie lieber etwas männlicher wären. Aus den Gesprächen kann ich schließen, dass sich das besonders auf Muskeln, Selbstsicherheit und Mut beziehen dürfte.
Bemerkenswert finde ich dazu die Aussage der Lehrerin C., die lachend betont, dass sie „eindeutig weiblich“ ist. Sie entspricht damit der in unserer Gesellschaft so häufig anzutreffenden Idealvorstellung einer eindeutigen Geschlechts- zugehörigkeit.
Grundsätzliche Aussagen der sieben Frauen, die mit ihrem Geschlecht zufrieden sind, lassen sich in den folgenden Kategorien zusammenfassen:
Weiblichkeit im Kontext zu einem männlichen Partner
Ärztin A. gibt an, sie habe seit einem Jahr einen „sehr guten Partner kennengelernt und wir uns deshalb fragen, eine Familie zu gründen.“ Sie sagt weiters, dass sie jetzt merkt, dass sich ihre Position als Frau dadurch verstärke. Diese Entwicklung vergleicht sie mit ihrem vorherigen Single-Dasein und sieht eine Veränderung in ihrem „Frausein“.
Auch die Lehrerin C. sieht sich selbst in Zusammenhang mit einem Mann. Zuerst stößt sie sich an dem „momentan“ meiner Fragestellung, findet dann aber als Kernpunkt ihrer Antwort, dass sie „die Freundin von ihrem Freund“ sei.
In beiden Fällen wird „Frausein“ als Partnerrolle zu einem männlichen Partner gesehen.
Frau als Ehefrau und Mutter, Familiengründung
Zwei Frauen sehen bei dieser Fragestellung einen Bezug zu Ehe und Familie. Lehrerin G. drückt das sehr spontan aus, wenn sie sagt: „Mutter natürlich, ich habe zwei Kinder, bin Ehefrau, ich denke ich habe eine sehr gute Beziehung.“
Danach wendet sie sich wieder dem Aspekt ihrer Arbeitswelt zu.
Ärztin A. ist weder verheiratet noch Mutter, sieht aber in der Möglichkeit Mutter zu werden, bedingt durch ihre gute Partnerschaft mit einem Mann, „dass ich jetzt, wenn wir ein Kind hätten, schwanger würde, das Kind auch austragen und gebären würde.“ Sie präzisiert auch noch durch einen Nachsatz: „Was nur ich machen kann, was wirklich meine Rolle definiert.“
„Frausein“ in speziellen Situationen
Zwei Befragte, die jeweils als Direktorin und Oberärztin tätig sind und dadurch auch Führungsaufgaben wahrnehmen müssen, erleben sich in ihrer Arbeitswelt als Frau, weil sie als Frauen bei Entscheidungsfindungen anders fühlen und handeln als männliche Kollegen.
Die Oberärztin gibt zu bedenken, dass grundsätzlich männliche und weibliche Ärzte in ihrer Position die gleiche Arbeit verrichten. Aber in der Reaktion der Patienten erlebt sie sich als Frau, weil ihre „mütterliche“ Art besonders bei älteren Patienten gut ankommt.
Die Schulleiterin G. erlebt sich z. B. bei Bezirkskonferenzen, wo sie die einzige Schulleiterin unter 15 männlichen Kollegen ist, insofern als Frau, weil sie spürt, ihre Entscheidungsfindungen laufen anders als bei männlichen Kollegen ab. Im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen überprüft sie genau, welche Aus- wirkungen von Entscheidungen zu erwarten sind. Sie ist überzeugt, dass männliche Kollegen weniger von Selbstzweifeln geplagt sind, und ver- allgemeinert: „Ich glaube, das ist typisch Frau, dass man sich immer bei jeder Entscheidung fragt: War das jetzt eine richtige Entscheidung? Was hat das für Folgen?“
4.3 Arbeit und Produktivität
Mit den Fragen „Wie wichtig ist Ihnen Ihre Arbeit?“, „Was ist Ihnen wichtig an Ihrer Arbeit?“, „Sind Sie beruflich das geworden, was Sie wollten?“ und „Identifizieren Sie sich mit Ihrem Beruf?“ wurde versucht, ein breit gefächertes Spektrum des beruflichen Umfeldes zu erfassen. Die Antworten auf die obigen Fragen machen eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll, weil sich einige Kategorien herausarbeiten lassen.
Allgemeine Aussagen zur Wichtigkeit der Arbeit
Für sieben der befragten Frauen ist ihre Arbeit sehr wichtig, teilweise ist sie sogar der Lebensinhalt. Es wird aber auch deutlich abgestuft: Einige würden „nicht alles der Arbeit unterordnen“, zwei der Befragten würden auch ihre Berufstätigkeit ändern, wenn das Einkommen dadurch steigen würde oder wenn sie auf das Einkommen verzichten könnten.
Berufsfindung - Wege zum erlernten Beruf
Die vier Friseurinnen haben die Frage, ob sie beruflich das geworden sind, was sie wollten, alle bejaht. Die Friseurinnen F. und M. reden von dem Wunsch Friseurinnen zu werden, seit sie Kinder sind. Die 2 jüngeren Friseurinnen würden aber inzwischen auch etwas anderes machen, da sie zu wenig verdienen.
Ärztin A. antwortet spontan mit ja und fügt zur Antwort nichts hinzu. Sehr anschaulich beschreibt Ärztin B. mit wenigen Worten, wie sie in den Beruf und in die „Rolle“ hineingewachsen ist: „Es ist eher so, dass ich so ein bisschen reingewachsen bin. Irgendwann habe ich mich für das Medizinstudium entschieden und dann daraus sind halt die Praktika gefolgt, und daraus dann der Turnus, und so bin ich halt in die Arbeit reingewachsen, und auch in die Rolle als Ärztin bin ich reingewachsen.“ Die Oberärztin D. begann ihre berufliche Laufbahn als Lehrerin. Erst mit 27 Jahren begann sie das Medizinstudium, weil sie sich das vorher noch nicht zugetraut hatte.
Für Lehrerin C. ist ihr Beruf einer von ihren Traumberufen, den sie schon als Jugendliche ergreifen wollte. Lehrerin E. hat die Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht. Danach suchte sie eine neue Herausforderung und wurde Lehrerin, weiß aber nicht, ob sie das bis zu ihrer Pension machen möchte.
Und so beschreibt die Schulleiterin G. ihren Werdegang: „Wie wir jung gewesen sind, ist das eine Einbahnstraße gewesen. Man hat irgendwann sich gedacht, ich werde das und das. Und ich habe zum Beispiel mit 13 mir gedacht ich werde Lehrerin.“ Diesen Weg ist sie dann konsequent gegangen, ohne nach „links noch rechts“ zu schauen.
Aspekte zum Themenkreis Arbeit - Möglichkeiten für Gelderwerb und Selbstverwirklichung
Die Motive sind zwar unterschiedlich, gemeinsam ist bei den folgenden Aussagen aber, dass Arbeit und Berufsausübung als Geldquelle angesehen werden. Die Friseurin K. spricht deutlich aus, dass sie arbeite, um das Geld zu bekommen, das sie zum Leben brauche, „so wichtig wäre es sonst nicht“.
In wesentlich abgeschwächter Form wird das von der Lehrerin C. ausgedrückt: „[…] das Geld ist natürlich nicht zu verachten. Das braucht man ja auch.“
Ärztin A. möchte vor allem deshalb Geld verdienen, „[…] weil ich unabhängig bleiben möchte.“
Bedingungen am Arbeitsplatz - Zufriedenheit am Arbeitsplatz
Die Bedingungen am Arbeitsplatz sind für die Befragten auch sehr wichtig. Es ist gut erkennbar, dass einerseits Freiheit bei einzelnen Entscheidungen und eigenständiges Handeln, aber auch das Eingebundensein in ein Team wichtig sind. Kompetenzbereiche mit Handlungsfreiheit werden gefordert, das ist der gemeinsame Nenner der folgenden Aussagen:
Friseurin K. braucht im Beruf die nötige Freiheit, sie kann nur zufrieden sein, wenn sie nicht gegängelt wird: „[…] dass ich frei arbeiten kann, dass ich kreativ sein kann, dass mir eben nicht die ganze Zeit jemand auf die Finger schaut.“
Weiter spricht sie das Arbeitsklima und die Hierarchie in Betrieben an: „Also vor allem, muss es passen in der Arbeit. Durch einige Erfahrungen habe ich mitbekommen, dass es oft […] nicht passt, sei es jetzt vom Arbeitgeber, […] von den Aufträgen her, die du zum Beispiel bekommst. Was der Chef von dir verlangt, oder Mitarbeiter von dir verlangen […] muss passen. […] das Hinunterdrücken von gewissen Leuten, das täte ich nicht verkraften, da täte ich aussteigen.“ Sie lässt offen, ob sie es nur dann nicht verkraften würde, wenn sie selbst davon betroffen wäre oder ob sie auch dann „aussteigen“ würde, wenn andere davon betroffen wären.
Auch Ärztin B. spricht Arbeitsweise und Bedingungen am Arbeitsplatz sehr deutlich an und weist darauf hin, was ihr besonders wichtig ist: „Mir ist wichtig, […], dass ich so meine Kompetenzbereiche habe, eigene Entscheidungen treffen kann, dass ich nicht nur auf Befehle hin irgendetwas ausführe, sondern dass ich wirklich eigenständig bin.“ Die Eigenständigkeit scheint vorrangig, wird aber in den darauffolgenden Sätzen sofort relativiert: „Wichtig ist mir das Umfeld, also die Gemeinschaft, ein Zusammenhalt, ein gegenseitiger Respekt, eine Wertschätzung eine gegenseitige, dann ist mir wichtig eine gute Kommunikation, dass man wirklich miteinander Dinge bespricht.“ Die Friseurinnen würden, wenn das „Umfeld passt“ auch „niedere Tätigkeiten“, wie Putzarbeiten, verrichten. Die Ärztin B. dagegen betont trotz der geforderten Eigenständigkeit das „Austauschen“ und „Dinge besprechen“.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: In einem funktionierenden Team zu arbeiten wird höher bewertet als die Eigenständigkeit. Diese wird nicht absolut gesetzt, sondern in Kompetenzbereichen gesucht.
Arbeit und Zeitstruktur
Arbeit ist für die Befragten zum Teil auch eine feste Größe im Tagesablauf. „Sie gibt mir irgendwie einen Halt in meinem Leben, es ist einfach irgendwie eine Regelmäßigkeit“, meint die Lehrerin C. Ähnlich sieht es ihre Berufskollegin G.: „Ich bin heute seit halb sieben in der Schule durchgehend und bleibe bis fünf. Und […] morgen haben wir Elternsprechtag bis acht am Abend, übermorgen fahre ich […] zu einer pädagogischen Konferenz.“ Durch das Aufzählen ihrer Tätigkeiten, die sie auflistet, als ob sie ihren Terminkalender vorlesen würde, gibt sie einen guten Einblick, wie die berufliche Tätigkeit in ihrem Alltag eine starke Struktur vorgibt.
Arbeit und Leistung
Nach Leistung und Leistungsdruck wird bei diesen Fragen nicht dezidiert nachgefragt, trotzdem kommen bei den Frauen mit Führungsfunktionen in den Antworten Umschreibungen und Bilder von Leistung und Leistungsdruck vor. Der Druck wird aber nicht erzeugt durch Anweisungen von Vorgesetzten, sondern von den eigenen Erwartungshaltungen und von der Verantwortung, die übernommen wurde und wahrgenommen wird. Die Befragten wollen keine Fehler machen und stecken ihre Ziele sehr hoch. Sehr gut reflektiert das die Schulleiterin G.: „Wichtig ist mir, die unterschiedlichen Aufgaben, die tagtäglich auf einen zukommen, […] zu meistern - […] wie man sie meistert, dass man sie meistert.“ Damit spricht sie zwei Ebenen an: Aufgaben müssen erledigt werden, das verlangt der Job. Das allein ist ihr aber zu wenig, auch das Wie ist entscheidend. Ich finde auch das verwendete Verb „meistern“ interessant, weist es doch darauf hin, eine Sache gut machen zu wollen. Weiters erzeugt auch das Leistungsdruck, dass sie in ihrem Beruf „derartig viele Gestaltungs- möglichkeiten“ hat und somit natürlich auch vieles falsch machen könnte.
Oberärztin D. stellt Leistung und Erwartungsdruck so dar: „Eigentlich ist mir wichtig, dass ich das, was mir als Auftrag gegeben ist, gut mache, dass die Leute zufrieden sind, die ich da betreue. […] dass ich das Richtige mache in der Medizin, dass man das richtig einschätzt, richtig macht, richtig therapiert.“ Gut erkennbar ist der Leistungsdruck, wenn man ihre nachgestellte Besorgnis betrachtet: „[…] hoffentlich übersehe ich nichts.“
Arbeit als Lebensinhalt und Selbstverwirklichung
Dieser Aspekt wird ganz unterschiedlich ausgedrückt. Oberärztin D. drückt das kurz aber selbstreflektierend aus, wenn sie sagt: „Arbeit ist mir sehr wichtig, ist sie doch auch mein Lebensinhalt.“ Ärztin B. spricht das noch direkter an: „Für mich ist Arbeit schon ein ganz wichtiger Bereich, wo ich mich selbst ver- wirklichen kann, wo ich irgendwie meine Kraft leben kann.“ Die Friseurin M. drückt es über ihre Biografie aus, indem sie zuerst betont, dass ihr die Arbeit sehr wichtig sei. Dann fährt sie fort: „[…] Also, ich mach das ja schon bald 40 Jahre. Für mich hat es nichts anderes gegeben. Schon mit 14 habe ich im Salon gearbeitet […] schon in der Hauptschule, […] da habe ich meine Mit- schülerinnen schon schön gemacht, weil ich genau gewusst habe, das ist genau mein Berufsbild und mein Berufsziel.“
Arbeit - Sozialkontakte - Menschen begegnen
Bezogen auf die berufliche Tätigkeit werden auch Sozialkontakte im Berufs- leben als Punkte bei den Fragen, was den Befragten am Arbeitsplatz wichtig sei, genannt.
Ärztin A.: „Dass man sehr viele verschiedene Menschen trifft, sie ein bisschen kennenlernt, verschiedene Lebenssituationen, ein bisschen, nur ansatzweise. Wir sehen die Leute ja nicht sehr lange. Trotzdem bekommt man einen kleinen Einblick, und manchmal kann man Leuten helfen, […] das gefällt mir sehr gut.“
Für die Friseurin F. ist der Dienst am Kunden wichtig, die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit findet sie in den Kundinnen gespiegelt, wenn sie sagt: „[…] Damit ich die Leute glücklich machen kann, weil die gehen immer strahlend hinaus […].“
Veränderungswünsche
Im Anschluss an die gestellten Fragen zur momentanen Erwerbsarbeit wurde untersucht, ob sich die Sichtweise stark ändert, wenn der Druck gelockert wird, indem die Befragten fiktiv die Freiheit bekommen, alles ändern zu können. Hier die Fragen: „Wenn Sie alles verändern könnten, was würden Sie in Ihrer Arbeit verändern?“, „Würden Sie dann überhaupt arbeiten?“
Alle der befragten Frauen, die geantwortet haben, würden weiterhin arbeiten, zwei sind nicht direkt auf den Teil der Frage eingegangen.
Friseurin M. begründet: „Ich kann mir das nicht ohne Arbeit vorstellen, weil jeder Mensch braucht ein Ziel und ein jeder Mensch braucht ein Ding, und wenn du das nicht hast, dann fangen Probleme an. Also das fängt schon bei den jungen Leuten an. Wenn die kein Ziel haben, das ist ja schrecklich.“ Diese Aussage ist sehr vielschichtig, Arbeit steht für Ordnung, für Sinn und für Ziele und stellt eine Grundstruktur dar, die es ermöglicht, ein sinnvolles Leben zu führen. Das wird besonders deutlich, wenn sie sich ein Leben ohne Arbeit vorstellt: „Da braucht man gar nicht auf der Welt zu sein, finde ich.“
Auch für Friseurin F. ist Arbeit wichtig, sie begründet: „Ich habe ein paar Tage freigehabt, aber gestern war ich auch froh, dass ich wieder arbeiten konnte. Da bin ich froh, weil sitzen und liegen oder essen oder schauen, was am nächsten Tag kommt, das ist für mich unvorstellbar.“
Die anderen Befragten begründen nicht direkt, warum sie arbeiten gehen, sondern beschäftigen sich mit den Änderungswünschen.
Die nachfolgenden Punkte fassen die Aussagen zusammen:
Veränderungen bei den Arbeitszeiten
Ärztin B.: „Ich würde die Arbeitszeiten ändern, die würde ich wesentlich flexibler gestalten, nicht nur jetzt, wenn ich Familie hätte, sowieso.“ Sie sieht darin die Möglichkeit gesünder zu leben, mehr nach „Lust und Laune“ zu arbeiten und auch das Wetter für Freizeitaktivitäten ausnützen zu können.
Auch Lehrerin E. würde bei den Arbeitszeiten etwas ändern: „[…] stundenmäßig reduzierter, um auch daneben etwas anderes zu machen.“
Ärztin A. erinnert sich an ihre vorherige Arbeitsstelle und greift den negativen Aspekt von langen Arbeitszeiten heraus: „[…] Arbeitszeiten [sind] sehr lang und ich musste auch oft am Wochenende arbeiten. Da war es schwierig, nebenan noch etwas zu haben. Das finde ich schlecht.“
Änderungen an Hierarchien und Strukturen
Die Beobachtungen von Lehrerin E. sind sehr interessant, weil sie geschlechtsspezifische Unterschiede in Strukturen und Hierarchien sieht:
„Ja, da würde ich schon gewisse Hierarchien und Strukturen ändern. Was einfach auffällig ist, dass Männer schon so ihre Netzwerke und Seilschaften haben, und das bei Frauen eigentlich extrem unterentwickelt ist. Und diese […] Abmachungen […] darauf basieren‚ ich mache dir jetzt einen Gefallen und dafür habe ich wieder einmal bei dir was gut, auch wenn es nicht korrekt abläuft.“
Was sie genau ändern würde, ist aber nicht erkennbar, dazu ist dieses Thema auch viel zu komplex, um es mit Änderungswünschen in wenigen Sätzen zu beschreiben.
Die Oberärztin D. kreidet bürokratische Strukturen an, die nach ihrer Meinung die Arbeit am Patienten stark einschränken: „Ich würde die Bürokratie, die uns so überhaupt nicht passt, die würde ich einmal zurückschrauben auf den Teil, der ihr zusteht. Aber nicht, dass wie jetzt 80% schon Bürokratie sind und 20% muss man sich stehlen für die Leute. Und dann muss man noch viel in der „Freizeit“ tun, damit man dann zufriedener heimgeht. […] da würde ich etwas ändern wollen.“
Änderungswünsche bezüglich Autonomie und Eigenständigkeit in der Berufsausübung
Ärztin B.: „Ja ich würde […] in meinem Arbeitsbereich schauen, dass es mehr Autonomie, […] mehr Eigenständigkeit gibt. Das finde ich ganz wichtig. Es muss jeder […] das Gefühl haben, er kann wirklich eigenständig selbstverantwortlich arbeiten.“ Zuerst ringt sie um das richtige Wort, Autonomie oder Eigenständigkeit. Ich interpretiere Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung und finde, es ergänzt sich gut mit Eigenständigkeit. Kritisch fährt sie dann fort: „Ja ich würde in der Medizin das ganze System ändern.“ Sie schränkt aber ein, dass diese Überlegungen sehr weit führen würden.
Veränderungswunsch nach weniger Zeitdruck und Stress
Die Äußerungen, die sich auf Stress beziehen, werden bei den Meisten nur sehr indirekt angesprochen. Die Medizinerinnen sehen als Stressoren das System und die überbordende Bürokratie, die fehlende Zeit für die PatienInnen. Das Wort Stress wird aber nicht direkt verwendet. Auch die Lehrerinnen erwähnen das Wort Stress in diesem Zusammenhang nicht.
Ganz konkret äußern sich hingegen die Friseurinnen. So wünscht sich Friseurin M.: „Ja weniger Stress zum Beispiel, würde ich schon ändern ja.“ Aber auch von einer anderen Kollegin werden die KundInnen als Stressoren genannt, weil sie keine Zeit hätten und sofort drankommen möchten, wenn zu einem Termin kommen.
Die Ärztinnen und Lehrerinnen haben sich vermutlich damit abgefunden, dass ihr Berufsleben Stress mit sich bringt. Sie beschreiben an anderen Stellen, wie sie mit Stress umgehen bzw. ihn abbauen.
Identifikation mit dem Beruf
Die Frage „Identifizieren Sie sich mit Ihrem Beruf?“ löst bei den Befragten die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Die Antworten fallen nicht besonders ergiebig aus. Einige Probandinnen fanden, ein einfaches „Ja“ oder „teilweise ja“ genüge. Erst durch kurze Anschlussfragen ergaben sich interpretierbare Antworten:
Friseurin K. identifiziert sich über das Arbeitsklima mit ihrem Beruf, sie antwortet auf die gestellte Frage: „Also von der Chefin einmal auf jeden Fall, von den Mitarbeitern auch, also wir haben ein wahnsinnig gutes Arbeitsklima.“
Ihre Kollegin M. hingegen geht bei der Identifikation sehr weit zurück, wenn sie meint: „Ja ich, weil eben, das hat eben schon sehr früh angefangen. Ah, das Schönmachen, ja und das Schminken hat mir gefallen. Einfach das Schöne, Ästhetik war bei mir im Vordergrund.“ Diese bereits seit ihrer Kindheit ausgeführten Tätigkeiten hat sie im Beruf professionell umgesetzt.
Ärztin B. antwortet aus einer Metaebene und betrachtet sich selbst: „Ich bin sicher mehr als der Beruf. Also meine Person macht wesentlich mehr aus, aber der Beruf ist doch ein wesentlicher Teil.“
Die Lehrerin D. identifiziert sich mit ihrem Beruf und begründet: „Weil es für mich doch ein Hauptinhalt in meinem Leben ist und weil man mit Menschen zu tun hat.“ Ebenso identifiziert sich ihre Berufskollegin E. und begründet das: „Also, weil er mir wichtig ist, und weil ich ihn auch total gerne mache und weil er einfach ein großer Teil von meinem Leben ausmacht.“
Wertschätzung am Arbeitsplatz
Die folgende Frage „Werden Ihre Leistungen am Arbeitsplatz wertgeschätzt?“ zielte darauf, etwas über die subjektiv empfundene Wertschätzung der eigenen Leistungen zu erfahren.
In unserer Gesellschaft wird Wertschätzung gegenüber arbeitenden Menschen am ehesten in Geld gemessen. Demnach müsste den Ärztinnen mehr Wertschätzung entgegengebracht werden als den Friseurinnen, und die Lehrerinnen würden in der Mitte liegen.
Die oben gestellte Frage berührt aber auch eine sehr persönliche Ebene und hierbei ist entscheidend, was eine Person als Wertschätzung empfindet. Die Frauen haben diese Frage sehr unterschiedlich beantwortet.
Ganz deutlich zeigt sich das in der Gegenfrage, die einige Probandinnen äußerten, nämlich „Wertschätzung von wem?“ Die ersten Interviewten bezogen sich bei den Antworten eher auf ihre Chefs, sodass ich mit der Zeit auch nachzufragen begann und in den letzten Interviews genauer definieren ließ, welche Wertschätzung die Frauen von wem bekämen. Diese Frage hätte ich vermutlich auch bei den ersten Interviews präziser stellen müssen.
Interessant ist jedenfalls, dass alle drei Ärztinnen fanden, dass sie besonders von „oben“ zu wenig Wertschätzung bekämen. Ärztin A. formuliert das folgendermaßen: „Wenn man nichts hört, dann ist man zufrieden, aber richtig gelobt oder so wird man eigentlich nicht.“ Oberärztin D. wird von den PatientInnen sehr geschätzt und bekommt das von ihnen zu hören, liegt aber immer wieder im Streit mit den „Chefobrigkeiten“, da sie zu wenig auf das vorgegebene, minutengenaue Zeitmanagement achte. Sie nimmt sich trotzdem Zeit für die PatientInnen und braucht deshalb über ihre Dienstzeiten hinaus- reichende zusätzliche Stunden. Obwohl diese Stunden nicht abgegolten werden, wird ihr das als mangelndes Zeitmanagement ausgelegt. Im Unterschied zu den beiden anderen Ärztinnen bezieht die Oberärztin die Wertschätzung der PatientInnen sehr stark mit ein.
Die Friseurinnen fühlen sich zum Teil wertgeschätzt. Für die angestellten Friseurinnen sind die Äußerungen der Vorgesetzten und der anderen Mitarbeiterinnen der Maßstab für Wertschätzung. Die Friseurchefin M. bezieht das auf ihre Kundinnen und drückt mit einem Vergleich aus, dass nicht von jeder Kundin eine wertschätzende Rückmeldung erwartet werden darf: „[…] das kann man nicht erwarten. […] ich sehe das gar nicht so negativ. Ich kann auch oft nicht irgendeinen anderen Beruf schätzen. Wenn da jetzt ein Mechaniker zu mir kommt, der macht mir jetzt mein Auto, und dann sehe ich die Rechnung und denke mir um Gottes Willen.“ Sie gibt zu bedenken, dass man oft nur den Geldbetrag sieht, aber nicht die Leistung, die dahintersteht. Dasselbe gilt auch in ihrer Branche.
Die Lehrerinnen sehen Wertschätzung auf verschiedenen Ebenen. Von der Gesellschaft würden sie sich mehr Wertschätzung wünschen. Hier sind es vor allem negative Medienberichte, die verallgemeinert werden. Sehr differenziert wird die Wertschätzung in der Schule selber erfahren. Kollegen können die Unterrichtsarbeit nicht wertschätzen, weil sie nicht direkt betroffen werden, Kinder schätzen aber eine besonders gelungene Unterrichtsstunde durchaus.
Eine Lehrerin drückt aus, wie sie Wertschätzung erfährt: „[…] wenn man irgendein Projekt macht, das jetzt öffentlich zugänglich ist, aber normalerweise kriegt man nicht viel direkte Wertschätzung.“ Es scheint so, dass bei den Lehrerinnen die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit und das Klima im Kollegium wichtiger sind, als von außen erfahrene Bezeugungen von Wertschätzung.
4.4 Haushalt, Haushaltsführung und Arbeitsteilung
Mit den nachfolgenden Fragen „Wie ist die Arbeitsteilung in Ihrem Haushalt? (Warum ist das so?)“, „Sind Sie zufrieden damit? (Warum?)“, „Würden Sie gern etwas daran ändern?“, „Wie wichtig ist Ihnen ein gut geführter Haushalt?“ und „Werden Ihre Leistungen im Haushalt wertgeschätzt?“ sollte ergründet werden, wie der Haushalt geführt wird, wobei es keine speziellen Fragen zur Kinderbetreuung gab.
Drei jungen Frauen leben noch daheim, und drei Frauen leben alleine. Ich hab mich daher hauptsächlich auf jene Frauen konzentriert, die eine eigene Familie gegründet haben (F., G.) und die, die in einer Beziehung leben (A., B.).
Die Friseurin F. kann bei meiner Frage nach der Arbeitsteilung in ihrem Haushalt kaum mit dem Lachen aufhören, und ich habe das Gefühl, etwas Falsches gesagt zu haben. Schließlich meint sie, dass es bei ihr keine Arbeitsteilung im Haushalt gebe. Sie macht den Haushalt mit zwei kleinen Kindern neben dem Vollzeit-Beruf selbst. Lachend meint sie aber, dass sie selber schuld sei, „weil sie halt alle nach Strich und Faden verwöhnt.“ Bei der Frage, ob ihre Arbeit im Haushalt denn geschätzt werde, meint sie: „Nein, nicht sehr viel, nein.“ Dann lacht sie: „Sonst ist es ein sehr feiner Mann, [...] einmal im Monat macht er etwas, als Trost.“
Die Hauptschuldirektorin G. meint, dass die viele Arbeit in der Direktion dem Haushalt nicht so gut tue. Ihr Mann und ihre zwei erwachsenen Kinder helfen mit, und sie hat auch eine Reinigungshilfe. Trotzdem findet sie, dass der Haushalt zu kurz kommt, und dass keine Zeit für Gartengestaltung, für Blumen und festliche Dekoration bleibe. Sie beneidet Freundinnen mit „Vorzeige- haushalt“. Allerdings kann sie Unordnung oder Chaos nicht ausstehen und es darf nichts herumliegen. Das ist ihr sehr wichtig. Im Laufe des Interviews kommen auch an anderen Stellen mehrere Bemerkungen über tolle Haushalte, und dass sie dafür einfach keine Zeit habe.
Die Ärztin A. und ihr Beziehungspartner wohnen im Moment nicht ständig in einem Haushalt zusammen. Sie ist insgesamt aber sehr zufrieden mit der Situation, da sie beide eine gute Arbeitsteilung gefunden haben, die durch eine Reinigungshilfe ergänzt wird. Sie und ihr Partner wertschätzen gegenseitig jene Arbeiten, die der andere im Haushalt macht. Insgesamt nimmt sie aber einen gut geführten Haushalt nicht ganz so wichtig.
Für Ärztin B. ist Ordnung und Sauberkeit wichtig. Sie und ihr Partner sind bemüht, die Arbeit gerecht zu verteilen. In manchen Bereichen, wie Müll entsorgen und einkaufen, funktioniere das gut, aber in anderen Bereichen, wie z. B. beim Putzen, nicht. Ärztin B. erzählt, dass sie sich wirklich auch da eine gerechte Aufteilung wünschen würde, aber sie sei „teilweise gewollt, teilweise aber auch ungewollt“ in die ungerechte Arbeitsteilung hineingerutscht. Auf meine Frage hin, ob sie da gerne etwas ändern würde, meint sie, dass sie sich oft gewünscht hätte, dass die Arbeitsteilung ausgeglichener wäre. Dann fügt sie hinzu, dass sie ursprünglich schon Idealvorstellungen gehabt habe, die ihr Partner aber wahrscheinlich nicht hätte erfüllen können.
Die Haushaltsführung dürfte in den untersuchten Beispielen einerseits stark vom Milieu andererseits vom Bildungsgrad der Frauen abhängen. Die Friseurin ist nach dem Sinusmilieumodell der konsumorientierten Basis zuzuordnen. Ganz traditionell ausgerichtet orientiert sich die Frau an der herkömmlichen Rollenverteilung im Haushalt. Sie beklagt sich nicht. Vielmehr scheint es so, als ob sie akzeptiert hätte, dass ein Mann keine Haushaltsarbeiten verrichtet.
Die Schulleiterin G. ist meines Erachtens vom Milieu her der Gruppe der Bürgerlichen Mitte zuzuordnen. Die sprachlichen Äußerungen lassen darauf schließen, dass sie einen sehr „partnerschaftlichen“ Haushalt organisiert. Die Anderen, ihre Kinder und ihr Mann, helfen ihr. Sie scheint sich also voll für den Haushalt verantwortlich zu fühlen, bekennt aber, dass ihr trotz Putzhilfe und Mitarbeit aller Familienmitglieder kein Musterhaushalt gelinge.
Bei den Ärztinnen, die dem Milieu der Postmateriellen zuzuordnen sind, wird Wert auf partnerschaftliche Aufteilung der anfallenden Arbeiten gelegt. Beide haben aber noch keine Kinder, die Verteilung der Arbeiten ist somit auch wesentlich leichter. Obwohl versucht wird die Aufgaben „gerecht“ zu verteilen, scheint es nicht immer perfekt zu klappen.
4.5 Führungsrollen in den einzelnen Berufssparten
Die folgenden Fragen „Was hat sich für Sie als Frau geändert, nachdem Sie eine Führungsrolle übernommen haben?“, „Haben Sie mit ähnlichen Schwierigkeiten zu tun wie ein Mann, der diese Stelle einnehmen würde?“, „Mit welcher Art von Druck haben Sie bei Ihrer Arbeit zu tun? Wie gehen Sie damit um?“ und „Wie fühlen Sie sich in Ihrer Position?“ sollen klären, mit welchen Problemen die drei Frauen, die innerhalb ihrer Berufsgruppe Führungs- funktionen ausüben, zu tun haben. Es soll auch dargestellt werden, wie sie darauf reagieren und ob sie Unterschiede zu ihren männlichen Kollegen in gleichen Positionen sehen:
Die letzte Frage führte zu keinen ausführlichen Antworten. Alle drei Frauen fühlen sich in ihren Positionen wohl und wollen das nicht näher erläutern.
Änderungen durch Führungspositionen
Die Oberärztin D. beschreibt, wie sie in ihre Führungsrolle harmonisch hineingewachsen ist. Sie bekam die Oberarztstelle zu einem Zeitpunkt, als sie mit ihrer Facharztausbildung noch nicht ganz fertig war. Dadurch hat sie sich an diese Position von Anfang an gewöhnt.
Die Schuldirektorin G. bezeichnet sich selbst als nicht so weiblichen Typ und glaubt, dass sie dadurch als Direktorin weniger Probleme hat. Bevor sie die Führungsrolle übernahm, war sie an ihrer Schule schon als Lehrerin tätig. Insgesamt sind in der Schule um die zwanzig Lehrpersonen tätig, davon ziemlich genau zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Gespräche mit ihren KollegInnen beschreibt sie so: „Ich war ja zuerst Kollegin. Und die Sachen, die wir davor abgeredet haben - wir haben alles miteinander abgeredet - solche Sachen werden jetzt auch abgeredet.“ Es scheint so, dass sie zwischen Beziehungsebenen und Sachebenen unterscheidet. Persönliche und private Gespräche mit den KollegInnen funktionieren wie früher. Für sie als Frau habe sich daher nicht allzu viel geändert.
Bei Friseurchefin M. ergaben sich größere Änderungen im Arbeitsablauf. Als Chefin des Salons ist sie zuständig „wenn jemand hereinkommt, auch wenn das ein Vertreter ist, da bin ich der Ansprechpartner“. Außerdem habe sie mehr Verantwortung und nach ihren Angaben laste alles auf ihr.
Schwierigkeiten in Führungspositionen im Vergleich zu männlichen Kollegen
Besonders spannend finde ich die Antworten der Oberärztin D., die große Unterschiede beschreibt zwischen den Problemen, die sie in der Position hat und die ein Mann hätte. Widersprüchlich dazu wirken ihre Antworten am Anfang des Interviews, in denen sie ausführt, dass zwischen Männern und Frauen heutzutage nicht mehr viel Unterschied sei. Ihre Erfahrung ist, dass Männer mehr delegieren, und dass das auch akzeptiert werde. Wenn sie selber delegiert, bekommt sie Antworten wie: „Ja, aber da müssen Sie schauen. Sie sind Stationsärztin und Sie müssen doch schauen, dass alles passt.“ Weiter erzählt sie, dass Männer die unbeliebten Kleinigkeiten, die niemand tut, einfach liegen lassen. Sie hingegen erledigt das selbst. Sie meint, dass Männer in der Position das nicht machen, weil sie für sich ganz selbstverständlich definieren, für solche Angelegenheiten nicht zuständig zu sein.
Die Schulleiterin G. erzählt auch von großen Unterschieden, je nachdem ob ein Mann oder eine Frau die Schule leitet. Es werden Probleme anders an sie herangetragen, als es bei ihrem männlichen Vorgänger der Fall war. Sie findet aber, es sei schwer abzugrenzen, inwiefern der Unterschied zwischen Mann und Frau ausschlaggebend ist, oder ob die jeweilige Persönlichkeit der Führungsperson das Relevante ist.
Sie ist überzeugt, dass der Führungsstil von Männern eher härter sei, dass ein Direktor eher über seine MitarbeiterInnen „drüberfährt“, und dass ihm die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen nicht so sehr ein Anliegen sei, solange alles funktioniere. Außerdem hinterfragen Männer insgesamt weniger als Frauen und zweifeln dadurch auch weniger.
Die Friseurchefin M. findet, dass Männer härter sind, zum Beispiel beim Verhandeln von Preisen, und dass sie ihr in technischen Angelegenheiten überlegen sind.
Schwierigkeiten und Druck in den Führungspositionen - Lösungsstrategien
Bei der Oberärztin D. und der Friseurchefin M. ist es vor allem Zeitdruck.
Die Oberärztin hat nach einigen verschiedenen Modellen, die sie durchprobiert hat, für sich die folgende Strategie gefunden: Sie atmet kurz durch und nimmt sich die Zeit, die sie braucht, um etwas zu tun, ohne auf die Uhr zu schauen oder sich stressen zu lassen.
Die Friseurchefin M. beschreibt nicht so genau, wie sie mit dem Stress umgeht. Sie zeigt auf, wodurch für sie Stress entsteht: Ausgangspunkt sind die KundInnen die nörgeln, wenn sie die vereinbarten Termine nicht ganz genau einhalten könne, da handwerkliche Tätigkeiten verschieden lange dauern. Eine ihrer Strategien ist es jedenfalls, gute Mitarbeiterinnen einzustellen. Das ist ihr sehr wichtig.
Bei der Schulleiterin G. kommt der Druck von LehrerInnen, die sich zum Beispiel mit neuen Projekten überfordert fühlen, aber auch von SchülerInnen und Eltern. Dazu kommt noch der Druck von den vorgesetzten Verwaltungs- stellen und vom Schulerhalter, der Gemeinde, weil sehr viele Richtlinien eingehalten werden müssen. Sie mache sich aber auch selber Druck, da sie bemüht ist, dass alles möglichst perfekt läuft. Eine ihrer Strategien ist Ausgleich durch Familie, Freizeit und Hobbys. Bei schweren Problemen nimmt sie „natürlich Hilfe von Außen in Anspruch“. Dazu zählt sie den Schulpsychologen und „Teamcoaching“. Neben den institutionellen Möglichkeiten nutzt sie auch ihre privaten Ressourcen: „Dann natürlich im Freundeskreis, dass man weiß, wenn es einmal gar nicht geht, dass man da auch etwas loswerden kann.“
4.6 Freizeitgestaltung
Die Erhebung nach dem Freizeitverhalten wurde mit folgenden Fragen vorgenommen: „Was machen Sie in Ihrer Freizeit?“, „Wie viel Freizeit haben Sie?“, „Mit wem und wie verbringen Sie diese?“, „Wenn Sie tun könnten, wie Sie wollten, wie würden Sie dann Ihre Freizeit gestalten?“
Die Antworten lassen den Schluss zu, dass der Begriff Freizeit als Synonym zu Hobby oder zumindest als Freizeitaktivität verwendet wird. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Keine Befragte gibt Tätigkeiten wie Fernsehen oder mit den Kindern spielen als Freizeit an.
Freizeitgestaltung - Arten der Betätigung
In Bezug auf Freizeitgestaltung sieht man eine Trennung zwischen den Klassen besonders stark: Zwei Friseurinnen haben durch Beruf und Kinder sehr wenig bis gar keine Freizeit. Die anderen Friseurinnen betreiben in der Freizeit folgende Sportarten: Skifahren, Radfahren, Schwimmen und Reiten.
Die Ärztinnen und Lehrerinnen betreiben auch alle Sport, aber sie gaben noch zusätzliche Freizeitaktivitäten an, wie lesen, Kino- und Theaterbesuche, sich mit Freunden treffen und Kaffee trinken oder essen gehen, telefonieren und reisen.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass alle außer den zwei viel beschäftigten Friseurinnen Sport betreiben. An anderen Stellen, meist bei den Fragen in Bezug auf den Körper, geben vier von den Frauen (zwei Lehrerinnen und zwei Ärztinnen) an, dass sie zu wenig zu Sport kommen und gern mehr Sport betreiben möchten.
Zeitangaben zur Freizeit
Alle drei Führungspersonen betonen, dass sie wenig Freizeit haben. Die Schulleiterin G. hat einen sehr genauen und straffen Tagesplan, in dem sie aber täglich zumindest etwas Sport einplant, weil sie den als Ausgleich braucht. Sie betont sehr, dass sie trotz der durchorganisierten Tagesplanung auch Hobbys und Freizeit einzubauen versucht. Im Sommer hat sie etwas mehr Zeit.
Die Friseurchefin M. hat auch sehr wenig Freizeit, da sie diese nutzt, um für ihren Friseursalon verschiedene Dinge zu erledigen.
Die Oberärztin D. begründet ihre wenige Freizeit einerseits durch sehr viele Arbeitsstunden und andererseits besonders auch durch Nachtdienste, nach denen sie zu müde sei für viele Freizeitaktivitäten. Ärztin B. beschreibt das sehr ähnlich: „Ich bin aber teilweise auch von der Arbeit so müde, dass ich Zeit hätte, aber nicht mehr fähig bin, aktiv die Freizeit zu gestalten.“
Die restlichen Frauen sind der Meinung, dass ihre Menge an Freizeit ausreichend ist. Die Freizeitaktivitäten werden vor allem am Wochenende ausgeführt.
Freizeit als soziale Interaktion
Auf die Frage „Mit wem verbringen Sie ihre Freizeit?“ antworteten sechs Frauen, dass sie einen Teil der Freizeit im Freundeskreis verbringen, drei davon differenzieren das genauer und sagen Freundinnen.
Zwei Ärztinnen, die angeben eine Partnerbeziehung zu haben, verbringen die meiste Zeit mit ihren Beziehungspartnern. Die zwei Frauen mit Kindern beschäftigen sich in ihrer Freizeit vorwiegend mit diesen. Zusätzlich geben drei Frauen an, ihre Freizeit hauptsächlich mit ihrer Familie zu gestalten. Nur die Ärztin B. verbringt auch manchmal Freizeit mit KollegInnen.
Veränderungswünsche zur Freizeit
Mit der Frage „Wenn Sie tun könnten, wie Sie wollten, wie würden Sie dann Ihre Freizeit gestalten?“ sollten Veränderungswünsche erhoben werden.
Sechs Frauen würden noch mehr Sport treiben. Die Friseurin H. betont aber, dass sie sich dabei nicht überanstrengen würde, weil es ihr hauptsächlich darum gehe, dass es Spaß mache und dass es ihr gut gehe.
Der Friseurin F. fiel zu meinem Erstaunen gar nichts ein. Sie arbeitet gerne, und mit zu viel Freizeit werde ihr schnell langweilig. Sie und zwei Lehrerinnen wünschen sich im Grunde genommen keine Veränderungen. Eine davon, die Schulleiterin G., würde zwar noch etwas öfter verreisen und auch mehr Sport machen, aber sie betont, dass sie auch so zufrieden sei.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Fünf Frauen würden einfach mehr von dem machen, was sie jetzt in der Freizeit bereits tun.
Drei Frauen würden aber auch gerne Dinge in Angriff nehmen, zu denen sie jetzt keine Zeit und keine Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel etwas Neues lernen. Bei zwei Ärztinnen wird das besonders deutlich, weil ihnen aufgrund der unregelmäßigen Arbeitszeiten die Teilnahme an entsprechenden Kursen und Veranstaltungen erschwert wird.
Weiterbildungen oder Kurse (z. B. Yoga, Singen, Tanzen und Sprachen) werden nur bei den Lehrerinnen und Ärztinnen angesprochen.
4.7 Materielle Sicherheit
Bei der Frage „Über welche materiellen Sicherheiten verfügen Sie?“ denken drei Friseurinnen an Versicherungen, wie Pensions- und Unfallversicherung und an die verbreiteten Sparprodukte „Sparbuch“ und „Bausparvertrag“. Eine Friseurin hingegen kann das nicht benennen und drückte es folgendermaßen aus: „Materielle Sicherheit? Na normal, was halt jeder hat.“
Ärztin A. sieht als materielle Sicherheit: „Ersparnisse, die mir […] erlauben, dass ich jetzt nicht am Ende des Monats schauen muss, […] sondern eine gewisse Sicherheit.“
Ärztin B. beschreibt ihre Besitztümer als Sicherheit: „Ich habe ein eigenes Auto, ich habe ausreichend Kleidung, […] ich habe eine Mietwohnung, wo ich weiß, da kann ich bleiben, ich weiß, ich kann mir die Miete leisten. […] Ich habe aber kein […] Kapital, auf das ich zurückgreifen könnte.“ Sie bindet, allerdings nicht direkt ausgesprochen, ihre Berufstätigkeit in diese materielle Sicherheit mit ein. Für die Stationsärztin D. ist die fixe Anstellung, vermutlich ist sie pragmatisiert, der erste Punkt, den sie bei dieser Frage nennt. Weiters fallen ihr noch Versicherungen, Ersparnisse, eine Wohnung und ein Haus als Sicherheiten ein. Sie betont auch, dass sie dafür dankbar ist, in solchen gesicherten Verhältnissen leben zu können.
Die junge Lehrerin C. beschreibt, was sie als Sicherheit anstrebt: Es sollte Geld für die Sicherung der Pension und für eventuelle medizinische Eingriffe vorhanden sein. Auch Lehrerin E. weicht ein wenig aus, sie beschreibt auch nur, wofür sie die finanziellen Rücklagen bildet: „Ja, sie ist mir schon wichtig, […] dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich die Arbeit verlieren würde, oder wenn irgendetwas Gröberes wäre.“
Zusammengefasst kann man feststellen: Quer durch alle Milieus nehmen Erwerbstätigkeit und gesicherter Arbeitsplatz eine zentrale Stelle bei den Sicherheiten ein. Das Einkommen muss auch reichen, um kleine Ersparnisse zu erwirtschaften, die in Sparbüchern und Bausparverträgen zurückgelegt werden. Auch Versicherungen und Immobilien sowie andere teure Gegen- stände, wie z. B. Autos, werden als Sicherheiten genannt. Im Gesamtbild habe ich hier aber keine Unterschiede in den verschiedenen Milieus erkennen können, denn die Antworten waren in jedem Milieu sehr gemischt.
Bedeutung der materiellen Sicherheit
Um die Bedeutung der materiellen Sicherheit zu klären, wurde die Frage „Wie wichtig ist Ihnen materielle Sicherheit?“ gestellt.
Für sieben von acht befragten Frauen ist die materielle Sicherheit sehr wichtig. Die Begründungen sind aber unterschiedlich. Für die Friseurinnen K. und H. sind die materielle Sicherheit wichtig, um die monatlichen Kosten decken zu können und dass darüber hinaus eine gleichmäßige Grundversorgung möglich ist. Sie möchten nicht, dass sie bereits in der Monatsmitte nachdenken müssen, ob das Geld noch bis zum Ende des Monats reiche. Diese Aussagen beziehen sich meines Erachtens auf das Milieu, in dem sich die beiden Befragten befinden, wo es durchaus üblich ist, dass man sich am Monatsanfang mehr leisten kann als am Ende.
Ärztin A. findet materielle Sicherheit für ihr Wohlbefinden wichtig, es sei eine Grundsicherheit, die dadurch entstehe. Sie führt das genauer aus: „Wenn etwas geschieht [...] und wenn man sich dann sagen kann, o. k. ich habe Reserven, es ist jetzt nicht so tragisch, ich kann eine Lösung finden, dann erleichtert das einem den Umgang mit unvorhersehbaren finanziellen Belastungen ungemein.“
Die Ärztin B. meint, materielle Sicherheit habe bei ihr keinen so hohen Stellenwert, dass sie irgendeinen Job annehmen würde, der ihr keine Freude mache. Sie vertraut auf ihre Familie und Freunde als Rückhalt, falls sie arbeitslos sein sollte. Das sprichwörtliche Dach über dem Kopf in Form eines eigenen Hauses würde sie dann bauen, wenn ihr das Einkommen aus einer Tätigkeit die ihr Spaß macht, es ermöglicht. Den umgekehrten Vorgang, nämlich hart arbeiten nur des Geldes wegen, möchte sie nicht anstreben. Bei ihr wird besonders deutlich, dass es auch das soziale Kapital ist, aus dem Menschen Sicherheit beziehen, denn durch ihre Bildung hat die Ärztin B. kulturelles Kapital erworben, das sich auch in ökonomisches transferieren lässt und sie hat durch den starken Zusammenhalt so wie die Solidarität ihrer Familie auch soziales Kapital. Zusätzlich stellt der Freundeskreis einen wichtigen Halt und Bezugspunkt ihres Lebens dar, und sie kann deshalb leichter sagen, dass ihr das ökonomische Kapital nicht ganz so wichtig ist. Ähnlich ist es bei der Hauptschuldirektorin G.
Die Friseurin H. dagegen findet materielle Sicherheit sehr wichtig. Sie täte in einer Notlage „alles, um irgendwie Geld zu bekommen“.
4.8 Beziehungen
Mit den zwei Fragen „Welche Beziehungen sind Ihnen am Wichtigsten?“ und „Wie pflegen Sie diese?“ wurde nach Beziehungsmustern gefragt.
Rangordnung der Beziehungen
Für sieben Frauen sind die Beziehungen zu Familienmitgliedern und Lebenspartnern am wichtigsten. An zweiter Stelle kommen dann Freundinnen und Freunde sowie Arbeitsbeziehungen. Für die restlichen drei Frauen sind alle Beziehungen gleich wichtig.
Ärztin B. kann ihre Beziehungen genau einordnen, und stellt bei der Frage nach deren Wichtigkeit folgende Reihung auf: „ […] die Beziehung zum Partner, ist mir am wichtigsten. Aber was gleichzeitig auch wichtig ist, oder dann als Nächstes kommen würde, sind sicher Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zur Familie, und auch gute Beziehungen zu Arbeitskollegen.“
Oberärztin D. führt als Überbau in Reihung und Qualität ihrer Beziehungen die Kategorie „friedvolle Beziehungen“ an. Danach nennt sie nach Familie die ArbeitskollegInnen, weil ihr für sonstige Freundschaften meist die Zeit fehle.
Lehrerin C. legt Wert auf Partnerschaft und Familie. Bei FreundInnen ist sie aufgrund einiger Vertrauensbrüche vorsichtiger.
Schulleiterin G. stellt auch klare Präferenzen, wenn sie ausführt: „Natürlich zuerst einmal die Familie, weil ich meine […] bei allen Problemen, die man sonst irgendwo hat, wenn man in der Familie den Halt hat, dann wird viel aufgefangen. […] meine Freunde, also der Freundeskreis, der ist mir schon wichtig […] und dann natürlich auch so die Kollegen und Kolleginnen […].“
Gestaltung, Pflege und Qualität der Beziehungen
Bei der Pflege der Beziehungen wird immer wieder der Faktor Zeit genannt. Bei den meisten der Befragten wird das besonders bei der Pflege der Freundschaften metaphorisch mit „sich Zeit schenken“ oder „gemeinsame Zeit verbringen“ umschrieben.
Ein sehr harmonisches Umfeld strebt Friseurin H. an: „Also ich würde keinen wirklichen Streit haben wollen […] wegen etwas Belanglosem. Ich möchte, dass ich […] mit denen ich zusammenarbeite oder privat bin, dass die einem vertrauen können.“ Dass ihr die anderen - ihre Beziehungspartner - vertrauen können, scheint für sie die Basis für gute Beziehungen zu sein. Sie fordert das aber nicht direkt von den anderen ein.
Friseurin H. sieht als Basis ihrer Beziehungsarbeit, dass man redet, miteinander Spaß hat und Vertrauen aufbaut. Dann differenziert sie und unterscheidet: „Es kommt halt darauf an, wie nahe einem der Mensch ist. Ich meine, wenn es ein Familienmitglied ist, würde ich den mehr beanspruchen, als wie einen anderen.“
Ärztin A. unterscheidet zwischen ihrer Partnerschaft und den verwandtschaftlichen Beziehungen: „Partnerschaft heißt, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich auch Mühe gibt, vielleicht wenn man mal eine schlechte Laune hat, also das eben abzufedern und nicht auszuspielen, sondern das einfach zu schätzen, dass man einander hat und die Zeit, die man zusammen hat.“ Bei den Verwandten versucht sie, durch telefonische Kontakte und gelegentliche Besuche die Kontakte aufrecht zu erhalten.
Ärztin B. stellt bei der Pflege ihrer Beziehungen fest: „Na, leider zu wenig, sporadisches Mailen und feststellen, ob derjenige noch lebt, ein Lebenszeichen von mir geben.“ Gemeinsame Aktivitäten kommen dazu, falls es die Zeit erlaubt.
Für Lehrerin C. ist das gegenseitige „sich Austauschen“ die wichtigste Aktivität bei der Pflege ihrer Beziehungen. Darunter versteht sie, dass man sich Zeit nimmt füreinander, nach dem Tagesablauf fragt und gegebenenfalls auch, bei den Familienmitgliedern beratend einwirkt. Bei den Freundschaften sind ihr das Zusammensein und das Zuhören am wichtigsten.
Für die Schulleiterin G. ist es sehr wichtig, ihre Freundschaften, die zum Teil auch Freundschaften ihrer Familie sein dürften, durch gemeinsame Aktivitäten zu pflegen: „Freundschaften, naja, erstens sieht man sich ja, wenn ich Zeit habe, und […] reden wir uns zusammen, dann gibt es eine Einladung, Essenseinladungen. Wir fahren miteinander mit dem Rad, wir gehen mit- einander auf den Berg, wir unternehmen so einfach gemeinsam Sachen.“
Auch Lehrerin E. präzisiert den Faktor Zeit, fügt aber noch zusätzlich an: „[…] dass man auch durch Aufmerksamkeiten und kleine Dinge, Überraschungen, dem anderen signalisiert, dass er wichtig ist.“
Zuständigkeiten in den Beziehungen
Von zwei Frauen werden harmonische bzw. friedvolle Beziehungen angestrebt, was in unserer Gesellschaft sicherlich als typisch weibliche Forderung gesehen wird. Darüber hinaus sieht sich Friseurin K. selbst in einer sehr mütterlichen Rolle, wenn sie über ihre Beziehungen spricht: „Hm, ja ich bin eigentlich so ein bisschen die Mama bei uns […] bei den Freundinnen. Also wenn es irgend- welche Probleme gibt, oder […] wenn sie irgendeinen Streit mit irgend- jemandem haben, kommen immer alle zu mir, […] ich bin immer die, die zuhört und dann Ratschläge gibt.“
Auch die Lehrerin C. sieht sich in dieser Rolle, wenn sie von ihrer Beziehung zu ihrem Lebenspartner ausführt: „[…] und den L. sehe ich natürlich auch jeden Tag, da tauschen wir uns auch aus, wie es ihm gegangen ist in der Arbeit, und ich höre ihm auch zu, und ja brems ihn manchmal ein bisschen ein, weil ich bin so der ruhigere Part von uns.“
4.9 Paarbeziehungen, Partnerschaft, Ehe
„Partnerschaft“ oder „Ehe“ wurde in den vorangegangenen Fragen schon kurz gestreift. An dieser Stelle wurde aber noch einmal explizit gefragt, was den Frauen an einer Partnerschaft wichtig sei.
Die zwei jungen Friseurinnen H. und K. betonten sehr, dass sie „einen Partner nicht auf das Podest stellen“ wollen. Da beide ihren Wunsch nach Eigen- ständigkeit betonen, scheint es in dem Milieu der „Konsumorientierten Arbeiter“ eine durchaus gängige Struktur zu sein, dass Frauen ihre Hobbys und Interessen denen des Partners unterstellen. Friseurin K. erzählt: „Also ich glaube einfach, [...] man sollte sich nicht nur auf den Partner konzentrieren. Man soll seine eigenen Sachen beibehalten, man soll seine Hobbys weiter machen, man soll sich auf seine eigenen Sachen weiter konzentrieren.“ Sie möchte ihre Freiheit behalten und nicht eingeengt werden und begründet das folgendermaßen: „Weil ich weiß nicht, ich habe es so mitbekommen von den Freundinnen und so, die Beziehungen haben. Sobald sie hergegangen sind, und er der Wichtigste ist und sie müssen immer parat stehen, wenn er Zeit hat und etwas tun will oder sonst irgendetwas, da ist ziemlich viel schon in die Brüche gegangen.“
Die ältere, verheiratete Friseurin F. legt Wert auf gute Zusammenarbeit und Treue, „genau wie in guten so auch in schlechten Zeiten. So wie man es verspricht“.
Auch Lehrerin C. betont die Wichtigkeit von Treue: „Was für mich auch wichtig ist, ist zum Beispiel Treue, Vertrauen. Das gehört für mich irgendwie zusammen, weil wenn der andere, mir nicht mehr treu ist, dann kann ich dem auch nicht mehr vertrauen.“
Vertrauen und Akzeptanz in einer Beziehung wurden insgesamt von den meisten Frauen aus allen drei Berufsgruppen erwähnt.
Von den Ärztinnen und Lehrerinnen werden zusätzliche Schwerpunkte wie eine gute Gesprächsbasis, bewusster Umgang mit Streit und Konflikten, ähnliche Wertanschauungen, ähnliche Interessen oder ein gemeinsamer Bekanntenkreis aufgezählt. Gleichberechtigung scheint in diesen Milieus kein Thema zu sein.
Schlussbetrachtung:
Der Begriff Treue wird nicht wirklich hinterfragt. Die formelhafte Wiedergabe des Ehegelöbnisses „… bis dass der Tod euch scheidet“ wird von einer Befragten als Maßstab erwähnt. Indirekt wird an diese Formel aber öfter angeknüpft. Man gewinnt den Eindruck, dass diese Treue als Synonym für Treue im sexuellen Bereich gebraucht wird. Dies scheint im krassen Gegensatz zu den gesellschaftsüblichen Usancen zu stehen. Der sogenannte Seitensprung mit den darauf folgenden Versöhnungszeremonien dürfte inzwischen kein Einzelfall mehr sein.
Sehr erstaunt hat mich, dass keine der befragten Frauen von Liebe gesprochen hat.
4.10 Beziehung zu den eigenen Kindern
Durch diese beiden Fragen „Was ist Ihnen in Ihrer Beziehung zu Ihren Kindern wichtig?“ und „Worauf achten Sie besonders bei der Erziehung Ihrer Kinder?“ wurde nachgefragt, wie die Beziehungen der Frauen zu ihren Kindern gestaltet werden.
Die Antworten sind nicht wirklich vergleichbar, bzw. es ist nicht sinnvoll, eigene Kategorien zu bilden, weil nur zwei der Befragten eigene Kinder haben. Die Auswertung macht trotzdem Sinn, da die Antworten etwas über die Werte der Frauen aussagen. Dazu kommt, dass diese zwei Frauen innerhalb der Milieugruppen sehr unterschiedlich sind. F. ist eine Friseurangestellte in einem kleinen Friseursalon und Mutter von zwei kleinen Kindern. G. ist Schulleiterin einer Hauptschule und hat zwei erwachsene Kinder.
F. erklärt als Erstes ganz warm und herzlich, dass ihre Kinder das Aller- wichtigste in ihrem Leben sind. Sie führt das aus: „Ja, dass ich sie lachen sehe, dass sie zufrieden sind, das ist mir am Allerwichtigsten, und Gesundheit.“ Mit ihrer Erziehung versucht sie nach ihren Angaben Folgendes zu vermitteln: „Ich achte auf Normalität, zum Beispiel, dass sie grüßen können, dass sie normale Sachen tun und dass sie höflich sind. […] obwohl die Kinder hören von den anderen Kindern das Allerschlimmste, und probieren das auch natürlich aus. […] sozial sein ist mir auch wichtig […], damit sie anderen auch helfen.“ In ihrer Erziehung stehen Höflichkeit und soziale Grundwerte im Vordergrund.
Für die Schulleiterin G. stellen sich die wichtigsten Erziehungsziele so dar: „[…] dass sie ehrlich sind, dass wir sie so erziehen, dass sie wirklich ehrlich sind, dass sie beziehungsfähig sind, dass sie einfach Menschen sind, mit denen man gut auskommen kann, und […] dass wir sie so weit bringen, dass sie selbstständig sein können. Ich meine das sind ja keine kleinen Kinder mehr, [...] beide sind noch relativ abhängig von daheim, dass wir sie soweit bringen, dass sie eigenständig leben können.“
Aufgrund der Altersunterschiede der erziehenden Eltern ergeben sich unterschiedliche Erziehungsziele. Beide Mütter wollen aber, dass sich ihre Kinder in der Gesellschaft einfügen können.
4.11 Erziehung zur Weiblichkeit
Friseurin K. gibt an, dass sie von ihren Eltern in keinerlei Hinsicht geschlechtsspezifisch erzogen worden sei. Sie begründet das folgendermaßen: „[…] meine Eltern sind ziemlich alternativ. Sie sind früher, sind so Althippies. Die sind viel mit Rucksack unterwegs gewesen. Ich bin auch nicht getauft worden. Weil der Papa ist evangelisch, die Mama ist katholisch, sie haben auch gesagt ich soll es mir später einmal selber aussuchen können, an was ich glaube.“
Friseurin H. wurde von den Großeltern erzogen. Sie erklärt: „Also zur Weiblichkeit erzogen bin ich eigentlich nicht geworden, ich bin halt mehr zu Moral erzogen worden.“ Sie tut sich mit den Kategorisierungen „männlich“ und „weiblich“ schwer: „Aber eben zwischen weiblich und männlich fehlt mir oft der Unterschied durch meine Erfahrungen. Ich sehe einen Menschen …“ Daher falle es ihr auch schwer bei der Erziehung Unterschiede zu erkennen.
Friseurin M. beschreibt deutliche Unterschiede bei der Erziehung und im Sozialisierungsprozess in ihrer Familie: „Ich habe noch fünf Geschwister. Wir waren drei Mädchen und drei Buben, und das hat sich schon genau so abgegrenzt, dass die Buben mit den Autos spielten und die Mädchen mit den Puppen, so hat es schon angefangen. So ist es zu meiner Zeit gewesen. […] oder die Kleider oder das schöne Anziehen nicht? Meinen Brüdern mit den Lederhosen, denen war das ja egal. Das war mir nicht egal, oder uns Mädchen nicht, weil wenn wir ein neues Kleid gekriegt haben, dann waren wir überglücklich.“
Ärztin A. trifft eine sehr pointierte Aussage, wenn sie an ihre Erziehung denkt: „Bewusst ist mir das eigentlich nicht, dass man gesagt hätte, das tun Mädchen nicht oder so. Ich bin als Mädchen gerne geritten und habe auch draußen gespielt, mit meinem Bruder. Ich hab die Haare kurz geschnitten, dass die anderen Kinder manchmal gesagt haben „Bist du ein Bub oder ein Mädchen?“ „[…] aber es wurde schon auch irgendwie versucht zu vermitteln, dass es etwas Schönes ist, eine Frau zu sein. Aber bewusst kann ich es nicht sagen, das sind mehr so Sachen, die ich fühle.“
Obwohl sie im weiteren Verlauf des Gespräches über ihre Sozialisation nachdenkt und diese auch analysiert, betont sie wiederholt, dass sie sich bei der Beschreibung auf der Gefühlsebene befinde.
Ärztin B. ist in einer „patriarchalen Familienstruktur“ aufgewachsen, „wo immer das Weibliche auch so ein bisschen abgetan worden ist.“ Das Weibliche wurde als wichtig und lebensnotwendig betrachtet, war aber „dem Männlichen doch irgendwie untergeordnet.“ In der Erziehung wurden zwischen ihr und ihrem Bruder Unterschiede gemacht: „Es hat bei uns sehr wohl in der Erziehung Aspekte gegeben, […] dass man einen Unterschied macht in der Erziehung zwischen Burschen und Mädels, vom Spielzeug angefangen, über Arbeitsaufgaben. Es hat gewisse Arbeiten gegeben, die ich als Kind gemacht habe, die mein Bruder nicht gemacht hat, und was mich ziemlich geärgert hat.“
Als Vorbild galt die Mutter, die sie folgendermaßen beschreibt: „Ich habe von meiner Mutter, […] eine Form von Weiblichkeit vorgelebt bekommen. Sie war sehr weiblich, aber sie war sich ihrer Weiblichkeit nicht bewusst.“
Anhand einiger Beispiele erklärt sie sehr emotional, wie sich die Unterschiede bei der Erziehung ausgewirkt haben: „Zum Beispiel putzen. Irgendwas zusammenkehren oder so. Mein Bruder hat mit meinem Papa irgendwelche Sachen gebaut, oder einfach spannendere Sachen gemacht, hat einen Holzstoß zerlegt oder neu aufgebaut, und ich hab dann den Staub zwischen den Brettern weggekehrt. Und das war dann teilweise so, dass wenn irgendwo beim Sägen oder so ein Staub oder Dreck angefallen ist, und mein Bruder und ich waren dort, dann hat der Papa gesagt: „B. komm schnell und kehr das da weg! Wir brauchen dich.“ Aber mein Bruder hätte das genauso machen können. Mein Bruder ist danebengestanden und hat zugeschaut. […] Das war für Burschen zu minder. Und das hat mich als Kind unglaublich gewurmt und heißgemacht. Die Unterscheidung war die Hölle, also das war wirklich. Das habe ich einfach nicht verstanden und das habe ich ungerecht gefunden, richtig ungerecht. Oder, obwohl andrerseits wieder, ich habe zum Beispiel genauso wie mein Bruder ein Schnitzmesser gekriegt. Aber halt mein Bruder hat schon ein bisschen ein besseres Schnitzmesser gekriegt.“
Zusammenfassend stellt B. noch fest: „Es ist nicht ein bewusster Unterschied gemacht worden, aber irgendwo war er doch da. Also, es gibt sehr unausgesprochene Regeln oder Gesetze, die so doch eine klare Trennung oder Unterscheidung zwischen Burschen und Mädels gemacht haben.“
Ärztin D. beginnt mit ihrem gesamten Umfeld. Sie ist in einem kleinen Dorf mit drei Schwestern und zwei Brüdern aufgewachsen. Sie berichtet von typischen Tabus dieser Zeit: Mädchen trugen andere Kleider und es galt als extrem unweiblich, auf der Straße zu rauchen. Auch beim Ausgehen der Jugendlichen wurden deutliche Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen gemacht. Im familiären Umfeld gab es die gleichen Bildungschancen für Mädchen und Buben. Der Vater ermöglichte allen, obwohl seine Geldmittel knapp waren, die gleichen Chancen. Jede und jeder durfte lernen, was sie/er wollte.
Lehrerin C. spricht von zwei weiblichen Bezugspersonen, der Oma und ihrer Mutter. Die Oma habe ihr traditionelle Werte zu vermitteln versucht, indem sie ihre Enkelin zu allen Arbeiten im Haushalt angehalten hat. Ihr Bruder hingegen sei bei diesen Tätigkeiten verschont worden.
Bei ihrer Mutter war das anders: „Aber wenn ich an die Mama zurückdenke, die war ja immer dabei, dass sie uns ausgleicht. Also dass ich genauso zum Beispiel beim Spielzeug genauso wie mein Bruder Autos bekommen habe und nicht nur wie andere Mädels Puppen. Bei uns war das total ausgeglichen.“ Auch bei den Verhaltensweisen sieht sie keine an die Jungen gerichteten Auf- forderungen: „Bei uns hat es das auch nicht gegeben, dass ein Bub nicht weinen darf. Ich habe auch alles machen dürfen, was der Bruder gemacht hat. Es hat nicht geheißen, du darfst jetzt nicht auf den Baum hinauf, weil du ein Mädchen bist.“
Lehrerin C. unterscheidet zwischen traditioneller Erziehung, die sie der Großmutter zuschreibt und einem offenen, modernen Erziehungsstil, der von ihrer Mutter gepflegt wurde. Der Vater wird von ihr nicht explizit erwähnt.
Lehrerin G. sieht bei dieser Fragestellung vor allem jene Aspekte, die in unserer Gesellschaft zum äußeren Erscheinungsbild einer Frau gehören, und drückt das so aus: „Das war bei mir daheim ja überhaupt so mit Lippenstift, schminken oder tolle Kleidung. […] ich kann mich nicht erinnern, dass es verboten war, aber es ist überhaupt kein Wert darauf gelegt worden.“ Sie beschreibt auch, dass sie ihre „Aufklärung“ durch die Jugendzeitschrift „Bravo“ und durch Gespräche mit Gleichaltrigen bekommen habe, weil das zu Hause kein Thema gewesen sei. Sie beschreibt sich selbst bei der geschlechtlichen Entwicklung als „Spätzünderin“.
Lehrerin E. merkt an, es fehle ihr der Vergleich zu einem Bruder, sie ist mit einer Schwester aufgewachsen. Sie vergleicht ihren Berufswunsch, den sie als typisch weiblich sieht, mit dem ihrer Schwester, die lange Zeit Tischlerin werden wollte. Bei beiden wäre vom Elternhaus kein Einwand gekommen. Auch sei nie darauf geschaut worden, dass sich die Mädchen besonders weiblich kleiden oder sich sonst besonders weiblich verhalten würden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Die neun befragten Frauen beschreiben sehr unterschiedliche Aspekte in ihren Erziehungsbiografien.
Drei Frauen meinen, dass in der Erziehung kein Unterschied beim Geschlecht gemacht worden sei. Fünf Frauen waren in ihren Familien nicht mit Verboten konfrontiert, was Mädchen tun oder nicht tun dürfen.
Ich interpretiere das so, dass die Gebote und Verbote für Mädchen sehr subtil weitergegeben wurden, oder als so selbstverständlich angesehen wurden, dass sie von den Frauen nicht als solche wahrgenommen wurden und sie sich mehr daran erinnern.
Zwei Frauen erwähnten, dass bei den Arbeitsaufgaben Unterschiede zwischen ihnen und ihren Brüdern gemacht wurden, und dass sie „niedrigere“ Aufgaben bekommen hätten und es sie ärgerte.
4.12 Körperlichkeit
Da Körperlichkeit ein zentraler Punkt in der Konstruktion von Weiblichkeit ist, habe ich folgende Fragen gestellt: „Was ist Ihnen in Bezug auf Ihren Körper wichtig?“ und „Was würden Sie gerne ändern?“
Die Friseurchefin M. bedient ein gängiges Klischee, wenn sie postuliert: „Welche Frau ist schon mit ihrem Körper zufrieden. Ich habe immer gesagt, ich möchte einmal eine Frau kennenlernen, die sagt: ‚Ich bin mit mir zufrieden.’ Das gibt es nicht.“
Friseurin K. beginnt mit ihrer momentanen Situation, sie trägt eine Schiene am Knie. Das Wichtigste sei im Moment die Muskulatur am Bein wieder aufzu- bauen. Dann geht sie auf ihre Figur ein, mit der sie zufrieden scheint: „Also ich habe nie Probleme mit meiner Figur gehabt, ich habe nie gemeint, dass ich zu dick bin, oder dass ich zu wenig Busen habe. […] Ich bin eigentlich zufrieden mit mir.“
Friseurin H. denkt neben ihrer körperlichen Gesundheit und Fitness auch an die psychische Gesundheit und „kämpft“ auch dafür. Sie möchte nicht depressiv werden.
Lehrerin C. achtet darauf, dass ihr Gesamtgleichgewicht stimmt. Auch sie betont, ihr sei die Gesundheit sehr wichtig und begründet das mit einer Viruserkrankung, an der sie schon seit einem Jahr leide. Auch gepflegtes Aussehen ist ihr wichtig. Sie stellt eine enge Verbindung zwischen gepflegter Erscheinung und Vorteilen, die sich daraus ergeben, her: „Ja ist wichtig, weil man sonst gleich abgestempelt wird, wirklich. Und man hat natürlich auch irgendwie gewisse Vorteile davon. Als blonder Mensch hat man oft Vorteile, das muss ich wirklich sagen.“ Um das zu erläutern, wurde nach einem konkreten Beispiel gefragt, das sie auch parat hat: „Ja zum Beispiel bei meinem Chef von der Ferialarbeit, die ich einmal gemacht habe. Dem gefallen einfach Blonde. Ich kann alles haben von dem, […] ich glaube, ich könnte ihm auf der Nase herumtanzen. Schon allein die Tatsache, dass ich blond bin, das nützt da irgendwie. […] Und ich habe auch oft schon in Zeitungen gelesen ‚Blonde führen ein besseres Leben’ oder ‚Blonde sind fröhlicher’. Oder ich kenne eine Freundin, die würde sich nie dunkle Haare machen lassen, weil sonst schaut ihr kein Mann mehr hinterher.“ Lehrerin C. artikuliert mit ihren Aussagen sehr deutlich, was meines Erachtens unterschwellig vielfach mit gepflegtem Aus- sehen erreicht werden soll. Das Spiel mit der Wirkung nach außen braucht auch konkrete Beweise. Die Wirkung auf einen Vorgesetzten steht hier als Ersatz für die Wirkung auf Männer schlechthin.
Auch die Schulleiterin G. will gepflegt sein und eine gute Figur bewahren. Dafür tut sie auch was. Sie ernährt sich vernünftig und hält sich fit. Auch auf ihr „Outfit“ achtet sie, weil es für ihre Berufstätigkeit wichtig ist. Begründend fügt sie hinzu: „[…] in der Position als Leiterin, also ich meine da abgewrackt daherkommen, denke ich mir einfach, ich bin da doch Repräsentantin der Schule, und da soll ich schon ein bisschen ein Vorbild auch sein.“
Lehrerin E. nimmt gegenüber ihrem Körper einen Standpunkt als Betrachterin ein, indem sie sagt: „Dass ich mich wohl fühle in meinem Körper, dass ich einfach denke, dass ich die Signale, die er mir sendet, beachte.“ Mit diesen Signalen, z. B. Schmerzsignalen, geht sie behutsam um. Sie achtet darauf, ihrem Körper Gutes zu tun, ernährt sich „ordentlich“ und betreibt ein bisschen Sport. Es muss ihr auch „seelisch und gefühlsmäßig“ gut gehen und sie ist überzeugt, dass man dafür etwas tun kann und auch dafür verantwortlich ist.
Von den Ärztinnen würde ich zum Thema Gesundheit ausführliche Stellung- nahmen erwarten, sie halten sich bei dieser Fragestellung jedoch sehr zurück.
Ärztin A. fasst sehr kurz zusammen: „Dass er gesund ist, und ich versuche ihn doch einigermaßen fit zu halten und nicht zu viel zuzunehmen. Das ist mir schon wichtig. Aber ich bin auch nicht extrem und ich denke, dass ich keinen Riesenaufwand betreibe.“
Ähnlich Ärztin B.: „[…] mein Aussehen ist mir wichtig, und meine Haltung ist mir wichtig, mir ist eine gewisse Beweglichkeit wichtig, eine Fitness ist mir wichtig, schon auch so eine Attraktivität ist mir nicht unwichtig.“
Ärztin D. will gesund sein und sieht als einen Baustein das Vermeiden von „Unsinnigkeiten“, wie das Tragen von ungesunder Kleidung, rauchen und sonstigem, was sich erst als Spätschäden, wie Nierenleiden und Herzinfarkten, bemerkbar macht.
Die Aussagen lassen sich folgendermaßen kategorisieren:
Gesundheit
Für den Großteil der Frauen (2 Friseurinnen, 2 Lehrerinnen, 2 Ärztinnen) ist Gesundheit oder, falls die Gesundheit angeschlagen ist, Heilung am wichtigsten. Dabei wurden von drei Frauen Rückenprobleme, von zwei Frauen Knieprobleme und von einer Frau eine langwierige Viruserkrankung ange- geben. Bei allen drei Ärztinnen wird die Wichtigkeit einer guten Haltung betont.
Körperliche Fitness
Vier Frauen wollen fit sein. Das wird immer im Zusammenhang mit Sport gesehen. Sportlichkeit wird als Synonym für Fitness verwendet, aber nie wirklich definiert.
Gepflegtes Aussehen
Das Aussehen ist für drei Frauen wichtig, jede betont aber, es nicht zu übertreiben. Es geht darum, „halbwegs gepflegt auszuschauen“. Für die Lehrerinnen geht es auch um eine Vorbildfunktion.
Schlankheit
Drei Frauen gaben an, dass es ihnen wichtig ist, schlank zu sein. Hier gibt es eine Parallele zum Thema Aussehen - beide Themen sind den Frauen wichtig, aber mit der Betonung, nicht übermäßig wichtig.
Die Hinweise auf den Wunsch nach einer guten Figur kamen insgesamt an mehreren Stellen.
4.13 Werte und Grundprinzipien
Diese Frage „Welche Werte haben Sie in Bezug auf das Geschlechterverhältnis?“ scheint für einige Frauen sehr komplex zu sein. Eine Friseurin und eine Lehrerin sagen unumwunden, dass ihnen dazu nichts einfalle.
Friseurin H. unterteilt die von ihr gesehenen Werte in zwei Kategorien. In beruflicher Hinsicht meint sie, dass sich die Frauen heutzutage von den Männern im Berufsleben weniger einschüchtern lassen und dass sie mehr ihren „eigenen Kopf“ durchsetzen. Früher hätten sich Frauen nicht beweisen können, heute seien die Möglichkeiten sich zu behaupten wesentlich günstiger. Friseurin H.: „Vorher war das ja ganz anders. Da bist du in die Schublade gesteckt worden und das war es dann. Da hast du dich nicht mehr beweisen können, und heute sind die Möglichkeiten so: Du kannst dich beweisen, wenn du willst. Für dich selber zumindestens.“
In Bezug auf Beziehungen zu Männern sieht sie bei den jungen Mädchen in ihrer Berufsgruppe größere Werteverschiebungen zu früher: „Es ist auch oft so, wenn ich in meinem Beruf schaue, wie die Mädchen sind, die sind schon so damenhaft und überheblich, und sie sind die Besten. Sie sind nichts und geben sich dann mit Männern ab, die auf gut deutsch Arschlöcher sind. Wo du schon siehst, in den Beziehungen vor allem, der ist nicht treu, der hat noch zehn andere. Und genau die sind die Helden [...].“ Etwas resignierend merkt sie noch an: „Vielleicht ist es auch so, dass Frauen ihre eigenen Werte oft unter- schätzen, dass sie von vorhinein aufgeben, etwas zu erreichen und sich sagen, ja ich bin so verletzlich und es gibt nichts, was ich tun kann.“
Lehrerin C. beginnt mit gesellschaftlich gängigen Klischees: Männer seien für Karriere und Unterhalt der Familie zuständig, Frauen hingegen für die Familienarbeit und den Haushalt. Sie selber sehe das anders, jeder Mensch solle sich nach seinen Möglichkeiten entwickeln und sich verwirklichen. Den Grund dafür ortet sie in der Erziehung. Sie sei immer ermutigt worden, das zu machen, was sie wolle. Für ihre derzeitige Situation zeigt sie allerdings keine wirklichen Alternativen auf. Sie wolle mit Heirat und Kinder kriegen warten. Dann aber werde sie vermutlich beim Kind zuhause bleiben, weil ihr Partner wesentlich mehr verdiene, als sie in ihrem Beruf. Im Bildungsbereich regt sie an, Mädchen und Buben gleich zu fördern und Mädchen bei den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern nicht zu benachteiligen.
Lehrerin E. äußert sich nur zu einem Punkt, der das Geschlechterverhältnis belasten könne: „[...] Was ich manchmal negativ erlebe bei Abwesenheit des Partners, dass negativ geredet wird [...] und dass das eher Männer machen.“
Ärztin A. beginnt bei sich und ihrem unterschiedlichen Fokus bei der Betrachtung von Frauen und Männern: „Wenn ich eine Frau neu kennenlerne, [...] dann schaue ich auch auf die Äußerlichkeiten, was bei Frauen auch dem Klischee entspricht, und schaue, wie zieht sich jemand an, oder wie ist der zurechtgemacht. Und dann geht es oft darum, ob die ganze Person stimmig ist. Bei gewissen Frauen habe ich oft das Gefühl, sie verstellen sich oder spielen eine Rolle, die sie gar nicht sind, übertrieben mit Make-up und Haaren und Kleidern [...].“ Bei Männern fallen diese Einschätzungen nicht ganz so scharf aus.
Im Berufsleben beobachtet sie tendenziell unterschiedliche Verhaltensweisen: „Bei uns haben immer drei Leute gemeinsam Dienst, und da ist man immer bunt mit verschiedenen Leuten zusammen geworfen. Und dann ist es sehr unterschiedlich, ob man mit einer Frau und einem Mann im Team ist. Da gibt es ganz andere Themen. Unabhängig von der Person, die ja auch immer eine Rolle spielt. [...] Frauen sind kommunikativer. Und Männer, die versuchen doch dominanter zu sein. Wie es in dieser Zusammenarbeit zum Beispiel ist, dass der Mann weniger oft der Frau den Vortritt lässt, oder sich zurückstellt, wenn es um eine Entscheidung geht. Das sind so die Werte, die ich gesehen habe.“
Sehr klar drückt Ärztin B. ihre Vorstellungen aus: „Also, was mir wichtig ist, sowohl im Beruf als auch im Privatleben, oder mit Freunden [...], dass man die Menschen jetzt nicht in Mann oder Frau kategorisiert oder in die Rolle Frau oder Rolle Mann einteilt [...] oder ihn auf das reduziert, sondern wirklich das Individuum zu sehen oder die Einzigartigkeit von dieser Person unabhängig seiner geschlechtlichen Rolle oder seines Geschlechts. Andererseits, glaube ich, hab ich schon auch in meinem Denken oder in meinen Wertvorstellungen die Vorstellungen, dass gewisse Rollen, [...] von Männern und gewisse Rollen nur von Frauen übernommen werden können, oder dass sie geeigneter sind. Also ich glaube, dass die Mutterrolle letztlich ein Mann nicht übernehmen kann. Das ist eine Rolle, die einer Frau zugeordnet werden muss oder die die Frau übernimmt.“
Sie fordert von der Gesellschaft, dass die „Weiblichkeit an sich“ und die „weiblichen Eigenschaften“ wieder mehr Bedeutung bekommen. Parallel dazu beobachtet sie, dass sie sich ihrer eigenen Weiblichkeit auch erst allmählich bewusst werde.
Sie präzisiert ihre Forderung noch: „Und ich sehe das auch als Gefahr [...], dass Frauen, die sich nicht mehr den Männern unterordnen wollen, sich ihren Raum erkämpfen aber doch oft mit männlichen Eigenschaften, mit männlichen Methoden, und auf eine Art, die eigentlich nicht weiblich ist, und sich ganz stark dem männlichen Prinzip oder männlichen Verhaltensweisen anpassen, die übernehmen, und dabei wieder das Weibliche eigentlich nicht so durchkommt, worum es eigentlich gehen würde.“
Für Ärztin D. sind Mann und Frau gleich, beide sind ein Mensch. Das sei die Maxime ihrer Wertvorstellungen. Alle Menschen werden gebraucht. In der Gesellschaft werde das allerdings oft anders gesehen, räumt sie ein.
Schlussfolgerung
Viele Antworten gehen an der Fragestellung vorbei. Genannt werden weniger die eigenen Werte, sondern gesellschaftliche Ausformungen von individuellen Einstellungen.
Werte sind auf diese Art schlecht abfragbar, da sie zu wenig bewusst sind. Die Fragestellung finde ich trotzdem gut, weil die Menschen von jenen Werten sprechen, die an der Oberfläche liegen. Werte zu Geschlechterfragen sind noch einmal eine Stufe schwieriger, sie sind zum Teil wohl nicht greifbar.
Das andere Geschlecht - Neidfaktoren
Auf die Frage „Beneiden Sie Männer um etwas?“ meint Friseurin K. sie beneidet Männer um ihren Mut. Sie vermutet, Männer seien mutiger, weil sie nicht so soviel darüber nachdenken, was passieren könnte. Sie selbst denke viel zu viel an mögliche Folgen und daher lasse sie von vornherein von verschiedenen Aktionen ab. Die restlichen Friseurinnen beneiden Männer nicht oder die Aussagen, wie Männer seien konsequenter, werden sofort wieder relativiert oder zurück genommen.
Lehrerin C. beneidet Männer manchmal um ihre direkte Art Probleme zu lösen. Frauen reden lange herum, analysieren Probleme mehrmals und betrachten diese von mehreren Blickwinkeln, bevor sie sich an Lösungen heranmachen. Männer können nach ihrer Meinung auch viel besser abschalten. Ihr Lebens- partner komme nach Hause und schon ist der Arbeitstag Vergangenheit. „Ich kann das aber nicht. Ich denke noch länger darüber nach, oder reflektiere dann noch ‚Warum hab ich jetzt das so gesagt?’ oder ‚Warum hat der Schüler das gesagt?’ oder so ähnlich.“
Schulleiterin G. merkt zuerst scherzhaft an, Männer seien „standfester beim Rotweintrinken“. Sie selber habe oft schon bei kleinen Mengen Kopfschmerzen und Übelkeit. Wenn sie bei Männern Erfolge beobachte, dann sieht sie das nicht als geschlechtsspezifischen Vorteil, sondern meint, auch Frauen bzw. sie selber könnte das anstreben. Sie sieht keinen Grund, Männer zu beneiden.
Auch Lehrerin E. beneidet Männer nicht, weil sie die gleichen Probleme hätten.
Ärztin A. beneidet Männer in folgenden Punkten: „Dass sie weniger Aufwand betreiben müssen, bezüglich Kleidung und Aussehen. Es geht einfach schneller, als bei Frauen. [...] und dass man nicht so sehr auf das Aussehen reduziert ist, es nicht so wichtig ist.“ Trotzdem ist sie aber gerne Frau und möchte nicht tauschen.
Ärztin B.: „Sporadisch beneide ich sie um eine gewisse Einfachheit, dass sie Dinge einfach sehen, auch wenn sie komplex sind. Sie reduzieren auf eine Einfachheit. Darum beneide ich sie schon manchmal.“ Auch sie möchte aber kein Mann sein, weil eine Frau mehr Möglichkeiten habe und vielfältiger sei.
Ärztin D. beneidet Männer überhaupt nicht, sie hätten es auch nicht leichter als Frauen.
Das Ergebnis zusammengefasst: Sechs Frauen beneiden Männer um gar nichts, die restlichen Frauen beneiden sie um den Mut und darum, dass sie weniger nachdenken, sich weniger Sorgen machen und dass sie auch komplexe Dinge öfter auf Einfachheit reduzieren.
Das gleiche Geschlecht - Neidfaktoren
Die Antworten auf die Frage „Welche Frauen beneiden Sie um etwas?“ fallen ergiebiger aus: Die meisten Interviewten beneiden mehr Eigenschaften bei anderen Frauen als bei Männern. Das Spektrum reicht von Ehrgeiz, Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit über Schönheit und Charme bis zum Finden guter Lösungen ihres Lebensweges, Kreativität und Musikalität. Nur drei der Befragten beneiden keine anderen Frauen um etwas.
Friseurin K. beneidet Frauen nicht, aber sie bewundert Frauen wie ihre Chefin oder eine Freundin, die es geschafft haben ein eigenes Geschäft zu gründen und zu führen. Ihr selber fehle dazu der Ehrgeiz, obwohl sie das auch ganz gerne machen würde.
Friseurin H. fällt überhaupt kein Grund ein, andere Frauen zu bewundern.
Friseurin M. beneidet Frauen mit schönen Zähnen, sonst kommen keine Angaben.
Ärztin A. beneidet sehr schöne Frauen, die trotzdem natürlich bleiben. Dazu kommen noch „Frauen, die eine gute Lösung für ihren Lebensweg gefunden haben, mit all den Eckpfeilern Partnerschaft, Beruf“.
Ärztin B. zählt eine größere Liste auf: „ [...] manche Frauen beneide ich um ihr Selbstbewusstsein, um ihr Aussehen. Ich beneide immer eher Frauen als Männer um irgendetwas. Die Tendenz ist auf jeden Fall da. Manche Frauen beneide ich auch um ihr Wissen, um ihr Auftreten, aber das hat mit selbstbewusstem Auftreten zu tun, um ihre Schönheit, um ihre Fähigkeit mit Männern umzugehen, die Fähigkeit Dinge zu erreichen, die Fähigkeit sich zu kleiden, sich zu schmücken, [...]. Also, da gibt es schon manches, worum ich eine Frau beneiden kann. Oder wo ich auch eifersüchtig sein kann.“
Ärztin D. beneidet keine anderen Frauen, aber die Fähigkeit in gewissen Situationen zu delegieren, nimmt sie sich zum Vorbild.
Lehrerin C. beneidet Frauen, die „gelassen“ sind und gut abschalten können. Sie selbst mache sich oft unnötige Gedanken und Sorgen. Ein Vorbild ist ihre Mutter, die auch in Widrigkeiten noch Sinn erkennen kann.
Schulleiterin G. begeistert sich für Frauen, die Haushalt und Garten hervorragend führen und auch noch gute Gastgeberinnen sind. Vor allem imponiert ihr, wenn diese Leistungen wie „aus dem Handgelenk geschüttelt“ wirken. Außerdem beneidet sie Frauen, „die in Gesellschaft [...] eine tolle Aus- strahlung haben und sich in den Mittelpunkt setzen können oder so. Dann denke ich mir [...], das gelingt mir ja auch. Ich bin auch keine, die sich die sich in aller Stille in die Ecke stellt, sondern ich gehe auch auf die Welt zu.“
Lehrerin E. beneidet Menschen, die ein Musikinstrument gut spielen können oder eine tolle Stimme haben. Außerdem beneidet sie noch Frauen, die sich in kreativen Disziplinen gut ausdrücken und verwirklichen können.
4.14 Ziele und Wünsche
Den Abschluss der Interviews bildete die Frage: „Was würden Sie in Ihrem Leben gerne noch erreichen?“ und die etwas allgemeiner formulierte Frage: „Was soll eine Frau in ihrem Leben erreicht haben?“
Vorausschau auf mittel- und langfristige Ziele
Die Friseurin K. erzählt: „Ich will auf jeden Fall so weit kommen, dass ich sage o. k., gut [...] Ich muss nicht reich sein oder so, aber ich habe keine Probleme, ich bin abgesichert, ich brauche auch keinen Luxus oder so, aber dass ich halt einfach abgesichert leben kann, dass ich vielleicht eine Eigentumswohnung habe, oder so."
Im Gegensatz dazu möchte die Friseurin H. „viele Kleinigkeiten“ erreichen, hat aber nichts „Großes“ im Kopf. Sie strebt an, „Spaß zu haben, die Welt zu sehen, hunderttausend Kleinigkeiten. Das ist für mich mein Ziel, aber nicht etwas Großes.“
Friseurin F. gibt an: „Ja, vielleicht ein neues Auto, vielleicht ein Haus, und schön zu leben.“
Die Friseurchefin M. meint schlichtweg, sie sei mit 54 Jahren schon zu alt, um noch etwas zu erreichen. Sie begründet das ganz knapp: „Das wäre utopisch.“
Die gleich alte leitende Oberärztin D. hat sehr wohl noch Ziele: „Dass ich ein bisschen mehr von der Welt sehe. Ja, das möchte ich schon noch gerne erreichen. Aber vielleicht, wenn ich einmal in Pension bin, dass ich es mit der Medizin verbinde, ja. So, das möchte ich schon noch erreichen.“
Die Ärztin A. hat nur ein Ziel angegeben: „Eigentlich eine funktionierende Familie zu gründen. Das ist so das Wichtigste. Und nebenan arbeiten zu können.“
Ärztin B.: „Ich möchte beruflich irgendwie meinen Weg finden, meinen ganz individuellen Weg. [...] Es hat ganz stark etwas mit Selbstfindung zu tun. [...] Ich möchte meine ganz individuelle Art zu heilen, oder meine Art als Ärztin zu wirken, meine Methode oder meinen Weg oder meine Form finden.“ Etwas später fügt sie hinzu: „Ich habe das Ziel, ich möchte eine alte, weise Frau sein, bevor ich sterbe. [...] mit Würde und ich weiß nicht Stolz und Selbstbe- wusstsein.“
Obwohl Lehrerin C. auch Ziele wie eine eigene Familie und ein Haus oder eine Wohnung hat, betont sie auch, dass sie sich beruflich noch verbessern möchte. Besonders wichtig ist ihr der Aspekt der Selbstverwirklichung. „Selbstver- wirklichung steht bei mir schon im Vordergrund, und dass ich wirklich mit mir [...] selber irgendwie im Reinen bin, dass ich sage, das passt jetzt für mich. Weil zurzeit fühle ich mich nicht mit mir im Reinen, das ist kein Kreis irgendwie, das ist so ein Chaos irgendwie. Ich bin jetzt nicht unzufrieden und so mit dem, aber einfach, dass ich sage, ja das passt jetzt zu mir.“
Die Schulleiterin G. hat Ziele in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel möchte sie die Leitung der Schule noch perfektionieren, stellt aber gleichzeitig fest, dass eine perfekte Schule nicht erfüllbar ist.
Sie geht dann über in den privaten Bereich: „Ich meine, das sind so Kleinigkeiten, dass man irgendwo bei gewissen Bereichen, dass man einfach besser sein will, mehr erreichen will. Und ich habe das zum Beispiel, dass ich mir denke, ich fahr auf den Berg hinauf mit dem Rad oder so, dass das ein bisschen besser ist, aber das sind Lappalien.“ Sie begründet ihre Einstellung, indem sie weiter ausführt: „Erreichen, ich meine, man muss sich in erster Linie, [...] denken, solange ich gesund genug bin, gell, und auch meine Familien- mitglieder und die, die mir nahestehen, gell, wenn die alle gesund sind und so ein normales Leben führen, dann passt es ja eigentlich.“ „Das sind alles keine Sachen, wo ich mir denke, die sind für mich nicht so erstrebenswert, dass ich mit meinem jetzigen Leben unzufrieden wäre.“
Schließlich, nach einer kurzen Pause fällt ihr noch ein: „Ich werde irgendwann einmal natürlich hoffe ich in Pension gehen, [...] dass es mir da gut geht, und dass ich wirklich dann noch ein erfülltes Leben haben kann, mit allem Drum und Dran, ist egal, wie man das dann definiert, [...] das ist mir schon wichtig dann. Mit Mann und mit Familie und so.“
Lehrerin E. würde gerne erreichen, „dass ich eigentlich immer gute Freunde um mich herum habe. [Und] vielleicht so Fähigkeiten, oder gerade im kreativen Bereich, dass man das mehr ausbaut, dass man da etwas macht, ein bisschen mehr noch von der Welt sehen täte ich gerne. Ich meine eine funktionierende Partnerschaft wäre sicher auch etwas das man, aber, ja, sicher man kann es sich wünschen.“
Die Aussagen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Materielle Ziele
Die Friseurinnen K. und F. und die Lehrerin C. haben Ziele wie eine Eigentumswohnung, ein eigenes Haus, ein Auto und generell ein abgesichertes, schönes Leben angegeben. Besonders eigene Immobilien sind für Friseurinnen ein schwer zu erreichendes Ziel. Wie sie den Traum verwirklichen wollen, führen sie nicht aus. Für die Ärztinnen, die sich deutlich mehr leisten können, ist dies keine Thematik.
Familie
Die Ärztin A. hat nur ein Ziel angegeben, nämlich das einer funktionierenden eigenen Familie. Auch für Friseurin K. und Lehrerin C. ist eine eigene Familie sehr wichtig.
Berufliche Verbesserungen - Persönlichkeitsentwicklung
Alle Lehrerinnen und die Ärztin B. möchten sich beruflich noch verbessern. Sie möchten dabei vor allem ihren eigenen Stil finden.
Auch verschiedene Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung waren bei Lehrerinnen und Ärztinnen ein Ziel, nicht aber bei den Friseurinnen.
Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung wird immer wieder angesprochen, aber keine der befragten Frauen erklärt, was sie darunter konkret versteht. Indirekt lässt sich erkennen, dass Selbstverwirklichung teilweise als Synonym für ein freieres Leben oder Arbeiten verstanden wird, aus verschiedenen Zwängen ausbrechen, um wirklich eigene Ideen realisieren zu können. Ärztin B. drückt das am konkretesten aus, sie will „ihre Medizin“ verwirklichen.
Manche Ziele werden in die Zukunft projiziert. Nach der Pensionierung will Lehrerin G. ein erfülltes Leben führen. Hier schwingt wohl auch schon ein bisschen Angst mit, dass sich ihre Lebensqualität mit der Pensionierung verschlechtert.
Die Welt sehen
Oberärztin D. will noch Reisen machen, sieht aber erst nach ihrer Pensionierung eine realistische Chance, das zu verwirklichen. Ein Hintertürchen zum derzeitigen Beruf bleibt offen, sie will es „mit der Medizin“ verbinden. Auch die zwei Lehrerinnen geben als zukünftige Ziele an, mehr reisen zu wollen.
Allgemeine Lebensziele
Bei der Frage, was eine Frau ganz allgemein im Leben erreichen soll, waren sich alle einig, dass man das nicht verallgemeinern könne beziehungsweise, dass es für jede Frau individuell verschieden ist, was sie erreicht haben soll. Sechs Frauen meinen, das wichtigste Ziel sei, dass man mit seinem Leben glücklich ist, dass man zurückschauen und zufrieden sein kann.
Ähnlich Antworten waren, dass Frauen das erreichen sollten, was ihnen Spaß mache. Auch sollten sie in ihrem Leben zu sich selbst finden bzw. etwas aus sich machen.
Friseurin H. formuliert das so: „[...] dass sie sagen kann, ok ich habe etwas gemacht aus meinem Leben.“
Friseurin K. nennt Unabhängigkeit von einem Mann als wichtigstes Ziel. Auch Kinder sollen nicht dazu führen, von einem Mann finanziell abhängig zu sein. Sie gesteht ein, dass dieses Ziel schwierig zu erreichen sei, aber sie sieht es trotzdem als ihr Ideal.
Friseurin H. äußert sich pragmatisch. Sie misst das Ergebnis an den selbst gesteckten Zielen, schränkt aber ein, dass es machbare Ziele sein müssten:
„[...] Ja, das, was sie sich vorgestellt hat, oder zumindest die Hälfte davon. Kommt immer darauf an, wenn ich Präsident von den Vereinigten Staaten werden will, dann werde ich das wahrscheinlich nicht erreichen. Aber zumindest einen Teil, dass sie sagen kann, ich habe etwas gemacht aus meinem Leben.“
Auch Friseurin M. sieht das Erreichen von Zielen als das wichtigste Kriterium.
„Ja, das ist jetzt auch verschieden. Wenn sie […] ihre Ziele, die sie sich vorgenommen hat, erreicht hat, dann ist es in Ordnung. Dann ist es ganz egal, ob sie eine Hausfrau und Mutter ist oder eine Geschäftsfrau.“
Die Friseurin F. geht auch davon aus, dass jeder Mensch Ziele erreichen möchte, widerspricht sich aber dann, wenn sie resignierend feststellt: „Obwohl auch zum Schluss niemand zufrieden ist, [...] weil jeder möchte immer mehr und mehr, auch zum Beispiel die Reichen.“ So entwickelt sich bei ihr die Aussage, dass es eigentlich um Zufriedenheit gehe.
Lehrerin C. beginnt mit dem Wunsch vieler Frauen, Kinder zu bekommen. Sie zitiert ein Beispiel:
„Ich habe eine Freundin, die wollte am liebsten schon mit 18 Jahren ein Kind haben und eine Familie haben, aber sie weiß halt, dass das noch nicht geht, weil sie ja noch arbeiten soll. Aber wenn die irgendeinen Freund dazu gehabt hätte, der gesagt hätte, ja machen wir das, dann wäre sie sofort dabei ge- wesen.“
Von diesem Beispiel ausgehend entwickelt sie den Gedanken, dass Kinder sehr wohl eine Zielvorstellung für viele Frauen seien. Sie selbst möchte ebenfalls Mutter werden, aber es sei genauso gut denkbar, dass sich Frauen für Karriere und gegen Kinder entscheiden. Wenn sie als alte Frau auf ihr Leben zurückblicke, möchte sie auch ein Kind heranwachsen gesehen haben. Sie sieht aber in Kindern keine Altersversorgung und erwartet nicht, dass sie ihre Kinder einmal pflegen würden, wenn sie pflegebedürftig sei. Nach diesen etwas längeren Ausführungen fasst sie noch einmal zusammen: „Eine Frau sollte erreichen, dass sie einfach zufrieden ist, für mich gibt es sonst kein Ideal.“
Lehrerin G. drückt das mit einem Leitsatz aus, der in ihrem Leben von Bedeutung ist: „Ich glaube, das kann man eigentlich nur so definieren, [...] dass man dann sagt, ich bin mit meinem Leben, so wie es gewesen ist, zufrieden.“
Sie selbst fühlt sich in einer privilegierten Position, weil sie ein ausgefülltes Berufsleben hat und erklärt: „ […] und wo ich mir einfach denke, wenn Frauen nichts haben als ihre Familie, dann Kinder groß ziehen, dann vielleicht irgendwo […] putzen gehen und dann, wenn der Mann in Pension geht, haben sie einen Mann daheim, betreuen den. Und eigentlich was dann, wenn man wirklich sagen muss, war das jetzt alles? […] Ich denke einfach, wenn ich das wirklich sagen kann, mein Leben hat gepasst, das war in Ordnung, dass das das Wichtigste ist.“
G. drückt hier deutlich aus, dass sie als Hausfrau ohne erfüllendes Berufsleben nicht zufrieden wäre.
Lehrerin E. antwortet: „Ich denke mir, dass sie eine ordentliche Schulbildung hat, dass sie das lernen hat können, oder beruflich das tun hat können, was sie wollte. Dass sie, wenn sie Familie haben wollte, dass sie sie hat haben können […] Und ja, dass man sein Leben leben kann, wie man will, dass man seine Entscheidungen, wenn sie niemandem anderen schaden, so fällen kann, wie man will und dass man glücklich ist mit seinem privaten und ah beruflichen Leben. Dass man sich nicht denken muss, das habe ich versäumt, das war mir nicht möglich, das hätte ich noch gerne gemacht.“
Ihre Grundaussage kann man gut in einem Satz zusammenfassen: Man sollte im Leben erreicht haben, so zu leben, wie man es gerne möchte, ohne anderen zu schaden.
Ärztin A. skizziert ihre Antwort wie ein Rezept, das für mehrere Frauen ihres Berufsstandes gelten könnte: „Glücklich zu sein, das zu tun, was ihr Spaß macht. Ich kenne auch einige Kolleginnen, die sagen, ich will keine Familie haben, ich will auch nicht eine Riesenkarriere machen. Ich will einfach sonst viel Sachen unternehmen im Leben. Und die sehe ich jetzt nicht als weniger weiblich an, als die, die jetzt schon Kinder haben wollen. Ich denke, da hat man als Frau doch die Wahl heutzutage, man kann ja auch selbstständig sein. Deshalb finde ich, wenn jemand glücklich ist in seinem Leben, dann hat er das Beste erreicht.“ Im letzten Satz hebt sie noch einmal hervor, was ihr besonders wichtig erscheint.
Auch Ärztin B. geht präzise auf die gestellte Frage ein und formuliert allgemein:
„Ich glaube, das wichtigste ist, dass sie zu sich findet, dass jede Frau einfach sich und ihre Qualitäten und ihr ihren Reichtum, ihre Einzigartigkeit entdeckt. Also für mich gibt es nicht, jede Frau muss einmal ein Kind bekommen haben, oder jede Frau muss beruflich Erfolg haben, oder jede Frau muss einmal eine funktionierende Beziehung haben, das sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegen- teil es soll jede Frau ihre Einzigartigkeit entdecken und eine Form finden, wie sie diese auch leben kann.“
Ärztin D. bezieht sich mit ihrer Grundaussage auf beide Geschlechter: „Ob Frau oder Mann, ein zufriedenes Dasein. […] Man muss zufrieden sein, […] egal was man tut. […] Also weder das akademische Studium noch irgendwelche wirtschaftlichen Großereignisse, […] aber zufrieden mit dem, was man hat und was man erreicht. Und auch immer noch Träume zu haben, das ist wichtig.“
Was zunächst etwas verwirrend klingt, erklärt sie mit einem Beispiel: Ob ein Mensch einen von der Gesellschaft sehr geachteten Beruf ausübt, wie z. B. Ärztin, oder einen weniger geachteten, wie z. B. Reinigungsfrau, spielt für sie eine untergeordnete Rolle, wenn der jeweilige Mensch zufrieden ist. Sie geht aber nicht darauf ein, ob die Zufriedenheit eines Menschen mit einem bestimmten Beruf leichter zu erreichen ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Die Zufriedenheit mit sich selbst wird bei den befragten Frauen als Maßstab genommen, um das zu bewerten, was man erreicht hat. Es folgen bei einigen Frauen Erklärungen, die stark relativieren, z. B. will Lehrerin C. ein Kind heranwachsen gesehen haben, wenn sie als alte Frau auf ihr Leben zurückblickt. Man fragt sich unwillkürlich, sollte sie das nicht erleben dürfen, wird sie dann zufrieden sein?
Für die Friseurinnen spielen selbst gesetzte Ziele eine große Rolle. Werden sie erreicht, stellt sich Zufriedenheit ein. Die Ziele sollten aber „realistisch“ sein.
Alle Aussagen stehen in einem starken Gegensatz zu dem, wie Menschen in unserer Gesellschaft agieren. Kaum jemand ist mit seinem Aussehen zufrieden, viele Menschen helfen mit künstlichen Mitteln bis hin zu Schönheitsoperationen nach, um mit ihrem Aussehen zufriedener zu werden. Die Konsumgesellschaft lebt von der „Unzufriedenheit“, um Konsumgüter, die noch gut brauchbar wären, durch neue, bessere zu ersetzen.
Zufriedenheit wird in den Interviews als Idealbild gesehen und zeigt einen Zustand an, der über die derzeitige Situation hinausweist.
5. Theoretische Reflexion der empirischen Ergebnisse
Bei meiner Recherche bin ich auf drei Forschungsansätze gestoßen, die unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten bieten. Im Folgenden möchte ich diese Ansätze kurz vorstellen.
5.1 „Geschlecht“ als „letzte Ressource“
Der Sozialpädagoge Lothar Böhnisch und die Soziologin Heide Funk beziehen sich auf das Konzept der Individualisierung. Die Frau ist beruflich gleich- berechtigt und akzeptiert, der Mann tritt mit weniger männlicher Überlegenheit auf. Die Lebensplanung hängt also nicht mehr so sehr vom Geschlecht ab, da Männer und Frauen das Gleiche erreichen können. Die geschlechtstypische Sozialisation und die geschlechterhierarchische Arbeitsteilung treten in den Hintergrund. Sie beschreiben das als das allgemeine Bild in unserer Ge- sellschaft, das aber im Gegensatz zu traditionellem Geschlechterverhalten steht.
Besonders in sozialen Randzonen sieht man aber traditionelles Geschlechterverhalten. Das eher auf die Familie bezogene Frausein und die eher auf die öffentliche Sphäre bezogene männliche Rolle sind nach Böhnisch und Funk das Einzige, über das sozial benachteiligte Menschen noch selbst verfügen können.
In mittleren Schichten tauchen die traditionell ausgelebten Geschlechterrollen dann auf, wenn kritische Lebensereignisse oder Konstellationen verarbeitet werden müssen. Dadurch, dass diese Menschen so auf sich selbst zurückgeworfen werden und hilflos sind, kommt das Geschlecht aus seiner Tiefendynamik hervor und beeinflusst das Bewältigungsverhalten. Die Haupt- these dazu von Böhnisch und Funk: „Geschlechterhierarchie und Geschlechter- differenz [sind] kein gesellschaftsleitendes Ordnungsschema mehr, wirken aber als je privates Bewältigungsschema weiter.“ (Böhnisch/Funk, 2002, 50)
Die ökonomisch-technologische Entwicklung übt Druck auf Männer und Frauen aus. Frauen geraten unter Druck, wenn sie Arbeit und Familie vereinbaren wollen. Männer wollen sich zwar mehr an der Familie beteiligen, sie geraten aber von Arbeitsverhältnissen, in denen sie intensiver verfügbar gehalten werden, immer mehr unter Druck und entfernen sich so weiter von der Familie.
Menschen, die in kritischen Lebenssituationen existenzieller Hilflosigkeit ausgesetzt sind, greifen unbewusst zu geschlechtstypischen Mechanismen. Männer spalten ihre Hilflosigkeit eher nach außen ab, rationalisieren sie und suchen Gründe, die nicht in ihrem Handlungsspielraum liegen. Sie projizieren ihre Hilflosigkeit eher auf Schwächere und begehen Delikte, die aggressiv und nach außen gerichtet sind. Frauen spalten die Hilflosigkeit eher nach innen ab. Das kann sich in Autoaggressivität, Schuldübernahme, Selbsthass, Selbstkontrolle und Zurücknahme der eigenen Interessen ausdrücken. (vgl. Böhnisch/Funk, 2002, 51f)
Da ich bei meinen Interviews keine Frauen in wirklichen Krisensituationen hatte, habe ich hierzu keine klaren Beispiele.
5.2 Ehe- und Familienmodelle, Arbeitsteilung und die Idee der Gleichheit
Bei dem Soziologen Jean-Claude Kaufmann geht es prinzipiell um Aufteilung der Haushaltsarbeit, ein Bereich des Lebens, den ich in meinen Interviews auch kurz gestreift habe. Viele Forschungen finden heraus, dass Frauen in einer Beziehung trotz Emanzipation und Gleichstellung immer noch wesentlich mehr Hausarbeit machen als Männer. Geschirr spülen, einkaufen, kochen und Müll wegbringen sind die Arbeiten, die häufiger gerecht aufgeteilt werden. Am unmännlichsten hingegen sind alle Arbeiten, die mit Wäsche zu tun haben.
„Waschen, Bügeln, das Annähen von Knöpfen und die Reinigung der Sanitäranlagen sind Arbeiten, die in mehr als 90 % der Fälle vorwiegend von Frauen verrichtet werden.“ (Kaufmann, 2005, 177f)
Im deutschsprachigen Bereich allerdings wird ein Ehe- und Familienmodell als ideal gesehen, in dem beide Ehepartner einen erfüllenden Beruf haben und sich die Haushaltsarbeiten gleichermaßen teilen. Dies ist für uns eine ganz selbstverständliche Idee, insofern, dass zum Beispiel keiner sagen würde „Frauen sind zum Arbeiten da und sollten mehr arbeiten als Männer.“ Modelle in denen Frauen sich weniger selbst verwirklichen können, oder daheim die Hausarbeit erledigen gelten als altmodisch. Trotzdem wird diese Idee im Großteil der Haushalte aber nicht umgesetzt. So entsteht ein Dilemma, in dem sich die einzelnen Paare bei Kaufmann gezwungen sehen, sich zu rechtfertigen und die Sache zu erklären. Besonders die Männer, die daheim nicht mithelfen, fühlen sich schuldig und versuchen sich zu verteidigen. Ihre Frauen, die den gesamten Haushalt alleine machen, fühlen sich genauso schuldig, da sie aus ihrer Rolle nicht aussteigen können und nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen. Auch sie versuchen zu erklären und nehmen die Männer in Schutz. (vgl. Kaufmann, 2005, 175f)
Besonders gut zu beobachten ist dieses Verhalten bei Friseurin F., die neben ihrem Vollzeitjob den kompletten Haushalt mit 2 kleinen Kindern führt. Sie meint lachend, sie würde halt ihre Familie nach Strich und Faden verwöhnen, so als ob das Ganze ihre alleinige Schuld sei. Dann fügt sie mildernd hinzu: „Sonst ist er ein sehr feiner Mann. [...] Ja einmal im Monat macht er etwas (lacht) als Trost.“
Weiters beschreibt Kaufmann, wie die Männer, die sich an häuslichen Aufgaben beteiligen, stolz von ihren Tätigkeiten berichten und diese aufbauschen und auch die Frauen Stolz zeigen einen solchen Partner zu haben. (ebda.)
Die Lehrerin C. beschreibt, dass sich in ihrer Familie sie und die Mutter die Hausarbeit und die Pflege der Großmutter teilen. Ihr Bruder helfe nur hie und da, indem er das Auto putze oder Holz in die Wohnung trage. Diese kleinen Haushaltsarbeiten werden in der Familie besonders hervorgehoben. In Bezug auf ihren Partner meint sie strahlend, dass der, wenn sie erst zusammenziehen würden, ihr sicher im Haushalt helfen werde. Alleine die Formulierung „er wird mir helfen“ weist eigentlich auf eine ungleiche Verteilung hin.
Die Idee und die Realität der ungleich aufgeteilten Haushaltspraxis scheinen also zwei verschiedene, getrennte Ebenen zu sein. Wenn man diese als eine Handlungs- und eine Denkebene separat betrachtet, werden die Widersprüche leichter verständlich. (vgl. Kaufmann, 2005, 178)
Bei manchen Interviewpartnerinnen war sichtbar, wie schwer diese zwei Ebenen vereinbar sind und wie Frauen mit diesen inneren Widersprüchen umzugehen versuchen. So erklärt Ärztin B.: „Nein, ich war eigentlich oft nicht glücklich damit. Also ich hätte mir schon oft gewünscht, dass es wirklich genau gleich ist, dass es ganz ausgewogen ist.“ und schwächt im nächsten Satz dann ab: „Wobei ich auch sagen muss, dass ich dann konkrete Vorstellungen gehabt hätte, die er wahrscheinlich nicht erfüllen hätte können. Also ich hätte dann auch ungern von meinen Idealvorstellungen Abstriche gemacht.“
5.3 Ehe- und Familienmodelle - Ausformungen in verschieden Milieus
Die Soziologen Cornelia Koppetsch und Günter Burkart sind der Meinung, dass Geschlechternormen sehr wohl noch in Paarbeziehungen eingreifen. Die Art und Weise wie diese in unserer Gesellschaft wirken, hat sich allerdings geändert. Im Gegensatz zu Kaufmann argumentieren sie, dass die Idealvor- stellung einer „guten Ehe“ milieuabhängig ist. Für das Gelingen einer guten Partnerschaft spielen die Möglichkeiten die Berufs- und Familienarbeit zu verändern eine wichtige Rolle.
In einer Studie, in der 27 unterschiedliche Paare interviewt wurden, gingen Koppetsch und Burkart der Forschungsfrage „Auf welche Weise sind Geschlechternormen in Paarbeziehungen unter den veränderten Bedingungen noch wirksam?“ nach. Durch die Analyse des empirischen Materials kamen sie auf folgende Milieustruktur und Beschreibung der drei idealtypischen Milieus. (vgl. Koppetsch, Burkart, 2008, 2ff)
Traditionales Milieu: Dieses Milieu ist typisch für die Arbeiterschicht. Die Geschlechter sind hierarchisch angeordnet. Die Leitvorstellungen der Menschen sind patriarchalisch, was aber nicht auf einzelne Individuen direkt bezogen ist, sondern eine Geschlechtsrolle ist. Das äußerlich sichtbare Verhalten ist sehr wichtig, besonders die Männer sollen Prestige und Männlichkeit darstellen. Dies wird einerseits durch körperliche und symbolische Ausdrucksweisen vermittelt, andererseits durch Rituale. Ein Beispiel hierfür wäre die Bestimmung über das allgemeingültige Fernsehprogramm für die ganze Familie. Der Mann ist der Alleinherrscher über die Fernbedienung, er ist für das Einschalten und die Programmwahl zuständig. Im Vergleich ist im individualisierten Milieu eher die reflexive Diskussion Ausdrucksmittel. Es herrscht mehr Autonomie der Partner als im familistischen Milieu, aber es geht dabei nicht so sehr um Selbstverwirklichung als um Sphärentrennung zwischen den Geschlechtern. Jeder ist seinem eigenen Bereich zugeordnet. Verwandt- schaftliche Netzwerke spielen eine größere Rolle als in den anderen Milieus, allerdings geht es auch hier eher um Unterstützung der jeweils gleichgeschlechtlichen Familienangehörigen.
Familistisches Milieu: Im Mittelpunkt steht hier die Familie, die gegenüber der Gesellschaft abgegrenzt wird. In den Partnerschaften sollen beide Partner einen Teil ihrer Autonomie für die Familie aufgeben. Die unterschiedlichen Wirklichkeitsentwürfe der Partner werden zu einem gemeinsamen ver- schmolzen. Mann und Frau werden als gleichwertig gesehen, sind aber nicht gleichartig, sondern ergänzen sich. Ein Beispiel wäre hier die weibliche Emotionalität im Gegensatz zur männlichen Rationalität. Die Frau ist die Spezialistin für die Erziehungsarbeit mit den Kindern und für die Gestaltung der angenehmen Familienatmosphäre. Das heißt also, dass die Kindererziehung und die Haushaltsarbeit als sehr wertvoll angesehen werden und den Status der Frau aufwerten. In den anderen zwei Milieus werden diese Aufgaben eher als lästig angesehen. Kommuniziert wird viel über Gefühle und die Atmosphäre.
Individualisiertes Milieu: In diesem Milieu sind Personen mit höherer Bildung und besonderem Interesse an Selbstverwirklichung. In den Partnerschaften werden die Menschen individualisiert und egalitär angesehen, was zu einem Abbau an rollenmäßigen Vorregulierungen und einer besonderen Orientierung an den individuellen Bedürfnissen und Interessen jedes Einzelnen führt. Wichtig sind auch Kontakte außerhalb der Partnerschaft. Für die Gemeinsamkeit soll möglichst keiner der Partner etwas aufgeben, sie soll vielmehr durch gleiche Interessen entstehen, oder auch durch das partnerschaftliche Aushandeln von Kompromissen. Bei der Arbeit im Haushalt kann es dabei leicht zu Konflikten kommen. (vgl. Koppetsch, Burkart, 1999, 16ff)
Es gibt in diesen Milieus Abweichungen, hier wird nur der jeweilige Idealtypus beschrieben. Mischungen entstehen, wenn Menschen aus unterschiedlichen Milieus eine Partnerschaft eingehen.
In den Milieus sind die Partnerschaftsideale sehr unterschiedlich - nicht in allen ist der Gleichheitsgedanke der Geschlechter ein Vorteil für die Frauen. Bei Koppetsch und Burkart geht es um die Wirksamkeit latenter Geschlechter- normen im Milieuvergleich - also ein etwas anderer Schwerpunkt als bei meiner Arbeit. Weiblichkeit wird aber entscheidend geprägt durch die geschlechtlichen Rollen. In der Beschreibung der drei Milieus habe ich die von mir interviewten Frauen sehr gut wieder erkannt, besonders die Art der Weiblichkeit, die in dem jeweiligen Rollenideal vorherrscht.
Ein sehr markantes Beispiel aus meinen eigenen Interviews ist die Friseurin F. Indem sie die Hausarbeit und die Kindererziehung alleine erledigt, bekommt sie einen eigenen, getrennten Machtbereich. Sie erspart sich erschwerende Diskussionen und erhält Anerkennung und infolgedessen auch Unterstützung von anderen Frauen in ihrem Umfeld. Obwohl sie milieukonform handelt, fühlt sie sich im Interview genötigt ihr Verhalten zu rechtfertigen und ihren Mann in Schutz zu nehmen, so wie Kaufmann es beschreibt.
Ein weiteres Beispiel aus meinen Interviews betrifft den persönlichen Freiraum. Die jungen Friseurinnen aus dem traditionalen Milieu betonen zum Beispiel, dass sie ihre Freiheit, ihre Hobbys und Interessen behalten wollen. In ihrem Milieu scheint das nicht selbstverständlich zu sein. Für die Frauen aus dem familistischen und dem individualistischen Milieu ist das hingegen kein angesprochenes Thema. Sie finden ein gutes Gesprächsklima, ähnliche Interessen und Wertanschauungen wichtig.
Zusammenfassung
Kaufmann beschreibt auf Basis empirischer Studien die Problematik des gesellschaftlichen Ideals der Gleichberechtigung, das er für alle Männer und Frauen erstrebenswert hält. Dieses Ideal wird aber nur selten realisiert.
Koppetsch und Burkart hingegen haben Milieus nachgezeichnet, in denen eine klare, traditionelle Rollenverteilung für die Frauen Vorteile bietet.
Bönisch und Funk beurteilen Geschlechterrollen als letzte Ressource im Kampf um Anerkennung und der Möglichkeit der persönlichen Problembewältigung.
Alle drei Thesen, die aus empirischen Studien generiert wurden, können durch die Empirie meiner Studien belegt werden.
Die oben genannten Arbeiten haben mich beim Durcharbeiten angeregt, Passagen der Interviews zu reflektieren und sie in einen breiteren Kontext zu bringen.
6. Resümee und Ausblick
Interviews im Rückblick
Obwohl die interviewten Frauen unterschiedlichen Milieus angehören, scheinen bei der vergleichenden Interviewauswertung auf den ersten Blick sehr ähnliche Ideale und Wertvorstellungen zu bestehen.
Unterschiede lassen sich dennoch beschreiben, wenn man die Lebensstilkonzepte der Befragten näher betrachtet.
Große Unterschiede gibt es bei der Verwendung der Sprache. Der restringierte Code, den die Friseurinnen verwenden, steht dem größeren Wortschatz der Ärztinnen und Lehrerinnen gegenüber. Die Friseurinnen hatten Schwierigkeiten mit der Fragestellung, diese musste zum Teil geändert werden. Den befragten Ärztinnen fiel es am leichtesten, ihre Antworten über ihre eigene Sichtweise auf eine Metaebene zu bringen.
Geht es um Paarbeziehungen, ist den Ärztinnen vor allem die „Gesprächskultur” wichtig. Bei der Aufteilung der Aufgaben, z. B. im Haushalt, gilt es nach den Grundsätzen von Gleichberechtigung und Arbeitsteilung zu handeln.
Die Friseurinnen erwähnen dies hingegen nicht. Ihnen ist es wichtig, einen Partner zu haben, der sie nicht einschränkt, sie respektiert und ihnen ihren Freiraum bei der Gestaltung von Haushalt und Freizeit lässt. Von den Lehrerinnen und Ärztinnen wird dieser Punkt nicht hervorgehoben.
Bei der Freizeitgestaltung wird von allen Befragten Sport als wichtiger Teil erwähnt. Für die Lehrerinnen und die Ärztinnen ist auch ein Teilhaben am kulturellen Leben, wie z. B. Theater- und Museumsbesuche, wichtig; bei den Friseurinnen hingegen nicht. Dies lässt sich wieder auf den Hauptunterschied zwischen den Milieus zurückführen, nämlich auf unterschiedliche Bildungs- niveaus.
Befragt nach konkreten Lebenszielen werden bei Ärztinnen und Lehrerinnen berufliche Weiterentwicklung und harmonische Lebensführung und Ähnliches genannt; materielle Wünsche werden weniger in Betracht gezogen. Friseur- innen wollen eher „viele Kleinigkeiten“ aber auch konkrete materielle Güter, wie z. B. ein neues Auto erreichen.
Gestützt durch zahlreiche Detailbeobachtungen lassen sich viele Unterschiede zwischen den Milieus durch unterschiedliche Bildungsniveaus erklären.
Schwierigkeiten mit der Thematik
Zum Thema Weiblichkeit hatten sich die Interviewpartnerinnen zuvor wenig Gedanken gemacht. Es fiel ihnen schwer, die Fragen, die sich direkt auf ihr „Frau sein“ bezogen, zu beantworten. Die Ärztinnen fanden hier etwas leichter Antworten. Zum einen hatten sie sich vermutlich schon eher Gedanken zum Thema Weiblichkeit gemacht, zum anderen können sie durch den intellektuellen Zugang die Fragen „spontaner“ beantworten. Die Beispiele, die sie geben, beziehen sich mehr auf das Thema.
Es gab bei den Interviews einige Passagen, die sowohl für die Befragten aber auch für mich als Interviewerin schwierig zu überbrücken waren. Wurde nach Prinzipien und Werten gefragt, taten sich vor allem die Friseurinnen sehr schwer. Für weitere Interviews würde ich mehrere Impulse vorbereiten. Vielleicht würde eine Auswahl an Begriffen und Beispielen weiterhelfen. Auch würde sich das Abfragen von Szenen anbieten.
Es scheint zum Teil so zu sein, dass das „Frausein“ getrennt von der eigenen Persönlichkeit gesehen wird. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre die gesteigerte Individualisierung in der Gesellschaft. Es geht weniger um „männlich“ und „weiblich“ als um die Unterschiede zwischen einzelnen Personen. Ein Beispiel von Friseurin H.: „Ich weiß, was ich für ein Mensch bin, o.k. darüber könnte ich reden. Was für mich jetzt das bedeutet eine Frau zu sein, ist für mich eine zu umschweifende Frage, wirklich.“ An einer anderen Stelle lautet die Aussage: „Ich sehe das nicht als männlich / weiblich, sondern was für ein Mensch…“
Ich konnte bei den Interviews wenige Unterschiede bei der Darstellung von Weiblichkeit feststellen.
Weiblichkeit ist für viele gefühlt und nur schwer in Worte zu fassen. Es scheint ein strukturelles Problem zu sein. Das zeigte sich bei den Interviews ganz deutlich.
Als sehr interessant empfand ich, dass fast alle Interviewten von sich behaupteten, gerne eine Frau zu sein. Diese Aussagen kamen von mehreren Frauen, ohne dass sie danach befragt worden wären. Es scheint so, dass sie damit ein Gegengewicht zu den erfahrenen Nachteilen und Ungerechtigkeiten schaffen wollten.
An anderen Stellen bekennen sich die Befragten dazu, dass es auch Nachteile hätte, eine Frau zu sein. Meistens wurden dazu passende Ereignisse erzählt. Als Beispiel möchte ich eine junge Ärztin A. zu Wort kommen lassen: „Es gibt die Situation bei uns im Spital, dass viele Leute immer noch Schwierigkeiten haben sich das vorzustellen, dass irgendwie eine Frau eine leitende Position hat. Und wenn man zum Beispiel als Ärztin mit einem Medizinstudenten in das Zimmer geht, dann sagen alle „Guten Tag, Herr Doktor“ und „Schwester geben Sie mir bitte den Nachttopf“. […] Dort merke ich doch, dass es mich ärgert.“
Die Interpretationen des aufgezeichneten Materials nahm ich sehr behutsam vor. Man hätte gewiss noch mehr interpretieren können, bei Zweifeln nahm ich aber lieber Abstand, um Überinterpretationen vorzubeugen.
Ausblick
Die Thematik der vorliegenden Arbeit bringt es mit sich, dass sich am Schluss mehr Fragen auftun als am Beginn der Arbeit.
Es stellt sich die Frage, ob die Aussagen wesentlich treffsicherer ausgefallen wären, wenn pro Milieugruppe die Anzahl der Interviews erhöht worden wäre. Wünschenswert erscheint mir auch, weitere Berufsgruppen im jeweiligen Milieu hinzuzunehmen.
Einige ganz konkrete Fragen, die sich mir jetzt aufdrängen, möchte ich auflisten, ohne dadurch eine Wertung nach Wichtigkeit vorzunehmen:
Welchen Einfluss hat die Berufstätigkeit der Frauen auf deren Einstellung zu Weiblichkeit? Kann ein signifikanter Unterschied beschrieben werden, wenn die Frauen ihre Berufe nicht mehr ausüben und als Hausfrauen für Kinder und Haushalt zuständig sind? Ändern sich Haltungen und Einstellungen, wenn die Frauen am Beginn einer Partnerschaft stehen bzw. nach mindesten 10 Jahren Ehe? Könnte man auch nach Lebensalter kategorisieren? Gibt es Unterschiede zwischen geschiedenen Frauen und solchen, die in einer Ehe leben. Wie beeinflussen eigene Kinder die Einstellungen zu Weiblichkeit? Wären die Aussagen wesentlich klarer, wenn die qualitativen Interviews durch quantitative ergänzt worden wären?
Die vorliegende Arbeit ist mein erster Versuch mit qualitativen Interviews Weiblichkeitskonzepte zu beschreiben. Ich betrachte die Interviewführung als wichtigsten Teil meiner Arbeit. Das Ergebnis könnte als Basis für weitere Interviews dienen.
Literaturverzeichnis
Verwendete Literatur
Behnke, C./ Loos, P./ Meuser M.: Habitualisierte Männlichkeit. Existentielle Hintergründe kollektiver Orientierungen von Männern. In: Bohnsack et al: Biographieforschung und Kulturanalyse. Transdisziplinäre Zugänge qualitativer Forschung. Verlag Leske + Budrich, Opladen1998
Böhnisch, Lothar; Funk, Heide: Soziale Arbeit und Geschlecht. Theoretische und praktische Orientierungen. Juventa Verlag, Weinheim und München, 2002
Bourdieu, Pierre: Ökonomische, kulturelles und soziales Kapital. In: Baumgart Franzjörg (Hrsg.): Theorien der Sozialisation. Klinkhardt, Regensburg, 2000
Bourdieu, Pierre: Die männliche Herrschaft. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 2005
Burzan, Nicole: Soziale Ungleichtheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2007
Connell, Robert W.: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006
Eckes, Thomas: Geschlechterstereotpe: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Becker et al (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004
Hartmann, Peter: Lebensstilgruppe und Milieu. In: Endruweit, Günter; Trommsdorff, Gisela (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie, Lucius und Lucius, Stuttgart, 2002
Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1994
Knapp, Gudrun-Axeli: Achsen der Differenz: Was verbindet Frauen, was trennt sie? In: Vogel, Ulrike (Hrsg.): Was ist weiblich - was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den Sozialwissenschaften. Kleine Verlag. Bielefeld. 2005
Koppetsch, Cornelia; Burkart, Günter: Die Illusion der Emanzipation, Zur Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2008
Koppetsch, Cornelia: Milieu und Geschlecht. Eine kontextspezifische Perspektive. In: Weiß et al (Hrsg.): Klasse und Klassifikaion. Die symbolische Dimension sozialer Ungleichheit. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2001
Krais, Beate; Gebauer Gunter: Habitus. Transcript Verlag, Bielefeld, 2002
Kroll, Renate (Hrsg.): Metzler Lexikon Gender Studies / Geschlechterforschung. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, 2002
Richter, Rudolf: Österreichische Lebensstile. Lit Verlag GmbH, Wien, 2006
Strauss, Anselm; Corbin Juliet: Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Psychologie Verlags Union, Weinheim, 1996
Verwendete Internetdokumente
Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch (Leipzig: S. Hirzel 1854- 1960. -
Quellenverzeichnis 1971). Trier, 2007.
http://germazope.uni- trier.de/Projects/WBB/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GW12313&mod e=linking [Stand 14.10.2009]
Sinus Sociovision: Informationen zu den Sinus Milieu. 2009 http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/informationen_2009_0 1.pdf [Stand 14.10.2009]
Sinus Sociovision: Die Zielgruppe Bürgerliche Mitte. 2003 http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/sm_buem.pdf [Stand 14.10.2009]
Sinus Sociovision: Die Zielgruppe Postmaterielle. 2002 http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/sm_POM.pdf [Stand 14.10.2009]
Sinus Sociovision: Die Zielgruppe Konsum-Materialisten. 2002 http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/sm_mat.pdf [Stand 14.10.2009]
Verwendete Abbildungen
Abbildung 1
Sinus Sociovison: Navigationssystem Österreich.
http://www.sociovision.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/microm_navigationssy stem_a.pdf [Stand 14.10.2009]
- Arbeit zitieren
- Anira Ivo (Autor:in), 2009, Weiblichkeitskonzepte von Frauen aus unterschiedlichen sozialen Milieus Österreichs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151280
Kostenlos Autor werden



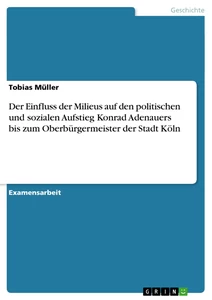


















Kommentare