Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Rahmenbedingungen
2.1 Formen der Ungleichheit
2.2 Segregationsforschung
2.3 Medizinsoziologie
2.4 Medizinische Versorgungslage
2.4.1 Das deutsche Gesundheitssystem
2.4.2 Die ambulante Versorgung
2.4.3 Die Bedarfsplanung
2.4.4 Vergütung und Standortwahl
2.4.5 Medizinische Versorgungsforschung
2.4.6 Das Akteursnetz
2.5 Hypothesen
2.6 Das Untersuchungsgebiet
3. Methodik und Datenbasis
3.1 Datengrundlage
3.2 Variablen
3.3 Datenaufbereitung
3.4 Methodische Vorgehensweise
3.5 Das Logitmodell
3.6 Methodenkritik
4. Untersuchungsergebnisse
4.1 Deskriptive Auswertung
4.2 Bivariate Analyse - Prüfung von H1
4.3 Bivariate Analyse - Prüfung von H2
4.4 Einfache multivariate Analyse - Prüfung von H3
4.5 Logistische Regressionsanalyse - Einbezug der Kontrollvariable
4.6 Prüfung von H4
4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
5. Fazit und Ausblick
Literatur
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
Die immer stärker wachsende sozialräumliche Ungleichheit in vielen deutschen Großstädten stellt sich sowohl für die Stadt- und Kommunalpolitik als auch für Teile der Stadtbevölkerung als ernsthaftes Problem dar (Friedrichs/Triemer 2009). Grund hierfür ist der zunehmende Verarmungsprozess im städtischen Raum. Bedingt durch den wirtschaftlichen Strukturwandel ist die Zahl der Arbeitslosen und Transfergeldbezieher in den letzten Jahrzehnten immens gestiegen (Friedrichs/Blasius 2000: 9). Im Februar 2005 wurden 5,29 Mio. Arbeitslose (14,1%) und damit die höchste jemals gemessene Arbeitslosenzahl seit der Wiedervereini- gung ermittelt (3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008). Mit der Arbeitslosigkeit und dem Bezug von staatlichen Transferleistungen steigt das Armutsrisiko deutlich an. Ausländer und Migranten sind hiervon in besonderem Maße betroffen. Das Risiko der Einkommensarmut ist bei ausländischen Mitbürgern fast dreimal so hoch (3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008).1]
Im Zuge der ansteigenden Verarmung haben sich die gut situierten Mittelschichten ver- stärkt aus bestimmten Stadtteilen zurückgezogen. Zugleich sehen sich viele Migranten und Arbeitslose aufgrund ihrer finanziellen Notsituation gezwungen, in Sozialwohnungen und preisgünstige Wohnviertel auszuweichen. Das Resultat dieser Entwicklung ist ein immer stär- keres räumliches Auseinanderdriften unterschiedlicher Sozialgruppen in der Stadt sowie eine immer stärkere Verarmung der städtischen Armutsgebiete (Friedrichs/Triemer 2009).
Die Folgen dieser als Segregation bezeichneten Prozesse bekommen besonders die armen2] Bevölkerungsschichten in den städtischen Problemvierteln zu spüren. So erfahren die Quar- tiersbewohner durch die räumliche Isolation sowie die Konzentration von städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen in ihren Quartieren eine nachweisbar doppelte Be- nachteiligung (Friedrichs 1998a; 3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008) Der Einfluss des Wohngebiets auf die Denk- und Verhaltensweisen seiner Bewohner führt auf längere Sicht neben der räumlichen auch zu einer sozialen Isolation und kann damit die Wiedereingliede- rung in die Berufs- und Alltagswelt der „Normalgesellschaft“ erschweren, wenn nicht gar verhindern.
Diese doppelte Benachteiligung der ökonomisch ohnehin schon schwächeren Bevölkerung, die durch die Gegebenheiten innerhalb des Wohngebiets entsteht, wird als „Gebietseffekt“ bezeichnet (Friedrichs 1998a: 83f.; Friedrichs/Blasius 2000). Dabei können verschiedene Ar- ten von Gebietseffekten unterschieden werden, die das Leben der Bewohner negativ beeinflussen. Neben dem Einfluss durch das äußere Erscheinungsbild des Wohngebiets, den sozialen Kontakten vor Ort oder dem institutionellen Einfluss von Schule und Familie, ist auch die Benachteiligung durch strukturelle Faktoren in Form fehlender Ausstattung zu nennen, die den Handlungsspielraum der Bewohner einschränken (Blasius et al. 2008: 12f.).
Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, in welchem Maße eine infrastrukturelle Benachteiligung in den städtischen Problemvierteln im Bereich der medizinischen Grundver- sorgung nachgewiesen werden kann. Als Untersuchungsgegenstand wurde das Merkmal der ambulanten medizinischen Versorgung gewählt, das eine messbare Ausstattungs- und Versor- gungsgröße darstellt und bereits seit längerer Zeit durch die Debatte um die Zweiklassen- Medizin im Kontext sozialer Ungleichheit steht. Trotz der allgemeinen Verbesserung des Ge- sundheitszustandes und des wohlfahrtsstaatlichen Systems, stehen der sozioökonomische Sta- tuts und der Gesundheitszustand einer Person weiterhin in engem Zusammenhang (Weyers/- Kunst 2006).
Die Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, den inhaltlichen Zusammenhang sozialer Segrega- tion und der Gesundheitsversorgung innerhalb eines Agglomerationsraums empirisch zu über- prüfen. Unabhängig von individuellen Faktoren, wie etwa der Behandlungsqualität, liegt das vorrangige Interesse dieser Arbeit auf der strukturellen Versorgung mit niedergelassenen Ärz- ten.
Dabei stehen folgende zentrale Forschungsfragen im Mittelpunkt:
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen der sozialen Segregation in einer Stadt und der Verteilung der ambulanten Ärzte?
- Gibt es eine Ungleichverteilung von Ärzten über das Stadtgebiet, aufgrund der sozialen Segregation der Stadtteile?
- Hat der Sozialstatus der Bewohnerschaft eines Stadtteils, Einfluss auf die medizinische Versorgung vor Ort?
- Sind trotz der bestehenden Bedarfsplanungsrichtlinien in überversorgten Regionen, einzelne Gebiete nachweislich unterversorgt?
Die Fragen sollen im Laufe dieser Arbeit empirisch überprüft werden, um auf diese Weise zu klären, ob eine angebotsorientierte Benachteiligung auf die armen Stadtteile von außen ein- wirkt und so Gebietseffekte in der medizinischen Versorgung für die Bewohner erzeugen. Als Untersuchungsraum wird beispielhaft die Stadt Köln als eine der größten Städte Deutschlands ausgewählt.
Zugleich soll in dieser Arbeit die Bedarfsplanung, bei der es um die Über- und Unterversor- gung von ambulanten medizinischen Leistungen geht, thematisiert werden (Gemeinsamer Bundesausschuss 2009). Die Bedarfsplanungsrichtlinien, die die Niederlassung der Vertrags- ärzte regeln, bewegen sich innerhalb des kleinsten räumlichen Planungsbereichs auf gesamt- städtischer Ebene und berücksichtigen daher städtische Segregationsentwicklungen in keinster Weise. Diese gesetzliche Regelung soll hinterfragt und zugleich empirisch überprüft werden, ob in den Agglomerationsräumen, in denen die größte soziale und ökonomische Spanne in- nerhalb der deutschen Gesellschaft besteht, die Niederlassung von Ärzten dem Zufall überlas- sen werden kann.
2. Theoretische Rahmenbedingungen
Den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bildet die Ungleichheitsthematik. Das Wort Un- gleichheit und sein Facettenreichtum bildet den umspannenden Bogen sowohl in der theoreti- schen Auseinandersetzung mit den Fragen nach der Segregation als auch der medizinischen Versorgung. Zunächst gilt es daher, den theoretischen Rahmen der Segregationsforschung als Teilgebiet der Stadtsoziologie sowie die gesundheitliche Ungleichheit als ein Themenschwer- punkt der Medizinsoziologie und anderen Teildisziplinen näher zu beleuchten. Das Binde- glied zwischen den beiden unterschiedlichen soziologischen Forschungsbereichen bildet dabei der Fokus auf gesellschaftliche Ungleichheiten. Neben der Auseinandersetzung mit den theo- retischen Ansätzen soll auch der Forschungsstand zu den hier anstehenden Themengebieten aufbereitet werden.
Zum besseren Verständnis der methodischen Umsetzung und zur Herleitung der hier disku- tierten Hypothesen, ist es darüber hinaus notwendig, einen Einblick in das medizinische Ver- sorgungsnetz und in die Gesundheitssystem- und Versorgungsforschungsdebatte zu nehmen. Hierzu gehört es auch, die gesetzlichen Grundlagen und die faktische Versorgungsituation, sowohl in Deutschland als auch im entsprechenden Untersuchungsraum Köln, kurz zu benen- nen.
2.1 Formen der Ungleichheit
Die Ungleichheitsdebatte ist seit langem Bestandteil soziologischer Forschung. Wenn von Ungleichheit die Rede ist, ist damit meist die an gesellschaftlichen Faktoren gemessene sozia- le Ungleichheit gemeint. Sie ist dabei von der bloßen biologisch bedingten Verschiedenartig- keit der Menschen zu unterscheiden (Kreckel 2004: 15) Einen wichtigen Beitrag zur Bestim- mung sozialer Ungleichheit leistete Ralf Dahrendorf Anfang der 1960er Jahre (Dahrendorf 1961). Der Ursprung sozialer Ungleichheit liegt nach Dahrendorf in der Existenz gesellschaft- licher Normen. Um normgemäßes Verhalten zu garantieren, unterliegt das menschliche Sozi- alverhalten Sanktionen. Konformes oder abweichendes Verhalten führen folglich zu Beloh- nungen oder Bestrafungen und erzeugen so unbeabsichtigt eine Rangordnung unter den Men- schen (Dahrendorf 1961: 20ff.). Die Ungleichheit äußert sich demnach durch Rangfolgen ver- schiedenster Art. Führen diese Rangfolgen zu einer Bevorzugung bzw. Benachteiligung be- stimmter Bevölkerungsgruppen, so kommt es zu einem sozialen Ungleichverhältnis.
Bis Ende der 1970er Jahre wurde die soziale Ungleichheit vor allem an den klassischen Ungleichheitsdimensionen Einkommen, Macht, Prestige, Besitz und Bildung fest gemacht (Berger/Schmidt 2004: 9ff.). Entsprechend der Ressourcenverteilung wird die Gesellschaft demnach in unterschiedliche soziale Schichten eingeteilt. Durch die zunehmende Vervielfältigung von Lebenslagen und Lebensmodellen, haben sich jedoch auch die Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit im Laufe der Zeit gewandelt. Heute steht aus theoretischer Sicht nicht mehr die klassische Ressourcenverteilung im Vordergrund, sondern die Frage, ob und in welchem Maße sich Vor- und Nachteile in unterschiedlichen Lebensbereichen für bestimmte Bevölkerungsruppen zu sozialen Lagen bündeln (Berger 2004: 11).
Ein Großteil der Ungleichheitsforschung beschränkt sich jedoch bis zum heutigen Tage, nicht zuletzt aus Gründen der Messbarkeit, auf die ressourcenbasierte soziale Ungleichheit (Ludwig-Mayerhofer 2004: 93.ff.). Diese wird allgemein unter dem Begriff der vertikalen sozialen Ungleichheit gefasst, da sie eine hierarchische Unterteilung entsprechend dem sozio- ökonomischen Status der Menschen ermöglicht. Sie unterscheidet nach Merkmalen wie Bil- dung, Einkommen und beruflichem Status. Daneben gibt es die horizontale soziale Ungleich- heit, die sich an Merkmalen des Alters, Geschlechts und der Nationalität bemisst (Mielck 2000: 18f.). Mit der sozialen Ungleichheit ist eine Vielzahl anderer Gesellschaftsphänomene verbunden, zu denen auch die Segregation und medizinische Ungleichheit zählen.
Segregation
Mit dem Begriff der Segregation ist eine Form der räumlichen Ungleichheit verbunden. Die räumliche Ungleichheit bezieht sich dabei meist auf den städtischen Kontext. Die Stadt kann laut dem Amerikaner Louis Wirth als eine relativ große, dicht besiedelte und dauerhafte Nie- derlassung gesellschaftlich heterogener Individuen umschrieben werden (Wirth 1938). Inner- halb dieses Ballungsraumes, so eine häufig zitierte Definition von Jürgen Friedrichs, markiert die Segregation die disproportionale Verteilung von Bevölkerungsgruppen über die städtischen Teilgebiete. Dabei stellt sie das Ergebnis sozialer Ungleichheit, d.h. ungleicher Chancen und Präferenzen einzelner Bevölkerungsgruppen dar (Friedrichs 1995: 79).
Soziale Segregation ist demnach der räumliche Ausdruck sozialer Ungleichheit und ver- weist auf die sozialräumlichen Unterschiede in der Stadt, die sich in der räumlichen Konzent- ration der Wohn- und Lebensräume bestimmter Bevölkerungsgruppen niederschlagen (Häu- ßermann/Siebel 2004: 139; Strohmeier/Bertelsmann Stiftung 2008: 9). Neben den sozialstruk- turellen Merkmalen kann eine räumliche Gliederung der Stadtbewohner auch nach anderen Merkmalen erfolgen (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung NRW et al. 2003: 4). Bei der ethnischen Segregation erfolgt eine räumliche Differenzierung nach Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit, bei der demographischen Segregation findet eine räumliche Trennung von Bevölkerungsgruppen aufgrund unterschiedlicher demographischer Merkmale wie Alter oder Haushaltstyp statt (Strohmeier/Bertelsmann Stiftung 2008: 9). Das Ausmaß der Segregation hängt dabei von der sozialen Distanz zwischen den Minoritäten und der Majorität der Stadtbevölkerung ab und ist ein Indikator für die Integration sozialer Minderheitsgruppen (Friedrichs 1995: 80f.).
Gesundheitliche Ungleichheit
Die gesundheitliche Ungleichheit ist, anders als die Segregation, nicht als fester Begriff etab- liert. Vielmehr umfasst sie eine ganze Bandbreite an wissenschaftlichen Disziplinen, zu der die Epidemiologie, die Sozialmedizin, die Medizinsoziologie und die Public Health-Debatte zählen (Mielck 2000: 164). Der Forschungsschwerpunkt liegt hier auf der gesundheitlichen Ungleichheit.
Gesundheitliche Ungleichheit meint dabei den indirekten Einfluss der vertikalen Merkmale sozialer Ungleichheit auf den Gesundheitszustand. Insofern können sich die sozial bedingten Lebensverhältnisse auf die Morbidität, Mortalität und das allgemeine Wohlbefinden auswirken (Richter/Hurrelmann 14ff; Mielck 2000: 47). Die gesundheitliche Ungleichheit thematisiert somit unter anderem den Zusammenhang zwischen der sozialen Lage von Bevölkerungsgruppen und dem Gesundheitszustand (Ammon et al. 2007: 6).
Eine noch größere Relevanz für diese Arbeit hat jedoch die Frage nach dem ärztlichen Ver- sorgungsstand. Der Klärung dieser Frage hat sich zu Teilen die Gesundheitssystemforschung mit ihrem Teilgebiet der Versorgungsforschung zugewendet, die sich mehr mit den strukturel- len Folgen medizinischer Ungleichheit befasst (Janßen et al. 2007: 7).
2.2 Segregationsforschung
Die Segregationsforschung als Teilgebiet der Stadtsoziologie beschäftigt sich neben der Ursa- chenforschung und den Erscheinungsformen vor allem mit den Folgen der Segregation. Die Stadt ist dabei mehr als nur ein Untersuchungsfeld sozialer Ungleichheit. Sie beeinflusst die soziale Ungleichheit durch ihre räumlichen Strukturen selbst. In der Stadtsoziologie stand nach 1945 das gesellschaftlich vorherrschende Verständnis sozialer Ungleichheit in engem Zusammenhang mit dem Stand der Stadtentwicklung (Harth et al. 2000: 17ff.).
Die Gründe für die Segregationsmuster in den innerdeutschen Städten gehen dabei auf so- ziodemographische Veränderungen zurück. Der Wandel der Familie seit Anfang der 1960er Jahre, eine Pluralisierung der Lebensformen sowie eine zunehmende Alterung der Bevölke- rung haben zu einer wachsenden Zahl an Single-Haushalten, Alleinerziehender und nichtehe- lichen Lebensgemeinschaften geführt (Strohmeier/Bertelsmann Stiftung 2008: 10).
Bis Ende der 1970er Jahre bestand weitestgehend Vollbeschäftigung in Deutschland. Der ökonomische Wandlungsprozess vom produzierenden- zum Dienstleistungsgewerbe im Rah- men der Deindustrialisierung in den 1980er und 1990er Jahren konnte den Verlust an Ar- beitsplätzen, insbesondere Vollzeitarbeitsplätzen, nicht in vollem Umfang ausgleichen, wo- durch besonders in den alt-industriellen Städten die Arbeitslosenzahlen stiegen und die jun- gen, gut ausgebildeten Bevölkerungsschichten abwanderten. Zusätzlich waren die schwieri- gen Arbeitsmarktverhältnisse durch den Wandel der Form der Arbeitsverhältnisse gekenn- zeichnet: geringfügige Beschäftigung, Teilzeiterwerbstätigkeit und Leiharbeit nahmen immer weiter zu. Auch die gestiegene Frauenerwerbsbeteiligung hatte eine zusätzliche Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zur Folge (3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 8; Strohmeier/Bertels- mann Stiftung 2008: 10). Zudem erhöhte sich durch die Globalisierung der Wettbewerb zwi- schen den Unternehmen, weshalb es zusätzlich zu Entlassungen und Verlagerungen von Ar- beitsplätzen in Billiglohnländer kam (Friedrichs/Blasius 2000: 18).
Von diesem Strukturwandel des Arbeitsmarktes und dem daraus folgenden Verlust an Ar- beitsplätzen sind bis heute Ausländer und Migranten aufgrund ihrer zum Teil niedrigen Quali- fikationen in stärkerem Maße betroffen als Deutsche (Friedrichs 1998b: 1750; Fried- richs/Triemer 2009: 30). Mit der Arbeitslosigkeit kam für viele Menschen der Bezug von Transferleistungen, wodurch sich allein im Untersuchungsraum Köln die Zahl der Sozialhil- feempfänger von 1980 bis 1997 von 13.135 auf 39.791 erhöhte und damit mehr als verdrei- fachte (Friedrichs/Blasius 2000: 11).
Die Arbeitsmarktbedingungen beeinflussen dabei die Segregation auf direkte und indirekte Weise. Durch den Einfluss des Einkommens wird zum einen die Wohnsituation gesteuert, und zum anderen werden Vorurteile und Diskriminierungen gegen ethnische Minderheiten auf- grund des hohen Wettbewerbs um Arbeitsplätze vorangetrieben (Friedrichs 1995: 92f.; Fried- richs 1998b: 1761).
In den 1980er Jahren kam es gleichzeitig durch Suburbanisierungsprozesse zu einer Abwanderung der gut situierten Mittelschichtfamilien in das städtische Umland, wodurch eine Konzentration von armen Familien sowie nicht-familiären Lebensformen in den Städten auftrat. Die Schrumpfung der deutschen Großstädte aufgrund der Abwanderungstendenzen der Deutschen wurde zahlenmäßig jedoch durch die Zuwanderung ausländischer Familien mit hohen Kinderzahlen ausgeglichen. Diese zunehmende Internationalisierung der Städte hat zur Folge, dass inzwischen in einer wachsenden Zahl von Städten die Mehrheit der Kinder einen Migrationshintergrund hat (Strohmeier/Bertelsmann Stiftung 2008: 11).
Die demographischen Veränderungsprozesse in Deutschland haben zu einer klaren sozialen und räumlichen Spaltung der Stadtgesellschaft geführt. Besonders bei den Familien ist eine deutliche Polarisierung zwischen arm und reich zu beobachten, die auch die Lebenschancen der nachwachsenden Generationen nachhaltig beeinflussen. Im Vergleich zu der immer noch steigenden Altersarmut, hat die Armut von Kindern, Jugendlichen und Familien in den letzten Jahrzehnten rapide zugenommen, wobei das Armutsrisiko bei den Kindern am höchsten ist (Strohmeier/Kersting 2003: 233f.; 3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008). Während sich die privilegierte Mittel- und Oberschicht am Stadtrand oder im Umland wiederfindet, zeigt sich für die Unterschicht zwei Wohnmuster: Sie wohnen entweder in traditionellen innenstadtna- hen Arbeiterquartieren mit ungünstigen Wohnbedingungen oder aber in randstädtischen Großwohnanlagen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus (Friedrichs/Blasius 2000: 12; Farwick 2003: 175).
Dass sich die arme Bevölkerung in den Sozialwohnungen wiederfindet, hat nicht nur etwas mit der soziodemographischen Entwicklung der letzten 50 Jahre zu tun, sondern auch mit dem städtischen Wohnungsmarkt. Die Wohnentscheidung wird dabei zum einen vom Wohnungs- angebot und den finanziellen Mitteln gesteuert, zum anderen spielen jedoch auch individuelle Wohnpräferenzen eine Rolle. So tendieren die Menschen dazu, sich in Nachbarschaften mit ähnlichem sozialen Hintergrund und ähnlichen Interessen niederzulassen, wodurch eine sozia- le Mischung nur bedingt möglich ist. Je größer die soziale Distanz ist, desto wahrscheinlicher und größer ist auch die räumliche Distanz (Strohmeier/Bertelsmann Stiftung 2008: 13; Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung NRW et al. 2003: 4).
Eine aktuelle Untersuchung aus dem Jahr 2009 (Friedrichs/Triemer 2009) zur sozialen und räumlichen Segregation der letzten 15 Jahre in den 15 größten deutschen Städten, hat ergeben, dass die Zahl der Armutsgebiete weiterhin ansteigt und die bereits segregierten Stadtviertel immer weiter verarmen. Während die soziale Segregation seit 1990 gestiegen ist, ist die ethni- sche Segregation eher rückläufig. Die Städte sind folglich in zunehmendem Maße stärker so- zial als ethnisch segregiert. Dennoch konnte eine hohe räumliche Korrelation zwischen der Segregation der Armen und der Migranten nachgewiesen werden. Die ethnischen Minoritäten sind dabei umso stärker segregiert, je geringer ihr Anteil an der Stadtbevölkerung ist (Fried- richs/Triemer 2009: 29ff., 71ff., 117).
Außer Frage steht, dass diese sozialen Distanzen in der deutschen Gesellschaft immer be- standen hatten. Segregation ist ein klassisches Stadtphänomen, und es hat sie immer gegeben. Neu ist dabei, dass der multidimensionale Charakter der Segregation immer mehr zum Vor- schein kommt, d.h. dass die unterschiedlichen Dimensionen von sozialer, ethnischer und de- mographischer Segregation in zunehmendem Maße miteinander korrelieren und sich räumlich überlagern, wie auch aktuell belegt werden konnte (Friedrichs/Triemer 2009: 117).
In den Stadtteilen mit dem höchsten Migrationsanteil leben somit zugleich die meisten Kinder und die ärmsten Deutschen (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung NRW et al. 2003: 4; 233). Durch die starke Konzentration verschiedener Problemlagen, lassen sich die betroffenen Stadtteile und ihre Bewohner immer klarer von der Restgesellschaft abgrenzen. Dadurch steigt die Gefahr der sozialen Ausgrenzung, die zu einer dauerhaften Bedrohung der sozialen Integration geworden ist. Der mehrdimensionale Ausgrenzungsprozess reicht von der Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt, über den sozialen und kulturellen Ausschluss bis hin zur räumlichen Isolation (Häußermann 2003: 147).
Auch von offizieller Seite wird die Segregationsproblematik thematisiert. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2008) verweist auf die Relevanz, die der Wohn- raum und die Wohnumgebung für die Lebensqualität der Menschen haben. Eine hohe Kon- zentration von sozialen Problemlagen in einzelnen Wohngebieten stellen ungünstige gesell- schaftliche Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentfaltung dar. Die sozialen Probleme treten in Form von Gebäudemängeln, Mängeln des Wohnumfeldes, unzureichender Infrast- ruktur, Umwelt- und Lärmbelastungen, geringer Wirtschaftstätigkeit, geringem Einkommen, Arbeitslosigkeit, fehlenden Schul- und Bildungsabschlüssen sowie den daraus resultierenden geringen Arbeitsmarktchancen auf (3. Armuts- und Reichtumsbericht: 116ff; Friedrichs 1995: 81). Stadtteile oder einzelne Wohnviertel, auch „Quartiere“ genannt (Friedrichs 1995: 115), in denen die genannten sozialen Probleme in gebündelter Form auftreten, werden als „Armutsviertel“, „arme Wohngebiete“, „Problemgebiete“ oder auch „soziale Brennpunkte“ bezeichnet (Friedrichs/Blasius 2000: 26).
Kontexteffekte
Besorgniserregend ist die räumliche Segregation vor allem deshalb, weil als Folge innerhalb der benachteiligten Wohngebiete, Kontexteffekte auftreten können, die zu einer zusätzlichen Benachteiligung der Bewohner führen (Friedrichs 1998a: 82; Institut für Landes- und Stadt- entwicklungsforschung NRW et al. 2003: 5). Ein Kontext ist per Definition ein Aggregat be- liebiger Größe. Dabei kann es sich um eine soziale Gruppe, einen Stadtteil oder eine ganze Stadt handeln. Ein sozialer Kontext wie die steigende Einkommensungleichheit, die zusätz- lich eine steigende Ungleichheit von Wohngelegenheiten nach sich zieht, führt dazu, dass sich die Wahlmöglichkeiten für beispielsweise einzelne Bewohner, Stadtteile oder ganze Städte unterschiedlich verteilen (Friedrichs 1995: 93). Bei einem Kontexteffekt geht es dabei um die Frage, welchen Effekt der soziale Kontext auf die Individuen hat, also, in welcher Weise das Individuum mögliche Einschränkungen wahrnimmt und der Kontext sein Verhalten und seine Einstellung beeinflusst (Friedrichs 1998a:78ff.).
Eine spezielle Form des Kontexteffektes ist der von dem Stadtsoziologien Jürgen Friedrichs geprägte Begriff des Gebietseffektes (Friedrichs 1998a). Dabei geht es um den gezielten Einfluss eines Stadtteils auf seine Bewohner. Der Gebietseffekt tritt häufig auch unter dem Namen Quartierseffekt in Erscheinung. Der Begriff „Quartier“ wird dabei alternativ für das Wort Wohnviertel verwendet (Friedrichs 1995: 115).
Innerhalb der Quartiere können unterschiedliche beeinflussende Effekte auftreten. So kann das von den Bewohnern wahrgenommene Erscheinungsbild eines Stadtteils (schlechter Ge- bäudezustand, Müll, Verwahrlosung) ihr Verhalten und ihre Einstellung beeinflussen. Außer- dem können die Bewohner eine direkte Einschränkung aufgrund struktureller Gebietsmerk- male in Form von gesundheitlichen Belastungen durch Luftverschmutzung und Lärmbelas- tung oder einer Einschränkung der Aktivitäten aufgrund fehlender Ausstattung mit Einrich- tungen des täglichen Bedarfs oder Freizeitangeboten erfahren. Auch können Institutionen wie Schulen, Vereine oder die Familie auf die Bewohner einwirken, indem Verhaltensmuster durch ein modellhaftes Lernen nachgeahmt werden (Blasius et al. 2008: 12f.)
Die Erforschung von Quartierseffekten erfährt in der Aktionsraumforschung (u.a. Dang- schat et al. 1982, Friedrichs/Blasius 2000) und der Sozialraumanalyse (u.a. Gestring/Janßen 2002; Heymann 2000) gesteigerte Aufmerksamkeit. Friedrichs (1998a) konnte durch die Auswertung einer Vielzahl von Studien erstmals nachweisen, dass ein ärmliches Wohnumfeld in der Tat die Armut der Bewohner verschärft, jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachbarschaft als Opportunitätsstruktur3] und die räum- liche Umgebung die sozialen Kontakte seiner Bewohner beeinflussen bzw. unterstützen. Die Verbreitung von Verhaltensmustern und Normen geschieht durch Interaktion und visuelles Verhalten. Durch soziale Kontakte innerhalb der Nachbarschaft und damit verbundene Inter- aktionen findet über den Prozess des sozialen Lernens und der normativen Anpassung eine unbewusste Adaption der Verhaltensweisen und Änderung der Ansichten statt.
Entscheidend für diese Veränderungen ist die Größe und Bandbreite des sozialen Netz- werks. Beschränken sich die sozialen Kontakte auf Menschen in der Nachbarschaft, die der gleichen gesellschaftlichen Gruppe angehören, findet eine immer stärkere Distanzierung und Entfremdung zur Restgesellschaft statt. Für die sozialen Netzwerke der Menschen in den Problemvierteln ergab sich zwar keine räumliche Begrenzung auf die Nachbarschaft, dennoch zeigte sich, dass die Armut zu einer minimalen täglichen Mobilität sowie einem geringen Maß an sozialen Kontakten, Freizeitaktivitäten oder anderen Betätigungen außerhalb des Wohnge- biets führt. Der Horizont des täglichen Lebens der Bewohner in den Armutsgebieten be- schränkt sich daher nichtsdestotrotz auf die Nachbarschaft und die lokale soziale Infrastruk- tur. Für Nicht-Erwerbstätige sowie Kinder und Jugendliche verstärkt sich dieser Effekt noch (Friedrichs 1998a: 83ff.).
Die Ergebnisse konnten in einer Reihe von nachfolgenden empirischen Untersuchungen in verschiedenen deutschen Städten und unterschiedlichen Untersuchungsjahren bestätigt wer- den (Dangschat et al. 1982; Farwick 2003; Keim/Neef 2000a/b; Friedrichs/Blasius 2000; Bla- sius et al. 2008). Bereits Anfang der 1980er hatte eine Untersuchung aus dem Jahre 1979 in der Stadt Hamburg ergeben (Dangschat et al. 1982), dass bei einer mangelhaften Gewerbe- und Infrastrukturausstattung des Wohnquartiers, diese von den Angehörigen der Mittel- und Oberschicht ausgeglichen wurde (Kompensationshypothese), während die Bewohner der tra- ditionellen Arbeiterviertel die Aktivitäten aufgrund des Mangels einfach einschränkten (Restriktionshypothese).
Die Ergebnisse der Restriktionshypothese wurden im Rahmen einer weiteren in Köln durchgeführten Studie bestätigt (Friedrichs/Blasius 2000: 84). So steigt mit sinkendem Ein- kommen, die Rate an Aktivitäten im eigenen Wohngebiet an. Der Aktionsraum der armen Menschen, in diesem Fall der Bezieher von Transferleistungen, ist deutlich verringert, wo- durch nicht zur die Sozialkontakte, sondern auch alle Aktivitäten des täglichen Lebens haupt- sächlich im eigenen Wohngebiet stattfinden. Zudem fand man heraus, dass die Gebietseffekte einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Bewohner haben, als die soziodemographischen In- dividualeffekte (Friedrichs/Blasius 2000: 79ff.). Auch die Interviewergebnisse einer Paneler- hebung in 2004 und 2006 in Köln (Blasius et al. 2008) konnten eine doppelte Benachteiligung in den sozialen Problemvierteln ausmachen. Dabei ergab sich für die verschiedenen Ethnien (Türken/Deutsche) kein Unterschied in der Alltagsbewältigung. Die Studie konnte daneben einen Zusammenhang zwischen der schlechten strukturellen Ausstattung und dem abwei- chenden Verhalten der Bewohner nachweisen.
Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in städtebaulich, wirtschaftlich und sozial belasteten Stadtquartieren sind im Rahmen eines Bund-Länder-Pro- gramms bereits vor einigen Jahren eingeleitet worden. Im Rahmen des Städtebauförderungs- programms „Soziale Stadt“ wurden zwischen 1999 und 2007 667 Mio. Euro in das aktive und aktivierende Quartiersmanagement von bundesweit insgesamt 500 ausgewählten Programm- gebieten investiert. In der Stadt Köln wurden so in unregelmäßigen Abständen insgesamt sechs Stadtteile gefördert.4] Das Problemgebiet Chorweiler war dabei kontinuierlich von Be- ginn an Teil des Förderungsprogramms (3. Armuts- und Reichtumsbericht: 227f.; Blasius et al. 2008: 15).
2.3 Medizinsoziologie
Bereits seit Anfang der 1970er Jahre sind Krankheit und soziale Ungleichheit ein Thema in Deutschland (Mielck/Helmert 1994: 93). Das Phänomen ist universell und daher weltweit an- zutreffen. Die Debatte um die gesundheitliche Ungleichheit entfachte mit der Veröffentli- chung des „Black Reports“, einer Untersuchung aus Großbritannien zum Thema Gesundheit und Sterblichkeit unter der Schirmherrschaft von Sir Douglas Black (Black et al. 1982). Die Untersuchung konnte erstmalig Gesundheitsdaten auf Basis offizieller britischer Regierungsberichte zur gesundheitlichen Ungleichheit, über einen langen Zeitraum hinweg vergleichen. Die Analyse ergab, dass zwischen 1950 und 1970 die Todeswahrscheinlichkeit in fast allen Altersgruppen in engem Zusammenhang mit dem gemessenen sozialen und ökonomischen Status stand. Während die Sterberate der Männer in den höheren Sozialschichten seit Anfang des 20. Jahrhunderts kontinuierlich gesunken war, stagnierte die Rate ungelernter Arbeiter seither, was als deutlichen Anstieg der gesundheitlichen Ungleichheit zwischen den Klassen interpretiert werden konnte (Bartley 2004: 6).
Seit dieser Zeit ist das wissenschaftliche Interesse an der gesundheitlichen Ungleichheits- thematik stark gestiegen. Sowohl theoretische Modelle zur Erklärung gesundheitlicher Un- gleichheit als auch empirische Untersuchungen haben sich in zunehmendem Maße mit dem Phänomen befasst (u.a. Mielck/Helmert 1994; Mielck 2005; Wendt/Wolf 2006; Rich- ter/Hurrelmann 2006; Hradil 2006; Behrens 2006; Jungbauer-Gans/Gross 2006; Siegrist 2007; Borgetto/Kälble 2007).
Der überwiegende Mehrzahl der theoretischen Ansätze zur gesundheitlichen Ungleichheit stimmen darin überein, dass sie die Morbidität und Mortalität als erklärende Variablen in di- rekten oder indirekten Zusammenhang mit dem sozialen, insbesondere dem sozioökonomi- schen Status setzen (Richter 2006: 19ff; Hradil 2006: 40ff; Behrens 2006: 62ff; Jungbauer- Gans/Gross 2006; 75ff; Jungbauer-Gans 2006: 93ff; Mielck 2000: 155ff; Mielck 2005: 49ff; Bartley 2004: 64ff; Schneider 2008: 257ff). Dabei wird davon ausgegangen, dass die Zugehö- rigkeit zu einer sozialen Schicht, durch das schichtspezifische Zusammenwirken von Lebens- umständen, Lebensgewohnheiten, Verhaltensweisen und Einstellungen eine Krankheit mit verursacht und deren Verlauf beeinflusst. Der Mangel an Wissen, Geld, Macht und Prestige kann unterschiedliche direkte und indirekte Folgen auf die Gesundheit haben (Janßen et al. 2006: 142).
Eine Folge ist das individuelle Verhalten, das die Gesundheit nachhaltig beeinflussen kann und eine wichtige Größe im kulturell-verhaltensbezogenen Ansatz der Medizinsoziologie dar- stellt (Richter/Hurrelmann 2006: 19; Schneider 2008: 258). Dabei haben Tabak- und Alkohol- konsum, das Ernährungsverhalten und das damit verbundene Körpergewicht sowie die sport- liche Betätigung einen medizinisch nachgewiesenen Einfluss auf den Gesundheitszustand. Besonders bei Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss besteht meist kein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein und Wissenslücken im Umgang mit Gesundheitsrisiken. Die Folgen sind eine fettreiche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsarmut und erhöhter Alkohol- und Zi- garettenkonsum (vgl. Tab. A195]; Robert Koch-Institut/ Statistisches Bundesamt 2006; Hradil 2006: 40f.). Folglich ist der Anteil der Männer mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der niedrigsten im Vergleich zur höchsten Bildungsgruppe um den Faktor 3,1 und bei Frauen um den Faktor 1,8 erhöht (3. Armuts- und Reichtumsbericht: 102). Jedoch kann das Gesund- heitsverhalten den niedrig gebildeten und zugleich meist sozial schwachen Menschen nicht ohne Weiteres selbst zugeschrieben werden, da gesundheitsförderliches Verhalten gesund- heitsrelevantes Wissen voraussetzt, das in diesem Fall nicht vorhanden und somit auch nicht anwendbar ist (Schneider 2008: 258).
Eine weitere Einflussgröße auf die gesundheitliche Ungleichheit ist das individuelle Ver- sorgungs- und Vorsorgeverhalten. Auch der Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, Fachärzten und Aufklärungsmaßnahmen, die Beachtung frühzeitiger Symptome sowie die korrekte Ein- nahme von Medikamenten hängt stark vom Bildungsniveau und dem Sozialstatus ab (Mielck 2000: 171; Mielck 2005: 49). Zudem kann der Bildungsgrad Einfluss auf das Arzt-Patienten- Verhältnis, in Form einer großen sozialen Distanz sowie einer schlechten Arzt-Patienten- Kommunikation nehmen (Jungbauer-Gans/Gross 2006: 77; Schneider 2008: 258).
Neben den individuellen Faktoren, hängt der Gesundheitszustand des Weiteren von ver- schiedenen Umwelteinflüssen ab. Hierbei sind vorrangig physische und psychische Belastun- gen wie Stressoren im Arbeits- und Wohnumfeld zu nennen, die bei Menschen mit geringe- rem Einkommen und statusniedrigen Positionen in verstärktem Maße auftreten (Mielck 2000: 171; Jungbauer-Gans/Gross 2006: 79). Gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz können durch schwere körperliche Arbeit, Arbeitsbelastung wie Lärm, Hitze und Staub sowie psychi- sche Belastungen durch Schichtarbeit, Zeitdruck, Über- oder Unterforderung oder einem Un- gleichgewicht von Arbeitsleistung und Lohn entstehen (Jungbauer-Gans 2006: 95). Innerhalb des statusspezifischen Wohnumfeldes und der unmittelbaren sozialräumlichen Umwelt wird die Gesundheit u.a. durch Faktoren wie Schimmel, Schadstoffe, Lärm, beengte Wohnverhält- nisse und unzureichende Naherholungsmöglichkeiten belastet (Schneider 2008: 257).
Angrenzend an das Arbeits- und Wohnumfeld können auch die materiellen und sozialen Lebensbedingungen Einfluss auf den Gesundheitszustand und seine Ungleichheiten nehmen. Der materialistische Ansatz geht dabei von einem steigenden Krankheitsrisiko bei schrittwei- sem Absinken der Einkommensstufe bzw. von einem verminderten Sterberisiko bei jedem Anstieg der Gehaltsgruppe aus (Bartley 2004: 90; Behrens 2006: 53). Obwohl im deutschen Krankenversicherungssystem jedem Pflichtversicherten grundsätzlich dieselben Leistungen zugesprochen werden, können finanziell besser Gestellte eine bessere medizinische Versor- gung, in Form von Privat- und/oder Zusatzversicherungen, in Anspruch nehmen. Auch die an- fallende Praxisgebühr kann ein zusätzliches Hemmnis der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen darstellen (Schneider 2008: 256f.). Neben der Finanzierung medizinischer Versor- gung können auch die mit dem Sozialstatus verbundenen Opportunitätskosten in Form von verfügbarer Zeit und Erreichbarkeit ein wichtiges Argument für das Ausbleiben eines Be- suchs medizinischer Versorgungseinrichtungen sein (Behrens 2006: 63f.).
Empirisch konnten die beschriebenen Zusammenhänge zwischen Morbidität und Mortalität sowie dem sozioökonomischen Status, anlehnend an die Forschung von Black, durch neuere Studien bestätigt werden (Mielck 2005: 7; Mielck/Helmert 1994: 102ff.). Eine 1994 durchge- führte Inhaltsanalyse von 61 empirischen Studien ergab einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einer höheren Mortalitäts- und Morbiditätsrate und einem niedrigen sozioökono- mischen Status (Mielck/Helmert 1994: 108ff.). Im Jahr 2000 konnte eine Untersuchung den Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Gesundheit ebenfalls belegen. Die Studie er- gab, dass in Deutschland die Morbidität in den unteren Einkommensgruppen 1,6 bis 2,8 mal so hoch ist wie in den oberen Einkommensgruppen (Mielck 2000: 92). Ähnliches zeigte sich durch die Auswertung des Sozio-Ökonomischen Panels für Deutschland. Demnach ist zwi- schen den 25% der Bevölkerung mit dem höchsten und niedrigsten Einkommen ein Unter- schied in der Lebenserwartung von zehn Jahren bei Männern und von fünf Jahren bei Frauen feststellbar (Janßen et al. 2006: 142). Auch für den städtischen Kontext am Beispiel der Stadt Bremen konnte nachgewiesen werden, dass die schichtspezifischen Mortalitätsunterschiede über die Jahre gestiegen sind. Während die Mortalitätsrate in den Unterschichtwohngebieten 1970 die Gesamtmortalität der Oberschicht noch um 20% überstieg, war sie 1989 bereits um 34% höher (Tempel/Witzko 1994: 338).
Des Weiteren konnte empirisch nachgewiesen werden, dass Personen unterer Sozialgrup- pen seltener an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen, in höherem Maße Risikofaktoren wie Rauchen und Übergewicht ausgesetzt sind, einen erhöhten Medikamen- tenkonsum aufweisen und häufiger zum Allgemeinarzt und dafür seltener zum Facharzt gehen (Mielck/Helmert 1994: 108ff; Mielck 2000: 219). Ein Telefonsurvey 2006 ermittelte ferner einen empirischen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Gesundheitszu- stand. Personen niedriger Bildungsschichten rauchen demnach häufiger, leiden häufiger an bestimmten Krankheiten, treiben weniger Sport und haben folglich häufiger Übergewicht (3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008: 102ff.). Die Auswertung eines Telefonsurveys von 2003 hatte zusätzlich ergeben, dass ältere Menschen, Menschen mit niedrigem Sozialstatus und solche mit einem höheren BMI häufiger einen Hausarzt aufsuchen als andere (Bergmann et al. 2005: 1376).
Die Ergebnisse sowie die hier diskutierten gesundheitlichen Einflussgrößen werden auch auf Bundesebene, durch die Gesundheitsberichterstattung des Bundes sowie den bereits angeführten 3. Armuts- und Reichtumsbericht bestätigt (3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008; Robert Koch-Institut/Statistisches Bundesamt 2006).
„Die Gesundheit und die Lebenserwartung der Deutschen wird in erheblichem Maße von der soziale Lage und dem Bildungsniveau, dem individuellen Lebensstil sowie Belastungen aus der Umwelt beeinflusst“ (Robert Koch-Institut/Statistisches Bundesamt 2006: 81).
Von den ungünstigen Gesundheitschancen sind Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, alleiner- ziehende Mütter sowie Kinder aus sozial schwachen Familien am stärksten betroffen (Robert- Koch-Institut/Statistisches Bundesamt 2006: 81ff.). Um die Gesundheitslücken zu schließen wurde 2007 ein EU Förderungsprogramm ins Leben gerufen. Das Projekt „DETERMINE“ das von 22 nationalen Gesundheitsagenturen innerhalb der EU durchgeführt wird, soll ein gesundheitliches Basiswissen schaffen und eine Infrastruktur aufbauen um damit Strategien und Programme zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheit zu unterstützen (www.health- inequalities.org; Weyers/Kunst 2006).
Trotz des vorhandenen gesundheitlichen Ungleichheitsbewusstseins richten sich fast alle theoretischen und empirischen Modelle der Epidemiologie, die paradoxerweise als Wissen- schaft für Krankheiten in der Gesellschaft bezeichnet wird, auf die Individualebene, wodurch gleichzeitig von strukturellen Defiziten auf gesellschaftlicher Ebene abgelenkt wird (Jung- bauer-Gans 2006: 88; Diez-Roux 1998: 221). An dieser Stelle liefert die Gesundheitssystem- forschung nähere Informationen zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Einfluss- größen medizinischer Ungleichheit.
2.4 Medizinische Versorgungslage
Die Kapitel 2.2 und 2.3 haben gezeigt, welche starke Wechselwirkung sowohl zwischen dem Wohnort als auch der Gesundheit und dem Sozialstatus eines Menschen besteht. Da in dieser Arbeit die Frage der strukturellen Verteilung der Ärzte auf die städtischen Wohngebiete im Vordergrund steht, gilt es zudem die Frage nach einer möglicherweise ungleichen medizinischen Versorgung in Deutschland zu klären.
Wie bereits angedeutet, besteht in Deutschland ein erhebliches Defizit an systematischer For- schung zur Versorgungsungleichheit (Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung 2000: 7). In den englischsprachigen Ländern ist die Forschung bereits wesentlich weiter voran geschritten (Hurley et al. 2005; Congdon 1995; Robert 1999). Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die soziale Ungleichheit in der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland kein Problem darstellt. Zudem basiert ein Großteil der epidemiologischen Forschung auf der Annahme, dass Gesundheit und Krankheit ausschließlich über die Eigenschaften der Individuen erklärt werden können. Erst in den letzten Jahren hat das Thema in der Diskussion um eine differenzierte Betrachtung gesundheitlicher Ungleichheit erhöhte Aufmerksamkeit erhalten (Diez-Roux 1998: 216; Von dem Knesebeck et al. 2009: 59).
Um die Forschungsansätze und Diskussionen zur medizinischen Versorgungslage in Deutschland nachvollziehen zu können, bedarf es zunächst eines Überblicks über das komplexe deutsche Gesundheitssystem, seine Organe und Akteure, über Handlungsspielräume, gesetzliche Richtlinien und die faktische Versorgungssituation.
2.4.1 Das deutsche Gesundheitssystem
Das deutsche Gesundheitssystem gestaltet sich als ein Netzwerk aus miteinander verknüpften Organisationen. Neben der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung gehört das Gesundheitssystem (GS) zu den drei Säulen des deutschen Sozialsystems. Innerhalb des GS kann zwischen fünf verschiedenen Teilbereichen unterschieden werden: 1) der ambulanten Versorgung, 2) der stationären und teilstationären Versorgung, 3) dem Gesundheitsschutz und -förderung, 4) der Gesundheitsindustrie und 5) den Versicherungen (Janßen et al. 2006: 143). Die Hauptaufgaben des GS liegen dabei in der Behandlung von Krankheiten sowie der prä- ventiven Versorgung und dem Erhalt der Gesundheit. Die Umsetzung erfolgt auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene durch die Gesamtheit des öffentlichen und privaten Gesund- heitswesens, die alle Einrichtungen und Personen umfasst, welche die Gesundheit der Bevöl- kerung fördern, erhalten und wiederherstellen sollen. Dazu zählen u.a. das Bundesgesund- heitsministerium, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Gesundheitsämter der Kommunen und Länder, Krankenhäuser, Universitätskliniken, private Großunternehmen im pharmazeutischen Bereich und Versorgungsangebote des privaten Sektors wie Apotheken, niedergelassene Ärzte und Heilpraktiker (Beske/Hallauer 1999: 45; Janßen et al. 2006: 134).
Das deutsche Gesundheitssystem ist dabei nach dem Sozialversicherungsmodell gestaltet, das sich aus einem Beziehungsdreieck von Krankenversicherungen, Versicherten und Leis- tungserbringern zusammensetzt. Grundprinzipien des deutschen Sozialversicherungsmodells sind die Versicherungspflicht, die einkommensabhängige Beitragsmessung und das Sachleistungsprinzip, nach dem die Krankenkassen die medizinischen Leistungen nicht selbst erbringen dürfen (Braun 2002: 15ff.). Gleichzeitig impliziert das Modell entsprechend der deutschen föderalistischen Staatsordnung und dem pluralistischen Gesellschaftssystem, dass der Staat nicht die alleinige Verantwortung für die Gesundheitspolitik trägt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008: 127f.)
Das Prinzip fußt auf den in den 1880er und 1890er Jahren unter Otto von Bismark entstan- denen Sozialgesetzen, in denen die erste systematische Gesundheitsversorgung der Bevölke- rung geregelt wurde. Kernstück ist das 1883 entstandene und bis heute bestehende Kran- kenversicherungsgesetz, das die Einführung einer Versicherungspflicht für Arbeitnehmer vor- sah, um so die wirtschaftliche Absicherung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit zu gewährleisten. Hieraus entstand die nun bereits über 120 Jahre alte gesetzliche Krankenversi- cherung (GKV) (Braun 2002: 15ff.; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008: 128). Von der gesetzlichen Versicherungspflicht sind heutzutage Beamte, Freiberufler sowie Ar- beitnehmer mit einem Einkommen über der Versicherungspflicht befreit. Hier besteht die Möglichkeit der Absicherung über eine private Krankenversicherung (PKV). Bei dieser treten die Patienten, anders als bei der GKV, in Vorkasse (Janßen et al. 2006: 144).
Die rechtlichen Grundlagen der deutschen Gesundheitsversorgung sind heute fast aus- schließlich im fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) geregelt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008: 127f.). Im Laufe der Zeit sind weitere Grundprinzipien der deutschen Gesund- heitsversorgung im SGB V gesetzlich verankert worden. Durch ein Gesetz über das Kassen- arztrecht von 1955 wurden die Rahmenbedingungen des Selbstverwaltungsprinzips der Ärzte und Krankenkassen festgelegt. Bereits 1931 waren im Zuge der Weltwirtschafskrise per ge- setzlicher Notverordnung, die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) zur Selbstverwaltung durch den örtlichen Zusammenschluss aller Kassenärzte ins Leben gerufen worden. Als län- derübergreifender Dachverband wurde 1953 die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) gegründet. Als weiterer Verband zur professionellen Selbstregulierung nach Innen und zu In- teressenvertretung der Ärzte wurden 1947 die Landesärztekammern und als Zusammen- schluss die Bundesärztekammer gegründet, in die jeder Kassenarzt verpflichtend eintreten muss (Alber/Bernardi-Schenkluhn 1992: 82f.; Beske/Hallauer 1999: 117; Beske et al. 2002: 22ff.; Siegrist 2005: 230ff.; Beske et al. 2009: 64).
[...]
1 Das Armutsrisiko von Personen ohne Migrationshintergrund liegt bei 12%, das von Spätaussiedlern bei 21%. Bei als Deutsche geborenen Personen mit Migrationshintergrund beläuft sich das Risiko auf 25% und bei der ausländischen Bevölkerung auf 34% (3. Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 141).
2 Die Begriff „arm“ und „reich“ steht in dieser Arbeit stellvertretend für den Bezug von staatlichen Hilfeleis- tungen. Auf Stadtteilebene stehen die Begriffe synonym für einen hohen bzw. niedrigen Anteil an Hilfeemp- fängern.
3 Die Opportunitätsstruktur eines jeden Stadtteils umfasst Angebote jeglicher Form, sowohl Einrichtungen wie Kinos, Schulen, Ämter, Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitstätten, Erholungsmöglichkeiten, als auch Angebote in Form von Nachbarschaftshilfen durch die Bewohner selbst. Die Opportunitäten erleichtern den Bewohnern die Bewältigung des Alltags. Sind sie nicht vorhanden, so muss Zeit und Geld investiert werden, um Angebote in anderen Teilen der Stadt wahrzunehmen (Friedrichs/Blasius 2000: 77).
4 Dabei handelt es sich um die Stadtteile Bocklemünd/Mengenich (Förderung in 2002-04, 2007), Chorweiler (1999-2006), Porz-Finkenberg (2002-04, 2006-08) sowie Mühlheim, Kalk und Vingst (1999-04, 2006, 2008).
5 Alle Tabellen- und Abbildungsverweise deren Nummerierung ein „A“ voran gestellt ist, finden sich im An- hang dieser Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Anna-Sophie Rauschenbach (Autor:in), 2010, Sozialer Status des Stadtteils und medizinische Versorgung in Köln, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151069
Kostenlos Autor werden









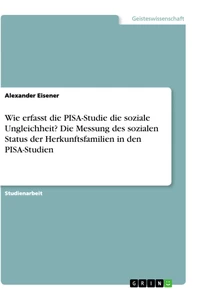

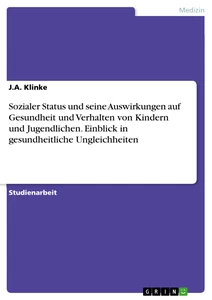




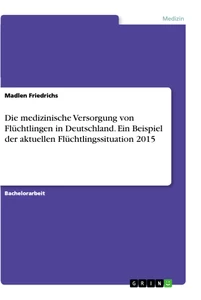



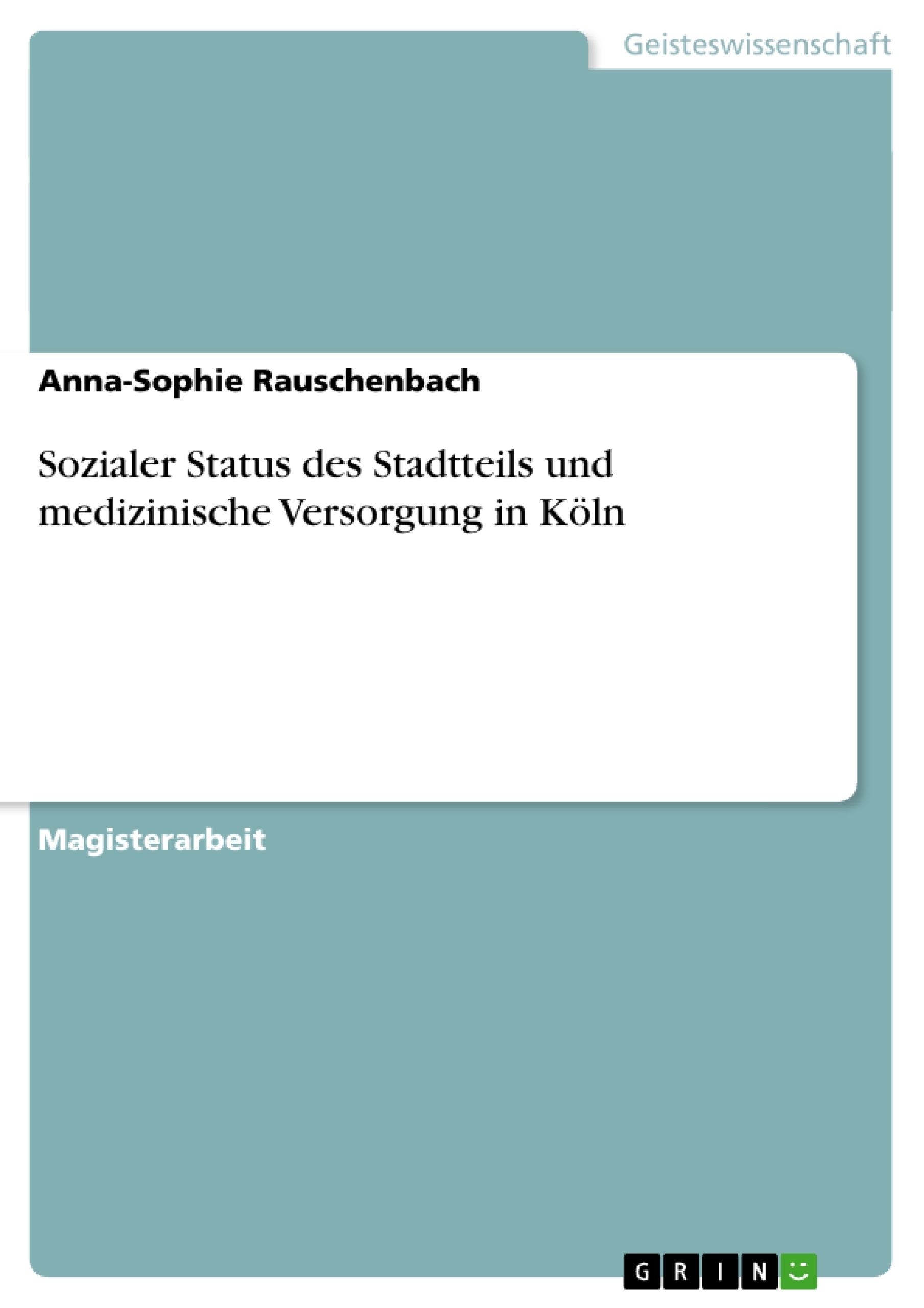

Kommentare