Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Fragestellung
2. Massenmedialer Diskurs zu familienorientierter Männlichkeit
2.1 Der Fürsorgeappell an Männer in der öffentlichen Debatte
2.2 Definition des Fürsorgeaspektes
2.3 Zusammenfassende Annahmen
3. Konstitution von Männlichkeiten
3.1 Theorien der Männerforschung
3.2 Männlichkeiten und Reproduktionsarbeit
3.3 Zusammenfassung: Einseitigkeit der männlichen Rolle
4. Arbeitsgesellschaft und Subjektivierung im strukturellen Wandel
4.1 Veränderungen in der Erwerbsarbeit
4.2 Das neue Leitbild der Arbeitskraft
4.3 Transformation sozialstaatlicher Regulierungen
4.4 Pluralisierung der Geschlechterverhältnisse
4.5 Subjektkonstruktion im neoliberalen Kapitalismus
4.6 Zusammenfassung: Entgrenzung und Subjektivierung
5. Familienorientierung und Männlichkeiten in einer gewandelten Arbeitsgesellschaft
5.1 Männlichkeiten im gesellschaftlichen Übergang
5.1.1 Vom Agenten und Akteur kapitalistischer Macht zum Unterdrückten
5.1.2 Entgrenzung und Auflösung der männlichen Ernährerrolle
5.1.3 Psychosoziale Folgen des Veränderungsdrucks
5.2 Ansätze für einen Wandel dominanter Männlichkeitsentwürfe
5.2.1 Veränderungspotenzial der hegemonialen Männlichkeit nach Connell
5.2.2 Wandlungsfähigkeit des männlichen Habitus
5.2.3 Reichweite des Rollenwandels
5.3 Aussagen der Männerforschung zur Hegemonialisierung des Fürsorgemoduls
5.3.1 Ambivalente Öffnung der Familienarbeit für Männer
5.3.2 Entwicklung fürsorglicher Selbstbilder
5.4 Zusammenfassung: Nischen und Handlungsbedarfe
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
7.1 Bücher und Texte
7.2 Internetreferenzen
7.3 Zeitungsartikel der Massenmedien
1. Einleitung
In den letzten dreißig Jahren haben sich die gesellschaftliche Ordnung und die Bedingungen der Arbeitswelt deutlich verändert: Arbeitsverhältnisse sind flexibler und häufig unsicherer geworden und fordern eine flexiblere Gestaltung des Lebenslaufs der Beschäftigten. Zeitgleich werden sozialstaatliche Aktivitäten drastisch reduziert und Zuständigkeiten dem privaten Leistungsvermögen der BürgerInnen zugewiesen. Strukturell werden damit neue Anforderungen an die Subjekte gestellt, die bis in die Organisation des Privaten und die Geschlechterverhältnisse hineinreichen.
Die neuen Maßstäbe in der Erwerbsarbeit betreffen zentrale Ankerpunkte männlicher Identität und schmälern die männliche Vormachtsstellung in der Gesellschaft. Immer mehr Männer können den stark mit Maskulinität verbundenen Status des Familienernährers nicht mehr ausfüllen und keine stabilen Positionen im Arbeitsleben einnehmen. Darüber hinaus sind Männer neuerdings verstärkt Zielgruppe von politischen Gleichstellungsmaßnahmen. Waren Männer durch ihre Ausrichtung auf die Erwerbsarbeit von Aufgaben im Haushalt und der fürsorglichen Betreuung entbunden, werden sie nun mehr von ihren Partnerinnen und von der Gemeinschaft aufgefordert, alte Konzepte abzustreifen. Männliche Subjekte befinden sich demnach in einem Spannungsfeld zwischen intensivierten Arbeitsanforderungen, den Sachzwängen der Ökonomie, vertrauten Spielregeln ihrer Geschlechterrolle und dem Appell, sich aktiv der Reproduktionsarbeit zu öffnen - einem Bereich, der bisher den Frauen zugeteilt war, der gesellschaftlich abgewertet ist und in dem man als Mann nie punkten konnte.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es gelingen kann, dass sich männliche Subjekte an gesellschaftlich notwendigen Arbeiten in Haushalt und Familie beteiligen und ihr Leben ganzheitlicher gestalten. Ich befrage deshalb in dieser Arbeit die aktuelle Männerforschung[1], ob sich ein Wandel des hegemonialen Leitbildes von Männlichkeit abzeichnet und Fürsorgeaspekte stärker in männliche Selbstbilder integriert werden. Außerdem möchte ich ein Augenmerk darauf legen, inwieweit die Erweiterung von Männlichkeitskonzepten um weiblich besetzte Anteile der Sorgearbeit bei zunehmenden ökonomischem Druck für realistisch gehalten wird.
Zunächst werde ich darstellen, wie sich der derzeitige Appell an Männer ausgestaltet und auf diese Art und Weise sowohl die eine Seite des Spannungsfeldes skizzieren als auch näher an das Thema heran führen. Ein kurzer Überblick über den massenmedialen Diskurs zu aktiver Vaterschaft/männlicher Fürsorge sowie eine inhaltliche Definition des Fürsorgeaspektes sollen die Richtung des gewünschten Engagements untermauern.
Als spannungsreiche, aber handlungsleitende Ebenen stellen sich die Konstruktion und die Internalisierung von Männlichkeiten sowie gesellschaftliche und ökonomische Strukturbedingungen dar. Aus diesem Grunde werde ich im zweiten Kapitel zuerst auf die Herstellungsbedingungen von Männlichkeiten eingehen. Es sollen hier zum einen die zentralsten Theorien der Männlichkeits- und Geschlechterforschung dargestellt werden und zum anderen die dort vorgefundenen Konzepte von Männlichkeiten in Verbindung mit Reproduktionsarbeit gebracht werden. Menschen und ihre Möglichkeiten zum Handeln, sind sowohl durch die sie umgebenden Strukturen bedingt, mit denen sich Menschen auseinander setzen müssen, als auch von ihrer psychosozialen Binnenausstattung beeinflusst. Ich möchte das „Innere“ zwar mit berücksichtigen, mich insgesamt aber auf den Einfluss äußerer Komponenten konzentrieren. Entwicklungspsychologische Aspekte fließen daher randständig ein.
Das vierte Kapitel nimmt deshalb den gesellschaftlichen Wandel und die geänderten Strukturbedingungen der Postmoderne in den Fokus. Ich werde hier die Gefasstheit der Arbeitsgesellschaft, den Wandel zu neuen Anforderungen an Arbeitskraft und Bezugspunkte für die Organisation des Geschlechterverhältnisses und reproduktiver Arbeiten darstellen. Insbesondere sollen hier Mechanismen sozialstaatlicher und ökonomischer Regulierung berücksichtig werden und wie diese auf Subjekte und ihre Identitätskonzepte einwirken. Ausgehend von dem Theoriekonzept der Gouverne- mentalität sollen Prinzipien der Selbst- und Fremdtechnologisierung, d.h. neue Formen von Regierung beschrieben werden, die im Neoliberalismus Subjekte transformieren.
Im fünften Kapitel werden dann die drei Felder Fürsorgeappell, Männlichkeitskonstruktion und struktureller Wandel auf Basis der Männerforschung zusammengeführt. Zuerst werden die Auswirkungen der beschriebenen Wandlungsprozesse auf bestehende Männlichkeitskonzepte angewendet. Danach erfolgt eine Umschau, inwieweit und unter welchen Bedingungen aus theoretischer Sicht ein Wandel männlicher Selbstbilder erfolgen könnte. Schließlich sollen aktuelle Meinungen und Studien im Sinne der Fragstellung Aufschluss über die tatsächlichen Entwicklungen geben.
Am Ende steht ein Fazit, in dem ich darstelle, was aufgrund meiner Literaturrecherche noch nicht oder nur unzureichend von der Forschung abgedeckt wird. Hier werde ich eigene Schlüsse ziehen und so versuchen, zu einer umfassenderen Klärung der Fragestellung beizutragen.
2 Massenmedialer Diskurs zu familienorientierter Männlichkeit
2.1 Der Fürsorgeappell an Männer in der öffentlichen Debatte
In den letzten Jahren ist in den Massenmedien das Bild des fürsorglichen, häuslichen Vaters und Mannes deutlich stärker in Erscheinung getreten. Väterlichkeit ist darüber hinaus zu einem starken Verkaufsargument des Produktmarketing geworden, das auf eine qualitativ hohe Freizeitorientierung der Konsumenten aufsattelt und die „besten“ Produkte für die Umsorgung der Lieben anbietet. Als Beispiele lassen sich der allein erziehende Vater der Melitta-Werbung, die Birkel-Kampagne oder die familiennahen Darstellungen und Slogans von Renault ( weil Familie über alles geht.“) an
führen. Die Werbung genießt als Produzent von Lifestyle durch das Verwenden utopischer Ideale deutlich mehr geschlechterrollenspezifische Freiheiten, als diese dann weitflächig praktiziert werden (vgl. Baader 2006, 120f.; Böhnisch 2003, 108ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.: Kampagne von Birke! und Mehr Zeit für Kinder e. V.
Gerade prominente Männer bekennen sich zunehmend öffentlich zu ihren Vater- und Familienfreuden und treten damit als Vorbilder auf. So pflegen Boris Becker[2], Johannes B. Kerner, Heiner Lauterbach, Til Schweiger sowie Hollywoodgrößen wie Brad Pitt und Johnny Depp ein soziales Image. Mit Bekenntnissen zu Familie und aktiver Kinderbetreuung heben sie Vaterschaft als elementares Erlebnis und wichtigen Wert der Selbsterfahrung medienwirksam hervor.
Spätestens seit dem Beschluss einer neuen Elterngeldregelung im Jahre 2006 und dessen Einführung zum 1. Januar 2007 werden entsprechende Anrufungen an Männer mit Familienplänen auf breiter Basis geführt. Mit dem neuen Elterngeld haben Eltern 14 Monate lang Anrecht auf eine Gehaltsersatzleistung von 67% des wegfallenden Nettolohnes des betreuenden Elternteils bzw. maximal EUR 1800,- mtl. Die maßgebliche Neuerung ist, dass zwei Monate an den anderen Elternteil gebunden sind - beteiligen sich also nicht beide Elternteile an der Frühbetreuung des Nachwuchses, verfällt ein Anteil des Anspruchs auf Familienförderung (vgl. Döge 2007, 1).
Mit dieser regulierten Verteilung der staatlich begünstigten Frühbetreuung von Kindern durch ihre Eltern, hat die Regierung einen bisher nicht erfolgten Schritt unternommen. Damit wird versucht, es dem Erfolgsmodell aus Schweden bei der Gleichstellung der Geschlechter gleich zu tun. Da bisher nur in Ausnahmefällen Elternzeit von Männern in Anspruch genommen wurde, ist der staatliche Eingriff in die innerfamiliäre Aufgabenteilung unter dem Begriff „Vätermonate“ in die öffentliche Debatte eingegangen. Die neue Regelung soll nun ausdrücklich Männer unterstützen, ihre Bedürfnisse nach Teilhabe an der Familienarbeit gesellschaftlich akzeptiert umsetzen zu können (vgl. Krupka in Die Zeit 28/2006, 06.07.06; „Ausgeprägter Kinderwunsch bei jungen Deutschen“ in Spiegel-Online, 26.04.06), sie aber auch Mitverantwortung in der Familienarbeit übernehmen zu lassen (vgl. Hildebrand/Niejahr in Die Zeit 18/2006, 27.04.06).
Die Familienministerin Ursula von der Leyen hat bereits mit dem Gesetzentwurf einen „Kulturkampf losgetreten“, der als „Zwangsmaßnahme“ in den Massenmedien kontrovers verarbeitet wurde und wird. Mit dem aktuellen Familienbericht und der als bedrohlich angesehenen demographischen Entwicklung als Hintergrund wurde vielfach eine Art Sachzwang für die Maßnahme aufgebaut. Die anhaltend niedrige Geburtenrate wurde mit der Finanzknappheit der Familien und der erhöhten Erwerbsneigung emanzipierter und gut ausgebildeter Frauen begründet (vgl. Krupka in Die Zeit 28/2006, 26.04.06; „Ausgeprägter Kinderwunsch bei jungen Deutschen“ in Spiegel-Online, 26.04.06).
Wo früher abwertend von „verweiblichten Sonderlingen“ die Rede war, werden fürsorgliche „Hausmänner“ heute eher positiv dargestellt, obwohl ihnen auch dabei noch immer ein gewisser Exotenstatus zuteil wird. „Die Zeit“ widmete dem neuen Männerbild sogar eine Serie, in der über Wochen das moderne Mannsein thematisiert wurde[3] und selbst die „Bild“ berichtet sachlich zum Thema. Außerdem traten in diesem Zusammenhang Politiker aller Lager an die Öffentlichkeit, die sich nicht nur zu ihrer Elternzeit bekennen und Familienarbeit als Erfahrungswert aufwerten, sondern als Erfolgsfaktor herausstellen, um mit dem Weichei-Image zu brechen[4] (vgl. „Väter auf neuen Wegen“ in Die Zeit 25/2006, 14.06.06).
Seit der Einführung des neuen Elterngeldes wird das positive Bild sorgender Väter fortgeschrieben und sowohl Machbarkeit und Ansehen dieser Männer signalisiert. So wird die wachsende Anzahl an Geburten mit dem finanziellen Anreiz für die Väter in Verbindung gebracht, die 7% Männeranteil bei den Antragsstellern gegenüber den 3,5% bei der alten Regelung gelobt und bereits von einem „Baby-Boom“ gesprochen (vgl. „Fürsorglichkeit kann auch männlich sein“ in Der Spiegel, 09/2007; Erdmann in Spiegel-Online, 02.07.2007; „Immer mehr junge Väter nehmen eine Babypause“ in Die Welt, 29. Juni 2007).
2.2 Definition des Fürsorgeaspektes
In der öffentlichen Debatte werden vielfältige Begrifflichkeiten und Termini um Sorgearbeit von Männern verwendet, die mit ihren Bedeutungsinhalten die Richtung vorgeben, wie sich Männer verhalten sollen. Aktive Vaterschaft, Fürsorge, Fürsorglichkeit, Familienorientierung, Familienverantwortung sind nur einige Beispiele. Diese Vielfalt ist auch darauf zurückzuführen, dass sich selbst in der deutschsprachigen Wissenschaft Begrifflichkeiten, die sich mit dem Thema Versorgung, Sorge um andere und Fürsorge und befassen, bislang wenig etabliert sind. In der englischsprachigen Literatur ist der Bereich mit den Begriffen „Care“ und „Carework“ dagegen besser aufgestellt.
Mit Care(work) sind allgemein Tätigkeiten der Pflege und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Menschen und Kindern, also die Arbeit mit und für Abhängige, gemeint. Carework kann alle Formen privater, häuslicher, öffentlicher, bezahlter und unbezahlter Pflege einschließen sowie informelle als auch professionell ausgeübte Personenbetreuung. Fürsorge bzw. Care umfasst dabei die Herstellung und Erhaltung einer lebenswerten Umwelt. Darin sind alle (all-)täglichen Tätigkeiten sozialer, psychologischer, emotionaler und physischer Aufmerksamkeit für Menschen enthalten. Ebenso ist die notwendige Verrichtung der Haushaltsführung, Erziehung, Körperpflege und die symbolische Produktion von (Familien-)Beziehungen eingeschlossen (vgl. Brückner 2004, 155; Tronto 2000, 27; Geissler 2002, 185; Gärtner/Riesenfeld 2004 2004, 102).
Sorgearbeit gilt als liebesbasiert, d.h. sie wird als Ausdruck und Pflege von persönlicher Zuneigung und sozialen Beziehungen verstanden. Dies trifft insbesondere auf nicht entlohnte Fürsorgearbeit zu und rechtfertigt damit auch das niedrige Lohnniveau in bezahlten Pflegeberufen. Private Familienarbeit an nahe stehenden Personen wird daher weitläufig nicht als Arbeit oder als gleichwertig mit Formen der Erwerbsarbeit wahrgenommen (vgl. Geissler 2002, 188f.).
Um Carework und Fürsorge leisten zu können, müssen bestimmte Werthaltungen vorliegen. Damit sind verinnerlichte Bilder und Normen bzw. Ideal- und Moralvorstellungen gemeint, die notwendig sind, um mit Gefühlen und Emotionen anderer umgehen zu können. Diese Ausrichtung des Selbst auf Andere ist in unserer Gesellschaft stark weiblich besetzt. Auf Fürsorge bezogene Werte sind auch bei Männern vorhanden und sozialisatorisch wie kulturell geprägt. Wertorientierungen an sich sind jedoch nur bedingt handlungsleitend: Sie können die Grundlage tatsächlich gezeigten Verhaltens darstellen; ein Wandel von Einstellungen bedeutet jedoch noch keine Abkehr von traditionell verankerten Handlungsmustern und institutionalisierten Verhaltensstrategien. Neuerungen sind bisweilen unter Alltagsbedingungen nicht umzusetzen (vgl. Döge 2004, 6ff.; Gesterkamp 2004, 78f.).
Wenn in der öffentlichen Debatte also von „aktiver Vaterschaft“ und „fürsorglichen Männern“ die Rede ist, ist damit eine deutliche Aufforderung zum aktiven Handeln verbunden. Männer sollen sich an Arbeiten beteiligen, die in unserer Kultur bisher als „mütterlich“ und mit der „Natur der Frau“ als gebärfähigem Menschen verbunden wurden. Damit ist u.a. die liebevolle und zugewandte Versorgung und Betreuung von Klein- und Kleinstkindern gemeint, die auch die Körperpflege, Zubereitung von Mahlzeiten bei aufmerksamer Präsenz einschließt sowie alle anfallenden Arbeiten im Haus (putzen, abwaschen, Wäsche waschen etc.).
In dem massenmedialen Diskurs ist ausschließlich von dem Aufgabenfeld der Kinderbetreuung die Rede. Die demographische Entwicklung zeigt sich jedoch nicht nur in der ausbleibenden Geburtenstärke, sondern auch in einer Überalterung der Gesellschaft. Die Sichtweise der Definition von Familienarbeit muss somit um die Sorge um ältere, aber auch behinderte und chronisch erkrankte Menschen erweitert werden.
2.3 Zusammenfassende Annahmen
Fürsorge leistende Männer scheinen mehr respektable und bedeutsame Vorbilder und Leitmodelle bekommen zu haben, als dies bisher der Fall war. Männliche Fürsorge und reproduktive Arbeit entwickeln scheinbar ein gewisses Gewicht, das von der Nachfrage sozialstaatlicher, politischer Akteure und der organisatorischen Sicht emanzipierter Privathaushalte gestützt wird (vgl. Gesterkamp 2004, 110).
Die Betonung des Exotenstatus und die Art und Weise, wie die massenmedialen Diskurse geführt werden, deuten darauf hin, dass diese Rolle für Männer nicht gerade selbstverständlich bzw. „arttypisch“ ist. Männer sind immer noch stärker in der Erwerbsarbeit als in der Familienarbeit verortet. Mit der Entwicklung scheint sich ein
verstärktes Spannungsfeld aufzutun, das Männlichkeiten in andere Bahnen lenken könnte bzw. soll. Voraussetzung dafür ist, dass Männer aktive Vaterschaft ausüben und die vielfach vernachlässigte Übernahme von Haus- und Versorgungsarbeiten übernehmen wollen. So belegen frühere empirische Studien der Männerforschung, dass mehr Männer die Sphäre der Reproduktionsarbeit für sich erschließen und aktive Väter sein möchten. Viele bleiben im Endeffekt in der Sphäre der Erwerbsarbeit haften und nutzen eher die dort gebotenen Chancen (vgl. u.a. Döge/Behnke 2004).
Dies zeugt davon, dass es noch andere Wirklichkeiten gibt, die auf Männer einwirken. Die wirtschaftsökonomische Seite erhebt Anspruch auf uneingeschränkt leistungsfähige und ultraflexible Arbeitnehmer und schafft wirksame Erfolgsideale. Das äußere Spannungsfeld und die wachsende Unzufriedenheit im Privaten, könnten zunehmend adäquatere Bewältigungsstrategien erforderlich machen, die möglicherweise einen Wandel der männlichen Geschlechterrolle mit sich bringen.
Es müssen also weitere Faktoren und Gesetzmäßigkeiten näher betrachtet werden, die für die Zurichtung und Vergesellschaftung von (männlichen) Individuen wichtig sind. Der Organisation von Arbeit scheint in diesem Zusammenhang ebenfalls eine große Bedeutung zuzukommen, da hier geschlechtliche Freiräume und Möglichkeiten für Subjekte geboten werden oder nicht.
Als weitere ausblickende Fragen stellen sich deshalb:
- Sind diese Debatten Zeichen für ein sich neu entwickelndes Ideal von Männlichkeit, das für Männer im Allgemeinen ein Vorbild wird?
- Reicht die neue Stoßrichtung aus, um Männer einem Bereich zuzuführen, dem sie vorher scheinbar fern geblieben sind, bzw. ihnen eine Teilhabe zu ermöglichen?
- Hat der geforderte fürsorgliche Mann angesichts eines sich verschärfenden kapitalistischen Wirtschaftssystems und dessen Arbeitswelt Zukunft?
- Ist die Entwicklung fürsorglicher Männlichkeiten vielleicht eine adäquate Bewältigung der „Krise von Männlichkeit“ und/oder Subjektivierungsmatrix einer neoliberalen Gesellschaft?
3 Konstitution von Männlichkeiten
Männlichkeit ist ein Topos, der sich nicht nur auf die Träger eines biologischen Geschlechtsmerkmals und sein soziales Geschlecht bezieht, sondern auch ein abstraktes Strukturmerkmal darstellt. Es handelt sich um einen relationalen Begriff, der die Ordnungsweise sozialen Handelns von Menschen und gesellschaftlicher Machtbeziehungen und -positionen bezeichnet (vgl. Döge/Volz 2002, 11). Er verweist auf die Struktur sozialer und individueller Praxis und beschreibt „die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur“ (Connell 2000, 91).
Zentrale Strategien bei der Herstellung von Männlichkeit bzw. Geschlecht sind:
- Differenzierung von Männlichkeit und Weiblichkeit
- Hierarchisierung geschlechtlicher Differenz und Herstellung sozialer Ungleichheitsbeziehungen (Dominanz des Männlichen, Unterordnung des Weiblichen)
- Invisibilisierung des Geschlechtlichen im Handeln (vgl. Meuser 2006, 122).
Männlichkeit und Weiblichkeit bedingen sich somit und schließen sich gegenseitig aus - d.h. ohne die Konstruktion von Weiblichkeit existiert keine Männlichkeit bzw. was männlich ist, kann nicht weiblich sein und vice versa. Männlichkeit ist durch den Phallus mit Autorität verknüpft, während Weiblichkeit symbolisch mit Mangel gleich gesetzt wird. Was Männlichkeit genau ist, ist demnach nie präzise definiert, sondern ergibt sich durch die Abgrenzung zum Weiblichen und muss erst mittels kultureller Deutungen festgelegt werden (vgl. Connell 2000, 91; Döge/Volz 2002, 11).
In der Gegenüberstellung ist das Männliche demnach der nicht markierte Begriff, der für das allgemein Menschliche steht. Der unsichtbare Androzentrismus in der Wahrnehmung von Realität erlaubt die Transformation von geschlechtlich konnotiertem Handeln in allgemeingültige Struktur, gesellschaftliche Prozesse und Institutionen (z.B. Rechsprechung, staatliches Handeln, Funktionalismus von Organisationen). Damit wird die Herstellung und Sicherung einer sozialen Ordnung, die Menschen ein vergeschlechtlichtes Leben führen lässt, begünstigt bzw. aufrechterhalten. Demnach existiert ein Gesamtzusammenhang der Herstellungsbedingungen von Geschlecht in allen gesellschaftlichen Dimensionen (vgl. Becker-Schmidt/Knapp 2000, 128f.; Meuser 2006, 82f., 110ff.):
- Meta-Ebene; damit sind übergeordnete gesellschaftliche Institutionen gemeint, die maßgeblich die Ausgestaltung der gesellschaftlichen Ordnung generieren. Sie gelten als gesellschaftliches und kulturelles Gemeingut, da in ihnen symbolisch der gesellschaftliche Wille, dominante Leitbilder und Ideologien geronnen sind und so die Sinninhalte des Handelns staatlicher Regierung, des Wirtschaftssystems und Organisationen etc. geprägt werden.
- Meso-Ebene; auf der Ebene der Organisationen wie z.B. Behörden, Medien und Unternehmen wird das Handeln von Individuen geordnet und Subjekte vergesellschaftet, indem gesellschaftliche Normen und Ideologien an die Individuen herangetragen und durch diese reproduziert werden. Als Multiplikatoren erinnern sie Individuen stetig an Gültigkeiten von eigener Zielsetzung und kulturellen geschlechtlichen Leitbildern. Geschlecht wird hier durch angelegte institutionelle Praxen zu sich verfestigender sozialer Realität (vgl. Türk 1995, 36f.; Scholz 2004, 24).
- Mikro-Ebene; als Ebene der sozialen Akteure und des individuellen Handelns, in welchem gesellschaftliche und geschlechtliche Rollen ausgeübt werden (doing gender). Mannsein und Frausein wird hier durch Aushandlungsprozesse und Interaktionen bzw. Machtkonstellationen zwischen Individuen in Alltagspraxen hergestellt (vgl. Riesenfeld 2004, 1; Böhnisch 2004, 21, Scholz 2004, 39)
Diese Ebenen sind in einem komplexen, strukturellen Zusammenhang und unterschiedlichsten Wechselwirkungen miteinander verschaltet. Sie befinden sich in starker Abhängigkeit von der Kultur und dem Wirtschaftssystem und sind historisch ausgeformt. Auf der Mikro-Ebene bilden sich spezifische Milieus und Klassenlagen heraus, die unterschiedliche Formen von Männlichkeit hervorbringen. Deswegen wird in der Geschlechterforschung heute nur noch von Männlichkeiten gesprochen, sofern die Individualebene gemeint ist (vgl. Meuser 2006, 120).
Böhnisch gibt die Interdependenzen der gesellschaftlichen Ebenen in einer begrifflichen Einteilung wieder, die an die Bewältigung sich ergebener Spannungen anschließt. Der Begriff der Männerrolle bezieht sich auf das interaktive und institutionsbezogene, zugeteilte Rollenhandeln; Maskulinität wird dagegen eher verwendet, wenn es um psychodynamisch-emotionale Erscheinungsformen und Prägungen geht; in dem subjektumgreifenden Begriff des Mannseins ist die lebensweltliche Perspektive gefasst, die entsteht, wenn Männer in gesellschaftlichen Zonen geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen ausgesetzt sind (vgl. Böhnisch 2004, 22).
Die Gesamtheit der Männer unterliegt der Problematik, dass Männlichkeit nie thematisiert werden musste, da die gesellschaftlichen Strukturen so angelegt sind, dass sich das Männliche stets als Norm bestätigt. Die männliche Geschlechtsidentität und die Position im Geschlechterverhältnis ist vor dem Hintergrund geschlechtsneutral wirkender, selbstverständlicher Gesellschaftsstrukturen schlecht reflektierbar, was es erschwert, andere Handlungsoptionen zu wählen (vgl. Meuser 2006, 83; Meuser, 2002, 8). Gleichzeitig werden hohe Erwartungen an Männer gestellt, ihre geschlechtliche Rolle und eine aktive, dominante Stellung in Familie und Gesellschaft einzunehmen. Die soziale Situation von Männern kann als eine Mischung von Privilegierung und Leid, aber auch als Kombination von Macht und Machtlosigkeit gesehen werden, deren Ambivalenzen von männlichen Individuen ausbalanciert werden müssen (vgl. Meuser 2006, 95). In Anlehnung an Hollstein und Böhnisch zeichnen sich in unserem Kulturkreis folgende „typische Symptome“ bzw. „Bewältigungsprinzipien“ als
Resultat männlicher Sozialisation ab (vgl. Hollstein 2001, 180; Walter 2000, 103;
Waidhofer 2006, 197; Gärtner/Riesenfeld 2004, 92):
- Externalisierung/Abspaltung; unter Externalisierung ist eine „kontinuierliche, zielgerichtete und nach vorne weisende Bewegung, eine Verausgabung, die den Bezugsrahmen für eigene und gesellschaftliche Anerkennung bildet“ (Gärtner/Riesenfeld 2004, 92) zu verstehen. Gefühle und die emotionale Innenwelt müssen dabei abgespalten werden, da sie in Abgrenzung zur Weiblichkeit mit Schwäche verbunden werden und die nach außen gerichtete Aktion hemmen. Das eingeschränkte Gefühlsleben begünstigt Frustration, Feindseligkeit und Wut, deren letztes Ausdrucksmittel ausagierte Gewalt sein kann;
- Homophobie und Körperferne; damit ist die Nichtwahrnehmung des eigenen Körpers und Missachtung körperlicher Warnsignale, Angst vor körperlicher Nähe zu anderen Männern, Funktionalisierung des Körpers und Abspaltung von Emotionalität in der Sexualität sowie Objektivierung von Frauen gemeint;
- Kontroll-, Macht- und Wettbewerbszwänge; bezeichnen u.a. Kontrolle der Umwelt und sich selbst z.B. durch Bevorzugung von Rationalität und Verdrängung von Emotionalität, Hervorbringen von Dominanz, Aktivität und Macht über andere;
- Sucht nach Leistung und Erfolg; wird als Mittel der Bestätigung der eigenen Männlichkeit durch andere Männer und vor Frauen eingesetzt. Hier wirkt aber auch das Prinzip der Benutzung, d.h. das Funktionalisieren und Abwerten von anderen zur Erhöhung des Selbst.
3.1 Theorien der Männerforschung
Als zentrale Theorien und Theorieansätze gelten:
1. Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von Raewyn (Robert) W. Connell, welches es ermöglicht, gesellschaftliche Ordnung nicht nur auf Basis von männlicher Dominanz über Frauen zu betrachten, sondern auch ein Augenmerk auf die Hierarchisierung von Männlichkeiten bzw. Dominanzverhältnisse zwischen Männern zu legen. Hierdurch kann sich dem Verständnis von Dynamiken und Prozessen der Inklusion und Exklusion unter Männern angenähert werden.
2. Die Theorie des männlichen Habitus nach Pierre Bourdieu, welche die Beziehungen zwischen gesellschaftlicher Struktur und individuellem Handeln heraus stellt und verdeutlicht, inwiefern Machtverhältnisse durch alltägliche Praxen gestützt werden.
Beiden gemein ist, dass sie in der Tradition der Genderforschung stehen, die davon ausgeht, dass Geschlecht als Ordnungskategorie sozial konstruiert ist: Das biologische Geschlecht von Menschen stellt ein symbolisches Kriterium dar, aufgrund des- sen sich stereotype Zuschreibungen machen lassen, die Menschen geschlechtlich konnotierten Sphären zuweisen und ihnen einen spezifischen Aktionsrahmen bieten. Dabei wird dem stereotyp männlichen die Gestaltungs- und Deutungsmacht zugestanden. Außerdem geht es bei den beiden Konzepten um eine Vermittlung zwischen Struktur und Handeln, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung; um der Reproduktion und Transformation von Geschlechterverhältnissen gerecht zu werden, ist es sinnvoll die Konzepte aufeinander zu beziehen (vgl. Scholz 2004, 41f.).
Im Habitus hat das Individuum ein Geschlecht in dem es „doing gender“ betreibt: Geschlecht wird von Individuen durch alltägliches Handeln reproduziert und sich selbst durch geschlechtliche Praxen der eigenen Geschlechtsidentität versichert. Da dies im Rahmen des Habitus geschieht, ist Geschlecht, obwohl es der Person als Merkmal zugeschrieben wird, keine individuelle Eigenschaft, sondern Ausdruck von Vergesellschaftung. Die kulturell und historisch herausgebildeten Deutungsmuster werden mit der Errichtung einer geschlechtlichen Identität durch „körperreflexive Praxen“[5] (Connell) „inkorporiert“ (Bourdieu), d.h. sie werden in den Körper eingeschrieben und sind am Ende nicht mehr getrennt von der Person und dem biologischen Geschlecht wahrnehmbar. So entsteht ein selbstreferenzielles System, das als „natürliche Gegebenheit“ in seinem Selbstverständnis nicht mehr hinterfragt wird und dessen sozialer Hintergrund sich kognitiven Prozessen entzieht (vgl. Meuser 2006, 117f.).
Bourdieu bezeichnet Habitus als System von Dispositionen, welche als Erzeugungsprinzip von Strategien wirken, „die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuen Situationen entgegen zu treten“ (Bourdieu zit. in Meuser 2006, 113). Männer und Frauen verfügen über nur einen geschlechtlichen Habitus, der sich allerdings entsprechend der Klassen- und Soziallage der Individuen unterschiedlich ausformt[6]. Die Position im gesellschaftlichen System ist ausschlaggebend dafür, auf welche Ressourcen bzw. Kapitalien zugegriffen werden kann, was sich in distinktiven Merkmalen niederschlägt. Innerhalb einer Gruppe mit sich ähnelnder Soziallage (bedingt durch Klasse, Ethnie oder Geschlecht) vermitteln entsprechend geprägte Praxen habituelle Sicherheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die Einhaltung bestimmter Normen wird von den anderen Gruppenmitgliedern überwacht und ein Austritt häufig durch Ausschluss aus der Gemeinschaft sowie von gesellschaftlichen Chancen sanktioniert. Ein männlicher Habitus muss durch eine Vielzahl u.a. körperbezogener Praxen und Rituale erst hergestellt werden und ist deshalb besonders sensibel für ein „Misslingen“. Insbesondere „die ernsten Spiele des Wettbewerbs“, die in homosozialen Männergruppen praktiziert werden (z.B. in Wirtschaftsunternehmen, Politik, Institutionen wie Militär und Kirche), dienen zur Herstellung und Bewertung von Männlichkeiten durch andere. Hierdurch werden Ränge in der Hierarchie von Männlichkeiten und der Zugang zu gesellschaftlicher Macht festgelegt (vgl. Meuser 2006, 113, 124, 129f.).
Auch Connell verortet in Industriegesellschaften zentrale Beziehungsstrukturen, in denen geschlechtliche Praxen vollzogen werden und durch die Geschlecht bzw. Männlichkeiten sich manifestieren und reproduzieren (vgl. Connell 2000, 92ff.; Meuser 2006, 100):
1. Machtbeziehungen: Dominanz von Männern, über Frauen und andere Männer,
2. Produktionsbeziehungen bzw. Arbeit, die sich im kapitalistischen Wirtschaftssystem herausbilden, das auf geschlechterdifferenzierender Arbeitsteilung basiert und zu geschlechtsspezifischen Akkumulationsprozessen führt,
3. emotionale Bindungsstrukturen, d.h. normative libidinöse Besetzung und Objektwahl, Heteronormativität als dominantes Muster emotionaler Anziehung,
4. Symbolisierung und Diskursivierung: Globale Zirkulation von Geschlechterbildern über die Massenmedien (z.B. über sportliche Wettkämpfe oder den kämpferischen, individualisierten Geschäftsmann) (vgl. Wolde 2007, 34).
Connell sieht diese Struktur in ihren Ausdeutungen und Relationen als historisch und kulturell beweglich an. Die Hauptachse der Machtstruktur ist jedoch die Verknüpfung von Autorität mit Männlichkeit, die sowohl das Geschlechterverhältnis als auch eine Hierarchie von Autoritäten zwischen Männlichkeiten bestimmt (vgl. Meuser 2006, 101). Diese Relation fasst Connell mit dem Begriff der „hegemonialen[7] Männlichkeit“.
„Hegemoniale Männlichkeit kann man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimationsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (bzw. gewährleisten soll)“ (Connell 2000, 98).
Hegemoniale Männlichkeit ist nicht als feste Charaktereigenschaft zu sehen, sondern stellt ein spezifisches kulturelles Ideal bzw. Orientierungsmuster dar, welches dem „doing gender“ der meisten Männer zugrunde liegt. Insofern ist es identitätsstiftend, da es bewirkt, dass sich Männer dazu in Beziehung setzen müssen; d.h. Männlichkeiten strukturieren sich entlang des hegemonialen Leitbildes. Dies erfolgt nach den
Prinzipien von Unterordnung, Komplizenschaft und Marginalisierung (vgl. Connell 2000, 99f.f; Meuser 2006, 101, 103ff.; Wolde 2007, 37):
Hegemoniale Männlichkeit wird am meisten durch das Weibliche bedroht. Homosexuelle Männlichkeiten sind in der Nähe des Weiblichen verortet. Sie werden als Angriff auf das Mannsein an sich, die Norm der Heterosexualität und der Geschlechterordnung betrachtet. Deshalb wird diese Gruppe an das unterste Ende der Männlichkeitshierarchie verwiesen (Prinzip der Unterordnung). Untergeordnete Männlichkeiten sind nur vage definiert, denn indem Alternativen nicht zu einer kulturellen Definition kommen können, sind sie als Gegenmodell auch nicht erkennbar. Außerdem wird der Ausschluss von unerwünschten Männlichkeitsbezügen zur impliziten Bestimmung dessen, was Mannsein bedeutet (vgl. Meuser 2006, 104; Wolde 2007, 36).
Marginalisiert oder abgewertet werden heterosexuelle männliche Lebensweisen, die sich hegemonialen Mustern entziehen oder dagegen opponieren - also ebenfalls eine Alternative zu der gängigen Männlichkeitsnorm darstellen (Prinzip der Marginalisierung). Marginalisierung verschränkt sich mit weiteren Merkmalen wie Klassenlage oder Ethnie. Außerdem sind Männlichkeiten betroffen, die vor dem Horizont der Zweigeschlechtlichkeit „weibliche“ Eigenschaften in ihr Persönlichkeitskonzept integrieren. Meuser benennt in dem Zusammenhang explizit „den Hausmann“, „den sanften Mann“, aber auch den „bewegten Mann“, der seine Männlichkeit hinterfragt. Diese Männlichkeiten werden als „das Andere“ definiert und dienen eher der Konstruktion und Verfestigung der hegemonialen Norm, als dass sie zu einer Schwächung beitragen (vgl. Meuser 2006, 104; Wolde 2007, 36f.).
Da es zahlenmäßig nur wenige Männer gibt, die die hegemonialen Muster vollständig verwirklichen können, bedarf es der Komplizenschaft eines Großteils der Männer, die das Herrschaftssystem stützen (Prinzip der Komplizenschaft). Männer werden daher aufgrund ihres Geschlechts allgemein begünstigt. Connell bezeichnet dies als „patriarchale Dividende“. Wichtiges Mittel ist hierbei die Norm der Heterosexualität mit der die gesellschaftliche Institution der Ehe verknüpft ist. Sie sichert jedem Mann rechtlich eine dominante Position über die Frau zu und verweist auf eine spezifische Arbeitsteilung mit sich ableitenden Abhängigkeits-/Unabhängigkeitsbeziehungen. Somit können auch Männer, die insgesamt wenig an der gesellschaftlichen Macht partizipieren, sich allein durch ihr Mannsein auf bedingte Vorzüge im privaten Lebensbereich stützen. Hierdurch sind sie an das Ideal hegemonialer Männlichkeit angeschlossen (vgl. Meuser 2006, 103; Wolde 2007, 35).
Alle Männlichkeiten stehen aufgrund ihrer geschlechtlichen Zuordnung in Bezug zu hegemonialen Mustern, indem sie sich auf die „Spielregeln“, die Männlichkeit konstituieren, einlassen und darauf bezogen bleiben. Sich entsprechend hegemonialer Anrufungen zu verhalten, vermittelt habituelle Sicherheit bei Männern (Meuser 2006, 277, 132). Die Erscheinungsformen von Männlichkeiten können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Es besteht aber eine gewisse Einheit in der Differenz, denn auch gegensätzliche Verhaltensweisen sind gleichermaßen Ausdruck des männlichen Habitus bzw. eine individuelle Reaktion auf die Herstellungsbedingungen hegemonialer Muster (vgl. Meuser 2006, 125f.; Gärtner/Riesenfeld 2004, 90). Dies wird befördert durch die überaus starke Institutionalisierung von hegemonialer Männlichkeit. Hiermit sind nicht nur soziale Praktiken gemeint, sondern auch gesellschaftliche Organisationen, die als jene sozialen Felder gelten, in denen die zentralen Machtkämpfe einer Gesellschaft ausgetragen werden. Hierdurch wird eine Elitenbildung vorangetrieben, die Standardpraktiken für alle setzt. Momentan wird hegemoniale Männlichkeit als Leitbild einer globalisierten, neoliberalen Gesellschaft zum einen in dem technokratischen Milieu des (Top-)Managements angesiedelt, wo die Basis interpersonelle Dominanz darstellt, und zum anderen in den Professionen, wo Wissen und Expertise zentral sind (z.B. technische Entwicklung) (vgl. Meuser 2006, 130).
[...]
[1] Mit „Männerforschung“ sind in diesem Fall wissenschaftliche Betrachtungen gemeint, in denen die Geschlechtlichkeit von Männern reflektiert und sie als soziale Konstruktion untersucht wird. Dies umfasst u.a. Arbeiten aus dem Bereich der kritischen/reflexiven Männerforschung, der Geschlechterforschung und der Frauenforschung in Bezug auf Themen der Fürsorgearbeit.
[2] Becker machte Ende der 1990er Jahre nach der Geburt seines ersten Sohnes medial Furore, als er sich für eine Baby-Pause aus Öffentlichkeit und Tennissport zurück zog (vgl. Baer 1998).
[3] „Was ist männlich? - Eine Zeit-Serie über den Widerspruch, ein Mann zu sein“; Die Zeit, 25-28/2006
[4] Als Beispiele lassen sich nennen: Anton Schaaf (Bundestagsabgeordneter der SPD), der seine Tochter notfalls im Bundestag wickelt („Der Improvisierer“ in Die Zeit 25/2006, 14.06.06); Gregor Gysi (Linkspartei) als allein erziehender Vater eines Sohnes ab dem 2. Lebensjahr („Der Alleinerziehende“ in Die Zeit 25/2006, 14.06.06); Dirk Niebel (Generalsekretär der FDP), der die Erziehung seiner drei Kinder in jahrelanger Teilzeit mit dem Beruf vereinbarte („Der Teilzeit-Vater“ in Die Zeit 25/2006, 14.06.06).
[5] Connell definiert körperreflexive Praxen als Herstellung von Geschlecht durch spezifische Durchführung und Deutung von körperlichen Vorgängen (Formen von Sexualität, Sport, Initiationsriten etc.). Er betrachtet den Körper als Agenten und Objekt der Praxis, aus der wiederum Strukturen entstehen, innerhalb derer Körper definiert und angepasst werden (vgl. Connell 2000, 73ff.; 81).
[6] Meuser bezeichnet den Habitus als das eine bestimmende, generierende Prinzip für den männlichen Habitus und Männlichkeiten als eine Vielzahl von Ausdrucksformen (vgl. Meuser 2006, 120).
[7] Der Hegemonie-Begriff geht auf Antonio Gramsci zurück, der damit Klassenbeziehungen beschrieb. Herrschaft wird in modernen Gesellschaften nicht durch Zwang erzeugt, sondern baut im Gegensatz zu anderen Formen von Herrschaftsverhältnissen ein großes Maß an Autorität auf, die von den Beherrschten akzeptiert, gestützt und legitimiert wird. Außerdem profitiert fast jeder durch das System und wird in die Lage versetzt, in bestimmten Bereichen selbst Formen von Macht auszuüben. Hegemonie ist nicht statisch und unveränderbar: Als hegemonial wird das angesehen, was sich in historisch spezifischen Situationen gegen konkurrierende Möglichkeiten durchsetzt. Kulturelle Hegemonie bezeichnet demnach die Produktion zustimmungsfähiger Ideen. Es herrscht ein Machtkampf um die vorherrschenden Ideen, da das Besetzen von Wissensbeständen die allgemeine Auffassung von Realität bestimmt. Leitideen können also herausgefordert und durch neue Konstellationen verworfen werden (vgl. Walter 2000, 100f.).
- Arbeit zitieren
- Andrea Kawall (Autor:in), 2007, Männlichkeiten im Spannungsfeld zwischen flexibilisierter Erwerbsarbeit und neuen Fürsorgeanforderungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150743
Kostenlos Autor werden



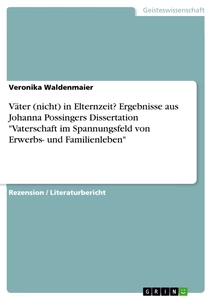















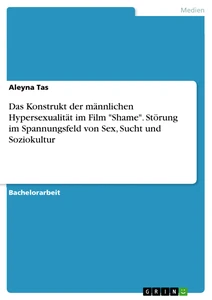


Kommentare