Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definition(en) von Familie
3 Definition von Bildung
4 Die Familie im Wandel
4.1 Die Familie im historischen Wandel
4.2 Familie(nformen) im sozialen Wandel – Die Individualisierungsthese
4.2.1 Weitere theoretische Erklärungsansätze für den sozialen Wandel der Familie
4.2.2 Die Rollenverteilung innerhalb der Familie - Karrierefrauen und Hausmänner
5 Zur Bedeutung verschiedener Familienformen
5.1 Die traditionelle Kleinfamilie
5.2 Die Ein-Eltern-Familie
5.3 Patchwork- und Stief-Familien
5.4 Die Benachteiligung verschiedener Familienformen
6 Funktionsverlust oder Funktionsverlagerung?
6.1 Die Funktionen der Familie
6.2 Alltägliche Lebensführung
7 Sozialisation in der Familie
7.1 Verschiedene Aspekte der Sozialisation
7.1.1 Erziehungsstile
7.1.2 Zum Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen
7.1.3 Geschlechterrollen
7.1.4 Die besondere Bedeutung der Geschwister
7.2 Gesellschaftliche Sozialisation: der Habitus
7.3 Sozialisation in Schule und Gleichaltrigengruppe
8 Familie und soziale Ungleichheit
8.1 Der soziale Raum nach Pierre Bourdieu
8.2 Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital
8.2.1 Kulturelles Kapital in der Familie
8.2.2 Soziales Kapital in der Familie
8.2.3 Das Konzept der intergenerativen Transferbeziehung
9 Bildungsverantwortung
9.1 Trennung von lebensweltlicher und institutioneller Bildung
9.1.1 Lebensweltliche Bildung von Kindern und Jugendlichen
9.1.2 Zum Zusammenhang von Lebenslage und Bildungserfolg
9.2 Überwindung der Differenz zwischen Elternhaus und Schule
9.2.1 Familienbildung - Elternbildung
9.2.2 Eine Schule für alle Kinder?
10 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abkürzungen
Anhang
„Bildung als eine Idee der Moderne drückt also die Notwendigkeit der Entfaltung eigener Vernunft (Autonomie) aus, unterstreicht die Selbstentfaltung und die Einmaligkeit jedes Einzelnen und ist darauf gerichtet, die Würde des Menschen gegen die Vereinnahmung fremdgesetzter Zwecke zu betonen.“[1]
1 Einleitung
In der gesellschaftlichen Öffentlichkeit sowie der (bspw. erziehungswissenschaftlichen bzw. soziologischen) Fachwelt wird immer wieder die Frage diskutiert, von welchen Faktoren der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen abhängig sei und wie die Chancen von Heranwachsenden auf eine erfolgreiche Bildung verbessert und optimiert werden können sowie welchen Stellenwert die Familie dabei hat. Im Rahmen meiner Diplomarbeit möchte ich mich nun diesem Thema widmen und mich kritisch mit folgender Fragestellung auseinandersetzen: Inwieweit beeinflusst die Herkunftsfamilie den Bildungserwerb von Kindern und Jugendlichen?
Da Kinder bereits vor Eintritt in die Schule Bildung und Erziehung erfahren und die primäre Sozialisation innerhalb der Kernfamilie stattfindet, möchte ich klären, welche Faktoren sich besonders auf den Bildungserwerb auswirken.
Sobald es um Bildung geht, muss diese gemessen werden. Hier soll dies einerseits u.a. anhand von Schulformen und –abschlüssen erfolgen. Andererseits möchte ich berücksichtigen, welche weiteren Kompetenzen und Fähigkeiten, auch bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung, durch die Familie vermittelt werden.
Um über Familie sprechen zu können, muss zunächst eine Definition erfolgen, die keinesfalls so einheitlich und klar ausfallen kann, wie man zunächst vermutet werden könnte. Die Institution Familie und die Bedeutung der Familie haben im Laufe der Zeit einen Wandel erlebt, den ich kurz beschreiben möchte, um die aktuelle Situation der Familie bzw. der Familienformen zu verdeutlichen.
Ein Faktor, der den Bildungserwerb von Kindern beeinflussen kann, ist die Familienform, in der sie aufwachsen. Durch die Pluralisierung der Lebensformen und der zunehmenden Individualisierung haben sich verschiedene Familienformen (z.B. Ein-Eltern-Familien, Patchwork- oder Stief-Familien, Familien mit gleichgeschlechtlichen Paaren) entwickelt, denen heute eine stärkere Beachtung geschenkt wird als in der vorindustriellen Zeit, als sie nur als defizitäre „Notlösung“ galten. Neben den Familienformen hat sich auch die Rollenverteilung der Eltern verändert, hier besonders stark die Rolle der Frau.
Ich möchte nun zunächst exemplarisch untersuchen, ob die Sozialisation in den verschiedenen Familienformen mit Kindern unterschiedlich verläuft und ob sich daraus Vorteile oder Nachteile für die Kinder, die in diesen Familienformen aufwachsen, ergeben. Zur Bedeutung der Geschwister werde ich später noch ausführlicher kommen, wenn es um die Vermittlung bestimmter Fähigkeiten durch die Kernfamilie geht.
Um zu erkennen, ob die Sozialisation in der Familie optimal für das Kind abläuft, muss man festlegen, welche Funktionen eine Familie erfüllen und welche grundlegenden Fähigkeiten sie den Kindern vermitteln sollte. Zuerst werde ich allgemein die Funktionen der Familie beschreiben und in einem weiteren Kapitel ausführlicher auf einige Fähigkeiten (z.B. Lesekompetenz) eingehen, welche die Familie ebenfalls grundlegend fördern sollte.
Bildung ist immer noch an soziale Herkunft gekoppelt, also an die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Milieu. Kann eine Familie ihr Kind abhängig vom sozialen Milieu in seinem Bildungserwerb unterstützen? Bestehen die sozialen Ungleichheiten bezüglich der Bildung, die eine Familie „vererben“ kann? Um diesen Fragen nachzugehen, möchte ich zunächst das Konzept der sozialen Ungleichheit anhand der Theorie des „Sozialen Raums“ und der Kapitalarten nach BOURDIEU verdeutlichen. So wird klar, dass Familien ihren Kindern unterschiedliches „Startkapital“ zur Verfügung stellen können. Evtl. ist dieses Startkapital ausschlaggebend für den Bildungserwerb der Kinder.
Neben dem Startkapital vermitteln Eltern ihren Kindern Werte und Orientierungsmuster auf unterschiedliche Art und Weise, z.B. durch unterschiedliche Erziehungsstile. Diese Erziehungsstile begünstigen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die wiederum durch eine Zugehörigkeit zu einem sozialen Milieu bedingt sein können. Ein Erziehungsziel kann z.B. die Lesekompetenz sein, die äußerst wichtig ist, um in der Schule erfolgreich zu sein.
Neben der Sozialisation durch die Familie spielen auch die Gleichaltrigen oder die Institution Schule eine Rolle. Auf diese beiden Aspekte werde ich nur kurz eingehen, da das Hauptaugenmerk auf der Herkunftsfamilie liegt.
Um zu verdeutlichen, dass Kinder durch die Familie nicht nach Belieben und völlig frei von gesellschaftlichen Zwängen bzw. Forderungen sozialisiert werden, werde ich das Konzept des Habitus vorstellen, das die gesellschaftlichen Aspekte und die Problematik des Zusammentreffens unterschiedlicher sozialer Milieus erklären kann. Diese Problematik der unterschiedlichen Passung von familialen Orientierungsmustern oder Verhaltensweisen und anderen, institutionellen Systemen (Schule, Arbeitsplatz) wird auch in der Trennung von lebensweltlicher und institutioneller Bildung deutlich. Hier können sich für manche Kinder Konflikte ergeben, die sie nicht durch ihre gewohnten Kommunikations- oder Handlungsweisen lösen können. So entsteht das Problem, dass diese Kinder nicht die geforderten Leistungen erbringen können, da sie „nicht die gleiche Sprache sprechen“ wie LehrerInnen oder MitschülerInnen. Da stellt sich die Frage, ob das Prinzip der Meritokratie, also „Chancen durch Leistung“ so umgesetzt Sinn ergibt, oder ob ein anderes Prinzip, mit anderen Maßstäben oder eine andere Definition von Leistung (die sich momentan an der Mittelschicht und an Erwerbstätigkeit orientiert) notwendig ist. Wenn davon ausgegangen wird, dass dieses Prinzip in unserer Gesellschaft umgesetzt wird, jedoch nicht alle Kinder die gleichen Chancen haben, stellt sich die Frage, an welchen Stellen die Pädagogik ansetzen kann, um der angestrebten Chancengleichheit näher zu kommen. So kann auf der einen Seite mit der Familie und ihren einzelnen Mitgliedern gearbeitet werden, indem Konzepte zur Familienbildung entwickelt und umgesetzt werden.
Schule versucht eine kompensatorische Erziehung, da sie einerseits von Defiziten der „Unterschichtkinder“ ausgeht. Andererseits kann (oder muss) auch die Institution Schule eine Veränderung durchlaufen, um die vielzitierten Defizite mancher Kinder abzubauen und allen Kinder die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen, unabhängig davon, welche Kompetenzen und Fähigkeiten ihnen ihre Herkunftsfamilie vermittelt (hat). Sobald die Defizite erkannt sind, kann man die Schuld nicht mehr allein den Eltern zuschreiben. Auch Lehrerinnen und Lehrer (und auch pädagogische Fachkräfte) müssen aktiv werden und den Kindern eine Lernumwelt anbieten, die sie anregt, ihre Fähigkeiten einzusetzen um sich weiter zu entwickeln und so ihren Platz in der Gesellschaft finden zu können.
2 Definition(en) von Familie
Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Familie eine biologische, wirtschaftliche und geistig-seelische Lebensgemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Generationen, die aber nicht unbedingt miteinander verwandt sein müssen.
Die Soziologin NAVE-HERZ sieht Familie als eine Eltern-Kind-Beziehung und unterscheidet zwischen Drei-Generationen-Familie, Eltern-Familie sowie Ein-Eltern-Familie (Mutter- oder Vater-Familie).
Die Definition des Statistischen Bundesamtes fasst den Begriff Familie sehr weit:
„ „Als Familie im Sinne der amtlichen Statistik zählen- in Anlehnung an Empfehlungen der vereinten Nationen- Ehepaare ohne und mit Kind(ern) sowie alleinerziehende ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Väter und Mütter, die mit ihren ledigen Kindern im gleichen Haushalt zusammenleben“ (Statistisches Bundesamt 1999, Zeitreihenservice im Internet)[2] “
In den bisher aufgeführten Definitionen wird der subjektive Aspekt ebenso außer acht gelassen wie die Emotionen, die im Familienleben eine große Rolle spielen.
Ergänzend schreibt BERTRAM:
„Familienmitglieder sind meist Verwandte, müssen es aber nicht sein. Aus der Sicht der Befragten sind jedoch nicht alle, die zur Familie gehören könnten, auch tatsächlich Mitglieder ihrer Familie. Andererseits werden Personen zur eigenen Familie gerechnet, die nach dem allgemeinen Verständnis nicht dazu gehören[3] “
Hier wird klar, dass Familie sehr individuell definiert werden kann. Selbst innerhalb einer Familie (nach der Definition z.B. des Statistischen Bundesamtes) können unterschiedliche Auffassungen vorherrschen, wer genau zur Familie gehört, und wer nicht. Diese subjektiven Entscheidungen sind von Gefühlen geleitet und wiegen für das Individuum meist mehr als objektive Faktoren, wie z.B. der Familienname.
In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Herkunftsfamilie im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Mit dieser Bezeichnung sind die Menschen gemeint, die zusammen in einem Haushalt leben, verschiedenen Generationen angehören und starke emotionale Bindungen zu einander haben. I. d. R. werden dies Mutter und / oder Vater (oder ein(e) Erziehungsberechtigte(r)) und ein oder mehrere Kind(er) sein. Ob es sich bei diesen Kindern um die leiblichen Kinder der Erwachsenen oder um Adoptiv-Kinder, Pflege-Kinder und um Geschwister oder um nicht verwandte Kinder handelt spielt zunächst eine untergeordnete Rolle, da sie ihr Leben gemeinsam gestalten. Lebt ein oder mehrere Großelternteil(e) ebenfalls im gleichen Haushalt, werden diese Personen mit zur Familie gezählt.
Allgemein gilt
„als zentrales Kennzeichen von Familie die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehr aufeinander bezogenen Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen, verstanden werden. […] Gleichzeitig lässt sich Familie als gesellschaftliche Institution begreifen und das Familienleben mit sich verändernden Leitbildern, Regeln, Handlungsmustern und Aufgaben(-erfüllung) in Verbindung bringen, so dass z.B. das Familienleben als das private Zusammenleben der Generationen nach außen abgrenzbar wird und auf diese Weise die Qualität von Familienbeziehungen untersucht werden kann[4] “.
Um Familien zu unterscheiden, können nicht nur die Familienstruktur bzw. die Familienform herangezogen werden, sondern auch die Verortung der Familie im sozialen Milieu betrachtet werden. Bei der Konstruktion von sozialen Milieus geht es nicht darum, eine Gruppe von Menschen zu beschreiben, die auch in der realen Welt auf irgendeine Weise miteinander verbunden ist, sondern vielmehr darum, die äußeren Lebensbedingungen und inneren Haltungen von Menschen im Zusammenwirken zu begreifen.
„So fassen „soziale Milieus“ Gruppen Gleichgesinnter zusammen, die gemeinsame Werthaltungen und Mentalitäten aufweisen und auch die Art gemeinsam haben, ihre Beziehungen zu Mitmenschen einzurichten und ihre Umwelt in ähnlicher Weise zu sehen und zu gestalten“[5]
HRADIL unterscheidet folgende Milieus, die sich durch Lebensziel, Lebensweise und soziale Lage unterscheiden: Konservativ-technokratisches Milieu, Kleinbürgerliches Milieu, Traditionelles ArbeiterInnenmilieu, Traditionsloses ArbeiterInnenmilieu, Aufstiegsorientiertes Milieu, Modernes bürgerliches Milieu, Liberal-intellektuelles Milieu, Modernes ArbeitnehmerInnenmilieu, Hedonistisches Milieu, Postmodernes Milieu[6] (siehe Anhang Tabelle 7).
Innerhalb dieser sozialen Milieus sind die Verhaltensweisen dennoch nicht von vornherein bestimmbar, jeder Mensch verfolgt seinen eigenen Lebensstil, den er gestalten kann, der aber immer geprägt ist von diversen Faktoren wie z.B. Alter, Lebensform, Bildung, Geschlecht, Wohnort, Berufsstand, Einkommen und somit nicht völlig frei gewählt ist, auch wenn es dem / der Betreffenden so scheint.
3 Definition von Bildung
Die vielfältige und weitreichende Diskussion um eine genaue und aktuelle Definition des Begriffs „Bildung“ (z.B. in der Wissensgesellschaft) kann und muss hier weder vertieft noch fortgeführt werden. Es ist lediglich wichtig festzustellen, dass Bildung weder ausschließlich reines Wissen noch eine gewisse Anzahl von Zertifikaten und Zeugnissen oder ein bestimmtes Maß an sozialen Kompetenzen bedeutet. Vielmehr ist Bildung eine Verbindung dieser gesamten Aspekte, einer allein würde nicht ausreichen. Durch Bildung im Sinne von Persönlichkeitsbildung werden Fähigkeiten erlangt, „die es dem Menschen erlauben, mit neuen und / oder problematischen Situationen umzugehen“[7], und die „Teilhabechancen am kulturellen und sozialen Leben eröffnen soll[en]“[8] Eine klare Trennung von Bildung und Erziehung ist nicht mehr möglich, oft werden die beiden Begriffe heute synonym verwendet[9], da nicht eindeutig ist, wo Erziehung aufhört, wo Bildung anfängt und wo genau die Unterschiede gemacht werden können.
„…Bildung als Bedingung für innere und äußere Freiheit durch geistige Selbständigkeit. Das ist ihr Zweck, dieser Zweck ist überzeitlich. Bildung ist daher der Weg zur ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit, den Dimensionen eines Verständnisses vom Menschen, das ihn tiefer begreift und würdigt denn nur als ein ökonomisches Wesen: Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, sein „Kapital“, aber er ist kein „Humankapital“; Bildung bietet die Möglichkeit, durch Wissen und Gewissen, durch Aneignung von „Welt“, Tradition und kultureller Herkunft und die Verinnerlichung von Moralität sein Leben selbständig zu gestalten und sich „in der Welt“ zu verstehen.“[10]
So wird auch klar, warum eine Festlegung von sog. Bildungsstandards kaum möglich sein kann. Dennoch lassen sich einige Kompetenzfelder definieren. Die Fähigkeiten , welche für eine nachhaltige Entwicklung in der Wissensgesellschaft unumgänglich sind, werden von TIPPELT folgendermaßen aufgeführt: Fachkompetenzen, methodische und instrumentelle Kompetenzen (u.a. allg. Kulturtechniken, Fremdsprachen), personale Kompetenzen (u.a. Selbstbewusstsein, Strukturierungsfähigkeiten), soziale und kommunikative Kompetenzen (u.a. Gesprächsführung und Empathie) sowie Lernkompetenzen und inhaltliches Basiswissen.[11]
Da ich mich in dieser Arbeit mit Bildungserfolgen und erfolgreicher Bildung von Kindern und Jugendlichen beschäftige, stellt sich natürlich die Frage, was unter Bildungserfolg zu verstehen ist. Primär geht es um den erfolgreichen Schulabschluss sowie das Ausüben einer Erwerbstätigkeit, die aber nicht unbedingt eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt und im Idealfall einen sozialen Aufstieg bedeutet. Grundlegend für eine erfolgreiche Schullaufbahn und das Erreichen von Bildungsabschlüssen ist die Fähigkeit am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, den eigenen Tagesablauf zu strukturieren und seine eigene Position in der Gesellschaft zu verankern. Diese Lebensführungskompetenzen werden nicht hauptsächlich in Bildungsinstitutionen vermittelt, sondern hier trägt die Familie der Kinder und Jugendlichen den größten Anteil. Familien müssen ihre Kinder auf ein Leben in der Gesellschaft vorbereiten können und sollten ihnen die bestmöglichen „Startchancen“ bieten. Zu einer erfolgreichen Bildung gehört wohl der soziale Aufstieg (oder auch das Beibehalten der angestammten sozialen Position) einer Person im Vergleich zu den Eltern bzw. der Herkunftsfamilie.
Durch Sozialisation wird die Persönlichkeit der Kinder geprägt und es werden ihnen bestimmte Fähigkeiten vermittelt, die in ihrer Herkunftsfamilie als bedeutsam anerkannt werden. Sobald aber diese Fähigkeiten (und Verhaltensweisen oder Kommunikationsformen) mit anderen Bereichen der Gesellschaft (Schule, Arbeitsplatz) nicht übereinstimmen, können Konflikte auftreten.
Ich möchte nun näher untersuchen, inwieweit die Familie ihren Kindern Bildungschancen eröffnet oder verwehrt und wie die Bildungserfolge (v. a. in der Schule) beeinflusst werden.
Um aber einen Schulabschluss erreichen zu können und auch später im Berufsleben erfolgreich sein zu können, müssen Heranwachsende noch viele weitere, nicht durch Zeugnisse und Zertifikate nachweisbare Fähigkeiten erwerben. Hier spielen die Begriffe soziales und kulturelles Kapital eine wichtige Rolle. Dieses Kapital ist notwendig um einen bestimmten Status, eine Position im sozialen Raum einzunehmen, der möglichst mit den Habitus kompatibel ist, da es sonst zu inneren Konflikten kommen kann.
Kinder und Jugendliche müssen lernen ihr Leben (und auch ihr Lernen) eigenverantwortlich zu gestalten, ein soziales Umfeld aufzubauen und auch Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Meist erfolgt immer noch eine Trennung von Bildungsbereichen, so ist z.B. die Familie für die lebensweltliche Bildung zuständig und in der Institution Schule können Zeugnisse der formalen Bildung erworben werden. Alle weiteren Fähigkeiten[12] müssen nebenbei erlernt werden, was für manche SchülerInnen zum Problem werden kann.
„Lernen in der Schule erfolgt als curricular vorgegebenes, methodisch und zeitlich strukturiertes sowie vor allem fremdbestimmtes Arbeiten. Was inhaltlich in der Schule gelernt wird, das hat mit dem Alltag der Schüler/innen allenfalls am Rande zu tun, das Alltagswissen lässt sich kaum im Unterricht einbringen.“[13]
Erfolg in der Schule entscheidet aber immer noch über einen großen Teil des weiteren Lebens und die Möglichkeiten, die sich einem Menschen bieten.
Durch die im Laufe des Lebens erworbenen Bildungsabschlüsse erfolgt eine Zuteilung der Lebenschancen, legitimiert durch (erfolgreiche) Leistung im Bildungssystem. Gute Leistungen im Bildungssystem bedeuten also gute (bessere) Lebenschancen. Um diese möglichst hochwertigen Bildungsabschlüsse zu erreichen sind auch heute noch verschiedene Ressourcen von Vorteil, wie z.B. das Beherrschen der Unterrichtssprache oder das Maß der Lernmotivation. „Habitualisierte Lerngewohnheiten“[14] können Bildungserfolge begünstigen, ebenso wie die Ausstattung der Kinder mit ökonomischem, kulturellem und sozialen Kapital, für die i.d.R. die Eltern zuständig sind.
Da scheinbar Jede und Jeder die Chance auf gute Bildungsabschlüsse und damit auf gute Lebenschancen hat, wird das Prinzip der Meritokratie meist ohne es zu hinterfragen umgesetzt und als „natürlich“ hingenommen, da unterschiedliche Begabung und folglich unterschiedlicher Bildungsabschluss, sowie unterschiedlicher Status ja nur natürlich seien. Aber:
„Mit der „notwendigen Mitarbeit“ der Eltern und der dadurch verursachten sozialen Relevanz ungleicher Herkunftsressourcen ist die moderne Schule nun so organisiert, dass Kinder statushöherer Schichten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, höhere Bildungszertifikate zu erwerben - auch wenn sie als demokratische Institution nicht garantieren kann, dass alle Kinder statushöherer Herkunft das zum Statuserhalt notwendige Bildungszertifikat erlangen, da sie Kinder statusniedriger Schichten vom Schulbesuch nicht (mehr) ausschließen kann.“[15]
Bildung wird immer noch und v. a. von der sozialen Herkunft beeinflusst, damals (vor der Bildungsexpansion) wie heute (nach PISA). Einige Ungleichheiten wie z.B. durch Geschlecht, Konfession oder Wohnort[16] wurden zwar nach der Bildungsreform in der 1970er Jahren deutlich vermindert, andere (z.B. schichtspezifische) Ungleichheiten blieben aber bis heute bestehen[17].
Die Legitimation der sozial ungleichen Bildungschancen hat sich in unserer Gesellschaft aber so verfestigt, dass die „objektive“ Leistungsbewertung durch die Institution Schule (und die Person des Lehrers / der Lehrerin) ausreicht, um auch die Kinder und Jugendlichen und ihre zukünftigen Lebenschancen (d.h. Chancen auf dem Arbeitsmarkt) zu „bewerten“ und die Tatsache der existierenden Unterschiede (Ungleichheiten) als nahezu unveränderbar zu akzeptieren.
Die Meritokratie scheint gesellschaftlich notwendig zu werden, da „moderne Gesellschaften veränderter Formen sozialer Ungleichheit bedürfen, insbesondere solcher, die Bildung, Verdienst und Leistung honorieren, um so individuelle Aufstiegshoffnungen und –bemühungen als Anreize für immerwährende Lernprozesse seitens der Gesellschaftsmitglieder zu stimulieren und die vorhandenen Bildungstalente und –ressourcen möglichst umfassend zu aktivieren.“[18]
Dennoch ist zu berücksichtigen, dass es keine „natürlichen“ Unterschiede in der Begabung gibt, es handelt sich lediglich um soziale Konstrukte, die der Einteilung in Bildungskategorien dienen, die wiederum nur konstruiert sind. Einerseits wird ein natürliches Kriterium (die Begabung) angeführt, andererseits müssen Bildungstitel erworben werden, und werden nicht einfach zugeteilt; die Anstrengung, die aufgebracht wurde, um sie zu erreichen, wird nicht berücksichtigt.[19]
Es ist notwendig Bildungsabschlüsse hierarchisch zu gliedern, da Berufspositionen hierarchisch gegliedert sind und die Differenz zur Herstellung sozialer Ordnung notwendig ist. Das Ziel kann folglich keine gleiche Gesellschaft sondern eine gerechte Gesellschaft sein.
Auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen wirken verschiedene Bereiche und Faktoren ein, die oft nur geringe Berührungspunkte aufweisen. Zu diesen Bereichen zählen die Bildung der Eltern, die Herkunftsfamilie als Bildungsinstitution, die Gleichaltrigenbeziehungen, sowie die Schule oder auch außerschulische Bildungsinstitutionen[20].
Ausschlaggebend für den Bildungserfolg von Kindern sind neben der elterlichen Vorstellung und Orientierung auch schulische und gesellschaftliche Barrieren oder Chancen. Das in Deutschland bestehende dreigliedrige Schulsystem trägt immer noch dazu bei, die bestehenden Differenzen, begründet auf der sozialen Herkunft der Kinder, zu verfestigen. Obwohl die Entscheidung über den weiteren Bildungsverlauf, also die Schullaufbahn, durch die Orientierungsstufen oder die verlängerte Grundschulzeit meist bis zum 6. Schuljahr verzögert wurde, können die Barrieren nicht, oder kaum, überwunden werden. Die Möglichkeiten für Kinder aus „bildungsfernen“ Familien, eine „höhere“ Schulbildung einzuschlagen sind deutlich verbessert worden aber immer noch nicht vergleichbar mit z.B. den Abiturientenzahlen der Kinder der Oberschicht.
Der Anteil, den Kinder und Jugendliche an Bildung erhalten bzw. erreichen können ist insgesamt für alle größer geworden, die Ungleichheiten existieren aber weiter.
Es sind immer noch deutliche Unterschiede zu erkennen, wenn berücksichtigt wird, welchen Beruf die Eltern der Kinder in den einzelnen Schulformen haben; Beamtenkinder sind an Gymnasien und Hochschulen immer noch stärker vertreten als Angestellten- oder Arbeiterkinder[21].
Je höher der Bildungsstand der Eltern, desto besser sind die Bildungschancen der Kinder, gleiches gilt für das Einkommen der Eltern, obwohl Bildungseinrichtungen meist kostenlos sind.
Um über Bildung sprechen zu können, muss eine genauere Definition von Bildung erfolgen. Bildung kann einerseits das Wissen und die Fähigkeiten einschließen, die durch Schule und Aus- bzw. Weiterbildung vermittelt werden. In diesem Fall spricht man von institutioneller Bildung, die zu formalen Bildungsabschlüssen führt. Anderseits beinhaltet Bildung auch Kompetenzen, die nicht in erster Linie in oder durch Schule o.ä. erworben werden können. Zu dieser lebensweltlichen oder informellen Bildung zählen Fähigkeiten wie das Spielen von Musikinstrumenten genauso, wie die Fähigkeiten, die im kommunikativen oder zwischenmenschlichen Bereich liegen.
Bildung unterliegt nicht allgemein gültigen Regeln, je nach sozialem Milieu können unterschiedliche Bildungsbegriffe definiert werden, da verschiedene Bereiche wichtiger sind als andere und deren Bewältigung notwendiger ist als z.B. das Erlernen einer Fremdsprache.
4 Die Familie im Wandel
Nachdem ich bereits einige verschiedene Definitionen zum aktuellen Begriff der Familie vorgestellt habe, möchte ich nun in diesem Kapitel verdeutlichen, warum es zu verschiedenen Definitionen von Familie kommen kann und wie sich diese Bedeutung im Laufe der Zeit verändert hat. Die Familie ist keinesfalls ein starres und unveränderbares Konstrukt, sondern sie unterliegt ständigen Veränderungen, dem historischen wie auch dem sozialen Wandel[22].
Die Familie als Institution hat in der Zeit von der Vorindustriellen bis zur Postmoderne eine Entwicklung durchlaufen, die sich nicht ausschließlich auf Struktur und Form bezieht, sondern v. a. auch in Bezug auf die gesellschaftlichen Ideale und Ansprüche an eine Familie zu sehen ist. Diese Entwicklung wird an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst und vollzieht sich auf zwei Ebenen, der historischen und der sozialen. Um zu verstehen in welcher Situation sich die Familie in der aktuellen Gesellschaft befindet und welche Auswirkungen dies auf Kinder und Jugendliche hat, werde ich zunächst die historische Entwicklung nachzeichnen, bevor ich auf den sozialen Wandel der Familie und einzelner Familienformen eingehen werde.
4.1 Die Familie im historischen Wandel
Um über die aktuelle Situation der Familie in Deutschland sprechen zu können, muss die Entwicklung berücksichtigt werden, welche die Familie in der Nachkriegszeit durchlaufen hat. Der oft beklagte Zerfall der Familie geht wohl von der „Normalfamilie“, zwei Elternteile (davon mind. eine/r berufstätig) sowie mind. ein Kind unter 18 Jahren aus. Dieses Idealbild herrscht immer noch vor, Abweichungen werden zunächst kritisch beäugt und auf eventuelle negative Auswirkungen auf die einzelnen Familienmitglieder untersucht. In den 1950er und -60er Jahren war diese Form der Normalfamilie am stärksten ausgeprägt und die vorherrschende Familienform[23], so dass im Jahr 1950 76% aller Frauen mit minderjährigen Kindern Hausfrauen waren[24].
Während der Industrialisierung waren in Deutschland deutlich mehr akzeptierte verschiedene Familienformen zu finden, als im Deutschland der 1960er Jahre. Die zur Zeit der Industrialisierung bestehende enge Verknüpfung von Familie und Produktion lässt sich besonders deutlich an der Sozialform des ganzen Hauses[25] im handwerklichen und bäuerlichen Bereich erkennen, die verschiedene Funktionen erfüllte, wie z.B. Produktion, Sozialisation oder Alters- und Gesundheitsvorsorge. In dieser Lebensform hatte die Produktion die größere Bedeutung, oder anders formuliert, das Familienleben hatte viele ökonomische Aspekte. Beispiele sind hier die Wahl des Ehepartners nach ökonomischen Gesichtspunkten oder die potentielle Arbeitskraft der Kinder. Im ganzen Haus spielten die Emotionen nur eine untergeordnete Rolle[26].
Erst nach der fortschreitenden Trennung von Arbeits- und Privatleben verlor die Sozialform des ganzen Hauses an Bedeutung, Frauen und Kinder mussten nicht mehr der Erwerbsarbeit nachgehen, die Familie wurde privat. Außerdem erfolgte auch eine räumliche Trennung des Arbeits- und Familienbereiches. Die Familien, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügten, zogen an den Stadtrand, weg von Büros und Produktionsstätten[27].
Diese Lebensform, die wir heute als Normalfamilie verstehen, entwickelte sich zunächst im Bürgertum; mit folgenden Kennzeichen: Kinder und Frauen gingen nicht mehr der Erwerbsarbeit nach, dadurch kam dem Mann die Rolle des Ernährers zu und die Geschlechterrollen wurden gefestigt; zur Aufgabe der Frau wurde die Kindererziehung, da Kindheit nun als solche anerkannt wurde und Kinder nicht mehr als kleine Erwachsene behandelt wurden; der Grund für eine Ehe war ab diesem Zeitpunkt zunehmend die Liebe[28] und nicht mehr ausschließlich die Mitgift der Braut oder andere ökonomische Vorteile. Die Liebesheirat wird ein großes Thema in der romantischen Literatur, bis sie sich schließlich auch in der Gesellschaft als Beziehungsnorm durchsetzt.
Die Auffassung, dass die Kindheit eine eigenständige Lebensphase sei, der besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, veränderte das Erziehungsverhalten nachhaltig. Bisher erfolgte die Sozialisation der Kinder nebenbei, sie lernten dadurch, dass sie bei allem was in der Familie und der Produktion geschah, anwesend waren. Da in der „neuen“ Kleinfamilie die Mutter keiner Erwerbsarbeit mehr nachgehen musste, konnte sie sich einer neuen Aufgabe, der Kindererziehung, widmen. Mit der (nun zugelassenen) zunehmenden Intensität der Gefühle den eigenen Kindern gegenüber wurde die Aufgabe der frühen Sozialisation immer deutlicher eine Aufgabe der Kernfamilie und die Betreuung der Kinder wurde nicht mehr von Großeltern oder Bediensteten übernommen. Diese neuentstandene Familie, in der die Grundlage der Beziehung der Eltern (im Idealfall) die Liebe war und auch die Eltern eine intensive Beziehung zu ihren Kindern aufbauten, bezeichnet man auch als Gatten- Familie[29].
Trotz der Orientierung am bürgerlichen Familienideal gelingt die Umsetzung dieser Lebensform nur Wenigen[30], da v. a. in Arbeiterfamilien die ökonomischen Verhältnisse eine andere Lebensweise[31] notwendig machen.
Die endgültige Durchsetzung der bürgerlichen Kleinfamilie erfolgte in den 1950er und 1960er Jahren, begründet durch Wirtschaftswunder, Aufschwung, insgesamt verbesserte Lebensbedingungen sowie auch den Beitrag von Kirchen[32] und Parteien. Die Abweichung von der Normalfamilie als Lebensform war zunächst nicht akzeptiert oder anerkannt; das gravierendste Beispiel ist hier wohl die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft, deren öffentliche Akzeptanz sich erst in den vergangenen Jahren durchsetzte, beginnend mit der rechtlichen Anerkennung der „eingetragenen Partnerschaft“.
Die Kleinfamilie erfüllt jetzt andere Funktionen als die überholte Produktions- und Lebensgemeinschaft. Innerhalb der Familie spielen heute Werte wie Nähe, Geborgenheit, Vertrauen und Intimität die größte Rolle, sie bildet den Gegenpol zur Arbeitswelt. Mit dieser Trennung von Arbeitsleben und Privatleben vollzog sich auch eine deutliche Trennung der Geschlechter, die Frau wird dem privaten, häuslichen Bereich zugeordnet und der Mann verfolgt weiterhin seine Ernährer-Funktion in der Arbeitswelt. Ein-Eltern-Familien, also i.d.R. alleinerziehende Mütter, waren keine vollständigen Familien, ihnen fehlte ein (Eltern-)Teil. In Familien mit beiden Elternteilen bildeten häufig Mutter und Kinder eine Einheit, die Mutter war Vermittlerin zwischen Vater und Kindern[33].
In der ehemaligen DDR vollzog sich Familienentwicklung ähnlich, wenn auch die Geschlechterrollen nicht in dem Maße wie in der BRD differenziert wurden[34].
4.2 Familie(nformen) im sozialen Wandel – Die Individualisierungsthese
Neben dem historischen Wandel der Familie muss auch der soziale Wandel der Familie beschrieben werden, der mit Hilfe verschiedener theoretischer Erklärungsansätze dargestellt werden soll.
Die aktuelle Gesellschaft befindet sich im Wandel von der kapitalistischen Klassengesellschaft bzw. klassischen Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, die auch von BECK als Risikogesellschaft bezeichnet wird. Dieser Wandel verstärkte sich Mitte der 1960er Jahre; den bisher häufig aufgegriffenen Erklärungsansatz hierfür bietet BECK mit seiner Individualisierungsthese. Mit der Individualisierung von Familienformen ging auch die Individualisierung der geschlechtsspezifischen Lebensläufe einher, die sich allerdings nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt entwickelten. So veränderte sich der Lebenslauf der Männer besonders stark im Zuge der Industrialisierung, während sich der typische Lebenslauf der Frauen erst in der Nachkriegszeit veränderte; man kann von zwei „Individualisierungsschüben“ sprechen.[35]
In der neuen Modernen droht die Enttraditionalisierung und der Verlust der bisher existierenden Werte. Durch die fortschreitende Individualisierung (auch der Lebensformen) und Pluralisierung der Gesellschaft fallen bisher traditionelle Werte und Normen als Orientierung weg. Gleichzeitig bieten sich nun für die Menschen deutlich mehr Möglichkeiten und Entscheidungsspielräume, den eigenen Lebenslauf individuell zu gestalten und eine andere Lebensform als die traditionelle Kleinfamilie zu wählen. Es wird dennoch deutlich schwieriger, Möglichkeiten der Orientierung zu erkennen und zu verfolgen[36], da sich eine fast unüberschaubare Fülle an Werten entwickelt, abhängig von vielen weiteren Faktoren. Damit geht für viele Menschen ein gewisser Verlust der Sicherheit einher, hier wird von der „Kultur des Zweifels“ gesprochen[37].
Kinder und Jugendliche orientieren sich zunächst an ihrer Kernfamilie, deren Werte sie durch Sozialisation vermittelt bekommen, später vermischen sich diese Werte häufig mit denen des weiteren (sozialen) Umfelds.
Weniger Kleinfamilien, dafür viele verschiedene Lebensformen
Obwohl das Ideal der Kleinfamilie als ein gemischtgeschlechtliches Ehepaar mit mindesten zwei Kindern immer noch besteht, nimmt die Anzahl dieser Lebensform immer weiter ab. Im Jahr 1994 lebten noch 33,2% aller Menschen in der Familienform „verheiratet, mit Kindern“; 2003 waren es nur noch 28,1%[38]. Die Anzahl der weiteren abgefragten Familienformen stieg hingegen an, bis auf die Form „ledig, bei Elternteil lebend“. In den Familien, in denen Kinder leben, sind es in den meisten Fällen zwei Kinder[39], dennoch lebt knapp die Hälfte (48,2%) der deutschen Bevölkerung nicht mit einem oder mehreren Kindern zusammen[40].
Die Veränderungen in der bestehenden Familienstruktur, von der „männlichen Alleinernährerfamilie“ hin zu einer „modernisierten Versorgerfamilie mit vollzeiterwerbstätigen Vätern und teilzeiterwerbstätigen Müttern“[41], sind also klar erkennbar. Trotz der Abnahme der Zahl der Familien mit einem oder mehreren Kindern verliert die Institution Familie keineswegs an Bedeutung; nur wird heute eine Entscheidung für und nicht gegen das Kind getroffen, da dank moderner Verhütungsmethoden eine Schwangerschaft meist genau geplant wird / werden kann. Vor der Schwangerschaft stehen folglich oft ausführliche Überlegungen, in die viele verschiedene Faktoren, nicht nur ökonomischer Natur, einbezogen werden.
Durch die veränderte Bedeutung der Kleinfamilie, bzw. der Zunahme der Bedeutung anderer Familienformen, verändern sich auch die bestehenden Geschlechterrollen, da sich Männer und Frauen den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen müssen; darauf werde ich in Kapitel 4.2.2 noch näher eingehen.
Neben dem Wandel der Verteilung der Familienformen fand auch ein Wertewandel statt, der sich auch in den Erziehungszielen der Eltern wiederspiegelt. Traditionale Werte wie Pflichterfüllung oder Ordnung haben an Bedeutung verloren, wohingegen postmaterialistische Werte wie Autonomie oder Selbstverwirklichung als wichtiger empfunden werden[42], gerade in der Kindererziehung. Dieser Wandel bedeutet nicht, dass ein sofortiger Austausch aller Werte stattfindet, einige traditionelle Werte vermischen sich meist mit „neuen“ Werten, wodurch ein neues heterogenes Wertesystem entsteht. Neben den neuen Werten werden aber ebenfalls neue Zwänge und Einschränkungen entstehen, sobald sich diese Werte im Laufe der Zeit in der Gesellschaft verankern.
So werden z.B. postmaterialistische Werte von Menschen in den alten Bundesländern häufiger vertreten als in Ostdeutschland, Ledige vertreten sie stärker als Verheiratete, und je höher der Bildungsabschluss, desto eher besteht die Chance, dass postmaterialistische Werte vertreten werden[43].
„Da die das Verhalten steuernden modernen Werte inhaltlich kaum festgelegt sind, müssen sie vom Individuum jeweils situations- und kontextanhängig interpretiert werden. Mit dem inhaltlichen Wandel der Werte geht also zwangsläufig eine Individualisierung des Umgangs mit den Wertorientierungen einher.[44] “
Auch hier wird die Ambivalenz der Individualisierungsthese deutlich. Es ist v. a. anzumerken, dass Individualisierung nicht nur positive Aspekte[45] beinhaltet, sondern auch Nachteile für den Einzelnen mit sich bringen kann, besonders in Bezug auf Sicherheit und Vertrauen, was in manchen Fällen zu Problemen bei der Identitätsfindung führen kann[46], da nicht nur die Chance, sondern der Zwang zur Entscheidung existiert.
Besonders im Bezug auf Partnerschaften kann die ständige Entscheidungspflicht das Zusammenleben erschweren. Im Berufsleben wird von den ParterInnen ständige Flexibilität und Anpassungsbereitschaft gefordert, die ein gewisses Maß an Individualität erfordert. Da dies i. d. R. von beiden, berufstätigen PartnerInnen gefordert wird, kann die Beziehung zu einer Belastung werden, in der die Konflikte ständig ausgehandelt werden müssen. Praktizierte Lösungen können hier eine „living-apart-together“-Beziehung, eine Wochenend-Beziehung oder sogar eine Trennung sein. Auf Kinder wird wohl auch verzichtet, da diese eine weitere Belastung sein können, da man auf deren Bedürfnisse ebenfalls eingehen muss.
4.2.1 Weitere theoretische Erklärungsansätze für den sozialen Wandel der Familie
Die Abnahme der Häufigkeit der oben beschriebenen Kleinfamilie (Zwei- Eltern- Familie) kann aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Einerseits kann die Deinstitutionalisierungsthese verwendet werden, die besagt, dass die Anzahl der stabilen Normalfamilien zurückgeht und dies eine problematische Entwicklung ist. Andererseits kann die Veränderung hin zu „neuen“ Familienformen als eine steigende Möglichkeit der Individualisierung und als eine Pluralisierung der Lebensformen, zunächst völlig wertfrei, angesehen werden[47].
Die Deinstitutionalisierungsthese bezieht sich auf den kulturellen Bedeutungsverlust der Kleinfamilie[48]. Familie als Institution bedeutet eine „richtige“ Familie, eine „normale“ Familie; mit diesen Formulierungen sind i.d.R. konkrete und allgemein anerkannte Anforderungen und Ideale verbunden. Der institutionelle Wandel einer Familie erfolgt genau auf dieser Ebene, die Ideale, Anforderungen und Vorstellungen einer „normalen“ Familie verändern sich, so dass das bisher gültige Bild nicht mehr aktuell ist und der Familientyp Zwei- Eltern- Familie an Bedeutung verliert, da andere Lebensformen die Anforderungen, die die Gesellschaft an Familie stellt, evtl. besser erfüllen können. So entstehen für jede einzelne Person mehr Wahlmöglichkeiten, bezüglich der Familienform und der Lebenspartner, die aber in manchen Fällen auch eine Überforderung darstellen können, da die Sicherheit des traditionellen Familienbildes, und der damit einhergehenden Rollenverteilung, kaum noch vorhanden ist. Diesen Ansatz verfolgt auch die Theorie der sozialen Differenzierung.
Die Theorie der sozialen Differenzierung
Um den sozialen Wandel der Familienformen zu erklären, können verschiedene Privatheitstypen unterschieden werden, wie dies die Theorie der sozialen Differenzierung vornimmt.
Neben der Familienform der Kleinfamilie sind weitere Formen getreten, die sich in verschiedenen Privatheitsmustern[49] ausdrücken, die aufgrund von verschiedenen Erfordernissen, die von der Kleinfamilie nicht mehr erfüllt werden können, entstanden sind.
Die Kleinfamilie ist stark kindzentriert und weist damit erzieherische Handlungsschemata auf, hinter denen die Ehe- oder Partnerbeziehung zurückstehen muss, da die Sozialisationsfunktion besonders stark in den Vordergrund gerückt ist. Erkennbar wird dies durch den Kinderwunsch als Anlass für eine Eheschließung. Diese Kindzentrierung wird so hoch geschätzt, dass Menschen ihre bisherige Lebensform aufgeben und die Ehe eingehen.
Im partnerschaftsorientierten Privatheitstyp[50] geht es um eine partnerschaftliche Handlungsthematik in einem auf Emotionalität basierenden Partnerschaftssystem. In der nichtehelichen Lebensgemeinschaft fehlt die Ausrichtung auf die Familienbildung und es handelt sich um eine unbestimmte Zukunftsperspektive, da das Scheitern der Beziehung in Kauf genommen wird.
Bei freiwillig Alleinwohnenden, Wohngemeinschaften sowie den sogenannten „living-apart-together Beziehungen[51] “ handelt es sich um einen individualistischen Privatheitstyp mit individualistischen Handlungsthematiken. Autonomie, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung spielen eine große Rolle, der Freizeitbereich wird betont. Individualität meint keinesfalls Isolation, es geht vielmehr um Kontakt mit FreundInnen und Gleichgesinnten. Besonders in Bezug auf Wohngemeinschaften handelt es sich häufig um Zeiten des biographischen Übergangs, der zeitlich begrenzt ist.
Die Entwicklung von Lebensformen mit unterschiedlicher Ausrichtung kann als eine Anpassung an die moderne Gesellschaft und ihre Herausforderungen gesehen werden, einige Aufgabe und Funktionen der Familie wurden auch an den Staat übergeben. Es geht um Fortschritt, der durch gesteigert Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gewährleistet sein kann. Gerade auf dem Arbeitsmarkt kann die traditionelle, dauerhafte Kleinfamilie ein Hindernis darstellen, da ihre Mitglieder häufig nicht so flexibel sein können, wie Menschen, die in anderen Lebensformen leben. Natürlich trifft dies nicht auf alle Kleinfamilien zu, genauso wenig, wie alle Mitglieder einer Wohngemeinschaft flexibel und anpassungsfähig sein müssen.
Die Problematik der zunehmenden Kinderlosigkeit oder auch die Situation der (ungewollt) Alleinerziehenden lassen sich nur schwer in die positive Vorstellung von gesteigerter Anpassungsfähigkeit einfügen.
Die hier beschriebene Entwicklung deutet einen Wandel von der heterogenen Lebensform Kleinfamilie (mit sehr unterschiedlichen Mitgliedern) hin zu einer Verbreitung von mehreren homogenen Gruppen an, in denen die Mitglieder keine großen Unterschiede aufweisen und sich so besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Mitglieder einstellen können. Die Familie hat keinen Funktionsverlust erfahren, vielmehr hat sie sich auf bestimmte Aufgaben spezialisiert, um diese besser bewältigen zu können[52]. Die Aufgaben, wie z.B. Produktion oder berufliche Ausbildung der Kinder liegen nun nicht mehr ausschließlich in der Hand der Familie, sondern wurden an (staatliche) Institutionen abgeben, die sich ihrerseits spezialisieren konnten. Der Institution Familie fallen nun Aufgaben, wie z.B. die primäre Erziehung der Kinder sowie die „Stabilisierung der Persönlichkeit der erwachsenen Familienmitglieder und die Befriedigung emotionaler und psychischer Bedürfnisse“[53] zu.
Die vielen verschiedenen Familienformen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, und auch in den Blick der Gesellschaft gerückt sind, sind mit verschiedensten Besonderheiten verbunden. Bevor eine detailliertere Betrachtung einiger familialer Lebensformen erfolgen kann, muss die damit einhergehende veränderte Rollenverteilung innerhalb der Familien berücksichtigt werden.
4.2.2 Die Rollenverteilung innerhalb der Familie - Karrierefrauen und Hausmänner
Nicht nur die Bedeutung und Ausprägung der Familienformen hat sich im Laufe der Zeit verändert, sondern auch die Rollen und Aufgaben der einzelnen Familienmitglieder innerhalb ihrer Familien. Besonders gravierend ist die Veränderung der Frauenrolle, Beruf und Familie (Haushalt, Kinderversorgung) müssen nun zunehmend stärker in Einklang gebracht werden, was neue und veränderte Handlungsweisen und auch eine andere, neue Vater- / Ernährer-Rolle mit sich bringt. Die traditionelle autoritäre Vaterfigur ist nicht mehr so häufig anzutreffen, wie noch vor einigen Jahrzehnten, da wirtschaftliche Wandlungsprozesse und auch die Bildungsexpansion zu einer verbreiteten Erwerbstätigkeit von Frauen geführt haben.
Diese veränderten Rollen und Positionen der Eltern haben schließlich Auswirkungen auf die Kinder und deren persönliche Entwicklung.
Die Rolle der Frau veränderte sich dahingehend, dass Erwerbstätigkeit für Frauen zur Normalität wurde, nicht zuletzt vorangetrieben durch die Studenten- und die Frauenbewegung. Zur Individualisierung der weiblichen Lebensläufe trug die bessere Planbarkeit von Schwangerschaften, eine verändertes Ehe- und Scheidungsrecht und verbesserte Bildungschancen bei, sowie die Tatsache, dass Kinderversorgung nur noch als phasenweise Hauptbeschäftigung der Frau betrachtet wurde[54]. Durch das vermehrte Erreichen von höheren Bildungsabschlüssen, entwickelten sich neue Denkformen, die auf mehr Selbständigkeit der Frauen abzielen. Trotz der stärken Orientierung an beruflichen Erfolgen, nahm die Bedeutung von Familie und Kindern für Frauen kaum ab. Diese Tatsache sagt aber noch nichts darüber aus, ob Frauen dann auch wirklich Beruf und Familie vereinbaren können oder wollen oder ob sie sich (zeitweise) für einen Bereich entscheiden. Die am stärksten vertretene Meinung lautet, dass je jünger die im Haushalt lebenden Kinder sind, desto weniger sollte ein Elternteil arbeiten. Ob das Vater oder Mutter ist, scheint theoretisch kein so deutlicher Unterschied zu sein, in der Praxis ist die Kinderversorgung in Zwei-Eltern-Familien i. d. R. immer noch Frauensache[55]. Die völlige Ablehnung von erwerbstätigen Müttern mit schulpflichtigen Kindern wird heute kaum noch vertreten. Es gilt der Grundsatz: „Je jünger die Kinder, desto niedriger ist die Erwerbsbeteiligung der Mütter.“[56]
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt für viele Frauen, auch in Zwei-Eltern-Familien, immer noch ein Problem dar, da immer noch der Tatsache Glauben geschenkt wird, dass Kinder unter der Berufstätigkeit der Eltern (besonders der Mutter) und der damit verbundenen Trennung von der Bezugsperson, leiden. Frauen sind u.U. oft verunsichert, ob sie der Erwerbstätigkeit nachgehen können ohne ihrem Kind vermeintlich zu schaden. So lässt sich vielleicht auch erklären, warum die Elternzeit (Erziehungsurlaub) in fast allen Fällen von den Müttern genommen wird, selbst wenn sie mehr verdienen als ihr Partner. Die Verhältnisse verschieben sich gerade etwas, das das neue Elterngeld einen finanziellen Anreiz für die Väter darstellt, eine Zeit lang die Pflege des Kindes zu übernehmen. Dennoch glauben die meisten Mütter, dass sie besser für das gemeinsame Kind sorgen könnten als ihr Partner[57], obwohl die Väter auch durchaus bereit wären die Versorgung des Kindes während der Elternzeit zu übernehmen. Die Sorge der Mütter, dass Kinder unter ihrer Berufstätigkeit leiden würden, konnte empirisch aufgehoben werden[58].
Um etwas über die Berufstätigkeit der Mutter und den damit verbundenen Chancen und Risiken für das Kind sagen zu können, „kommt es vor allem darauf an, ob die betreffende Mutter freiwillig oder unfreiwillig zu Hause bleibt und ob sie tatsächlich den Wunsch hat, arbeiten zu gehen oder lieber bei ihren Kindern bleiben würde. Im ersten Fall kann es zu ausgesprochenen Vorwurfshaltungen gegenüber dem Kind kommen; im zweiten Fall könnte die Mutter-Kind-Beziehung mit Schuldgefühlen belastet werden.“[59]
Frauen verbringen die meiste Zeit mit ihrem Kind, übernehmen auch fast die ganze Pflege und Versorgung. Die Zeit, die der Vater (in Zwei-Eltern-Familien) mit dem Kind verbringt, wird von ihm meist als Freizeit gewertet und zählt zum Vergnügen. Die „unangenehmeren“ Aufgaben, die zur Kinderversorgung gehören, wie z.B. Wickeln oder nachts aufstehen, werden oft von den Müttern erledigt. Auch die sog. „Neuen Väter“[60] verbringen praktisch deutlich weniger Zeit mit ihrem Nachwuchs, als sie es selber für theoretisch notwendig erachten und begnügen sich während dieser Zeit meist mit Spielen und verrichtet seltener die pflegerischen Tätigkeiten wie wickeln oder füttern. Hier kommt auch wieder die stereotype Vorstellung zum Tragen, dass Frauen kompetenter in der Kinderversorgung sind und sie ihren Partnern nicht zutrauen[61].
Die Akzeptanz von berufstätigen Müttern ist in Westdeutschland immer noch niedriger als in den neuen Bundesländern[62]. Dabei wirkt sich die Kombination von Familie und Beruf und die damit verbundene Steigerung der eingenommenen Rollen positiv aus; Frauen und auch Männer, die neben der Familie auch berufstätig sind, sind gesünder, psychisch stabiler und zufriedener. Weiterhin können sie besser mit familiären Problemen umgehen, wenn Erfolgserlebnisse im Beruf erfahren werden. Durch die gesteigerte Anzahl der Rollen, steigt auch das Maß an sozialer Unterstützung, da verschiedene „Systeme“ verbunden und genutzt werden können[63].
Die Veränderungen der Mutterrolle bringen natürlich auch eine Veränderung der Vaterrolle mit sich. So sehen sich immer weniger Väter als die Ernährer der Familie und immer mehr als Erzieher der Kinder. Aber auch hier liegen leider Theorie (Wünsche der Väter) und Praxis (Alltag in der Familie) weiter auseinander als vermutet.
Nach der Geburt des ersten Kindes verfallen viele Paare oft in eine klischeehafte Rollenverteilung, auch wenn dies ihrem bisher gelebten Partnerschaftskonzept widerspricht. Wenn die bisherige Partnerschaftsqualität gut war, wandelt die Vaterrolle sich zunehmend in die Richtung Vater als Erzieher, im gegenteiligen Fall verläuft die Entwicklung stärker in die Ernährer-Richtung[64]. Die Schwierigkeit die Väter als homogene Gruppe anzusehen macht eine eindeutige Bestimmung der Entwicklung nicht einfach, der Trend lässt doch erkennen, dass die traditionelle Vaterrolle mehr und mehr verschwindet. Der „neue Mann“ unterstützt natürlich die Erwerbstätigkeit seiner Frau, beteiligt sich gleichberechtigt am Haushalt und der Kindererziehung /-versorgung. Viele Männer halten aber ebenfalls am stereotypen Mutterbild fest, dass Frauen einfach besser Kinder erziehen können, worin sie mit vielen Frauen übereinstimmen, die sich dann auch mit einem geringeren Beitrag der Männer zur Erziehungsarbeit zufrieden geben und dies als fair wahrnehmen.
5 Zur Bedeutung verschiedener Familienformen
Um die Besonderheiten und speziellen Situationen von verschiedenen Familienformen zu verdeutlichen, werde ich nun exemplarisch auf einige Familienformen vertiefender eingehen und die evtl. existierenden Unterschiede in der Sozialisation der Kinder aufzeigen.
5.1 Die traditionelle Kleinfamilie
Die traditionelle Kleinfamilie (im Folgenden: Kleinfamilie) bestimmt immer noch das gesellschaftliche Idealbild einer Familie mit Vater und Mutter, die natürlich verheiratet sind und zwei (oder mehr) Kindern (idealerweise Sohn und Tochter), obwohl sie nur eine mögliche Familienform ist, die in der heutigen Gesellschaft einen immer geringeren Anteil einnimmt (siehe Anhang: Tabelle 1 und Tabelle 9). Dennoch werden Familienformen, die nicht der „normalen“ Kleinfamilie entsprechen immer noch als unvollständige Familien betrachtet, auch von Familienmitgliedern, die in diesen „alternativen“ Familienformen leben. Zwei Veränderungen führen hauptsächlich dazu, dass die oben beschriebene Form der Kleinfamilie abnimmt: immer mehr Paare entscheiden sich gegen ein Kind[65], so dass die Zahl der kinderlosen Paare zunimmt (siehe Anhang: Tabelle 1). Dazu kommt, das die Bedeutung der Institution Ehe abgenommen hat und es mehr Paare gibt, die zusammen leben ohne verheiratet zu sein. Hier wird der Wertewandel deutlich, die postmodernen Werte wie Selbstständigkeit und Individualität nehmen zu.
Dieses Idealbild einer Familie mag dadurch entstanden sein, dass die Annahme existiert, die Kleinfamilie sei eine Art „Urfamilie“, also lange Zeit die einzige praktizierte Familienform gewesen. Diese Annahme ist schlichtweg falsch, da es bereits in der vorindustriellen Zeit viele verschiedene Familienformen neben der Kleinfamilie gab. Alleinerziehende, Alleinstehende oder Stief-Familien waren durchaus bekannt und verbreitet.
Die Dominanz der Kleinfamilie war in Deutschland in den 1950/60er Jahren zu erkennen, diese Art des Zusammenlebens wurde mit einer unhinterfragten Selbstverständlichkeit gelebt[66]. Die gesellschaftliche Norm von Ehe und Familiengründung (damals noch nahezu untrennbar verbunden und an traditionellen Geschlechterrollen gebunden) wurde durch Sozialisation vermittelt.
Zu einem idealen Familienbild gehören oft auch die Großeltern, welche die Eltern entlasten und sich gerne um ihre Enkelkinder kümmern. Von den, in der 1. World Vision Kinderstudie befragten, Kindern gaben 23% an, dass sie täglichen Kontakt zu mind. einem Großelternteil haben. Kinder, die ein Geschwister haben, haben den häufigsten Kontakt zu den Großeltern, steigt die Geschwisterzahl auf mehr als drei an, vermindert sich der Kontakt zu den Großeltern statistisch gesehen wiederum, was aber darin begründet sein kann, dass viele Familien mit Migrationshintergrund drei oder mehr Kinder haben, deren Großeltern nicht in Deutschland leben[67]. Über die Hälfte der befragten Kinder gaben an, dass ihre Großeltern in der Nachbarschaft oder der gleichen Stadt leben. So ist ein enger Kontakt von Großeltern und Enkeln auch möglich, wenn sie nicht im selben Haushalt leben[68].
5.2 Die Ein-Eltern-Familie
Da die traditionelle Kleinfamilie, mit Mutter und Vater, wie oben beschrieben, immer noch als gesellschaftliches Ideal betrachtet wird, liegt es nahe, dass Familien mit einem Elternteil als unvollständig und defizitär angesehen werden. Von diesem Standpunkt gilt es aber abzukommen, da Belege für die defizitäre Sozialisation von Kindern, ausschließlich aufgrund des Aufwachsens in Ein-Eltern-Familien, nahezu fehlen. Viele weitere Faktoren müssen in diesem Zusammenhang berücksichtig werden, auf die ich später noch eingehen werde.
Eine begriffliche Unklarheit gilt es anfangs zu klären. Ein-Eltern-Familie bedeutet zunächst, dass im gemeinsamen Haushalt die Kinder nur mit einem Elternteil (in den meisten Fällen handelt es sich um die Mutter) zusammenleben. Wie der Kontakt zum anderen Elternteil (in den meisten Fällen handelt es sich hier um den Vater) ist und wie viel Zeit sie miteinander verbringen, wird hier außer acht gelassen. Alleinerziehend muss nicht unbedingt auch Alleinstehend bedeuten, eine neue Partnerschaft muss nicht ausgeschlossen sein.
Es ist unmöglich ein klares Bild der alleinerziehenden Mutter / des alleinerziehenden Vaters zu zeichnen, da die Lebenslagen unterschiedlicher oft nicht sein könnten.
Deutlich ist, dass die überwiegende Zahl der Alleinerziehenden Mütter sind, der Anteil (unabhängig vom Familienstand) lag 2003 bei 80,8%[69]. 5,5% (4,5 Mio.) der Kinder in Deutschland lebten 2003 in Ein-Eltern-Familien[70], wobei die meisten Kinder keine Geschwister hatten, da Alleinerziehende in den meisten Fällen nur ein Kind haben[71].
Im folgenden Abschnitt möchte ich überprüfend darstellen, welche Besonderheiten die Sozialisation von Kindern in Ein-Eltern-Familien aufweist und welche Problematiken sich für die Mitglieder dieser Familienform ergeben können.
Die Untersuchung von Sozialisation in Ein-Eltern-Familien bezieht sich meist auf evtl. Störungen, wie z.B. abweichendes Verhalten oder Aggressivität der Kinder[72]. In diesem Fall stellt sich natürlich die Frage, ob die problematischen Situationen und Verhaltensweisen ausschließlich auf das Aufwachsen mit einem Elternteil zurückzuführen ist. Die Forschungslage ist auch hier leider nicht ausreichend um eine klare Antwort zu geben. Als problematisch erweist sich auch, dass Studien erst nach der Scheidung oder Trennung der Familie durchgeführt werden. Die Schwierigkeiten innerhalb der Familie, die zur Trennung geführt haben, werden nicht berücksichtigt, obwohl sie natürlich ebenfalls Auswirkungen auf das Verhalten und den Kompetenzerwerb des Kindes / der Kinder haben[73].
Festzustellen ist aber, dass Kinder aus Ein-Eltern-Familien laut ihren Eltern häufig weniger Freunde haben, mit denen sie nicht sehr viel Zeit verbringen. Neben den ca. zwei Stunden, welche die Kinder mit Mutter oder Vater verbringen, sind sie die überwiegende Zeit des Tages in Betreuungseinrichtungen untergebracht oder sie sind alleine zu Hause[74].
Hier wird auch das größte Problem Alleinerziehender deutlich, die Betreuung des Kindes während des ganzen Tages; oft ist hier auch die Herkunftsfamilie des jeweiligen Elternteils eine wichtige Unterstützung. Die Kinder müssen sich aber trotzdem zwangsläufig den Tagesstrukturen der Erwachsenen anpassen, sei es den Arbeitszeiten der Mutter / des Vaters oder den Öffnungszeiten des Hortes.
Weiterhin problematisch erscheint es den Alleinerziehenden, dass immer alle Entscheidungen, das Kind / die Kinder betreffend, von ihnen allein getroffen werden müssen und sie auch die gesamte Verantwortung tragen. Die Kinder werden in manchen Fällen recht früh in die Entscheidungsprozesse miteinbezogen, was zu einer emotionalen Überforderung führen kann[75]. Hier spielt der Grund für die alleinige Erziehung des Kindes eine wichtige Rolle. Warum leben Alleinerziehende nicht (mehr) in einer Beziehung und wie sehr sind sie damit zufrieden? Solange die Trennung vom Partner, sei es durch Tod oder Scheidung, nicht verarbeitet wurde, haben viele Menschen auch hier noch mit einer großen Belastung zu kämpfen[76].
Zum Thema Schulleistungen haben TILLMANN / MEIER festgestellt, dass Kinder aus Ein-Eltern-Familien keinesfalls schlechter abschneiden, als Kinder aus „vollständigen“ Familien.
[...]
[1] Vgl. Tippelt, Rudolf; Bildung als pädagogisches Anliegen; In: Lindner, Werner / Thole, Werner / Weber, Jochen (Hrsg.); Kinder- und Jugendarbeit als Bildungsprojekt. S. 33-45 Leske + Budrich, Opladen. 2003. S. 34
[2] Vgl. Zimmermann, Peter; Grundwissen Sozialisation- Einführung zur Sozialisation im Kindes- und Jugendalter; VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 2006 S. 85
[3] Vgl. ebd. S.85
[4] Vgl. Büchner, Peter; Kindheit und Familie. In: Krüger, Heinz Hermann / Grunert, Cathleen (Hrsg.) Handbuch der Kindheits- und Jugendforschung. S. 475 – 496 Leske + Budrich, Opladen . 2002 S. 484
[5] Vgl. Hradil, Stefan; Soziale Ungleichheit in Deutschland. 8. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 2005. S. 45
[6] Vgl. Hradil, 2005. S. 427ff
[7] Vgl. Grunert, Cathleen; Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen in außerunterrichtlichen Sozialisationsfeldern. S. 9-94 In: Sachverständigenkommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht (Hrsg.) Band 3: Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen im Schulalter. Verlag Deutsches Jugendinstitut, München. 2005. S. 11
[8] Vgl. Büchner, Peter; Der Bildungsort Familie. Grundlagen und Theoriebezüge. S. 21-48 In: Büchner, Peter / Brake, Anna (Hrsg.) Bildungsort Familie. Transmission von Bildung und Kultur im Alltag von Mehrgenerationenfamilien; VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 1. Auflage 2006. S. 23
[9] Die Bedeutung der Begriffe Bildung und Erziehung nähern sich immer weiter an, während früher durchaus genau zwischen Erziehung (als Einfluss der Erwachsenen, bes. der Mutter, auf das kleine Kind) und Bildung (Unterricht, meist durch männliche Lehrer, und selbständige Aneignung von Wissen mit Veränderung der Persönlichkeit verbundene Tätigkeit) unterschieden wurde. Die Annäherung und Überschneidung der beiden Begriffe wird deutlich in der Diskussion um den Bildungsauftrag des Kindergartens, indem auch schon Kinder im Vorschulalter nicht mehr ausschließlich erzogen werden sollen, sondern auch die Möglichkeit erhalten sollen sich Wissen und Kompetenzen anzueignen.
[10] Vgl. Gauger, Jörg-Dieter; Über „Bildung“ und „Schulbildung“. In: Gauger, Jörg-Dieter (Hrsg.) Bildung der Persönlichkeit. S. 48-84 Herder, Freiburg, Basel, Wien. 2006. S. 58
[11] Vgl. Tippelt, Rudolf; Bldung als pädagogisches Anliegen; In: Lindner, Werner / Thole, Werner / Weber, Jochen (Hrsg.); Kinder- und Jugendarbeit als Bildungsprojekt. S. 33-45 Leske + Budrich, Opladen. 2003. S. 35
[12] Bspw. Sozialkompetenzen, Teamfähigkeit, „Schlüsselqualifikationen“
[13] Ulich, Klaus; Einführung in die Sozialpsychologie der Schule. Beltz Verlag, Weinheim und Basel. 2001. S. 117
[14] Vgl. Solga Heike; Meritokratie – die moderne Legitimation ungleicher Bildungschancen. In: Berger, Peter A. / Kahlert, Heike (Hrsg.) Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert. S. 19 – 38; Juventa Verlag, Weinheim und München. 2005 S. 19
[15] Ebd. S. 21
[16] Regionale Unterschiede zwischen Stadt und Land.
[17] So wurde z.B. das damals sprichwörtliche „katholische Arbeitermädchen vom Lande“ durch den „männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ ersetzt.
[18] Vgl. Solga, 2005 S. 22
[19] Vgl. ebd. S. 25f
[20] Grundmann, Matthias / Huinink, Johannes / Krappmann, Lothar; Familie und Bildung. Empirische Ergebnisse und Überlegungen zur Frage der Beziehung von Bildungsbeteiligung, Familienentwicklung und Sozialisation. S. 70f In: Büchner, Peter u.a.; Kindliche Lebenswelten, Bildung und innerfamiliale Beziehungen. Materialien zum 5. Familienbericht/ Band 4. DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München. 1994. S. 41- 105
[21] Vgl. Hradil, 2005. S. 165
[22] Siehe Kapitel 4.2
[23] Vgl. Peuckert, Rüdiger; Familienformen im sozialen Wandel. 6. Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. 2005. S. 20
[24] Vgl. Nave-Herz, Rosemarie; Ehe- und Familiensoziologie. Eine Einführung in Geschichte, theoretische Ansätze und empirische Befunde. Juventa Verlag, Weinheim und München. 2004. S. 56
[25] Vgl. Peuckert, 2005. S. 21
[26] Vgl. ebd. S. 21f
[27] Vgl. Nave-Herz, 2004. S. 49f
[28] Zeitalter der Romantik, (Ehe-) Partner haben größere Bedeutung.
[29] Vgl. Nave-Herz, 2004. S. 51f
[30] Vgl. Peuckert, 2005. S. 24
[31] z.B. weiterhin Mitarbeit von Frauen und Kindern
[32] Idealbild einer monogamen Ehe mit Kindern
[33] Vgl. Nave-Herz, 2004. S. 52
[34] Vgl. Peuckert, 2005. S. 25
[35] Vgl. Huinink, Johannes / Konietzka Dirk; Familiensoziologie. Eine Einführung; campus Studium, Frankfurt / New York. 2007. S. 105f
[36] Vgl. Tillmann, Klaus- Jürgen. Sozialisationstheorien. Eine Einführung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. 1989. 14. Auflage 2006. S. 262
[37] Vgl. Huinink, / Konietzka, 2007. S. 108
[38] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung Quelle: http://www.bpb.de/wissen/R6Z0NX,,0,Pluralisierung_der_Lebensformen.html Zugriff: 13.01.08
[39] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung Quelle: http://www.bpb.de/wissen/RCQ36N,,0,Kinder_nach_Geschwisterzahl_im_Haushalt.html Zugriff: 13.01.08
[40] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung Quelle: http://www.bpb.de/wissen/PN4BDH,,0,Lebensformen_mit_Kindern.html Zugriff: 13.01.08
[41] Vgl. Jurczyk, Karin; Familienleben heute – Was brauchen Familien? S. 34-38 In: Forum Erwachsenenbildung 3 (2006) S. 36
[42] Vgl. Peuckert, 2005. S. 365
[43] Vgl. Peuckert, 2005. S. 365
[44] Ebd. S. 365 (Hervorhebung im Original)
[45] Wie z.B. mehr Freiheit durch größere Entscheidungsspielräume.
[46] Vgl. Peuckert, 2005. S. 366
[47] Vgl. Nave-Herz, Rosemarie; Familie heute- Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 1994. S. 3
[48] Vgl. Huinink / Konietzka, 2007. S. 104f
[49] Vgl. Peuckert, 2005. S. 377ff
[50] Kinderlose Ehe oder nichteheliche Lebensgemeinschaft
[51] Partnerschaft mit zwei getrennten Haushalten
[52] Vgl. Huinink / Konietzka, 2007. S. 102f
[53] Vgl. ebd. S. 103
[54] Vgl. Peuckert, 2005. S. 260
[55] Vgl. ebd. S. 264ff
[56] Vgl. World Vision Deutschland e.V. (Hg.) Kinder in Deutschland. 1. World Vision Kinderstudie. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main. 2007. S. 72
[57] Vgl. Peuckert, 2005. S. 268f
[58] Vgl. ebd. S. 269
[59] Vgl. Nave-Herz, 1994. S. 39
[60] Vgl. Sauter, Sven. Väterlichkeit- eine normative Kategorie in der Familienforschung? In: Zeitschrift für Familienforschung, 12 (2000) 1, S. 27-48; S. 42ff
[61] Vgl. Peuckert, 2005. S. 283
[62] Vgl. ebd. S. 271
[63] Vgl. Peuckert, 2005 S. 273
[64] Vgl. ebd. S. 285
[65] Auch im Zusammenhang mit der verbreiteten Erwerbstätigkeit von Frauen und der dadurch entstehenden Problematik der Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Immer mehr Frauen entscheiden sich schließlich für den Beruf.
[66] Vgl. Peuckert, 2005. S. 20
[67] Vgl. World Vision Deutschland e.V. (Hg.) 2007. S. 69
[68] Nur 3% der befragten Kinder leben in Drei-Generationen-Familien. Vgl. World Vision Deutschland e.V. (Hg.) 2007. S. 67
[69] Quelle: http://www.bpb.de/wissen/2MCCQW,0,Alleinerziehende_ohne_Lebenspartner.html
Zugriff: 23.01.08
[70] Quelle: http://www.bpb.de/wissen/PN4BDH,,0,Lebensformen_mit_Kindern.html Zugriff: 23.01.08
[71] Vgl. Braches- Chyrek, Rita; Zur Lebenslage von Kindern in Ein-Eltern-Familien; Leske + Budrich, Opladen. 2002 S. 86
[72] Vgl. Zimmermann, 2006 S. 110
[73] Vgl. Braches- Chyrek, 2002 S. 45f
[74] Vgl. Zimmermann, 2006 S. 111
[75] Vgl. ebd. S. 112
[76] Vgl. Nave-Herz, 1994. S. 94
- Arbeit zitieren
- Mareike Schmid (Autor:in), 2008, Die Funktion der Familie im Zusammenspiel von Bildung und Sozialer Ungleichheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150285
Kostenlos Autor werden



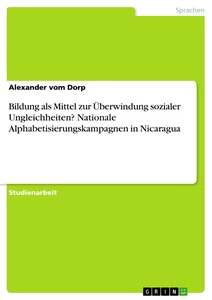
















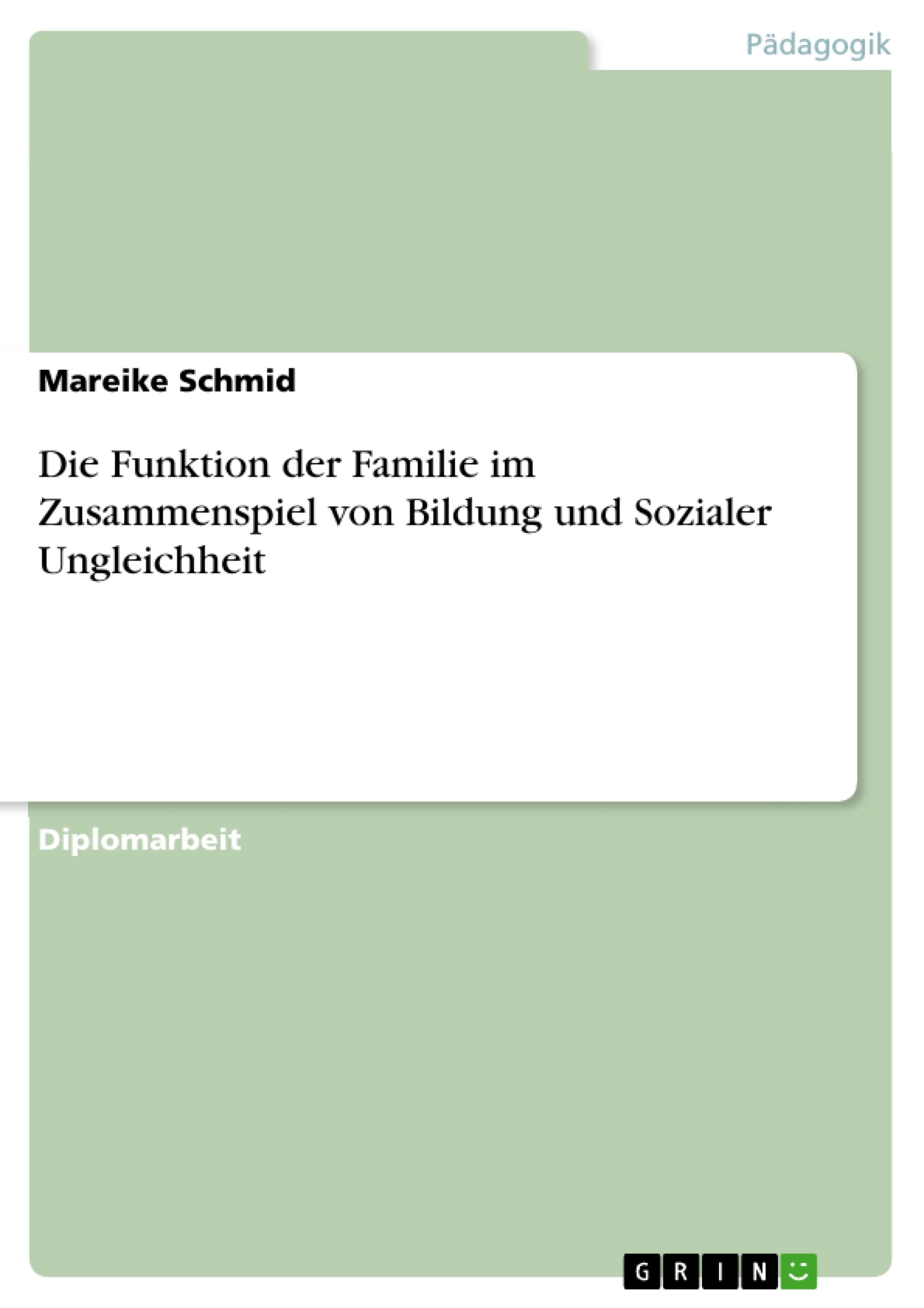

Kommentare