Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vergleich der politischen Systeme
2.1 Das politische System der USA
2.2 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
3. Das Wahl- und Parteiensystem in den USA und der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Das W ahlsystem der USA
3.2 Das Parteiensystem der USA
3.3 Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland
3.4 Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland
4. Einflussgrößen und ihre Bedeutung für das Wahlgeschehen
4.1 Rechtliche Stellung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Mitglieder des US-Kongresses im jeweiligen politischen System anhand des Grundgesetzes und der US-Verfassung
4.2 Einfluss des Wahl- und Parteiensystems in Deutschland und den USA auf die Kandidatur und den Wahlkampf
4.3 Finanzierung der Wahlkämpfe von Kandidaten und Parteien
4.4 Die Medien im Wahlkampf
4.5 Taktisches Wählen und Stimmensplitting
5. Vergleich der Wahlkämpfe
5.1 Kongresswahlkampf in den USA - ein Überblick
5.2 Bundestagswahlkampf in Deutschland - ein Überblick
5.3 Bundestagswahlkampf am Beispiel des Wahlkreises 70 zur Bundestagswahl 2009
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
8. Anhang A
9. Anhang B
1 Einleitung
„Den alten Rheinstrom seh ich wieder fließen, In seinem Blau sich Berg und Burgen spiegeln, Goldtrauben winken von den Rebenhügeln, Die Winzer klettern und die Blumen sprießen.“
- Heinrich Heine: „An J.B.R.“
Ähnliche Bilder dürften sich im Sommer 2009 der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland geboten haben, als sie mit dem Rheingold-Express auf den Wahlkampfspuren des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, wandelte (vgl. SPIEGEL 2010). Wahlkampf ist immer auch Inszenierung, die sich an den Gegebenheiten in den unterschiedlichen Demokratien orientiert.
„Es ist nicht so, dass sich John MacCain nicht (um Amerika) kümmere, aber er versteht die Probleme einfach nicht“
(Barack Obama, zit. nach: FOCUS 2008).
„Wachstum schafft Arbeit“
(Angela Merkel, zit. nach: FOCUS 2009).
„Die zentrale Frage für Deutschland wird sein: Wie schnell überwinden wir die Krise?“
(Angela Merkel, zit. nach: FOCUS 2009).
Diese kurze Gegenüberstellung von Wahlkampfäußerungen von 2008 und 2009 zeigt bereits exemplarisch, wie unterschiedlich Wahlkampf in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika geführt wird. Während Personalisierung und damit auch persönliche Angriffe gegen die politischen Gegner in den USA an der Tagesordnung sind, stehen in Deutschland Sachthemen im Vordergrund. Der Trend zur Verkürzung und Zuspitzung des politischen Programms ist in Wahlkampfzeiten in allen aufgeführten Zitaten dokumentiert.
Insgesamt können die politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland und der USA als sehr gut erforscht gelten. Vergleiche zwischen den beiden Staaten finden sich häufig in der wissenschaftlichen Literatur. Nicht ohne Grund wurde von einer zunehmenden Amerikanisierung der deutschen Politik und insbesondere der Wahlkämpfe gesprochen.
Aktuelle Forschungen gehen hierbei allerdings von einer Modernisierung aus, da spezifische Elemente der deutschen politischen Kultur bei diesem Trend erhalten bleiben und Übernahmen aus der amerikanischen politischen Kultur um diese spezifischen Elemente ergänzt beziehungsweise auf diese abgestimmt werden (vgl. Wagner 2005: 402).
Sucht man nach Vergleichen der politischen Systeme sowie der Wahl- oder Parteiensysteme der USA und Deutschland, so fällt die Erststimme für die Direktmandate in der Bundesrepublik nicht besonders ins Gewicht. Dabei sind es gerade die Direktmandate die, schon aufgrund des Wahlmodus, den Mandaten für das US-Repräsentantenhaus und den US- Senat auf den ersten Blick am stärksten ähneln. Direkt gewählte Abgeordnete besitzen aufgrund ihrer unmittelbaren Wahl durch das Volk einen hohen Grad an Legitimation. Dementsprechend könnte auch der Wahlkampf Ähnlichkeiten aufweisen. Dennoch spielen die Direktmandate in Vergleichen bislang eine eher untergeordnete Rolle.
Um die Wahlkämpfe in Deutschland und den USA untersuchen zu können, müssen zunächst die bestimmenden Einflussgrößen der Wahlkämpfe herausgearbeitet werden. Bei der Überlegung, welche Faktoren Einfluss auf einen Wahlkampf haben, sticht das politische System als Grundlage hervor. Daneben haben ebenso das Wahlsystem und das Parteiensystem signifikanten Einfluss. Daher werde ich diese drei Systeme zunächst beschreiben und miteinander vergleichen.
Während die drei oben genannten Systeme grundlegenden Einfluss auf die Wahlen und somit den Wahlkampf haben, wirken weitere Einflussgrößen eher spezifisch. Aus diesem Grund werde ich anschließend die Einflüsse der Parteien auf die Kandidaturen vergleichen, die Einflüsse der Parteienfinanzierung untersuchen sowie die Bedeutung der Medien im Wahlkampf darstellen. Gerade in Anbetracht aktueller Diskussionen über die Spendenpraxis sowohl in Deutschland, als auch in den USA, sind hier für die Zukunft weitere Änderungen zu erwarten (vgl. FAZ 2010a, 2010b und N-TV 2010).
Die Möglichkeit des taktischen Wählens stellt, nicht nur in Deutschland, eine weitere Einflussgröße dar. Gerade durch die zur Verfügung stehenden zwei Stimmen zur Bundestagswahl könnte das taktische Wählen einen verstärkten Einfluss, insbesondere auf die Direktmandate, erhalten. Daher werde ich untersuchen, inwiefern taktisches Wählen die Erststimme stärken kann und ob dadurch die Möglichkeit besteht, dass die Personenstimme die Parteienstimme überlagern könnte.
Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit ist der Wahlkampf in Deutschland und in den USA. Insbesondere werde ich dabei in meiner Arbeit untersuchen, welche Bedeutung die Erststimme in Deutschland besitzt und ob diese zunehmen kann. Es ist zu vermuten, dass die Bedeutung der Erststimme aufgrund der Erosion der großen Parteien und der damit einhergehenden knapperen Zweitstimmenergebnisse in Zukunft noch stärker zum Zünglein an der Waage der Mehrheitsbildung werden wird. Allerdings ist ebenfalls davon auszugehen, dass die Zweitstimme als Parteienstimme aufgrund der Konstruktion des deutschen Wahlsystems ihre grundsätzliche Bedeutung für die Zusammensetzung des Bundestages nicht verlieren wird.
2 Vergleich der politischen Systeme
Im Folgenden möchte ich die politischen Systeme der beiden Staaten, die ich in dieser Arbeit in Bezug auf den Wahlkampf vergleiche, darstellen. Das politische System bildet die Grundlage aller Gesetze und Regularien, die Wahlen und somit auch Wahlkämpfe erst ermöglichen. Ein politisches System ist die Basis eines jeden staatlichen Gebildes, in ihm sind die Institutionen angelegt, die durch einen erfolgreichen Wahlkampf errungen werden sollen. Es bildet ferner die Grundlage jedweden politischen Handelns innerhalb eines Landes, daher ist es wichtig seine Funktionen und Mechanismen zu begreifen, um das Handeln innerhalb des Systems verstehen zu können.
2.1 Das politische System der USA
In diesem Abschnitt möchte ich kurz das politische System der Vereinigten Staaten von Amerika skizzieren. Dazu werde ich das politische System der USA an den Institutionen Präsident, Kongress, Supreme Court und den Einzelstaaten auf der polity-Ebene beleuchten.
Eine Parallele zwischen der Entwicklung des politischen Systems der USA und dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland findet sich in der Entstehungsgeschichte beider politischen Systeme. Sie sind beide als Konsequenz aus den Erfahrungen mit vergangenen Systemen entstanden. Während das politische System der Bundesrepublik auf den Erfahrungen mit dem Systemen der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus aufbaut und dem politischen Druck der Alliierten widerstehen musste, geht das us-amerikanische politische System auf Erfahrungen aus den Mutterländern der Siedler und dem Herrschaftssystem in den 13 ursprünglichen Kolonien zurück. Maßgeblich ist der Bruch mit der britischen Monarchie und dem daraus erwachsenen Misstrauen gegen eine zu starke Zentralgewalt. Dies spiegelt sich noch heute in der bewussten Machtaufteilung in der politischen Praxis in den Vereinigten Staaten wider. Das grundlegende Prinzip der checks and balances prägt das Handeln im politischen System der USA bis heute (vgl. Lösche 2008a: 5). Die checks an balances sind:
„ ein System prinzipieller Gewaltenteilung und nur punktueller Gewaltenverschränkung. Die relative Schwäche des Zentralstaates und die Konkurrenz, ja Anarchie zwischen unzähligen Ämtern und Institutionen, die sich in ihren Kompetenzen zum Teil überschneiden, sind bewusst gewollt(Lösche 2008a: 5)
Ihre heutige Ausprägung erhielten Sie durch die Fortentwicklung der Verfassung von 1788. Diese entstand nach dem zuvor gescheiterten Versuch einer staatenbündischen Union der ehemaligen britischen Kolonien (vgl. Lösche/ von Loeffelholz 2004: 31ff).
Das politische System der USA ist ebenso wie das deutsche politische System in der Tradition der Gewaltenteilungstheorie entstanden. So finden sich in den USA, ebenso wie in Deutschland, die drei Gewalten: Legislative, Exekutive und Judikative. Der Präsident wird als geschlossene Exekutive alle vier Jahre mittels Wahlmänner durch das Volk gewählt. Mit der Zustimmung des Senats ernennt er die neun Richter des Supreme Courts auf Lebenszeit. Repräsentantenhaus und Senat werden unmittelbar vom Volk gewählt. Die 435 Repräsentanten werden alle zwei Jahre in ihren Wahlkreisen direkt gewählt, die Verteilung der Wahlkreise auf die Einzelstaaten entspricht dabei ihrer Bevölkerungszahl. Die 100 Senatoren werden ebenfalls direkt gewählt, jeder Staat hat - unabhängig von Größe und Einwohnerzahl - genau zwei Senatswahlkreise. Die Amtszeit der Senatoren beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird ein Drittel des Senats gleichzeitig mit den Wahlen zum Repräsentantenhaus neu bestimmt (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 22f).
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika stellt die Spitze der Exekutive in den USA dar, im unterstehen außer den unabhängigen Regierungskommissionen alle Ämter und Behörden der Bundesebene. Er ist ebenfalls Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der erste Diplomat seines Landes, als Staatsoberhaupt repräsentiert er die USA nach Außen (vgl. Lösche 2008c: 16). Die Ressortstruktur ist auf Bundesebene relativ starr, dies liegt vor allem in der Tatsache begründet, das letztlich der Kongress über die finanzielle Ausstattung und den Zuschnitt der Departments und Bundesbehörden entscheidet (vgl. Hartmann 2004: 165f). So wird der Präsident als Spitze der vollziehenden Gewalt nur zu einem Mitspieler in Bezug auf die ihm nachgeordnete Verwaltung, da der Kongress sowohl bei der Bestellung herausgehobener Verwaltungsstellen zustimmen und die finanzielle Ausstattung der Ämter und Behörden genehmigen muss. Die Verwaltung wird somit zum „Kampfplatz, auf dem die institutionellen Konflikte der Gewaltenteilung ausgetragen werden“ (Lösche/von Loeffelholz 2004: 233). Dem Präsidenten ist ebenso in Bezug auf die Gesetzgebung die „Notwendigkeit der Kooperation mit dem Kongress auferlegt“ (Lösche/von Loeffelholz 2004: 227). Das Präsidentenamt ist im politischen System der USA straff eingebunden. Gesetze kann nur der Kongress verabschieden, der Präsident als Regierungschef kann sie lediglich mit einem Veto blockieren - sofern ihn der Kongress nicht überstimmt (vgl. Lösche 2008c: 17 und Lösche/von Loeffelholz 2004: 230). Die Machtfülle des Präsidenten ist seit Gründung der Vereinigten Staaten angestiegen. Dies liegt vor allem an gewachsenen Erwartungen an die Bundesregierung und den Präsidenten als Integrationsfigur für die gesamte Nation (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 227). In der Gesetzgebung spielt der Präsident als Agenda Setter eine herausgehobene Rolle, verfassungsmäßig steht ihm eine Gesetzgebungsinitiative nicht zu, er muss für seine gewünschten policy-Vorhaben Lobbyarbeit im Kongress leisten und durch Verhandlungen eine Mehrheit für die von ihm unterstützten Vorhaben finden. Dazu steht ihm seit dem 20. Jahrhundert ein Mitarbeiterstab zur Verfügung. In der Rede zur Lage der Nation gibt der Präsident daher seine politische Agenda dem Kongress bekannt (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 228ff und Lösche 2008c: 13ff). Eine weitere Möglichkeit liegt in der politischen Instrumentalisierung des präsidialen Vetorechts. Bis 1989 wurden lediglich 103 von rund 2500 präsidialen Vetos durch die Zweidrittelmehrheit des Kongresses überstimmt. Demnach ist das präsidiale Veto geeignet, den Kongress im Sinne der präsidialen Gesetzeswünsche zu beeinflussen. Jedoch kann der Kongress dies umgehen, indem er beispielsweise einen vom Veto bedrohten Gesetzentwurf mit einem dem Präsidenten wichtigen Entwurf koppelt. Somit würde am Veto des Präsidenten ebenfalls ein Gesetzentwurf seiner eigenen Agenda scheitern müssen, da immer der gesamte Gesetzentwurf durch den Präsidenten unterschrieben oder abglehnt werden muss (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 230f). In der Außenpolitik spielt der Präsident eine weitaus größere Rolle als in der Innen- und Wirtschaftspolitik. Als erster Diplomat und Oberbefehlshaber der Streitkräfte stehen ihm besondere Kompetenzen zu - er allein hat das Recht außenpolitische Verträge zu schließen (vgl. Lösche 2008c: 16), dennoch kann in keinem Bereich eine policy des Präsidenten erfolgreich sein, sofern sie nicht durch den Kongress unterstützt wird (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 232). Außenpolitische Verträge müssen durch den Senat ratifiziert werden, sind Budgetrechte betroffen, ist der Vertrag auch Angelegenheit des Repräsentantenhauses.
Die strikte Ämtertrennung und die direkte Wahl der Kongressmitglieder stärken die Position des einzelnen Abgeordneten beziehungsweise Senators gegenüber der Fraktion, der Partei und gegebenenfalls gegenüber dem Präsidenten. Der Kongress ist in seinen Entscheidungen weitgehend autonom, er ist die einzige gesetzgebende Instanz auf Bundesebene (vgl. Lösche 2008d: 28). Vom „halbsouveränen Kongress“ (Lösche 2008d: 28) wird gesprochen, da der Präsident mit seinem Veto Gesetzentwürfe zumindest suspendieren kann und der Supreme Court über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen entscheidet. Gerade im 20. Jahrhundert sind allerdings einige Kompetenzen des Kongresses auf den Präsidenten übergegangen. Dies ging vor allem mit der Fortentwicklung des Sozialstaates, dem Aufstieg der USA zur Weltmacht und der Globalisierung einher (vgl. Lösche 2008d: 28). Zentrale Aufgaben des Kongresses sind die Bundesgesetzgebung, die Kontrolle der Exekutive sowie die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt. Der Haushaltsentwurf wird dem Kongress über das präsidiale Office of Management and Budget (OMB) zugeleitet. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Kongress seine eigenen Rechte[1] in Bezug auf die Kontrolle der genehmigten Gelder massiv erhöht (vgl. Lösche 2008d: 28ff).
Die Judikative besteht auf Bundesebene nicht nur aus dem Supreme Court. Horizontal ist sie von den Judikativen der Einzelstaaten getrennt, vertikal unterteilt sie sich in 88 District Courts, 11 Circuit Courts (Berufungsgerichte) und den Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof. Dieser beschäftigt sich nicht nur mit Verfassungsrecht, sondern ist oberste Instanz für alle richterlichen Entscheidungen, die Bundesrecht betreffen (vgl. Lösche 2008e: 36). Da neben dem Bundesrecht auch eigene Gesetzgebungen der Einzelstaaten existieren, ist auch das Rechtssystem der USA stark fragmentiert. Die Richterinnen und Richter des Supreme Courts des Bundes werden mit Zustimmung des Senats durch den Präsidenten auf Lebenszeit ernannt. Dies soll ihre Unabhängigkeit gegenüber Exekutive und Legislative sichern (vgl. Lösche 2008e: 36f).
Der amerikanische Föderalismus ist durch die Machtdiffusion gekennzeichnet. Die Zuständigkeiten des Bundes sind in der US-Verfassung in Artikel I Absatz 8 niedergelegt. Die Gewaltenteilung der Bundesebene wiederholt sich auf der Ebene der Einzelstaaten in teilweise unterschiedlicher Ausprägung. So finden sich bis auf Nebraska in allen Staaten Zweikammerparlamente (vgl. Lösche 2008e: 38). Bis 1920 war der duale Föderalismus, der den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten eines Agrarstaates entsprach, systemprägend. Die Einzelstaaten waren in diesem System die mächtigeren Akteure. Erst mit zunehmender Aufgabenwahrnehmung auf der Bundesebene, die in Folge der Entwicklung des Sozialstaates im Rahmen der New Deal-Politik und der fortschreitenden Globalisierung einsetzte, nahm die Bedeutung der Bundesebene zu. Im Zuge der Entflechtungspolitik unter Präsident Reagan und dem Rückzug des Bundes aus einigen gemeinsamen Programmen mit den Einzelstaaten erhalten diese im kooperativen Föderalismus wieder ein stärkeres Gewicht (vgl. Lösche 2008e: 39f). Der US-Föderalismus ist im Vergleich zum deutschen Föderalismus insgesamt durch eine stärkere Trennung zwischen Bundes- und Landesebene gekennzeichnet.
2.2 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
In diesem Abschnitt möchte ich das politische System der Bundesrepublik Deutschland kurz skizzieren. Analog zur Erklärung des politischen Systems der Vereinigten Staaten werde ich dazu auf die Institutionen Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht eingehen sowie die föderalen Strukturen der Bundesrepublik beleuchten. Am Rande werde ich auch die Stellung des Bundespräsidenten im politischen System darlegen.
Zentraler Aspekt des politischen Systems der Bundesrepublik sind die Lehren aus den Erfahrungen mit den politischen Systemen der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Insofern findet sich hier eine Parallele zwischen den politischen Systemen der Bundesrepublik und der USA, beide sind aus den Erfahrungen der Vergangenheit entstanden und spiegeln diese in ihren Vorschriften wider. Die Präambel des Grundgesetzes zeugt vom Ende des Zweiten Weltkrieges und der daraus resultierenden Teilung Deutschlands. Erst mit Vollendung der Deutschen Einheit verlor das Grundgesetz seinen Charakter einer Übergangsverfassung (vgl. Jarras/Pieroth 2009: 12). Das Grundgesetz ist 1990 zu einer „dauerhafte Verfassung“ (Jarras/Pieroth 2009: 12) geworden. Gleichzeitig stellt das Grundgesetz einen Gegenentwurf zur Weimarer Verfassung dar (vgl. Hartmann 2004: 29).
Auch das deutsche politische System ist durch die Gewaltenteilungstheorie beeinflusst. Dennoch sind die Abgrenzungen zwischen Exekutive, Legislative und Judikative nicht so strikt wie in den USA. Die Bundesrepublik ist von einer starken Verrechtlichung des politischen Systems geprägt, dem ein klares Machtzentrum fehlt (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 131). Wie in allen parlamentarischen Regierungssystemen ist das Verhältnis von Exekutive zur Legislative durch eine Verschränkung von Regierung und Regierungsmehrheit im Parlament gekennzeichnet. Da in Deutschland in der Regel auf Bundesebene eine Koalitionsregierung herrscht, schränkt dies die verfassungsrechtlichen Kompetenzen des Regierungschefs ein. Insbesondere seine Richtlinienkompetenz kann der Bundeskanzler nur schwer gegen seine Koalitionspartner durchsetzen (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 131). Neben Bundestag und Bundesrat als Legislative, Bundespräsident und Bundesregierung als Exekutive und dem Bundesverfassungsgericht auf judikativer Seite, existiert mit Bundes- und Landesebene auch eine vertikale Gewaltenteilung.
Die Legislative der Bundesrepublik wird durch Bundestag und Bundesrat gebildet. Der Bundestag wird frühestens 46 und spätestens 48 Wochen nach dem Beginn einer Wahlperiode neu gewählt (vgl. Artikel 39 I GG). Der genaue Wahltag wird dabei durch den Bundespräsidenten festgelegt (vgl. § 16 Bundeswahlgesetz). Ebenso legt das Bundeswahlgesetz die Wählbarkeit der Abgeordneten und den Ablauf der Wahl fest (vgl. Kirchhof 2007: 204-212). Der Bundekanzler beziehungsweise die Bundeskanzlerin wird von der Mehrheit der Abgeordneten gewählt. Die Bundesregierung stützt sich in ihrem exekutiven Handeln auf die Mehrheit der Parlamentsabgeordneten, genauer gesagt auf die Parteien der Regierungskoalition. Nur mit einem konstruktiven Misstrauensvotum kann der Regierungschef abgelöst werden. Das heißt, nur bei gleichzeitiger Wahl eines Nachfolgers wird der Amtsinhaber abgelöst. Allerdings kann auch der Regierungschef sich des Vertrauens des Parlaments versichern und die sogenannte Vertrauensfrage stellen. Wird ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen, so kann der Bundespräsident das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen (vgl. Artikel 63 GG, Artikel 67 GG und Artikel 68 GG). Gerade bei unpopulären Maßnahmen und der Gefahr die Mehrheit zu verlieren, können die Regierungsfraktionen so diszipliniert werden. Damit kann die Bundesregierung als Exekutive Einfluss auf die Legislative nehmen. Der exekutive Einfluss ist allerdings noch weitergehend, da Gesetzesinitiativen direkt von der Bundesregierung in das Parlament eingebracht werden können.
Die Konstruktion des Bundesrates knüpft an die Tradition des Deutschen Kaiserreiches an. Ursprünglich als Gremium geplant, dass den Verwaltungssachverstand der Länder in die Bundesgesetzgebung einbringen soll, kann der Bundesrat im Falle von divergierenden Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat auch als Blockadeinstrument genutzt werden. Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass dies sehr häufig der Fall war (vgl. Schmidt 2007: 199ff). Im Bundesrat sind die Länderregierungen vertreten, ihre Stimmen sind nach der Bevölkerungszahl der jeweiligen Bundesländer gestaffelt und müssen einheitlich abgegeben werden (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 131 f). Dabei ist der Bundesrat eine spezielle Konstruktion. Er ist keine Ständeversammlung, wie beispielsweise der Ständerat in der Schweiz, noch folgt er dem Senatsprinzip, wie der US-Senat (vgl. Schmidt 2007: 198). Er ist sowohl die zweite Kammer des bikameralen Systems der Bundesrepublik als auch ein Verfassungsorgan (vgl. Wagner 2005: 131). Bundesrat und Bundestag sind in der Gesetzgebung nicht gleichberechtigt. So ist die Zustimmung des Bundesrates in der Bundesgesetzgebung nur in rund 60 Prozent aller Fälle erforderlich. Diese Zustimmungsgesetze müssen aber im gleichen Wortlaut von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden, so dass der Bundesrat zum Blockadeinstrument werden kann. Im Falle von entgegengesetzten Mehrheiten von Bundestag und Bundesrat regiert die Bundestagsopposition quasi mit. Stimmen die Mehrheiten von Regierungskoalitionen und Koaltionen in der Stimmenmehrheit der Länder überein, sinkt in der Regel die Vetomacht des Bundesrates (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 132ff). Da im Bundesrat die Länderinteressen vertreten werden, bleibt der Bundesrat aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen zwischen Bund und Ländern ein gewichtiger Vetospieler. Der Bundesrat zwingt die Bundesregierung Konsens für Gesetzesvorhaben herbeizuführen.
In der Exekutive spielt neben der Bundesregierung auch der Bundespräsident eine wichtige Rolle im politischen System der Bundesrepublik. Aus den Erfahrungen der Weimarer Republik sind seine Kompetenzen äußerst knapp gehalten. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf die Repräsentation des Gesamtstaates und die formelle Prüfung der Bundesgesetze (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 132), ein materielles Prüfungsrecht steht dem Bundespräsident nur eingeschränkt zu. Nach herrschender juristischer Lehrmeinung muss es sich dabei um offensichtliche Verstöße gegen das Grundgesetz handeln (vgl. Jarras/Pieroth 2009: 865). Im Falle des Gesetzgebungsnotstandes nach Artikel 81 des Grundgesetzes und im Falle einer verlorenen Vertrauensfrage des Bundeskanzlers kommen dem Bundespräsidenten Reservefunktionen zu, um die Handlungsfähigkeit der Exekutive aufrechtzuerhalten (vgl. Jarras/Pieroth 2009; 861 ff und Abromeit/Stoiber 2006: 132). Die Amtsführung des Bundespräsidenten findet seine Bestimmung „hauptsächlich in stilgebenden, repräsentativen, zeremoniellen Funktionen“ (Schmidt 2007: 177) des Staatsoberhauptes. Gewählt wird der Bundespräsident, dessen Wiederwahl einmal zulässig ist, alle fünf Jahre durch die Bundesversammlung. Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und der gleichen Anzahl von durch die Länderparlamente gewählten Mitgliedern.
Die schwache Stellung des Bundespräsidenten rührt aus den Erfahrungen der Weimarer Zeit her, dem Bundespräsidenten soll es nicht möglich sein, als Ersatzgesetzgeber aufzutreten oder in irgendeiner Situation „den Bundestag oder die Bundesregierung überspielen“ (Hartmann 2004: 30) zu können.
Auf der judikativen Ebene findet sich im politischen System der Bundesrepublik das Bundesverfassungsgericht. Im Gegensatz zum US-Supreme Court kann es nicht ablehnen, politische Streitfälle zu entscheiden. Weiterhin ist es nicht Teil des ordentlichen Instanzenzuges (vgl. Jarras/Pieroth 2009: 968). Seine spezielle Aufgabe ist es „Hüterin der Verfassung“ (Jarras/Pieroth 2009: 932) zu sein. Weiterhin vermittelt es im Organstreitverfahren bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Verfassungsorganen. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts bestimmen, wie die Bundesgesetze auszulegen sind (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 132f und Jarras/Pieroth 2009: 932f).
Die Rolle der Bundesländer ist weit schwächer ausgeprägt, als die der us-amerikanischen Einzelstaaten. Detailliert legt das Grundgesetz in Artikel 70 bis 74 die Gegenstände ausschließlicher und konkurrierender Gesetzgebung fest. Den Ländern sind somit weitgehende Spielräume in der Umsetzung von Bundesrecht genommen, Alleinzuständigkeiten der Länder sind ebenfalls sehr begrenzt (vgl. Abromeit/Stoiber 2009: 133 und Schmidt 2007: 215ff). Der deutsche Föderalismus ist von Verflechtung geprägt, eine vollständige Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen Gliedstaaten und Gesamtstaat findet nicht statt. Wenn auch die Länder nur noch mit wenigen Gesetzgebungskompetenzen ausgestattet sind, haben sie über den Bundesrat einen hohen Mitwirkungsgrad an der Bundespolitik erreicht. Seit 1992 wirken die Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union mit (vgl. Schmidt 2007: 198 und 216).
Anteile der Mehrheits- und der Konsensdemokratie halten sich in der Bunderepublik die Waage. Entscheidungen und Wahlen werden häufig durch die absolute beziehungsweise relative Mehrheit getroffen, beispielsweise die Wahl des Bundeskanzlers durch mindestens die absolute Mehrheit oder die Wahl der Direktkandidaten mit mindestens relativer Mehrheit in ihren Wahlkreisen in den Bundestag. Die Politikverflechtung durch die Beteiligung der Bundesländer an der Bundesgesetzgebung und die engmaschige Verknüpfung von Steuerverbund und Finanzverflechtung hingegen, generiert einen hohen Grad an Konsensorientierung (vgl. Schmidt 2007: 271 und Hartmann 2006: 291). Das Machtzentrum im politischen System stellen, aufgrund ihrer durch im Grundgesetz in Artikel 21 niedergelegten Mitwirkungsrechte und -pflichten, die Parteien dar. Dieses Machtzentrum ist in sich durch die Bundesebene und die Landesverbände der jeweiligen Parteien fragmentiert. Je nach Mehrheitsverhältnissen schwankt der Grad der Machtkonzentration (vgl. Abromeit/Stoiber 2006: 136 und Wagner 2005: 129). „Die Bundesrepublik verkörpert einen parlamentarischen Bundesstaat komplizierter Art“ (Hartmann 2006: 290).
Insgesamt, hat die Bundesrepublik mit ihrem auf Konsens ausgerichteten politischen System eine politische Stabilität in ihrer über 60-jährigen Geschichte erreicht, die in Europa und der Welt ihres Gleichen sucht. In den Jahren von 1949 bis 2005 bekleideten acht Personen das Amt des Regierungschefs. Großbritannien und die USA verweisen in der gleichen Zeit auf 11 Regierungschefs, Italien und Japan kommen sogar auf 24 Regierungschefs (vgl. Schmidt 2007: 163f). Die Lehren aus vorangegangenen Epochen hat das Grundgesetz und mit ihm das politische System der Bundesrepublik erfolgreich umgesetzt.
3 Das Wahl- und Parteiensystem in den USA und der Bundesrepublik Deutschland
In diesem Abschnitt werde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wahl- und Parteiensysteme zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland herausarbeiten. Das Wahl- und Parteiensystem bildet die konkrete Grundlage für Wahlkampf um die politischen Institutionen. Den Begriff des Wahlsystems, kann man sowohl in einem engen, als auch in einem weiten Sinn verstehen. Nach der weiten Begriffsdefinition umfasst das Wahlsystem den gesamten Wahlprozess. Dies schließt das konkrete Wahlrecht und auch die Wahlorganisiation mit ein. Die enge Auslegung umfasst hingegen den „Modus, nach welchem die Wähler ihre Partei- und/oder Kandidatenpräferenz“ (Nohlen 2009: 61) ausüben und wie das Wahlergebnis dann in konkrete Parlamentsmandate umgesetzt wird. In dieser Auslegung, die ich im Folgenden nutzen werde, gehören zum Begriff des Wahlsystems die Regelungen über Wahlkreiseinteilung, Wahlbewerbung, Stimmabgabe und Umrechnung der Stimmen in Parlamentsmandate (vgl. Nohlen 2009: 61). Das Wahlsystem übt durch seine Konzeption Einfluss auf das Parteiensystem aus. Es beeinflusst, wie parteiliche Mehrheitsbildung im politischen System funktioniert. Für das Funktionieren eines poltischen Systems sind Wahlsysteme äußerst relevant (vgl. Nohlen 2009: 65), allerdings eher in der Richtung, wie sie das Verhalten von politischen Akteuren und Institutionen prägen (vgl. Nohlen 2009: 67ff).
„Unter Parteiensystem ist das strukturelle Gefüge der Gesamtheit der politischen Parteien in einem Staat zu verstehen“ (Nohlen 2009: 73). Dies umfasst die Anzahl der Parteien und ihre Größenverhältnisse sowie idiologische Entfernungen zwischen den verschiedenen Parteien, Interaktionsmuster, die Parteibeziehung zur Gesellschaft und zu gesellschaftlichen Gruppen.
Weiterhin rücken die Stellung der Parteien in Bezug auf das politische System und die Strukturiertheit des Parteiensystems in den Betrachtungsmittelpunkt. Von Sartori wurde in den 1960er Jahren eine Einordnung der Parteiensysteme entwickelt, die sich stark auf den Zusammenhang zwischen Fragmentierung und Polarisierung konzentrierte. Entstanden ist damit die altbekannte Einteilung in Zweiparteien-, Mehrparteien- und Vielparteiensystem. Der Polarisierungsgrad nimmt darin mit größer werdender Parteienzahl zu. Während bei Zwei- oder Mehrparteiensystemen die Parteien ideologisch eher in der Mitte zu finden sind, ist die Dynamik in Vielparteiensystemen eher zentrifugal (vgl. Nohlen 2009: 75). Eine Erweiterung dieses Systems nahm Sartori in den 1970er Jahren vor. Zur Einordnung nutzte er ein Kontinuum, unter anderem wurde die Typenanzahl erweitert und Kriterien zur Typenbestimmung vervielfältigt, auch wenn die Anzahl der Parteien das wichtigste Kriterium blieb. Demnach finden sich in der neueren Einteilung das Einparteiensystem, hegemoniales Parteiensystem, dominantes Parteiensystem, Zweiparteiensystem, gemäßigter Pluralismus und polarisierter Pluralismus. Wobei jenseits des polarisierten Puralismus nur extrem kleine Parteien zu finden wären. Die Einteilung entspricht eher einer Gruppierung als einem festen Gefüge mit scharfen Übergängen (vgl. Nohlen 2009: 75ff). Daher sieht Lipset die nationalen Parteiensysteme als Ergebnis einer spezifischen Entwicklung. Er und Rokkan sehen die Parteiensysteme in den Sozialstrukturen verankert, so „entsprechen die vereinbarten Institutionensysteme mehr oder weniger den sozialstrukturell fundierten Parteiensystemen“ (Nohlen 2009: 79).
3.1 Das Wahlsystem der USA
Die starke Stellung der Einzelstaaten im politischen System der USA spiegelt sich auch im Wahlsystem wider. Selbst in Bezug auf Bundeswahlen kann nicht von einem einheitlichen Wahlsystem gesprochen werden. Vielmehr wird das sogenannte Electoral College nach den Wahlgesetzen der Einzelstaaten bestimmt, diese können sogar unterschiedliche Wahlmethoden innerhalb der verschiedenen Counties zulassen (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 344 und Dörner/Vogt 2002: 194f). Übliches Wahlverfahren ist in den Vereinigten Staaten die relative Mehrheitswahl. Der Kongress der Vereinigten Staaten besteht aus Repräsentantenhaus und Senat. Während die 435 Repräsentanten entsprechend der Bevölkerungszahl auf die Einzelstaaten aufgeteilt sind, stehen jedem Staat zwei Senatoren zu. Repräsentanten werden alle zwei Jahre gewählt, die Amtszeit von Senatoren beträgt sechs Jahre. Allerdings wird je ein Drittel der Senatoren alle zwei Jahre zusammen mit den Abgeordneten des Repräsentantenhauses gewählt (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 22f). Das Wahlrecht zum US-Senat ist seit 1866 auf Bundesebene einheitlich geregelt, seit 1917 werden die Senatoren zudem durch relative Mehrheitswahl in ihren Wahlkreisen durch das Volk gewählt (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 22). Parteien spielen bei der Wahl nur eine untergeordnete Rolle. In erster Linie stehen die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis als Person im Vordergrund. Die Parteizugehörigkeit ist bestenfalls nützlich (vgl. Hartmann 2004: 100). Die Zahl der Kongressabgeordneten hat sich seit dem ersten Kongress erhöht. Die ist eine Folge der Abhängigkeit von der Bevölkerungsgröße, der Zusammensetzung des Repräsentantenhauses und der Abhängigkeit der Anzahl der Senatoren von der Anzahl der Einzelstaaten. So stieg die Zahl der Senatoren zuletzt 1961 auf 100 an. Die Zahl der Repräsentanten wurde 1922 auf 435 Mitglieder begrenzt (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 23). Entsprechend aller zehn Jahre stattfindender Volkszählungen werden die Wahlkreise der Repräsentanten verteilt. Allerdings wird diese proportionale Aufteilung verzerrt, da jedem Staat mindestens ein Repräsentant zusteht (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 23). Die kurze Legislatur der Repräsentanten führt zu einem Zustand des Dauerwahlkampfes in den Wahlkreisen und trägt entscheidend zu dem engen Verhältnis von Repräsentant und seinem Wahlkreis bei (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 23). Da die konkrete Wahlkreiseinteilung den Einzelstaaten überlassen ist, kommt es bei der konkreten Gestaltung der Wahlkreise zu Auseinandersetzungen. Jede der beiden großen Parteien ist bemüht, möglichst eigene Hochburgen zu erhalten und die Hochburgen des Gegners aufzuteilen. In der Regel kommt es aber zu Parteiabsprachen, da die erforderlichen Mehrheiten zur Änderung der Einteilung selten in der Hand einer Partei liegen. Auch hierdurch ist beispielsweise die hohe Wiederwahlquote der Repräsentanten zu erklären (vgl. Filzmaier/Plasser 2005: 23ff).
Ursprünglich war das amerikanische Wahlsystem zensusgeprägt, das heißt, das Wahlrecht war an das Zahlen von Steuern geknüpft. Mit dem Hinzutreten der neugegründeten Einzelstaaten im Westen und der damit verbundenen stärkeren Durchsetzung einer anderen Auffassung des Gleichheitsprinzips wurde vom Zensuswahlrecht Abstand genommen. Ein weiterer Demokratiesierungsschub setzte nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ein, als auch den schwarzen Bevölkerungsteilen das Wahlrecht zuerkannt wurde. Das Frauenwahlrecht wurde erst 1920 als Verfassungszusatz eingeführt, ebenso wurde mit Bürgerrechtsgesetzen in den 1960er Jahren die Diskriminierung der afro-amerikanischen Bevölkerungsteile per Verfassungszusatz beendet. Seit 1961 dürfen auch die Bewohner der Bundeshauptstadt an Präsidentschaftswahlen partizipieren, das Wahlalter wurde 1974 auf 18 Jahre abgesenkt (vgl. Lösche/von Loefelholz 2004: 344).
3.2 Das Parteiensystem der USA
„Die USA gelten als Geburtsstätte des modernen Parteiwesens“
(Lösche/von Loeffelholz 2004: 319).
Dennoch funktioniert das amerikanische Regierungssystem eher trotz dem Vorhandensein von Parteien, es käme auch ohne sie aus. Dementsprechend schwach sind die Parteien an sich auch im Kongress vertreten. Fraktionsdisziplin bildet eher die Ausnahme, Mehrheiten lassen sich eher an den Notwendigkeiten für den eigenen Wahlkreis finden (vgl. Hartmann 2004: 41). Amerikanische Parteien bildeten sich, um als Vehikel den Machterwerb zu sichern. Da die Wählerschaft sehr heterogen war, waren zumindest zeitweise Vereinigungen vonnöten, um Minderheiteninteressen zu bündeln und so die relative Mehrheitswahl für ein öffentliches Amt zu gewinnen (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 320). Es waren die praktischen Erwägungen, Interessen bündeln zu können, um erfolgreich eine Wahl zu gewinnen, die Parteiformationen entstehen ließ. Zur Entstehungszeit der Parteien fehlten die klassischen, in Europa zu findenen, Konfliktlinien. Da Staat und Religion in den USA strikt getrennt sind, fehlt der Anreiz, Parteien an einem weltanschaulichen Grundmuster auszurichten. Sozio-ökonomischen Konflikten konnte bis weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Besiedelung neuer Territorien begegnet werden (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 320). Somit konnten sich Parteien als „Patronagepartei“ (Lösche/Loeffelholz 2004: 320) etablieren. Erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts und wachsenden Wohlfahrtsfunktionen des Staates, wandelten sich die amerikanischen Parteien im Zuge zahlreicher Bürokratiereformen und gesetzlicher Reformen im Parteienwesen, wie beispielsweise die Einführung der Vorwahlen, oder die Regulationen in der Parteienfinanzierung. Die klassischen Züge der Patronagepartei finden sich hauptsächlich nur noch auf lokaler und regionaler Ebene, auf denen zahlreiche Ämter gewählt werden. Auf Staats- und Bundesebene ähneln die Parteien eher Interessenverbänden (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 321).
Die Parteiengeschichte der Vereinigten Staaten ist vom Dualismus zweier Parteien geprägt, den Demokraten und den Republikanern, die sich mit wechselnden Mehrheiten gegenüberstehen. Dabei können beide Parteien auf bestimmte Hochburgen und Stammwählerschaften zurückgreifen, die sie über einige Jahrzehnte halten können. Trotz unterschiedlicher Programmpositionen sind die beiden großen Parteien ideologisch nicht weit voneinander entfernt. Neue Streitfragen brechen die traditionellen Parteigrenzen auf und führen zu einer Verschiebung in den Machtverhältnissen zwischen den Parteien (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 321 ff). Gerade auf lokaler und regionaler Ebene sind weitere, Dritte Parteien, anzutreffen. Dies können unter anderem abtrünnige Flügel der etablierten Parteien sein, wie beispielsweise die States‘ Right - Partei unter Strom Thumond oder auch unabhängige Parteien wie die People’s Party, die 1892 sogar 22 Elektorenstimmen bei der Präsidentschaftswahl, mehrere Gouverneursämter und hunderte lokale Ämter gewinnen konnte. Die meisten Drittparteien bleiben aber regional oder thematisch sehr begrenzt (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 324). Dennoch zwingen sie die großen Parteien, sich ihren Themen zu öffnen und verändern somit das Machtgefüge zwischen den Demokraten und den Republikanern.
Beide großen Parteien berufen sich auf lange Traditionslinien, die bis in die Gründungszeit der USA hineinreichen. Dabei sehen sich die Republikaner letztlich in der Tradition der Föderalisten um George Washington und John Adams, als Organisierte Partei ging sie nach 1810 nieder, blieb aber als politische Strömung präsent. Sehr stark sehen sie sich als Grand Old Party in Tradition Lincolns, als Partei, die die uramerikanischen Werte vertritt (vgl. Lösche/von Loeffelholz). Die Anti-Federalists Gruppierung um Thomas Jefferson, James Madison und James Monroe firmierten unter dem Laber ,Republikaner‘, sie bilden die Tradition, auf die sich die Demokratische Partei beruft. Grundsätzlich treten bis nach dem Bürgerkrieg unterschiedliche Parteigruppierungen auf. Die großen politischen Strömungen bleiben in den unterschiedlichen Parteien sichtbar. Die heutige Republikanische Partei findet ihre konkreten Wurzeln 1856 in der Gegenbewegung zum Kansas-Nebraska-Act (vgl. Brogan 1954: 63), die heutige Demokratische Partei entstand bereits in der zweiten Legislaturperiode von Präsident Andrew Jackson (1833-37). In das moderne US- Parteiensystem ging sie erst nach Ende des Bürgerkrieges und Überwindung ihrer inneren Spaltung ein (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 322; Brogan 1954: 58 und 63).
Die heute existierenden Konfliktlinien im US-Parteiensystem sind sozialstrukturellideologische Konflikte, die ihre Ursache in der Weltwirtschaftskrise oder der New-Deal- Politik haben (vgl. Lösche/von Loeffelholz 2004: 332).
3.3 Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland
Die Grundsätze zur Wahl des Deutschen Bundestages haben sich seit 1949 nicht verändert. Er wird seit Bestehen der Bundesrepublik durch die personalisierte Verhältniswahl gewählt. Ebenso wie das gesamte politische System der Bundesrepublik ruht das Wahlsystem auf einem Kompromiss des Parlamentarischen Rates. Es soll die Zersplitterung des Parlamentes verhindern, indem es Mehrheits- und Verhältniswahl kombiniert (vgl. Nohlen 2009: 326f).
[...]
[1] Der Budget and Impoundment Control Act von 1974 verpflichtet den Präsident die Nichtausgabe von Geldern dem Kongress anzuzeigen. Dieser kann den Präsidenten zwingen, die Gelder dennoch auszugeben. Ebenso ist mit dem Congressional Budget Office ein Gegengewicht zum OMB geschaffen (vgl. Lösche 2008d: 29f). Weiterhin erhält der Kongress über die Haushalte der Bundesbehörden Einfluss auf diese.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schröder (Autor:in), 2010, Vergleich von Wahlen zum US-Kongress mit den Bundestagswahlen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Erststimme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148833
Kostenlos Autor werden









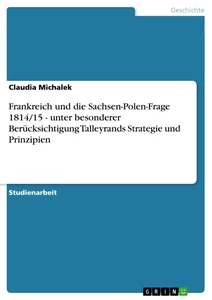
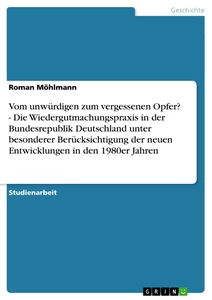


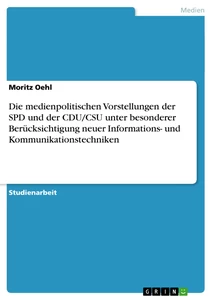






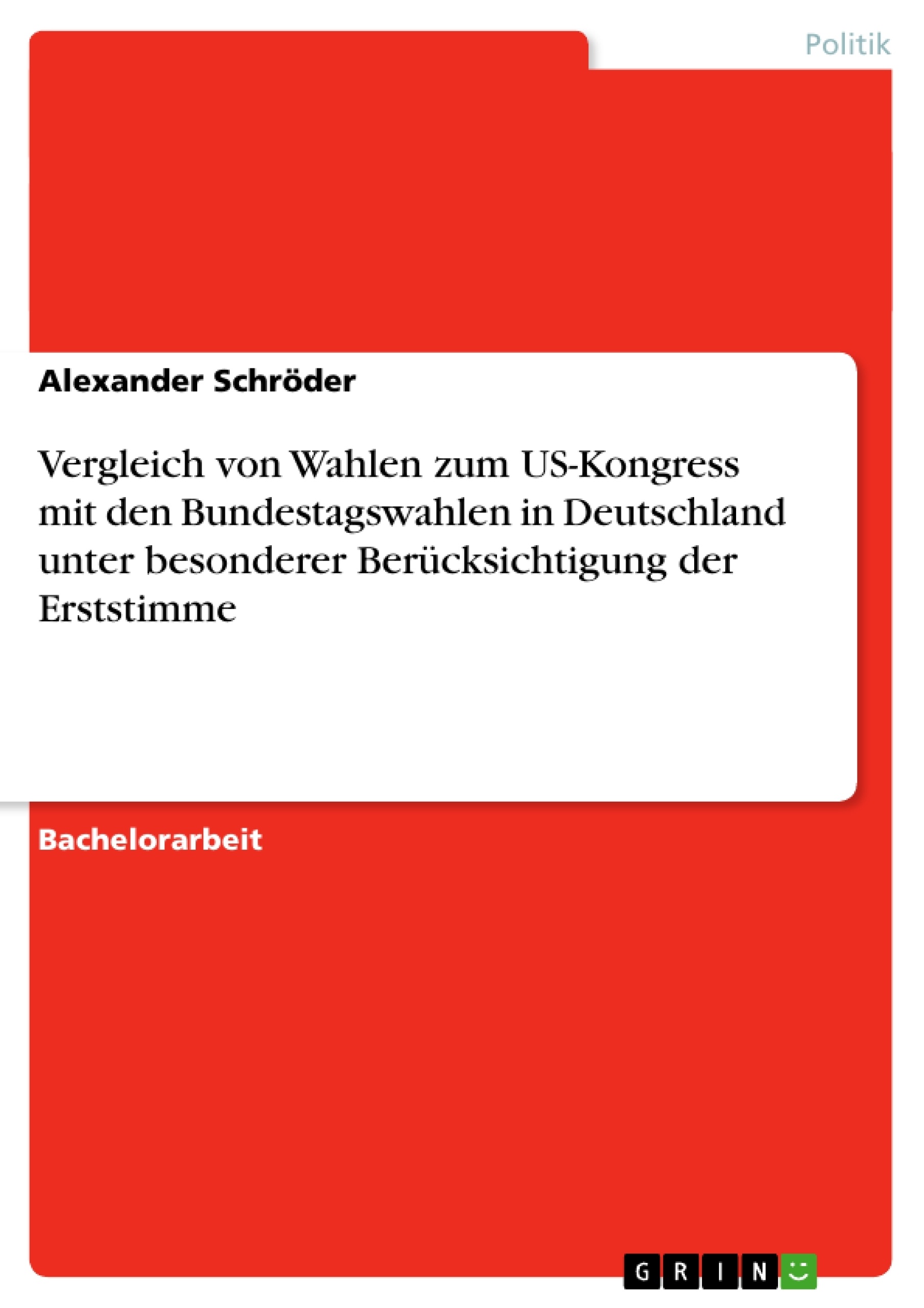

Kommentare