Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes
3. Die Ähnlichkeitstheorie
4. Muß Bilderlesen gelernt werden?
5. Das logische Argument
5.1 Ähnlichkeit als notwendige Bedingung
5.2 Ähnlichkeit als hinreichende Bedingung
6. Das transzendentale Argument
6.1 Die Welt kopieren, wie sie ist
6.2 Das unschuldige Auge
6.3 Einhörner und Käfer in Schachteln
7. Fazit
8. Anhang
8.1 Literatur
8.2 Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Die antike Anekdote des Wettstreits zwischen den Malern Zeuxis und Parrhasios berichtet, dass Zeuxis so wirklichkeitsnahe Trauben malte, daß die Vögel nach ihnen pickten; Parrhasios übertraf ihn, indem er einen Vorhang zeichnete, den Zeuxis aufzuziehen wünschte, sodaß Zeuxis zwar die Tiere, Parrhasios aber selbst die Menschen zu täuschen vermochte.
Was macht ein Bild zum Bild? Wie wird der Referent eines Bildes festgelegt? Und worin besteht der Unterschied zwischen pikturaler Repräsentation und verbaler Beschreibung? Meiners „Enzyklopädie Philosophie“ definiert ein Bild als „einen Gegenstand, der innerhalb einer Mitteilungshandlung oder Ausdruckshandlung im Unterschied zur sprachlichen Darstellung nicht als Beschreibung, sondern als visuelle Veranschaulichung eines (fiktiven oder realen) Sachverhalts aufgefasst wird.“[1]
In dieser ersten Definition wird „Bild“ direkt in Opposition zur Beschreibung definiert. Doch worin besteht diese Opposition? Etwa darin, dass das Bild seinem Gegenstand ähnlicher ist als die Beschreibung? Sind pikturale Symbole motiviert, während sprachliche arbiträr sind?
Der klassischen Antwort zufolge ist dies der Fall. Die Relation zwischen Bild und Abgebildetem ist eine Ähnlichkeitsrelation. In dieser Hausarbeit wird als Vertreter dieser Position durchgehend Klaus Sachs-Hombach mit seinem Aufsatz: „Über Sinn und Reichweite der Ähnlichkeitsrelation“[2] angeführt. Nelson Goodman hingegen vertritt die Gegenposition. Er analysiert im ersten Kapitel seiner „Sprachen der Kunst“[3] jene Ähnlichkeitsrelation. Dabei stößt er auf eine Reihe von Problemen, die ihn zu dem Schluß kommen lassen, daß die Beziehung zwischen Bild und Abgebildetem „keine ‚natürlichere’ Beziehung als die zwischen sprachlichen Zeichen und Bezeichnetem“[4] ist. Daß jene Relation zwischen Bild und Abgebildetem nicht auf Ähnlichkeit beruht, ist im höchsten Maße kontraintuitiv.
Die Ähnlichkeitstheorie hat einen gewissen Reiz und ist nicht bloß ein Dogma. Zum einen ist das die offizielle Lehre, aber das ist nicht alles. Denn wenn es sich bloß um ein „Dogma“ handelte, wie Oliver Scholz wiederholt betont,[5] so würde der Hinweis auf die Unzulässigkeit von dogmatischer Begründung genügen, um die Ähnlichkeitstheorie zu Grabe zu tragen, auch wenn sie noch so langlebig ist. Doch es kommt noch mehr hinzu. Die hier angeführten Kritiker der Ähnlichkeitstheorie berufen sich auf Nelson Goodman. Goodman setzt der Ähnlichkeitstheorie eine andere Theorie gegenüber, wie Bedeutung von Bildern statt dessen zustande kommt. Er wählt dabei einen rein extensionalen Ansatz.[6] Wenn aber die Bedeutung von Bildern und allen übrigen Zeichen mittels Bezugnahme zustande kommt, so stellt sich die Frage, wie diese Bezugnahme funktioniert. Daher geht Goodman sehr ausführlich auf die Ähnlichkeitstheorie ein: Er möchte zeigen, daß diese Bezugnahme nicht auf Ähnlichkeit beruht, sondern von ganz anderer Art ist.
Klaus Sachs-Hombach faßt die Kritik an der Ähnlichkeitstheorie folgendermaßen zusammen:
„Die Probleme des bildtheoretischen Rückgriffs auf den Ähnlichkeitsbegriff liegen nicht so sehr darin, dass Bilder gar nichts mit Ähnlichkeit zu tun hätten oder dass die Ähnlichkeitstheorie in allen Fällen falsch oder insgesamt unsinnig ist. Vielmehr bleibe die Ähnlichkeitstheorie nach Ansicht ihrer Kritiker für die entscheidenden philosophischen Fragen einer Begriffsanalyse unergiebig. Weder für die Frage, was ein Bild zum Bild macht, noch für diejenige, wie der konkrete Referent eines Bildes festgelegt wird, liefere der Ähnlichkeitsbegriff hinreichende oder notwendige Bedingungen.“[7]
Es sind diese Punkte, die in der folgenden Arbeit konkreter betrachtet werden sollen, hinzu kommt, ob die Ähnlichkeitstheorie hilft, bildliche und sprachliche Zeichen zu unterscheiden. Zunächst werde ich untersuchen, auf welche Art von Bildern sich der Ähnlichkeitsbegriff sinnvoll anwenden läßt. Daran anschließend werden die drei oben genannten Fragen diskutiert. Ich beginne mit einer Untersuchung, ob Ähnlichkeit etwas dazu beitragen kann, bildliche von sprachlichen Zeichen zu unterscheiden, indem ich das Argument der semantischen Anomalie des Bildes prüfe. Im nächsten Schritt wird analysiert, ob Ähnlichkeit ein Kriterium an die Hand gibt, zu entscheiden, was ein Bild zum Bild macht, ob sie dafür notwendige oder hinreichende Bedingung sein kann. Als letzte der oben genannten Fragen werde ich diejenige aufgreifen, ob Ähnlichkeit dazu beiträgt, den Referenten eines Bildes festzulegen. Am Ende dieser Hausarbeit wird dann im Fazit kurz Goodmans alternative Theorie der Bezugnahme vor- und der Ähnlichkeitstheorie gegenübergestellt.
2. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes
Wie bildliche bzw. pikturale Bezugnahme funktioniert soll in dieser Hausarbeit untersucht werden. Dabei ist es wichtig, zunächst einmal den Begriff des Bildes näher zu bestimmen, denn „Bild“ kann vieles bedeuten. Der Begriff kann für Gemälde und Fotographien genauso stehen wie für Spiegel und Schattenbilder, sprachliche Bilder – also Metaphern – oder gar Phantasiebilder und Vorstellungen. Es handelt sich fraglos um sehr verschiedene Kategorien von „Bildern“. Für eine umfassende Untersuchung aller dieser Phänomene fehlt hier der Raum. Daher möchte ich zunächst jede Art von Vorstellungsbildern aus der Untersuchung ausschließen, schon allein, weil es sich dabei um „Käfer in Schachteln“[8] handelt, und eine Untersuchung entsprechend unzählige ungelöste Fragen aufwerfen würde. Allerdings werden wir später sehen, wie eng der Begriff der Vorstellung auch mit dem hier behandelten Bildbegriff verknüpft ist. Ferner gehören auch „natürliche Bilder“ wie Schatten und Spiegelungen nicht zum Untersuchungsgegenstand. Letztlich wird sich diese Arbeit auf jene Art von Bildern beschränken, die von Menschen gemacht wurden und von Menschen betrachtet werden können. Oliver R. Scholz liefert hier eine hilfreiche Definition:
„Der Terminus „Bild“ und seine Äquivalente in anderen Sprachen bezeichnen heutzutage primär Dinge wie Gemälde, Zeichnungen und Verwandtes (Kupferstiche, Holzschnitte etc.) nebst ihren vielfältigen technischen und elektronischen Weiterentwicklungen.
Bilder in diesem Sinne sind Artefakte, künstliche Gegenstände, die in bestimmter […] Weise etwas darstellen oder zumindest etwas sehen lassen.“[9]
Im folgenden werde ich, wenn nicht anders ausgezeichnet, immer von diesem artifiziellen Bildbegriff ausgehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ferner kann „Ähnlichkeit“ auch nicht auf alle Bilder dieser Definition angewandt werden. Es gibt Bilder, bei denen die Frage, ob sie aufgrund von Ähnlichkeit funktionieren, fehl am Platze ist. Bei einem Bild, wie Yves Kleins „Monochrom“ spielt Ähnlichkeit keine Rolle, weil der Weg der Bezugnahme im Fall eines solchen abstrakten Gemäldes nicht der der Repräsentation oder Denotation ist, sondern dieses Bild zum Symbol wird, indem es exemplifiziert. Daß diese Bilder nicht Teil der Untersuchung sind, scheint zunächst selbstverständlich, doch Oliver Scholz liefert einen Einwand, warum nicht-denotierende Bilder nicht aus der Ähnlichkeitstheorie herausfallen dürfen: Solche Bilder seien zum einen vollwertige Bilder und nicht etwa degeneriert, wie manchmal behauptet wurde. Zum anderen weisen solche Bilder, wie eben kurz erläutert, keine Relation zu einem abgebildeten Gegenstand auf. Hieraus ergibt sich, daß der Bildbegriff nicht durch die Relation zum abgebildeten Gegenstand erklärt werden kann, da viele Gegenstände, auf die as Prädikat „Bild“ zutrifft von der Theorie unbetroffen sind.[10] Hier zeigt sich also eine erste Hürde für die Ähnlichkeitstheorie, bei ihrem Anspruch, die Frage zu beantworten, was ein Bild zum Bild macht. Da diese Frage aber im fünften Kapitel modallogisch beantwortet wird, gehe ich nicht weiter auf abstrakte Bilder ein. Hinzu kommt, daß wenngleich die Ähnlichkeitstheorie das Phänomen abstrakter Bilder nicht erklären kann, so besagt dies nicht, daß sie nicht die Unterkategorie der Abbildungen erläutern kann. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß die Übergänge zwischen Abbildungen und anderen Bildern fließend sind. Speziell Bilder mit Null-Denotation, die gewissermaßen eine Zwischenstellung einnehmen, da sie etwas abbilden, das nicht existiert, müssen hier behandelt werden.
Der letzte zu klärende Terminus ist der Terminus: „Welt“. Nelson Goodman, der hier als Hauptangegner der Ähnlichkeitstheorie angeführt wird, kann aus einem ganz simplen Grunde Ähnlichkeit nicht als Faktor für pikturale Darstellung zulassen: Dafür müßte es eine uns zugängliche Welt geben, die der auf Bildern dargestellten ähnlich ist:
„Zeitgenössische Realisten stehen in der Gefahr zu meinen, dass eine optimale wortwörtlich verstandene Sprache ihren Anwendungsbereich in natürliche Arten unterteilt oder die Natur an den Angelpunkten zerlegt oder die wahre und letzte Struktur der Realität ans Licht bringt. Irgendwie soll die Welt ihre angemessene Beschreibung diktieren. Goodman lehnt das ab. Er glaubt, dass jede Ordnung, die wir finden, eine Ordnung ist, die wir auferlegen.“[11]
In diesem Konstruktivismus Goodmans, den man mit Sicherheit auch auf seine Bildtheorie übertragen kann, liegt seine Ablehnung einer Ähnlichkeitsrelation begründet. Denn Goodman zufolge läßt sich die Welt nur anhand von Symbolsystemen erschließen, was eine Ähnlichkeitsrelation zwischen einem Bild und seinem Referenten – die dritte zu untersuchende Frage – ausschließt.
3. Die Ähnlichkeitstheorie
Daß Bilder aufgrund von Ähnlichkeit bedeuten oder auf etwas Bezug nehmen, galt lange als unangefochten.[12] Es ist ein intuitiver Gedanke, eine Wahrheit, die sich sofort zu erschließen scheint, doch Oliver Scholz vertritt die Ansicht, daß dieses Dogma, welches lange Zeit einer genaueren Untersuchung von Bildern im Weg gestanden habe, nicht so unproblematisch sei, wie es zunächst den Anschein habe:
„Versucht man dennoch der zunächst ansprechenden Ähnlichkeitsauffassung auf den Grund zu gehen, so stößt man auf zahlreiche grundsätzliche Schwierigkeiten, welche die Unzulänglichkeit dieses Ansatzes ans Licht bringen.“[13]
Der klassischen Theorie nach sind Bilder ikonische Zeichen im Sinne Charles S. Peirce. Solche ikonischen Zeichen bezeichnen etwas aufgrund einer Ähnlichkeit.[14]
Die Auffassung, daß Bilder aufgrund von Ähnlichkeit Bezug nehmen, hängt eng mit der Auffassung zusammen, daß sprachliche Zeichen dies nicht tun. Diese Lehre, das sprachliche Zeichen sei arbiträr, läßt sich leicht erklären, wenn man sprachliche Zeichen bildlichen gegenüberstellt. Die Klasse der Zeichen umfaßt folglich bildliche Zeichen die motiviert aufgrund einer Ähnlichkeitsbeziehung sind und Wörter, die das offensichtlich nicht sind. Entsprechend läßt sich die Unterklasse sprachlicher Zeichen von der der bildlichen abgrenzen, indem sie als bloß konventionell funktionierend beschrieben wird. Sachs-Hombach zeigt sich bestrebt, die Ähnlichkeitstheorie zu verteidigen, indem er einigen Argumenten der Gegner recht gibt, aber meint, die Ähnlichkeitstheorie könne dennoch aufrecht erhalten werden. Sachs-Hombach gibt zu, daß Bilder konventionell sind, aber sie seien nur eingeschränkt arbiträr, da unter anderem das Bildverstehen oft anhand ‚natürlicher Bilder’ erlernt werde. Man könne aber nicht von einer ‚Nicht-Arbitrarität’ sprechen, ohne auf den Ähnlichkeitsbegriff zurückzugreifen.[15] Er schränkt mithin die Reichweite der Ähnlichkeitstheorie ein:
„Sicherlich ist Ähnlichkeit kein geeigneter Kandidat bei der allgemeinsten Frage, was ein Bild überhaupt zum Bild macht. Für die konkretere Frage nach der Unterscheidbarkeit von bildhaften und sprachlichen Zeichen und ebenso für die Frage, wie Bilder repräsentieren, scheint mir der Ähnlichkeitsbegriff aber […] ein zum Verständnis wertvolles Kriterium zu liefern.“[16]
Diese beiden Punkte, die Unterscheidung von pikturalen und sprachlichen Symbolen einerseits und andererseits die Frage, wie Bilder referieren, müssen also geklärt werden, um die Ähnlichkeitstheorie zu prüfen. Darüber hinaus, wird auch die Frage, was ein Bild zum Bild macht noch behandelt, denn wenngleich Sachs-Hombach sie hier ablehnt, ist er es selbst, der sie später wieder durch die Hintertür in die Untersuchung einführt.
Ich wende mich aber zunächst der Unterscheidung von pikturalen und sprachlichen Symbolen zu. Zwischen diesen beiden Kategorien von Symbolen wird ein grundlegender Unterschied angenommen. Als Indiz dafür gilt, daß sprachliche Zeichen erlernt werden müssen, während dies bei Bildern nicht der Fall ist.
[...]
[1] Meiner „Enzyklopädie Philosophie“ 1999; S. 184.
[2] Sachs-Hombach 2005.
[3] Goodman 1995.
[4] Sachs-Hombach 2005; S. 204.
[5] Vgl. Scholz 2004; unter anderem S. 17.
[6] Vgl. Goodman 1995; S. 9 ff.
[7] Sachs-Hombach 2005; S. 203.
[8] Vgl. Wittgenstein: PU 293. Ich werde diesen Punkt am Ende der Arbeit wieder aufgreifen und dort die wittgensteinsche Metapher erläutern.
[9] Scholz 2004; S. 5.
[10] Vgl. Sachs-Hombach 2005; S. 220. Sachs-Hombach bezieht sich hier auf Oliver R. Scholz: „’Mein teurer Freund, ich rat’ Euch drum / Zuerst Collegium Syntacticum’ – Das Meisterargument in der Bildtheorie“; in: Sachs-Hombach/ Rehkämpfer (Hg.): „Bildgrammatik. Interdisziplinäre Forschungen zur Semantik bildhafter Darstellungsformen“; Magdeburg 1999; S. 33-45.
[11] Elgin 2005; S. 47.
[12] Vgl. Scholz 2004; S.17.
[13] Scholz 2004; S. 17.
[14] Vgl. CP 2.274. Man muß allerdings beachten, daß Pierce’ Konzept des Ikons komplexer ist. Ähnlichkeit ist für Pierce bloß die Relation des Zeichens zu seinem Objekt und reicht nicht hin, um ein Zeichen verständlich zu machen. Die Beschaffenheit des Zeichens spielt genauso eine Rolle wie der sogenannte Interpretant, ein weiteres Zeichen mit dessen Hilfe das Ikon interpretiert wird. In der Pierceschen Konzeption kann man auch zwischen artifiziellen Bildern (ikonischen Zeichen) und natürlichen Bildern wie Schatten oder Spiegelungen, welche indexikalische Zeichen genannt werden, unterscheiden.
[15] Vgl. Sachs-Hombach 2005; S. 204; Fußnote.
[16] Sachs-Hombach 2005; S. 204/205.
- Arbeit zitieren
- Daniel Brockmeier (Autor:in), 2006, Die Bezugnahmen von Bildern - Eine Kritik an der Ähnlichkeitsrelation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146504
Kostenlos Autor werden



















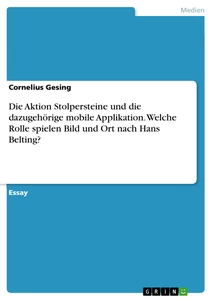
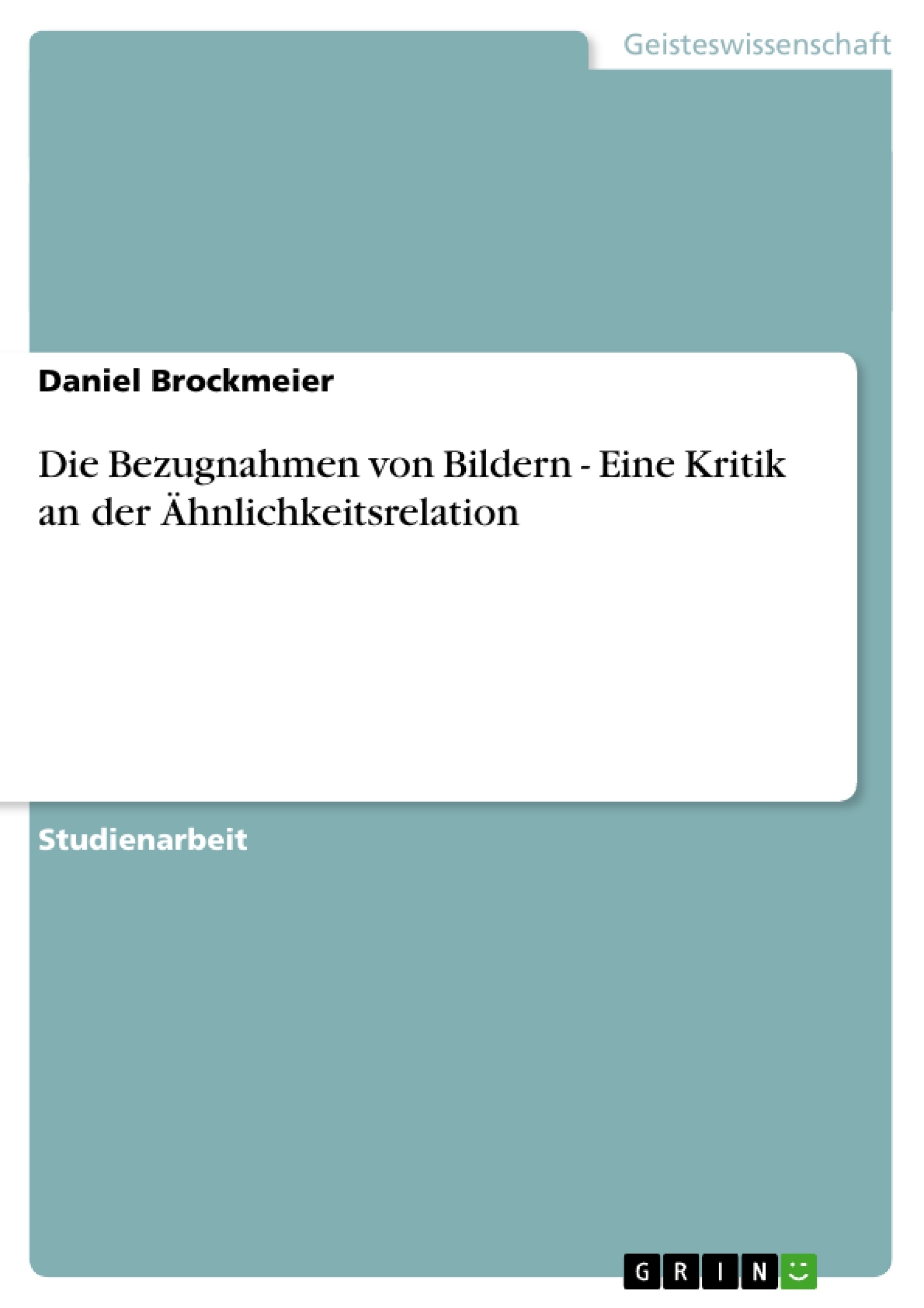

Kommentare