Leseprobe
Inhalt
6. Die Muster der Erfahrung
6.1 Der Begriff des Objekts
6.2 Implikationen des Kommunikationsschemas für den Begriff
6.3 Die Kategorien der Erfahrung
6.4 Der apriorische Gehalt der Erfahrung
6.5 Form und Inhalt
6.6 Form und Werkzeug
6.7 Der Realitätsverlust des radikalen Konstruktivismus
6.8 Ein vergeblicher Versuch zur Rettung der Realität
6.9 Der konstruktivistische Formbegriff
6.10 Von der Seinsart der Gegenstände der Mathematik
6.11 Das Objekt als reine räumliche Form
6.12 Die Erscheinung von realen und idealen Quantitäten
6.13 Das Universum der reinen Quantität
6.14 Mathematik und Sprache
6.15 Die Mathematisierung der Erfahrung
6.16 Das Unreine an der reinen Mathematik
7. Die Funktionen der Sprache
7.1 Sprechen als stellvertretendes Handeln
7.2 Gegenüberstellung von Ersatz- und Probehandeln
7.3 Die Sprachstruktur als Abbild der Struktur des Handelns
7.4 Ergänzende Sprachfunktionen
7.5 Das Sprachspiel und seine Grammatik
7.6 Einer Regel folgen
8. Die Gesetze der Logik
8.1 Das Urteil und die Geltung von Verhaltensregeln
8.2 Zum pragmatistischen Stellenwert des Urteils
8.3 Das Urteil vor dem Hintergrund des Kommunikationsschemas
8.4 Die Rolle des Urteils beim Erkennen und Probehandeln
8.5 Die Bedeutung der Termini und der generellen Urteile
8.6 Der Sinn von Sein
8.7 Der Satz vom Widerspruch
8.8 Die Regeln der Konstruktion von Regelsystemen
8.9 Die duale Erscheinung des Urteils
8.10 Komplexe Sachverhalte und Geltungsrelationen
8.11 Die prädikatenlogische Funktion der logischen Partikel
8.12 Äquivalenzurteil und physikalisches Äquivalenzprinzip
8.13 Die beiden Arten der Negation
8.14 Die aussagenlogische Funktion der logischen Partikel
8.15 Freges Position
8.16 Die Abbildungsprobleme der modernen Logik
8.17 Wahrheitswert und Tauschwert
8.18 Bedeutung und Sinn im transzendentalen Pragmatismus
9. Pragmatismus und Pragmatik
9.1 Verstehen und Erklären
9.2 Pragmatismus und Kontemplation
9.3 Pragmatismus und praktische Vernunft
9.4 Pragmatismus und Pragmatik
9.5 Der Sprachidealismus der transzendentalen Hermeneutik
9.6 Wahrheit und Diskurs
9.7 Die Grenzen der psychoanalytischen Tiefenhermeneutik
9.8 Ideologiekritik als Kritik der Grammatik von Sprachspielen
9.9 Kritik und Weltveränderung
9.10 Die Aufgaben der Philosophie
9.11 Erkenntnistheorie und Ethik
Verzeichnis der in den Bänden I und II zitierten Literatur
6. Die Muster der Erfahrung
Nach der in Band I abgeschlossenen Analyse des klassischen Kraft-Materie-Paradigmas wird in weiterer Folge darzustellen sein, wie (und warum) sich der physikalische Begriffsapparat allmählich wandelt. Im Zuge jener Entwicklung ändert sich nicht nur das Verständnis dessen, was man als Objekt bezeichnet, sondern auch die Vorstellung davon, was als Eigenschaften und als Verhalten jenes nun in neuem Lichte erscheinenden Gegenstandes anzusehen sei. Bevor wir jedoch im dritten Band der Studienreihe und in einer auf diesen folgenden Publikation die Details dieser Revolution der physikalischen Sichtweise des Objekts betrachten können, gilt es, im vorliegenden zweiten Band den erkenntnistheoretischen Hintergrund unserer bisher erzielten Ergebnisse ausleuchten.
Wir werden die dafür erforderliche systematische Reflexion auf den Vorgang des Begreifens von Gegenständen in vier Anläufen vollziehen: Zunächst haben wir im nun folgenden Teil 6 die wichtigsten Muster der Erfahrung zu analysieren. Im anschließenden Teil 7 müssen wir uns der Rolle der Sprache im Erkenntnisprozeß vergewissern, um dann in Teil 8 eine korrekte Bestimmung des Stellenwerts der Logik bei der Konstitution der uns erscheinenden Welt vornehmen zu können. In Teil 9 schließlich, versuchen wir nochmals eine abschließende Schärfung der Konturen des all unseren Überlegungen zugrunde liegende erkenntnistheoretischen Ansatzes, indem wir ihn mit einigen der für seine Entstehung wichtigen Positionen aus der älteren und jüngeren Geschichte der Philosophie vergleichen.
Im Zuge dieser Auseinandersetzung mit den Grundfragen von Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie und Logik wird sich zeigen, daß ein enger Zusammenhang zwischen dem Objektivismus der Einzelwissenschaften, wie etwa der klassischen Physik, und einer in der philosophischen Tradition immer wieder zum Durchbruch kommenden Tendenz zur Verdinglichung des Erkennens selbst besteht. Während man im ersten Fall die Konstitution der Naturphänomene durch die Praxis des erfahrenden Subjekts ausblendet, wird im zweiten die Tätigkeit des Erkennens als ein Hantieren mit Dingen mißverstanden.
Wenn es daher bei unseren vorangehenden Reflexionen auf die Methode der Physik darum ging, die verdeckten Bezüge zwischen den Erscheinungen des physikalischen Objekts und dem Handeln zu entdecken, ist in der nun folgenden Auseinandersetzung mit den traditionellen Positionen von Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie und Logik, eine Alternative zur ontologischen Sicht des Erkennens aufzuzeigen - wobei eine besondere Herausforderung für die Suche nach einer solchen Alternative darin besteht, daß wir uns dabei zugleich von jenen konstruktivistischen Positionen der modernen Philosophie abgrenzen müssen, welche in ihrem Kampf gegen die traditionelle Ontologie das Kind mit dem Bade ausgießen, indem sie den Vorgang der Konstitution von Erfahrung auf sein subjektives Moment reduzieren und damit übersehen, daß Erfahrung immer nur im Zuge der Praxis, also im Verlauf eines zwischen Subjekt und Objekt ablaufenden Wechselspiels stattfindet.
Die mit den Mustern dieser Erfahrung befaßten Ausführungen des vorliegenden Abschnitts werden zunächst (in 6.1 und 6.2) erläutern, was unter einem ‚Begriff’ zu verstehen ist und dann (in 6.3 und 6.4) den Stellenwert der ‚Kategorien’ des Erfahrens aus der Sicht des transzendentalen Pragmatismus skizzieren. In der Folge (6.5 bis 6.9) wird sich im Zuge einer Diskussion weiterer wesentlicher Aspekte der Tätigkeit des Erkennens die Gelegenheit ergeben, den sowohl von der Ontologie als auch vom Konstruktivismus gründlich mißverstandenen Sinn unserer Rede von der ‚Realität’ zu rekonstruieren und das transzendental-pragmatistische Verständnis des Verhältnisses von Erkennen und Sein zu explizieren. In den Abschnitten 6.10 bis 6.16 schließlich verläßt dann die Reflexion das Feld der qualitativen Erfahrung, um den für das physikalische Weltbild zentralen Gesichtspunkt der Erscheinung von Quantitäten zu erforschen.
6.1 Der Begriff des Objekts
Wir beginnen mit einer kurzen Rekapitulation dessen, was wir bereits über die im vorliegenden Zusammenhang relevanten Aspekte des Konstitutionsprozesses wissen:
- Generell ist davon auszugehen, daß die Erscheinung einer in Objekte gegliederten Natur der Kommunikationsorientierung allen Handelns entspricht: Der Akteur kann sich prinzipiell immer nur so verhalten, wie er sich einem Interaktionspartner gegenüber verhält, weshalb die gesamte Welt für ihn aus subjektartigen Gegenspielern besteht.
- Die Annäherung an den Gegenstand auf Basis jenes Kommunikationsschemas führt dazu, daß der Handelnde das Objekt als ein Gegenüber in den Blick faßt, das auf sein eigenes, durch Regeln gesteuertes Verhalten in einer ebenfalls regelbezogenen, das heißt erwartbaren Weise reagiert, was infolge des Stellvertreterprinzips auch für die Reaktionen des Objekts auf das Verhalten anderer Gegenstände gilt.[1]
Dieser Bezug des Objektverhaltens auf regelgestützte Erwartungen ist die Basis für zwei prinzipiell zu unterscheidende Arten des Zugangs zum Gegenstand:
Zum einen können die Reaktionen eines konkreten Objekts in ihrer Spannung zu den ihnen jeweils modellhaft zugrunde gelegten Regeln betrachtet werden, wodurch dieses Objekt in seiner Individualität als einer von vielen ähnlichen, jedoch nicht völlig gleichen Gegenständen in den Blick gerät, die den betreffenden Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Zum anderen können die Abweichungen jener Reaktionen von der ihnen unterstellten Regelhaftigkeit übergangen werden, sodaß eine Vorstellung der jeweiligen Verhaltensweisen als reiner Verkörperungen der zugrunde liegenden Regeln entsteht. Wenn wir den Gegenstand in der zuletzt angeführten Perspektive ansehen, dann erscheint uns das, was an ihm erwartbar bzw. allgemein ist, weil es allen Objekten gemein ist, deren Verhalten der betreffenden Regel unterliegt.
Die Gesamtheit dieser Erwartungen bezüglich der Reaktionen des Objekts auf das Verhalten von uns und von anderen Gegenständen, also das Ensemble unserer Erwartungen an das betreffende Objekt, bezeichnen wir als seinen Begriff, wobei wir vorläufig noch nicht zwischen dem Begriff selbst und seiner sprachlichen Gestalt als Terminus unterscheiden.[2] In der Allgemeinheit des Begriffs spiegelt sich somit letztlich das Wesen der Handlungsregel, die jedem individuellen Tun als eine gemeinsam anerkannte Norm vorausgeht, indem sie ein bestimmtes, vom einzelnen Akteur zu vollziehendes Handlungsmuster vorschreibt. Durch die Übertragung des Kommunikationsschemas auf all unsere Objektkontakte resultiert daraus eine entsprechende Strukturierung unserer Gegenstandswahrnehmung, im Zuge derer das Verhalten dieser Gegenstände als gesetzlich determinierte, individuelle Realisierung eines vorausgesetzten, überindividuellen Verhaltensmusters erscheint.
Da jeder an einer gesellschaftlichen Regel orientierte Akteur den in der betreffenden Norm gesetzten Anforderungen widersprechen oder zuwiderhandeln kann, ist es umgekehrt möglich, eine solche Norm auch kontrafaktisch, also im Gegensatz zum tatsächlichen Verhalten der Handelnden aufrecht zu erhalten. Dieser potentielle Widerspruch zwischen den gesellschaftlichen Regeln und der Praxis der Individuen konstituiert die Erfahrung des Sollcharakters der Normen.
Wie bereits in Abschnitt 4.4 erwähnt, erfährt das soeben skizzierte Wesen der Regel durch deren Übertragung von der gesellschaftlichen Sphäre auf die Objektkontakte eine bedeutsame Wandlung: Da die Gegenstände als bloß virtuelle Subjekte im Unterschied zu den menschlichen Akteuren den auf sie projizierten Regeln prinzipiell nicht widersprechen und auch nicht auf deren Abänderung dringen können, verliert die auf das Objektverhalten bezogene Regel den Sollcharakter und wird zum bloß beschreibenden Ausdruck einer sich mit ‚objektiver’ Notwendigkeit vollziehenden Regelmäßigkeit.
Zwei weitere damit zusammenhängende Differenzen zwischen den Regeln des menschlichen und dinglichen Verhaltens sind von ähnlich großer Relevanz:
- Während im gesellschaftlichen Bereich der Akteur und die Regel aufgrund der zwischen ihnen bestehenden Spannung einander grundsätzlich immer in Frage stellen und daher auch wechselseitig beeinflussen, ist zwischen den im Begriff enthaltenen Regeln und dem durch jene Regeln beschriebenen Objektverhalten keine entsprechende Wechselwirkung vorhanden. Im Fall einer Diskrepanz zwischen Begriff und Verhalten ist hier daher prinzipiell immer nur der Begriff und nie das durch ihn erfaßte Geschehen in Frage gestellt.
- Wenn die wechselseitige Relativierung von Anspruch und Verhalten im Falle der sozialen Regeln dazu führt, daß sowohl das Handeln als auch die ihm zugrunde liegende Norm als gut oder böse erfahren werden können, so stehen im Bereich der Objekterfahrung einem in seiner Faktizität schlichtweg zu akzeptierenden Objektverhalten eine zutreffende oder unzutreffende begriffliche Beschreibungen gegenüber.
Fassen wir den Begriff des Objekts in der eben angedeutete Weise als ein Set von Verhaltensregeln auf[3] und bedenken wir deren Herkunft aus dem gesellschaftlichen Kontext, dann wird klar, daß das Allgemeine, welches ja nur Ausdruck dieser Regeln ist, kein Ding sein kann. Denn jene Regeln sind selbst nicht dinglicher Natur, sondern bloß Chiffren für die Selbststeuerung jedes Interaktionsprozesses. Durch Übertragung des Interaktionsmodells auf den Objektkontakt werden die Regeln und mit ihnen das Allgemeine zum Grundelement unserer Naturerfahrung. Sie unterliegen dabei zwar den eben geschilderten Modifikationen, verlieren aber nicht ihren Bezug auf die Interaktion und dürfen daher keinesfalls als dingliche Strukturen vorgestellt werden.
Genau dies passierte aber über weite Strecken im Umgang der philosophischen Tradition mit dem Allgemeinen. Die meisten ihrer zahlreichen Versuche einer Deutung des Wesens der Begriffe sind daher durch Aporien gekennzeichnet, die aus der Reduktion des durch den Begriff verkörperten Allgemeinen auf ein Ding folgen.
So sieht etwa Platon das Allgemeine als Idee[4], zu der die Einzeldinge, welche unter den jeweiligen Begriff fallen, durch Teilhabe (methexis) in Beziehung treten. Schon Aristoteles erkannte völlig zurecht, daß hier der Begriff nach dem Muster eines Körpers gedacht wird, der sich in seinem Bezug auf die konkreten Objekte zersplittern muß. Er weist damit punktgenau auf den wesentlichen Unterschied zwischen einem Ding und einer Regel hin: während ersteres durch die Teilhabe Vieler seine als körperliche Ganzheit vorgestellte Identität verliert, gewinnt die Regel umgekehrt umso mehr Kraft, je mehr Individuen ihr folgen.
Aristoteles‘ eigener Vorschlag zur Problemlösung führt allerdings nicht aus der von ihm aufgezeigten Sackgasse heraus. Er verwirft zwar die Vorstellung einer Existenz des Allgemeinen in Gestalt eigenständiger Ideen, kann aber dem mit der Verdinglichung des Allgemeinen gesetzten Zersplitterungsproblem nicht entkommen, da er selbst das Allgemeine als ein jedem Einzelding innewohnendes Prinzip auffaßt.
Da sowohl die platonische als auch die aristotelische Auffassung von einer tatsächlichen dinglichen Existenz des Allgemeinen ausgehen, werden beide als Spielarten des sogenannten Universalienrealismus bezeichnet[5]. In neuerer Zeit entwickelten sich dazu zwei Gegenpositionen, welche man in grober Vereinfachung, das heißt absehend von der Vielfalt ihrer unterschiedlichen Ausprägungen, als Nominalismus[6] und Konzeptualismus bezeichnen kann.[7]
Ersterer versucht den zuvor skizzierten Problemen des Universalienrealismus dadurch auszuweichen, daß er das dingliche Vorhandensein des Allgemeinen leugnet und die Begriffe zu bloßen Zeichen erklärt. Mit der einfachen Negation der verdinglichenden Vorstellung des Allgemeinen ist jedoch noch keine Erklärung für die faktische Anwesenheit dieses Allgemeinen in unserer Erkenntnis geliefert. Und so steht jene Position „vor der Schwierigkeit, erklären zu müssen, wie ein Zeichen, das doch als solches nur ein konkreter Gegenstand ist, als allgemeines fungieren kann, ohne für etwas Allgemeines zu stehen.“[8]
Aus der Perspektive unseres Verständnisses des Begriffs als eines Sets von Verhaltensregeln verweist die Auseinandersetzung zwischen Begriffsrealisten und Nominalisten um das Verhältnis zwischen dem Allgemeinen und dem Gegenstand darauf, daß beide Streitparteien die Fundierung des Begriffs im Kommunikationsschema verkennen. Das gemäß diesem Modell beim Objekt wahrgenommene regelbezogene Verhalten ist als integraler Prozeß zu verstehen, bei dessen Betrachtung man nicht die Norm vom Verhalten abspalten darf. Keiner der beiden Aspekte repräsentiert daher die ‚eigentliche Realität’. Und so ist etwa die platonische Idee, als Ausdruck der Regel, welche dem Verhalten des jeweiligen Gegenstandes modellhaft unterlegt wird, um nichts mehr oder weniger ‚real’ als das betreffende Verhalten selbst.
Der Konzeptualismus fußt auf der cartesianischen Unterscheidung zwischen einer körperlichen und einer geistigen Sphäre, welche aus letzterer von vornherein ein bloßes Spiegelbild der ersteren macht. Das Allgemeine erscheint daher hier im Gegensatz zum Universalienrealismus nicht als Bestandteil der einen, allumfassenden Realität, sondern als Produkt eines selbst körperartig vorgestellten Geistes. Ein typischer Vertreter jenes Ansatzes ist etwa Locke. Er spricht von „abstract ideas“, die für ihn im Unterschied zu den Nominalisten keine bloßen Namen sind, sondern Hilfskonstruktionen des Verstandes darstellen, die letzterer für seinen eigenen Gebrauch geschaffen hat. Das Allgemeine ist in dieser Perspektive ein geistiges Ding, das durch nachträgliche Abstraktion als das Gemeinsame vieler Objekte aus den entsprechenden Einzelwahrnehmungen herausgefiltert wird.
Es ist zu beachten, daß bei unserem an das cartesianische Denken gerichteten Vorwurf einer Verdinglichung des Allgemeinen der Terminus der ‚Verdinglichung’ einen anderen Akzent hat als bei der vorangehenden Kritik am Universalienrealismus. Der Unterschied zwischen beiden Spielarten der Verdinglichung kann am besten dadurch verdeutlicht werden, daß wir uns noch einmal kurz auf die gemeinsame Problemstellung der zwei Ansätze besinnen:
Diese besteht in beiden Fällen darin, daß sich das Erkennen selbst zum Objekt macht. Da nun aber der Realist das Objekt generell nicht als etwas vom Erkennen Konstituiertes ansieht, ist für ihn auch dieses Erkennen selbst kein von allen anderen Gegenständen prinzipiell zu unterscheidendes Objekt. Und eben jenes Fehlen einer Einsicht in die qualitative Differenz zwischen dem Objekt ‚Erkennen’ und allen übrigen Gegenständen haben wir im Sinn, wenn wir von der Verdinglichung des Erkennens im Realismus sprechen.
Demgegenüber liegt die große Leistung des von Descartes ausgehenden Denkens in der Anerkennung eines grundsätzlichen Unterschiedes zwischen dem Erkennen und allen übrigen Gegenständen, indem ersteres hier als jenes Objekt bestimmt wird, das alle anderen Gegenstände durch seine konstituierende Aktivität überhaupt erst zu Objekten macht. Von Verdinglichung müssen wir in diesem Fall nur deshalb sprechen, weil man die Konstitution nicht mit voller Konsequenz als gesellschaftliche Praxis begreift, sondern bloß als negatives Gegenbild der übrigen Objekte bestimmt, das ihnen im Rahmen eines räumlichen Innen-Außen-Verhältnisses gegenübertritt.
Während sich beim Universalienrealismus die Unangemessenheit der verdinglichenden Vorstellung des Allgemeinen in dessen Zersplitterung bei der Teilhabe der Einzelobjekte äußert, zeigt sie sich im Konzeptualismus in Gestalt eines Wahrnehmungs- bzw. Vorstellungsproblems. Schon Berkeley, der seinerseits eine nominalistische Position einnahm, weist in seinem „Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge“ auf diese Schwierigkeit hin, indem er darauf beharrt, daß das Bewußtsein immer nur etwas Bestimmtes und nie das Allgemeine selbst wahrnehmen oder vorstellen kann.
Erst Kant entgeht jenem Einwand und weist dabei erstmals auf die richtige Spur, indem er in seiner Lehre vom Begriff das Konzept der Regel ins Spiel bringt. Er sieht im Begriff nämlich ein Schema, das heißt eine Regel, zur Erzeugung einer Synthesis einzelner Sinnes- oder Vorstellungsbausteine. So ist für ihn etwa „der Begriff vom Hunde ... eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein.“[9]
So wichtig dieser Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Begriff und Regel auch ist, so deutlich wird doch die konzeptualistische Deformierung des Regelkonzepts in seiner Anwendung durch Kant. Zum einen besteht das Erkennen im Gegensatz zu der im vorangehenden Zitat vertretenen Auffassung nicht darin, daß eine Gestalt nach bestimmten Regeln konstruiert wird. Es geht dabei vielmehr darum, das Muster des menschlichen Tuns und damit auch dessen Regelhaftigkeit modellhaft auf das Verhalten des Objekts zu übertragen. Zum anderen reflektiert Kant nicht die Einbettung des Prozesses der Regelbefolgung in Kommunikationszusammenhänge.
Eine Position, welche diesen konstitutiven Bezug des Regelkonzepts bzw. des Begriffs auf Interaktionsvorgänge berücksichtigt und damit auch der aus ihm resultierenden Spannung zwischen dem Allgemeinen und dem Individuum bzw. zwischen Begriff und Objekt Rechnung trägt, ist jene von Hegel. Dieser sieht jedoch im Begriff kein bloßes Erkenntnisinstrument, sondern verabsolutiert ihn zu einem der Leibnizschen Monade ähnlichen Prinzip des Seins, was einer Aufgabe der von Kant vorgegebenen erkenntniskritischen Position zugunsten einer Versöhnung des Konzeptualismus mit dem Universalienrealismus gleich kommt.
Auch jüngere Ansätze, wie etwa die von Husserl und Frege, können das Rätsel des Begriffs keiner Lösung zuführen. So wird der Begriff für Husserl durch einen Denkakt, den er als eine höherstufige, das heißt nicht sinnliche Form des Vorstellens beschreibt, konstituiert, womit das Allgemeine wieder zu etwas Produziertem, also zu einem Ding nach Art der platonischen Idee[10], gemacht ist. Frege dagegen versucht den Begriff in Analogie zur mathematischen Funktion zu verstehen[11], was uns der Antwort auf die Frage nach seinem Wesen um keinen Schritt näher bringt. Denn die Funktion ist ein Muster des mathematischen Erkennens, und die Mathematik ist, wie wir noch sehen werden[12], nichts anderes als die Betrachtung der auf ihre nackte Quantität reduzierten Objekte. Sie befaßt sich daher bloß mit einem ganz bestimmten Teilaspekt der Gesamterscheinung des Gegenstands, weshalb die mathematischen Begriffe samt und sonders bloß als Spezialfälle des Begriffsinstrumentariums und nicht als dessen Basis anzusehen sind.
Die Rückführung der Begriffe auf Funktionen gelingt Frege nur mit Hilfe eines (ihm selbst vermutlich nicht bewußten) Argumentationstricks, der folgendermaßen aufgebaut ist: Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet das herkömmliche Funktionskonzept, bei dem Frege zwischen dem Funktionsausdruck, dem Wert und dem Argument der jeweiligen Funktion unterscheidet. So steht etwa bei der Funktion (x)2 das x für das Argument, während der Funktionsausdruck ( )2 lautet und der Wert der Funktion im Ergebnis der Berechnung für das jeweils gewählte Argument gegeben ist.
Frege zeigt zunächst, wie sich im Verlauf der Entwicklung der Mathematik das Konzept der Funktion laufend erweiterte, indem man zum einen immer neue Rechenoperationen als mögliche Bestandteile von Funktionsausdrücken anerkannte und zum anderen mit den komplexen Zahlen auch den Kreis dessen vergrößerte, was als Argument auftreten kann. Er selbst geht dann einen Schritt weiter, indem er „zu den Zeichen +, -, usw., die zur Bildung eines Funktionsausdruckes dienen, noch ... Zeichen wie =, >, <“ hinzunimmt, sodaß er „z. B. von der Funktion x2 = 1 sprechen kann, wo x wie früher das Argument vertritt.“[13]
Hier erhebt sich nun die entscheidende Frage, was der Wert einer Funktion ist, deren Funktionsausdruck eine Gleichung (bzw. Ungleichung) darstellt. Frege besinnt sich bei der Beantwortung dieser Frage auf den Umstand, daß jede Gleichung wahr oder falsch sein kann. Er bezeichnet die betreffende Eigenschaft von Gleichungen als deren Wahrheitswert „und unterscheide(t) den Wahrheitswert des Wahren von dem des Falschen.“[14]
Betrachtet man den zuletzt referierten Gedankengang etwas genauer, dann zerfällt er in zwei Teile, von denen der erste unter der Decke bleibt. Wenn Frege nämlich davon ausgeht, daß Gleichungen wahr oder falsch sein können, dann weist er implizit darauf hin, daß jede Gleichung eine Behauptung darstellt, und faßt damit - ohne dies deutlich zu machen - ein mathematisches Objekt als Spezialfall eines Gegenstands der Logik auf. Was explizit wird, ist dann die von dieser unausgesprochenen Basis ausgehende Kehrtwendung der Argumentation: Das Merkmal der Wahrheit bzw. Falschheit, welches an der als Behauptung aufgefaßten Gleichung feststellbar ist, macht Frege nun wieder zu einem Gegenstand der Mathematik, indem er es als eine Variable mit zwei möglichen Werten betrachtet.
Damit ist aus der Wahrheit, als einer ursprünglich dem Gegenstandsbereich von Logik bzw. Erkenntnistheorie zuzuordnenden Eigenschaft ein Objekt der Mathematik geworden, was dann die Voraussetzung dafür ist, im nächsten Schritt auch weitere logische Gegenstände wie Behauptungen oder Begriffe als mathematische Gegenstände zu behandeln, sodaß zum einen der Behauptungssatz als „sprachliche Form einer Gleichung“[15] und zum anderen der Begriff als Spezialfall einer Funktion bezeichnet werden kann, während in Wirklichkeit jeweils das genaue Gegenteil gilt.
Als haltbares Ergebnis der hier wiedergegebenen Argumentation bleibt nur der Verweis auf die Verwandtschaft von Funktion und Begriff bzw. Gleichung und Behauptung. Dieser Hinweis hilft aber nicht auf dem von Frege eingeschlagenen Weg, sondern nur in umgekehrter Richtung weiter - nämlich bei dem Versuch, die mathematischen Denk- und Sprachmuster als Sonderformen der allgemeinen Muster des Erfahrens und sprachlichen Begreifens unserer Welt zu verstehen.
Der einzig mögliche Weg zur ‚Entdinglichung‘ des Begriffs findet sich erst in den „Philosophischen Untersuchungen“ des späten Wittgenstein. Letzterer weist in dem genannten Werk zunächst in einer brillanten Kritik des konzeptualistischen Zugangs zum Allgemeinen nach, daß eine sich in völlig privater Innerlichkeit vollziehende Konstitution von Sinn niemals zu dem führen kann, was wir als Erkenntnis bezeichnen, weil ihr das für jedes Wissen unabdingbare reinigende Element der wechselseitigen Kritik abgeht. In weiterer Folge macht er dann deutlich, daß diese Kritik ein sozialer Prozeß ist, der als die gemeinschaftliche Orientierung an einer Norm beschrieben werden kann, womit aufgezeigt ist, daß die in Interaktionsprozessen verankerten Regeln nicht nur die gesellschaftliche Praxis steuern sondern als Basis dessen, was wir das Allgemeine nennen, auch die Grundlage aller Erkenntnis darstellen.
Für die Methodologie der transzendentalen Analyse ist es von großer Wichtigkeit, daß wir Wittgensteins Einwand gegen den Konzeptualismus, also gegen das cartesianische Konzept eines sich in Abgrenzung von der fragwürdig gewordenen äußeren Wirklichkeit definierenden Bewußtseins, das durch diesen Rückzug auf sich selbst ein letztes Refugium der Gewißheit zu finden glaubt, richtig verstehen:
Wittgenstein leugnet keineswegs das Vorhandensein der durch die Phänomenologie bzw. die idealistische Transzendentalphilosophie beschriebenen Bewußtseinsinhalte des Ich. Vielmehr unterläuft er die von vornherein nur ontologisch orientierte Antworten zulassende Frage nach der Existenz oder Nichtexistenz solcher Vorstellungen, indem er zu bedenken gibt, daß die Berufung auf sie keine Erkenntnisbasis abgibt, die für höhere Gewißheit bürgen würde als die in der Interaktion mit Bezugnahme auf gemeinsam befolgte Regeln erzielten Übereinstimmungen. Dies ist deshalb der Fall, weil jede sinnvolle Definition von Richtigkeit bzw. Falschheit - und damit auch von Gewißheit - den Verweis auf Normen impliziert.
Durch diese Sichtweise des Erkenntnisproblems wird der Brennpunkt der transzendentalen Fragestellung aus der je individuellen Erfahrung herausgehoben und im Kommunikationsnetz der gesellschaftlichen Praxis verankert. Die in der Analyse privater Bewußtseinsinhalte aufzuzeigenden Sinnstrukturen werden dadurch nicht einfach negiert, jedoch des ihnen anhaftenden Scheins höchster Gewißheit entkleidet und erhalten so den ihnen eigentlich zukommenden Stellenwert als individuelle Kristallisationspunkte eines seinem Wesen nach kollektiven Prozesses der Erkenntnisgewinnung.
6.2 Implikationen des Kommunikationsschemas für den Begriff
Nach der Abgrenzung unserer Sichtweise des Begriffs von den großen Irrtümern der philosophischen Tradition ist die Analyse dieses zentralen Erkenntnisinstruments fortzusetzen. Wir gehen dabei von der im vorangehenden Abschnitt gewonnenen Einsicht aus, daß der Begriff jenes Set von Verhaltensregeln ist, welches der Gesamtheit unserer Erwartungen an die modellhaft nach dem Muster von Subjekten gedachten Gegenstände entspricht und letztere daher als individuelle Realisierungen eines ihnen gemeinsam zugrunde liegenden Allgemeinen erscheinen läßt.
Wenn sich damit nun aber der Begriff stets auf viele Objekte bezieht, ist im nächsten Schritt zu überlegen, welche Beziehung zwischen jenen Gegenständen besteht. Erinnern wir uns zunächst an die Feststellung, daß jedes Objekt infolge seines heimlichen Subjektcharakters als ein sich sozial verhaltender virtueller Akteur aufgefaßt wird. Es scheint auf diese Weise immer in Interaktionszusammenhänge integriert zu sein, welche als Wirkungsbeziehungen bezeichnet werden können[16] und dadurch charakterisiert sind, daß ihre Protagonisten komplementären, reziprokes Verhalten sicherstellenden Regeln unterliegen.
Betrachten wir die Stellung derartiger Kommunikationsgefüge innerhalb der menschlichen Gesellschaft, dann kommen wir zu dem Schluß, daß jedes Gemeinwesen aus mehreren derartigen Beziehungseinheiten besteht, welche einander in ihrem Zusammenspiel funktionell ergänzen. Komplexe Gesellschaften zeichnen sich des weiteren dadurch aus, daß es in ihnen neben einer Vielheit unterschiedlicher sozialer Beziehungen mit jeweils anders gearteter Aufgabe für das Ganze, auch eine große Anzahl von einander gleichenden Beziehungen mit jeweils identischer Funktion gibt.
Die das soziale Handeln leitenden Regeln erfahren dadurch im Zuge des Übergangs vom einfachen Gemeinwesen zur komplexen Gesellschaft einen wesentlichen Bedeutungszuwachs: Während die in einer isolierten Gruppe vorhandenen Normen bloß die dem Individuum gegenüberstehenden Erwartungen seiner unmittelbaren Interaktionspartner repräsentieren, fungiert in einer komplexen Gesellschaft jede Norm als Steuerungsinstanz für eine unübersehbare Vielzahl gleich gearteter, neben einander bestehender Beziehungen. Das von den Regeln konstituierte Allgemeine wird so von einem schon immer auf dieselbe Weise Vollzogenen zu einem immer und überall in gleicher Art zu Vollziehenden, wodurch der Gegensatz zwischen dem Allgemeinen und dem ihm gegenüberstehenden Individuum noch schärfere Ausprägung erhält als in der jeweils nur in einfacher Ausführung (oder ‚beschränkter Auflage’) realisierten Sozialbeziehung.
Ausdruck jenes in komplexen Gesellschaften verschärften Gegensatzes zwischen der Regel und dem Individuum ist die hier nur noch typisiert erfolgende Wahrnehmung des Einzelnen: Die Verhaltenserwartungen, welche für die Protagonisten eines in vielfacher Ausfertigung an jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Standorten existierenden Beziehungsmusters bestehen, bilden eine bestimmte Rolle, während das mit diesen Erwartungen konfrontierte Individuum als Rollenträger erscheint. Als das auf die Objekterfahrung übertragene Pendant zur sozialen Rolle ist der Begriff daher nichts anderes als ein bestimmter Typus virtueller Subjektivität (auch Objekttyp genannt), wogegen der durch ihn erfahrene Gegenstand als Pendant des individuellen Rollenträgers für uns zu einer individuellen Realisierung des betreffenden Objekttyps wird.
Wir sehen also, daß die Erscheinung des einzelnen Gegenstands als einer von vielen individuellen Vertretern eines allgemeinen Objekttyps kein notwendiges Merkmal aller Wahrnehmung ist, sondern als Produkt einer höherstufigen Organisationsform der sozialen Praxis des erkennenden Subjekts verstanden werden muß: Erst durch die Übertragung der Rollenstruktur komplexer Gesellschaftsformationen auf die als heimliche Akteure aufgefaßten Objekte wird aus jedem Gegenstand das Mitglied einer ganzen Gruppe von Objekten bestimmten Typs, auf die sich gleiche Verhaltenserwartungen richten.
Der in der Umgangssprache eingebürgerte Brauch, eine solche Gruppe als Klasse zu bezeichnen, erinnert zwar noch unüberhörbar an den soeben explizierten gesellschaftlichen Hintergrund des Begriffs. Die durch einen verdinglichten Zugang zum Denken geprägten Logiker versuchen diesen Bezug jedoch zu verdrängen, indem sie immer wieder auf mathematische Assoziationen ausweichen und anstatt von Klassen und deren Mitgliedern häufig von Mengen und den Elementen derselben sprechen.[17] Auch im vorliegenden Zusammenhang gilt jedoch das schon im vorangehenden Abschnitt zu Freges Theorie des Begriffs Gesagte:
Der Verweis auf die Mathematik kann uns prinzipiell nicht die Reflexion auf das Wesen des Begriffs ersparen, da (wie bereits angedeutet) genau umgekehrt vorzugehen ist, weil die Grundstrukturen des mathematischen Denkens als Spezialfälle des Begriffsinstrumentariums und nicht als dessen Basis anzusehen sind. In diesem Sinne werden wir annehmen müssen, daß auch das Verhältnis zwischen der mathematischen Menge und ihren Elementen letztlich nur ein modellhaftes Abbild der Beziehung zwischen dem individuellen Akteur als Rollenträger und der Gruppe aller individuellen Träger der betreffenden Rolle darstellt.
Die Erwähnung des Konzepts der Menge im Kontext der Erkenntnistheorie darf sich aber nicht auf dessen Rolle bei der Verschleierung der sozio-ökonomische Basis der Begriffe beschränken, sondern muß auch seine kognitive Funktion ansprechen, welche eine Ergänzung zum Konzept der Klasse darstellt. Erfaßt nämlich die Klasse jene (virtuellen) Akteure, die einem bestimmten Set von Regeln (also einem bestimmten Begriff) unterliegen, als Gruppe, so betrachtet die Menge diese Gruppe unter dem Gesichtpunkt der Anzahl ihrer Mitglieder. Der von Georg Cantor systematisch entfaltete Mengenbegriff besetzt damit eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen dem qualitativen und dem quantifizierenden Erfahren unserer Welt.
Der wesentliche Unterschied zwischen der begrifflichen Klasse bzw. Menge und ihrem gesellschaftlichen Vorbild, der Gruppe von Menschen, die an jeweils unterschiedlichen Standorten ein und dieselbe gesellschaftliche Funktion erfüllen, besteht darin, daß das Individuum nur im zweiten Fall seine Unterordnung unter das für alle Mitglieder geltende Set von Handlungsregeln widerrufen, also aus der Gruppe austreten kann. Was beide Fälle der Gruppenbildung eint, ist der Umstand, daß der Umfang der jeweiligen Gruppe zumeist nicht über die Festlegung einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern definiert wird, sondern nur implizit durch die Art der jeweils konstitutiven Regeln bestimmt ist. Die Begriffsklassen haben damit zwar sehr unterschiedliche Umfänge, sind aber zumeist prinzipiell offen.
Eine längst zum Gemeingut gewordene Einsicht der Soziologie besagt, daß das Individuum in einer komplexen Gesellschaft immer viele Rollen spielen muß. Als Folge davon gehört der einzelne stets einer entsprechend großen Anzahl jener Gruppen an, die dadurch gekennzeichnet sind, daß ihre Mitglieder eine jeweils identische Rolle verkörpern. Er ist also etwa zugleich ‚Vater’, ‚Angestellter’, ‚Autofahrer’, ‚Patient’ und vieles andere mehr. In genau demselben Sinn ist auch jedes konkrete Objekt immer in zahlreiche Begriffsklassen einordenbar.
Wenn sich die gesellschaftliche Position eines menschlichen Individuums durch seine sozialen Rollen, also seine Zugehörigkeiten zu den unterschiedlichsten funktional definierten sozialen Gruppierungen definieren läßt, dann kann man den Stellenwert eines konkreten Gegenstands für den Akteur als das Ensemble seiner verschiedenen Klassenzugehörigkeiten bestimmen. Es gibt auch so etwas wie eine oberste Klasse, der alle Gegenstände angehören, bzw. einen obersten Begriff, der über allen anderen Begriffen steht. Es handelt sich dabei um den Begriff ‚Objekt’ (zu deutsch ‚Gegenstand’[18] ) selbst.
Kamlah und Lorenzen stellen in ihrer als „Vorschule des vernünftigen Redens“ deklarierten „Logischen Propädeutik“ die Sinnhaftigkeit der Bildung eines solchen obersten Begriffes in Frage, wobei sie sich darauf berufen, „daß Aussagen über den ‚Gegenstand als Gegenstand‘ über nichtssagende Tautologien in keiner Weise hinausführen, daß es eine ‚Fundamentalontologie‘ als ‚erste Philosophie‘ (so Aristoteles) so wenig geben kann wie eine fundamentale Epistemologie.“[19]
Diese Auffassung ist als ein seinerseits fundamentales Mißverständnis zurückzuweisen. Wie die vorliegenden Ausführungen belegen sollten, handelt es sich nämlich bei der Qualifizierung eines beliebigen Gegenübers als ‚Objekt’ um einen für den gesamten weiteren Erkenntnisprozeß entscheidenden und daher alles andere als nichtssagenden Schritt:
Etwas in die oberste Begriffsklasse des ‚Objekts’ einzureihen und damit als Gegenstand aufzufassen, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als es dem Kommunikationsschema zu unterwerfen, das heißt zu beschließen, es sei fortan nach dem Muster eines regelbezogen agierenden Subjekts zu verstehen und zu behandeln. Dieser Beschluß ist kein Akt der Willkür, sondern ruht auf dem unaufhebbaren Praxisbezug von Erkenntnis, also auf deren Aufgabe, das in der sozialen Interaktion bewährte Modell des kommunikativen, regelbezogenen Handelns auf immer größere Wirkungskreise auszudehnen.
Die Tatsache, daß wir uns angesichts jedes beliebigen Gegenübers auf die geschilderte Weise verhalten, daß wir mit anderen Worten kein alternatives Verhaltensmuster kennen, ist kein Grund dafür, Aussagen über das betreffende Vorgehen als sinnlos zu bezeichnen. Ein derartiges Argument würde auf der irrigen Annahme fußen, daß man sich nur mit jenen Aspekten der eigenen Praxis auseinanderzusetzen habe, die durch alternative Handlungsmöglichkeiten gekennzeichnet sind und wäre daher ungefähr so absurd wie die Aufforderung, sich nicht mit der Funktion des Atmens für den menschlichen Organismus zu beschäftigen, weil es ja doch keine Alternative dazu gibt.[20]
Diese Einstellung spart gerade die tiefsten Sinnschichten unseres Verhaltens von der Selbstreflexion aus, was im Bereich der Erkenntnistheorie notwendig zu verhängnisvollen Konsequenzen führt. Denn wie jeder Handelnde stellt auch der Erkennende unweigerlich die Fragen nach den fundamentalen Begründungen seines Tuns. Wenn sich daher die Philosophie um die Antworten auf diese Fragen herumdrückt, werden sie vom Common Sense gegeben - und der denkt (gerade auch in der Physik) immer auf die eine oder andere Weise ontologisch, was dann fast zwangsläufig in einen der im vorangehenden Abschnitt skizzierten Irrwege des Nominalismus, Konzeptualismus oder Begriffsrealismus führt.
Wir kehren nun wieder zur Analyse der Implikationen des Kommunikationsschemas für das begriffliche Erkennen zurück und entdecken als nächstes, daß sich der Bezug des Begriffs auf Handlungsregeln nicht nur darin äußert, daß er den Gegenstand nach dem Muster eines an Regeln orientierten Akteurs erfaßt. Vielmehr bringt die in besagtem Schema enthaltene Vorstellung einer Reziprozität des Verhaltens von Subjekt und Objekt als Interaktionspartner den Begriff auch in eine indirekte Beziehung zu den für den Handelnden selbst geltenden Normen: Wenn der Begriff nämlich die Verhaltensregeln für alle unter ihm subsumierbaren Objekte repräsentiert und damit für das von ihnen zu erwartende Verhalten steht, dann verweist er dadurch mittelbar auch auf die Gesamtheit der für das Subjekt selbst geltenden Regeln einer erfolgversprechenden ‚Behandlung’ jener Gegenstände.
Die eben erwähnte Reziprozität der Verhaltensregeln von Interaktionspartnern ist natürlich nicht nur beim Kontakt zwischen Objekt und Akteur zu beachten, sondern ebenso bei den Beziehungen zwischen den verschiedenen, durchwegs als virtuelle Subjekte aufgefaßten Gegenständen. Als Folge davon ist das Objekt nicht allein von den unmittelbar auf sein eigenes Verhalten bezogenen Regeln betroffen, sondern unterliegt darüber hinaus auch dem mittelbaren Einfluß der das Verhalten sämtlicher übriger Gegenstände regelnden Gesetze.
Man sieht also, daß der Drang des Erkennens, das Verhalten aller Objekte vor dem Hintergrund eines umfassenden Netzes reziproker Verhaltensregeln zu verstehen, eine Konsequenz der Logik des Kommunikationsschemas ist. Dieses ist die Basis dafür, daß der Handelnde seine durch den jeweiligen Begriff festgelegte Erwartung an das Verhalten jedes einzelnen konkreten Gegenstands mit den Erwartungen an das Verhalten sämtlicher übriger Objekte verknüpft, sodaß für ihn letztlich jener Gesamtzusammenhang aller Verhaltenserwartungen resultiert, den er als seine Welt bezeichnet.
Wittgensteins Einsicht, daß die Grenzen meiner Sprache identisch mit den Grenzen meiner Welt sind, hält einerseits den engen, in weiterer Folge noch zu präzisierenden Zusammenhang zwischen Begreifen und Sprechen fest und drückt andererseits die Begrenztheit unserer Welt aus. Zugleich aber verweist sie indirekt auf deren prinzipielle Offenheit. Wenn nämlich der Begriff eine Gesamtheit von Erwartungen darstellt, dann repräsentiert meine Sprache, welche ja sämtliche mir verfügbaren Begriffe enthält, auch all meine auf die Objekte gerichteten Erwartungen, bzw. alles von mir als möglich angesehene Objektverhalten. Da nun aber die Tätigkeit des begrifflichen Erkennens genau am Einbruch des Überraschenden, also Unbekannten, in das Reich des Erwarteten, also Bekannten, ansetzt, besteht ihre Funktion in nichts anderem als im ständigen Hinausschieben dieser Grenzen meiner Welt.
Für die dem Akteur erscheinende, durch das Gesamtsystem der jeweils verfügbaren Begriffe definierte Welt der Objekte ist neben dem Merkmal der Offenheit auch jenes der Widerspruchsfreiheit charakteristisch. Letztere ist jedoch nicht unmittelbar gegeben, sondern der Erkenntnis bloß als Aufgabenstellung vorgezeichnet. Es ist wichtig zu verstehen, daß jene als innerer Zwang erlebte Zielvorgabe weder vom Himmel fällt noch als ein bloß psychologisches Phänomen gedeutet werden darf, sondern genau wie die Offenheit unserer Welt aus der reziproken Struktur des aller Objekterkenntnis zugrunde liegenden Kommunikationsschemas resultiert. Dieses fordert nämlich, daß jedes denkbare Objektverhalten durch Regeln erklärbar sein muß, die komplementär zur Gesamtheit der dem Verhalten aller übrigen Objekte zugrunde liegenden Regeln sind.[21]
Wenn wir Widerspruchsfreiheit nur als ein Regulativ des Erkenntnisprozesses auffassen, dann ist das gleichbedeutend damit, daß wir von der ständigen Anwesenheit des Widerspruchs im Begriffsapparat ausgehen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob diese Präsenz des Widerspruchs im Instrumentarium der Erkenntnis ihrerseits bloß zufällig - also Ausdruck von fehlerhafter Anwendung jenes Apparates - ist, bzw. ob sie nicht umgekehrt ebenso systematisch in der Logik des Kommunikationsschemas wurzelt wie das Ziel der Widerspruchsfreiheit. Es handelt sich hier um das seit der Antike im Zentrum des epistemologischen Denkens stehende und immer wieder mißverstandenen Problem der dialektischen Struktur des Begriffs.
Wird das Erkennen als photographische Annäherung des Subjekts an eine ihm gegenüberstehende Wirklichkeit aufgefaßt, so erscheint der Begriff als Abbild von Dingen, was dazu führt, daß sich seine allfällige Unangemessenheit immer bloß als Ungenauigkeit, Unschärfe, Verzerrung oder allenfalls Unübersichtlichkeit darstellt. Nimmt man dagegen eine Verwurzelung des Begriffs in der Handlungsregel an, dann ist, wie wir uns im Folgenden verdeutlichen wollen, von seiner im engsten Sinn des Wortes zu verstehenden inneren Widersprüchlichkeit auszugehen:
Wie bereits in Abschnitt 4.4 erwähnt, tritt die Norm dem Einzelnen im gesellschaftlichen Leben stets als fordernde Instanz gegenüber, welche die von der jeweiligen Gruppe an ihn gestellten Ansprüche verkörpert. Da die Bedürfnisse des Individuums nie völlig mit den gemeinschaftlich akzeptierten Gruppenzielen übereinstimmen, widersprechen sie, soweit sie im Individuum zu sprachlichem Ausdruck finden, stets in mehr oder weniger großem Ausmaß den Regeln der jeweiligen Gruppe. Wenn nun aber das konkrete Objekt nach dem Vorbild des menschlichen Individuums vorgestellt wird und der Begriff der Handlungsregel nachgebildet ist, dann ist das im Begriff vorhandene Spannungsverhältnis zwischen dem Allgemeinen und dem Individuellen von vornherein als Widerspruch zu verstehen.
So lange die gesellschaftliche Norm nur mit dem Widersprechen vereinzelter Individuen konfrontiert ist, wird sie immer stärker sein als diese. Das Widersprechen des Einzelnen hat nur dann Chance gehört zu werden, wenn es sich durch die vereinten Stimmen vieler Individuen Gehör verschaffen kann. Letztere konstituieren sich dann als Teilgruppe innerhalb des jeweiligen Gesamtensembles, welche eine Modifikation der gemeinsamen Handlungsregel durchsetzen kann, die auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Mitglieder Rücksicht nimmt.
Analoge Verhältnisse finden wir bei der begrifflichen Annäherung an die Gegenstände: So lange sich nur vereinzelte konkrete Objekte auf unerwartete Weise verhalten, wird von bloß zufälligen Abweichungen gesprochen.[22] Erst wenn sich die Zufälle mehren, hat der jedem Begriff immanente Widerspruch zwischen dem Allgemeinen und Individuellen eine derartige Stärke entfaltet, daß man in den individuellen Abweichungen ein neues Allgemeines erkennt. Wir bezeichnen dieses nur für einen Teil der durch den ursprünglichen Begriff erfaßten Gesamtgruppe von Objekten zutreffende Allgemeine, als das Besondere und sehen in ihm eine Untergruppe der ursprünglich ungegliederten Begriffsklasse.
Nachdem wir nun die Zusammenhänge zwischen dem Begriff und der Handlungsregel beleuchtet haben, sind noch einige erläuternde Bemerkungen zum Charakter jener auf das Objekt gerichteten Erwartungen anfügen, welche durch die den jeweiligen Begriff konstituierenden Verhaltensregeln definiert werden. Es geht vor allem darum zu verstehen, daß wir es dabei aus mehreren Gründen niemals mit der bloßen Summe punktueller Einzelerwartungen zu tun haben:
Allein schon die durch die Allgemeinheit bzw. den Regelbezug des Begriffs konstituierte Situationsunabhängigkeit der durch ihn repräsentierten Erwartungen läßt sich nicht zureichend als ein Zusammentreten von unendlich vielen Einzelerwartungen bezüglich unendlich vieler möglicher Einzelsituationen beschreiben. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, daß sich die dem Begriff zugrunde liegenden Regeln auf Verhalten, also auf ein prozeßhaftes Geschehen beziehen, das von seiner Zielorientierung her als Einheit zu verstehen ist, die sich erst nachträglich in Teilmomente zerlegen läßt, denen dann momenthafte Einzelerwartungen zuordenbar sind.
Ferner muß folgendes bedacht werden: Wenn wir den Gegenstand konsequent nach dem Vorbild des Subjekts vorstellen, dann weist er auch so etwas wie eine übergeordnete, die verschiedenen Aktionsbereiche integrierende Identität auf. Die auf einzelne Verhaltensweisen des jeweiligen Objekts projizierten Regeln (bzw. die durch sie konstituierten Verhaltenserwartungen) stehen daher nicht isoliert nebeneinander, sondern bilden Zusammenhänge, die ihrerseits als Ausdrücke von zugrunde liegenden Regeln zu verstehen sind. Jede für das Verhalten eines bestimmten Objekts geltende Regel verweist somit auf eine Vielfalt weiterer Regeln (bzw. Verhaltenserwartungen).
Der Begriff bezieht sich deshalb niemals auf einzelne regelbezogene Verhaltensweisen des Gegenstandes sondern stets auf das hinter allem möglichen Verhalten stehende virtuelle Subjekt. Und wie der Handelnde bei sich selbst zwischen Aktualität und Potentialität, also zwischen aktuell vollzogenen und bloß möglichen Handlungen unterscheidet, wird damit durch den Begriff auch sein als Interaktionspartner aufgefaßter Gegenstand zu einer Einheit aus Aktualität und Potentialität. Wie die das Tun des Akteurs leitenden Regeln nicht nur sein gegenwärtiges Verhalten bestimmen, sondern auch die Gesamtheit der für ihn bestehenden Handlungsmöglichkeiten festlegen, definieren die im Begriff des jeweiligen Objekts versammelten Verhaltensregeln das gesamte Verhaltens- bzw. Eigenschaftspotential des Gegenstands.
Diese vieldimensionale Unendlichkeit des in jedem Begriff implizierten Geflechts von Erwartungen des Akteurs an sein Objekt bettet jede einzelne von ihnen in ein ganzes Erwartungsfeld ein, das nicht nur auf das jeweils aktuelle Verhalten des Gegenstandes bezogen ist, sondern alle unter anderen Umständen, in der fernsten Vergangenheit und Zukunft erfahrbaren Verhaltensweisen des betreffenden Objekts umfaßt. Im Bewußtsein des Akteurs ist jedoch immer nur ein kleiner Ausschnitt dieses durch den jeweiligen Begriff abgedeckten Erwartungsfeldes präsent.
Da nämlich das Subjekt stets nur einzelne Handlungsmöglichkeiten aus seinem unendlich großen Aktionsrepertoire herausgreift, richtet es auch seine Aufmerksamkeit, das heißt seine bewußte Erwartung an den Gegenstand, immer nur auf ganz bestimmte, von seinen jeweiligen Handlungszielen und den Besonderheiten der Handlungssituation abhängige Aspekte von dessen Verhalten. Wir müssen deshalb die Gesamtheit des Erwartungsfeldes, welches durch die von einem Begriff verkörperten Verhaltensregeln definiert wird, in je-
weils situationsabhängig bestimmte explizite (bewußte) und implizite (vorbewußte) Erwartungen unterteilen[23].
Die Zweiteilung der durch Erwartungen konstituierten Erscheinung des Objekts in sichtbare Aktualität und unsichtbare Potentialität deckt sich mit jener Untergliederung unseres Gegenübers, bei welcher sich ein im Zentrum der Aufmerksamkeit stehender Vordergrund von einem nur mittelbar präsenten Hintergrund abhebt. Wir haben es beide Male mit demselben Unterschied zu tun. Dieser ist jedoch im ersten Fall aus der Perspektive des sich verhaltenden und dabei einen Teil seines Potentials aktivierenden Objekts betrachtet, während er im zweiten aus der Sicht des das Objektverhalten erfahrenden Beobachters beschrieben wird.
6.3 Die Kategorien der Erfahrung
Der Begriff ist nicht nur als das Ensemble aller auf das Verhalten eines bestimmten Objekttyps bezogenen Erwartungen von vielschichtiger Gestalt. Auch jede einzelne, aus dem Gesamtzusammenhang des jeweiligen Begriffs herausgelöste Erwartung ist mehrfach in sich gegliedert und besteht somit aus unterschiedlichen Erwartungskomponenten. Dies hat damit zu tun, daß der Gegenstand dieser Erwartungen, also das dem Objektverhalten modellhaft zugrunde gelegte kommunikative Handeln, eine komplexe Gestalt aufweist, welche unterschiedliche Aspekte umfaßt. In diesem Sinne können wir etwa die der Aktion vorausgesetzte Bereitschaft zu einem Verhalten bestimmten Typs von der eigentlichen Aktion, also der Ausführung des betreffenden Verhaltensmusters unterscheiden.
Da unsere Interpretation des Objektverhaltens stets auf ein und demselben Kommunikationsschema fußt, ist der innere Aufbau jener Erwartungsbestandteile immer derselbe. Die unendliche Vielfalt der Erwartungen und der aus diesen zusammengesetzten Begriffe besteht damit aus einer begrenzten Anzahl von Strukturkomponenten, weshalb letztere den Stellenwert von Konstruktionselementen unserer begrifflichen Erfahrung besitzen. Wir können diese Konstruktionselemente auch die Kategorien der Erfahrung nennen.[24]
Übersetzte man den Terminus ‚Kategorie’ im vorliegenden Zusammenhang mit ‚Grundbegriff’, dann wäre der entscheidende Unterschied zum Begriff verwischt[25]. Da die Kategorien Strukturkomponenten des Begriffs darstellen, sind sie keine Sonderformen desselben und somit natürlich auch keine Grundbegriffe. Während der Begriff auf den gleichsam hinter all seinen einzelnen Erscheinungen stehenden Objekttyp abzielt und diesen in seinem vollen inhaltlichen Reichtum erfaßt, strukturieren die Kategorien die unterschiedlichen Teilaspekte jener Erscheinungen, indem sie unser gesamtes durch den Begriff auf das Objekt bezogenes Erleben vor dem Hintergrund des Kommunikationsschemas interpretieren.
Man kann den Unterschied zwischen den Termini ‚Begriff’ und ‚Kategorie’ auch folgendermaßen erläutern: Jeder Begriff besteht aus einem Bündel einzelner Verhaltenserwartungen, die sich auf einen (virtuellen) Akteur bestimmten Typs beziehen. Es ist möglich, jede dieser Erwartungen in einige wenige Aspekte zu untergliedern, welche nun ihrerseits den Kategorien entsprechen.
Um sprachliche Verwirrungen zu vermeiden, müssen wir bei unserer Rede von Begriffen und Kategorien immer drei Ebenen auseinander halten:
- Bei der ersten handelt es sich um jene Metaebene, auf der wir einen Begriff des Begriffs von einem Begriff der Kategorie unterscheiden. Wenn der eine besagt, daß jeder Begriff ein Bündel von Erwartungen ist, hält der andere fest, daß jede Kategorie einem bestimmten Aspekt jener Erwartungen entspricht, die durch Begriffe gebündelt werden.
- Die zweite Ebene ist die, auf der wir von dem Begriff als dem Erwartungsbündel und den Kategorien als den unterschiedlichen Aspekten der einzelnen Erwartungen jenes Erwartungsbündels sprechen.
- Die dritte Ebene besteht einerseits aus der unendlich großen Zahl der einzelnen Begriffe und andererseits aus der ebenfalls unbegrenzten Vielheit von Ausprägungen jeder der Kategorien.[26]
Bezeichnen wir das Erleben des Eintreffens bzw. Nichteintreffens einer Erwartung als Erfahrung, dann handelt es sich bei den Kategorien um jene strukturellen Komponenten der Erwartung, die unsere Erfahrung konstituieren. Da sich alle kategorialen Erwartungen auf ein subjektartig vorgestelltes Gegenüber beziehen, das an eben jenen Regeln orientiert ist, welche unseren Erwartungen zugrunde liegen, interpretieren wir jede der auf die geschilderte Weise konstituierten Erfahrungen als Ausdruck der Erscheinung dieses Gegenübers. Man kann daher auch sagen, daß die Kategorien die Erscheinung des Objekts konstituieren.
Die universelle Anwendung des Kommunikationsschemas, welche für die Reduktion der unendlichen Vielfalt der Erscheinungen auf eine überschaubare Anzahl von sich kontinuierlich wiederholenden Grundmustern der Erfahrung verantwortlich zeichnet, ist ihrerseits, wie wir bereits wissen, keine kognitive Marotte, sondern Ausdruck eines pragmatistischen Erfordernisses: Um unsere grundsätzlich kommunikative Form des Handelns angesichts eines zunächst unbekannten Gegenübers ins Spiel bringen zu können, müssen wir dieses als Subjekt, das heißt als einen sich selbst ebenfalls kommunikativ verhaltenden Akteur auffassen, weshalb für uns all seine Äußerungen eine durch die identische Grundstruktur jeder Kommunikation bestimmte Gestalt annehmen.
Die Diskussion des Stellvertreterprinzips in Abschnitt 4.2 hat gezeigt, daß wir auch den als virtuelle Subjekte begriffenen Objekten eine fiktive wechselseitige Wahrnehmung auf Basis des Kommunikationsschemas unterstellen. Wir gehen in diesem Sinne davon aus, daß die Gegenstände nicht nur vom Handelnden selbst als Subjekte erlebt werden, sondern tun vielmehr so, als ob sie einander auch wechselseitig, das heißt unabhängig von der Präsenz eines menschlichen Akteurs als kommunizierende Subjekte gegenübertreten, also für einander in derselben Weise erscheinen, wie sie dies für uns tun.
Dies wieder bewirkt, daß die kommunikativen Äußerungen des Gegenstands aus ihrem Bezug zum Handelnden herausgelöst werden und den Anschein einer Unabhängigkeit vom Akteur erhalten. Die Grundmuster jener Erscheinungen, unsere Kategorien der Erfahrung, werden dadurch zu Kategorien eines vorgeblich objektiven Seins und sind als solche eines der Lieblingsspielzeuge der philosophischen Ontologie.
Es liegt hier ein Paradoxon vor: Gerade weil der Mensch die Objekte im Zuge der universellen Anwendung des Kommunikationsschemas immer als Subjekte auffaßt und weil er dieser Auffassung so konsequent anhängt, daß er auf seine Gegenstände auch wechselseitige subjektartige Wahrnehmung projiziert, entsteht die Illusion eines unabhängig von ihm ablaufenden Geschehens, die ihn mit unwiderstehlichem Sog in die objektivistische Weltsicht hineinzieht.
Wir lassen uns hier jedoch von dem durch die Anwendung des Stellvertreterprinzips erzeugten ontologischen Schein nicht beirren und werfen nun einen kurzen Blick auf einige dieser Kategorien, für welche bereits im Zuge der Analyse des Kraft-Materie-Paradigmas in Teil 4 die Verankerung im Modell der menschlichen Kommunikation aufgezeigt wurde. Gemeint sind die ‚Eigenschaft’, das ‚Verhalten’ und das ‚Wirken’, wobei die eben angeführten Benennungen weder Merkmalstypen, wie etwa ‚die Härte’ oder ‚die Schwere’ noch Tätigkeitsmuster wie ‚das Fallen’, oder ‚das Drücken’ bezeichnen, sondern auf jene Erfahrungsmodalitäten hinweisen, welche ihren sprachlichen Ausdruck in Eigenschaftswörtern (hart, schwer, usw.) und Zeitwörtern (fällt, drückt, usw.) finden.[27]
Der jeweilige Bezug zwischen dem Erleben und dessen Interpretation auf Basis des Kommunikationsschemas kann in den drei genannten Fällen folgendermaßen skizziert werden:
- Aus dem Blickwinkel der all meinem Tun vorangehenden Absichten erscheint mir das Objekt stets im Lichte der mit meinen jeweiligen Zielen verbundenen Erwartung seiner Bereitschaft, in bestimmter Weise auf mein Handeln zu reagieren. Diese Disposition zur kommunikativen Reaktion auf eine beabsichtigte Aktion wird als Objekteigenschaft oder -merkmal[28] bezeichnet. Vermittels des Stellvertreterprinzips konstituieren die Objekte im Zuge des Interaktionsgeschehens ihre Merkmale auch untereinander, sodaß die Eigenschaft als ‚Qualität’ zu einer der Grundbestimmungen (‚Kategorien’) des Seienden der Ontologie mutiert.
- Sobald ich die im Stadium der Eigenschaftswahrnehmung bloß beabsichtigte Handlung tatsächlich vollziehe, findet das aktuelle Erleben der zuvor nur erwarteten Reaktion meines Gegenübers statt. Diese wird infolge der dem Visavis unterstellten Subjekthaftigkeit als ein zu meinem eigenen Tun reziprokes Verhalten aufgefaßt.
- Indem ich mein gesamtes Handeln nach Motiven ausrichte, die ihrerseits durch die Erwartungen meiner Interaktionspartner beeinflußt werden, sind für mich sowohl das an den Objekten wahrgenommene Verhalten als auch die sich in ihrem jeweiligen Eigenschaftsprofil ausdrückenden Verhaltensdispositionen am Verhalten und den ‚Erwartungen’ der übrigen subjektartig vorgestellten Gegenstände ‚orientiert’. Ich bezeichne diese wechselseitige Beeinflussung von ‚motivorientiertem’ Verhalten als Wirken und unterstelle, daß die Vielheit der mir erscheinenden Abläufe durch ein Geflecht von objektiven Wirkungen bzw. Wechselwirkungen bedingt ist.
Zwischen den verschiedenen Kategorien besteht eine äußerst enge Verzahnung, die darauf beruht, daß jede von ihnen in einem bestimmten Aspekt des die Strukturen aller Erlebnisse prägenden Kommunikationsschemas verankert ist. Wenn wir zur Illustration dieser Behauptung einige Wechselbezüge zwischen den Kategorien der Eigenschaft und des Verhaltens herausgreifen, dann können wir eine dreifache Verknüpfung feststellen:
Das erste dieser drei Scharniere, welche die beiden genannten Erfahrungsmuster mit einander verbinden, ist, wie bereits erwähnt, das dem Verhalten zugrunde liegende Ziel. Es bestimmt einerseits die beim (menschlichen oder virtuellen) Akteur stattfindende Selbsterfahrung seiner auf das jeweilige Visavis bezogenen Aktion und konstituiert für ihn andererseits die dieser Aktion entsprechende Eigenschaft jenes Gegenübers, also die Erscheinung von dessen Bereitschaft, in ganz bestimmter Weise auf das betreffende Verhalten zu reagieren.[29]
Besonders hervorzuheben ist der Umstand, daß diese Komplementarität zwischen der am Gegenstand wahrgenommene Eigenschaft und der merkmalskonstitutiven Tätigkeit des Subjekts nicht nur für die Art der jeweils erscheinenden Eigenschaft, sondern auch für deren Ausprägung gilt: Die Erfahrung unterschiedlicher Ausprägungsgrade ein und derselben Eigenschaft deutet also nicht allein auf diesbezügliche Verschiedenheiten seitens des Objekts hin. Sie ist zugleich immer auch ein Hinweis auf entsprechende Tätigkeitsunterschiede beim Subjekt. In diesem Sinne sind zum Beispiel weitere räumliche Ausdehnung nur durch vermehrte Bewegung und größere Schwere nur durch verstärkte Hebeanstrengung erfahrbar.[30]
Neben Art und Ausprägung eines Merkmals hängt auch dessen Zuordnung zur Gruppe der extensiven oder zu jener der intensiven Eigenschaften[31] davon ab, wie der das betreffende Merkmal erfahrende Akteur sein eigenes Interaktionsverhalten erlebt: Wenn ich mich zu den verschiedenen Teilen meines Objekts so verhalte wie zu einer mir gegenüber als Kollektiv agierenden Gruppe von Gegenspielern, dann hat für mich das als ein derartiges Kollektiv aufgefaßte Gesamtobjekt eine entsprechend stärkere Ausprägung des im Zuge der betreffenden Interaktion erfahrenen Merkmals als einer oder mehrerer seiner Teile.[32] Wenn ich dagegen mit jedem der Teile meines Gegenstands gesondert interagiere, hat das Gesamtobjekt für mich dieselbe Eigenschaftsausprägung wie jeder seiner Teile, weil ich in diesem Fall meinen Gegenstand nicht als ein Kollektiv auffasse, dessen Mitglieder bei ihrem auf mich bezogenen Verhalten mit einander kooperieren.
Die zweite Verbindung zwischen der Kategorie der Objekteigenschaft und der des Verhaltens besteht darin, daß erstere infolge ihres Stellenwerts als Bereitschaft für uns nichts anderes repräsentiert als ein ganz bestimmtes Aktionspotential des Objekts, das sich im Zuge des entsprechenden Verhaltens aktualisiert. Daraus resultiert eine wichtige Implikation für die Erfahrbarkeit von Objekteigenschaften: Da wir zuvor Erfahrung als das Eintreffen bzw. Nichteintreffen einer Erwartung definierten, ist klar, daß das, was wir erfahren, niemals die Objekteigenschaft ist, sondern immer das Verhalten des Objekts. Dieses Verhalten bestätigt bzw. widerlegt dann unsere Annahme bezüglich der dem Gegenstand unterstellten Eigenschaften.
Eine dritte Verknüpfung der beiden genannten Grundmuster der Erfahrung beruht darauf, daß wir eine dem Wechselverhältnis zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung nachgebildete Beziehung zwischen Verhaltensbereitschaft (Eigenschaft) und Verhalten unterstellen: So wie das Bedürfnis durch seine Befriedigung im Handeln gestillt wird, ist für uns jedes Objektverhalten mit einer entsprechenden Änderung der ihm zugrundeliegenden Verhaltensbereitschaft (Eigenschaft) des betreffenden Gegenstandes verbunden. Umgekehrt sehen wir auch jede Veränderung einer Eigenschaft (zum Beispiel der räumlichen Position oder der Härte) als Folge eines Verhaltens an.
Zu den drei bereits angeführten Kategorien gesellt sich als ein viertes Grundelement der Erfahrung die bisher noch nicht in ihrer kategorialen Gestalt, sondern bloß in dem auf Raum und Zeit bezogenen Erscheinungstypus[33] untersuchte Relation. Ein Beispiel für das Vorkommen einer solchen Relation in physikalischem Kontext wäre etwa die Feststellung ‘Der Mond ist Trabant der Erde.’, in welcher der Relationsausdruck ‘... ist Trabant der ...’ eine Beziehung zwischen den beiden Objekten ‘Mond’ und ‘Erde’ herstellt.
Wenn bei der Kategorie der Eigenschaft sowie jener des Verhaltens an der Oberfläche nur der Bezug auf ein einzelnes Subjekt bzw. einen bestimmten Subjekttyp erscheint und die Einbettung in das Kommunikationsschema erst durch die Reflexion auf die komplementäre Verzahnung der beiden Erfahrungsmuster klar hervortritt, so repräsentiert die Relation genau wie die Kategorie der (Wechsel-) Wirkung das Kommunikationsgeschehen auf unmittelbare Weise.
Was ist nun aber der Unterschied zwischen Relation und (Wechsel-) Wirkung? Letztere stellt die Aktualisierung einer den Gegenständen unterstellten Beziehung dar und statuiert dadurch zugleich einen Tätigkeitsbezug zwischen den als Interaktionspartner aufgefaßten Objekten. Sie ist somit das Pendant zur Kategorie des Verhaltens, welche ebenfalls auf den Aktualisierungsaspekt bzw. die Tätigkeit abstellt, aber den kommunikativen Gehalt derselben nur implizit enthält. Die Relation steht dagegen für die der Interaktion zugrunde liegende Beziehung der virtuellen Kommunikationspartner, also für das vorhandene Potential zur (Wechsel-) Wirkung und ist deshalb das Gegenstück zur Kategorie der Eigenschaft.
Am deutlichsten wird der Unterschied zwischen Wirkung bzw. Wechselwirkung und Relation in seiner Analogie zum sozialen Verhalten. Während die Wechselwirkung dem aktuellen Spiel der in einer bestimmten sozialen Beziehung vorhandenen Rollen durch deren Exponenten entspricht, wird durch die Relation der Wechselbezug der Rollen selbst, unabhängig von dessen Aktualisierung durch das Rollenspiel der Interaktionspartner, erfaßt.
Wenn wir jede dieser Rollen als ein Ensemble von Verhaltensregeln begreifen, dann entspricht die Relation dem Wechselbezug jener dem tatsächlichen Interagieren vorausgesetzten Regelsets. Die Funktion der Relation für die Interpretation der Erfahrung vor dem Hintergrund des Kommunikationsschemas besteht somit in der Darstellung der Wechselbezüge zwischen den Verhaltensregeln der im Rahmen einer bestimmten Wirkungsbeziehung als virtuelle Interaktionspartner mit einander verbundenen Objekte.
Unsere in Teil 8 folgende Auseinandersetzung mit der Logik wird zeigen, daß die Vertreter der genannten Disziplin dieses Wesen der Relation nicht erfaßt haben. Sie können nämlich nicht zwischen der Kategorie der Relation und jener der Wirkung unterscheiden[34], was daran liegt, daß die Logiker immer nur den formalen Aufbau von Aussagen untersuchen und nicht deren pragmatistischen Stellenwert reflektieren, also keinen Bezug zwischen der jeweils analysierten Behauptung und dem die Erfahrungsbasis jeder Behauptung strukturierenden Kommunikationsschema herstellen.
Ein zusätzliches Defizit der Logik im Umgang mit der vorliegenden Kategorie besteht darin, daß sie den gravierenden Differenzen zwischen der soeben dargestellten Art von Relationen und einem weiteren Relationstyp zu wenig Beachtung schenkt, welchen wir erst in 6.5 behandeln werden. Bevor wir jedoch diese Vertiefung unseres Verständnisses der Relationen in Angriff nehmen können, sind noch einige grundsätzliche Überlegungen zum Stellenwert von Begriffen und Kategorien sowie zu weiteren Grundelementen unseres Erkenntnisapparats anzustellen.
6.4 Der apriorische Gehalt der Erfahrung
Wir beginnen mit der Darstellung eines bisher noch nicht behandelten elementaren Bausteins unseres Erkenntnisvermögens, der als Ergänzung von Begriff und Kategorie wesentliche Funktionen bei der Konstitution der Erfahrung erfüllt. Das damit angesprochene Deutungsmuster wird als ‚ Theorie ’ bezeichnet und hat folgenden Stellenwert: Während wir ausgehend von der Auffassung des Objekts als eines virtuellen Subjekts mit der Gesamtheit unserer Begriffe eine differenzierte Palette von Typen virtueller Akteure (genannt ‚Objekttypen’) bilden, schaffen wir uns auf Basis des Vorsatzes, alle Abläufe im Objektbereich nach dem Muster von Interaktionen zu interpretieren, mittels der Theorien eine ebenso differenzierte Palette von Interaktionstypen, welche man auch als ‚ typisierte Wirkungsbeziehungen ’ bezeichnen kann.
Wenn somit jeder einzelne Begriff eine bestimmte Konkretisierung der allgemeinen Überzeugung von der Subjektartigkeit des Objekts repräsentiert, so sind sämtliche Theorien als Konkretisierungen des allgemeinen Kommunikationsschemas zu sehen. Diese Konkretisierungen haben immer zwei Aspekte:
- Zum einen spezifiziert jede Theorie das abstrakte Grundmuster der menschlichen Interaktion in Richtung auf eine ganz bestimmte Art des Kommunizierens, wobei sie etwa auf gewisse Formen der Interaktion (wie die ‚gegenseitige Anziehung oder Abstoßung’), bestimmte Kooperationsmuster (wie das ‚Übermitteln von Information’ bzw. das ‚Erteilen von Befehlen’) oder Formen der feindlichen Auseinandersetzung (wie das ‚Eindringen bzw. Abwehren von Gegnern’) abstellt.
- Zum anderen appliziert sie die jeweils gewählte Art der Konkretisierung des allgemeinen Kommunikationsschemas auf einen ganz bestimmten Erfahrungsbereich - etwa auf das Bewegungsverhalten von Himmelskörpern, oder auf bestimmte Vorgänge im menschlichen Organismus.
Die hier nur beispielhaft erwähnten Arten des Kommunizierens sind Teilstrukturen dessen, was für das erkennende Subjekt als ‚das Bekannte’ fungiert, auf das alles ‚Unbekannte’ zurückgeführt werden soll. Indem eine Theorie jene Strukturen des Bekannten unter Anwendung des Äquivalenzprinzips auf bestimmte (vorläufig noch) unstrukturierte Erfahrungsbereiche überträgt, dehnt sie die Sphäre dessen, was bekannt ist, auf den Bereich des bisher Unbekannten aus, wobei es zur Bildung neuer Begriffe und Kategorien kommt. Letzteres hat zur Konsequenz, daß man nun alle Erfahrungen des betreffenden Bereiches auf ein System von Erwartungen beziehen kann, das aus neuen Typen von virtuellen Akteuren mit neuen Eigenschaften, neuen wechselseitigen Relationen, sowie neuen Verhaltens- und Wirkungsmustern besteht. Die sprachlichen Ausdrücke dieser von einer bestimmten Theorie geschaffenen Erwartungen haben die Gestalt von Behauptungssätzen[35] und werden als die aus der jeweiligen Theorie abgeleiteten Hypothesen bezeichnet.
Fußen mehrere, auf verschiedenste Erfahrungsbereiche bezogene Theorien auf ein und derselben Konkretisierung des abstrakten Grundmusters aller menschlichen Interaktion (also etwa auf dem Kommunikationstyp des ‚Übermittelns von Informationen’), dann bezeichnen wir den betreffenden Kommunikationstyp samt dem auf ihn bezogenen Repertoire an Typen von virtuellen Akteuren (mit den jeweils dazugehörenden Eigenschaften, Relationen, Verhaltens- und Wirkungsmustern) als das Paradigma der betreffenden Theorien.
Während sich also die Theorie immer auf einen ganz bestimmten Erfahrungsbereich bezieht, ist das Paradigma stets offen für die Übertragung auf verschiedenste Erfahrungsbereiche. Ein gutes Beispiel dafür ist jenes der klassischen Mechanik, in dem es um virtuelle Akteure geht, die ihr Bewegungsverhalten durch gegenseitige Anziehung bzw. Abstoßung beeinflussen und bei einem Zusammentreffen wechselseitig körperliche Kraft auf einander ausüben. Dieses von uns im Teil 4 in seiner kommunikativen Tiefenstruktur betrachtete Kraft-Materie-Paradigma wurde einige Jahrhunderte lang auf breitester Front angewendet, was zur Entstehung eines weiten Spektrums entsprechender mechanischer Theorien führte, das von der Astronomie über die Optik bis zu Wärme- und Elektrizitätslehre reichte.
Wenn das schon etablierte Paradigma also auch über bzw. zwischen den einzelnen Theorien angesiedelt ist, so entsteht doch ein neues Paradigma stets nur im Zuge der Entwicklung einer innovativen, auf ein ganz bestimmtes Erfahrungsgebiet bezogenen Theorie, um dann im weiteren Verlauf (wieder unter Anwendung des Äquivalenzprinzips) die Theoriebildung in anderen Bereichen zu strukturieren.
In dem Maße, in dem vorangehende Erkenntnisleistungen Vorgänge aus der Objektsphäre oder dem Bereich des Subjekt-Objektkontakts in den Bestand des als gesichert geltenden Wissens integriert haben, kann bei der Entwicklung neuer Paradigmen auch auf derartige, nun als ‚bekannt’ geltende Vorgänge zurückgegriffen werden. Einschlägige Beispiele dafür bietet das weite Feld der Analogien aus der Welt der Werkzeuge und Maschinen[36]. Da aber, wie eben erwähnt, nur solche Vorgänge zur Paradigmenbildung taugen, die ihrerseits bereits nach dem Muster der menschlichen Interaktion verstanden sind, verweisen alle objektbezogenen Paradigmen zumindest indirekt wieder auf das Kommunikationsschema als letzte Basis dessen, was als gewiß angesehen wird.
Der soeben explizierte Paradigmen-Begriff ist deutlich unterschieden von dem durch Th. S. Kuhn in die wissenschaftstheoretische Diskussion eingebrachten Konzept des Paradigmas[37]:
Das Kuhnsche Paradigma ist ein primär deskriptiv-wissenssoziologisch orientierter Begriff, der neu auftretende Interpretationsmuster beschreibt, welche in der Community der Forscher Anklang finden, weil sie einerseits faszinierend und einleuchtend sind, andererseits jedoch so viele Fragen offen lassen, daß sie ein breites Feld für weiterführende Forschung eröffnen[38]. Demgegenüber hat das hier verwendete Konzept des Paradigmas systematisch-erkenntnistheoretischen Stellenwert, da es auf die Beziehung der empirischen Theorien zum transzendentalen Kommunikationsschema abstellt. Wir begnügen uns daher nicht mit der Feststellung, daß das Paradigma einleuchtend, faszinierend und forschungsanregend ist, sondern können auch die Frage beantworten, warum dies so ist. Die Begründung liegt darin, daß ein breit akzeptiertes Paradigma stets Ausdruck der jeweils historisch gegebenen gesellschaftlichen Kommunikations- und Kooperationsstrukturen ist und damit einen optimalen Ansatzpunkt zur Rückführung des Unbekannten auf das Bekannte sowie zur Verknüpfung der auf Basis der Theorien gemachten Erfahrungen mit der jeweiligen gesellschaftlichen Praxis bietet.[39]
Mit der Feststellung der Einbettung des Paradigmas in bestimmte historisch gegebene Kommunikations- und Kooperationsstrukturen sind wir bei einem der wichtigsten Themen der Erkenntnistheorie angelangt. Gemeint ist die Frage nach dem apriorischen Stellenwert des kategorialen Rahmens unserer Erfahrungen.
Die Relevanz des Begriffs des Apriori für die Erkenntnistheorie hat ihren Ursprung im zentralen Stellenwert desselben in der „Kritik der reinen Vernunft“. Kant geht im genannten Werk davon aus, daß zwar „alle Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt“, jedoch „nicht eben alle aus der Erfahrung“ entspringt. Er bezeichnet solche nicht aus der Erfahrung entspringenden Einsichten als „Erkenntnisse a priori, und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung haben.“[40]
Diese Formulierungen geben breiten Auslegungsspielraum und es ist daher erforderlich zu präzisieren, wie wir den Begriff des Apriori im vorliegenden Zusammenhang verstehen. Zunächst muß darauf hingewiesen werden, daß wir ihn immer nur auf begriffliche, also regelbezogene Erfahrung beziehen dürfen. Es gibt nämlich sowohl in individueller als auch in gattungsgeschichtlicher Perspektive Vorläufer der begrifflichen Erfahrung, die nicht durch die Kategorien konstituiert sind.
Weiters zeigt die soeben dargestellte Einbettung sämtlicher konkreter Ausprägungen der Kategorien in eine jeweils durch historisch-gesellschaftliche Determinanten bestimmte, paradigmatische Spezifizierung des Kommunikationsschemas, daß die Rede vom apriorischen Stellenwert der Kategorien nicht zu deren Erhebung in den Rang von anthropologischen Konstanten führen darf. In diesem Sinne haben wir etwa schon in dem der Entwicklung der gesellschaftlichen Basis des Kraft-Materie-Paradigmas gewidmeten Teil 5[41] aufgezeigt, wie der mit dem Übergang vom feudalen zum kapitalistischen Gemeinwesen verbundene Wandel der gesellschaftlichen Praxis zu einer wesentlichen Akzentverschiebung in der Kategorie des Wirkens führte, im Zuge derer aus dem finalen ein kausales Ursachenverhältnis wurde.[42]
Die historische Plastizität des kategorialen Rahmens der Erkenntnis ist aber nicht unbegrenzt: So sehr die gesellschaftliche Praxis auch ihre Gestalt verändern mag, sie wird doch ihrem Wesen nach immer Kommunikation bleiben. Beide Grundbestimmungen der Interaktion, die Orientierung des Verhaltens an wechselseitigen Erwartungen und der Bezug jener Erwartungen auf gemeinsam anerkannte Regeln, stellen deshalb stabile Merkmale aller denkbaren Formen von menschlicher Gesellschaft dar.
Damit aber bilden diese zwei Bestimmungen zugleich das Fundament jeder möglichen historischen Ausformung des der begrifflich-kategorialen Erfahrung zugrunde liegenden Kommunikationsschemas. Die Vorstellung einer Subjektartigkeit des Gegenstandes, wird auf diese Weise ebenso zum Bestandteil des genannten Erfahrungstyps wie etwa die Erscheinungen von Eigenschaften und Wirkungen. Wenn wir Änderungen im Erfahrungsmuster begegnen, dann betreffen diese daher immer nur das, was jeweils unter einem Subjekt, unter einer Eigenschaft oder unter wirkendem Verhalten verstanden wird.
Das dritte mögliche Mißverständnis des apiorischen Stellenwerts der Kategorien betrifft die Frage ihrer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von der Erfahrung. In gewissem Sinne gilt beides: Zum einen sind die Kategorien notwendigerweise erfahrungsunabhängig, da sie ja wegen ihrer konstitutiven Rolle jeder einzelnen begrifflich-kategorialen Erfahrung vorausgesetzt sind. Zum anderen fußen sie aber aufgrund ihrer Fundierung im Kommunikationsschema mit ebensolcher Notwendigkeit selbst auf Erfahrung.
Denn das Kommunikationsschema repräsentiert ja jenes als gewiß geltende Bekannte, auf welches wir das Unbekannte zurückführen müssen, um es zu erkennen. Dies Bekannte, muß jedoch auch selbst erfahren worden sein und täglich aufs Neue erfahren werden, um bekannt zu sein. Auch bei dem vorangehenden Hinweis darauf, daß sich unser dem Kommunikationsschema zugrunde liegendes Verständnis von Interaktion im Zuge des Wandels der sozialen Praxis verändert, wird ja vorausgesetzt, daß die betreffenden Modifikationen der Kooperationsform von uns gelebt und damit erfahren werden.
Die Einführung der Kategorie in die philosophische Diskussion erfolgte durch Aristoteles, bei dem ihre Funktion für das Erkennen im Sinne der naiven Ontologie der klassischen griechischen Philosophie noch unmittelbar mit ihrem Seinsaspekt zusammenfiel. Explizit erkenntnistheoretischen Stellenwert erhält die Kategorie dann erst in der Kritik der reinen Vernunft. Eines der gravierendsten Defizite von Kants Annäherung an das mit dem Terminus ‚Kategorie’ bezeichnete philosophische Problem besteht darin, daß in ihr das soeben angedeutete diffizile Wechselspiel zwischen Erfahrungsbegründung und Erfahrungsabhängigkeit vorschnell im Sinne einer Erfahrungsunabhängigkeit der Kategorien gedeutet wird. Ein weiterer Fehler liegt in mangelnder Reflexion auf die Einbettung der Kategorien in das Kommunikationsschema.
Dieses Defizit führt dazu, daß Kants zwölfteiliges System der Kategorien aus heterogenen Elementen besteht, deren Zusammenhang ungeklärt bleibt. Die Kategorientafel der Kritik der reinen Vernunft enthält nämlich neben dem Verhältnis von Ursache und Wirkung, das einem der wichtigsten Strukturmomente des Kommunikationsschemas entspricht und damit eine Kategorie in dem von uns skizzierten Sinn darstellt, eine Reihe weiterer Bestimmungen, wie etwa Realität, Negation und Limitation oder auch Einheit, Vielheit und Allheit, welche zwar ebenfalls apriorischen Charakter haben, jedoch in ganz anderer Weise auf das Kommunikationsschema Bezug nehmen als die bisher von uns erwähnten Kategorien.[43]
Die angeführten Reflexionsmängel mögen ebenso wie die zuvor aufgezeigte ‚Anfälligkeit’ des Kategoriebegriffs für ontologische Fehlinterpretationen mit dazu beigetragen haben, daß in neuerer Zeit sowohl die Logik als auch die Erkenntnistheorie dem Konzept der Kategorie generell sehr reserviert gegenüberstehen.[44] Diese Skepsis hat um so mehr Berechtigung, als eine gewisser Vorsicht im Umgang mit dem Konzept der Kategorie selbst dann angebracht ist, wenn wir seine objektivistische Interpretation abgewehrt und sein Verhältnis zu den Begriffen, zur Erfahrung sowie zum Kommunikationsschema korrekt bestimmt haben.
Die Rede von den Kategorien verleitet nämlich zu der Illusion, es gäbe so etwas wie einen abgeschlossenen und damit dogmatisch verkündbaren Katalog von Grundmustern der Erfahrungsinterpretation. Hinter einer solchen Überbetonung der Geschlossenheit des systemischen Zusammenhangs der Kategorien, welche jeder Suche nach einem vollständigen Katalog derselben zugrunde liegt, verbirgt sich letztlich wieder nur die implizite Annahme, daß das Kommunikationsschema, auf das alle Systematisierungsversuche rekurrieren müssen, eine historisch unwandelbare Gestalt habe.
Fruchtbarer erscheint ein nicht vom Katalog-Denken her kommender Zugang zur Kategorie, der diese bloß als ein regulatives Prinzip der erkenntniskritischen Analyse begreift: Das genannte Prinzip hält uns erstens an, in den einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen nach jenen Elementen zu suchen, welche den in sehr weit gestecktem Rahmen historisch wandelbaren Strukturen des aller Erfahrungsinterpretation zugrunde liegenden Kommunikationsschemas entsprechen. Zweitens läßt es uns Ausschau halten nach den zwischen diesen elementaren Interpretationsmustern bestehenden Wechselbezügen.[45] Und drittens erinnert der pathetische „Fundamentalismus“ des Kategoriebegriffs[46] daran, daß unser Interpretationsrahmen nicht die Beliebigkeit von konstruktivistischen Deutungsrastern hat, sondern jenen bereits mehrfach erläuterten pragmatistischen Erfordernissen gehorcht, die dazu zwingen, unsere eigenen Interaktionsmuster zum Ausgangspunkt aller Auslegungen von Erfahrung zu machen.
6.5 Form und Inhalt
Bei der Diskussion der Kategorien der Eigenschaft und des Verhaltens in Abschnitt 6.3 erwähnten wir, daß diese auf sprachlicher Ebene durch Eigenschafts- bzw. Zeitwörter repräsentierten Interpretationselemente nicht mit der Erscheinung der durch Hauptworte benannten Merkmalstypen und Tätigkeitsmuster verwechselt werden dürfen. Wir wenden uns nun der in 6.3 angekündigten Analyse des Konstitutionsprozesses der beiden letztgenannten Erfahrungsbausteine zu und beginnen jenes Vorhaben mit einem Nachtrag zur Kategorie der Relation. Auch diesen Nachtrag haben wir bereits angekündigt, und zwar durch den am Ende von Abschnitt 6.3 notierten Verweis auf eine weitere, bisher noch nicht behandelte Art von Relationen.
Während die in 6.3 untersuchten Relationen vor dem Hintergrund der auf die Objekte projizierten Kommunikationsbeziehungen erscheinen, fußt die Konstitution der nunmehr darzustellenden Relationen auf dem Umstand, daß die menschlichen Träger jener Beziehungen über reflexive Identität verfügen. Sie gehen daher nicht in ihren jeweils aktuellen Handlungen auf, sondern setzen diese in Verbindung zu ihren früheren und künftigen Aktionen. Das führt dazu, daß sie auch zwischen den Verhaltensbereitschaften und Verhaltensweisen ihrer Objekte entsprechende Bezüge wahrnehmen. Es sind zwei Arten solcher Bezüge zu unterscheiden, und zwar die qualitativen und die quantitativen Relationen[47].
Erstere werden nicht nur zwischen verschiedenen Verhaltensweisen eines Objekts wahrgenommen (Dieses Messer sticht und schneidet.), sondern auch zwischen den jeweils als Grundlagen der betreffenden Verhaltensweisen postulierten Verhaltensbereitschaften (Dieses Messer ist spitz und scharf.). Aufgrund des in allen Erfahrungsprozessen zur Anwendung gelangenden Komplementaritätsprinzips verweist die Wahrnehmung jeder derartigen Relation im Bereich der Objekte auf eine in komplementärer Selbstwahrnehmung festgestellte Beziehung zwischen den jeweils erfahrungskonstitutiven Handlungsvollzügen unterschiedlichen Typs. Im vorliegenden Beispiel der Wahrnehmung einer Relation zwischen der Spitze und Schärfe eines Gegenstandes bzw. dessen Stechen und Schneiden wäre dies die Selbsterfahrung des Unterschiedes zwischen der mit dem Daumen ausgeführten Tätigkeit des Drückens, bei welcher das Stechen der Messerspitze erlebt wird, und jener gleitenden Bewegung des genannten Fingers, in deren Verlauf man die möglicherweise blutige Erfahrung der Schärfe der Schneide des Messers macht.
Im Gegensatz zu den qualitativen erscheinen die quantitative Relationen nicht zwischen verschiedenen Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen, sondern zwischen verschiedenen Graden der Bereitschaft zur Durchführung ein und derselben Art des Verhaltens bzw. zwischen verschiedenen Graden der Intensität von Aktivitäten identischen Typs. Die komplementäre Selbsterfahrung des die Relation registrierenden Subjekts bezieht sich in diesem Fall nicht auf unterschiedliche Typen der erfahrungskonstitutiven Tätigkeit, sondern auf entsprechende Unterschiede der Intensität von eigenen Aktionen ein und desselben Tätigkeitstyps.
In diesem Sinne erscheint etwa zwischen zwei bestimmten Gegenständen nur deshalb eine quantitative Relation unterschiedlicher Schwere, weil das Subjekt in dem identitätsstiftenden Prozeß der Selbstreflexion die jeweils entsprechenden Hebehandlungen mit der Erfahrung bzw. Erwartung eines unterschiedlichen Kraftaufwands verknüpft. Und so wie die an jedem der beiden Objekte beobachtete Eigenschaft der Schwere das Komplement zum jeweiligen Kraftaufwand beim Heben darstellt, ist die zwischen den zwei Gegenständen wahrgenommene Schwererelation nur das Gegenstück zu der introspektiv registrierten Beziehung zwischen den beiden Hebehandlungen.[48]
Wenn wir hier wieder die Perspektive der individuellen Selbsterfahrung einnehmen, verlieren wir dabei nicht aus den Augen, daß (entsprechend der in 6.1 referierten Kritik Wittgensteins am Ansatz der Introspektion) beide eben erwähnten Vorgänge der Selbstreflexion in den sozialen Prozeß der gemeinsamen Befolgung von Regeln eingebettet sind. Denn die in jeder qualitativen und quantitativen Relation enthaltene Feststellung von bestimmten Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen der in die betreffende Relation einbezogenen Objekte ist Resultat von Beobachtungsaktivitäten. Und deren Durchführung mit einer gegen die ständig drohende Gefahr der Selbsttäuschung abgesicherten Verläßlichkeit ist letztlich nur möglich als kollektiver Prozeß, der die wechselseitige Kritik der Beobachter auf der Basis von intersubjektiv gültigen Beobachtungsregeln umfaßt.
Um den in Abschnitt 6.3 dargestellten Relationstyp von den beiden nun im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehenden Relationen zu unterscheiden, können wir ihn als Wirkungsrelation bezeichnen, da er unmittelbar der in das Kommunikationsschema eingelassenen Wirkungsbeziehung zuzuordnen ist. Im Gegensatz zur Wirkungsrelation sieht es beim derzeitigen Stand der Betrachtung so aus, als ob die zwischen den Eigenschaften und Verhaltensweisen der Gegenstände erscheinenden qualitativen und quantitativen Relationen keinen Bezug zum interaktiven Kern des auf die Objekte projizierten Kommunikationsschemas aufwiesen, resultieren sie doch in der eben angedeuteten Weise aus der Reflexion der Handelnden auf ihr eigenes Tun, bei welcher unterschiedliche erfahrungskonstitutive Tätigkeiten in Bezug zu einander gebracht werden.
Der Schein trügt jedoch. Denn infolge der bereits mehrfach erwähnten, unerhörten Konsequenz, mit der die Akteure ihre Subjektivität auf die Objekte übertragen, projizieren sie auch jene Reflexivität, die sie zu ihrem eigenen Verhalten entwickeln, auf die Gegenstände. Dadurch verliert das auf den ersten Blick nur in Komplementarität zur Selbstreflexion des erfahrenden Akteurs konstituierte Phänomen der qualitativen und quantitativen Relationen seinen unmittelbaren Bezug auf das Subjekt der Erfahrung.
Dies bedeutet zweierlei: Zum einen wird so die Reflexivität - natürlich nur in spezifisch abgewandelter Form - zu einer Eigenschaft aller virtuellen Subjekte[49]. Zum anderen sind dadurch die quantitativen und qualitativen Relationen genau wie die Wirkungsrelationen nicht bloß Grundbestimmungen der Erfahrung, sondern auch solche des als subjektunabhängig vorgestellten Seins.
So wie die objektbezogene Gliederung der Erfahrung und die Strukturierung aller Erscheinungen des mittels der Begriffe als Subjekt interpretierten Objekts durch die in 6.3 und 6.4 behandelten Kategorien, Theorien und Paradigmen stellt auch das Registrieren von qualitativen und quantitativen Relationen keinen kognitiven Selbstzweck sondern die Erfüllung von wesentlichen pragmatistischen Funktionen dar:
- Die Wahrnehmung von qualitativen Relationen zwischen den unterschiedlichen Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen ein und desselben Objekts, im Zuge derer dieses etwa als spitz ‚und’[50] scharf registriert wird, bringt verschiedene, jeweils merkmalskonstitutive Handlungsmuster in Verbindung mit einander und umgibt dadurch jede einzelne dieser Tätigkeiten mit einem Horizont von Vorstellungen aller möglichen Verhaltensweisen gegenüber dem betreffenden Gegenstand.
- Die Bildung von quantitativen Relationen zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen ein und derselben Eigenschaft bzw. Verhaltensweise bei verschiedenen Gegenständen bettet schließlich das Ergebnis der auf das einzelne Objekt bezogenen Handlung eines bestimmten Typs in die Vorstellung der Gesamtpalette aller möglichen Resultate von Aktionen der betreffenden Art ein. Sie stellt damit nicht nur den jeweiligen Gegenstand in ein Verhältnis zu den übrigen Gegenständen, sondern reißt zugleich auch die Bezüge zwischen der aktuellen Handlung und der Gesamtheit der bereits vollzogenen bzw. als möglich erachteten Aktivitäten des betreffenden Typs auf.
Erst durch die Feststellung von quantitativen und qualitativen Relationen entwickelt sich somit das zunächst dem Hier und Jetzt verhafteten Tun zu erfahrungsorientiertem und planvollem Agieren.
Betrachten wir nun eine Gemeinsamkeit, welche die quantitativen und qualitativen Relationen nicht nur mit den Wirkungsrelationen sondern auch mit allen übrigen Kategorien verbindet: In jedem der genannten Fälle haben wir es mit einem bestimmten Aspekt der Erfahrung zu tun, dem sich der Akteur in reflexiver Haltung zuwenden kann. Dabei geschieht dann genau das, was immer passiert, wenn sich sein Bewußtsein auf etwas bezieht: Das Bewußtsein muß dieses Etwas als einen sich interaktiv verhaltenden Gegenspieler auffassen, das heißt: zu seinem Objekt machen.
Wenn wir die alles begriffliche Erkennen kennzeichnende Verwandlung des Unbekannten in ein nach dem Vorbild des Subjekts interpretiertes Gegenüber als den ersten, grundlegenden Schritt der Reflexion ansehen, dann sind wir hier auf eine zweite Reflexionsebene gestoßen. Auf ihr werden die einzelnen Aspekte der Erfahrung, welche sich durch die verschiedenen Komponenten der auf jenes subjektartige Gegenüber gerichteten Erwartungen konstituieren, selbst zu Gegenständen begrifflichen Erkennens gemacht.
Dieses Vorgehen ermöglicht es dem Akteur, Verhaltens- und Wirkungsweisen, Eigenschaften und Relationen unabhängig von ihrer Verbindung mit den jeweiligen Gegenständen nach dem Muster eigenständiger Objekte zielgerichteten Handelns zu betrachten, was sie in erhöhtem Maße kontrollier- bzw. gestaltbar macht. Im Bereich der Erscheinungen entsteht dadurch neben der aus Gegenständen mit Eigenschaften und Wechselbeziehungen zusammengesetzten ‚ersten’ Welt so etwas wie ein ‚inneres’ Universum der Reflexion, welches sich folgendermaßen konstituiert:
- Abstrahiert der Handelnde vom jeweiligen Gegenstand seines Tuns, dann erscheinen ihm anstelle der Eigenschaften und Aktionen eines bestimmten Objekts die unabhängig von ihrer Verbindung mit dem jeweiligen Gegenstand betrachteten Merkmale und Verhaltensweisen. Wir bezeichnen diese aus ihrem Bezug zum ursprünglichen Objekt (etwa zu dem oben als Beispiel benutzten Messer) herausgelösten und als eigenständige Gegenstände wahrgenommenen Eigenschaften und Verhaltensweisen als Inhalte. Da letztere stets unmittelbare Komplemente zu den jeweils erfahrungskonstitutiven Handlungen des individuellen Akteurs darstellen, haben wir es dabei immer mit konkreten Inhalten zu tun (eine ganz bestimmte Schärfe, ein ganz bestimmtes Schneiden, usw.)
- Wenn der Akteur in einem weiteren Schritt der Abstraktion seine für die Erfahrung eines solchen Inhalts konstitutive Aktion nicht als konkrete Handlung sondern als allgemeinen Tätigkeitstyp ins Auge faßt, dann erscheint ihm auch der jeweilige Inhalt selbst nicht mehr in einer bestimmten Ausprägung sondern in seiner allgemeinen Gestalt als ein Merkmals - bzw. Verhaltenstyp (die Schärfe, das Schneiden, usw.)[51]. Wird ein solcher Merkmals- bzw. Verhaltenstyp als eine meßbare Größe angesehen, dann sprechen wir von einer Dimension.
- Jeder Merkmals- bzw. Verhaltenstyp repräsentiert nun seinerseits ein begrifflich erschlossenes Objekt, das selbst wieder bestimmte ‚Eigenschaften’ und ‚Verhaltensweisen’ zeigt und in ganz bestimmten ‚Relationen’ zu den übrigen Merkmals- und Verhaltenstypen steht. So haben etwa viele Merkmals- und Verhaltenstypen die Eigenschaft der Meßbarkeit, andere nicht, einige Eigenschaften sind mit bloßem Auge besser beobachtbar als andere, usw.
- Betrachtet der Akteur weder den ursprünglichen Gegenstand seines Handelns noch dessen Eigenschaften oder Verhaltensweisen als sein zu behandelndes Gegenüber, sondern behält bloß die Beziehung zwischen verschiedenen Ausprägungsgraden eines oder mehrerer Merkmale (bzw. einer oder mehrerer Verhaltensweisen) im Blick, dann verhält er sich zu jenen Relationen wie zu einem eigenständigen Objekt. Der auf diese Weise konstituierte Gegenstand der Reflexion, das als Objekt betrachtete Relationsgefüge also, wird üblicherweise als Form bezeichnet.
- Wie der Gegenstand der ersten Reflexionsebene existiert auch das Formobjekt für den Akteur sowohl in individueller als auch in allgemeiner Gestalt. Während es sich bei der individuellen Form stets um ein von einem konkreten Gegenstand ‚abgezogenes’ Gefüge von Relationen handelt, hat die allgemeine Form ihr Pendant nicht im konkreten Objekt sondern in dessen Begriff und ist damit (so wie letzterer) als ein bestimmtes Set von Erwartungen zu charakterisieren.
- Entsprechend unserer Unterscheidung von qualitativen und quantitativen Relationen müssen wir im Bereich der Formerscheinungen zwischen ein- und mehrdimensionalen Formen differenzieren. Formen des ersten Typs liegen vor, wenn nur die Ausprägungsverhältnisse eines einzigen Merkmals (bzw. einer isolierten Verhaltensweise) als Gegenstand betrachtet werden. Mit Formen des zweiten Typs haben wir es dann zu tun, wenn das Formobjekt aus den jeweiligen Ausprägungsverhältnissen mehrerer Merkmale (bzw. Verhaltensweisen) besteht.[52]
Ein bereits in Abschnitt 4.6 erwähntes Beispiel für das Auftreten des Phänomens der Form im Kontext der klassischen Mechanik ist die Erscheinung der räumlichen Gestalt von Körpern. Bei deren Konstitution abstrahiert der Akteur zunächst vom eigentlichen Gegenstand als dem Träger einer unendlichen Vielfalt von Eigenschaften und Verhaltensweisen und faßt nur das Merkmal der räumlichen Position jedes Oberflächenpunktes ins Auge. Im zweiten Konstitutionsschritt werden dann die zwischen diesen räumlichen Positionen der einzelnen Oberflächenpunkte bestehenden, quantitativ bestimmten Abstands- und Richtungsrelationen zum Gegenstand seiner Betrachtung. Und jetzt erst erscheint ihm die Form des ursprünglichen Handlungsgegenstandes ‚Körper’ als eigenständiges Objekt. Daß diese Form nun nicht aus den räumlichen Positionen einzelner Punkte besteht, sondern aus den Relationen zwischen jenen Positionen, ist daran zu erkennen, daß sie völlig unabhängig von ihrer jeweiligen Lage im Raum ist. Sie kann vielmehr beliebig im Raum verschoben oder gedreht werden, ohne ihre Identität zu verlieren.
In der Dimension der Zeit gibt es eine zur räumlichen Form analoge Erscheinung: Ihre Konstitution fußt nicht auf der Wahrnehmung oder Vorstellung eines bestimmten Gegenstands, bei dem man nur die räumliche Position der Oberflächenpunkte ins Auge faßt. Es geht hier vielmehr um ein bestimmtes Verhalten, bei dem ausschließlich die Relationen zwischen den zeitlichen Positionen seiner auf einander folgenden Stadien beachtet werden. Während man im Fall der räumlichen Form von einer Gestalt spricht, bezeichnet man die zeitliche Form als Rhythmus. Bei einer Kombination von raum-zeitlichen Formelementen haben wir es mit der rhythmischen Veränderungen von räumlichen Gestalten zu tun. Da die Zeit ihrerseits auch einer verräumlichenden Betrachtung unterworfen werden kann, ist jeder Rhythmus auch als Gestalt eines verräumlichten Zeitablaufes vorstellbar.
Bezieht sich die Betrachtung von Ausprägungsunterschieden nicht auf bloße Positionen im Raum oder in der Zeit, sondern auf eine konkrete Eigenschaft (bzw. ein konkretes Verhalten), dann erscheint keine rein räumliche bzw. zeitliche Form, sondern ein auf das jeweilige Merkmal (bzw. Verhalten) bezogenes Muster, wie zum Beispiel ein bestimmtes Farbmuster oder ein bestimmtes Bewegungsmuster. Unter allen möglichen Eigenschaften kommt allerdings den Merkmalen der räumlichen und zeitlichen Position insofern eine Sonderstellung zu, als jedes auf einen beliebigen Merkmalstyp (bzw. ein beliebiges Verhalten) bezogene Formgebilde immer auch als räumliche und/ oder zeitliche Form erscheinen muß, und zwar aus folgendem Grund:
Da die Form ein als Objekt betrachtetes Gefüge von quantitativen (bzw. fallweise auch qualitativen) Relationen darstellt, bezieht sie sich notwendigerweise stets auf mindestens zwei verschiedene Wahrnehmungsinhalte oder Vorstellungen. Das Registrieren solch unterschiedlicher Inhalte geschieht jedoch, wie wir schon im Abschnitt 2.4 erkannten, aus pragmatistischen Gründen immer in den Modi des Neben- oder Nacheinander, weil die für die betreffenden Erfahrungen konstitutiven Handlungsvollzüge mit einander durch Ruhe oder Bewegung des Akteurs verbunden sind.
Wenn somit jede Wahrnehmung von Relationen zwischen unterschiedlichen Typen oder Ausprägungen von Merkmalen (bzw. Verhaltensweisen) notwendigerweise von der Feststellung der räumlichen bzw. zeitlichen Verhältnisse zwischen den Orten bzw. Zeiten ihres Auftretens begleitet ist, müssen auch die auf beliebige Eigenschaften oder Verhaltensmuster bezogenen Formen immer mit entsprechenden raum-zeitlichen Formerscheinungen verbunden sein. Anders gesagt wird jede Form prinzipiell nur in räumlichem oder zeitlichem Kleid, bzw. in kombiniertem raum-zeitlichem Modus wahrgenommen oder vorgestellt.[53]
6.6 Form und Werkzeug
Sehen wir uns nun die Funktion der zweiten Reflexionsebene für die gesellschaftliche Praxis etwas genauer an, um den Stellenwert der Erscheinungen von Form und Inhalt besser verstehen zu lernen.
Wenn die Merkmale der Gegenstände sich im Zuge von Aktivitäten konstituieren, die ganz bestimmten Absichten entsprechen, dann bildet die Verwandlung der Merkmale in eigenständige Objekte, welche im Zuge ihrer begrifflichen Analyse als eine Vielfalt unterschiedlichster ‚Merkmalstypen’ erscheinen, den Anstoß für eine systematische Auseinandersetzung mit den jeweils konstitutiven Aktionen und den ihnen zugrundeliegenden Absichten.
Beide Aspekte der Konstitution werden dadurch aus ihrer Einbettung in konkrete Handlungssituationen herausgelöst und in Gestalt von allgemeinen Handlungsmustern und Zielen universalisiert. Während die Reflexion über die Ziele des Handelns den Ausgangspunkt für die Entwicklung allgemeiner Moralvorstellungen darstellt, ist die Reflexion über Handlungsmuster die Basis dessen, was man unter dem Sammelbegriff des methodischen Wissens zusammenfaßt[54].
Der Begriff der Methode zeigt dabei eine zweifache Akzentuierung:
- Geht die Reflexion der Frage nach, auf Basis welcher Handlungsziele bzw. im Zuge welcher Verrichtungen bestimmte Eigenschaften zu erfahren sind, dann haben wir es mit der Methodik der Wahrnehmung, des Beobachtens und Messens zu tun.
- Stellt sie sich dagegen in Umkehrung der Betrachtungsrichtung dem Problem, welche Handlungsziele, bzw. Handlungsmuster zu wählen sind, damit bestimmte Eigenschaften in jeweils gewünschter Ausprägung erfahrbar werden, dann geht es um die Methodik der Herstellung.
Während so die Objektivierung von Eigenschaften zu eigenständigen Merkmalstypen den Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit isolierten Handlungsmustern bildet, ist die entsprechende Vergegenständlichung der zwischen den Eigenschaften erscheinenden quantitativen und qualitativen Relationen in Gestalt von Formgebilden die Grundlage der Reflexion über die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Tätigkeiten im Rahmen komplexer Handlungsgefüge. Letztere finden sich nicht nur im Tun des einzelnen Akteurs, sondern auch im Zusammenwirken mehrerer Individuen.
Die Konstitution der Erfahrung von Formobjekten ist hierdurch aufs Engste mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verknüpft. In diesem Sinne sind die im Objektbereich wahrgenommenen Formen immer schon Gegenstücke zu den praktizierten Mustern der Kooperation, weshalb auch der allen Formphänomenen eigene Ordnungscharakter, der im Begriff der Struktur [55] angesprochen wird, nur das Pendant zum normativen Gehalt des Gefüges der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist.
Wenn somit die Vergegenständlichung von Eigenschaften zum Anlaß für die bewußte Auseinandersetzung mit den Tätigkeiten des Beobachtens, Herstellens und Bewertens wird, ist die Erscheinung der Form Pendant zur Entwicklung einer systematischen Reflexion der Probleme des Koordinierens, Organisierens und Ordnens.
Die Fähigkeit zur Betrachtung von Eigenschaften und Relationen als eigenständige Inhalts- und Formobjekte entfaltet sich zwar im Einklang mit den jeweils entsprechenden Aspekten der Selbstreflexion. Der soeben aufgezeigte Wechselbezug zwischen diesen beiden Entwicklungen des Erkenntnisvermögens ist jedoch nicht im Bewußtsein der Akteure präsent, was im Wesen des für die Erscheinung von Eigenschaften und Relationen konstitutiven Komplementaritätsprinzips begründet liegt:
Die Verwendung der nach jenem Prinzip gebildeten Begriffe ermöglicht es dem Akteur, sein Gegenüber auf eine Art wahrzunehmen, die nicht nur auf das Objekt, sondern auch sein eigenes Verhalten bezüglich des betreffenden Gegenstandes verweist. Ein und dasselbe Erscheinungsmuster stellt damit zugleich das Objekt und den Handelnden selbst dar. Allerdings enthält die auf dem Komplementaritätsprinzip fußende Gegenstandserfahrung bloß einen gründlich versteckten, gleichsam verschlüsselten Verweis auf die Perspektive des Akteurs. Denn der diesbezügliche Fingerzeig erfolgt stets im Modus der Objekterfahrung, sodaß etwa die Art der im Zuge der jeweiligen Wahrnehmung ausgeübten Aktivität des Subjekts als bestimmte Eigenschaft des Objekts erscheint. An der Oberfläche des nach dem Komplementaritätsprinzip konstituierten Bewußtseinsinhalts ist somit nur das Bild des Gegenstandes und nicht dasjenige des Handelnden zu sehen.
Die Einführung einer zweiten Reflexionsebene, auf der Eigenschaften und Formen selbst als Objekte betrachtet werden, hebt nur die Situationsabhängigkeit der Erfahrung auf, sodaß eine Auseinandersetzung mit den allgemeinen Bedingungen möglich wird, unter denen bestimmte Eigenschaften und Relationen erscheinen. Die im Komplementaritätsprinzip in Gestalt einer verschlüsselten Verweisbeziehung installierte Kluft zwischen Objekt- und Selbsterfahrung bleibt jedoch weiter bestehen, was sich in einer Aufspaltung des Wissens in die das erfahrungskonstitutive Handeln und Kooperieren betreffenden methodischen und moralischen Einsichten einerseits und die auf allgemeine Inhalte und Formen der Gegenstandswelt bezogenen Kenntnisse andererseits äußert. Erst die transzendental-pragmatistische Betrachtung kann jene Kluft im Wissen überwinden und den verdeckten Bezug zwischen Objekt- und Selbsterfahrung offenlegt.
Wenden wir uns nun nach dem Ausblick auf den pragmatistischen Stellenwert der Unterscheidung von Form und Inhalt den Wechselbezügen zwischen beiden Erscheinungsmustern zu:
Da die Bedeutung der Rede von einem bestimmten Merkmalstyp allein aus der Bezugnahme auf den die jeweilige Eigenschaft konstituierenden Tätigkeitstyp resultiert, ist in ihr von allen konkreten Ausprägungen des betreffenden Merkmals abgesehen. Bei der Erscheinung der eindimensionalen Form dagegen kommt es auf das Verhältnis der unterschiedlichen Ausprägungsintensitäten der jeweils merkmalskonstitutiven Tätigkeit an, wogegen der Typ jener Tätigkeit keine Rolle spielt. In diesem Sinne achten wir etwa bei einem Muster, das aus Elementen unterschiedlicher Intensität ein und derselben Farbe besteht, nicht auf die Art der betreffenden Farbe, sondern nur auf den Intensitätswechsel als solchen.
Während somit die Erscheinung des Inhalts den durch die Rede von der Form repräsentierten Bedeutungsgehalt ausblendet, verhält es sich im Fall der eindimensionalen Form genau umgekehrt. Eine selbständige Existenz als Form ohne Inhalt bzw. Inhalt ohne Form, kommt diesen beiden Erscheinungsmustern jedoch nur auf der zweiten Reflexionsebene zu. Denn an den unterschiedlichen Bestandteilen eines konkreten Objekts wird der Inhalt immer nur in ganz bestimmten Ausprägungen wahrgenommen. Diese stehen in Relation zu einander, was gleichbedeutend ist mit der Erscheinung einer entsprechenden Form des betreffenden Inhalts. Auf der anderen Seite ist auch die Form als Relation von Merkmalsausprägungen am konkreten Objekt immer mit dessen Inhalt verknüpft.
Sind aber Form und Inhalt einmal im Prozeß der sekundären Reflexion als eigenständige Handlungsgegenstände etabliert, dann sieht ihre Verbindung in den Objekten der primären Reflexionsebene wie das Ergebnis einer Interaktion von zwei unabhängig von einander existierenden Wesenheiten aus. Dies kann zu der Vorstellung führen, daß es sich bei Form und Inhalt um die eigentlichen Akteure des Weltgeschehens handle, die durch das Eingehen von immer neuen Verbindungen die Vielfalt der Erscheinungen erzeugen.[56]
Der wahre Kern dieser ontologischen Illusion des objektiven Idealismus besteht darin, daß sich die als eigenständiges gedankliches Objekt etablierte Form in verschiedensten Inhalten manifestiert. Dies bedeutet zum einen, daß der Handelnde in Objekten mit unterschiedlichsten Merkmalen nach identischen Formen sucht und andererseits im Zuge seiner Praxis unterschiedlichsten, in der Natur vorgefundenen Gegenständen seine Formvorstellungen aufprägt.
Er bedient sich dabei bestimmter Werkzeuge, und wenn wir diese nun etwas näher betrachten, ist zunächst festzuhalten, daß die Entwicklung von Werkzeugen generell nur in Verbindung mit der Etablierung einer zweiten, auf Formen und Inhalte bezogenen Reflexionsebene möglich ist. Denn erst dann, wenn die jeweils aktuellen Aktionen als Realisierungen von allgemeinen, situationsunabhängigen Handlungsmustern erfaßt sind und zugleich damit am Objekt entsprechend allgemeine Eigenschaften in bestimmten mehr oder weniger zufriedenstellenden Ausprägungen erscheinen, kann aus dem zufällig in der Natur vorgefundenen Hilfsmittel ein bewußt gesuchtes und nach und nach auch selbst hergestelltes Arbeitsinstrument werden.
In seiner einfachsten Gestalt ist das Werkzeug auf einen einzelnen Handlungstyp bzw. auf die ihm entsprechende Objekteigenschaft bezogen, indem es als Hilfsmittel bei der zielgerechten Veränderung der an den Gegenständen vorgefundenen Ausprägungsgrade des betreffenden Merkmals dient. Das Arbeitsinstrument hilft hier nur bei der Veränderung des Inhalts und nicht der Form. Denn Form ist nie das Ergebnis des einzelnen Handlungsvollzugs, sondern immer Resultat einer gezielten Verknüpfung von mehreren Einzelaktionen.
Auf der untersten Stufe der Werkzeugverwendung liegt daher alle Formungsaktivität beim Arbeiter selbst bzw. bei der Arbeitsgruppe, wobei es darum geht, die mittels Werkzeug vollzogenen Einzelaktionen möglichst geschickt zu einer Gesamtaktivität (des individuellen Akteurs bzw. der Gruppe) zu verbinden, welche dann ihrerseits erst formenden Charakter aufweist. So ist etwa die mittels eines Hammers durchgeführte Oberflächenbearbeitung eines Steines durch den Steinmetz ein formprägender Handlungszusammenhang, der aus inhaltsbezogenen Teilaktivitäten (einzelnen Hammerschlägen) besteht.
Erst nach und nach wird auch die Formgebung selbst in das Arbeitsinstrument ausgelagert. Einfachstes Beispiel dafür ist die Präge- oder Gußform. Diese repräsentiert einen sehr primitiven Typ der gestaltgebenden Werkzeuge, dessen Anwendung nur dann möglich ist, wenn vorher die natürliche Formbeschaffenheit des zu bearbeitende Objekts zerstört wurde, was zum Beispiel im Fall des Tons durch Kneten und beim Metall durch Schmelzung geschieht.
Der wesentliche Unterschied zum einfachen inhaltsbezogenen Werkzeug besteht darin, daß die Präge- oder Gußform nicht mehr als Hilfsmittel eines isolierten Arbeitsgangs dient, sondern viele solcher Hilfsmittel für ebenso viele, miteinander kombinierte Tätigkeiten zu einem Gesamtobjekt verbindet, das als solches die aus den Einzelschritten bestehende Gesamttätigkeit eines einzelnen Arbeiters bzw. einer Gruppe von Arbeitern repräsentiert. In diesem Sinne kann man sich die Präge- oder Gußform als gegenständlichen Stellvertreter einer Gruppe von Akteuren vorstellen, die in vorher abgesprochener Weise alle gleichzeitig von außen und innen in einer ebenfalls zuvor abgesprochenen Stärke gegen das zu formende Material pressen.
Wollen wir voreilige Verallgemeinerungen vermeiden, dann müssen wir beachten, daß nicht jedes Werkzeug, welches viele Einzeltätigkeiten zu einer Gesamtaktion verknüpft, formgebend ist. So dient etwa ein Seil, an dem mehrere Arbeiter gemeinsam ziehen, bloß der punktförmigen Konzentration der nebeneinander ausgeführten Zugaktivitäten, die dadurch gleichsam zu einer Einzeltätigkeit verschmelzen. Die Anwendung eines solchen Zugseils hat somit nicht formgebenden, sondern inhaltsverändernden Charakter, verändert sie doch die räumliche Gesamtposition eines bestimmten Objekts und nicht dessen räumliche Form. Während beim Prägevorgang die Kraft eines einzelnen Arbeiters in die im gestaltgebenden Gefäß vergegenständlichten kooperativen Handgriffe vieler Arbeiter umgesetzt wird, verwandelt das Zugseil die Kräfte einer real vorhandenen Vielzahl von Arbeitern in die im Seil vergegenständlichte Einzelkraft eines virtuellen Gesamtarbeiters.
So kunstvoll die Gestalt der jeweiligen Präge- oder Gußform auch sein mag, als Vergegenständlichung eines zugrunde liegenden Tätigkeitsgefüges weist sie in allen Fällen ein äußerst simples Konstruktionsprinzip auf: Erstens sind die in ihr mit einander verknüpften Einzelaktivitäten durchwegs vom selben Typ (‚Pressen’). Zweitens erfolgt hier die Verbindung jener Einzelaktivitäten zu einer formgebenden Gesamtaktion auf eine völlig starre (nicht veränderbare) Weise, und drittens sind sämtliche durch dieses Arbeitsinstrument verkörperten Teilaktivitäten in der einfachsten aller möglichen Zeitstrukturen mit einander verbunden: alle durch die Prägeform ausgeübten Preßaktivitäten erfolgen nämlich gleichzeitig.
Die weitere Entwicklung der formgebenden Werkzeuge läuft darauf hinaus, daß immer komplexere Tätigkeitsgefüge bzw. Kooperationsstrukturen in den Arbeitsinstrumenten vergegenständlicht werden. Man könnte deshalb die gesamte Abfolge der drei industriellen Revolutionen der vergangenen 250 Jahre auch als eine Geschichte zunehmender Auslagerung der ursprünglich in der Arbeitserfahrung des einzelnen Akteurs und in den Kooperationsstrukturen der Arbeitsgruppe verankerten Formgebungskompetenz an die Maschinerie beschreiben.[57]
Die wichtigste diesbezügliche Errungenschaft der drei technischen Revolutionen ist der Automat. In ihm verbindet sich die bereits im Zeitalter der Manufaktur[58] sehr weit getriebene Zerlegung formkonstituierender Arbeitszusammenhänge in einzelne, von unterschiedlichen Arbeitskräften auszuführende Arbeitsschritte mit der Erfindung der Kraftmaschine. Während letztere, zunächst in Gestalt der Dampfmaschine, die zuvor von den Arbeitskräften selbst einzubringende Aktivität als objektiviertes Kraftsubstrat liefert, stellt die von der Maschine betriebene mechanische Apparatur des Automaten die Vergegenständlichung der formgebenden Tätigkeitsstruktur dar.[59]
Von der Prägeform unterscheidet sich der Automat dadurch, daß er nicht bloß einen einzigen Tätigkeitstyp (etwa das Pressen) verkörpert, sondern eine mehr oder weniger breite Palette von Aktivitäten beherrscht, die er in beliebiger zeitlicher Staffelung auszuführen vermag. So kann er etwa den von ihm zu bearbeitenden Gegenstand zunächst in bestimmter Position fixieren und zugleich auf gewisse Art (durch Schleifen, Pressen, Bohren, usw.) bearbeiten, worauf er dann die Position des Objekts ändert und einen nächsten, möglicherweise völlig anders gearteten Arbeitsschritt setzt. Die große Komplexität der auf diese Weise im Automat vergegenständlichten Handlungs- und Zeitstruktur ermöglicht es diesem, eine Formveränderung am Arbeitsgegenstand vorzunehmen, ohne daß zuvor dessen ursprünglich vorhandene Form zerstört werden muß. Die Formung erfolgt nun durch automatische Oberflächenbehandlung oder durch automatische Zusammenfügung von Teilobjekten.
Weitere Meilensteine der hier nicht im Detail nachzuzeichnenden Entwicklung der formgebenden Werkzeuge sind die programmierbaren Automaten, die Konstruktionscomputer sowie die Meß- und Regelungstechnik. Im ersten Fall haben wir es mit Werkzeugen zu tun, deren Handlungsrepertoire nicht nur komplex sondern auch flexibel ist, sodaß die Maschine den Objekten nicht bloß eine bestimmte, sondern eine Vielzahl von Formen aufprägen kann, wobei dem Akteur nur mehr die Aufgabe der Programmierung, also die vorab erfolgende Festlegung des die jeweilige Form erzeugenden Gefüges von Einzelaktionen, verbleibt, welche der Automat dann selbständig der Reihe nach bzw. gleichzeitig durchführt. Die Existenz von programmierbaren Automaten wird so zum augenfälligsten technischen Beleg dafür, daß sich die Erscheinung der Form durch die normierte Verknüpfung von Einzelhandlungen zu einem Handlungsgefüge konstituiert.
Wenn im einfachen und im programmierbaren Automaten nur die Ausführung der formgebenden Tätigkeit an die Maschinerie delegiert wird, so beteiligt sich die Maschine in Gestalt des Konstruktionscomputers selbst noch an der Planung dieser Aktivität. Dabei werden Dialogsysteme (Operator - Computer) mit entsprechender Hard- und Software eingesetzt[60], welche die Ideen des Konstrukteurs nicht nur bis hin zur fertigen, normgerechten Konstruktionszeichnung verwirklichen, sondern auch Automatenprogramme, Werkstoffauswahl und Materiallisten erarbeiten.
Automaten und Konstruktionscomputer verlagern zwar in immer höherer Perfektion die Tätigkeit der Erzeugung von Formen in die Maschinerie hinein. Sie vergegenständlichen dabei aber bloß die Konstitution der Form in ihrer allgemeinen Gestalt. Die tatsächliche Realisierung eines solchen allgemeinen Formgebildes im Zuge der Produktion, macht es jedoch erforderlich, die Allgemeinheit der betreffenden Form mit den aktuellen Produktionsbedingungen (Besonderheiten des jeweiligen Arbeitsmaterials, der Arbeitsumgebung, usw.) zu vermitteln, was dadurch geschieht, daß ein kontinuierlicher Vergleich zwischen den durch die Form repräsentierten Sollwerten und den jeweils erzielten Zwischenergebnissen des Arbeitsprozesses durchgeführt wird.
Während diese Aufgabe im Handeln des Menschen der Selbstreflexion zukommt, bei der das in den physikalischen Begriffen implementierte Komplementaritätsprinzip eine entscheidende Rolle spielt[61], wird die entsprechende Funktion in den automatischen Produktionssystemen durch die Meß- und Regeltechnik erfüllt. Diese konnte sich zwar in großem Umfang erst auf Basis des elektrotechnischen Wissens entfalten, wurde jedoch ansatzweise bereits im Zeitalter der ersten industriellen Revolution entwickelt.[62]
Alle zuletzt behandelten technischen Errungenschaften beziehen sich auf den Akt der Formgebung, der in zunehmendem Maße vom Menschen auf die Maschine übertragen wird. Sie repräsentieren damit nur die eine Seite der Entwicklung des Formgebungspotentials der Technologie. Deren andere Seite besteht darin, daß sich die formende Tätigkeit des Subjekts immer neue inhaltliche Bereiche erschließt. So wie es auf der kognitiven Ebene keine Inhalte gibt, die ohne Form auftreten, kennt damit zuletzt auch die Praxis keine Handlungsgegenstände mehr, die nicht der formenden Kraft des Subjekts in Gestalt von formgebender Technologie unterworfen werden.
Nachdem die Erschließung der gesamten toten Natur letztlich sogar die Umformung und Neubildung der elementaren Grundbausteine der Materie ermöglicht, setzt die Entwicklung von Sozialtechnologien, das Subjekt auch in die Lage, eine gezielte Neuformung der quasi naturwüchsig verfestigten Strukturen des eigenen gesellschaftliche Handelns vorzunehmen. Den letzten Schritt setzt dann die Biotechnologie, im Rahmen derer sich die formgebende Praxis schließlich zur Überformung der Baupläne des Lebens selbst aufschwingt.
6.7 Der Realitätsverlust des radikalen Konstruktivismus
Der im vorangehenden Abschnitt erwähnte objektiv idealistische Schein einer unabhängig vom Subjekt existierenden Formungskraft bleibt nur so lange aufrecht, wie die Verselbständigung der Form auf der zweiten Reflexionsebene bloß begrifflich vollzogen ist. Hat erst einmal auch die Praxis in Gestalt der zuvor behandelten formgebenden Technologien radikal mit der Entwicklung des formalen Denkens gleichgezogen, so entsteht die entgegengesetzte Illusion der Projizierbarkeit von beliebigen Formen auf gegebene Inhalte, welche schließlich im Konstruktivismus zu einer völligen Ablösung des Formbegriffs von seiner inhaltlichen Basis führt.[63]
Die Erfahrung einer nahezu unbegrenzten technischen Formbarkeit des Inhalts ist aber nur eine der gesellschaftlichen Voraussetzungen für diesen begrifflichen Verlust des Rückhalts der Form am Inhalt. Ergänzend treten hinzu die Ablösung einer von offen sichtbaren Klassengegensätzen geprägten Gesellschaft durch Produktionsverhältnisse, an deren Oberfläche eine bunte Palette von konkurrierenden Lebensstilen und Einzelinteressen erscheint, sowie die Globalisierung des Prozesses der Kapitalverwertung, welche auf dem Weg der Erzeugung einer einheitlichen Weltkultur zunächst die Vielfalt aller bestehenden kulturellen Traditionen in engsten Kontakt miteinander bringt.
Wenn der Formbegriff die Reflexion auf gewachsene Handlungsgefüge und Kooperationszusammenhänge repräsentiert, dann stellen die skizzierten Entwicklungen eine ganz neue Ausgangslage für das formale Denken dar. Denn dieses steht nun vor der Herausforderung, „mit der modernen Pluralität der Diskurse und den anhängigen Problemen des ‚Relativismus‘ des ‚Historizismus‘, der ‚Dekonstruktion‘ und des ‚anything goes‘ begrifflich zurande zu kommen“[64]. Wir wollen uns ansehen, wie man mit jener Herausforderung umgeht und werden deshalb nun untersuchen, mit welchen erkenntnistheoretischen Mitteln und welchen Konsequenzen für den Formbegriff der sogenannte ‚radikale Konstruktivismus’ jener Herausforderung gerecht werden möchte[65]. Erster Gegenstand der folgenden Analyse ist ein bereits in Abschnitt 2.5 im Zusammenhang mit dem Problem der Zeitkonstitution behandelter Artikel von Humberto R. Maturana, in dem der genannte Autor die Grundzüge seiner radikal konstruktivistischen Epistemologie umreißt.
Versucht man die in der genannten Publikation durch Maturana eingenommene Position in aller Kürze zusammenzufassen, dann kann man fünf Thesen formulieren:[66]
1. „Wir Menschen existieren in Sprache“. Unser Sprachhandeln ist also „eine Weise des Lebens in Koordinationen von Handlungen und nicht eine Weise, Züge einer unabhängigen Realität zu symbolisieren.“
2. All unsere Begriffe, wie etwa der des Objekts oder jener des Subjekts, dienen bloß der „konsensuellen Koordination von Verhalten“ und beziehen sich nicht auf eine entsprechend strukturierte außersprachliche Realität.
3. Die Vorstellung einer solchen Realität ist bloße Fiktion, „die wir Menschen erfunden haben, um das, was wir im Geschehen unseres Lebens als unsere Erfahrungen unterscheiden, so zu erklären, als ob dies unabhängig von unserem Tun existieren würde.“
4. Es gibt erwartete, also kohärente, und überraschende Erfahrungen, welche Unsicherheit erzeugen. In beiden Fällen entsteht die Erfahrung „spontan buchstäblich aus nichts, oder wenn man so will, aus dem Chaos, aus einem Bereich über den wir nichts aussagen können, was nicht in den Kohärenzen unserer Erfahrungen seinen Ursprung hätte.“
5. Erkenntnis führt somit nicht zur Übereinstimmung mit außersprachlicher Realität, sondern bloß zur Herstellung von Kohärenzen innerhalb der Erfahrung mit dem Ziel der Reduktion der vorhandenen Unsicherheiten. Es sind daher so viele Arten richtiger Erklärungen einer Sache möglich, „wie es für uns Menschen mögliche Bereiche von Kohärenz von Erfahrungen gibt.“
Wie bereits in 2.5 erwähnt, scheint es auf den ersten Blick so, als gingen Maturanas erkenntnistheoretische Überlegungen vom Begriff des Sprachspiels aus. Wir werden im weiteren Verlauf sehen, daß dem nicht so ist, können aber zunächst festhalten, daß er mit seinem Konzept des zirkulär immer nur auf sich selbst bezogenen Sprachhandelns einen Standpunkt einnimmt, der auch von der Transzendentalphilosophie geteilt wird - und zwar sowohl von deren introspektiv vorgehendem Zweig als auch von der beim Sprachspiel ansetzenden Tradition.
Beide Ansätze unterscheiden zwischen konstituiertem Sinn und sinnkonstitutiver Praxis. Diese wird zwar im ersten Fall als geistige Aktivität eines über sein Erleben reflektierenden Individuums und im zweiten als das mit Sprechen verbundene Handeln einer Gruppe von Akteuren aufgefaßt, ist jedoch beide Male streng selbstbezogen. So hat es das introspektiv wahrgenommene Bewußtsein immer nur mit seinen eigenen intentionalen Akten zu tun und nicht mit den durch diese Akte vorgestellten Objekten. Und auch für die Analyse eines Sprachspiels gehören die im Zuge der Beobachtung des Sprechens und Handelns zu beschreibenden Gegenstände, Vorgänge und Beziehungen nicht zu der von den Akteuren des Sprachspiels vorgestellten ‚objektiven Realität’, sondern fungieren bloß als Elemente des für die Entstehung jener Vorstellung konstitutiven Sprachspiels, weshalb man auch über das beim Sprachhandeln ablaufende Geschehen sagen kann, daß es immer bei sich bleibe.
Diese Möglichkeit zur methodischen Unterscheidung zwischen der Ebene der konstitutiven Praxis und der des konstituierten Sinns ist Voraussetzung für jede erkenntniskritische Betrachtung. Denn der Versuch einer Rekonstruktion von fragwürdig gewordenen Sinngehalten kann nur dann gewagt werden, wenn sich ein bestimmter Bereich der Erfahrung - eben jene Selbsterfahrung der konstitutiven Praxis - durch eine zumindest vorläufige Gewißheit auszeichnet, wenn also (um bei der Beobachtung des Sprachhandelns zu bleiben) die Elemente des sinnkonstitutiven Sprachspiels - seine Akteure, deren Handeln und Sprechen, sowie die Umstände, unter denen sie dies tun - in der Haltung eines naiven Realismus beschreibbar sind.
Es ist allerdings zu beachten, daß wir die Unterscheidung zwischen Konstituens und Konstitutum, so wichtig sie für alle transzendentalen Analysen ist, nicht verabsolutieren, indem wir uns der Illusion hingeben, unser Zugang zur erfahrungsbegründenden Praxis bestehe in einer Art von unmittelbar gegebenem Wissen. Schon bei Hegel werden wir nachdrücklich auf die Vermitteltheit des scheinbar Unmittelbaren hingewiesen[67]. Wir begreifen daher, daß der transzendentale Zirkel nicht durch die Voraussetzung eines Ursprungswissens, sondern immer nur durch vorläufige Annahme von vorübergehend dem Zweifel entzogenen Überzeugungen gelöst werden kann.
Maturana mißversteht zwar den rein methodischen und immer nur vorläufigen Charakter der Unterscheidung zwischen konstitutiver Praxis (Sprachspiel, Sprachhandeln) und konstituierten Sinngehalten nicht in dem Sinne, daß er einen der beiden Bereiche zum Gegenstand eines schlechthin unmittelbaren Wissens erklärt, aus dem sich alles Weitere ableiten läßt, begeht jedoch einen gewissermaßen noch gravierenderen Fehler. Dieser besteht darin, daß er das Verhältnis von Konstituens und Konstitutum als ein ontologisches Nebeneinander von zwei Existenzbereichen auffaßt[68], was ihn unweigerlich in einer der durch den Descartschen Dualismus von Sein und Bewußtsein[69] vorgezeichneten erkenntnistheoretischen Sackgassen landen läßt.
Er kann nämlich nun die in den Status eigenständigen Seins erhobene Ebene der Subjektivität (das Sprachhandeln) nicht mehr mit dem ebenfalls verdinglichten Objekt zusammenbringen, sodaß für ihn alle Erfahrungen der in ihrem Sprachhandeln selbstbezogen agierenden Akteure aus einem bloßen Nichts bzw. Chaos entstehen (These 4). Maturana grenzt sich damit vom Alltagsbewußtsein ab, das den Ursprung der Erfahrungen in einem entsprechend unseren Begriffen und Theorien strukturierten, subjektunabhängigen Sein sucht, welches für ihn nichts weiter als eine bloße Erfindung ist (These 3).
Wir wollen nun keineswegs den Realitätsbegriff des Alltagsbewußtseins gegenüber jenem Nichts bzw. Chaos verteidigen, das bei Maturana an die Stelle der Realität tritt. Es soll jedoch zweierlei behauptet werden: Erstens möchten wir darauf hinweisen, daß es zwischen diesen beiden Extremen so etwas wie einen vermittelnden Standpunkt gibt, welcher zwar nicht beansprucht, die Realität an sich erkennen zu können, aber doch davon ausgeht, daß es sich bei den vom Alltagsbewußtsein als real erlebten Basisstrukturen der Welt nicht um willkürliche Erfindungen bzw. bloße Fiktionen handelt, sondern um notwendige Annahmen, die den Akteuren durch die grundlegenden Ausgangsbedingungen ihres Handelns aufgezwungen werden. Zweitens wollen wir deutlich machen, daß Maturanas Reduktion der Realität auf das Nichts bzw. Chaos auf ihre Weise genauso unzutreffend ist wie der ontologische Realitätsbegriff des Alltagsbewußtsein.
Wir beginnen mit der Ausführung des ersten der beiden Punkte, wobei wir zunächst daran erinnern, bereits nachgewiesen zu haben, daß die objekthafte und kausale Strukturierung der den Akteuren erscheinenden Welt in einer inneren, unaufhebbaren Verbindung zur Form ihres Handelns steht. Der entsprechende Nachweis soll nun auch noch für die im Zentrum der Realitätsvorstellung des Alltagsbewußtseins stehende Eigenschaft der Subjektunabhängigkeit der erscheinenden Objekte erbracht werden.
Da sich alle Eigenschaften der Gegenstände nur vor dem Hintergrund der Ziele des jeweiligen Handelns zeigen, ist bei der transzendentalen Analyse der Erscheinung eines bestimmten Merkmals stets zunächst zu klären, in welchem Verhältnis seine Erfahrung zu den Zielen unseres Tuns steht. Wir müssen uns also im vorliegenden Fall fragen, in welchem Verhältnis das an den Gegenständen der Erfahrung wahrgenommene Merkmal der Subjektunabhängigkeit zu den Zielen unserer erfahrungskonstitutiven Tätigkeit steht.
Die Erinnerung an beliebige Beispiele objektbezogener Praxis macht zunächst deutlich, daß Realität bzw. Subjektunabhängigkeit im Unterschied zu allen übrigen Objekteigenschaften nicht im Zuge der Zielverwirklichung erfahren wird. Während wir nämlich etwa die Räumlichkeit des Gegenstandes im Verlauf unserer Bewegung, die Schwere beim Heben und die Härte im Drücken erleben, besteht die Realitätserfahrung darin, daß ein bestimmtes Ziel eben nicht auf die angestrebte Weise realisierbar (!) ist, weil der Gegenstand auf unser Handeln in einer unerwarteten Weise reagiert.
Der eigentliche Sinn unserer Rede von der Subjektunabhängigkeit bzw. Realität des Erfahrungsgegenstands, besteht also in dessen existenzbedrohender Unerbittlichkeit gegenüber unzutreffenden Erwartungen sowie den ihnen zugrunde liegenden falschen Begriffen und Theorien. Damit aber spiegelt sich in der fraglichen Eigenschaft unserer Erfahrungsgegenstände eine der unaufhebbaren Grundbestimmungen jeder Handlungssituation, woraus folgt, daß wir Maturanas These, sämtliche Strukturen der Realität des Alltagsbewußtseins seien bloß „erfunden“, zurückweisen müssen.
Wir schreiten nun weiter zur Kritik an Maturanas Reduktion dessen, was wir ‚Realität’ nennen, auf ein bloßes Nichts bzw. Chaos und halten zu Beginn der diesbezüglichen Auseinandersetzung nochmals fest, daß wir im Geschehen des Unerwarteten jenen Aspekt der erfahrungskonstitutiven Praxis gefunden haben, an dem sich das Realitätserlebnis entzündet.[70] Maturana kann diesen Stellenwert von unerwarteten Handlungsergebnissen für die Konstitution der Realitätserfahrung nicht korrekt bestimmen, da er jenes Handeln selbst, welches zu erwarteten oder unerwarteten Resultaten führt, unter verzerrtem Blickwinkel sieht. Wenn er nämlich unserem in den Erscheinungen verkörperten Wissen gemäß den Thesen 1 und 2 ausschließlich die Funktion zubilligt, das Handeln zu koordinieren, wobei es gemäß These 5 praktisch unendlich viele, gleichwertige Arten einer solchen Koordination geben soll, dann zeichnet er die Konturen einer Praxis mit völliger Beliebigkeit der Ziele.
Einem solchen Bild des erfahrungskonstitutiven Tuns ist das lebendige Subjekt abhanden gekommen. Die Akteure der von Maturana anvisierten Ebene des Sprachhandelns stehen nicht in einem Spannungsfeld zwischen ihren Bedürfnissen und deren sprachlicher Interpretation, sondern hängen wie antriebslose Marionetten an den Fäden ihrer Sprachgespinste. Anstelle von echten Bedürfnissen, die sich in mehr oder weniger angemessen formulierten Handlungszielen niederschlagen und im tatsächlichen Vollzug der Praxis dann eine mehr oder weniger vollständige Befriedigung erfahren, ist ihnen nur eine einzige Form der Bedürftigkeit geblieben: ihre Unsicherheit.
Und so ist es natürlich kein Zufall, wenn in der konstruktivistischen Psychologie etwa eines Paul Watzlawick der Begriff des Unbewußten keine Rolle mehr spielt.[71] Denn dieser Begriff markiert genau jenen Punkt, an dem das der Reflexion als sein eigener Gegenstand erscheinende Subjekt gewahr wird, daß neben den äußeren Objekten auch es selbst Bestandteil einer nicht gänzlich in der Sprache aufgehenden Realität ist: Als solches zwar nie direkt sondern nur über erinnerte Traumbilder, Ängste und Fehlleistungen des Alltagslebens erfahrbar, ist das Unbewußte keineswegs beliebig interpretierbar, setzt es sich doch gegen falsche Konstruktionen der Selbstwahrnehmung mit Krankheitssymptomen zur Wehr. Es kann damit als psychologischer Inbegriff des vorsprachlichen Bedürfnissubstrats der Akteure des Sprachspiels betrachtet werden.
Ist diese Bedürftigkeit der Handelnden, welche im Menschenbild Freuds genau wie in jenem von Marx noch im Sinne umfassender Notdurft eines aus Fleisch und Blut bestehenden Mangelwesens verstanden wurde, erst einmal in die sublimierte Gestalt des rein kognitiven Konzepts der Unsicherheit transformiert, dann wird auch das Erkennen aus seinem Zusammenhang mit den Bedürfnissen herausgelöst. Wo daher Habermas im Anschluß an die beiden eben genannten Denker noch von erkenntnisleitenden Interessen spricht[72], sieht Maturana nur mehr eine einzige Funktion des Erkennens: die Reduktion der Unsicherheit.
Aus dieser Fehleinschätzung des Ziels aller Erkenntnis resultiert ein Mißverstehen des Prozesses der Erfahrung bzw. der Konstitution der Erscheinungen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, daß letztere nichts anderes sind, als die entweder erwarteten oder unerwarteten Ergebnisse des Handelns. Werden nun die erfahrungskonstitutiven Sprachspiele von Akteuren mit beliebigen Handlungszielen, bzw. einer Bedürfnisstruktur von unendlicher Plastizität, gespielt, die nur von einem einzigen unverrückbaren Streben, nämlich jenem nach kognitiver Sicherheit getrieben sind, dann erscheinen unerwartete Handlungsergebnisse bloß als Brüche der Erfahrungskohärenz und haben nicht den ihnen tatsächlich im Alltag zukommenden Stellenwert eines Scheiterns.
Ausdruck dieser Beliebigkeit der Handlungsziele ist die durch Maturana vorgenommene (und durch die konstruktivistische Erkenntnistheorie bereitwillig akzeptierte) Reduktion des erfahrungskonstitutiven Handelns auf die Tätigkeit des Beobachtens.[73] Denn beim Beobachten kehrt sich die Relation zwischen dem Tun und der dabei konstituierter Erfahrung im Vergleich zum Alltagshandeln um: Während bei letzterem das Handlungsziel, also das erwartete Ergebnis deshalb von Relevanz ist, weil es einen bestimmten Stellenwert bezüglich der Befriedigung eines ihm zugrundeliegenden Bedürfnisses hat, ist das erwartete Ergebnis der Beobachtung nur als Erwartetes wichtig.
Zwar können auch Experimente scheitern, aber das Scheitern hat in diesem Fall nicht bedürfnisbezogene, existenzielle Wichtigkeit, sondern eben nur den Stellenwert eines Bruchs der im Lichte einer bestimmten Theorie gegebenen Kohärenz eines Erfahrungszusammenhangs. Wenn dagegen der Akteur des erfahrungskonstitutiven Sprachspiels nicht als bloßer Zuseher oder Experimentator, sondern als tätiges Wesen begriffen wird, verlieren die Handlungsziele ihre Beliebigkeit, während falsche Prognosen bzw. technische Umsetzungen, die nicht zu den erwarteten Ergebnissen führen, jene Dramatik gewinnen, die dem bloßen Experiment fehlt. Denn in der Ernstsituation des Alltags hat die Setzung falscher Ziele ein Selbstmißverständnis und die Umsetzung vorhandener Ziele in fehlerhafte Prognosen bzw. Techniken ein Scheitern der Befriedigung von Bedürfnissen zur Folge.
Natürlich wird hier keineswegs geleugnet, daß die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun im Zentrum dessen steht, was wir Subjekt nennen. Wir haben es dabei aber nicht mit der leidenschaftslosen Selbstbeobachtung eines sein Leben als bloßen Laborversuch auffassenden Experimentators zu tun, sondern mit der Reflexivität eines vom jeweiligen Handlungsergebnis unmittelbar betroffenen, und daher bei allem Tun unter unerbittlichem Wahrheits- und Erfolgszwang stehenden Akteurs.
Wenn man sich nun fragt, warum ein Denker wie Maturana, der doch als Biologe[74] ein gewisses Verständnis für die Härte des Überlebenskampfes aufbringen sollte, ein derart verzeichnetes Bild von der erfahrungskonstitutiven Praxis entwirft, dann kommt man zu dem Ergebnis, daß dafür paradoxerweise gerade der biologische Ausgangspunkt, bzw. die mangelnde Reflexion auf die versteckten theoretischen Implikationen desselben, verantwortlich zu machen ist.
Maturana begegnet nämlich jenen Implikationen mit einer geradezu unglaublichen Naivität, versucht er doch das uralte und scheinbar unausrottbare Vorurteil von der Voraussetzungslosigkeit der Erfahrungswissenschaft gegen den vermeintlichen Dogmatismus der Philosophie auszuspielen. So bekennt er sich etwa in der Einführung zu einer Sammlung seiner erkenntnistheoretischen Arbeiten zunächst ausdrücklich zu der Absicht, das Erkenntnisproblem als Biologe und nicht als Philosoph zu behandeln, um dann den Vorteil dieses Zugangs gegenüber der traditionellen philosophischen Epistemologie darin zu suchen, daß er als Erfahrungswissenschafter auch bei der Untersuchung des Erkennens nur „von Erfahrung spreche“ und somit im Unterschied zu den Philosophen „keinerlei transzendentale Voraussetzungen“[75] mache.
Der Hinweis auf die transzendentalen Voraussetzungen bezieht sich auf das Bild, welches alle einschlägigen Analysen vom erfahrungskonstitutiven Handeln zeichnen müssen. Wir haben bereits festgestellt, daß die Epistemologie diese Basis des Erkennens nur in naiv-realistischer Einstellung beschreiben kann, damit aber keineswegs einen wie auch immer gearteten Dogmatismus gemeint, sondern eine ganz spezifische Form der Erfahrungswissenschaft. Diese muß sich des gleichsam bloß ‚vorläufigen’, weil durch den transzendentalen Zirkel in Frage gestellten Stellenwerts all ihrer Einsichten jederzeit bewußt sein und darf daher weder mit der Überheblichkeit einer ontologisch überhöhten Wesensschau daherkommen, noch in die Scheinautorität einer Einzelwissenschaft flüchten.
Denn das Charakteristikum jener herkömmlichen Erfahrungswissenschaften besteht ja gerade darin, daß sie, vollauf beschäftigt mit der Erkenntnis ihrer Objekte, auf die Konstitutionsbedingungen des eigenen Begriffsapparates vergessen. Wird nun der Gegenstand der Erkenntnistheorie mittels der Kategorien einer solchen Wissenschaft beschrieben, dann überträgt man alle unausgesprochenen, axiomatischen Annahmen der betreffenden Disziplin, im vorliegenden Fall jene der Biologie, unbesehen auf das darzustellende erfahrungskonstitutive Handeln, wodurch dessen Bild auf ganz bestimmte Weise verzerrt wird.
Indem etwa Maturana den Akteur gemäß den paradigmatischen Voraussetzungen seiner Leitwissenschaft, der Biologie, als lebendiges System auffaßt, werden von ihm das Handeln und mit diesem auch die Sprache zur bloßen Systemfunktionen erklärt, was letztlich auf eine Ersetzung der transzendentalen Sprachspieluntersuchung durch biologische Systemanalyse hinausläuft.[76] Da nun aber das biologische System aufgrund der a priori geltenden Annahmen der Systemtheorie, als ein im Normalfall erfolgreich an seine Umwelt angepaßter Organismus aufgefaßt wird, ist damit die Problematik des Scheiterns sozusagen per definitionem wenn schon nicht ausgeklammert, so doch in einer der Situation des menschlichen Akteurs nicht adäquaten Form gestellt.[77]
Zwar trägt auch Maturanas Ansatz der Tatsache Rechnung, daß es einerseits verfehlte Anpassung und andererseits so etwas wie ein vom Ziel des Überlebens getragenes Ringen um erfolgreiche Anpassung gibt. Er trennt jedoch den zuletzt genannten Aspekt, in unreflektierter Anwendung eines weiteren biologischen Axioms, vom individuellen System ab und delegiert ihn an die Gattung bzw. die Evolution: Das individuellen Systems ist zwar per definitionem erfolgreich angepaßt - jedoch nur so lange, wie sich seine Umwelt nicht ändert.[78] Ist dies der Fall, dann geht das einzelne System zugrunde, denn eine Änderung im Modus der Anpassung an die jeweilige Umwelt ist im Reich der Biologie nur auf evolutionärem Wege möglich.[79]
Es gibt somit auch für die Biologie so etwas wie das Scheitern. Im Unterschied zum Handelnden geht jedoch das individuelle biologische System in seinem Scheitern zugrunde. Während die menschlichen Akteure aus ihrem Scheitern lernen, ist ein zu tiefgreifenden Verhaltensänderungen, sowie zur Umgestaltung der Umwelt führendes Lernen im biologischen Paradigma ausschließlich der Gattung vorbehalten. Das Scheitern hat damit für das biologische System einen völlig anderen Stellenwert als für den Handelnden, weshalb der biologistische Blick auf die Akteure der erfahrungskonstitutiven Sprachspiele notwendigerweise zu einer verfehlten Konzeption dessen führen muß, was ‚Realität’ heißt.
Sehen wir uns zunächst die Konstitution des Realitätsbegriffs bei Subjekten an, die nicht auf den Biologismus der „lebendigen Systeme“ reduziert sind. Da wir es in diesem Fall mit Handelnden zu tun haben, die in ihren Aktionen elementare Bedürfnisse befriedigen und dabei entweder erfolgreich sind oder scheitern, müssen wir davon ausgehen, daß sie den Einbruch des Unerwarteten in das Gefüge der im Zuge ihrer bisherigen Praxis aufgebauten Erwartungen im Normalfall als eine Beschränkung ihrer Absichten erleben. Sie erfahren damit, daß die durch ihre eigenen Erwartungen konstituierten Erscheinungen nicht ausschließlich von diesen Erwartungen abhängig sind, sondern zugleich auch etwas repräsentieren, das nicht sie selbst sind.
Diese Annahme eines ‚Etwas’, das sich an der in ihrem Scheitern erfahrenen Grenze zeigt, ist schon ein entscheidender Schritt mehr als die nackte Erfahrung des Scheiterns selbst: Es ist eine Interpretation, das heißt eine Auslegung jener Erfahrung vor dem Hintergrund eines bestimmten Modells. Das Modell, welches hier zum Tragen kommt, ist das der Kommunikation: Die Interpretation der im Scheitern erfahrenen Grenze als Ausdruck eines sich an dieser Grenze zeigenden Widerparts, der sich in seiner Erscheinung zwar äußert, aber nicht völlig in ihr aufgeht, ist angelehnt an die Erfahrung des sich in der Kommunikation enthüllenden, aber nie gänzlich preisgebenden Interaktionspartners.
Immer dann, wenn ein Akteur sagt, daß ein bestimmtes Objekt ‚ist’ und ihm dadurch Eigenständigkeit, also Realität, zuspricht, drückt er aus, wohl zu wissen, daß sich seine die betreffende Erscheinung konstituierenden Erwartungen als falsch erweisen können, weil er davon ausgeht, daß jene Erscheinung nicht nur durch diese Erwartungen bedingt ist, sondern Resultat eines Prozesses darstellt, den er als Kommunikationsvorgang zwischen sich selbst und einem sich ihm in der Erscheinung enthüllenden Gegenüber deutet.
Natürlich kann er diese kommunikative Relation zwischen sich und seinem Gegenstand in einem Akt der Reflexion selbst wieder zum Objekt machen. Aus dem sich in jener Kommunikation zeigenden Gegenüber wird dann ein ‚Sich Zeigen’ und an die Stelle des Objekts, das für ihn ‚ist’, tritt das Sein des betreffenden Gegenstandes. Er ist damit bei einer Form der Ontologie angelangt, die sich von den herkömmlichen Spielarten dieser Disziplin dadurch unterscheidet, daß sie in ihrer Rede vom Sein nicht versucht, das Objekt aus seinem Bezug zum Subjekt herauszulösen, sondern genau jene Beziehung zu ihrem eigentlichen Thema macht.
Da das kommunikative Wechselspiel zwischen dem Handelnden und seinem Objekt, bei dem sich der Gegenstand dem Akteur enthüllt, nichts anderes ist als dessen Tätigkeit, hat jene transzendentale Form der Ontologie ihren Bezugspunkt in der jeweiligen Praxis des Subjekts; wobei mit dieser Feststellung auch schon darauf hingewiesen ist, daß es nicht nur eine einzige transzendentale Ontologie gibt, sondern deren viele – weil sich ja in Abhängigkeit von den jeweiligen Aktionsbedingungen auch mannigfaltige Formen der Praxis bilden können.[80]
Wenn wir dem eben skizzierten Modus der Entstehung von Realitätserfahrung die Konstitution der Realität für das biologistisch verfremdete Subjekt gegenüberstellen, zeigt sich folgendes Ergebnis:
Wird das Wechselspiel von Scheitern und Lernen entsprechend dem biologischen Evolutionsparadigma aus der Betrachtung des individuellen Handelns ausgeklammert, dann hat das auf der Individualebene stattfindende Erkennen bzw. Wahrnehmen keinen unmittelbaren Bezug mehr zum Überleben sondern den Stellenwert eines bloßen Ordnens, dessen pragmatistische Funktion sich auf die Reduktion von Unsicherheit beschränkt. Während aber diesem Ordnen bei den natürlichen Organismen seine Kriterien jeweils artspezifisch vorgegeben sind, erweckt die Übertragung jener Betrachtungsweise auf das handelnde Individuum den Anschein, als ob der betreffende Akteur die Ordnungstätigkeit nach beliebigen Kriterien orientieren könnte und sich somit bloß wie ein mit seinem eigenen Leben experimentierender Beobachter verhielte.
Für einen solchen Experimentator wären alle in sich schlüssigen Interpretationen von Welt gleich richtig und alle an diesen Interpretationen orientierten Formen der Praxis gleich gut, da schon die bloße Kohärenz eines Systems von Erwartungen dem einzigen verbliebenen Ziel der Erkenntnis - dem Abbau von Unsicherheit - Genüge leistet. Was mit dieser Verstümmelung der pragmatistischen Dimension verloren geht, ist der eigentliche Sinn unserer Rede von der Wahrheit und damit auch der von Realität.
Denn einem Akteur, für den die Kriterien seiner Ordnung beliebig sind, erscheint im Unterschied zum vorher behandelten Fall auch das im Zuge des Erkenntnisprozesses zu Ordnende nicht als ein sich der Wahrheit fügender und dem Irrtum gegenüber widerborstiger Gegenspieler, sondern als bloße Unordnung, bzw. als ein „Chaos“ im Sinne von Maturanas These 4.
6.8 Ein vergeblicher Versuch zur Rettung der Realität
Radikale Positionen wie die Maturanas, welche die Realitätsvorstellung des Alltagsbewußtseins von der Selbstbezüglichkeit des Sprachhandelns her in Frage stellen, bleiben in der sehr facettenreichen erkenntnistheoretischen Diskussionen des Konstruktivismus durchaus nicht unumstritten. So wendet sich etwa Niklas Luhmann im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Zeichenbegriff[81] gegen ein Konzept des Sprachhandelns, welches die Beziehung zwischen den Zeichen und den durch diese bezeichneten Dingen kappt und damit letztlich darauf hinausläuft, „daß es nur Zeichen und nichts anderes gibt“. Aus seiner Sicht würde eine solche Theorie der „Zeichen ohne Referenz“ ihren eigenen Realitätsbezug aufheben, wäre doch in diesem Fall auch „der Begriff des Zeichens seinerseits ein Zeichen ohne Referenz ..., also ein Zeichen, das nur zum Ausdruck bringt, daß es keine Zeichen gibt.“[82]
Luhmann selbst möchte den Zeichenbegriff keinesfalls völlig von der Vorstellung eines durch das Zeichen Bezeichneten ablösen. Er geht vielmehr davon aus, daß das Zeichen für dessen Anwender erst durch den Akt der Unterscheidung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem zum Zeichen wird und prägt daher für seine eigene Position folgende Kurzformel: „Ein Zeichen ist die Differenz von Zeichen und Bezeichnetem (so wie: ein System ist die Differenz von System und Umwelt ...)“[83].
Beim Lesen dieser Zeilen entsteht die Hoffnung, Luhmann könnte mit der eben zitierten Formel eine Rettung des Realitätskonzepts gelingen. Rückt doch der hier angedeutete Zugang zur Sprache den Begriff des Zeichens in die Nähe des Begriffes der ‚Erscheinung’, für die im vorangehenden Abschnitt ein unauflöslicher Bezug auf ein sich zeigendes Objekt nachgewiesen wurde, sodaß die Erscheinung in Analogie zu Luhmanns Zeichenbegriff als Differenz von Erscheinung und Erscheinendem zu definieren wäre. Die Hoffnung erweist sich jedoch als trügerisch, denn die erkenntnistheoretischen Schlußfolgerungen, die Luhmann aus seiner Zeichentheorie zieht, stimmen in letzter Konsequenz weitgehend mit den epistemologischen Positionen Maturanas überein. Sie können folgendermaßen umrissen werden:
Ausgehend von einer Zurückweisung des ontologischen Ansatzes, welcher Welt als „die Gesamtheit der bezeichnenden und bezeichneten Dinge und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen begreift“[84], definiert Luhmann Welt als das, was durch den Akt des Bezeichnens in Bezeichnendes und Bezeichnetes gespalten wird. In diesem Akt grenzt sich das Subjekt, das auch bei Luhmann als System gefaßt wird, von seiner Umwelt ab und wird damit so wie das lebendige System Maturanas zum autonomen Schöpfer seiner ihm erscheinenden Welt: „Systeme selbst können gar nicht operieren, ohne eben dadurch Grenzen zu ziehen. Aber sie reproduzieren sich selbst, organisieren sich selbst, erzeugen mit ihren eigenen Operationen ihre eigenen Strukturen und ihre eigenen Grenzen.“[85]
Indem somit Luhmann einerseits Welt als jene Einheit begreift, die der vom System durchgeführten Selbstabgrenzung gegenüber einer ihm erst durch den Akt der Unterscheidung erscheinenden Umwelt vorausgeht, und andererseits allen Systemen vollständige Autonomie, um nicht zu sagen Beliebigkeit, bei der Wahl ihrer Grenzziehungen zugesteht[86], setzt er implizit die jeder Grenzziehung vorausgesetzte Einheit ‚Welt’ mit dem System selbst gleich. Letztlich wird damit das Objekt vollständig ins Subjekt hereingenommen, wodurch die in Luhmanns Definition des Zeichenbegriffs angelegte Analogie zum Konzept der Erscheinung, welches an der unaufhebbaren Differenz zwischen Subjekt und Objekt festhält, wieder zurückgenommen ist.
Diese Wendung ist uns aus der Geschichte der idealistischen Philosophie vertraut, hat sie doch gewisse Ähnlichkeit mit der Interpretation, die der transzendentale Ansatz Kants durch dessen Nachfolger Fichte erfuhr: Während Kant in seiner Rede vom ‚Ding an sich’ auf das subjektunabhängige Realitätssubstrat jeder Erscheinung hinweisen wollte, beseitigte Fichte jenen Dualismus von Subjekt und Objekt, indem er das ‚Ding an sich’ als das reine, absolute ‚Ich’ bestimmte, das sein eigenes Sein nur dadurch setzen kann, daß es sich von einem ‚Nicht-Ich’ unterscheidet. Dieser dem Fichteschen Subjekt innewohnende Drang, sich durch Unterscheidung von einem Objekt selbst zu definieren, findet sich nun auch bei den Luhmannschen Systemen wieder, die ohne Selbstabgrenzung nicht handlungsfähig sind.
Was führt nun aber dazu, daß Luhmann die zunächst von ihm durch die Gegenüberstellung von Zeichen und Bezeichnetem korrekt angesprochene Subjektunabhängigkeit des Objekts schließlich in eine vom System in völliger Autonomie durchgeführte Selbstdefinition auflöst? Wie im folgenden darzulegen ist, liegt der Grund hiefür darin, daß er genau wie Maturana (und unter expliziter Berufung auf diesen[87] ) Handeln als bloßes Beobachten auffaßt und nicht in seinem umfassenden Stellenwert als eine auf Bedürfnisbefriedigung bezogene und daher vom Scheitern bedrohte Aktivität begreift.
Gehen wir von jenem tatsächlichen Tun aus, dann haben wir die der Unterscheidung von Subjekt und Objekt vorausgesetzte Einheit im Gegensatz zu Luhmann nicht im Subjekt (bzw. System) selbst zu suchen, sondern in der glückenden Praxis, im Zuge derer das Subjekt ‚bei’ seinem Objekt ist und dieses daher nicht bewußt als sein Gegenüber erlebt. Anlaß und Ausgangspunkt für die Konstitution einer Erscheinung, das heißt für das Auseinandertreten von Subjekt und Objekt (bzw. von System und Umwelt), ist hier nicht ein autonomer Entschluß des Subjekts zur Selbstabgrenzung, sondern ein unbefriedigtes Bedürfnis oder das Scheitern eines zuvor erfolgreichen Handelns.[88]
Wenn wir uns im Folgenden auf den für das technisch-wissenschaftliche Weltbild besonders wichtigen Fall der Konstitution einer Erscheinung im Zuge des Scheiterns von erfolgsorientiertem Handelns konzentrieren, dann ist zu beachten, daß alles zielbezogene Tun immer nur jenen kleinen Ausschnitt der gesamten Handlungssituation kontrolliert, das heißt durch explizite Erwartungen ausleuchtet, der den unmittelbaren Absichten der jeweils aktuellen Aktivität entspricht. Es ist das der Bereich der Handlungssituation, welcher die bewußt wahrgenommene, durch Bezeichnung abgegrenzte Erscheinung des Objekts ausmacht. Die übrigen Umstände der Tätigkeit sind nur von impliziten Erwartungen betroffen. Letztere sind zwar jederzeit einer expliziten sprachlichen Interpretation zugänglich, bleiben aber von Reflexion und Beobachtung so lange ausgespart, also gleichsam eingeklammert, wie die auf die betreffenden Situationsaspekte bezogenen Handlungsvollzüge auch ohne direkte Zuwendung des Bewußtseins erfolgreich verlaufen.
Sobald jedoch jene impliziten Erwartungen enttäuscht werden, ist der Akteur gezwungen, das zunächst unerwartete Handlungsergebnis zu interpretieren (bzw. zu bezeichnen), wodurch er es gleichsam nachträglich zu einem erwartbaren Ereignis, bzw. einem sprachlich interpretierten Phänomen macht. Es geht dabei nicht darum, eine zunächst nur vorbewußte Erwartung bewußt zu machen. Vielmehr muß die gesamte Interpretation der Handlungssituation modifiziert werden, damit an die Stelle der soeben enttäuschten impliziten Erwartung zutreffende explizite Erwartung treten kann. Erst vor dem Hintergrund der so konstituierten Erscheinung des Objekts kann dann der Handelnde sein vorangehendes Scheitern begreifen, sodaß eine Umorientierung seines weiteren Tuns möglich wird.
Wenn Luhmann bei seinem Versuch der Bestimmung des Stellenwerts der Zeichen für das Subjekt auf Peirce verweist, welcher die dem Unterschied von Bezeichnendem und Bezeichnetem zugrundeliegende Einheit im „pragmatischen Bezug“ des Zeichens sah[89], nimmt er zwar die Spur jenes im Handeln liegenden Geheimnisses der Einheit von Subjekt und Objekt auf. Er kann der von Peirce vorgezeichneten Fährte jedoch nicht wirklich folgen, weil er den tatsächlichen Charakter der Aktivität von lebendigen Subjekten mißversteht.
Indem Luhmann nämlich Praxis von vornherein auf die Tätigkeit des Beobachtens reduziert, übersieht er, daß unser Tun, wie soeben erläutert, über weite Strecken aus sprachlosen Vollzügen besteht, in deren Verlauf sich kontinuierlich implizite Erwartungen erfüllen, sodaß wir ohne bewußtes Registrieren von Erscheinungen bzw. ohne Nutzung von Zeichen auskommen. Er verkennt damit, daß das in bewußter Wahrnehmung, das heißt im Unterscheiden von Bezeichnendem und Bezeichnetem, bestehende Beobachten immer schon auf glückendes Handeln verweist, im Zuge dessen sich das Subjekt nicht vom Objekt und das Bezeichnende nicht vom Bezeichneten unterscheidet.
Da Luhmann somit nicht bei der sich im Tun vollziehenden Einheit von Subjekt und Objekt ansetzt, muß er beim Betrachten des Handelns - aus seiner Sicht konsequent, tatsächlich jedoch völlig verkehrt - von der Differenz dieser beiden Pole ausgehen[90]. Wenn sich aber die Einheit von Subjekt und Objekt nicht innerhalb der Praxis selbst ereignet, dann kann man sie nur als einen allem Handeln vorausgesetzten Ausgangspunkt denken, was für Luhmann sehr schnell zu einem Problem wird. In einer auf diese Weise konstruierten Einheit fungieren nämlich Subjekt und Objekt nicht mehr als zwei gleichgewichtig aufgehobene Pole. Vielmehr ist hier die ‚Welt’, wie bereits erwähnt, in das Subjekt hineinverlagert, und zwar mit allen unangenehmen Folgen eines solchen Schritts:
Zunächst einmal muß Luhmann eingestehen, daß in seinem Konzept das Objekt „dem System operativ unzugänglich bleibt“[91], daß wir es also mit einer Welt ohne Objekte zu tun haben. Darüber hinaus bleibt natürlich in diesem Ansatz genau wie bei jenem Maturanas der Wahrheitsbegriff auf der Strecke[92], und zu guter Letzt geht dann auch noch das Subjekt verloren. Denn ein Akteur, dem sein Objekt operativ unzugänglich ist, da er es auf der Basis willkürlicher (weil auf den Wahrheitsanspruch verzichtender) Unterscheidungen abgrenzt und behandelt, der findet, wie ebenfalls bereits in der Diskussion von Maturanas Thesen festgestellt wurde, auch keinen Zugang zum eigenen Selbst.
Wenn nun aber Luhmann trotz dieser katastrophalen erkenntnistheoretischen Konsequenzen wegen seines verkürzten Praxisbegriffs nicht bei einer sich im Tun vollziehenden Einheit von Subjekt und Objekt ansetzen kann, sondern Handeln immer schon als ein Unterscheiden ansieht, wie bestimmt er dann jenen sich in der Praxis (sprich: im Beobachten) manifestierenden Unterschied? Da er ihn nicht ontologisch, das heißt als Referenz des Bezeichnenden auf ein externes Bezeichnetes begreifen will, hat er sich nach einer Art Ersatzlösung umgesehen, die er uns folgendermaßen präsentiert: „Ein operativ geschlossenes, Sprache verwendendes System kann sich auf der Ebene seiner Operationen nicht mit der Umwelt in Verbindung setzen. Insofern gibt es keine Referenz. Aber diese Unmöglichkeit wird intern dadurch kompensiert, daß das System in der Beobachtung seiner Operationen zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden kann, ja unterscheiden muß.“[93]
Was meint jedoch „Fremdreferenz“, wenn wir sie weder ontologisch noch pragmatistisch, also mit Bezug auf glückende oder scheiternde Praxis, verstehen sollen? Luhmann muß hier nach einer weiteren Krücke suchen und meint, sie im Sinnbegriff gefunden zu haben. Er möchte dabei die Chance nutzen, die sich daraus ergibt, daß der ehemals an die ontologische Referenzvorstellung „gebundene Begriff des Sinns frei geworden ist. Ein Zeichen hat ... keine Referenz, also, könnte man folgern, keinen Sinn. Aber der Sinnbegriff hat sich schon längst vom Referenzbegriff abgekoppelt und sich in der Phänomenologie neu formiert... (Letztere) beschreibt Sinn als einen Überschuß an Verweisungen über das hinaus, was jeweils aktuell intendiert ist“.
Luhmann greift diese Sichtweise auf, indem er Sinn „als Einheit der Differenz von Aktualität und Potentialität im Erleben oder Kommunizieren“[94] definiert und glaubt das Problem des verloren gegangenen Objektbezugs seiner Systeme damit gelöst zu haben, daß er die Fremdreferenz der Zeichen mit deren Überschuß an potentiellen Bedeutungen gleichsetzt.
Fassen wir unsere bisherige Auseinandersetzung mit Luhmann zusammen, dann können wir folgendes Zwischenergebnis festhalten: Während der transzendentale Pragmatismus die Frage der Referenz dadurch beantwortet, daß auf die in der glückenden Praxis immer schon verwirklichte Einheit von Subjekt und Objekt verweist, welche zunächst im Scheitern des Handelns partiell aufbricht, um dann durch wahre, das heißt wieder zu erfolgreichem Handeln führende Erkenntnis, neuerlich hergestellt zu werden, möchte Luhmann das Referenzproblem von vornherein innerhalb des Systems lösen.
Er blendet daher die im erfolgreichen Handeln immer schon realisierte Einheit des Subjekts mit dem Objekt aus seinen Überlegungen aus und setzt an die Stelle des Zerbrechens jener Einheit im scheiternden Handeln einen autonomen Abgrenzungsakt des Systems, durch den dieses sich gewissermaßen selbst in Bezeichnendes und Bezeichnetes spaltet. Dieser Ansatz birgt für ihn jedoch ein großes Problem: Da jede auch nur irgendwie sinnvolle Definition von Referenz auf die Vorstellung der Subjektunabhängigkeit des Objekts Bezug nimmt, muß er nach Differenzierungsakten innerhalb des Systems suchen, welche Bedeutungsgehalte konstituieren, die an die Stelle jener Subjektunabhängigkeit treten können. Er glaubt sie in den beiden gleichgesetzten Unterscheidungen von Selbst- und Fremdreferenz bzw. Aktualität und Potentialität gefunden zu haben.
Die folgende Analyse der von Luhmann angebotenen Ersatzlösung des Referenzproblems wird zwar zeigen, daß sich mit diesen beiden von jedem System intern vollzogenen Unterscheidungen die den Realitätsbegriff kennzeichnende Vorstellung einer Subjektunabhängigkeit des Objekts nicht rekonstruieren läßt. Zunächst ist jedoch festzuhalten, daß die Behauptung eines für alle Systeme bestehenden Zwangs zur Selbstabgrenzung, auf der jene Ersatzlösung aufbaut, völlig richtig ist. Luhmanns Fehler liegt bloß darin, diesen Zwang nicht genau genug zu bestimmen. Er übersieht zum einen, daß es mehrere, von ihm zum Teil nicht klar genug auseinandergehaltene, zum Teil nicht entdeckte Motive sind, die das System zur Grenzziehung bzw. Unterscheidung drängen. Zum anderen entgeht ihm, daß wir es entsprechend dieser Differenziertheit der Abgrenzungsmotive auch mit mehreren von einander zu unterscheidenden Arten der Grenzziehung zu tun haben.
Wenn wir die diesbezügliche Untersuchung mit der nötigen Genauigkeit durchführen, können wir ausgehend von dem im Zuge unserer bisherigen Ausführungen entwickelten Konzept des Handelns drei Arten der Grenzziehung mit drei entsprechenden Abgrenzungsmotiven unterscheiden:
Das erste Motiv des Subjekts, sich vom Objekt abzugrenzen, resultiert aus der Enttäuschung von expliziten oder impliziten Erwartungen, bezieht sich also auf die Situation des scheiternden Handelns. Wie bereits im vorangehenden Abschnitt aufgezeigt, erlebt der Akteur in diesem Fall das Objekt als eine von ihm unabhängige Instanz, die sich seinen Absichten nicht ohne weiteres beugt, weshalb er generell die für ihn gegebene Erscheinung des Objekts vom tatsächlichen Gegenstand (Ding an sich), bzw. das Bezeichnende vom Bezeichneten unterscheidet.
Der zweite Grund zur Abgrenzung gegenüber dem Objekt entsteht aus der Notwendigkeit, im Zuge des zielorientierten Handelns neben dem Objekt kontinuierlich zugleich auch sich selbst zu beobachten. Ermöglicht wird dies durch die Komplementärstruktur der auf den Gegenstand bezogenen Begriffe[95], welche sicherstellt, daß in jedem durch den Akteur registrierten Bild seines Gegenstandes jeweils auch ein gleichsam unsichtbares Abbild des Betrachters enthalten ist, sodaß also etwa die am Objekt beobachtete Aktivität auf eine entsprechende Passivität des wahrnehmenden Subjekts verweist.
Der in diesem Komplementaritätsprinzip der Wahrnehmung begründeten Möglichkeit zur kontinuierlichen Selbstspiegelung des Subjekts an seinem Objekt entspringt nicht nur das Motiv des oben zitierten Fichteschen Ichs, sich in Ich und Nicht-Ich zu spalten. Auf ihr fußt auch die von Luhmann für das System konstatierte Notwendigkeit, sich von seiner Umwelt zu unterscheiden, bzw. der von ihm richtig erkannte Zwang zur Differenzierung von Selbst- und Fremdreferenz.
Daß es sich dabei um eine völlig andere Art der Unterscheidung vom Objekt handelt als bei der Differenzierung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem (bzw. zwischen Erscheinung und Ding an sich), wird deutlich, wenn wir die jeweils verschiedenen Funktionen dieser beiden Selbstabgrenzungen im Prozeß der Objekterkenntnis beachten.
Erinnern wir uns zu diesem Zweck zunächst daran, daß der Akteur gemäß der im Äquivalenzprinzip ausgesprochenen Grundregel aller Erkenntnis, das Unbekannte auf das Bekannte zurückzuführen, das Objekt immer als einen Kommunikationspartner betrachtet und demzufolge auch entsprechend behandelt. Damit ist für ihn jede Wahrnehmungs- und Erkenntnissituation von vornherein als Kommunikationsbeziehung definiert. Nun sind aber alle derartigen Beziehungen durch zwei nicht aufeinander reduzierbare Strukturmerkmale gekennzeichnet: Zum einen stehen die Interaktionspartner zu einander stets in einem Verhältnis der Komplementarität, denn erst dadurch bilden sie gemeinsam eine aktionsfähige Handlungseinheit. Zum anderen muß jeder der beiden Partner innerhalb dieser Einheit seine Selbständigkeit wahren, da man andernfalls gar nicht von einer Beziehung zweier unterschiedlicher Subjekten sprechen könnte.
Die Eigenschaft der Selbständigkeit darf daher weder bei der Betrachtung der Interaktionsbeziehung noch bei der Analyse der nach ihrem Vorbild konstituierten Erkenntnis- bzw. Wahrnehmungsrelation zwischen Subjekt und Objekt durch das Merkmal der Komplementarität ersetzt werden, und auch der umgekehrte Reduktionsversuch wäre zurückzuweisen. Denn weder verbindet sich mit der Komplementarität der wechselseitigen Erwartungen und Verhaltensweisen der Interaktionspartner ‚automatisch’ deren Selbständigkeit noch führt die Selbständigkeit dieser Partner unmittelbar zur Komplementarität.
Weil somit gelingende Kommunikation immer beides zugleich sicherzustellen hat und daher auch in der Beschreibung der Grundstruktur der Wahrnehmungs- und Erkenntnisbeziehung stets beide Komponenten gesondert zu berücksichtigen sind, ist Luhmanns Versuch, die Relation von Bezeichnendem und Bezeichnetem (bzw. von Erscheinung und Ding an sich) durch jene von Selbst- und Fremdreferenz zu ersetzen, zurückzuweisen. Das vorliegende Angebot zur Lösung des Referenzproblems kann die eigentliche Bedeutung der Rede von der Subjektunabhängigkeit des Gegenstandes nicht erklären und verfehlt damit eine wesentliche Dimension unserer Objekterfahrung.
Wenden wir uns nun dem dritten Aspekt der Abgrenzung des Subjekts vom Objekt zu. Um ihn zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, daß sich der Akteur mittels des soeben behandelten Komplementaritätsprinzips immer nur über sein jeweils aktuelles Tun im Objekt spiegelt. In der auf Basis der Unterscheidung von Fremd- und Selbstreferenz kontinuierlich durchgeführten Selbstreflexion kann sich das Subjekt daher stets bloß punktuell erfassen. Schon bei unserer Analyse der Zeitstruktur des Handelns[96] und auch im Zuge der vorangehenden Überlegungen zum Begriff der Form sind wir jedoch zu dem Ergebnis gekommen, daß sich die Selbstreflexion des Akteurs immer auch in die zeitliche Tiefe (vergangene und künftige Handlungen) und in die Möglichkeitsdimension (potentielles Tun) hinein erstreckt.
Während die zuvor behandelte, jeweils momenthafte Spiegelung des Akteurs im Objekt auf der Komplementärstruktur der Begriffe fußt wird die Ausweitung seiner Selbstreflexion auf den Gesamtumfang des Handlungshorizonts dadurch gewährleistet, daß es sich bei den Begriffen, mittels derer die Handlungsgegenstände interpretiert werden, niemals um bloß punktuelle Erwartungen bezüglich des Interaktionspartners ‚Objekt’ handelt, sondern stets um umfassende Erwartungssysteme.[97]
Rückt nun ein bestimmtes Objekt in den Brennpunkt einer aktuellen Handlung, dann liegen derselben nicht nur jene expliziten Erwartungen zugrunde, welche die für das unmittelbar bewußte Handlungsziel relevanten Reaktionen des Gegenstands anvisieren. Die betreffenden Hypothesen sind vielmehr verknüpft mit der Gesamtheit aller übrigen Erwartungen, die den jeweiligen Begriff des Gegenstandes konstituieren. Letztere bleiben zwar bei der genannten Aktion vorbewußt, können aber bei Bedarf (etwa im Fall ihrer Enttäuschung) bzw. im weiteren Verlauf der Operation jederzeit bewußt gemacht werden.
Wir haben es also hier mit jenem Wechselspiel von Aktualität und Potentialität zu tun, das Luhmann mit dem Begriff des Sinns belegt. Es ist ihm durchaus zuzustimmen, wenn er dieses Wechselspiel unter dem Gesichtspunkt einer Abgrenzung des Subjekts von seinem Objekt behandelt. Denn worin unterscheidet sich die Aktualität des Subjekts von seiner Potentialität? Erstere wird durch die Kommunikation mit dem Objekt bestimmt und ist damit zu gleichen Teilen die Gegenwart des Handelnden und seines Gegenstandes. Das Verlassen der Aktualität bzw. der Eintritt ins Reich der bloßen Möglichkeit ist dagegen eine Aktivität, im Zuge derer sich das Subjekt von der tatsächlichen Interaktion mit dem Objekt distanziert. Luhmanns Irrtum liegt daher im vorliegenden Fall nur darin, daß er beide Arten der Selbstabgrenzung des Akteurs von seinem Gegenstand, die Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz einerseits bzw. von Aktualität und Potentialität andererseits, nicht klar genug von einander abhebt.
Erst die Gesamtheit aller drei von uns unterschiedenen Aspekte der Abgrenzung des Handelnden von seinem Objekt konstituiert das, was wir im Alltag unter einem ‚Ding’ verstehen. Denn erst in ihrem Miteinander ergeben sie das Bewußtsein eines selbständigen, sich in Komplementarität zum Akteur und zu den anderen Objekten verhaltenden Gegenstandes, dessen Realität nicht in der jeweils aktuellen Erfahrung von ihm aufgeht, sondern neben zeitlicher Tiefe auch eine Potentialität umfaßt, die sich nicht in der aktuellen Erfahrung sondern erst bei allfälliger Ausführung von derzeit bloß möglichen Aktivitäten des Subjekts erschließt.
Es ist daher nicht statthaft, den ersten der drei Abgrenzungsaspekte durch die beiden anderen zu ersetzen und wir müssen auch, genauer als dies bei Luhmann geschieht, zwischen dem zweiten und dritten Aspekt der Selbstunterscheidung des Subjekts vom Objekt differenzieren, da in beiden Fällen jeweils ganz verschiedene Aspekte der Erfahrung dessen konstituiert werden, was wir als einen Gegenstand bezeichnen.
6.9 Der konstruktivistische Formbegriff
Verfahren wir bei der Rekonstruktion der Erscheinung des Gegenstandes so wie Luhmann, dann beschert uns das nicht nur den schon bei Maturana konstatierten Verlust der Subjektunabhängigkeit des Objekts, sondern auch eine einschneidende Veränderung im Stellenwert des Begriffs der Form. Dieser verliert dadurch nämlich, wie bereits erwähnt, seinen Rückhalt am Gegenbegriff des Inhalts[98]. Denn letzterer ist untrennbar mit eben jener Vorstellung eines Realitätssubstrat von Erfahrung verbunden, das dem Konstruktivismus immer wieder unter den Händen zerrinnt.
Säubert man den Begriff des Inhalts von diesem Realitätsbezug, dann fällt er zusammen mit der durch Luhmanns Sinnbegriff angesprochenen Summe aller aktuellen oder potentiellen Bewußtseinsinhalte des Subjekts und wird damit zu einer rein systemimmanenten Größe. Luhmann präsentiert uns diese als eine Gesamtheit von lose verknüpften Elementen, welche er „Medium“ nennt. Die nur lockeren Verbindungen zwischen den einzelnen Bestandteilen jenes Mediums können nach Belieben verfestigt und dann später wieder gelöst werden, um neuen, festen Verbindungen Platz zu machen.
Luhmann bezeichnet diese vom System geknüpften und wieder auflösbaren Bande zwischen bestimmten Elementen seines Universums an Erlebnissen und Vorstellungen als „Formen“[99], was auf den ersten Blick durchaus dem in der vorliegenden Untersuchung entwickelten Ansatz nahe zu kommen scheint. Denn auch für uns ist das, was wir als ‚allgemeine Form’ bzw. als ‚Begriff’ bezeichnen[100], eine bis auf Widerruf feste und bei Bedarf aktualisierbare Verbindung von Elementen, wobei wir allerdings letztere als die im kollektiven Prozeß der Regelbefolgung aufgebauten Erwartungen bestimmen, welche nur im individuellen Bewußtsein der an den Regeln orientierten Akteure die Gestalt von bestimmten Vorstellungen bzw. Erlebnisinhalten annehmen.
Während jedoch der transzendental-pragmatistische Ansatz der menschlichen Gewißheit Rechnung trägt, daß das Objekt widerborstig ist, sich also gegen unangemessene Versuche des Begreifens zur Wehr setzt, indem es ein Scheitern des an den betreffenden Begriffen (bzw. Formen) orientierten Handelns auslöst, ist der lose Charakter der im Rahmen des Luhmannschen Mediums zwischen den einzelnen Erlebnismomenten bestehenden Beziehungen für die Bildung von beliebigen Begriffs- bzw. Formverbindungen offen, wodurch die Dialektik von Form und Inhalt ruhig gestellt wird.
Will man den Begriff des Mediums auf transzendental-pragmatistische Weise interpretieren, dann muß man das Medium in buchstäblicher Bedeutung als Mittler, das heißt als die erfahrungskonstitutive Praxis des Subjekts verstehen. Die einzelnen Begriffe bzw. allgemeinen Formen repräsentieren dann Erwartungszusammenhänge, die sich auf bestimmte Muster des erfahrungskonstitutiven Handelns beziehen. In diesem Sinne ist zum Beispiel die Praxis der Bewegung jenes Medium, in dem sich die Erfahrung des Raumes bildet. Den allgemeinen räumlichen Formen der Gegenstände entsprechen dabei ganz bestimmte Bewegungsmuster des Akteurs, sodaß etwa die Erfahrung einer geraden Linie im Zuge einer Bewegung ohne jegliche Richtungsänderung gemacht wird, während die Wahrnehmung einer Kreislinie komplementär zur Selbsterfahrung einer Eigenbewegung mit völlig gleichmäßigen, kontinuierlichen Richtungsänderungen entsteht.
Der auf Basis einer solchen Vorstellung des „Mediums“ entwickelte transzendental-pragmatistische Formbegriff hat im Unterschied zum konstruktivistischen Konzept der Form nicht alle Brücken zum Gegenstand abgebrochen. Wenn wir nämlich einerseits allgemeine Formen auf allgemeine Handlungsmuster beziehen und andererseits davon ausgehen, daß das Subjekt in seiner glückenden Praxis zumindest vorübergehend eins mit seinem Objekt ist, dann repräsentiert die uns erscheinende individuelle Form jenes Gegenstands nichts anderes als die Sequenzen des auf ihn bezogenen erfolgreichen Tuns. Die Begriffe bzw. Formen erhalten auf diese Weise transzendentalen, also erkenntnis- und seinsbegründenden Stellenwert im Sinne des im Abschnitt 6.7 entwickelten Begriffs von transzendentaler Ontologie und sind damit keine beliebig austauschbaren Ordnungsvarianten, sondern Weisen der Erscheinung eines von uns im Zuge der Praxis zu erschließenden Seins.
Der dem gegenüberstehende vollständige Relativismus des Formkonzepts der Konstruktivisten kommt nirgends deutlicher zum Ausdruck als in der geradezu kultischen Begeisterung vieler Vertreter der genannten Denkschule für George Spencer Browns „Laws of Form“[101], die wir nun zum Abschluß unserer Reflexion über den Formbegriff etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen.
Spencer Brown untersucht in der genannten Studie auf äußerst scharfsinnige Weise die Erzeugung von Ordnung durch die Tätigkeit des Unterscheidens, und es mag zunächst scheinen, als gäbe er eine durchaus differenzierte Antwort auf die Frage, ob den von ihm analysierten Unterscheidungsakten transzendental-pragmatistischer, also auch seinsbegründender Stellenwert beizumessen sei, oder ob ihnen ausschließlich erfahrungskonstitutive Funktion zukomme. Notiert er doch in einem seiner zahlreichen Vorworte zu den „Laws“ folgendes:
„Obwohl alle Formen und somit alle Universen möglich sind, und jede besondere Form veränderlich ist, wird es offensichtlich, daß die Gesetze, die solche Formen in Beziehung bringen, die selben für jedes Universum sind. Es ist diese Selbigkeit, die Idee, daß wir eine Realität finden können, die unabhängig ist davon, wie das Universum tatsächlich erscheint, die dem Studium der Mathematik solche Faszination verleiht.“[102]
Brown spricht somit einerseits von einer unbeschränkten Vielzahl möglicher Universen, was eine subjektivistische, auf bloße Erfahrungskonstitution abstellende Interpretation der „Laws of Form“ nahelegt. Andererseits betont er die identische Grundstruktur all jener Welten und sieht in ihr den Hinweis auf eine der Vielfalt alternativer Erscheinungsformen zugrunde liegende identische Realität, was man wohl als Andeutung eines seinsbezogenen Anspruchs der von ihm durchgeführten Analyse verstehen kann.
Die Rezeption der Konstruktivisten wehrt jene Andeutung eines realitäts- bzw. seinsbegründenden Gehalts der „Laws“ ab und nimmt ausschließlich das Motiv der Erfahrungskonstitution wahr. Für diese subjektivistische Lesart betreffen „die ‚Gesetze der Form‘ ... Operationen der Konstruktion von Formen“, was als gleichbedeutend damit angesehen wird, daß der Autor der „Laws“ darauf verzichte, „der Fülle der Erscheinungen und der Fülle der Erkenntnisse Formen vorzugeben, denen diese jeweils schon genügen müssen, um sein zu können, was sie sind.“[103]
Unsere bisher gewonnenen Einsichten in den Konstitutionsprozeß legen eine gegenläufige Auslegung der „Gesetze der Form“ nahe: Wir halten am transzendental-pragmatistischen Potential der „Laws“ fest und sehen daher in ihnen den Versuch einer Analyse jenes Prozesses der Konstitution von Formen mit Seinscharakter, der uns im weiteren Verlauf unserer Untersuchung noch mehrfach beschäftigen wird.[104] Auf Basis dieser Interpretation kritisieren wir jedoch Browns Vorstellung, daß sich das von ihm erkannte Realitätssubstrat jenes formalen Aufbaues der Welt mit einer in die Beliebigkeit abdriftenden Vielfalt von konkreten Formgestalten verbinde.
Anliegen dieses Einwands ist natürlich nicht die Leugnung der offensichtlichen Mannigfaltigkeit von bestehenden bzw. möglichen Universen. Vielmehr geht es um den Hinweis darauf, daß die unterschiedlichen Welten verschiedenen Arten der Praxis entsprechen, und daß jede dieser Handlungsformationen unter Erfolgszwang steht bzw. mit dem Problem des Scheiterns ringt, weshalb es immer so etwas wie glückendes Handeln gibt, bei dem das jeweilige Subjekt mit seinem Objekt vereint ist. Wird dieser Umstand berücksichtigt, dann verlieren die einzelnen Universen ihre Beliebigkeit, was gleichbedeutend damit ist, daß die in ihnen möglichen Erfahrungen Seinsbezug im Sinne der transzendentalen Ontologie[105] gewinnen, während die auf jenen Erfahrungen fußenden Aussagen wahrheitsfähig werden.
Wichtigster Beleg dafür, daß Brown auf den von ihm selbst angedeuteten seinsbegründenden Anspruch seiner „Laws“ letztlich verzichtet, ist nicht der in der bereits zitierten Vorwortpassage enthaltene Hinweis auf die Vielheit möglicher Formgestalten, sondern die zentrale These des ersten Abschnitts des Haupttextes. Letztere besteht in der Behauptung, daß wir eine Unterscheidung treffen, weil die zwei dabei von uns unterschiedenen Inhalte verschiedenen Wert für uns haben[106]. Der Haken dieser Aussage liegt darin, daß die betreffenden Inhalte für uns nur dann unterschiedlichen Wert besitzen, wenn wir sie zuvor bereits verschieden bewertet haben, was nicht ohne ihre Unterscheidung als Inhalte möglich ist.
Geht man von der zuvor präsentierten konstruktivistischen Interpretation aus, die in den „Laws“ eine Analyse der allgemeinen Gesetze von willkürlichen Ordnungen ohne jeden Anspruch auf Realitäts- bzw. Seinscharakter sieht, dann kann man diese vertrackte logische Struktur der Anfangsbehauptung als Ausdruck davon deuten, daß Brown die Ausgangsunterscheidungen des Subjekts aus seinen Überlegungen ausklammert, weil er sie als Resultat einer willkürlichen Entscheidung auf Basis einer nicht weiter zu untersuchenden subjektiven Wertebasis des Akteurs ansieht. Lesen wir das Werk dagegen unter transzendental-pragmatistischem Blickwinkel, dann ist jene Anfangsbehauptung als schlechter, weil vermeidbarer Zirkel zu kritisieren.
Bei oberflächlicher Betrachtung zeigen der transzendentale Zirkel[107] und Spencer Browns Ausgangsthese eine ähnliche Struktur. Wenn es im ersten Fall darum geht, daß jedes Wissen auf bereits vorhandene Gewißheit verweist, haben wir es im zweiten Fall mit einer Unterscheidung zu tun, die nur deshalb möglich ist, weil zuvor bereits unterschieden wurde. Während sich aber beim transzendentalen Zirkel Wissen und Gewißheit auf zwei vorübergehend von einander methodisch getrennte Sphären (Konstitutum und Konstituens) beziehen[108], ist es bei Brown immer dieselbe Unterscheidung, die schon getroffen sein muß, um getroffen werden zu können, was offensichtlich unsinnig ist!
Dieser Zirkel wird vermeidbar, wenn man im Gegensatz zu den „Gesetzen der Form“ nicht vom Akt der Unterscheidung ausgeht[109], sondern von jener Handlungssituation, in welcher der Akteur eben nicht unterscheidet, weil sein Handeln mit selbstverständlicher Routine glückt, was sich darin äußert, daß die Reaktionen der Umwelt laufend seine impliziten Erwartungen bestätigen.
Fragen wir nun danach, wieso der Akteur in dieser Situation eine Unterscheidung trifft, dann müssen wir nicht auf ein bestimmtes Motiv bzw. auf eine vorgängige unterschiedliche Bewertung der betreffenden Inhalte rekurrieren. Wie bereits zuvor in der Kritik an Luhmann dargelegt, geht nämlich hier die ‚Initiative’ zur Unterscheidung im Gegensatz zu Spencer Browns Ansicht, daß es keine Unterscheidung ohne ein Motiv geben könne, überhaupt nicht vom Handelnden selbst aus, sondern von dessen Objekt, das aus zunächst unerfindlichen Gründen unerwartete Reaktionen zeigt.
Die Tätigkeit des Unterscheidens besteht daher zunächst überhaupt nicht in der Differenzierung zwischen zwei bestimmten Inhalten, die infolge ihrer verschiedenen Bewertung von einander abgehoben werden, sondern in der Aufspaltung der Erfahrung in implizit Erwartetes und Unerwartetes. Dieses Unerwartete findet dann jene Aufmerksamkeit des Akteurs, welche für die bewußte, also reflexive Wahrnehmung von Inhalten vorausgesetzt ist. Der Inhalt konstituiert sich somit immer erst in einem durch das Objekt selbst provozierten Akt der Unterscheidung und ist dem Unterscheiden daher niemals vorausgesetzt.
6.10 Von der Seinsart der Gegenstände der Mathematik
Rufen wir uns stichwortartig die Hauptetappen des bisherigen Argumentationsgangs im vorliegenden sechsten Teil unserer Reflexionen ins Gedächtnis, so ist zunächst an die einleitende Betrachtung der Begriffe und Kategorien zu erinnern. Ein wichtiges Element der Analyse dieser grundlegenden Strukturierungsprinzipien der Erfahrung war die Untersuchung der Kategorie der Relation. Wir beschäftigten uns dabei unter anderem mit der Differenz zwischen qualitativen und quantitativen Relationen und stießen in diesem Kontext auf das Konzept einer dem ‚Inhalt’ gegenüber stehenden ‚Form’, mit dem wir uns schließlich etwas eingehender auseinandersetzten.
Die allen Reflexionen über die der Erscheinung der Form zugrunde liegende Unterscheidung von qualitativen und quantitativen Relationen setzte ein implizites Verständnis für das voraus, was man als Quantität bezeichnet. Wenn wir uns nun anschicken, dieses Verständnis durch die Analyse der Konstitution des Erfahrens von Quantitäten explizit zu machen, dann sind wir bei einem für unsere Untersuchung zentralen Thema angelangt. Denn die damit gestellte Frage zielt direkt auf die erkenntnistheoretische Basis des mathematischen Zugangs zur Physik.
Unser Schlüssel zum Einstieg in die genannte Thematik ist ein Gesicht. Es ist das Gesicht des Physikers, der von einem Laien um die Erklärung eines komplexen physikalischen Problems gebeten wird. Dieses Gesicht lächelt - etwas gelangweilt, ein wenig herblassend, vielleicht mitleidig, auf jeden Fall aber unendlich überlegen. Denn der Träger dieses Gesichts weiß, daß sein Gegenüber letztlich keine Chance hat, das gestellte Problem zu verstehen, weil in der modernen Physik spätestens seit der Beschreibung von Struktur und Veränderung des elektromagnetischen Felds durch die vier Maxwellschen Grundgleichungen der Elektrodynamik ohne Mathematik gar nichts mehr geht.
Der lächelnde Gelehrte beharrt völlig zurecht auf der Schlüsselrolle des Verstehens mathematischer Zusammenhänge für den Zugang zur Physik. Der einzige, allerdings entscheidende Schwachpunkt seiner ihm so viel Überlegenheit vermittelnden Position besteht darin, daß er vermutlich nicht weiß, wie sehr er im Recht ist mit seiner Überzeugung von der Unhintergehbarkeit des Begreifens der mathematischen Grundlagen der Physik. Denn wenn er es wüßte, verginge ihm das Lächeln. Nimmt man nämlich das seiner Haltung zugrunde liegende Ideal einer klaren Einsicht in jene mathematischen Grundlagen beim Wort, dann muß man auch klare Einsicht in die Grundlagen der Mathematik selbst fordern. Und hier fällt dann der an den Laien gerichtete Vorwurf eines Verständnisdefizits auf unseren Physiker zurück: Was er gelernt hat, ist das Jonglieren mit Zahlen und anderen Gegenständen der Mathematik, sowie die Verwendung dieser Fertigkeit für die Erstellung korrekter Prognosen des Verhaltens von physikalischen Objekten. Er ist aber weit davon entfernt, auch zu verstehen, was er da tut.
Resultat all seiner mathematischen Studien war ja nur das Wissen darüber, wie Zahlen funktionieren. Kein Mensch hat ihm aber je gesagt, was Zahlen sind, denn das weiß auch keiner der mehr oder weniger virtuosen, manchmal sicherlich genialen Zahlenjongleure, welche die mathematischen Universitätsinstitute bevölkern. Und weil unserem Lächler niemand sagen konnte, was Zahlen sind, hat er auch keine Ahnung, was es mit seinen physikalischen Objekten, denen er ja nur mittels der Zahlen beikommt, auf sich hat. Er ist bei ihnen wieder genau so weit von echtem Verstehen entfernt wie bei den Zahlen und weiß ebenfalls wieder nur, wie sie aus mathematischer Sicht funktionieren, wie sich also ihre quantitativ faßbaren Eigenschaften zu einander verhalten und in wechselseitiger Abhängigkeit im Zeitverlauf entwickeln
Wie soll er auch mehr wissen, wenn selbst ein Meister der Physik wie Richard Feynman im Verlauf einer seiner berühmten Vorlesungen angesichts der zuvor erwähnten mathematischen Beschreibung des elektromagnetischen Feldes folgendes einbekennt: „Mathematisch gesehen gibt es an jedem Punkt im Raum einen elektrischen und einen magnetischen Feldvektor; das bedeutet, daß jedem Punkt sechs Zahlen zugeordnet sind. Können Sie sich vorstellen, wie jedem Punkt im Raum sechs Zahlen zugeordnet sind? Das ist zuviel des Guten! Können Sie sich auch nur eine Zahl vorstellen, die jedem Punkt zugeordnet ist? Ich nicht! Ich kann mir so etwas wie die Temperatur an jedem Punkt im Raum vorstellen. Das erscheint verständlich. Es gibt Hitze und Kälte, die sich von Ort zu Ort ändert. Aber die Idee einer Zahl an jedem Ort ist mir wirklich unverständlich.“[110]
Auch wenn es vermessen erscheint: wir wollen uns bemühen genau an dieser Stelle im physikalischen Verstehen der Welt einen Schritt weiter zu kommen als Feynman. Ob das gelingt, wird sich letztlich erst zeigen, wenn wir uns der transzendentalen Analyse des physikalischen Feldbegriffs und im speziellen des Begriffs des elektromagnetischen Feldes zuwenden.[111] Was wir aber jetzt schon im Zuge unserer Untersuchung der allgemeinen Strukturen des Erkennens in Angriff nehmen müssen, ist die Beantwortung der Frage nach dem Wesen der Zahl, denn erst wenn wir hier klarer sehen, wird später die Chance bestehen zu verstehen, was es bedeutet, wenn man im Rahmen jenes Feldbegriffs allen Punkten des Raumes Zahlen in Form von Vektoren zuordnet.[112]
Bevor wir unseren Versuch einer Lösung der damit angeschnittenen Frage nach der Seinsart der Gegenstände der Mathematik präsentieren, sollen kurz einige wesentliche einschlägige Positionen umrissen werden, wobei wir uns schwerpunktmäßig mit den Diskussionsbeiträgen aus der jüngeren Geschichte der Philosophie der Mathematik befassen wollen.
Zunächst ist aber Platon zu nennen, für den die Zahlen Musterbeispiele dessen waren, was er als die allen Erscheinungen vorausgesetzten Ideen bezeichnete, weshalb er in der Mathematik eine unentbehrliche Vorschule der Philosophie sah. Man kann alle weiteren Beiträge von Philosophen zum gegenständlichen Problem auch als Stellungnahmen zu diesem ersten großen Versuch einer Lösung des Rätsels der Zahl lesen. Wie wenig überzeugend jedoch all jene Stellungnahmen sind, erkennen wir allein daran, daß bedeutende Mathematiker selbst noch des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts wie etwa Cantor, Frege und Gödel ‚im Grunde ihres Herzens’ lupenreine Platonisten waren[113].
Schon bei der Diskussion des Begriffs in Abschnitt 6.1 wurde erwähnt, daß sich ein Versuch der Zurückweisung der platonischen Ideenleere bereits bei Aristoteles[114] findet, welcher seinerseits die mathematischen Gegenstände als Abstraktionen und Idealisierungen von Eigenschaften der konkreten Dinge unserer Erfahrung deutete. Eine vermittelnde Position zwischen Platons Idealismus und dem aristotelischen Empirismus bezog Kant, der einerseits am apriorischen Charakter der Mathematik festhalten und andererseits das sich vor unseren Augen stets aufs Neue vollziehende Wunder ihrer Anwendbarkeit in den empirischen Wissenschaften begründen wollte. Kant löste das so gestellte Problem mit dem Verweis auf die durch ihn entdeckte Apriorität von Raum und Zeit als reinen Formen der Anschauung unserer Sinnesempfindungen: Indem Geometrie und Arithmetik die Gesetze der Konstruktion dieses formalen Rahmens aller Erfahrung aufsuchen und explizieren, sind sie weder Erfahrungswissenschaften noch auf einen jenseitigen Ideenhimmel bezogen, sondern mit der Analyse der transzendentalen räumlichen und quantitativen Strukturen des Erfahrens befaßt.
Widerlegt wurde dieser Ansatz Kants erst durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die bestimmte Befunde der Astrophysik durch den Verweis auf die nicht-euklidischen Strukturen des Raumes erklären konnte[115] und damit deutlich machte, daß das, was Kant für eine universelle Voraussetzung alles Erfahrens gehalten hatte, sehr wohl einer Kontrolle durch die Empirie unterliegt, also nicht apriorischen Charakter im Sinne Kants hat. Zugleich mit der Apriorität der Strukturen von Raum und Zeit war damit natürlich auch jene der Mathematik in Frage gestellt, was Einstein zu folgender kecker Bemerkung veranlaßte: „Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit.“[116]
Die Transzendentalphilosophie hat diesen Schlag des Empirismus bis heute nicht überwunden, wenn man auch bei den Versuchen ihrer zeitgemäßen Weiterentwicklung zu einigen sehr bedeutsamen Einsichten kam. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein vom Physiker Hugo Dingler im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelter operativistischer Ansatz, der in der Folge durch Arbeiten von Paul Lorenzen, Peter Janich und anderen weitergeführt wurde und heute in Fachkreisen mit dem Schlagwort ‚Protophysik’[117] assoziiert wird.
Die Bedeutung des Dinglerschen Ansatzes für die erkenntnistheoretische Grundlegung von Mathematik und Physik besteht darin, daß hier die von Kant noch im Anschauen und Denken verankerte Apriorität der Erfahrung aus der Sphäre der Kontemplation herausgeholt und auf die Ebene der kollektiven Praxis verlagert wird. Damit ist einerseits die bei Kant zerrissene Einheit von Theorie und Praxis hergestellt und andererseits die Voraussetzung für die beim Begründer der Transzendentalphilosophie noch fehlende Einsicht in die Historizität des Apriori geschaffen. Wenn man dieses Apriori nämlich erst einmal am kollektiven Alltagshandeln festgemacht hat, dann ist es nur ein kleiner Schritt zu dem Gedanken, daß sich die Struktur jenes Handelns (und zugleich mit ihr natürlich auch das Apriori) aufgrund von Veränderungen im Bereich der Technik und der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit kontinuierlich wandelt.
Dingler setzte diesen kleinen Gedankenschritt allerdings noch nicht, sondern fixierte sich bei seiner Suche nach dem für die Geometrie konstitutiven Handeln auf eine ganz bestimmte historische Gestalt der gesellschaftlichen Praxis, wodurch ihm der Blick auf den Wandel des Apriori verstellt blieb. Das von ihm als konstitutiv erkannte Tun ist die formerzeugende Tätigkeit der Arbeiter im Gewerbe und in der Industrie, welche bestimmte Operationen umfaßt, in deren Zielen er die geometrischen Grundformen wie Punkt, Gerade oder Ebene als Sollwerte des Produzierens entdeckte. Ebene Flächen dachte er sich in diesem Sinne als Ergebnisse des wechselseitigen Aneinanderschleifens von Platten, während Schnittkanten ebener Flächen für ihn die Realisate von Geraden und Schnittecken gerader Kanten jene von Punkten waren.[118]
„Dingler glaubte fest daran, die von ihm beschriebenen formerzeugenden Handlungen (‚in den Fabriken’) erzwängen die Geltung der euklidischen Geometrie im Realraum (und widerlegten damit insbesondere Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie). Er übersah dabei, daß seine Formen-Herstellung nur lokal, d.h. in kleinen Raumgebieten, stattfinden kann und damit über die geometrische Struktur des Universums noch nichts entschieden ist.“[119]
Vergleichen wir Dinglers Position mit unseren eigenen Überlegungen zur Erfahrungskonstitution, dann wird deutlich, daß der eben konstatierte Fehler bei der Bestimmung des für die Geometrie konstitutiven Praxistyps eng mit zwei tiefer liegenden Mängeln von Dinglers transzendentalem Denken zusammenhängt.
Der erste der beiden besteht darin, daß er mit seiner Analyse des Raumes nicht tief genug angesetzt und deshalb die raumkonstitutive Praxis nicht in voller Reinheit erfaßt. Er sucht nämlich das die Raumerfahrung begründende Handeln in einer Tätigkeitsform, bei welcher der Aktionstyp des ‚Sich Bewegens’, der von uns als maßgeblich für die Konstitution der Erscheinung des Raumes erkannte wurde, mit Handlungselementen vermischt ist, die als solche nichts mit der Raumerfahrung zu tun haben. Denn das von Dingler untersuchte formgebende Arbeiten umfaßt ja neben der Bewegung auch das Ruhen, sowie aktives Ausüben und passives Empfangen von Kraftwirkungen. Es ist somit bereits eine ‚höhere’ Praxisform, bei deren Vollzug sich weit mehr als nur Raum für den Handelnden konstituiert.
Der zweite Mangel beruht auf fehlender Einsicht in die allgemeinen Prinzipien der Erfahrungskonstitution. Dingler hat nämlich nicht begriffen, daß die Objekte den Menschen infolge der Anwendung des erkenntnistheoretischen Äquivalenzprinzips als virtuelle Subjekte erscheinen und deshalb in weiterer Folge stellvertretend für sie auch Erfahrung konstituieren können (was von uns in 4.2 als das ‚Stellvertreterprinzip’ bezeichnet wurde). Er entwickelt daher kein Verständnis für eine „Ausdehnung der Begriffe der praktischen Geometrie auf Räume von kosmischer Größenordnung“[120], welche nicht mehr durch die raumerzeugende Bewegung des Menschen selbst sondern durch die Bewegungen der Himmelskörper und des Lichts konstituiert werden.
Die beiden erwähnten Defizite hängen insofern zusammen, als das Ausgehen von der beim handwerklichen und industriellen Produzieren stattfindenden Formgebung die konstitutive Praxis auf einer so niedrigen Abstraktionsstufe erfaßt, daß eine Fixierung auf das menschliche Konstitutionshandeln fast unausweichlich ist und somit die Einsicht in das zum Tragen kommende Stellvertreterprinzip verstellt bleibt.
Blicken wir an dieser Stelle für einen Moment über den Tellerrand unseres aktuellen Themas ‚Mathematik’ hinaus, dann müssen wir feststellen, daß neben Dinglers Ansatz auch die meisten übrigen Versuche einer Weiterentwicklung der transzendentalen Position an der richtigen Erfassung des erfahrungskonstitutiven Handelns bzw. an dessen korrekter Einbettung in den Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Praxis scheitern. Einschlägige Mängel finden sich nicht nur bei dem in den vorangehenden Abschnitten behandelten ‚radikalen Konstruktivismus’ sondern ebenso in den verschiedenen auf Frege und Dingler zurückgehenden Schulen des sogenannten ‚methodischen Konstruktivismus’[121], wie auch bei den an die hermeneutische Tradition bzw. den Frankfurter Neomarxismus anknüpfenden Ansätzen von Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas, mit denen wir uns im neunten Teil unserer Untersuchung noch ausführlich befassen werden.
Während der radikale Konstruktivismus den Zugang zur erfahrungskonstitutiven Praxis allein schon dadurch verfehlt, daß er sich seinen Begriff des Handelns von den hinsichtlich ihrer Formen des Erfahrens erst zu begründenden Einzelwissenschaften, wie etwa der Biologie und der Systemtheorie, vorgeben läßt, überwinden die übrigen angesprochenen Positionen zwar diese erste, von jeder Erkenntniskritik zu bewältigende Hürde, tappen aber in andere, noch heimtückischer gestellte Fallen der Selbstreflexion des Erkennens.
So nähern sich etwa Habermas und Apel wie auch Lorenzen dem Erkennen über die Analyse von dessen dialogischer Struktur und scheitern dabei am Problem der Vermittlung der erkenntniskonstitutiven Rolle des Dialogs mit den erfahrungsbegründenden Funktionen der vorsprachlichen Elemente des gesellschaftlichen Handelns.[122] Der zuvor als einer der führenden Vertreter der ‚Protophysik’ genannte Peter Janich dagegen konzentriert seine transzendentale Analyse des raumzeitlichen Bezugsrahmens der Physik primär auf die Praxis des Messens[123] und vergißt dabei, daß alles Messen immer schon die Erscheinung eines zu messenden Gegenstand voraussetzt, dessen Konstitution daher in einer Sphäre des Handelns stattfinden muß, die allem Messen vorangeht. Darüber hinaus besteht ein gemeinsames Problem aller genannten Philosophen darin, daß sie bei ihren Untersuchungen von erfahrungsbegründenden Funktionen der außersprachlichen Tätigkeit nur das zielgerichtete Tun beachten und dabei übersehen, daß der begriffliche Rahmen des physikalischen Erkennens auch wesentliche konstitutive Elemente des Ausdruckshandelns enthält.[124]
Der zuletzt beanstandete Mangel ist seinerseits eine Folge davon, daß hier (so wie bei Dingler) durchwegs die Einsicht fehlt, daß Objekte den Stellenwert von virtuellen Interaktionspartnern besitzen. Dies nun wieder verweist schließlich auf einen Fehler, der den meisten Formen des Konstruktivismus anhaftet und daher auch so etwas wie eine ‚Problemklammer’ zwischen den Positionen des radikalen und des methodischen Konstruktivismus darstellt: Wie schon der Terminus des ‚Konstruierens’ zeigt, versteht der typische Konstruktivist das Erkennen als eine im wesentlichen durch ihr Ziel bestimmte Aktivität und nicht als eine (aus ziel- und ausdrucksorientierten Handlungselementen bestehende) Interaktion mit (virtuellen) Partnern, bei der, so wie bei jeder glückenden Kommunikation ein Gleichgewicht zwischen aktiven und passiven Handlungselementen besteht. Er ist daher stets in Gefahr den untrennbar mit der passiven Seite des Erkennens verknüpften Aspekt des Erkenntnisinhalts aus den Augen zu verlieren und in einen Relativismus beliebiger Formkonstruktionen abzudriften.[125]
Wenn wir nun wieder zu unserer kleinen Geschichte der Antworten auf die Frage nach der Seinsart der Gegenstände der Mathematik zurückkehren, dann können wir feststellen, daß das Prinzip des Konstruktivismus hier nicht nur bei den erwähnten Versuchen einer Neubegründung der Geometrie eine Rolle spielte, sondern auch in der Arithmetik von einiger Bedeutung war, und zwar in Gestalt der am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts durch den niederländischen Mathematiker Luitzen E. J. Brouwer begründeten Schule des sogenannten Intuitionismus.
Für Brouwer[126] wurden alle Gegenstände der Mathematik letztlich durch die bereits im vorwissenschaftlichen Alltag mit Erfolg praktizierte Tätigkeit des Zählens konstituiert. Er forderte daher dazu auf, sämtliche Objekte der Arithmetik, wie etwa natürliche und rationale Zahlen oder Intervalle mit rationalen Zahlen, auf das Zählen, als den einfachsten Fall eines konstruktiven Verfahrens, zurückzuführen. Die Tätigkeit des Zählens selbst sah Brouwer in einer „Ur-Intuition“ fundiert. Diese war für ihn eine nicht-sinnliche, das heißt von kontingenten Bestandteilen der Wahrnehmung gereinigte Anschauung, die er als unmittelbare Quelle einer aller Erfahrung vorausgesetzten (also apriorischen) und nicht durch Sprache vermittelten Erkenntnis begriff.
Brouwers Rekurs auf eine das mathematische Denken begründende Ur-Intention ist eine Erneuerung des Kantschen Versuchs einer Fundierung der Arithmetik in der reinen Anschauung der Zeit. Denn in besagter Ur-Intention erleben wir nach Brouwers Ansicht nichts anderes als das „Auseinanderfallen eines Lebensmoments in zwei qualitativ verschiedene Dinge, von denen das eine als dem anderen weichend und trotzdem als durch den Erinnerungsakt behauptet empfunden wird.“ Brouwer spricht deshalb auch von der „Ur-Intention der Zwei-Einigkeit“, wobei er betont, daß es sich dabei um ein geistiges Phänomen handelt, das als solches völlig losgelöst ist „von der mathematischen Sprache und dementsprechend von der sprachlichen Erscheinung der theoretischen Logik.“[127]
Es sind vor allem zwei Aspekte, die wir von diesem Versuch einer Erfassung des Wesens der mathematischen Begriffe im Auge behalten müssen, weil sie wichtige erkenntnistheoretische Einsichten beinhalten. Einerseits ist Brouwer auf der richtigen Spur, wenn er die Gegenstände der Mathematik nicht in einem Ideenhimmel sucht, sondern als Resultate einer konstruktiven Tätigkeit des Menschen begreift. Und andererseits hat er auch Recht mit seiner Vermutung, daß sich das Rechnen nicht auf ein Operieren mit sprachlichen Symbolen reduzieren läßt. Die zuletzt genannte Einsicht entspricht nicht nur den neuesten Forschungsergebnissen der experimentellen Psychologie und der Neurowissenschaft[128], sondern bestätigt sich auch bei den in der Folge von uns selbst anzustellenden Reflexionen. Letztere werden zunächst das mathematische Erkennen als Spezialfall des allgemeinen Erkenntnisvorgangs ausweisen und im weiteren dann aufzeigen, daß bei jener allgemeinen Form des Erkennens stets eine das sprachliche Begreifen fundierende Ebene des vorsprachlichen Verstehens vorhanden ist.
Vorausblickend auf unsere späteren Erörterungen des Verhältnisses zwischen sprachlichem Begreifen und vorsprachlichem Verstehen müssen wir allerdings festhalten, daß der Intuitionismus von einer allzu starren Trennung zwischen Sprechen und Erkennen ausgeht: Wohl ruht der Begriff immer auf einem vorsprachlichen Verständnis des Objekts. Jedes Arbeiten mit Begriffen ist jedoch untrennbar an Sprache gebunden. Denn der Begriff ist (entsprechend den Ausführungen in 6.1) ein Set von Regeln und die Anwendung von Regeln setzt, wie wir noch deutlich machen werden[129], sprachliche Verständigung voraus. Sprache hat daher auch auf dem Gebiet der Mathematik im Gegensatz zur Ansicht der Intuitionisten keineswegs bloß eine kommunikative Funktion.[130]
Der Verweis auf unsere eigenen Überlegungen zum Prozeß des Erkennens deutet aber noch auf drei weitere Grenzen des Brouwerschen Ansatzes hin:
Erstens hat die auf Kant zurückgehende Fundierung der Arithmetik in der reinen Anschauung der Zeit einen Haken, und zwar aus folgendem Grund: Die Zahl als der eigentliche Gegenstand der Arithmetik ist zweifellos irgend eine Form von Objekt - nennen wir es das uns als bloße Quantität erscheinende Objekt, so wie der Gegenstand der klassischen Physik das uns als bloßer Körper gegenübertretende Objekt ist. Wenn es in der Arithmetik aber um Objekte geht, dann kann sie prinzipiell nicht in der reinen Anschauung der Zeit begründet sein, da es auf dieser Konstitutionsebene noch gar keine Objekte gibt, sondern bloß die Relationen des Nacheinander.
Das gleiche Argument gilt im übrigen auch in Bezug auf Kants Versuch einer Fundierung der Geometrie in der reinen Anschauung des Raumes. Denn auch die Geometrie handelt von Gegenständen, nämlich von den als reine räumliche Formen bestimmten Typs (Punkt, Gerade, Vieleck, Kegel, usw.) erscheinenden Objekten. Sie ist daher ebenso wenig wie die Arithmetik in einer Anschauung, welche keine Objekte sondern nur Relationen (im vorliegenden Fall solche des Nebeneinander) kennt, begründbar.
Zweitens folgt aus unseren Überlegungen zum Prozeß des Erkennens, daß beim Zählen so wie bei jedem anderen erfahrungs- und erkenntniskonstitutiven Tun die Einbettung in den Gesamtzusammenhang des gesellschaftlichen Handelns zu beachten ist. In diesem Sinne gilt es zu überlegen, wieso bzw. unter welchen sozio-ökonomischen Bedingungen sich eine arbeitsteilig abgesonderte Form der Praxis entwickelt, der Objekte als Quantitäten erscheinen, welche Zähl- und Rechenoperatonen unterworfen werden können. Wenn demgegenüber Brouwer dies Zählen und Rechnen von vornherein ganz isoliert betrachtet, indem er es als Ausdruck einer Ur-Intuition auffaßt, dann reißt er den Akt der Konstruktion nicht nur aus seinen Bezügen zu den übrigen Aspekten der gesellschaftlichen Praxis heraus, sondern reduziert ihn auch (ganz in Kantscher Manier) auf einen rein geistigen Vorgang. Die durch Dinglers Konstitutionsanalyse bereits erreichte Einheit von Theorie und Praxis wird daher in den entsprechenden Bemühungen Brouwers wieder verfehlt.
Drittens stellt sich gegenüber dem Konzept einer als Ur-Intention auftretenden Anschauung Skepsis ein, wenn wir es vor dem Hintergrund unseres in Abschnitt 6.1 durchgeführten Streifzugs durch die wichtigsten Theorien des Begriffs betrachten. Gehen wir davon aus, daß das mathematische Erkennen ein Sonderfall des Erkennens überhaupt ist, dann sind auch die auf das Erfassen der Gegenstände der Mathematik bezogenen Begriffe nur Spezialfälle dessen, was man ganz generell unter einem Begriff versteht. Dieser Begriff aber ist, wie sich im Zuge unserer Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition zeigte, eben nicht über so etwas wie eine Anschauung zugänglich. Denn das durch den Begriff erfaßte Allgemeine der Dinge ist selbst kein Ding, das angeschaut oder durch ein Bild dargestellt werden kann. Es ist vielmehr die Regel, die wir befolgen und im weiteren dann auf unsere virtuellen Interaktionspartner projizieren.
Wir können daher vorausblickend auf die folgenden Reflexionen zur Konstitution der Quantität schon jetzt vermuten,
- daß auch die Objekte der Mathematik (in noch zu bestimmender Weise) als von Regeln geleitete virtuelle Akteure aufzufassen sind
- daß die Begriffe der Mathematik sich auf jene das Verhalten ihrer Objekte bestimmenden Regeln beziehen,
- und daß schließlich das Verständnis mathematischer Zusammenhänge nicht als so etwas wie eine intellektuelle Anschauung aufzufassen ist, sondern als ein Verstehen der betreffenden Regeln begriffen werden muß.
Verschieben wir aber die genauere Ausführung unserer soeben nur andeutungsweise umrissenen Position noch etwas, um den Rückblick auf die Geschichte der Philosophie der Mathematik zu Ende zu führen. Zunächst ist noch ein wichtiger Nachtrag zu Brouwers intuitionistischer Begründung der Mathematik einzufügen, welcher an unseren kritischen Hinweis auf eine gewisse Inhaltsfeindlichkeit des Konstruktivismus anknüpft. Der Nachtrag besteht in der Betonung, daß Brouwer unter dem eben genannten Gesichtspunkt kein typischer Konstruktivist war. Denn so sehr sein Konzept einer die mathematische Erkenntnis begründenden Anschauung auch am Stellenwert des Allgemeinen als einer Verhaltensregel vorbeiging, so klar betonte es doch den Seinsbezug der Mathematik, indem es bei aller Akzentuierung des konstruktiven Elements an der vermittelnden Funktion des Erkennens im Rahmen eines zwischen Subjekt und Objekt stattfindenden Interaktionsprozesses festhielt. Auf diese Weise eröffnet es für uns den Weg zu der dem konstruktivistischen Denken zuwider laufenden Einsicht, daß die Erscheinung der Quantität nicht etwas allein vom Menschen Gemachtes ist, sondern als ein ganz bestimmter Ausdruck seiner Kommunikation mit dem Objekt begriffen werden muß.
Das Beharren auf einer Realitätshaltigkeit der Mathematik war geradezu das zentrale Motiv des Brouwerschen Denkens, entfaltete sich letzteres doch als eine Reaktion auf die immer stärkere Entfernung der damaligen Mathematik von ihrer Einbettung in die Erfahrungszusammenhänge der Alltagswelt. Bestes Beispiel für diese Tendenz war die Entwicklung von sogenannten nicht-euklidischen Geometrien. Sie hatte bereits mit N. I. Lobatschewski und J. Bolyai eingesetzt, die beide unabhängig von einander zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts entdeckten, daß man ein geometrisches System aufbauen kann, in dem die vom Parallelenaxiom[131] postulierte Parallele nicht existiert. Bald darauf kamen dann Systeme hinzu, bei denen mehr als nur eine Parallele vorhanden ist.
Man konnte diesen Systemen zwar nachträglich wieder Erfahrungsrelevanz verleihen, indem man sie als Geometrien von elliptisch (etwa kugelförmig) oder hyperbolisch (etwa sattelförmig) geformten Objektoberflächen interpretierte - allein das vom direkten Bezug auf die Empirie emanzipierte mathematische Denken wollte sich die einmal errungene Selbständigkeit nicht mehr nehmen lassen und verleugnete nun jegliche unmittelbare Verknüpfung seiner Grundbegriffe und Axiome mit dem Erfahren, sei diese Verknüpfung nun platonisch, empiristisch oder transzendental gedacht. Der Mann, der diesen zwar falschen, aber doch außerordentlich kühnen und letztlich auch sehr fruchtbaren Gedanken in scharfer Gegnerschaft zum Intuitionismus mit aller Konsequenz entwickelte, war der deutsche Mathematiker David Hilbert.
Für den als Formalismus bezeichneten Standpunkt Hilberts ist die Mathematik nur der Spezialfall einer vollständig formalisierten Sprache, bei der die außersprachliche Bedeutung Ihrer Zeichen nicht von Interesse ist. Eine solche, ‚Kalkül’ genannte Sprache ist ein System von Zeichen und Regeln, bei dem zwei Hauptgruppen von Regeln zu unterscheiden sind. Bei der ersten der beiden handelt es sich um Satzbildungsregeln, bei der zweiten um die Gesetze der Logik. Die Regeln des ersten Typs legen fest, wie die Zeichen mit einander zu Sätzen verknüpft werden können, jene des zweiten Typs bestimmen, wie man von gegebenen Zeichenverknüpfungen (Sätzen) zu neuen Verknüpfungen (Sätzen) fortschreiten darf. Werden nun einige wenige der prinzipiell möglichen Zeichenverknüpfungen herausgegriffen und als wahre Sätze (genannt ‚Axiome’) definiert, dann kann man vor dem Hintergrund der Verknüpfungsregeln mittels der logischen Gesetze alle übrigen wahren Aussagen des Kalküls ableiten bzw. beweisen.[132]
Während also der Intuitionist das innige Verschränkungsverhältnis von Sprache und Erkenntnis vorschnell zugunsten letzterer auflöst, indem er das mathematische Erkennen als einen völlig sprachunabhängigen Akt des menschlichen Geistes auffaßt, reduziert der Formalist die Mathematik auf ein sich selbst genügendes Sprechen, dessen einziger Ehrgeiz darin besteht, mittels vollständiger Formalisierung alle für die umgangssprachliche Kommunikation charakteristischen Mißverständnisse und Verstöße gegen die Logik auszuschließen. In Bezug auf das Verständnis des kognitiven Instruments ‚Zahl’ kann man diesen Gegensatz auch so formulieren: Ist die Zahl für den Intuitionisten ein auf sprachunabhängige Erkenntnis bezogener Begriff, so sieht der Formalisten in ihr ein bloßes Zeichen ohne jegliche darstellende Bedeutung.
Die Vorläufer dieser Sichtweise gehen bis auf Leibniz zurück, der in seinen Schriften zur „Characteristica universalis“ nachdrücklich betonte, daß die Umgangssprache um so ungeeigneter zum Ausdruck unserer Gedanken ist, je abstrakter die Gegenstände sind, auf die sich unser Denken richtet. Nach einem ersten Ansatz des englischen Mathematikers Boole schuf dann Frege eine sogenannte „Begriffsschrift“, die bald darauf durch den wesentlich leichter lesbaren Kalkül von Whitehead und Russell abgelöst wurde.[133] Das Neue an der Position Hilberts war also nicht die Verschmelzung von Mathematik und Logik zu einer vollständig formalisierten Sprache, sondern bloß die radikale Leugnung einer innerlich notwendigen Verbindung des auf diese Weise erzeugten Formalismus mit einer externen Realität.
Die formalistische Grundlegung der Mathematik führt damit schnurstracks in jene uns schon von der Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus her bekannte Sackgasse eines Erkennens ohne Inhalt, in die jedes Denken gerät, das sich auf seine in vermeintlicher Autonomie aus sich selbst herausgesponnenen Formen zurückziehen möchte. Denn die axiomatisierte Mathematik ist so wie alle anderen auf die zuvor skizzierte Weise
axiomatisierten Wissenschaften nichts weiter als ein in sich geschlossenes System von formalisierten Aussagen, bei dem es nur mehr um innere Widerspruchsfreiheit sowie um vollständige Rückführbarkeit aller Aussagen auf die Axiome und nicht mehr um deren inhaltliche, das heißt realitätsdarstellende Bedeutung geht.
Dieser Verzicht auf einen externen Erkenntnisanspruch bedeutet natürlich keineswegs, daß die formalistische Mathematik nichts mehr zu den Erkenntnisbemühungen der Erfahrungswissenschaften beitragen kann und will. Sie schließt nur das Nachdenken darüber, warum dies möglich ist, aus ihrem Fragehorizont aus - und das gleich in zweifacher Weise: Zum einen verweigert sie sich der Reflexion über die Wahrheit ihrer Axiome und zum anderen legt sie keine Rechenschaft darüber ab, wieso der von ihr benutzte Apparat der Logik die Ableitung von wahren Schlußfolgerungen aus wahren Prämissen gestattet, wieso also die Struktur der Realität offenbar der Struktur der formalen Sprache entspricht.
Ein philosophiegeschichtlich hochbedeutsamer Versuch der Grundlegung von Mathematik und Logik, welcher einerseits diese wesentlichen Fragen nicht von vornherein in formalistischer Manier beiseite schiebt, sich andererseits aber dem intuitionistischen Antwortversuch verweigert, ist Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus[134]: Hier wird dem Kalkül ein transzendentaler Stellenwert zugebilligt, wodurch die formalistische Zurückweisung eines darstellenden Inhalts von mathematischen und logischen Strukturen zwar beim Wort genommen, doch zugleich auf den Kopf gestellt ist. Denn der auf diese Weise interpretierte Kalkül hat es nicht nötig, externe Strukturen darzustellen, weil er ja selbst der seinen Anwendern erscheinenden Welt diese Strukturen vorgibt. Vordergründig gelingt es dadurch, alle weiteren Fragen nach dem Grund für die Entsprechung zwischen der formalisierten Sprache und der Erfahrungswirklichkeit ruhig zu stellen. Bei genauerer Betrachtung ist diese Position allerdings nicht durchzuhalten, da eine Argumentation, die den Kalkül zur sinnkonstitutiven Basis alles Wissens erklärt, sich letztlich selbst (als ein nicht in die Form des Kalküls gegossenes Sprechen) der Sinnlosigkeit zeiht.
Der tiefere Grund für diese Selbstaufhebung des Tractatus[135] liegt darin, daß auch hier wieder (ähnlich wie schon bei Dingler und Brouwer) ein bestimmter Teilaspekt der umfassenden gesellschaftlichen Praxis künstlich isoliert und zur transzendentalen Basis der Erfahrung hochstilisiert wird. Im Fall des Tractatus haben wir es gleich mit einem ‚Doppelfehler’ der geschilderten Art zu tun. Zum einen reißt Wittgenstein hier das Sprechen aus seiner Verknüpfung mit dem Handeln heraus und erklärt Sprache als solche (das heißt unabhängig von ihrer Einbettung in ein bestimmtes Tun) zur Basis der Erfahrung. Zum anderen wird von ihm nicht mitreflektiert, daß die Anwendung des Kalküls Teil eines Handelns ist, das nur praktiziert werden kann als ein arbeitsteilig abgesonderter Seitenarm der umfassenden gesellschaftlichen Praxis, welche ihrerseits notwendigerweise auf umgangssprachlicher (also nicht kalkülmäßig restringierter) Verständigung der Akteure fußt.
Trotz seiner somit auch durch den Tractatus nicht behobenen Defizite ging der Formalismus aus dem Streit mit dem Intuitionismus eindeutig als Sieger hervor und wurde zur weithin anerkannten Doktrin der Mathematik. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, daß die Mathematiker ihre obersten Wahrheiten durch den offen deklarierten Verzicht auf deren außermathematischen Gehalt besser gegen die Gefahr einer empiristische Infragestellung ‚abgedichtet’ sehen als durch eine Position, welche jene Wahrheiten mittels einer Ur-Intuition begründen will, die sich eines Tages womöglich als ebenso erfahrungsabhängig erweist wie das vermeintliche Apriori des euklidischen Raums.[136]
Wenn wir demgegenüber an der weder von Kant und seinen intuitionistischen Nachfolgern noch vom jungen Wittgenstein richtig beantworteten, aber immerhin mit allem erforderlichen Nachdruck gestellte Frage nach dem Grund für die Mathematisierbarkeit aller Naturerfahrung festhalten und darüber hinaus der von der Empirie ausgehenden ‚Gefahr’ für die obersten Wahrheiten der Mathematik auf eine weniger defensive Weise begegnen wollen als der Formalismus, dann müssen wir den von ihm eingeschlagenen Weg einer Begründung der Mathematik zurückweisen und zweierlei betonen:
- Erstens ist im Sinne des transzendentalen Anliegens der eben erwähnten philosophischen Positionen darauf zu beharren, daß sich sowohl die Grundbegriffe und Axiome der Mathematik als auch die Gesetze des logischen Apparats, welcher allen mathematischen Ableitungen zugrunde liegt, auf gegenstandskonstitutive Basisstrukturen unserer Erfahrung beziehen und damit nicht bloß zufällig, sondern aus präzise angebbaren Gründen zur Erzielung wahrer Erkenntnisse über unsere Gegenstände taugen.
- Zweitens ist festzuhalten, daß jene gegenstandskonstitutiven Erfahrungsstrukturen, auf denen die Grundbegriffe und obersten Gesetze von Mathematik und Logik beruhen, wegen des sinnstiftenden Handlungsbezugs jeder Form von Wissen untrennbar mit bestimmten historisch wandelbaren Formen der gesellschaftlichen Praxis verbunden sind. Mit der Entwicklung von neuen Technologien und Mustern der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit verändern daher notwendigerweise auch die Apriori der Mathematik und Logik ihre Gestalt.
Unmittelbar mathematikbezogene Beiträge zur Einlösung dieser beiden Forderungen finden sich nur in den anschließenden Abschnitten 6.11 bis 6.16, in denen die Konstitution der apriorischen Basis von Geometrie und Arithmetik analysiert und das Geheimnis der Mathematisierbarkeit aller Naturwissenschaft gelüftet wird. Die im Anschluß daran zu lesenden Reflexionen über die Rolle der Sprache für das Erkennen und Handeln sowie über den transzendentalen Stellenwert der Logik und den Sinn von Wahrheit beziehen sich zwar auf den Erkenntnisprozeß im allgemeinen, also nicht explizit auf dessen mathematische Komponente, es ist aber zu hoffen, daß sie in Verbindung mit den vorangehenden und nun noch folgenden Ausführungen zum mathematischen Erkennen ein ausreichend deutliches Bild der Konturen des transzendental-pragmatistischen Fundaments der Mathematik ergeben.
6.11 Das Objekt als reine räumliche Form
Lassen wir den im vorangehenden Abschnitt durchgeführten Streifzug durch die Antworten auf die Frage nach der Seinsart der Gegenstände der Mathematik noch einmal kurz revue passieren, dann zeigt sich bei allen skizzierten Positionen Einigkeit darüber, daß jene Gegenstände von idealer Natur sind. Die Antworten unterscheiden sich jedoch danach, was jeweils als das Wesen dieser Idealität angesehen wird. Haben wir es mit einem von wem auch immer geschaffenen, von uns nur ergriffen staunend anzuschauenden Himmel der Ideen zu tun? Handelt es sich um Abstraktionen aus unserer eigenen Erfahrung? Liegen beliebige axiomatische Setzungen ohne rational begründbaren inneren Bezug auf empirische Erfahrung vor, oder kann der ideale Charakter der Gegenstände der Mathematik mit der transzendentalen Methode, also durch das Aufzeigen gewisser Strukturen des erkenntniskonstitutiven Handelns bestimmt werden?
Wie bereits angedeutet, soll nun Letzteres versucht werden, wobei wir allerdings auf eine Vermeidung der anhand der Positionen Dinglers, Brouwers und des jungen Wittgenstein angesprochenen Irrtümer des transzendentalen Denkens achten müssen. Die diesem Bemühen dienende Argumentation wird folgenden Aufbau haben:
In ihrem ersten Schritt wollen wir uns im vorliegenden Abschnitt ausgehend von der Konstitution der Objekte der reinen Geometrie die allgemeine Frage stellen, wie es zur Erscheinung von idealen Gegenständen der Mathematik kommt. Haben wir auf diesem Wege geklärt, worin sich ein idealer von einem realen Gegenstand unterscheidet, werden wir uns in 6.12 der Zahl als dem Hauptobjekt der Arithmetik zuwenden, um zu überlegen, was bei der Konstitution dieses speziellen Typs eines idealen Gegenstands geschieht. Nach der Rekonstruktion einiger weiterer Grundstrukturen des Universums der reinen Mathematik (in 6.13 und 6.14) müssen wir schließlich (in 6.15 und 6.16) noch einen Blick auf die angewandte Mathematik werfen, um Antwort auf die Frage zu finden, wie es möglich ist, daß alle naturwissenschaftlichen Erfahrungen (im speziellen jene der Physik) quantifizierbar sind.
Wenn wir nun programmgemäß mit der Konstitution der Objekte der reinen Geometrie beginnen, dann erinnern wir uns zuerst am besten kurz daran zurück, was uns in dieser Angelegenheit bereits bekannt ist:
Aus der Analyse des Raumes wissen wir, daß letzterer der Inbegriff aller Relationen des Nebeneinander ist, welche wir vor dem Hintergrund unserer eigenen Bewegungen registrieren[137]. Die Erscheinung von Objekten, die ausschließlich Raum enthalten, muß also einem Verhalten korrespondieren, das seinerseits nichts anderes als Bewegung umfaßt. Die einzige Eigenschaft, die solchen Gegenständen abgesehen von ihrem Objektstatus und ihrer Räumlichkeit als solcher zukommt, besteht darin, daß jene Räumlichkeit in bestimmter Weise geformt ist. Sie enthalten also gleichsam nur ‚Raum’ und ‚Form’, weshalb man sie auch als ‚reine räumliche Formen’ bezeichnen kann.
Entsprechend dem Resultat der Reflexionen des Abschnitts 6.5 ist die Form ihrem allgemeinen Begriffe nach ein als eigenständiges Objekt betrachtetes Gefüge von Relationen. Im Falle der räumlichen Form des Gegenstands handelt es sich dabei um die zwischen den räumlichen Positionen seiner Oberflächenpunkte bestehenden, quantitativ bestimmten Richtungs- und Abstandsrelationen, was eine wichtige Schlußfolgerung auf das Verhältnis zwischen den transzendentalen Grundlagen von Geometrie und Arithmetik zuläßt. Die Feststellung, daß die räumliche Form aus quantitativen Relationen besteht, weist nämlich darauf hin, daß ihre Wahrnehmung untrennbar mit der Wahrnehmung von Quantitäten verknüpft ist. Sie macht damit deutlich, daß die Konstitution der Gegenstände der Geometrie in enger Verbindung mit jener der Gegenstände der Arithmetik erfolgt und daher auch nicht unabhängig von ihr begriffen werden kann.
Wodurch kommt es nun aber zur erwähnten Erscheinung von quantitativ bestimmten Richtungs- und Abstandsrelationen zwischen den räumlichen Positionen der einzelnen Oberflächenpunkte des Gegenstands? Während die Räumlichkeit des Objekts als solche daraus resultiert, daß wir im Zuge seiner Wahrnehmung Eigenbewegungen vollziehen, ist die jeweilige Form dieser Räumlichkeit das Pendant zur Struktur jener Eigenbewegungen. Wenn wir von möglichen Geschwindigkeitsunterschieden absehen, ist die Struktur einer Bewegung ausschließlich durch Art und Häufigkeit der in ihrem Verlauf stattfindenden Richtungswechsel bestimmt. Die jeweiligen Formen der Räumlichkeit von uns erscheinenden Objekten resultieren somit daraus, daß wir bei der Konstitution jener Räumlichkeit Bewegungsabläufe mit ganz bestimmten Richtungsmustern vollziehen.
Wir haben bis jetzt in bewußter Unschärfe von der Entstehung bzw. Konstitution der Erscheinung eines Objekts gesprochen, ohne zu präzisieren, ob es sich dabei um die eines idealen oder eines realen Gegenstands handelt. Es gilt nun, diese im Zentrum unserer aktuellen Fragestellung stehende Präzisierung nachzuholen, indem wir zunächst überlegen, wie die Erscheinung der räumlichen Form eines realen Objekts zustande kommt.
Bezeichnen wir Realität als den Inbegriff dessen, was wir erfahren, so können wir als erstes festhalten, daß die fragliche Erscheinung das Resultat eines Erfahrungsprozesses ist, welcher, wie wir bereits wissen, von dessen Subjekt als ein Vorgang der Kommunikation mit einem virtuellen Interaktionspartner interpretiert wird. Dieses aller Erfahrung anhaftende Merkmal der Intersubjektivität führt uns auf die Spur zu einem weiteren Aspekt der Konstitution der fraglichen Erscheinung:
Aus dem Umstand, daß bloßes Bewegungsverhalten monologischen Charakter hat, können wir nämlich schließen, daß hier neben der reinen Bewegung noch eine zweite Verhaltensdimension ins Spiel kommen muß, in der so etwas wie kommunikative Erfahrung entstehen kann. Es handelt sich dabei um jenes im Abtasten der Oberfläche eines Körpers stattfindende Wechselspiel aktiven Ausübens und passiven Empfangens von Kraftwirkungen, im Zuge dessen das jeweilige Gegenüber als ein einheitlicher Gegenstand erlebt wird, der an seiner äußeren Grenze mit mehr oder weniger entschiedenem Widerstand auf jede äußere Krafteinwirkung reagiert.
Sofern der erfahrende Akteur die Absicht hat, den jeweiligen Körper in irgend einer Weise zu bearbeiten oder an einen anderen Standort zu transportieren, wird es ihm bei seiner durch die Finger bzw. Hände vollzogenen Kontaktaufnahme darauf ankommen, das Ausmaß und die genaue Art des Widerstands des betreffenden Objekts auszuloten. Die Widerstandserfahrung ist somit in diesem Fall als eine Materieerfahrung mit bestimmter qualitativer und quantitativer Ausprägung von unmittelbarem Interesse für ihn.
Geht es ihm dagegen bloß um eine genauere Erkundung der räumlichen Begrenzung seines Gegenübers, dann ist das in jedem Augenblick der Berührung stattfindende Widerstandserlebnis nur deshalb von Relevanz für ihn, weil es bei der weiteren Steuerung seiner tastenden Erkundungsbewegung als eine Art Kompaß fungiert, der ihm sagt, in welche Richtungen er seine über den Gegenstand gleitenden Hände, bzw. Finger bewegen muß, wenn er den Kontakt zu dessen Oberfläche nicht verlieren will. Da es ihm also hier beim eigenen Handeln bloß auf das Richtungsmuster seiner Bewegung ankommt, besteht im Sinne des Komplementaritätsprinzips auch die durch jenes Handeln konstituierte Erscheinung seines realen Objekts nur aus den diesem Bewegungsmuster entsprechenden Wahrnehmungsaspekten. Und das sind eben genau jene quantitativ bestimmten Richtungs- und Abstandsrelationen zwischen den räumlichen Positionen der Oberflächenpunkte des betreffenden Gegenstands, welche wir als dessen räumliche Form bezeichnen.
Zusammenfassend können wir daher festhalten, daß die Erscheinung der räumlichen Form eines realen Objekts das Pendant zu einem bestimmten Richtungsmuster der raumkonstitutiven Bewegung des erfahrenden Akteurs ist, welche ihrerseits durch Berührungskontakte mit der Oberfläche des betreffenden Körpers gesteuert wird.
Die Erscheinung bestimmter idealer räumlicher Formen in Gestalt von entsprechenden idealen Objekten konstituiert sich ebenfalls komplementär zum jeweiligen Richtungsmuster der raumkonstitutiven Bewegung des Akteurs. Diese Bewegung wird hier allerdings nicht unmittelbar durch die Erfahrung der räumlichen Begrenzung eines aktuellen Gegenübers gesteuert, sondern ist nur mittelbar erfahrungsbezogen, wobei wir zwei Konstitutionsstufen mit zunehmender Erfahrungsunabhängigkeit unterscheiden müssen:
Auf der ersten Stufe erinnert sich der Akteur an die Bewegungen, welche er im Zuge früherer Erfahrung von Oberflächenformen realer Objekte bestimmten Typs vollzogen hat und fragt sich in Anlehnung an diese Erinnerung: Wie muß ich mich bewegen, damit meine Bewegung ein Richtungsmuster aufweist, das der bei der Oberflächenerfahrung jener Objekte durchgeführten Bewegung entspricht? Er stellt sich diese Frage nur deshalb, weil er ein reales Objekt produzieren (oder in der Natur suchen) will, das hinsichtlich seiner räumlichen Form dem einst erfahrenen realen Objekt gleicht. Zu diesem Zweck möchte er die bei jener Erfahrung der räumlichen Form des realen Objekts durchgeführte Bewegung nachvollziehen, um auf diesem Wege ein (entweder bloß vorgestelltes oder gezeichnetes) Erinnerungsbild der betreffenden Form zu erzeugen, das ihm dann als Vorbild für seine produzierende oder suchende Tätigkeit dienen kann.
Diese erste Konstitutionsstufe ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Entstehung der Erscheinung einer idealen räumlichen Form, denn sie enthält bereits einen Umschlag in der Haltung des Akteurs vom primär passiven Erfahren zum aktiven Erzeugen eines inneren Bildes, das dann als Basis für eine äußere Aktivität (das durch jenes Bild geleitete Produzieren oder Suchen) fungiert. Der Übergang von der Erscheinung dieses Erinnerungsbildes einer räumlichen Form zur Erscheinung eines entsprechenden Idealbilds findet dann im Rahmen der zweiten Konstitutionsstufe als ein weiterer Schritt der Emanzipation von der Erfahrung statt: Während nämlich das Vorstellen bei der Erzeugung eines Erinnerungsbildes noch ganz eng an die vorangehenden Kontakte mit dem Objekt gebunden ist, löst es sich bei der Produktion eines Idealbilds sehr weitgehend vom interaktiven Erlebnismodus der Erfahrung ab um selbstgegebenen Gesetzen zu folgen.
Damit wir genau verstehen, was dabei passiert, wollen wir uns ein konkretes Beispiel der Entstehung des Idealbilds einer bestimmten räumlichen Form vor Augen führen. Wir denken zu diesem Zweck an den sagenhaften Erfinder des Rades, der zum Zeitpunkt unseres phantastischen Rendezvous knapp vor seiner die Welt verändernden Erfindung steht.[138] Er hat schon des öfteren, ohne zu wissen, was eine Form im allgemeinen und eine Kreisform im besonderen ist, mit seiner Fingerspitze den in ungewöhnlich ebenmäßiger Rundung geformten Umfang eines einst am Ufer eines Baches gefundenen flachen Steins abgetastet. Mittlerweile hat er diesen Stein verloren und möchte nun die bei dessen Abtastung durchgeführte Bewegung mit seinem Finger im Sand nachzeichnen. Er kann dabei auf zwei unterschiedliche Weisen verfahren, welche den beiden zuvor erwähnten Konstitutionsstufen der Erscheinung von idealen räumlichen Formen entsprechen.
- Entweder er ruft sich den Bewegungsablauf in der vom Umriß des verlorenen Steins vorgegebenen Weise Stück für Stück ins Gedächtnis und läßt sich bei seiner aktuellen Zeichenbewegung allein durch dieses Erinnerungsbild einer räumlichen Form leiten.
- Oder aber er versucht, ausgehend von jenem Bild eine Bewegungsregel zu entwickeln, welche den fraglichen Bewegungsablauf aus sich heraus rekonstruiert, sodaß ihre Befolgung dann unabhängig von jeder weiteren Erinnerung an die einstige Erfahrung zu einem Bewegungsmuster führt, das der seinerzeitigen Bewegung gleicht.
Im vorliegenden Fall würde diese Regel in einer ersten, noch relativ stark an die ursprüngliche Erfahrung angelehnten Version folgendermaßen lauten: ‚Stelle dir zunächst den Punkt in der Mitte des verlorenen Steins vor und markiere ihn mit der Spitze deines Zeigefingers im Sand. Anschließend denke an eine beliebige Stelle auf dem Umfang des Steins und zeichne auch sie in den Sand. Nun lege deine Fingerspitze auf die zuletzt markierte Stelle und bewege sie dann so durch den Sand, daß sich ihr Abstand zu dem im erste Schritt markierten Punkt nicht verändert.’ Bei späteren Versionen jener Regel würde dann sukzessive jeder Bezug auf die ursprüngliche Erfahrung des runden Steins eliminiert, sodaß die beiden am Beginn der Konstruktion zu zeichnenden Punkte nur mehr durch ihren Abstand von einander definiert wären.
Wenn wir die beiden eben präsentierten Möglichkeiten zur Aktualisierung der die Erfahrung einer bestimmten räumlichen Form konstituierenden Eigenbewegung mit einander vergleichen, dann erkennen wir, daß die Rekonstruktion der betreffenden Bewegung mittels Definition der jeweils passenden Bewegungsregel gegenüber der Erinnerungsmethode einen wesentlichen Vorteil aufweist. Dieser besteht darin, daß die Steuerung des aktuellen Bewegungsablaufs unabhängig von der vagen Erinnerung wird und daher einerseits beliebig genau präzisierbar ist und andererseits einfacher zum Gegenstand der Kommunikation mit etwaigen Kooperationspartnern gemacht werden kann. Das hat zur Folge, daß das betreffende Bewegungsmuster jederzeit von jeder beliebigen Person, die der Sprache mächtig und in der Lage ist, Regeln zu befolgen, reproduziert werden kann - und zwar auch dann, wenn diese Person selbst den runden Stein, dessen Erfahrung Ausgangspunkt für die Erstellung der betreffenden Bewegungsregel war, nie gesehen oder angegriffen hat.
Das vorangehende Beispiel zeigt uns, daß jede ideale räumliche Form ihren Ursprung in einer Handlungsregel hat. Diese definiert das Richtungsmuster einer Bewegung, welche jene erfahrungskonstitutive Bewegung nachahmt, die zuvor im Kontakt mit realen Objekten der entsprechenden räumlichen Form vollzogen wurde. Damit in weiterer Folge die Erscheinung einer idealen räumlichen Form entsteht, muß die betreffende Bewegungsregel in eine Erzeugungsregel umgewandelt werden, welche die gedanklich oder als Zeichnung zu vollziehende Konstruktion einer entsprechenden idealen Form anleitet.
Da diese ideale Form aber nur deshalb erzeugt wird, weil ein Vorbild (bzw. eine Richtschnur) für die Produktion (bzw. Suche) eines entsprechenden realen Gegenstands geschaffen werden soll, muß zugleich mit ihr auch das hinter der Form stehende Objekt miterzeugt werden. Es gilt also ein ideales Gegenüber zu produzieren, das neben der genannten Form auch über all die sonstigen Eigenschaften (wie etwa Substanzialität und Interaktionsfähigkeit) verfügt, die wir von jedem Gegenstand erwarten. Die vom Akteur geschaffene ideale Form wird dadurch zur Erscheinungsform eines gleichfalls selbst produzierten idealen Gegenstands, zu dem er sich auf symbolischer Ebene gestaltend und verändernd verhalten kann, so wie er sich zu seinen realen räumlichen Objekten gestaltend und verändernd verhält.
Die Analogie zwischen realen und idealen Objekten ist jedoch keine vollständige: Während wir auf den uns in der Realität begegnenden virtuellen Interaktionspartner bloß bestimmte Verhaltensregeln projizieren, ist unser ideales Gegenüber nach den von uns selbst gesetzten Regeln produziert, was bedeutet, daß sein Verhalten den betreffenden Regeln mit innerer Notwendigkeit unterliegt. Wenn wir also an unser reales Gegenüber eine Reihe von Verhaltenserwartungen richten, die aus der jederzeit falsifizierbaren Annahme resultieren, es verhalte sich so, als ob es ganz bestimmten Regeln unterläge, so gehorcht das ideale Objekt seinen Regeln auf eine durch keinerlei Erfahrung widerlegbare Weise, da seine Existenz mit der Existenz der durch uns geschaffenen Regeln seines Verhaltens zusammenfällt.
Der eben angesprochene Unterschied schlägt sich in folgender Differenz zwischen den Erscheinungen von realen und idealen Objekten nieder:
- Weil das tatsächliche Verhalten des realen Objekts in unaufhebbarer Spannung zu dem von ihm erwartbaren Verhalten steht, müssen wir zwischen dem betreffenden individuellen Gegenstand und seinem Begriff (dem jeweiligen Objekttyp)[139] unterscheiden.
- Weil das Verhalten des idealen Objekts demgegenüber notwendigerweise gänzlich seinen jeweiligen Verhaltensregeln entspricht, kann man in seinem Fall nicht in demselben Sinn wie bei den realen Gegenständen zwischen dem allgemeinen Begriff und seinen individuellen Vertretern unterscheiden.
Während sich also etwa die Umrisse von realen kreisförmigen Objekten prinzipiell nie bis ins kleinste Detail gleichen, ist ein idealer Kreis bestimmten Umfangs abgesehen von der Lage seines Mittelpunkts völlig identisch mit allen übrigen idealen Kreisen desselben Umfangs und verhält sich auch zu seinen Sekanten und Tangenten sowie zu jedem anderen Objekt der reinen Geometrie auf genau dieselbe Weise wie sie. Unterschiede kann es nur zwischen den verschiedenen individuellen Vorstellungen eines solchen idealen Kreises geben. Derartige Differenzen sind deshalb möglich, weil die Akteure, welche diese Vorstellungen gemäß den allgemeinen Erzeugungsregeln für ideale Objekte des jeweiligen Typs produzieren, verschiedenste Fehler bei der Anwendung der betreffenden Regeln begehen können.
Die Erwähnung der individuellen Vorstellungen des idealen Objekts bringt uns zu der Frage nach der Seinsart des idealen Gegenstands zurück, wobei wir zunächst nochmals die obige Bemerkung über das Zusammenfallen seiner Existenz mit der Existenz der durch uns geschaffenen Regeln seines Verhaltens unterstreichen wollen: Das ideale Objekt ist in einem sehr wörtlichen Sinne nichts anderes als jenes Bündel selbst geschaffener Regeln, welche uns bei seiner Produktion leiten und dadurch indirekt nicht nur sein Verhalten definieren, sondern in weiterer Folge auch festlegen, wie wir im Kontakt mit ihm zu agieren haben.
Eine Regel besteht aber, wie uns der späte Wittgenstein lehrt, immer bloß in der kontinuierlichen Bekräftigung jener Übereinkunft, welche wir als ihre Geltung bezeichnen, sowie in dem fortwährenden Ringen der diese Geltung anerkennenden Akteure um die korrekte Anwendung der betreffenden Norm. Die Existenz einer Regel ist damit in doppelter Hinsicht an einen sozialen Prozeß gebunden und darf keinesfalls bloß aus der Perspektive der intentionalen Vorgänge im Inneren der an ihr orientierten Akteure betrachtet werden. In unserem Fall bedeutet dies, daß wir die Existenz der ein ideales Objekt bestimmenden Regeln nicht darauf reduzieren können, daß die Handelnden Vorstellungsbilder von dem betreffenden Gegenstand erzeugen. Unsere Rede von der Existenz der betreffenden Regeln muß vielmehr stets auch den Gedanken an alle jene Handlungen einschließen, welche Teil des kollektiven Bemühens um den ihre Geltung sichernden Konsens sowie um ihre korrekte Anwendung sind. Die auf die Existenz jener Regeln zielende Rede befaßt sich in diesem Sinne notwendigerweise etwa auch damit,
- wie wir von ihnen oder von den mit ihrer Hilfe konstruierten idealen Objekten sprechen,
- wie wir Fehler bei ihrer konstruktiven Anwendung oder beim Sprechen über sie bzw. über die mit ihrer Hilfe konstruierten idealen Objekte kritisieren,
- wie wir gedanklich oder graphisch konstruierte ideale Objekte bei der Erzeugung entsprechender realer Gegenstände verwenden,
- und wie wir diese Verwendung durch bestimmte Weisen des Sprechens begleiten.
Wenn nun also einerseits die Existenz des idealen Objekts mit der Existenz der den betreffenden Gegenstand definierenden Regel zusammenfällt und andererseits jene Regel nur als ein sozialer Prozeß existiert, dann folgt daraus, daß auch das von uns imaginierte ideale Objekt nur als ein sozialer Prozeß existiert, weshalb seine Existenz niemals gleichgesetzt werden darf mit den individuellen Vorstellungen von ihm, oder gar mit einer als Anschauungsgegenstand dieser Vorstellungen unterstellten ‚objektiven’ Idee.
Beschreiben wir daher das Entstehen bzw. Erzeugen von inneren Bildern, so konzentriert sich unsere Analyse bloß auf den Anteil des einzelnen Akteurs an jener kollektiven Handlung, wobei sie auch diesen individuellen Beitrag nicht vollständig, sondern nur aus der Perspektive seiner Innenansicht erfaßt. Die einzige Rechtfertigung für dieses in doppelter Hinsicht reduktive Vorgehen besteht in der Notwendigkeit einer Vereinfachung unseres Zugangs zum äußerst komplexen Geschehen der gemeinsamen Befolgung von Regeln. Es ist daher an dieser Stelle nochmals auf den folgenden siebenten Teil unserer Reflexion zu verweisen, in dem wir uns ganz allgemein mit der Rolle jener kollektiven Praxis für die Konstitution von Erfahrung sowie von Bedeutung und Sinn sprachlicher Zeichen befassen.[140]
Alles eben Gesagte gilt in analoger Weise auch für die vorangehende Analyse der Konstitution unserer Erfahrung vom realen Objekt. Hier ist es das Wahrnehmungs- oder Erinnerungsbild, das der einzelne Handelnde im Zuge seiner Interaktion mit dem betreffenden Gegenstand erzeugt, welches bloß den Stellenwert einer Innenansicht des verstehenden Anwendens der auf jenen Gegenstand projizierten Verhaltensregel hat. Auch in diesem Fall steht also der aus einer Vielzahl von symbolischen und nichtsymbolischen, äußeren und inneren Tätigkeiten bestehende kollektive Prozeß der Anwendung einer gemeinsam anerkannten Regel im Zentrum der transzendentalen Analyse und nicht die individuelle Produktion von inneren Bildern.
Der einzige (allerdings gravierende!) Unterschied zwischen der Konstitution von idealen und realen Objekten besteht darin, daß die gemeinsam anerkannte Regel im ersten Fall nicht auf ein reales Gegenüber projiziert wird, mit dem man interagiert, sondern bloß als Vorschrift zur Erzeugung eines entsprechenden Gegenstands dient. Die genannte Differenz führt zu einem tiefen Kontrast in der jeweiligen Seinsart von Gegenständen idealer und realer Art:
Während die Seinserfahrung bei letzteren ganz wesentlich an den Widerstand des Objekts gegen unangemessene Regelprojektionen gebunden ist,[141] verweist das Sein des idealen Gegenstands infolge seiner Verknüpfung mit der seiner Erzeugung zugrunde liegenden Regel in unmittelbarer Weise nur auf die eigene Existenzerfahrung der Akteure, welche ja die betreffenden Regel selbst geschaffen haben und nunmehr durch ihre kontinuierliche Befolgung am Leben halten. Da sich jedoch die Handelnden bei der Konzeption jener Regel, wie erläutert, an vorangehenden Erfahrungsprozessen orientieren, ist die Erscheinung des Seins des idealen Gegenstands indirekt auch auf die Erfahrung des Seins seines realen Pendants rückbezogen.
Wenn wir abschließend unsere Erklärung für die Entstehung der Erscheinung idealer Objekte vor dem Hintergrund des im vorangehenden Abschnitt präsentierten Überblicks über die wichtigsten Positionen der Philosophie der Mathematik betrachten, dann ist sie als eine zwischen den empiristischen und den konstruktivistischen Ansätzen angesiedelte Mittelposition zu charakterisieren. Denn auf der einen Seite gibt sie ein Stück weit dem Konstruktivismus recht, da sie in den idealen Objekten Gegenstände sieht, welche sich der Mensch selbst nach seinen eigenen Regeln schafft. Auf der anderen Seite kommt sie aber auch dem Empirismus entgegen, weil sie einsieht, daß jene Regeln, welche die Produktion von idealen Objekten leiten, die Muster eines erfahrenskonstitutiven Handelns nachbilden, das sich im Zuge einer langen Vorgeschichte von entsprechenden Erfahrungsprozessen entwickelte.
6.12 Die Erscheinung von realen und idealen Quantitäten
Nachdem nun geklärt ist, was wir unter einem idealen im Gegensatz zu einem realen Gegenstand zu verstehen haben und wie es zur Erscheinung von idealen Gegenständen kommt, schreiten wir zum nächsten Punkt unseres Argumentationsprogramms, bei dem wir überlegen, wie die Erscheinung jener idealen Objekte entsteht, die man als Zahlen bezeichnet.
Erinnern wir uns zu Beginn der nun folgenden Reflexion an den Gedankengang des vorangehenden Abschnitts, wo es um reale und ideale geometrische Formen ging: Wir zeigten dort zunächst auf, wieso uns Erfahrungsobjekte als reale räumliche Formen gegenübertreten und erläuterten dann, wie sich auf Basis dieser Erscheinung entsprechende ideale räumliche Formen konstituieren. Wollen wir nun in analoger Weise argumentieren, so müssen wir uns als erstes fragen, welche Art der Erscheinung von Erfahrungsobjekten als Ausgangspunkt der Konstitution der idealen Objekte vom Typus ‚Zahl’ fungiert.
Die gesuchte Erscheinung besteht in ihrer einfachsten Gestalt darin, daß uns jeder Gegenstand als ‚genau Einer’[142] gegenübertritt, wobei wir mehrere Objekte gleichen Typs, von denen wir jedes als eine solche elementare Quantität wahrnehmen, zu Quantitäten höherer Ordnung verknüpfen können. In diesem Sinne ist es also etwa möglich, mehrere Gegenstände des Typs ‚Apfel’, von denen jeder für sich betrachtet als ‚genau ein Apfel’ erscheint, bei Bedarf in integraler Form als eine Menge von beispielsweise ‚drei Äpfeln’ zu erfassen.
Wenn wir die eben skizzierte Art der Wahrnehmung des Objekts in Analogie zu unserer transzendental-pragmatistischen Annäherung an seine Erscheinungen als räumliche Gestalt, oder als Ausgangspunkt von Kraftwirkungen verstehen wollen, dann haben wir uns drei Fragen zu stellen. Erstens gilt es herauszufinden, was der Handelnde dazu beiträgt, daß ihm jeder Gegenstand als ‚genau Einer’ gegenübertritt, zweitens ist zu überlegen, wie es möglich ist, unterschiedliche Objekte, von denen jedes als ‚genau Eines’ wahrgenommen wird, zur Erscheinung eines quantitativen Objekts höherer Ordnung zu verknüpfen, und drittens müssen wir klären, welche Absicht der Akteur verfolgt, wenn er seine Objekte auf die geschilderte Weise erfaßt.
Wir können bei der Erörterung dieser Fragen von einem der Hauptresultate unserer bisherigen Konstitutionsanalysen ausgehen. Es handelt sich dabei um das bei der Untersuchung des raum-zeitlichen Orientierungsrahmens und des Kraft-Materie-Paradigmas entdeckte transzendentalphilosophische Komplementaritätsprinzip. Dieses besagt, daß jeder Aspekt der Erscheinung eines Objekts einem bestimmten Gesichtspunkt des auf jenen Gegenstand bezogenen Handelns der erfahrenden Akteure entspricht, wobei die erwähnte Entsprechung dadurch zustande kommt, daß letztere im Zuge der Steuerung ihrer Praxis gezwungen sind, die Objekterfahrung kontinuierlich zum Erleben der betreffenden Aspekte des eigenen Tuns in Beziehung zu setzen. Geht man davon aus, daß sich auch die Wahrnehmung des Objekts als eine elementare Quantität auf einschlägige Weise konstituiert, dann ist zu fragen, welchen Aspekt ihres Handelns die Akteure in den Blick fassen müssen, damit ihnen an ihrem Gegenstand weder dessen räumliche Form noch irgend eine andere Qualität zu Bewußtsein kommt, sondern bloß dessen Bestimmung, ‚genau Einer’ zu sein.
Die Annäherung an die gesuchte Antwort gelingt am ehesten schrittweise, indem wir beim Beispiel der eingangs erwähnten Äpfel bleiben und die Konstitution der Erscheinung des Apfels als elementare Quantität (‚genau ein Apfel’) mit dem Zustandekommen von zwei weiteren Arten der Wahrnehmung dieser wunderbaren Frucht vergleichen. Es handelt sich dabei um ihren Auftritt als ein ganz bestimmtes Individuum (‚dieser Apfel hier’) bzw. als anonymer Vertreter des betreffenden Objekttyps (‚ein Apfel’ - mit ‚ein’ in der Funktion des unbestimmten Artikels und nicht jener des Zahlworts).
Wenn wir versuchen, die drei erwähnten Erscheinungsformen gegen einander abzugrenzen, wobei wir zugleich auch auf die Unterschiede in der jeweils erfahrungskonstitutiven Praxis des Akteurs achten, so kommen wir zu folgendem Ergebnis:
Die einzelne Frucht erscheint mir als anonymer Vertreter des Typus ‚Apfel’ wenn ich bei ihrer Betrachtung nur auf das achte, was sie mit allen anderen Repräsentanten jenes Typus gemein hat. Die Handlungssituation, in der eine solche Erscheinung für mich entsteht, ist die einer ersten Orientierung, in der es (noch) nicht um konkrete Aktionen geht. Dabei wird ein zuvor noch nicht wahrgenommenes bzw. beachtetes Objekt durch seine projektive Unterordnung unter ein bestimmtes Set von Verhaltensregeln mit einer bestimmten Palette von Interaktionschancen in Verbindung gebracht, wodurch ich es noch nicht zu meinem aktuellen Handlungsgegenstand erkläre, sondern bloß für mögliche spätere Aktionen zugänglich mache.
Dieselbe Frucht tritt mir als Individuum des Typus ‚Apfel’ gegenüber, wenn ich mich für die Besonderheiten interessiere, welche sie von allen übrigen Vertretern desselben Typus unterscheiden. Dies ist dann der Fall, wenn ich diese Besonderheiten entweder um ihrer selbst willen suche bzw. fliehe (weil ich sie liebe bzw. scheue), oder genauer wahrnehmen möchte, um meine Interaktionen mit der betreffenden Frucht (also etwa meine Pflück- oder Schälhandlungen) zu optimieren. Im Gegensatz zu der zuerst behandelten Erscheinungsform ist der Gegenstand hier bereits im Visier meiner aktuellen Praxis, weshalb wir verallgemeinernd sagen können, daß sich die Wahrnehmung meines Gegenübers als ein Individuum stets vor dem Hintergrund eines unmittelbar auf das betreffende Objekt bezogenen Handelns vollzieht.
Während meine Aufmerksamkeit sowohl bei der Erscheinung des Objekts als Individuum als auch bei jener als anonymer Repräsentant des Typus ‚Apfel’ nur zwischen dem jeweiligen Gegenstand und jenem Set von Verhaltensregeln pendelt, das diesen Typus bildet, stelle ich meinen Gegenstand bei seiner Wahrnehmung als eine elementare Quantität der genannten Art (‚genau ein Apfel’) anderen Vertretern desselben Typus zur Seite. Eine elementare Quantität ist unser Apfel für mich nämlich nur dann, wenn ich ihn weder als Individuum mit all seinen Besonderheiten noch als isolierten Repräsentanten seines Typus (‚Apfel’) sehe, sondern vielmehr im Auge habe, daß er für mich dieselbe Palette von Interaktionschancen repräsentiert, wie jeder andere Vertreter des betreffenden Typs (also ihn zu pflücken, zu lagern, zu schälen, zu essen, usw.). Dieser Aspekt seiner Erscheinung tritt in den Vordergrund, sobald ich im Zuge der Planung meines künftigen Tuns die durch unterschiedliche Vertreter desselben Objekttyps verkörperten Handlungsmöglichkeiten mit einander zu Handlungspotentialen höherer Ordnung verknüpfe (indem ich etwa plane, mehrere Pflückhandlungen zu vollziehen).
Versuchen wir nun, die aus der vorangehenden vergleichenden Analyse dreier Wahrnehmungsmuster resultierenden Einsichten in die Konstitution der Erfahrung von Quantitäten im Hinblick auf die drei leitenden Fragestellungen unserer aktuellen Reflexion zusammenzufassen, so können wir zunächst festhalten, daß die Wahrnehmung des Gegenstands in Gestalt einer elementaren Quantität bestimmten Typs (‚genau ein Apfel’) grundlegend andere Funktionen für das Handeln hat als jene Wahrnehmungsformen, welche der Erscheinung des Objekts als anonymer Vertreter des betreffenden Typs oder als ein ihn verkörperndes Individuum zugrunde liegen. Sie konstituiert sich für die Akteure bei der Planung ihres Verhaltens, etwa im Rahmen von systematisch gestalteter Arbeitsteilung oder Vorratswirtschaft, im Zuge derer sie die durch einzelne Objekte gleichen Typs repräsentierten Interaktionsmöglichkeiten zu Interaktionspotentialen höherer Ordnung verknüpfen.
Was dabei zunächst gedanklich verbunden wird, sind die Handlungen, welche sich auf die Interaktionspotentiale der verschiedenen Vertreter des jeweiligen Objekttyps beziehen. Wenn es die planende Reflexion also etwa mit Äpfeln zu tun hat, und jeder derselben repräsentiert die Möglichkeit, gepflückt zu werden, so verknüpft sie die einzelnen Pflückhandlungen zu einer höherstufigen Aktion[143], indem sie entweder Wiederholungen der betreffenden Handlung durch ein und denselben Akteur oder gleichzeitiges Ausführen durch verschiedene Akteure denkt. Komplementär zu diesem Verknüpfen der auf die Interaktionspotentiale von Objekten gleichen Typs bezogenen Handlungen scheinen ihr dann auch die entsprechenden Interaktionspotentiale selbst mit einander zu verschmelzen.
Unsere Analyse der Konstitution der Erfahrung von Quantitäten hat somit zwei Hauptergebnisse:
1. Wenn der Akteur Objekte beliebigen, aber jeweils gleichen Typs im Zuge der Planung seines Handelns als Träger von prinzipiell verknüpfbaren Interaktionspotentialen betrachtet, erscheinen sie ihm als elementare Quantitäten.
2. Sobald seine planende Reflexion die auf jene Objekte bezogenen Handlungen zu höherstufigen Aktionen verknüpft, verbinden sich für ihn die ihm erscheinenden elementaren Quantitäten zu größeren Quantitäten.
Wir haben bis jetzt immer nur über die Quantität von Objekten bestimmten Typs, also über Erscheinungen wie ‚genau ein Apfel’, oder ‚drei Äpfel’ gesprochen. Es ist aber klar, daß die Quantitätswahrnehmung als kognitives Instrument erst dann vollständig zur Entfaltung kommt, wenn den Handelnden bewußt wird, worin das Gemeinsame an Erscheinungen wie ‚genau ein Apfel’ und ‚genau ein Schaf’ oder etwa ‚drei Äpfel’ und ‚drei Schafe’ besteht. Die Situation ist also dieselbe wie bei der im vorangehenden Abschnitt behandelten geometrischen Form: Auch die ist als solche erst dann erfaßt, wenn die Akteure sie gedanklich als eine eigenständige Eigenschaft festzuhalten vermögen, die sich an Gegenständen unterschiedlichsten Materials manifestiert.
Im Fall der Quantitätserfahrung bedeutet dies, daß der Sinn des ‚Genau eines Seins’ erst dann vollständig begriffen ist, wenn verstanden wurde, daß nicht bloß der Apfel oder das Schaf, sondern das Objekt völlig beliebigen Typs, ‚genau eines’ ist, sobald man es nur als Träger eines Interaktionspotentials auffaßt, das in Beziehung zu den durch andere Objekte gleichen Typs repräsentierten Interaktionspotentialen gesetzt werden kann, sodaß der planenden Reflexion gänzlich gleichartige und daher jederzeit verknüpfbare Gegenstände erscheinen.
Hand in Hand mit dieser Verallgemeinerung der Erscheinung von Quantitäten geht eine weitere Veränderung der Quantitätserfahrung: Während nämlich ursprünglich das auf der Objektseite wahrgenommene Verschmelzen elementarer Quantitäten zu größeren Aggregaten bloß als Pendant zu der im Zuge von Planungsaktivitäten durchgeführten Verknüpfung von Einzelaktionen zu höherstufigen Handlungen erlebt wird, verschiebt sich bei oftmaliger Wiederholung dieses Vorgangs der Brennpunkt der Aufmerksamkeit der planenden Akteure zum Objekt hin.
Ging es ihnen ursprünglich um die Verknüpfung ihrer eigenen Handlungen, so werden bald nur noch die von diesen Handlungen anvisierten Objekte mit einander verbunden, wobei nach und nach sogar das Wissen darum verloren geht, daß jenes Verbinden von Gegenständen bloß deshalb möglich ist, weil letztere als Träger von Interaktionspotentialen für ihrerseits verknüpfbare Handlungen fungieren. Die der Wahrnehmung von Quantitäten zugrunde liegende Komplementarität von Objekt- und Selbsterfahrung wird damit allmählich durch einen dichten Schleier des Objektivismus zugedeckt, der den Anteil des Subjekts am Zustandekommen der Quantitätserfahrung verbirgt.
Die Verallgemeinerung der Quantitätserfahrung, welche auf der einen Seite zu deren objektivistischer Verfremdung führt, ist aber auf der anderen Seite die Basis für das Entstehen der reinen Mathematik. Denn das mit dieser Verallgemeinerung einhergehende Begreifen der Quantität als eine eigenständige Eigenschaft, die an jeder beliebigen Art von Erfahrungsgegenständen zur Erscheinung gebracht werden kann, ist die Voraussetzung dafür, daß es zur Bildung jener idealen Quantitäten kommt, die wir als ‚natürliche Zahlen’ bezeichnen. Analog zum idealen geometrischen Gegenstand, den wir als ein Gedankenobjekt kennen lernten, dessen einziges Merkmal in einer bestimmten räumlichen Form besteht, ist nämlich die natürliche Zahl ein gedanklich erzeugter Gegenstand, der keine andere Bestimmung besitzt als seine jeweilige Quantität. Um einen derartigen Gegenstand denken zu können, muß daher die mentale Ablösung der Quantität von allen Qualitäten bereits vollzogen sein.
Auch der intellektuelle Vorgang, der schließlich zur Produktion des idealen Objekts ‚natürliche Zahl’ führt, verläuft parallel zum entsprechenden Prozeß bei der Konstitution idealer geometrischer Gegenstände. Um die betreffende Analogie sichtbar zu machen, wollen wir uns kurz an den Übergang vom Erfahren einer geometrischen Form zur Erzeugung eines entsprechenden idealen Formobjekts erinnern: Wir hatten es dabei mit einem Prozeß zu tun, in dessen Verlauf der Akteur zunächst nach einer Regel sucht, die es ihm gestattet, das Handeln, welches seine Erfahrung der betreffenden Form beim Kontakt mit realen Objekten konstituiert, aus sich heraus zu rekonstruieren. Ist diese Regel dann gefunden, so kann er sie als Anleitung zur Konstruktion der Form eines gedachten Gegenstands verwenden, der keine andere Eigenschaft aufweist als eben jene Form.
Versuchen wir nun vor dem Hintergrund dieser kurzen Skizze zu verstehen, wie es dazu kommt, daß der Akteur reine Quantitäten in Gestalt von natürlichen Zahlen erzeugt, dann müssen wir wie bei den geometrischen Formen zunächst wieder von der entsprechenden Erfahrung ausgehen, wobei es sich im vorliegenden Fall selbstverständlich nicht um die Erfahrung realer räumlicher Formen sondern um das Wahrnehmen realer Quantitäten handelt.
So wie sich die körperliche Bewegung des Akteurs als sein für die Erscheinung räumlicher Formen konstitutives Handeln bei der Erfahrung einer realen räumlichen Form durch den Kontakt mit dem betreffenden Objekt (genauer gesagt mit dessen Oberfläche) steuern läßt, ist auch die planende Reflexion, also jenes Handeln, das konstitutiv ist für das Erscheinen des Gegenstands als Träger eines Interaktionspotentials, bei der Erfahrung einer realen Quantität auf den Objektkontakt angewiesen. Die Steuerung geschieht hier aber nicht durch die hinter dem Tastkontakt mit der Körperoberfläche des jeweiligen Gegenübers stehende Frage nach dem ‚Wo’, sondern durch die Frage nach dem ‚Wieviel’, welche gleichsam die Funktion einer Zauberbrille hat, die dem Akteur gleichartige Objekte beliebigen Typs als Träger von prinzipiell verknüpfbaren Interaktionspotentialen zeigt.
Da die Suche nach derartigen Interaktionspotentialen niemals um ihrer selbst Willen stattfindet, sondern stets auf bestimmte übergeordnete Ziele des Handelns bezogen ist, weist sie für gewöhnlich eine zweifache Fokussierung auf. Zum einen ist die jene Suche leitende Frage nach dem ‚Wieviel’ stets auf einen ganz bestimmten Objekttyp bezogen (‚Wieviele Äpfel?’, ‚Wieviele Schafe?’ usw.) und zum anderen wird in ihr fast immer ein bestimmtes Handlungsfeld abgrenzt, innerhalb dessen nach verknüpfbaren Interaktionspotentialen gefahndet werden soll. Diese Abgrenzung kann zum Beispiel durch räumliche oder soziale Kriterien geschehen, was im ersten Fall zu Fragestellungen des Typs ‚Wieviele Äpfel liegen hier unter dem Baum?’ und im zweiten zu Fragen der Art ‚Wieviel Schafe gehören dieser Familie?’ führt. Ergebnis der Suche ist in jeder der beiden Varianten die Wahrnehmung einer bestimmten, als Anzahl bezeichneten realen Quantität, welche dadurch zustande kommt, daß der Akteur alle in dem doppelt abgegrenzten Fahndungsbereich gefundenen elementaren Interaktionspotentiale zu einem Interaktionspotential höherer Ordnung verknüpft.
Überlegen wir nun, wie es ausgehend von der eben beschriebenen Konstitution der Erfahrung realer Quantitäten (Anzahlen) zur Erzeugung von idealen Quantitäten (natürlichen Zahlen) kommt, so ist zunächst nochmals an den bereits eingangs erwähnten Umstand zu erinnern, daß die wichtigste Voraussetzung für die Produktion eines idealen Objekts, dessen einziges Merkmal seine jeweilige Quantität ist, in der Fähigkeit des Akteurs besteht, jene Quantität in vollständiger Loslösung von allen sonstigen Objektmerkmalen als gänzlich eigenständige Eigenschaft festzuhalten. Denn erst sobald ihm dies gelingt, hat er das für die Erfahrung der Quantität konstitutive Handeln in absoluter Reinheit erfaßt und wird es auch unabhängig vom Kontakt mit realen Objekten aus sich heraus reproduzieren können, um auf diesem Wege einen idealen Gegenstand des genannten Typs zu erzeugen.
Konkret geht der Akteur dabei so vor, daß er sich zunächst ähnlich dem entsprechenden Verfahren bei der Konstruktion von idealen geometrischen Objekten einen völlig abstrakten Gegenstand vorstellt. Das bedeutet, daß er ein Objekt denkt, dessen imaginiertes Verhalten nur solchen Erwartungen entspricht, welche jedem Gegenstand, unabhängig von seinen konkreten Eigenschaften, zukommen. Ergänzend dazu muß er sich jene Sicht auf die realen Objekte vergegenwärtigen, aus deren Perspektive ihm Gegenstände gleichen Typs als Träger von beliebig verknüpfbaren Interaktionspotentialen erscheinen. Wenn er nun das vorgestellte abstrakte Objekt aus der genannten Perspektive betrachtet, so überträgt er auf diesen keinerlei konkrete Eigenschaften aufweisenden Gegenstand eben durch seine Art der Betrachtung das Merkmal, Interaktionspotential zu repräsentieren. Er wird dadurch für ihn zu jener völlig inhaltsleeren elementaren Quantität, die wir als ‚Eins’ bezeichnen.
Der Handelnde ist nun in der Lage, auf die eben geschilderte Weise ganz nach Wunsch, Laune oder Bedarf derartige Einsen zu produzieren, wobei sich letztere wegen des schon bei der Analyse der idealen geometrischen Formen erwähnten Fehlens jeder Spannung zwischen dem Individuum und seinem Objekttyp untereinander alle aufs Haar gleichen. Da ferner sämtliche Einsen aufgrund ihrer Inhaltsleere mit einander verknüpfbar sind, kann er beliebige solcher Verknüpfungen herstellen und erhält dabei jeweils unterschiedliche ideale Quantitäten höherer Stufe, oder mit anderen Worten, jeweils verschieden große natürliche Zahlen.
Er verfügt damit über zwei Handlungsregeln, von denen ihm die eine zur Schaffung der Grundbausteine eines Universums idealer Quantitäten dient, während er mittels der anderen sämtliche aus diesen Grundbausteinen zusammengesetzten Objekte jenes Universums erzeugen kann. Was ihm nun noch fehlt, ist eine ergänzende Vorschrift, welche es ihm gestattet, dieses Produzieren von höherstufigen Quantitäten so zu vollziehen, daß seine Resultate auf bestimmte Weise geordnet erscheinen. Denn erst dann, wenn dies der Fall ist, können bereits erzeugte höherstufige Quantitäten präzise von einander unterschieden bzw. gezielt reproduziert werden.
Wir sind damit genau an dem uns schon von der Analyse der Konstitution reiner geometrischer Formen her bekannten Punkt angelangt, wo an die Stelle des bei der Wahrnehmung durch das Objekt gelenkten Erfahrens das gezielte, durch eine selbst gesetzte Regel gesteuerte Produzieren einer Vorstellung tritt. Während wir es im ersten Fall, also bei dem durch die Wahrnehmung realer Objekte gesteuerten Erfahren von Quantitäten mit einem Abzählen zu tun haben, liegt im zweiten, nun darzustellenden Fall jenes durch eine Ordnungsregel autonom gesteuerte Erzeugen von idealen Quantitäten vor, das wir als Zählen bezeichnen.
Die ergänzende Vorschrift, welche die noch fehlende Ordnung im Universum der reinen Quantitäten erscheinen läßt und damit das Zählen ermöglicht, besteht in der Anweisung, alle auf die geschilderte Weise produzierbaren Quantitäten höherer Stufe der Reihe nach so hinter der elementaren Quantität anzuordnen, daß jede Quantität höherer Stufe genau einen Nachfolger hat, der sich von ihr nur durch die zusätzliche Verknüpfung mit genau einer weiteren elementaren Quantität unterscheidet. Diese Vorschrift verbindet die Akte der Produktion von sämtlichen denkbaren reinen Quantitäten höherer Stufe mit einander, sodaß die Regel zur Erzeugung einer beliebigen natürlichen Zahl einerseits indirekt aus der Regel zur Erzeugung ihres Vorgängers hervorgeht und andererseits selbst schon die Regeln zur Erzeugung aller ihr nachfolgenden natürlichen Zahlen enthält.
Die Anwendung der eben erwähnten Ordnungsvorschrift bei der Erzeugung von natürlichen Zahlen sorgt nicht nur dafür, daß eine gezielte Produktion von reinen Quantitäten bestimmter Größe erfolgen kann. Sie ist auch die Voraussetzung dafür, daß der Betrachter des auf die geschilderte Weise erzeugten Universums der reinen Quantität zwischen den verschiedenen Objekten jener Kunstwelt ein lückenloses und konsistentes Netz von quantitativen Relationen[144] (größer bzw. kleiner als ...) wahrnimmt. Denn erst das Vorhandensein einer solchen geordneten Zahlenreihe stellt jede Zahl in Bezug zu sämtlichen übrigen konstruierbaren Zahlen und eröffnet damit die Möglichkeit für einen systematischen Vergleich der Rangplätze der einzelnen Zahlen innerhalb der Gesamtheit aller reinen Quantitäten.
Es liegt auf der Hand, daß das eben beschriebene Prinzip einer Reihe, in der jedes Glied genau einen Vorgänger bzw. Nachfolger hat, nichts anderes als eine bestimmte räumliche Anordnung der natürlichen Zahlen ist. Denn der Begriff der Reihe impliziert sowie die mit ihm verbundenen Begriffe des Vorgängers bzw. Nachfolgers die Vorstellung von einem Nebeneinander. Das eben aufgezeigte Erfordernis des Herstellens von Ordnung im Universum der idealen Quantitäten führt somit dazu, daß der Akteur die zuvor mühsam von allen qualitativen Beimengungen gesäuberte Erscheinung reiner Quantitäten nachträglich wieder mit einer räumlichen Gestalt versieht - womit wir einem weiteren Wechselbezug zwischen der Konstitution der Objekte der Geometrie und jener der Objekte der Arithmetik auf die Spur gekommen sind.
Auch die dimensionale Struktur des durch die natürlichen Zahlen gebildeten Zahlenraums ist transzendental begründbar, wissen wir doch aus unserer Analyse der Konstitution der Dimensionalität des Raumes[145], daß die Anzahl der einen bestimmten Raum strukturierenden Dimensionen von der Anzahl der Richtungsentscheidungen abhängt, welche bei jeder Fortsetzung der den betreffenden Raum konstituierenden Bewegung zu treffen sind. Weil nun das bei der Erzeugung höherstufiger Quantitäten zu vollziehende Handeln immer nur in demselben Akt des Hinzufügens eines weiteren Interaktionspotentials zu einer bereits vorhandenen Verknüpfung von Interaktionspotentialen besteht, und daher keine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten erfordert, erscheint auch der Zahlenraum als ein bloß eindimensionales Gebilde, das heißt als ein Zahlenstrahl, der seinen Ausgangspunkt bei der elementaren Quantität nimmt und alle übrigen natürlichen Zahlen als Punkte enthält.
Die Erscheinung von realen und idealen Quantitäten ist nun auf die jeweils zugrunde liegende gesellschaftliche Praxis zurückgeführt, und wir wollen unsere diesbezüglichen Erläuterungen nur noch um eine kleine, aber wichtige Akzentuierung ergänzen. Es handelt sich dabei um die Darstellung des Unterschieds zwischen der Erscheinung der Quantität und jener des ökonomischen Werts. Die Objekteigenschaft des Werts konstituiert sich im Zuge der über Austauschprozesse vermittelten Arbeitsteilung, und es besteht ein sehr enger Zusammenhang mit der Konstitution der Quantitätserscheinung. Denn die Notwendigkeit allen zu tauschenden Produkten bestimmte Werte zuzuordnen und deren jeweilige Höhe im Akt des Tausches zu vergleichen, wobei dann diese Werte als Tauschwerte erscheinen, ist eine der Voraussetzungen für die Herausbildung von stabilen quantitätsorientierten Bewußtseins- und Motivationslagen und damit für die Entstehung einer eigenständigen quantitativen Dimension unseres Weltbilds.
Wenn wir von dem auch durch Marx übernommenen Wertbegriff der klassischen Ökonomie ausgehen, dann ist die am Produkt erscheinende Werthaltigkeit Resultat des Umstands, daß es durch Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im allgemeinsten, abstraktesten Sinne erzeugt wurde.[146] Abgesehen davon, daß sie sich zunächst nur an den vom Menschen produzierten Gegenständen zeigt[147], unterscheidet sich die so konstituierte Objekteigenschaft von der Quantität unter zwei Gesichtspunkten:
1. Zu Quantitäten werden Objekte dadurch, daß sie Interaktionspotentiale, also Ansatzpunkte für mögliche künftige Tätigkeit repräsentieren. Werte sind sie dagegen als Resultate vergangener Tätigkeit.
2. In ihrer Erscheinung als Quantitäten können Gegenstände mit anderen Objekten desselben Typs verknüpft werden, während man sie als ökonomische Werte gegen andere Objekte beliebigen Typs eintauschen kann.
Zusammenfassend können wir daher feststellen, daß sich die Erscheinung der Quantität im Zuge des Verknüpfens von Potentialen für künftige Handlungen konstituiert, während die Erscheinung des ökonomischen Werts vor dem Hintergrund des systematischen Austausches von arbeitsteilig erzielten Ergebnissen vergangener Handlungen entsteht.
In beiden Praxisfeldern kommt es zur Erzeugung von künstlichen Objekten, welche die jeweilige Eigenschaft in reiner Form verkörpern. Während man die reine Quantität durch die Zahl vergegenständlicht, wird der als Tauschwert erscheinende reine ökonomische Wert in Gestalt des Geldes objektiviert. Beide Arten von Kunstobjekten unterscheiden sich durch ihre jeweilige Zweckbestimmung: Die Zahlen wurden zur Perfektionierung der beim Verknüpfen von Quantitäten zu vollziehenden Tätigkeitsabläufe geschaffen, während das Geld der Vereinfachung der Handlungsvollzüge dient, welche beim systematischen Tausch von Objekten mit ökonomischem Wert anfallen.
6.13 Das Universum der reinen Quantität
Es gilt jetzt die transzendental-pragmatistische Untersuchung der Strukturen des Universums der reinen Quantität zu vertiefen und wir beginnen die Umsetzung dieses Vorhabens mit dem Nachtrag von zwei ergänzenden Bemerkungen zum Stellenwert jenes Universums für den Handelnden:
Die erste befaßt sich mit der Art des Seins der Zahl und weist darauf hin, daß das ideale quantitative Objekt genau wie die ideale räumliche Form in sehr wörtlichem Sinne nichts anderes ist, als jenes Bündel selbst geschaffener Regeln, welche uns bei seiner Produktion leiten und zugleich damit nicht nur sein Verhalten (bzw. seinen Begriff) definieren, sondern auch festlegen, wie wir im Kontakt mit ihm zu agieren haben. Wenn es also irgend einen Sinn hat, vom ‚Sein der Zahlen’ zu sprechen, dann ‚sind’ diese nur als das Geflecht der eben erwähnten Regeln, wobei deren Existenz, wie bereits in 6.11 erwähnt, als ein sozialer Prozeß zu verstehen ist. Gemeint ist der Prozeß, im Zuge dessen die Akteure einerseits an der kontinuierlichen Bekräftigung jener Übereinkunft arbeiten, welche wir als die Geltung der betreffenden Regeln bezeichnen und andererseits in wechselseitiger Kritik um die korrekte Anwendung besagter Regeln ringen.
[...]
[1] Zum Regelbezug des Objektverhaltens vgl. 4.4, zum Stellvertreterprinzip vgl. 4.2
[2] Mit der Differenzierung zwischen dem Begriff und seiner sprachlichen Gestalt werden wir uns erst bei den der Sprache gewidmeten Überlegungen befassen.
[3] Die Definition des Begriffs als ein Set von Regeln ist äquivalent zu seiner Bestimmung als ein Ensemble von Erwartungen, da eine vollständige Entsprechung zwischen den beiden Termini der Erwartung und der Regel besteht: Auf der einen Seite sind Regeln nichts anderes als übereinstimmende wechselseitige Verhaltenserwartungen von Interaktionspartnern. Auf der anderen Seite sind alle Erwartungen mit innerer Notwendigkeit auf Verhaltensregeln bezogen. Ich vermag es zwar, mir beliebige, von jeder Regel unabhängige Inhalte von Erwartungen auszudenken, kann mir also etwa vorstellen, daß der Erzbischof von Wien morgen früh den Kaffee an mein Bett serviert - tatsächlich erwarten kann ich derlei aber nur, wenn ich ihm die Orientierung an einer entsprechenden Verhaltensregel unterstelle. Alles andere sind bloße Wünsche oder Phantasien.
[4] idea: das Erschaute
[5] Das Allgemeine ist im Lateinischen das ‚universale’.
[6] Die sozialhistorische Basis des Übergangs vom Universalienrealismus zum Nominalismus an der Schwelle zur Neuzeit wurde bereits in Abschnitt 5.3 dargestellt.
[7] Tugendhat, E., Wolf, U. (1983), Seite 131
[8] a.a.O., Seite 131
[9] Kant, I. (1781), Seite 216 f.
[10] Husserl spricht in seinen „Logischen Untersuchungen“ ausdrücklich von allgemeinen Gegenständen, die wir in allgemeinen Anschauungen konstituieren; vgl. Husserl, E. (1901), § 52
[11] Vgl. Frege, G. (1891), Seite 28
[12] Die transzendentale Analyse der Konstitution der Quantitätserfahrung und der Vorstellung von reinen Quantitäten in Gestalt von Zahlen erfolgt in den Abschnitten 6.12 bis 6.16, wobei Abschnitt 6.16 eine Erörterung des Konzepts der Funktion enthält.
[13] Frege, G. (1891), Seite 26
[14] a.a.O., Seite 26
[15] a.a.O., Seite 28
[16] Vgl. Abschnitt 4.3
[17] Vgl. etwa Tugendhat, E., Wolf, U. (1983), Seite 141 f.
[18] Das deutsche Wort Gegenstand ist im 17. Jahrhundert als Übersetzung des lateinischen ‚objectum’ entstanden, welches im Englischen und Französischen weiterlebt. Vgl. Kamlah, W., Lorenzen, P. (1996), Seite 43
[19] a.a.O., Seite 43
[20] Die in Band I präsentierten Analysen zum raum-zeitlichen Bezugsrahmen und zum Kraft-Materie-Paradigma sollten zur Genüge bewiesen haben, daß selbst auf jener fundamentalsten Ebene unserer Erkenntnisaktivität, auf der wir uns immer in derselben Weise verhalten, noch viele überraschende und auch gehaltvolle, weil für den einzelwissenschaftlichen Forschungsprozeß durchaus nicht folgenlose Entdeckungen zu machen sind.
[21] Vgl. auch die transzendentale Analyse des Satzes vom Widerspruch in Abschnitt 8.7
[22] In der Sprache der philosophischen Tradition werden seit Aristoteles ‚zufällige’ von ‚wesentlichen’, also der jeweiligen Regel entsprechenden, Eigenschaften der Gegenstände unterschieden. Vgl. Kamlah, W., Lorenzen, P. (1996), Seite 101
[23] Unter den großen Philosophen ist es wieder einmal Leibniz, der den hier angesprochenen Aspekt des Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesses am deutlichsten sieht. Er unterscheidet zwischen „petites perceptions“ und „apperceptions“, wobei erstere die nicht klar und deutlich im Bewußtsein vorhandenen Vorstellungen bezeichnen und sich damit auf das beziehen, was wir eine implizite Erwartung nennen, während letztere bewußt reflektierte Vorstellungen, also explizite Erwartungen, darstellen. Die Konzeption von Leibniz unterscheidet sich vom hier vertretenen Ansatz durch das Fehlen der Einsicht, daß es sich bei beiden Vorstellungsarten um Erwartungen handelt, die sich im Zuge der gemeinsamen Befolgung von Handlungsregeln konstituieren. Darüber hinaus begeht Leibniz, wie bereits in 3.8 angedeutet, den Fehler, im Objekt nicht bloß eine modellhafte Nachbildung des Subjekts zu sehen, sondern dieses als Realsubjekt zu begreifen. Als solches verfügt der Gegenstand für ihn auch selbst über petites perceptions. Diese erfüllen damit in der Philosophie von Leibniz jene Funktion, die im vorliegenden Ansatz an das Komplementaritäts-, das Äquivalenz- und das Stellvertreterprinzip delegiert ist, welche in ihrem Zusammenspiel eine virtuelle Subjektivität in die Objektsphäre hineintragen.
[24] Wie schon bei der vorangehenden Diskussion des Begriffs differenzieren wir auch hier zunächst nicht zwischen den Kategorien und ihrer sprachlichen Gestalt, mit welcher wir uns erst bei den der Sprache gewidmeten Überlegungen befassen.
[25] Eine derartige Fehldeutung findet sich in Kants Kritik der reinen Vernunft; vgl. Kant, I. (1781), Seite 151. Im Anschluß daran begehen auch andere Autoren denselben Fehler; vgl. etwa Kamlah, W., Lorenzen, P. (1996), Seite 92
[26] Um beispielhaft zu erläutern, was wir unter der Ausprägung einer Kategorie verstehen, ist ein kurzer Vorgriff auf die weitere Argumentation erforderlich. Es werden in deren Verlauf vier Kategorien näher untersucht. Eine davon ist die Kategorie der Eigenschaft. Die einzelnen Ausprägungen dieser Kategorie sind die verschiedenen Eigenschaften: schwer, träge, schnell, hart, usw.
[27] Bei den Erscheinungen von Merkmals- bzw. Tätigkeitstypen (‚die Härte’, ‚das Fallen’ usw.) handelt es sich um die Resultate von höherstufigen Konstitutionsprozessen, mit denen wir uns erst im Abschnitt 6.5 näher befassen werden.
[28] Vgl. Abschnitt 8.5, wo wir der Kategorie der Objekteigenschaft jene der Verhaltenseigenschaft gegenüberstellen werden.
[29] Wie schwer es ist, den ontologischen Schein von an sich gegebenen Objekteigenschaften zu durchbrechen und konsequent an der Einsicht festzuhalten, daß sich das, was wir als Objekteigenschaft wahrnehmen, immer nur vor dem Hintergrund der Ziele unseres jeweiligen Handelns konstituiert, wird deutlich, wenn wir erfahren, daß selbst C. S. Peirce, der Vater des Pragmatismus, der Meinung war, es gebe neben den handlungskonstituierten Merkmalen des Objekts, wie etwa seiner nur unter dem Druck des Messers zu erfahrenden Härte, auch so etwas wie unmittelbar erlebbare Qualitäten, wie etwa seine Farbe. Die detaillierte Kritik dieser Position findet sich in Abschnitt 9.4
[30] Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen kann das Newtonsche Axiom der Gleichheit von actio und reactio als spezifischer Ausdruck des für alle Wahrnehmungen geltenden Komplementaritätsprinzips im Bereich der Krafterfahrung interpretiert werden.
[31] Merkmale, deren Ausprägung bei einem Gesamtobjekt genau der Summe ihrer Ausprägungen bei dessen einzelnen Teilen entspricht, werden als extensiv bezeichnet. Beispiele dafür sind Masse, elektrische Ladung und Energie. Das Gegenstück dazu sind intensive Eigenschaften, wie etwa die Farbe, welche für eine Gesamtgruppe von gleichartigen Elementen dieselbe Ausprägung aufweisen wie für jeden ihrer Teile. Vgl. Krieger, M. (1992), Seite 21
[32] Man denke etwa an den Versuch, einen Körper mittels des Seils ein Stück weit zu ziehen: So wie beim Spiel des ‚Seilziehens’ jeweils alle Mitglieder der mir gegenüberstehenden Gruppe gemeinsam an ihrem Ende des Seils ziehen, scheinen auch alle Teile des betreffenden Körpers gemeinsam an dem um ihn geschlungenen Seil zu ziehen.
[33] Vgl. die Ausführungen zum Bedeutungsgehalt unserer Rede vom Neben- und Nacheinander in den Abschnitten 2.2 bis 2.4
[34] Vgl. etwa Tugendhat, E., Wolf, U. (1983), Seite 81, wo die Kategorie der Relation anhand des Beispielsatzes ‚Peter malt einen Kreis‘ eingeführt wird. Erläuternd heißt es dann: „Der Ausdruck ‚malt ...‘ ist ein Relationsausdruck. Andere Relationsausdrücke sind z.B. ‚ist größer als ...‘, ‚ist Vater von ...‘. Solche Ausdrücke stehen nicht für eine Eigenschaft eines Gegenstandes, sondern für die Relation, in der ein Gegenstand zu einem anderen steht, der dann in dem ergänzenden Ausdruck (z.B. ‚einen Kreis‘) genannt wird.“
[35] Vgl. Abschnitt 8.1
[36] Wenn dabei, wie etwa im Fall der Anwendung des Modells der informationsverarbeitenden Maschinen auf das Verständnis des menschlichen Gedächtnisses, objektbezogene Paradigmen zur Grundlage von Theorien werden, welche ihrerseits menschliches Verhalten zum Gegenstand haben, dann kommt es zu einer über das Objekt vermittelten Selbstinterpretation des Subjekts. Vgl. auch die diesbezüglichen Ausführungen am Beginn des Abschnitts 4.5.
[37] Vgl. Kuhn, Th. S. (1962)
[38] Vgl. a.a.O., Seite 25
[39] Die systematisch-erkenntnistheoretische Funktion unseres Paradigmenkonzepts wird auch daran deutlich, daß es sich nicht bloß auf wissenschaftliches Erkennen bezieht: So wie die Begriffe und Kategorien nicht nur in methodisch reflektierter Gestalt auftreten, sondern schon den aller Wissenschaft vorausgesetzten alltäglichen Zugang zur Welt strukturieren, gibt es auch Theorien und Paradigmen bereits auf der Ebene unseres Alltagsbewußtseins.
[40] Kant, I. (1781), Seite 50f.; Hervorhebungen durch I. Kant.
[41] Vgl. Abschnitt 5.4
[42] Neben den möglichen Modifikationen des kategorialen Rahmens gibt es noch weitere Spielarten der Veränderung im Bereich des apriorischen Gehalts unserer Erfahrung. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der in Abschnitt 3.10 analysierte Übergang von der klassischen Raum-Zeit zum relativistischen Raum-Zeit-Kontinuum. Die dabei stattfindende Veränderung des aller Erfahrung vorausgesetzten raum-zeitlichen Bezugsrahmens resultiert nicht aus einem Wandel des sozialen Hintergrunds der Kategorien, sondern hängt damit zusammen, daß die technische Entwicklung ein Niveau erreicht, auf dem eine wesentliche Eigenschaft des zur Koordinierung der Zeitmessungen verwendeten Objekts Licht (nämlich dessen Geschwindigkeit) erstmals erfahrbar bzw. meßbar wird.
[43] Die Bestimmung des systematischen Stellenwerts der zuletzt beispielhaft erwähnten Arten von Kategorien erfolgt erst im Rahmen der transzendentalen Analyse der Tätigkeit des Urteilens. Vgl. Abschnitt 8.3
[44] Vgl. etwa Kamlah, W., Lorenzen, P. (1996), Seite 92
[45] Die gesamte Argumentation des vierten Teils der vorliegenden Studie, in der wir das wechselseitig bewirkte aktive und passive Verhalten der Körper und ihre im Zuge dieses Verhaltens konstituierten Eigenschaften analysierten, ist nichts anderes als eine im Bereich der klassischen Mechanik vorgenommene Suche nach solchen im Kommunikationsschema wurzelnden Interpretationselementen und ihren Wechselbezügen.
[46] Vgl. Kamlah, W., Lorenzen, P. (1996), Seite Seite 92
[47] Die Thematik der Relation ist in der nun folgenden Reflexion auf das Wesen der qualitativen und quantitativen Relationen noch nicht mit der erforderlichen Vollständigkeit erfaßt. Wir werden uns daher im Rahmen der im Teil 8 stattfindenden transzendentalen Untersuchungen zur Logik neuerlich mit den Relationen befassen und dabei noch einem weiteren Relationstyp begegnen. (Vgl. die Abschnitte 8.9 und 8.10)
[48] Vgl. die Ausführungen zur Tätigkeit des Messens in Abschnitt 6.15
[49] Mehr zu dieser spezifisch abgewandelten Form der Reflexivität bei virtuellen Subjekten in 8.10
[50] Das ‚und’ ist im vorliegenden Fall sprachlicher Ausdruck der qualitativen Relation.
[51] Ausdrücke wie ‚die Schärfe’ heißen in der Sprache der Logiker „abstrakte singuläre Termini“, weil sie jeweils für einen einzelnen, abstrakten Gegenstand - ein Universale - stehen. Vgl. Tugendhat, E., Wolf, U. (1983), Seite 142.
Es ist von entscheidender Bedeutung, daß wir die Gegenständlichkeit dieser Universalien nicht im ontologischen bzw. platonischen Sinne mißverstehen, sondern als Resultat des oben dargestellten Konstitutionsprozesses begreifen.
[52] Beispiel für das, was wir eine eindimensionale Form nennen, ist etwa eine Folge von Tönen, die sich ausschließlich hinsichtlich ihrer Höhe unterscheiden. Eine mehrdimensionale Formen würde dagegen vorliegen, wenn die Töne auch Unterschiede in Lautstärke, Klangfarbe und Tondauer aufwiesen.
[53] Wegen der Unauflöslichkeit des Bandes zwischen dem auf ein beliebiges Merkmal (eine beliebige Verhaltensweise) bezogenen Muster und seiner jeweiligen raum-zeitlichen Form wollen wir die Verbindung einer räumlichen bzw. zeitlichen Form mit der Form eines einzigen sonstigen Merkmals (einer einzigen sonstigen Verhaltensweise) nicht als mehrdimensionale Form bezeichnen.
[54] Die Verselbständigung von Objekteigenschaften zu eigenständigen Gegenständen des Bewußtseins und Handelns ist zwar notwendige Bedingung für das Entstehen von Reflexion über das, was wir heute als moralische und methodische Fragen bezeichnen, impliziert jedoch keinesfalls von vornherein die uns geläufige Trennung zwischen Moral und Methode. Die Argumentation in Abschnitt 5.5 hat vielmehr bereits aufgezeigt, daß sich Methodik und Moral nur unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen als zwei streng von einander geschiedene Reflexionssysteme etablieren.
[55] In lateinischer Sprache bedeutet structura ‚ordentliche Zusammenfügung, Ordnung’
[56] Vgl. die Ausführungen in 5.3 zum aristotelischen Konzept der formgebenden Kraft (Entelechie)
[57] Als ‚erste industrielle Revolution’ bezeichnet man in der Regel jene Phase beschleunigter technologischer und sozioökonomischer Entwicklung, im Zuge derer sich ausgehend von der Erfindung der Dampfmaschine ab etwa 1760 Großbritannien und danach das übrige Europa, sowie Nordamerika und Japan von Agrar- zu Industriegesellschaften wandelten. Der Begriff der ‚zweiten industriellen Revolution’ bezieht sich auf die durch eine rapide beschleunigte Automatisierungstendenz ab der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmte Entwicklung, und unter der ‚dritten industriellen Revolution’ versteht man jene tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen der jüngsten Zeit, die auf die Verbreitung der Mikroelektronik in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung zurückgehen.
[58] Diese Frühform des kapitalistischen Industriebetriebes hatte ihre Hochblüte im 17. und 18. Jhdt.
[59] Einer der ersten in der Massenproduktion erfolgreichen Automaten ist die sogenannte Jacquard-Maschine, welche beim Weben von Stoff mustern (!) eingesetzt wurde.
[60] Es handelt sich dabei um sogenannte CAD-Systeme: c omputer a ided d esign
[61] Vgl. die Abschnitte 2.3 und 4.1
[62] Ein frühes Beispiel für meß- und regelungstechnische Vorrichtungen ist der Wattsche Fliehkraftregler für Dampfmaschinen, der die Drehzahl der Maschinen ohne ständiges Eingreifen des Menschen konstant hielt.
[63] Dirk Baecker, einer der profundesten Kenner der einschlägigen Strömungen der Gegenwartsphilosophie, bringt diese Entwicklung auf den Punkt, wenn er im Hinblick auf den konstruktivistischen Formbegriff in aller Schärfe formuliert: „Der Formbegriff verliert den früheren Rückhalt an Gegenbegriffen wie Materie oder Inhalt.“ Vgl. Maresch, R. (1998)
[64] Roberts, D. (1993), Seite 27
[65] Wie andere Hauptströmungen des Konstruktivismus mit dem Problem einer zunehmenden Emanzipation der Form von ihrem Inhalt umgehen, wird uns erst im weiteren Verlauf unserer Auseinandersetzung mit den Fragen der philosophischen Grundlegung von Mathematik, Sprachtheorie und Logik beschäftigen.
[66] Alle folgenden Zitate bis zur nächsten Fußnote aus Maturana, H., R. (1997), Seite 116ff
[67] Vgl. Hegel, G. W. F. (1832), Seite 24 ff.
[68] „Ich behaupte ..., daß wir ... in zwei sich nicht überschneidenden Existenzbereichen leben, in dem, in dem sich unsere Körperlichkeit realisiert, und in dem anderen, in dem wir unsere Beziehungen realisieren. Weiter gehe ich davon aus, daß wir menschliche Wesen als Menschen im Bereich unserer Beziehungen existieren, nicht im Bereich unserer Körperlichkeit, auch wenn wir uns in unseren Beziehungen durch Körperlichkeit realisieren.“ Maturana, H. R. (1998), Seite 14
[69] Vgl. die Abschnitte 2.11 und 5.6
[70] So wie wir bei der Konstitutionsanalyse des raum-zeitlichen Orientierungsrahmens und des Kraft-Materie-Paradigmas auf einem immer schon vorhandenes Verständnis dessen aufbauen, was Bewegung und Ruhe, bzw. Aktivität und Passivität heißt, ist bei der Analyse dessen, was wir mit Realität meinen, das Verstehen des Sinns der Unterscheidung zwischen dem Erwarteten und dem Unerwarteten vorausgesetzt.
[71] Vgl. Watzlawick, P. (1969), Seite 46
[72] Vgl. Habermas, J. (1969)
[73] Diese Interpretation ist durch zahlreiche Belege aus Maturanas gesamtem Oeuvre abstützbar. Hier sollen zur Illustration nur drei kurze einschlägige Formulierungen präsentiert werden:
* „Wir Menschen operieren als Beobachter ...“, Maturana, H. R. (1998), Seite 228
* „Damit steht außer Frage, was Realität ist: ein Bereich, der durch Operationen des Beobachters bestimmt wird.“ a.a.O., Seite 133
* Auch der durch Maturana geprägte Begriff des „Superbeobachters“ (gemeint ist der Erkenntnistheoretiker selbst) enthält implizit den Hinweis darauf, daß das, was die Erkenntnistheorie beobachtet, nicht das Erkennen eines Handelnden ist, sondern das eines bloßen Beobachters. Vgl. a.a.O., Seite 134ff
[74] Maturana ist Professor für Biologie und Leiter eines von ihm gegründeten Laboratoriums für experimentelle Erkenntnistheorie und Biologie der Erkenntnis an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität von Santiago de Chile.
[75] a.a.O., Seite 8
[76] Neben dieser Reduktion der menschlichen Akteure auf biologische Systeme gibt es noch einen zweiten wesentlichen Unterschied zwischen Wittgensteins Sprachspielbegriff und der durch Maturana praktizierten Analyse des Sprachhandelns: Während für Wittgenstein die Interaktionspartner Sinn gemeinsam konstituieren, indem sie mit einander bestimmten Regeln folgen, erzeugt bei Maturana jedes der durch Sprache kommunizierenden lebenden Systeme seinen je eigenen Sinn für sich. Sprache bewirkt dabei nur eine wechselseitige Orientierung dieser jeweils innerhalb der einzelnen Systeme stattfindenden Sinnproduktion, da ihre Funktion allein „darin besteht, den zu Orientierenden innerhalb seines kognitiven Bereiches zu orientieren...“ (a.a.O., Seite 56). Damit steht Maturanas Theorie der sprachlichen Kommunikation dem phänomenologischen Ansatz der privaten Sinnkonstitution viel näher als dem Konzept Wittgensteins, der in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ die Denkunmöglichkeit einer in vollständiger Privatheit erfolgenden Sinnkonstitution nachgewiesen hat. Vgl. dazu Czasny, K. (1973), Seite 34ff.
[77] Man lese unter diesem Gesichtspunkt der definitorischen Ausschaltung der Problematik des Scheiterns die folgende Begriffsbestimmung des lebenden Systems: Letzteres ist für Maturana „jene Art der zirkulären Organisation, in der die Bestandteile, die sie bestimmen, eben diejenigen sind, deren Synthese oder Erhaltung die zirkuläre Organisation selbst garantiert. Daher ist das Produkt des Funktionierens der Bestandteile genau die funktionierende Organisation, die diese Teile produziert.“ Maturana, H. R. (1998), Seite 27; Hervorhebungen durch K. Cz.
[78] „Die zirkuläre Organisation impliziert somit die Voraussage, daß eine Interaktion (mit der Umwelt), die einmal stattgefunden hat, wiederum stattfinden wird. Geschieht dies nicht, so zerfällt das System... Solche Voraussagen können in einer sich fortwährend verändernden Umwelt nur erfolgreich sein, wenn die Umwelt sich hinsichtlich des Vorausgesagten nicht verändert.“ Maturana, H. R. (1998), Seite 28
[79] „Die evolutive Veränderung lebender Systeme ist das Ergebnis jener Eigenschaft ihrer zirkulären Organisation, die die Erhaltung ihrer basalen Zirkularität sicherstellt, die jedoch gleichzeitig in jedem reproduktiven Schritt Veränderungen in der Art der Erhaltung dieser Zirkularität zuläßt.“ a.a.O., Seite 30
[80] Worin sich dieser Bezug der transzendentalen Ontologie auf eine Vielheit möglicher und wirklicher Formen der Praxis vom Relativismus der Konstruktivisten unterscheidet, wird erst im folgenden Abschnitt aufgeklärt werden.
[81] Luhmann, N. (1993)
[82] a.a.O., Seite 46
[83] a.a.O., Seite 49
[84] a.a.O., Seite 60
[85] a.a.O., Seite 61
[86] Der obige Hinweis auf die Beliebigkeit der Grenzziehung ist ein Vorgriff auf die noch folgende Kritik am Fehlen eines Wahrheitskriteriums bei Luhmann.
[87] Vgl. a.a.O., Seite 53, Fußnote 21
[88] Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 4.5 zur Konstitution von sinnlicher Erfahrung beim ziel- bzw. ausdrucksorientierten Handeln
[89] a.a.O., Seite 52
[90] „Die Semantik der Unmittelbarkeit, die in der Lebensphilosophie, im unmittelbaren Selbstverständnis der Reflexionstheorie, in der Daseinsanalytik Heideggers Vorläufer hat, bezeichnet eigentlich nur den Kollaps bestimmter Unterscheidungen - sei es der von Subjekt und Objekt, sei es der von Zeichen und Bezeichnetem, setzt also voraus, daß man zunächst von diesen Unterscheidungen auszugehen hat, die dann in der Unmittelbarkeit der Operation nicht zum Zuge kommen.“ a.a.O., Seite 47
[91] a.a.O., Seite 65
[92] „... es gibt auch kein Wahrheitskriterium für die Wahl einer Ausgangsunterscheidung.“ a.a. O., Seite 50
[93] a.a.O., Seite 51
[94] Dieses und das vorangehende Zitat: a.a.O., Seite 62f
[95] Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen zum raum-zeitlichen Bezugsrahmen und zum Kraft-Materie-Paradigma in den Abschnitten 2.3 und 4.1
[96] Vgl. Abschnitt 2.10
[97] Vgl. Abschnitt 6.2
[98] Vgl. die einleitenden Bemerkungen in Abschnitt 6.7
[99] „Lose gekoppelt bilden Elemente ein Medium, fest gekoppelt bilden sie eine Form. Nur in Form einer Form unterscheiden sich aktualisierbare Sinnstrukturen vom allgemeinen Medium Sinn, das nur die Möglichkeit einer immer auch anders möglichen Kopplung bereit hält.“ a.a.O., Seite 64
[100] Allgemeine Formen sind eine bestimmte Klasse von Begriffen: Der Begriff ist jenes Instrument, mit dessen Hilfe der Akteur das ihm zunächst unbekannte Gegenüber in einen subjektartigen, Regeln unterliegenden Gegenspieler verwandelt. Wendet er dieses allen Begriffen zugrunde liegende Erkenntnisprinzip der Objektivierung in reflexiver Haltung auf sein eigenes Erkennen an, dann bildet er Begriffe der zweiten Reflexionsebene, wie etwa Merkmals- und Tätigkeitstypen sowie allgemeine Formen. Vgl. 6.5
[101] Brown, G. S., (1969)
[102] a.a.O., Seite XXXV
[103] Baecker, D. (1993), Seite 9
[104] Vgl. die nun folgenden Abschnitte 6.10 bis 6.16 (zur mathematischen Grundlage der Physik) und den gesamten Teil 8 (zum Stellenwert der Logik im Prozeß des Erkennens).
[105] Vgl. Abschnitt 6.7
[106] „Es kann keine Unterscheidung geben ohne Motiv, und es kann kein Motiv geben, wenn nicht Inhalte als unterschiedlich im Wert angesehen werden.“ Brown, G. S., (1969), Seite 1
[107] Vgl. die Ausführungen zum transzendentalen Zirkel in Abschnitt 1.5
[108] So muß etwa der Akteur bei der Unterscheidung zwischen räumlichen und zeitlichen Relationen immer schon zwischen Eigenbewegung und Ruhe differenzieren können.
[109] Nach dem einleitenden ersten Kapitel, das sich mit dem Begriff der Unterscheidung befaßt und den soeben kritisch beleuchteten Ausgangszirkel enthält, beginnt Spencer Brown im zweiten Abschnitt der „Laws“ mit der eigentlichen Analyse des Prozesses der Konstitution von Ordnung. Der erste Unterabschnitt dieses Kapitels trägt die Überschrift „Konstruktion“ und besteht aus einem einzigen Satz in Gestalt einer Aufforderung: „Triff eine Unterscheidung.“
[110] Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. (1963), Seite 383 (Hervorhebungen von den genannten Autoren)
[111] Dies soll erst im Rahmen einer auf den dritten Band dieser Studienreihe folgenden Publikation geschehen.
[112] Genau genommen geht die Aufgabe, die uns bei der Analyse des Begriffs des elektromagnetischen Feldes bevorsteht, weit über das Verstehen der bloßen Zuordnung von Vektoren zu allen Punkten des Raumes hinaus. Denn die eigentliche Leistung der von Maxwell vorgelegten mathematischen Form des erwähnten Begriffs besteht ja in der Erfassung der Veränderungen dieses Feldes im Verlauf der Zeit mittels jener mathematischen Funktionen, welche man als ‚Gradient’, ‚Divergenz’ und ‚Rotor’ bezeichnet. Was also ansteht, ist eine transzendentale Untersuchung dieser drei zuletzt genannten mathematischen Beschreibungsformen des elektromagnetischen Feldes.
[113] Vgl. Purkert, W., Ilgauds, H.J. (1985), Seite 63, Patzig, G. (1994), Seite 5, sowie Weibel, P., Köhler, E. (1986), Seite 83
[114] Vgl. Patzig, G. (1994), Seite 11
[115] Es ging dabei um drei Phänomene: 1. die Drehung der Ellipsen der Planetenbahnen um die Sonne, 2. die Krümmung der Lichtstrahlen in der Nähe großer Himmelskörper und 3. die Verschiebung der Spektrallinien des von Sternen bedeutender Masse zu uns gesandten Lichts (nach dem roten Spektralende hin); vgl. Einstein, A. (1919), Seite 131
[116] Einstein, A. (1921), Seite 119
[117] Dieser bereits von I. Kant in seinem Opus postumum im Zusammenhang mit einer Begründung der Physik geprägte Ausdruck wird 1927 von Friedrich R. Lipsius zur Bezeichnung des Ansatzes von H. Dingler verwendet. Davon unabhängig schlägt P. Lorenzen das Wort ‚Protophysik’ 1961 in einem Aufsatz über die „Geometrie als Wissenschaft der räumlichen Ordnung“ für eine Theorie vor, die „nicht das Verhalten wirklicher Körper beschreibt, sondern ihnen vielmehr gewisse Grundformen vorschreibt.“ Zitiert nach Janich, P. (1997), Seite 10
[118] Vgl. Schreiber, A. (2002)
[119] a.a.O.
[120] Einstein, A. (1921), Seite 125
[121] Der methodische Konstruktivismus tritt in verschiedenen Varianten auf; vgl. Sandkühler, H. J. (Hg.) (1999), Bd.1, Seite 723. Neben den bereits erwähnten protophysikalischen Ansätzen ist aus unserer Perspektive einer erkenntnistheoretischen Grundlegung der Physik vor allem der auf P. Lorenzens Untersuchungen zur dialogischen Struktur der Logik zurückgehende ‚logische Konstruktivismus’ von Bedeutung.
[122] Vgl. dazu die detaillierten Auseinandersetzungen mit dem hier angesprochenen Mangel in den Abschnitten 7.1, 8.15 und 9.4 bis 9.6
[123] In diesem Sinne definiert Janich in der Einleitung zu seiner diesbezüglichen Publikation das Untersuchungsziel als „eine Klärung der Frage, welche Rolle tatsächlich erfolgreiche Meßverfahren ... als Verfahren zur Erzeugung der Gegenstände spielen ...“ und bezeichnet einige Seiten später ein bestimmtes Argument als einen Hinweis, der „im Rahmen eines Buches über das Messen“ erwähnt werden darf. Vgl. Janich, P. (1997), Seiten 24 und 28 (Hervorhebung von P. Janich)
[124] Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in Teil 4, insbesondere Abschnitt 4.5
[125] Nachträgliche Bemerkung des Autors: Christian Thiel hat nach der Lektüre des vorangehenden Textabschnitts die Frage gestellt, ob nicht zumindest Wilhelm Kamlah von dieser Kritik auszunehmen sei, da bei ihm das Wechselspiel oder Zusammenwirken von „Handlung und Widerfahrnis“ eine zentrale Rolle erhalte. Der Autor gibt diese Frage unkommentiert an den Leser zur eigenen Beurteilung weiter.
[126] Vgl. zum folgenden: Schreiber, A. (2002) und Ritter, J., Gründer, K. (1971), Seiten 1016 und 1019
[127] Alle Zitate dieses Absatzes aus Brouwer, L. E. J. (1927), Seite 21
[128] Vgl. Dehaene, S. (1999), Seiten 53 und 89 ff.
[129] Vgl. 7.6
[130] Für den Brouwerschüler Heyting etwa benützt die Mathematik „die natürliche und formalisierte Sprache nur dazu, um Gedanken zu kommunizieren, um andere oder sich selbst dazu zu bringen, seinen eigenen mathematischen Ideen zu folgen.“ Heyting, A. (1931), Seite 42.
[131] Dieses Axiom besagt, daß man in der Ebene zu einer Geraden durch einen beliebigen, nicht auf ihr gelegenen Punkt genau eine parallele Gerade ziehen kann.
[132] Wir werden uns bei den Reflexionen über den Wahrheitsbegriff im Kontext des Logik-Teils noch einmal ausführlich mit dem Prinzip des Kalküls beschäftigen und dabei unter anderem auch auf die oben erwähnte Fruchtbarkeit des Hilbertschen Ansatzes zu sprechen kommen. Vgl. Abschnitt 8.17
[133] Vgl. Patzig, G. (1994), Seite 9 und Weibel, P., Köhler, E. (1986), Seite 80
[134] Wittgenstein, L. (1921)
[135] Bekanntermaßen vollzieht Wittgenstein selbst im letzten Satz des Tractatus („Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“) die oben angesprochene Selbstaufhebung seiner Position und eröffnet sich damit den Spielraum für eine beispiellos radikale philosophische Wende.
[136] Ein weiterer Grund für den ‚Sieg’ des Formalismus liegt darin, daß das Leugnen der darstellenden Bedeutung von sprachlichen Zeichen scheinbar einen Ausweg aus den erkenntnistheoretischen Aporien der ontologischen und intuitionistischen Konzepte des Allgemeinen weist. Mehr dazu in 6.14 und in dem mit der Logik befaßten Teil unserer Untersuchung.
[137] Vgl. die Ausführungen zur Konstitution des raum-zeitlichen Bezugsrahmens in den Abschnitten 2.2 bis 2.4
[138] In Wirklichkeit gab es ‚den’ Erfinder des Rades nicht, denn das Rad wurde, wie wir heute zu wissen glauben, um etwa 3.500 v. Chr. an verschiedenen Orten gleichzeitig erfunden. Vgl. Hoffmann, E. (1999), Seite 318
[139] Wir erinnern uns: Der Begriff eines Objekts ist genau jenes Set von Regeln, welches unsere an das jeweilige Gegenüber gerichteten Verhaltenserwartungen definiert. Vgl. Abschnitt 6.1
[140] Vgl. insbesondere die Abschnitte 7.5 und 7.6
[141] Vgl. auch die Ausführungen zur Bedeutung des Wortes ‚Sein’ in den Abschnitten 6.7 und 8.6
[142] Das Wort ‚ein’ kann einerseits als Zahlwort und andererseits als unbestimmter Artikel fungieren. Um Mißverständnisse zu vermeiden, wollen wir im vorliegenden Abschnitt, in dem beide Verwendungsformen eine wichtige Rolle spielen, die Zahlenfunktion durch die Formulierung ‚genau ein’ von der anderen Bedeutungsvariante abheben.
[143] Mit einer höherstufigen Aktion ist einfach ein größeres Handlungsgefüge gemeint, das mehrere Einzelaktionen umfaßt. Die möglichst weitgehende Vermeidung von Worten wie ‚größer’ ist nur der Versuch eines angemessenen Umgangs mit dem transzendentalen Zirkel (Vgl. 1.5). Denn natürlich bezeichnet ‚größer’ eine quantitative Relation, also genau eine jener Quantitätserscheinungen, deren Erzeugung durch bestimmte Handlungen hier beschrieben werden soll. Der erfahrende Akteur ist nur mit dem Vollzug der betreffenden Handlungen befaßt und betrachtet sie (noch) nicht als Objekte. Das tun erst wir im Zuge unserer transzendentalen Analyse, wobei wir an diesen uns als Objekte gegenübertretenden Handlungen dann auch quantitative Aspekte wahrnehmen. Die Vermeidung von Bezeichnungen, welche sich auf jene quantitativen Bestimmungen des von uns objektivierten Tuns beziehen, spiegelt unser Bemühen, uns aus der transzendentalen Betrachtungsperspektive wieder in jene des Akteurs zurückzuversetzen, der in seinem Handeln die Erscheinung der Quantität erst konstituiert.
[144] Vgl. die Ausführungen zur Konstitution der Erscheinung von quantitativen Relationen in 6.5
[145] Vgl. Abschnitt 2.15
[146] „Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, daß sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. ... Der Wert der Ware ... stellt (daher) menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung menschlicher Arbeit überhaupt.“ Marx, K. (1890), Seite 58 f.
[147] Bei voll entfalteter kapitalistischer Warenproduktion erscheint das Merkmal der Werthaltigkeit tendenziell an allen Objekten, also auch an den nicht vom Menschen produzierten Gegenständen.
- Arbeit zitieren
- Dr. Karl Czasny (Autor:in), 2010, Erkenntnistheoretische Grundlagen der klassischen Physik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145326
Kostenlos Autor werden
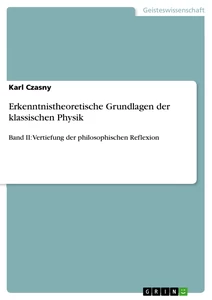















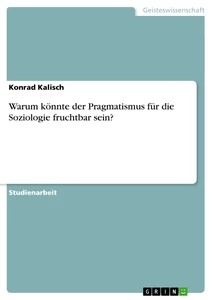



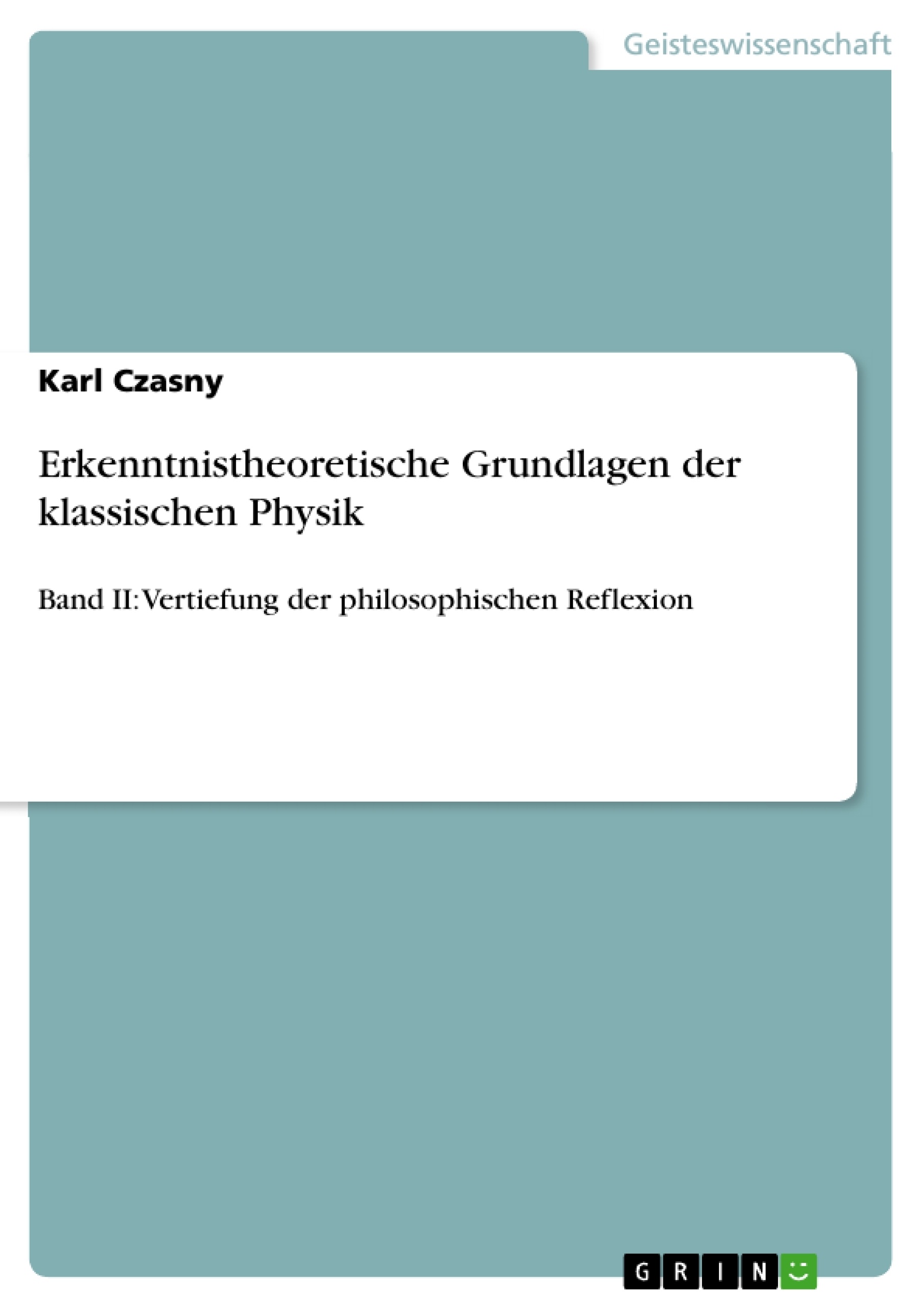

Kommentare